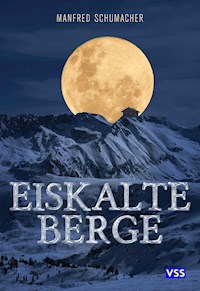5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die unterschiedliche Bewertung der Außerirdischen innerhalb der stramm evangelikalen „Liga für Schrift und Glauben“ endet in einer Katastrophe. Gleichzeitig zettelt ein amerikanischer Südstaaten-Industrieller eine unheilsvolle Jagd auf die Relikte der Florentiner Bruderschaft an. Nach wie vor versuchen zwei auf der Erde gestrandete Aliens, irgendwie auf ihren Heimatplaneten zurückzugelangen. Sie gewinnen in Matteo und Fausto neue Verbündete, und Tom muss sich in seiner neuen Rolle bei einem Showdown mit einem US- Offizier für eine Seite entscheiden. Die dreibändige Engelsjünger-Saga präsentiert in einzigartiger Weise Science Fiction, die nahezu ausschließlich auf der Erde stattfindet. Ein Epos, das eine neuartige E.T.-Story für Erwachsene entrollt, mit Aliens, die nach Hause wollen und vor ihren Verfolgern auf der Hut sein müssen. Jeder Band der Engelsjünger-Saga ist in sich abgeschlossen und nahezu unabhängig von den anderen Bänden lesbar. Manfred Schumacher lebt in Rheinhessen, studierte Anglistik/Amerikanistik, Politik und Philosophie und promovierte über ein literaturwissenschaftliches Thema. Später leitete er eine PR-Agentur. Im vss-Verlag erschienen bereits von ihm der historische Roman Der Hurenwagen (2021), der Katastrophen-Thriller Eiskalte Berge (2022) sowie – in Zusammenarbeit mit seiner Tochter Eva Vanessa Nagel unter dem Pseudonym E.M. Schumacher - der 1. Band der dreibändigen Engelsjünger-Saga mit dem Titel Das Geheimnis der Wächter (ebenfalls 2022).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Ähnliche
Die Suche nach dem geheimnisvollen Kristall
Band 2 der Engelsjünger-Saga
Impressum
Die Engelsjünger-Saga
Band 2
Die Suche nach dem geheimnisvollen Kristall
Manfred Schumacher
Impressum
Copyright: vss-verlag
Jahr: 2022
Lektorat/ Korrektorat: Peter Altvater
Covergestaltung: Sabrina Gleichmann
Verlagsportal: www.vss-verlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig.
VORWORT
Gut zehn Wochen sind es her, dass an der Südostküste Grönlands ein mehrere Hundert Meter großer Asteroid auf der Erde einschlug. Doch schon bald stellte sich der Asteroid für einige der vielen Betroffenen als etwas ganz anderes heraus. Fünf von ihnen merkten es bereits am ersten Tag. Diese fünf - Anna, Lucy, Tom, Mike und Stefan - fanden, nachdem sie mit einem Linienflug aus Köln im gebirgigen Süden Islands eine Notlandung überlebt hatten, an einem abgelegenen Haus eine Raumkapsel mit drei toten Aliens. Nicht nur das: Zwei der drei toten Insassen des fremdartigen Fluggeräts sahen wie Engel aus der Bibel aus.
Damit nicht genug, gerieten sie zwischen die Fronten einer uralten italienischen Bruderschaft und einer ominösen Kölner Gruppierung evangelikaler Hardcore-Fanatiker, die das Wissen um diese „Engel“ unterschiedlich bewerten und verteidigen. Es kam zu einer Hals-über-Kopf-Entführung nach Köln und einem späteren Attentatsversuch.
Zudem fanden die zuständigen staatlichen Stellen kurz danach Neues über den ominösen Asteroidenabsturz heraus. Der nämlich entpuppte sich plötzlich als Aufprall eines fremdartigen Großraumschiffs auf die Erde. Und während der Hauptdrahtzieher der Island-Entführung seinen Hals gerade so aus der Schlinge ziehen konnte, sorgte eine in den sozialen Netzen kursierende Offerte eines reichen Amerikaners für neuen Konfliktstoff.
Noch zwei weitere Außerirdische haben sich damals aus dem abstürzenden Großraumschiff gerettet und überlebt. Sie sind auf der Erde, entziehen sich den Blicken der Menschen und fristen ein Leben im Verborgenen. - Und sie sind nach etwas auf der Suche …
PROLOG
Bethlehem, heutiges Westjordanland – um die Zeit von Jesu Geburt
Im Mondlicht schlich eine männliche Gestalt von trüben Lehmhütten weg in östlicher Richtung. Sie verließ, vom Zirpen der Heuschrecken begleitet, die Siedlung, um rasch einem steinigen Weg zu folgen. Er führte weit nach Nordosten bis in die Senke des Jordantals. Sein Ziel hatte der Mann aber bereits nach kurzem Fußmarsch erreicht. Dunkel und von hellerem Fels im Hintergrund eingepfercht, lag die langestreckte Hütte vor ihm, die dem reichen Dattelbauern Abiram gehörte. Der Mann entzündete eine mitgebrachte Fackel, trat an die Hütte heran und öffnete die Tür. Stickige, warme und nach Schafsmist stinkende Luft schlug ihm entgegen. Er spähte hinein. Nichts.
„Psst!“, machte es von der Ecke.
Der Mann fuhr herum und sah die dunkle Gestalt. Sie hatte sich unter einen Dachvorsprung geduckt, dessen Bretter gut zwei Ellen in den angrenzenden Pferch hineinreichten.
Die Gestalt winkte ihn heran. „Du bist Sem?“, fragte sie mit unterdrückter Stimme herüber, als der als Sem Angesprochene noch ein Dutzend Schritte entfernt war. Ihre Aussprache hörte sich seltsam an. Anders als wenn ein Philister oder Ägypter Sems Sprache sprach.
Sem nickte und schob ein „Ja“ hinterher, als er merkte, dass der Fremde seine Kopfbewegung in der Dunkelheit kaum mitbekam. Sem näherte sich ihm weiter. Die Gestalt war riesig, fast eine ganze Pertica hoch. Gut, dass Ascher ihn vorgewarnt hatte. Ohne Vorwarnung hätte er sich bei dem Anblick gewiss vor lauter Angst bepinkelt. Jetzt sah Sem, dass der Fremde sein Gesicht unter einer Kapuze verbarg. Im schwachen Schein der Fackel nahm Sem nur bleiche Wangen und das Aufblitzen heller Augen wahr. Ebenfalls helle Haare ragten unter der Kapuze hervor und hingen dem Fremden bis auf die Schultern. Im Fackellicht schimmerten sie gelb wie Flachs oder Stroh. Solche Haare hatte Sem bisher nur einmal gesehen, als er vor Jahren eine Karawane ins phönikische Sidon begleitet hatte. Dort im Hafen waren sie ihm auf einem Schiff der Nordmänner aufgefallen. Die Haare waren aber nicht das Sonderbarste an dem Fremden. Das waren seine Flügel. Auch da war es gut, dass Ascher ihn darauf vorbereitet hatte.
„Du gehörst zum Stachel Aristobuls?“, fragte der Fremde.
„Psst!“, zischte Sem unwillkürlich. „Nicht so laut!“ Man wusste ja nicht, wer sich jetzt sonst noch hier so rumtrieb. War zwar unwahrscheinlich, aber wenn irgendein Römerspitzel das mitbekam, dann landete man in diesen Zeiten schneller am Kreuz, als man bis drei zählen konnte. Geheim zu bleiben war eben der Sinn jeder Unabhängigkeitsbewegung, auch und gerade ihrer judäischen. Die Römer spaßten nicht, wenn es auch nur ansatzweise gegen ihre Autorität ging. „Das darf keiner wissen“, sagte Sem laut. „Du darfst das, was wir vorhaben, keinem sonst erzählen. Auch nachher nicht, hörst du? Es muss unser Geheimnis bleiben. Du - ihr dürft es keinem sagen“, verbesserte er sich. Er sagte es, wie man sonst zu einem Kind sprach, verständlich und eindringlich. Dabei waren die Fremden wohl schon lange in Judäa, immer mal wieder. Abirams Vater hatte davon erzählt. Es gäbe da alte Geschichten, ganz alte sogar.
Der Fremde nickte.
Sem registrierte es mit einer gewissen Erleichterung. Hoffentlich hielt er sich auch daran. Hielten sie sich, korrigierte er sich gedanklich. „Dein -“, er stockte, suchte nach dem richtigen Wort, „Kumpan weiß, was er zu tun hat?“
Der Fremde nickte erneut.
„Du hast ihm gesagt, wo er die Mederpriester in Bardhaa findet?“, bohrte Sem nach.
Wieder nickte die Gestalt.
„Können wir uns wirklich darauf verlassen, dass er ein Zeichen in den Himmel zaubert, dass sie hierher nach Bethlehem führt?“
„Das könnt ihr. Sie werden kommen. Verlasst euch darauf!“
Eigentlich zweifelte Sem nicht daran, dass der Kumpan seines Gegenübers es schaffte. Er wollte es nur noch mal von ihm bestätigt haben. Ihre ganze Erscheinung war auch zu gewaltig, um das, was sie sagten oder taten, zu ignorieren. Das war wirklich ein toller Plan, den Manasse da ausgeheckt hatte, gestand sich Sem erneut ein. Dabei verdankte sich alles nur einer günstigen Fügung des Schicksals. Timon und Manasse, die den Jerusalemer Arm vom Stachel Aristobuls anführten, bereisten gerade etliche Ortschaften im Süden. Vor Tagen waren sie mittags nach Bethlehem rausgekommen, um sich auch mit der hiesigen Ortsgruppe abzustimmen. Sie hatten im Erdkeller von Abirams Sohn gehockt, der eigentlich zur Lagerung von Most, Käse, Hirse und Obst diente und den sie seit Jahren für ihre geheimen Treffen nutzten. Dann war Ruben aufgetaucht und hatte mit verschmitzter Miene erzählt, dass er einem Paar aus Nazareth seinen schlechtesten Schuppen, in dem er sonst nur altes Stroh aufbewahrte, vermietet hatte.
Zurzeit kamen viele nach Bethlehem, weil sich die Leute überall schätzen lassen mussten, wie es dieser Römerkaiser angeordnet hatte. Jehova schaffe ihm den Aussatz an den Hals! Deshalb waren die Unterkünfte in den Hostels und Schänken alle belegt. Ja, sogar die Plätze in den gut zwanzig Ställen, die es in Bethlehem gab, waren mit Leuten vollgepackt. Die Bethlehemer Bauern und Schafbesitzer machten dieser Tage sicher ein gutes Geschäft, und jetzt hatte der geldgierige Ruben auch noch seinen abbruchreifen Stall an den Mann gebracht. Dann, als er von der hochschwangeren Frau erzählt hatte, die kurz vor der Niederkunft stand, war Manasse hellhörig geworden. Er hatte seinen Plan geschmiedet und ihn den anderen mitgeteilt. Er hatte sie rasch davon überzeugt, ziemlich rasch sogar. Sogar Timon hatte er schnell überzeugt, der eher als übervorsichtig galt und lieber dreimal überlegte, bevor er sich zu was hinreißen ließ. Dass die Frau kurz vor ihrer Niederkunft stand, wusste Ruben von Esther. Sie war die Hebamme am Ort und der Mann der Schwangeren hatte sie zum Stall geholt, nachdem Ruben ihn auf Esther aufmerksam gemacht hatte. Der Mann war Zimmermann und alt, hatte Esther erzählt, viel älter als die Frau. Aber das war nichts Ungewöhnliches. Männer nahmen sich oft viel jüngere Frauen.
„Können wir uns darauf verlassen, dass wir die versprochene Belohnung erhalten?“
Die Stimme des Fremden riss Sem aus seinen Gedanken.
Die Gestalt hatte ihren Kopf nach vorn gereckt und Sem wich unwillkürlich einen Schritt zurück. „Natürlich könnt ihr das“, beeilte er sich zu sagen. „Eine Amphora Weizen und zwölf Silbersesterzen, wie ausgemacht.“
Die Gestalt des Fremden entspannte sich.
„Wir sollten jetzt gehen. Es ist Zeit“, sagte Sem. Er deutete mit der Hand zum östlichen Dorfrand, wo sich Rubens Olivenhain befand, neben den er seine beiden Ställe und den erbärmlichen Ziegenpferch gebaut hatte. Ohne noch etwas zu sagen, machte er kehrt und hielt auf die steinige Anhöhe zu, über die der Weg in einem leichten Bogen zum Dorf zurückführte. Der Fremde folgte ihm.
Sem horchte auf seine Schritte, die ihm auch zur Anhöhe hoch ohne die geringste erkennbare Anstrengung folgten. „Du weißt, was zu tun ist?“, fragte er keuchend. Er wollte sich lieber noch mal vergewissern, obwohl Ascher die Kreatur bereits instruiert hatte. Er schaute kurz über die Schulter zurück.
„Ja, ich weiß, was ich tun soll“, kam die ruhige Antwort zurück.
„Eine alte Frau wird bei ihnen sein. Esther. Sie heißt Esther“, flüsterte Sem, als er voranschritt. Er hatte den Kopf ein wenig nach hinten gewandt, damit ihn der Fremde besser hörte. Am Abend war es jetzt in diesem Teil des judäischen Berglands still und die Geräusche drangen weit. Keiner sollte etwas von dem Fremden und dem, was sie vorhatten, mitbekommen. Keiner würde es, beruhigte sich Sem sofort. Die hereinbrechende Nacht hatte den Himmel bereits dunkel gefärbt. Es waren nur wenige Sterne am Himmel und im trüben, silbrigen Licht des Mondes waren die beiden nächtlichen Wanderer nur dunkle Schatten zwischen ebenso dunklen Sträuchern, Gebüschen und gezackten Felsformationen, zwischen denen sie ihr Weg hindurchführte. „Esther. Sie ist eine Hebamme aus unserem Dorf. Der Alte, dem die Gebärende anvermählt ist, ließ sie rufen.“ Sem nannte sie nicht Hebamme, sondern Maia, was das griechische Wort dafür war, weil er vermutete, dass der Fremde das besser verstand. „Vorsicht! Hier geht es mehrere Felsstufen im Stein hoch“, warnte er den Fremden hinter sich. Mühsam stieg er die Stufen empor und erreichte das südliche Plateau, von dem es nur noch knapp eine halbe Meile bis zu Rubens Ställen war. „Du musst nach Miriam schicken, wenn Esther oder der Alte dein Klopfen beantworten. Die Gebärende heißt Miriam. Sie muss unbedingt kommen, weil sie dich sehen muss. Du verstehst?“, presste Sem immer noch keuchend hervor. Ascher hat es ihm bestimmt schon eingeimpft, dachte Sem, aber sicher ist sicher.
„Ich verstehe. Ich frage also nach Maria, dass sie zur Tür kommt und mich sieht“, bestätigte der Fremde. Seine hellen Augen leuchteten unter der Kapuze, als er Sem anschaute.
„Ja, genau, du fragst nach Maria“, bestätigte Sem. Seine Vermutung, dass der Fremde des Griechischen besser mächtig war als des hier gebräuchlichen Aramäischen hatte sich bestätigt. Er hatte das griechische Maria für das semitische Miriam gebraucht. Sem nahm es zufrieden zur Kenntnis. „Da vorn ist es.“ Sem deutete mit dem Finger in Richtung der Ställe, die vom Plateau nur als dunkle Flecke auszumachen waren. Sie hasteten weiter durch die aufziehende Nacht. Der Plan hatte es in sich, ging Sem durch den Kopf, als er mit dem Fremden im Rücken die südöstlichen Hütten Bethlehems weiträumig umrundete. Der Ort lag still und dunkel vor ihnen. Vereinzelte Lichter drangen aus den schemenhaften Gebäuden, irgendwo blökte ein Schaf. Das musste man diesem Jerusalemer Schlitzohr Manasse lassen, seine Idee war einfach genial. Sems Gedanken kreisten weiter um das, was sich in wenigen Augenblicken hoffentlich genauso wie beabsichtigt zutragen würde. Diese fremdartigen Kreaturen, mit denen Ascher wie auch immer bekannt war, dazu zu benutzen, um dem Volk einen neuen Maschiach, einen neuen Gesalbten, zu verkaufen, wie ihn einst die Propheten als Befreier von drückender Fremdherrschaft herbeigesehnt hatten. Das konnte in der Tat das Tüpfelchen auf dem I sein, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und die echten Judäer endlich zum Aufstand gegen die römischen Besetzer und Landräuber bewegen würde. Ebenso gegen diese verhasste Hasmonäersippe mit ihrem Volksverräter Herodes, der doch nur eine Marionette Roms war. Sem riss sich aus seinen Gedanken, als sie nur noch drei Dutzend Schritte vom Stall entfernt waren.
Schwacher Lichtschein drang aus dem einzigen schmalen und windschiefen Fenster, das er besaß. Sem deutete mit dem Kinn hinüber und wies sicherheitshalber mit dem Finger darauf. „Da ist es. Geh nun, ich warte hier hinter dem Felsen“, wies er den Fremden an. „Wir treffen uns morgen vor Sonnenaufgang. Dort wo du mich heute erwartetest. Dann bekommt ihr eure Belohnung.“
Der Fremde nickte, drehte sich weg und schritt zum Stall, während Sem sich hinter einen Felsvorsprung kauerte und beobachtete. Das Wesen pochte an die Stalltür, hart und laut. Sem vernahm im Stall Bewegung, dann glaubte er, schwache Schritte zu hören. Die Tür öffnete sich und auf der Schwelle erschien ein älterer Mann mit grauem langem Bart. In der Hand hielt er ein trübes Talglicht, das sein verwittertes Gesicht und sein schütteres Haar erleuchtete. Erschrocken wich er zurück, als er die riesige Gestalt über sich sah.
„Hab keine Angst“, sprach ihn der Fremde an. Dann senkte er seine Stimme, sodass Sem nur noch Wortfetzen mitbekam.
„Wer ist es denn, Josef?“, hörte er aus dem Stall eine helle Frauenstimme.
Statt einer Antwort trat der Mann zurück in den Stall. Wenige Augenblicke danach erschien die Gestalt einer jungen Frau mit dem Talglicht in der Hand. Sie war jung, kaum sechszehn, schätzte Sem. Dazu zierlich und klein, gerade mal fünf Fuß groß. Ihr Körper, der sich am Bauch weit nach vorn wölbte und dort den Stoff spannte, steckte in einem Kleid aus Ziegenfell. Um den Hals hatte sie sich einen Schal gewunden, der im Lichtschein so grau wie das Kleid schimmerte. Im Schein der Lampe nahm Sem die Züge ihres Gesichts wahr. Es war gleichmäßig geformt, zeigte einen Mund mit vollen Lippen und eine olivfarbene Haut.
Im Moment war sie starr vor Schreck, obwohl ihr Begleiter sie sicher auf die Begegnung vorbereitet hatte. Mit weiten Augen und offenem Mund starrte sie den Fremden wie eine überirdische Erscheinung an, die er in gewisser Weise sicher auch war. Sie war ein, zwei Schritte in den Stall zurückgewichen. Sein Aussehen schlug jeden in seinen Bann. Sem hatte es am eigenen Leib verspürt.
„Fürchte dich nicht!“, beeilte sich der Fremde zu sagen und zeigte ihr zum Zeichen seiner Friedfertigkeit seine offenen Handflächen.
Vorsichtig, ja zögerlich, erschien sie wieder auf der Schwelle und schaute ängstlich zu ihm hoch.
Er trat zwei Schritte zurück und verneigte sich leicht vor ihr. „Sei gegrüßt, Maria“, sagte er.
„Miriam, ich bin Miriam.“
„Ich habe eine Botschaft für dich“, entgegnete er, ohne auf ihren Einwand einzugehen. In dem Moment, als er sich aufrichtete, öffneten sich leicht seine beiden Schwingen, die ihm vorher am Rücken zusammengefaltet lagen.
„Bei allen Stämmen!“, murmelte Sem, als er es sah.
Auch die Schwangere bemerkte es und beugte sich, so gut es ihr in ihrem Zustand möglich war, nach vorn und neigte den Kopf nach vorn. Der ältere Mann und eine Frau, wohl Esther und dem Aussehen nach noch wesentlich älter als der Mann, waren in der Tür erschienen. Als sie die Flügel des Wesens sahen, die im Mondlicht wie Elfenbein schimmerten, sanken sie neben der Jungen fast wie vom Blitz erschlagen zu Boden.
„Himmlischer, wieso schickt der Herr dich ausgerechnet zu mir, seiner geringsten Dienerin?“, fragte die junge Frau zaghaft, während sie verstohlen zu ihm aufblickte.
Erst hob der Fremde den Kopf unter der Kapuze, als stocke er und sei er erstaunt. Er stand einen Moment, als suche er nach einer Antwort. Dann forderte er alle mit einer Geste seiner Hände auf, sich zu erheben. „Steht auf, alle!“, sagte er gleich darauf.
Sie folgten seiner Anweisung, hielten aber die Köpfe demütig gebeugt und wagten nicht, ihn anzuschauen.
„Hör zu, Frau, was ich dir zu sagen habe!“, begann er erneut. „Das Kind, das du empfangen wirst, wird groß sein und Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen.“
Sem nickte in seinem Versteck zufrieden. Das war genau das, was Manasse sich ausgedacht hatte, was er sagen sollte. Dann glaubte Sem noch zu hören, dass der Fremde etwas von dem Messias sagte, der das Volk Israel von der fremden Herrschaft befreien werde. Sicher war er sich aber nicht, weil in dem Moment das Geschrei eines Esels aus dem Stall drang. Jetzt musste es kommen. Sem wartete gespannt. Auch das hatte Manasse sich ausgedacht. Tatsächlich, in dem Augenblick geschah es. Das Wesen breitete seine mächtigen Flügel aus, über mindestens zwei Pertica, schwang sie auf und nieder. Dann erhob es sich vom Boden und schwebte für wenige Augenblicke gut eine Elle über der Oberfläche.
Der Mann und die ältere Frau lagen da bereits schon wieder vor Ehrfurcht und Angst auf dem Boden und drückten ihre Köpfe in den Staub. Die Jüngere beugte ergeben den Rücken und hielt den Kopf tief gesenkt. Sem verschlug es den Atem und er stierte wie gebannt auf die Gestalt, die gut zwanzig Schritte von ihm entfernt in der Luft zu stehen schien.
„Flapp, flapp“, dröhnte es dann dumpf aus der Höhe. Die Kreatur entschwand und man sah nur noch kurz das Auf- und Niederschwingen ihrer mächtigen Flügel, bevor die Dunkelheit sie verschluckte. Sem murmelte etwas und rieb sich die Augen, als sei er aus einem fantastischen Traum aufgewacht. Er blieb in seiner Deckung und beobachtete, bis Esther und das ungleiche Pärchen wieder im Stall verschwunden waren. Keine Frage, Manasses Plan war bis ins Kleinste aufgegangen. Es gab die gewünschten Zeugen dieses nächtlichen Spektakels und von Esther war bekannt, dass sie in ihrem langen Hebammenleben ungleich mehr Tratsch als Kinder in die Welt gesetzt hatte. Morgen wüsste man in ganz Bethlehem von der nächtlichen Verheißung, übermorgen womöglich schon in Jerusalem und überübermorgen würde, wenn es gut lief, ganz Judäa Bescheid wissen. Die Saat war gelegt. Jetzt musste es nur noch auch wirklich ein Junge werden, der die kommenden Stunden oder Tage das Licht der Welt erblickte, damit sich die Geschichte vom neuen Volksbefreier entfalten konnte. Aber Esther hatte mittags nach der ersten Untersuchung der jungen Frau bereits gegenüber Ruben verlauten lassen, dass es mit Sicherheit ein Junge würde. Das sollte ihnen erst mal reichen, denn die alte Esther war in solchen Prognosen erstaunlich treffsicher.
Dieser seltsame Flügelmann war alles Geld der Welt wert gewesen, zumindest jede einzelne Sesterze, die sie ihm versprochen hatten. Er hätte sie auch verdient gehabt bei der Vorführung, die er seinem Publikum geboten hatte. Schade nur, dass es da noch diese andere Sache gab. Sem fühlte einen Moment den Ansatz von Bedauern für die Fremden, ein Gefühl, das er aber ebenso rasch wieder abschüttelte. Was für ein Abend, dachte er stattdessen. Bis zu seinem Lebensende würde er das gerade Erlebte nicht vergessen. Mit diesem Gefühl machte er sich auf den Nachhauseweg.
Noch vor dem Morgengrauen wartete Sem mit Ascher, Ruben und drei anderen in Abirams Hütte. Davor stand wie zur Begrüßung der als Lohn versprochene Sack Weizen. Timon und Manasse hatten aber entschieden, dass die Fremden ihn nicht mitnehmen sollten. Der Sack, den sie als sichtbares Zeichen ihres guten Willens vor der Hüttentür auf den staubtrockenen Boden gestellt hatten, sollte bei den Fremden jeden Argwohn beseitigen. Die Bethlehemer Ortsgruppe vom Stachel Aristobuls hatte sich nach kurzer Diskussion der Argumentation der Jerusalemer Führung angeschlossen. Ja, es war einfach zu gefährlich, die Fremden lebend fortzulassen. Sie waren gezwungen, ihre mit ihnen getroffene Abmachung zu brechen, weil das Geheimnis sonst nicht sicher bewahrt blieb. Was wiederum wichtig für den erhofften Aufstand gegen Rom und seinen verhassten Lakeien Herodes war.
Sie warteten angespannt und stumm, während sich am Horizont die ersten Sonnenstrahlen bemerkbar machten. Dann stand einer der Fremden plötzlich wie aus dem Nichts gut zwanzig Schritte vor der Hütte. Sie hatten ihn nicht kommen gesehen, obwohl sechs Augenpaare in die Richtung geschaut hatten. Während sie sich noch von ihrer Überraschung erholten, kam der Fremde auf sie zu. Sem wusste nicht, ob es dasselbe Wesen war, das Stunden vorher das Nazarenerpärchen in Angst und Schrecken versetzt hatte. Sie sahen alle gleich aus, sagte Ascher. Der Fremde trug jetzt am frühen Morgen keine Kapuze. Sein langes, außergewöhnlich gelbes Haar hing ihm wie bei einer Frau fast bis auf die Brust. Das Gesicht war unnatürlich hell, geradezu weiß, als hätte es in seinem ganzen Leben noch keine Sonne abbekommen. Sem gab den anderen ein Zeichen und trat vor die Hütte. Als der Fremde ihn sah, stockte er.
Sem winkte ihm zu und deutete auf den Sack. Der Fremde nickte und schritt zum Sack, fasste den Sackzipfel mit einer Hand, die Sem ungewöhnlich lang wie sein ganzer Arm und Körper vorkam. Als er den Sack anhob, stieß Sem einen kurzen Pfiff aus und seine Gefährten stürmten aus der Hütte an ihm vorbei auf den Fremden zu. Zwei attackierten ihn, während die anderen nach einem möglichen Begleiter Ausschau hielten. Ascher nutzte das Überraschungsmoment und rammte dem Fremden seinen Dolch in den Leib. Da hatte die Kreatur bereits ein von Ruben aus der Hütte abgeschossener Pfeil in die Seite getroffen und abgelenkt. Die überrumpelte Gestalt lag jetzt gekrümmt am Boden und stellte für sie keine Gefahr mehr da.
In dem Moment fraß sich blitzschnell eine gleißend helle Flamme auf Ascher zu, erfasste ihn und schien für die Zeit zwischen zwei Herzschlägen wie flüssiges Sonnenlicht an ihm zu kleben. Im nächsten Augenblick war das flüssige Licht wieder verschwunden und mit ihm Ascher. Der ganze Ascher war weg, als hätte ihn der Lichtwurm bis auf das letzte Staubkörnchen aufgefressen. Panisch rannten alle zur Hütte zurück, um hinter ihr zu verschwinden. Ruben und zwei andere wurden in kürzester Zeit von drei weiteren Lichtschlangen erwischt. Sem nahm zu seinem allergrößten Entsetzen aus den Augenwinkeln wahr, wie Ruben, der gerade noch die Arme in die Luft geworfen hatte, neben ihm verschwand. Einfach so, als hätte es ihn nie gegeben. In dem Moment spürte Sem für den Bruchteil eines Herzschlags etwas Heißes in seinem Rücken, als hielte ihm jemand eine glühende Kohle dagegen.
Der Fremde stand nahe dem Sack, den man dort erst vor Kurzem für ihn und seinen Kumpan hingestellt hatte. Er beobachtete für eine kurze Zeit angestrengt in Richtung der Hütte und einiger steiniger Hügel mit spärlichem Bewuchs dahinter. Dann senkte er den langen silbrigen Stab, den er in Händen hielt. Er schlang ihn sich um die Schulter und eilte zu seinem Kumpan. Er redete kurz auf ihn ein, hob ihn wie ein Bündel Reisig auf und trug ihn zu einer entfernteren Stelle. Dort legte er ihn behutsam ab. Er kam zurück, griff sich den Sack und trug ihn zu der Stelle, wo er den Verwundeten abgelegt hatte. Er kramte in seinem Umhang. Kurz darauf kam die Hand mit einem eiförmigen Gegenstand darin zum Vorschein. Er drückte darauf und sogleich flimmerte es in der Luft. Ein unsichtbarer Vorhang schien sich zu öffnen und dahinter erschien ein seltsames Objekt mit merkwürdigen Flügeln und einer Farbe, die der des Stabs auf seinem Rücken ähnelte.
Kapitel 1
Cagliari, Sardinien – 18. Juni
Cagliari hatte an diesem Morgen rein gar nichts von einem Postkartenidyll. Der Hauch von Afrika, der die Stadt oft schon im Frühjahr umgab, wenn die Einheimischen noch weitgehend von Touristen verschont waren, war buchstäblich vom Wind verweht. Vom Meer peitschte es stürmisch herüber, begleitet von einem schleierartigen Regen, der die Häuser und die Kalksteinhügel, auf denen sie standen, grau und unansehnlich machte. Am Lungomare Poetto kämpften nur wenige Jogger gegen die Gewalten der Natur an, und die paar Straßenmusiker, die es trotz des Wetters versuchten, verzogen sich rasch in die Häuser oder drückten sich im Castello-Viertel an die Wände der schmalen Gassen. Der heftige Wind ließ die Jacarandabäume erzittern und wehte hoch bis in den Nordwesten der Stadt. Er schüttelte die Pinien im Park San Michele und dort in der Nähe einige knorrige Büsche hinter verwitterten Schuppen, deren Gemäuer und Wellblechdächer bessere Zeiten gesehen hatten.
An einem der Schuppen hing über einem breiten Tor ein unansehnliches Blechschild, an dem ebenfalls sichtbar der Zahn der Zeit nagte. Mit Mühe war auf ihm noch der Schriftzug „Officina Fanari“ zu entziffern. Das Tor stand offen und gab den Blick auf hölzerne Werkbänke frei, auf denen alle möglichen Werkzeuge herumlagen. Alles glänzte schwarz und verrußt im Licht dreier Leuchtstofflampen, die an dünnen Ketten von der Decke hingen. Der Boden war schmierig und es roch nach altem Öl und Benzin. In der Mitte der Werkstatt befand sich eine Hebebühne. Darauf war eine dreirädrige Ape Calessino aufgebockt. Ihr weißes Chassis glänzte im hellen Neonlicht und bildete einen nicht besser möglichen Kontrast zu den bordeauxroten Segeltuchtüren, dem gleichfarbigen Faltdach und der grün getönten Frontscheibe.
Ein Mann lehnte mit dem Rücken an der glänzenden Stahlsäule der Hebebühne. Er war hager, nicht besonders groß und etwa Mitte fünfzig. In seinem schalen, faltigen Gesicht saßen eine hakige Nase und unter dünnem Mund mit spärlichem Schnurrbart ein schmales Kinn. Sein angegrautes Haar, das ihm in dünnen Strähnen in die Stirn hing, glänzte schmierig wie der wuchtige Schraubenzieher, den er in der Hand hielt. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt. In der anderen Hand hielt er eine Arbeitsleuchte, auf der der Staub und Fliegendreck von Jahren klebte. Konzentriert leuchtete er den Unterboden der Ape ab. Er klopfte mit dem Schaft gegen die Hinterachse. Dann hämmerte er ihn an einer Radaufhängung leicht gegen den Querlenker. Er bewegte sich zwei Schritte zur anderen Seite und wiederholte die Prozedur. Er klopfte sekundenlang im Takt, genauso wie der Regen, der über ihm auf das Wellblech trommelte. Als er wenig später den Krümmer abklopfte und an verdächtigen Stellen mit der Klingenspitze kratzte, fiel ihm blättriger Rost entgegen. „Cazzo!“, zischte er ungehalten und wischte sich Rostkrümel aus seinen Haarsträhnen und der Stirn.
Vor dem Eingang hörte man Schritte, die sich rasch der Werkstatt näherten. Der Hagere setzte seine Inspektion fort, ohne sich dafür zu interessieren. Im Eingang erschien eine kleine, untersetzte Gestalt, die vom raschen Gehen heftig schnaufte. Der Neuankömmling war ungefähr so alt wie der Hagere. Auf seinem gedrungenen Körper saß ein kugeliges Gesicht über kurzem speckigem Hals, der wie Teile seines Gesichts von dunklen Bartstoppeln übersät war. Der Hals steckte in einem zerschlissenen Pullover von undefinierbarer Farbe. Der Mann trug eine gräuliche Latzhose, die sich nur dadurch von der des Hageren unterschied, dass sie weniger sichtbare Zeichen vergangener Autoreparaturen aufwies.
„Giuliano!“, rief er keuchend zu dem Hageren hinüber.
Doch der schien nichts zu hören, weil er weiter ungerührt den Unterboden der Ape ableuchtete.
„Giuliano!“, schrie er nun gegen das Geräusch des Regens an. Diesmal hatte er Erfolg.
Der Hagere stockte, ließ den Arm mit der Arbeitsleuchte sinken und drehte sich herum. Ungehalten schaute er zu dem Mann auf der Torschwelle, der ihn in seiner Beschäftigung störte. „Romano, die hier braucht einen neuen Auspuff, Schalldämpfer und Krümmer“, begann er sofort, obwohl er sah, dass ihm sein Gegenüber gerade dringend etwas mitteilen wollte. „Schau hier!“ Er wandte ihm erneut den Rücken zu. „Hier, der Krümmer ist an zwei Stellen durch. Auch der Pott.“ Er stocherte mit dem Schraubendreher unter dem Schalldämpfer herum, bis die Spitze in einem Loch verschwand. „Siehst du!“ Mit zufriedenem Gesicht wandte er sich wieder Romano Fanari zu.
„Jetzt hör doch endlich mal zu!“, fuhr ihn Fanari an. Seine Augen sprühten vor Ungeduld, während er mit der freien Hand wild in der Luft herumfuchtelte. In der anderen hielt er ein Blatt Papier, dessen Ränder sich vor Feuchtigkeit wellten. „Die Amerikaner haben angebissen. Habe gerade eine Mail gekriegt“, rief er Giuliano aufgeregt zu, dessen Aufmerksamkeit er endlich auf sich gezogen hatte. Wie zum Beweis schwenkte er das Blatt hin und her. Jetzt erst merkte er, dass ihm Wasser in den Kragen perlte. Er rieb sich den Regen aus dem Gesicht und machte drei Schritte nach vorn.
Giuliano legte die Leuchte und den Schraubenzieher achtlos auf einen nahen Rollwagen und trat ebenfalls auf Fanari zu. „Wie angebissen?“, fragte er.
In seinen Augen glaubte Fanari nun etwas wie Neugier zu entdecken. „Andrea hat mir die Übersetzung geschickt.“ Er hielt ihm das Blatt Papier hin. Auf seinem Gesicht machte sich ein zufriedenes Grinsen breit.
Einen Moment sah es so aus, als wollte sein Werkstattkumpan nach dem Blatt greifen. Gleich darauf senkte er die Hand wieder. Stattdessen nickte er Fanari auffordernd zu. „Na los, sag schon!“
„Na, von der Antwort dieser Redking Industries-Firma.“
„Was schreibt sie denn?“ Giuliano wischte sich, während er auf Antwort wartete, seine rechte Hand am Ärmel seines T-Shirts ab, dessen Grundfarbe irgendwann mal oliv war.
Fanari räusperte sich vor Aufregung. „Sie wollen Fotos von der Kiste“, sagte er hastig. „Von allen Details. Am besten auch ein Video.“
Als sich ihre Blicke trafen, sah er, wie Giuliano die Unterlippe in den Mund nahm, als überlege er sich bereits einen Plan.
„Dann wollen sie noch eine Materialprobe, ein Stück Metall oder so“, machte Fanari weiter. Er war damals, er wusste noch, dass es 2002 war, mit dem Abschlepper nach Is Pelus gefahren. John Carpenter hatte es so gewollt. Fanari kannte ihn von früher, und nach Jahren hatte er wieder angerufen. Er hatte ihm ordentlich Geld für einen Job versprochen, der rasch erledigt werden müsste. Sie hatten diese Metallkiste, die wie eine schmale Gefriertruhe aussah, in eine der vielen verdreckten Planen eingepackt, die dort in einem Gerümpellager vergammelten. Sie hatten sie aufgeladen, zu Fanari gefahren und in den Schuppen neben der Werkstatt gebracht, wo sich hauptsächlich alte Autoreifen stapelten. Sie waren rein ins Haus und hatten sich, zumal sich der Tag bereits neigte, einen Rotwein gegönnt. Mister John war für seine Verhältnisse in euphorischer Stimmung gewesen, obwohl er diesen Jungen, wegen dem er aus England gekommen war, nicht angetroffen hatte. Fanari nannte Carpenter immer noch Mister John, auch in Gedanken. Es fiel ihm jetzt ein, als er daran dachte. Er nannte ihn auch noch nach den vielen Jahren so, die er ihn jetzt nicht mehr gesehen hatte.
Es war Abend geworden und er hatte Pizza vorbereitet. Giuliano war längst nach Hause gefahren und sie waren allein gewesen. Mister John hatte seine Millie anrufen wollen und war nach draußen verschwunden. Fanari erinnerte sich, dass er die Pizza aus dem Ofen geholt und ihn zum Essen hatte rufen wollen. Draußen im Hof war er nicht, und dann hatte Fanari das Licht im Schuppen bemerkt. Erst hatte er laut rufen wollen, war dann aber einfach nur rübergegangen und hatte durch das angelehnte Tor beobachtet. Mister John hatte sich an der Kiste zu schaffen gemacht und sie war zum Leben erwacht. Unzählige Lichtpunkte waren auf dem Ding umhergehüpft und hatten den Schuppen in einen gelblichen Schein getaucht. Fanari war wieder unbemerkt zum Haus zurück. Kurz danach war Mister John gekommen. Er hatte ihm, Fanari, vorher bereits, als sie Wein tranken, gesagt, er solle die Kiste schnellstmöglich auf seinen Schlepper packen, mit Gewichten vollpacken und spätabends im Dunkeln an einer der Brücken oder Molen ins Wasser befördern.
Fanari hatte es ihm versprochen. Mister John hatte ihn mit gutem Geld für den Gefallen bezahlt und war nach der Pizza verschwunden. Fanari hatte zwar ein schlechtes Gewissen gehabt, hatte sich aber nicht von der Kiste trennen können. So war sie bis jetzt im Schuppen geblieben. Fanari hatte versucht, die Kiste nach Mister Johns Abreise zu aktivieren, hatte es aber nicht geschafft. Er hatte die Kiste im Schuppen über die vielen Jahre einfach vergessen, bis er vor vier Wochen beim Herumstöbern in Facebook auf den Namen Redking gestoßen war. Rosalia hatte ihm dort eine Seite eingerichtet, mit der er ein bisschen Werbung für sein Officina Fanari machen sollte. Dort hatte er von dem Angebot gelesen, wonach dieser Redking jedem, der ihm den Beweis für außerirdisches Leben oder Technologie erbringe, eine Million Dollar bar auf die Hand zahlen wolle.
Fanari hatte zuerst nur müde gegrinst, als er das gelesen hatte. In der kurzen Zeit, die er seither dank Rosalia in Facebook unterwegs war, hatte er schon viele abstruse Einträge von allen möglichen Spinnern gelesen, die Aufmerksamkeit brauchten. Dann hatte er aber gesehen, dass Redking zu einer Firma Redking Industries gehörte. Er hatte ein bisschen im Internet gesucht und war fündig geworden. Die saßen irgendwo in den Südstaaten, machten bestimmt eine Menge Kohle und Redking war wohl der Haupteigentümer dieser Firma.
„Glaubst du wirklich, dass der Kasten außerirdisch ist?“, riss ihn Giuliano aus seinen Gedanken.
Fanari sah seinen skeptischen Blick. „Ja, glaube ich. Schau dir die Kiste doch an! Die ist doch nicht auf dieser Welt fabriziert.“
Giuliano presste die Lippen zusammen, sagte aber nichts.
„Der Engländer, dem ich damals dabei half, das Ding aus Is Pelus wegzuschaffen. Der hatte Angst.“
Fanaris Kumpan zog geräuschvoll die Luft hoch. „Wie Angst?“
„Eben Angst, dass andere davon erfahren. Der wollte die Kiste einfach nur verschwinden lassen.“
„Warum das denn?“ Giuliano schaute auf seine dreckverschmierten Hände. Er rieb sie aneinander und wischte sie an den Hosenbeinen ab.
„Warum denn, warum denn?“, äffte ihn Fanari ungeduldig nach. „Warum auch immer. Was weiß denn ich!“ Ungehalten machte er mit seiner speckigen Hand eine Bewegung, als wollte er lästige Fliegen verscheuchen. „Das ist mir aber erst später klargeworden. Ich habe mich damals, als die Kiste schon im Schuppen lag, noch mal bei der Frau umgehört, von der er die Kiste hatte.“
Giuliano hatte Kopf und Nacken nach vorn geschoben, als wollte er eine Wand einrennen.
Fanari wertete es als Zeichen seines Interesses. „Die hat gesagt, sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie sich die Kiste plötzlich verfärbte. Sie war dabei, als der Engländer damals in Is Pelus an der Kiste herumhantierte, weißt du.“ Fanari sah seinen Kumpan mit großen Augen an. „Richtig bläulich sei sie geworden“, machte er weiter, als er bei ihm keine Reaktion entdeckte. „Strahlend blau, die ganze Kiste. Das ist doch Metall oder“, er machte eine kurze Pause, suchte nach dem passenden Wort, „irgendein Metall“, ergänzte er. „Hast du mal gesehen, dass sich Metall blau verfärbt?“ Er schaute Giuliano auffordernd an.
Der schaute kurz nach oben, als suchte er etwas über dem Tor. Dann schüttelte er bedächtig den Kopf.
„Höchstens doch rot, wenn es ganz heiß wird“, fuhr Fanari fort. „Die Frau sagte auch, die Kiste habe sich sonst kühl angefühlt. Auch in der größten Hitze, wenn die Sonne auf den Schuppen knallte.“ Fanari sah Giuliano fest an. „Sie hatte sie wohl selbst mal angefasst, als sie in das Haus zog.“
„Das bedeutet aber nichts. Jedenfalls nicht, dass das Alienzeugs ist“, sagte Giuliano. Er hatte die Arme über der Brust verschränkt und die Stirn in Falten gelegt.
Fanari machte eine Geste, als wollte er etwas wegwerfen, atmete schwer. „Da ist noch was.“ Er suchte den Blick von Giuliano. „Als der Engländer damals weg war, hat es mich am nächsten Morgen gepackt. Ich habe die Kiste mit dem Trennjäger bearbeitet. Mit der härtesten Scheibe, die ich hatte.“ Er suchte in Giulianos Augen erneut nach einer Reaktion, fand aber keine. „Ging sonst durch jeden Stahl wie Butter, mehrere Zentimeter, kein Thema“, machte er weiter. „Und hier? Nichts! Ich sag dir, nichts!“
Giulianos Augen blieben ausdruckslos. Er räusperte sich und spuckte auf den Boden. „Es gibt auch sehr harte Legierungen. Die sind manchmal … .“
„Das ist keine Legierung. Definitiv ist das keine Legierung“, schnitt ihm Fanari das Wort ab. „Die Schleifhexe hat nur ein bisschen dran gekratzt und dann, dann ist der Riss einfach wie von selbst zugegangen“, stieß er aufgeregt hervor. Er schaute Giuliano herausfordernd ins Gesicht. „Danach war nichts mehr zu sehen.“ Er schüttelte den Kopf. „Das ist kein Metall. Was auch immer das ist. Das ist keine Legierung, kein Metall. Sowas gibt es bei uns nicht, nirgends.“
„Hm.“ Giuliano blies die Backen auf und ließ den Atem stoßweise entweichen.
„Hat mich damals nicht weiter interessiert. Hab´ nicht mehr an das Ding gedacht.“ Fanari lächelte verlegen, als wollte er sich entschuldigen. „Aber jetzt, wo dieser Amerikaner richtig viel Geld dafür abdrücken will, na, ja.“ Er schaute seinen Kumpan vielsagend an.
„Hm“, brummte Giuliano erneut. Er schniefte und fuhr sich mit der Hand über die Nase.
Fanari wusste, dass Giuliano nicht viel von der Sache hielt. Er hatte diesen Redking einen dummen Spinner und Aufschneider genannt. Die ganze Sache hielt er für eine ausgemachte Luftnummer. Genauso sah es Rosalia. Davon würde er, Fanari, sich aber nicht entmutigen lassen. Er wusste, was er wusste! „Ich rufe nachher Andrea an, damit er mir bei dem Brief an den Sekretär von diesem Redking hilft“, sagte er fast trotzig. Andrea war Giulianos Schwager. Er hatte lange Jahre in Amerika gelebt, bevor er mit seiner Familie vor einigen Jahren nach Sardinien zurückgekehrt war. Er war eigentlich nur zurückgekommen, weil er in der alten Heimat sterben wollte, nachdem er Krebs bekommen hatte und ihm die Ärzte in Amerika wenig Hoffnung gemacht hatten. Er hatte den Krebs aber überlebt und sich wieder so wohl in Muravera, wo er jetzt lebte, gefühlt, dass er und seine Frau sich entschieden hatten, auf der Insel zu bleiben. „Andrea kann mir was schreiben und wir machen Fotos, schöne Fotos von dem Ding.“
Giuliano nickte widerstrebend.
Fanari zwang sich, seine fehlende Begeisterung zu ignorieren. „Wenn der Regen weg ist, machen wir die Fotos.“ Er ruderte mit der Hand durch die Luft, winkte Giuliano zu sich heran. Schon drehte er sich um. „Komm mal mit“, rief er ihm über die Schulter zu. Mit zwei kurzen, raschen Schritten war er am Eingang, wo der Regen in dicken Fäden vor der Schwelle auf den Boden platschte. „Wir machen die bei schönem Wetter da draußen im Hof.“ Fanari deutete mit dem Kinn in Richtung dreier aufeinandergestapelter Autowracks. Davor lagen etliche Altreifen übereinander auf löchrigem Asphalt, der vom Regen schwarz glänzte.
Giuliano, der neben Fanari getreten war, schaute uninteressiert in die gezeigte Richtung. Als ihm Regen auf den Kopf tropfte, zog er ihn rasch zurück.
„Wir hieven sie dort auf die Palette.“ Fanari deutete auf eine leere Palette. Darauf hatten bis letzte Woche noch drei oder vier rostige Hinterachsen mit und ohne Differential gelegen, die der Schrotthändler aus Quertucci Anfang der Woche mitgenommen hatte. Fanari zog tief Luft durch die Nase. „Man riecht richtig den Sommer“, ließ er seinen Kumpan wissen.
Giuliano tat es ihm nach. „Hm“, machte er nur und zuckte die Schultern.
Jetzt erst merkte Fanari, dass er immer noch das Blatt in der Hand hielt. Der Regen durchweichte bereits sichtbar das Papier. Er faltete es rasch zusammen und ließ es in der Brusttasche seines Overalls verschwinden. „Dort machen wir auch ein Video von dem Ding.“ Fanaris Finger zeigte erneut auf die Palette. „360-Grad-Panorama“, tat er professionell.
Statt einer Antwort, spuckte Giuliano erneut aus und beobachtete einen kurzen Moment, wie sich die Spucke in einer Wasserpfütze verteilte.
„Schade, dass ich das Ding nicht aktivieren kann“, sagte Fanari mehr zu sich selbst. In seiner Stimme schwang Enttäuschung mit. „Der Engländer konnte es. Hab´ es einmal mit eigenen Augen gesehen.“ Er sah Giuliano gespannt an.
Der fuhr sich mit der Zunge über die Zähne, als wollte er sie befeuchten.
Fanari wandte den Blick von ihm ab. Er starrte sekundenlang angestrengt in den Hof und beobachtete, wie der Regen unablässig auf Asphalt prasselte und auf Autoblech trommelte. „Das wäre erst eine Show für die Amerikaner, aber egal“, überlegte er weiter. „Die Fotos und der Clip tun´s hoffentlich auch. Gut, dass es dieses Plättchen gibt, das irgendwann von der Kiste abgefallen ist.“ Er wandte sich wieder Giuliano zu, suchte seinen Blick. „Das schick´ ich ihm.“
Giuliano nickte reflexartig.
„Die Antwort kriegt er per Mail und das Plättchen per Luftpost.“ Er sagte es mehr zu sich selbst.
„Hört ihr denn nicht? Essen ist fertig“, drang eine Frauenstimme durch den strömenden Regen.
„Hast du Rosalia rufen gehört?“, fragte Giuliano überrascht.
Kapitel 2
Köln – 23. Juni
Cornelius Reiter saß hager und aufgerichtet wie ein hingestelltes Brett neben dem Mann an der elektronischen Orgel, während die Gemeinde mit Inbrunst sang. „All' Sünd' hast Du getragen, sonst müssten wir verzagen“, stimmte er mit seiner sonoren Tenorstimme ein. Als die Brüder und Schwestern in den langen Stuhlreihen vor ihm „Wir preisen Dich, o Lamm Gottes“ intonierten, erhob er sich. Gemessenen Schritts bewegte er sich zur Kanzel, bei der es sich eigentlich um ein schmuckloses Rednerpult handelte. Eine hohe Stufe führte hinauf und er nahm sie mit einem leichten Schritt. Sekundenlang ließ er seinen Blick über die Gemeinde und dann in einer fließenden Kopfbewegung über die beiden brusthohen Metallständer links und rechts der Kanzel gleiten, in denen lange, stämmige Kerzen brannten.
Das Rodenkirchener Versammlungshaus im Rheinbogen von Köln war wie an den Sonntagen davor nahezu bis auf den letzten Platz besetzt. In dem Moment entschied Cornelius für sich, dass der Wochen zurückliegende Horror-Tsunami, der so viele Leben gekostet hatte, dem wahren Glauben gutgetan hatte. Er entschied es wieder einmal, denn der Gedanke war schon mehrmals in seinem Kopf aufgetaucht. Zuerst hatte er ihn zurückzudrängen versucht, weil er natürlich ungeheuerlich und schauderhaft war. Weil er seine Bestätigung dem Leben unzähliger Menschen verdankte. Doch dann hatte er ihn als wahr und das Werk dahinter als Wille des dreieinigen Gottes angenommen. In der Not suchte der Mensch eben das Wort des Herrn. Cornelius merkte, dass die Gemeinde wartete, und reckte den Kopf in die Höhe.
„Ich habe noch zwei Ankündigungen, liebe Schwestern und Brüder“, sagte er laut und vernehmlich. „Die Hausandacht findet diese Woche am Donnerstag bei unserer Schwester Marion statt. Alles Nähere steht in dem Faltblatt, das unser Bruder Ingo vor dem Gottesdienst auf euren Sitzen verteilt hat.“ Mit flinkem Blick suchte er das Gesicht von Ingo Schofs. Er fand ihn am Ausgang, wo er gerade das Zehntenlamm in Position brachte. Ihre Blicke kreuzten sich kurz. Es reichte Cornelius, um Ingo ein anerkennendes Nicken zu schenken. „Auf euren Plätzen liegen auch Formulare“, machte Cornelius weiter. „Darauf können die, die es noch nicht gemacht haben, ihre Kontodaten eintragen.“ Zwischen den Stuhlreihen raschelte Papier. „Bitte mitnehmen und das nächste Mal wieder abgeben. Vergesst euren Zehntenbetrag nicht.“ Wenig später hatten viele Hände die Blätter weggepackt und war das Rascheln verschwunden. Cornelius wartete noch einige Sekunden, bis er sich der vollen Aufmerksamkeit seiner Zuhörerschaft gewiss war. Er schob die Brust nach vorn, hob das Kinn und machte mit den Händen eine ausladende Bewegung. „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Schwestern und Brüder. Amen“, sagte er laut und feierlich.
„Amen“, wiederholte die Gemeinde.
Der Mann an der elektronischen Orgel griff erneut in die Tasten und die allen vertraute Melodie erfüllte den Versammlungsraum. Rasch und geräuschvoll schob sich eine kleine Menschentraube in den Mittelgang. Die Schwestern und Brüder unterhielten sich angeregt, als sie dem Ausgang zustrebten. Manche, die es vorher nicht geschafft hatten, sich zu begrüßen, umarmten sich herzlich. Cornelius war mit dem Einsetzen der Musik zum Ausgang geeilt, um die Gottesdienstbesucher zu verabschieden. Er stand am rechten Flügel der Glastür. Ihm links gegenüber lehnte Ingo am anderen Flügel. Nach geraumer Zeit war auch der letzte Besucher in Richtung Parkplatz verschwunden. Ingo nahm die Keramikfigur mit beiden Händen vorsichtig von dem recht breiten, viereckigen Standklotz, auf dem sie gut sichtbar zur Kollekte angehalten hatte. Reflexartig schüttelte er sie vorsichtig. Es raschelte ordentlich, was er als ein gutes Zeichen wertete. Als er Sekunden später über den Mittelgang eilte, entdeckte er Sophie Molineaux in einem ihrer engen Kostüme. Mit einem messingfarbenen Kerzenlöscher erstickte sie gerade die Flamme der letzten der beiden Kerzen. Sie legte ihn neben der Kanzel auf den Boden und griff nach dem Metallständer. Obwohl sie nicht sonderlich groß war, musste sie sich leicht bücken, um ihn zu umfassen, wobei ihr das blondierte Haar tief in die Stirn fiel.
„Lass gut sein, Sophie. Ich mach´ das schon“, rief Ingo ihr zu, als er nach rechts schwenkte, um auf eine Bogentür zuzusteuern.
„Ich mache mich gern ein bisschen nützlich“, kam es von Sophie zurück. Sie hatte sich ihm zugedreht und sah ihn durch ihre Brille an.
Auch Ingo war stehengeblieben. Er zog das Keramiklamm an sich, als müsste er es vor ihr beschützen.
„Besser das hier, als wie das fünfte Rad am Wagen rumzustehen“, meinte sie mit einem unterdrückten Lächeln. „Ich will noch ein paar Sätze mit Cornelius wechseln, bevor ich mich auf den Heimweg mache. Aber der scheint noch anderweitig beschäftigt zu sein.“ Sie wies mit der Hand zum Ausgang. Ingos Blick folgte ihrer Handbewegung. Dort war Cornelius in ein Gespräch mit Schwester Marion vertieft. Anscheinend war sie noch mal zurückgekommen, um letzte Details wegen der anstehenden Hausandacht zu besprechen. Sie verrenkte sich beim Sprechen fast ihren speckigen Hals, so aufgeregt redete sie auf Cornelius ein.
„Wird wohl noch ein bisschen dauern“, bestätigte Ingo Sophies Einschätzung. „Na, gut, dann gerne!“ Er deutete mit dem Kinn auf den Kerzenständer. Sie verstand und griff ihn mit beiden Händen. Sie hob ihn hoch und folgte Ingo, der bereits vorauseilte. Nachdem die beiden Kerzenständer im Nebenraum verstaut waren, half sie ihm bei sechs weiteren, die wie gewöhnlich bei Gottesdiensten im Eingangsbereich und an der Rückwand des Saals aufgestellt worden waren. Als sie nach ihrem letzten Gang aus dem Nebenraum in den Versammlungsraum zurückkamen, sahen sie, dass sich Cornelius immer noch mit Schwester Marion unterhielt. Tatsächlich redete sie ununterbrochen auf ihn ein und er hörte ihr geduldig zu. Ihre kräftigen, kurzen Arme kreisten fast ununterbrochen durch die Luft, um den Schwall ihrer Worte zu untermalen. Cornelius machte zweimal kurz hintereinander eine Abwehrbewegung mit der Hand und wich einen Schritt zurück, als wollte er sich dem Gespräch entziehen. Doch sie setzte sofort nach, stand jetzt dort vor ihm, wo sich fünf Minuten vorher noch der Holzsockel mit dem Lamm oben drauf befunden hatte.
Sophies Pfennigabsätze klapperten hinter Ingo über den Boden, bis sie die erste Sitzreihe erreicht hatten. Beide setzten sich und warteten. Sekunden später entdeckte Cornelius sie. Gleich darauf war er es, der auf Schwester Marion einredete. Dabei gestikulierte er mit der Hand und wies dabei mit dem Finger in die Richtung der beiden. Diesmal wirkte es. Schwester Marion schob ihren molligen Körper nach draußen. Cornelius schloss beide Flügel der breiten Eingangstür und schob das Holzpodest hinter den Vorhang. Dann machte er kehrt und kam mit langsamen Schritten auf Ingo und Sophie zu. Sein Blick ruhte ausschließlich auf Sophie.
„Schön, dass du es heute mal wieder zur Versammlung geschafft hast, Sophie“, sagte er, als er bei ihnen angelangt war. Er zog sich einen Stuhl heran und stellte ihn vor die beiden. Bedächtig setzte er sich rittlings darauf. Sophie musterte ihn ruhig. Er wartete auf eine Antwort von ihr. Als keine kam, sagte er: „Ich sehe, du hast eine neue Frisur. Steht dir ausgesprochen gut.“
Sie nickte ihm dankbar zu, sagte aber nichts.
„Finde ich auch“, schob Ingo sein Kompliment hinterher. „Wir haben uns wochenlang nicht gesehen“, fiel ihm ein.
Sophie sagte nichts darauf.
„Du hättest dich ruhig mal melden können“, sagte Cornelius. Es klang weniger wie eine Anklage, eher wie eine Feststellung.
Sophie stockte für einen Moment. „Ich hatte viel mit mir selbst zu tun“, sagte sie mit leiser Stimme. Sie hatte den Blick gesenkt.
Cornelius räusperte sich, als hätte er etwas im Hals stecken. „Noch mal was von Stefan gehört?“, fragte er mit gepresster Stimme.
„Nein“, gab Sophie leise zur Antwort. Sie schüttelte traurig den Kopf. Sie schwiegen einige Sekunden, bis Sophie wieder das Wort ergriff. „Die Polizei informierte mich Tage nach der Sache in Island, dass sie seinen Wagen gefunden hatten. Sie verhörten mich, wollten wissen, was das mit dem Geheimfach in seinem Audi für eine Bewandtnis habe.“
„Ein Geheimfach?“, fragte Ingo erstaunt.
Sophie nickte. „Ich konnte ihnen dazu nichts sagen, weil ich nichts davon wusste.“ Wieder folgte eine Pause. Sophie schaute auf ihre Hände, die sie im Schoß gefaltet hielt. Sie atmete tief ein und aus. Dann hob sie den Kopf, sah Cornelius fast trotzig ins Gesicht. „Er gilt offiziell als vermisste Person.“ Ihre Stimme war jetzt rau. „Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder bei der Polizei angerufen. Auch John habe ich gefragt.“ Wieder eine Pause.
„Und?“, fragte Cornelius.
„Er machte nur Andeutungen. Dass Stefan hinter den Leuten her war, die die Aliens gefunden hatten.“ Wieder eine Pause. Cornelius und Ingo warteten, ließen ihr die nötige Zeit. „Ich kann mir das nicht vorstellen, obwohl ich weiß, wie fanatisch er …“, sie zögerte und überlegte, „sein konnte“, sagte sie dann. Sie schluckte und wischte sich über die Augen. „John druckste herum.“ Sophie schaute erst zu Cornelius, dann zu Ingo. „Er sagte, es falle ihm schwer, es mir zu sagen, halte es aber für das Richtige. Er … .“
„Was sagen?“, unterbrach Ingo sie. Seine Augen glänzten vor Neugier.
„Er hat, sagt er, einen seiner isländischen Freunde angerufen. Der habe gute Kontakte zur Reykjavíker Polizei. Sie vermuten, dass es dort, wo das deutsche Flugzeug abgestürzt war, ein Feuergefecht gab. Als gerade die Trauerfeier war.“
„Ein Feuergefecht?“, fragte Cornelius ungläubig. Er drückte seine Handflächen fest gegen die Stuhllehne. Auf dem Nachbarsitz spannte sich auch Ingo in neugieriger Erwartung wie eine Feder.
„Ja, ein Feuergefecht. Es gab dann wohl eine Lawine, die durch Schüsse ausgelöst wurde. Sie haben eine finnische Präzisionswaffe gefunden. Keine verwertbaren Fingerabdrücke, aber eine Scharfschützenwaffe.“
„Das heißt aber doch nichts“, meinte Ingo.
Sophie senkte kurz den Blick. „Doch“, sagte sie tonlos, als sie sich zur Seite wandte und Ingo anschaute. Langsam wanderte ihr Blick zu Cornelius. „Stefan war in Finnland zu Schießübungen. Bei so einer Gruppe. Das weiß ich.“
Cornelius nickte, als er zu begreifen begann.
„Und sie haben in der Nähe der Waffe einen verschmorten Bergsteigerschuh gefunden“, fuhr sie langsam und mit besonderer Betonung fort. „John hat über seinen isländischen Kontakt ein Foto des Schuhs bekommen und mir geschickt.“ Sie stockte, dann: „Ich kannte ihn. Stefan hat sich irgendwann im Spätherbst so ein Paar gekauft.“ Sie schluckte schwer und schwieg.
Alle schwiegen, bis Ingo sich zurücklehnte und über seine Bartstoppeln rieb. „Wenn das wirklich Stefan war, dann war das völlig … .“
Sophie ließ ihn den Satz nicht zu Ende bringen. „Ich weiß, was das war!“, blaffte sie ihn an.
Es entstand eine verlegene Pause, bis Cornelius mit den Handflächen auf die Sitzfläche klopfte. Er suchte Sophies Blick. „Wie geht es John eigentlich?“ Er versuchte, möglichst harmlos dreinzuschauen.
„Besser, denke ich. Jetzt, wo er nicht mehr mit einer Anzeige der in Island gekidnappten Leute rechnen muss.“ Ihre grünen Augen ließen keine Regung erkennen.
„John hat sich seither nicht mehr blicken lassen“, bemerkte Cornelius. Seine Augen waren weiter auf Sophie gerichtet.
„Ist auch gut so“, kam es von Ingo wie aus der Pistole geschossen.
John hatte sich von der Liga distanziert. Damit war, nachdem die Dinge so gelaufen waren, wie es der Fall war, zu rechnen gewesen. Ja, es ist gut so, dachte Cornelius. Laut sagte er: „Er will aber das Geld zurück, dass er uns vor zwei Jahren für das Versammlungshaus geliehen hat.“
„Es war eben geliehen“, konterte Sophie spitz. Sie schob herausfordernd das Kinn nach vorn.
„Klar war es das“, entgegnete Cornelius bestimmt. „Aber ursprünglich war auch von mehr Zeit die Rede, um es zurückzuzahlen. Er will uns ja auch Zeit lassen.“ Cornelius machte eine wegwerfende Handbewegung, die signalisieren sollte, dass die Sache längst vom Tisch war. „Die Raten, die er will, werden wir mit Ach und Krach zusammenkriegen“, fuhr er fort. „Er sagt, dass er das Geld für seine Anwälte braucht.“
„Für einen alten Rechtsstreit in England, sagt er“, erklärte Sophie.
„Pah!“ Ingo zog abfällig die Mundwinkel nach unten.
Sophie drehte sich zu ihm hin, schob sich die Brille fast bis zur Nasenspitze und starrte ihn über das Brillengestell hinweg an. „Er glaubt, dass einer von der Liga ihn vor Wochen verpfiffen hat“, wechselte sie das Thema. Ihre Stimme klang gefährlich kalt.
„Dann soll er glauben, was er will“, blaffte Cornelius und machte eine ärgerliche Handbewegung. „Wir waren das nicht. Es hat sich damals in unserer Gemeinde wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Jeder war entrüstet, jeder kann es gewesen sein.“
„Keiner wollte, dass die Liga der Mittäterschaft verdächtigt wird“, sprang Ingo ihm bei.
Sophie beachtete ihn nicht. Ihre Augen fixierten Cornelius. „Wobei du natürlich direkt in der Sache mit drin warst.“ Ihr Blick lag schwer wie Blei auf ihm. „Aber gut, lassen wir das“, sagte sie plötzlich. Ihre Miene entspannte sich. „Ist ja für John noch mal glimpflich ausgegangen.“ Sie klang jetzt beinahe ein wenig müde, blickte auf ihren Schoß. „John und die Liga sind geschiedene Leute, das ist Fakt“, sagte sie, als sie wieder aufschaute und Cornelius ins Gesicht sah.
„Und wie stehst du heute zu uns, Sophie?“, fragte Cornelius. Er sah sie mit durchdringendem Blick an.
„Das weiß ich noch nicht so genau, ehrlich gesagt, Cornelius. Ich muss erst einmal zur Ruhe kommen“, antwortete sie ihm. „Mich mit der Tatsache abfinden, dass Stefan wohl nie mehr nach Hause kommt.“ Sie schniefte kurz und blinzelte eine Träne weg.
Cornelius gab ihr einen Augenblick Zeit. „Aber schön, dass du heute da bist“, sagte er dann. „Es würde uns freuen, wenn du uns weiter die Treue hältst.“
Ingo nickte zustimmend, ohne dass sie es bemerkte.
„Sag einfach mal Bescheid, wenn du mehr weißt“, meinte Cornelius. Sophie presste die Lippen zusammen, nickte und erhob sich. Sie strich sich mit beiden Händen über den Rock, prüfte den Sitz ihrer Jacke. Auch die beiden Männer erhoben sich. Sie verabschiedete sich von ihnen, drehte um und klapperte mit ihren Absätzen hart über den Hallenboden in Richtung Ausgang. Ingo und Cornelius schauten ihr nach, bis sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte.
„Gut, dass du so schnell reagiert hast“, begann Ingo.
Cornelius drehte ihm fragend den Kopf zu, obwohl er eigentlich wusste, worauf Ingo anspielte.
„Ich war kurz davor, ihr reinen Wein einzuschenken.“
„Untersteh dich!“, wies Cornelius ihn zurecht. „Es reicht gerade, wenn ich es weiß. Weißt du, wie rachsüchtig John womöglich ist? Auch heute noch?“ Er schaute Ingo streng ins Gesicht. „Sophie erzählt ihm doch alles brühwarm weiter, das weißt du doch.“
Ingo nickte bedächtig.
Cornelius drehte sich von Ingo weg, tat einen Schritt, um den Stuhl zurück in die Reihe zu befördern.
Ingo hielt ihn am Arm zurück. „Ich habe da noch was“, sagte er, als sich Cornelius ihm wieder überrascht zuwandte. „Dieses Video, das Sophie uns vor der Geschichte mit Stefan zeigte. Dieser Alien mit seiner unverständlichen Ansprache.“
„Ja?“, unterbrach Cornelius ihn gespannt. Seine Neugier war sofort geweckt.
„Sie hat vorhin ihr Handy im Nebenraum hingelegt, als sie mir bei den Kerzenständern half.“ Ingo wartete einen Moment.
Auch Cornelius wartete, verzog die Augen zu kleinen Schlitzen.
Kapitel 3
Köln – 6. Juli
Gut drei Monate, nachdem er mit viel Glück einem verunglückten Flugzeug entstiegen war, befand sich Mike Thiebes wieder im unmittelbaren Abflugbereich einer Flughafenhalle. Genauer gesagt, stand er mit durchgedrücktem Rücken an der Sicherheitskontrolle. Er fühlte sich angespannt. Er hatte diesen lästigen Teil des Fliegens nie gemocht: anzustehen und sich von oben bis unten mit einem Metalldetektor abtasten zu lassen. Auch dem, was danach kam, sah er mit gemischten Gefühlen entgegen. Nach der Sache mit Island hatte er sich geschworen, nie mehr einen Fuß in einen Flieger zu setzen. Anna zuliebe war er eingeknickt und hatte ihrem Plan zugestimmt. Eine Woche Kanaren mit ausgewogenem Kontrastprogramm, mit dem beide hoffentlich klarkamen. Ein bisschen mit dem Fahrrad rum und ein wenig Wandern, sofern es die Temperaturen zuließen. Aber vor allem Ruhe, Gemütlichkeit und gutes Essen. Das war der Plan. Abgesehen vom Fliegen, freute sich auch Mike auf die Woche, die vor ihnen lag, und verspürte sogar so etwas wie Urlaubslaune, seit sie am Morgen mit gepackten Koffern nach Köln Grengel zum Airport gefahren waren.
Trotzdem blieb das mulmige Gefühl. Anna hatte ihn überredet, nein überzeugt, wieder in einen Flieger zu steigen. Er wusste, dass sie recht hatte. Man durfte es nicht zu lange aufschieben, sonst wurde die Angst schlimmer und irgendwann ging gar nichts mehr. Mike setzte die rote Baseballmütze ab und kratze sich die Platte. Die Kappe war das einzige Accessoire des Urlaubers, das er sich heute zugestand. Darunter die braune Tweedjacke, die er besonders mochte. Sie passe zwar farblich gut zur Kappe, würde ihn auf den Kanaren aber wohl rasch ins Schwitzen bringen, hatte Anna gemeint. Er hatte sich trotzdem für die Jacke entschieden. Es gab ja noch Alternativen im Koffer. Er setzte die Kappe wieder auf und kämmte sich das restliche Haar mit den Fingern hinter die Ohren. Dann prüfte er den Sitz der Kappe und merkte, dass das Licht der Deckenbeleuchtung unangenehm blendete. Er zog sich den Mützenschirm tiefer in die Stirn und ließ seinen Blick durch die geräumige Halle schweifen. Er zählte fünf Stationen, von denen zwei besetzt waren. Am Ausgang einer jeden stand eine gelbe Mülltonne. Davor und dahinter schwarzweiß uniformiertes Sicherheitspersonal und die Blauhemden der Bundespolizei.
„Alles gut?“, riss ihn Annas besorgte Stimme aus seiner Beobachtung. Sie befand sich vor ihm in der Schlange Wartender und hatte sich zu ihm umgedreht. Ihre Finger streichelten beruhigend über seine Faust, die den Bordrucksack hielt.
Mike versuchte ein überzeugendes Lächeln. „Alles gut“, sagte er. Als es quälend langsam in der Schlange weiterging, dachte er an den Minirucksack. Einen ähnlichen hatte er letztes Mal mit an Bord gehabt. Hoffentlich kein schlechtes Omen, kam ihm in den Sinn und er versuchte, den Gedanken zu verdrängen. Anna half ihm dabei, als sie sich erneut zu ihm umschaute und die Augen verdrehte. Ausgerechnet sie hatte jemanden von der langsamen Sorte vor sich, bei dem es dauerte, bis er das Deo in die Klarsichttüte gepackt und die letzte Münze aus der Hosentasche gekramt hatte. Genervt kämmte sie sich hastig mit den Fingern eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihr Haar bekam es häufig ab, wenn sie geladen war. Mike musste unwillkürlich lächeln und sie bekam es in den falschen Hals. Sie rollte mit den Augen und setzte bereits zu einer Bemerkung an, als einer vom Sicherheitspersonal ihn rettete.
Der Mann bat Anna zum Förderband. Sie schaute sich zu Mike um und machte eine Miene, die ihm Mut zusprechen sollte. Gleich darauf drängte sie sich rasch an ihn und strich ihm über den Arm, während sie ihren Kopf an seine Schulter drückte. Genauso rasch war sie wieder fort und am Förderband, wo sie die angereichte Gepäckwanne in Empfang nahm. Mike sah ihr dabei zu, wie sie Jacke und Schuhe in die Wanne beförderte. Sie zog den Gürtel aus den Schlaufen ihrer Hose und er wanderte ebenfalls in die Wanne. Gleich darauf prüfte sie den Sitz ihrer Bluse am Hosenbund, strich hinten und vorn darüber. Zuletzt kamen die Armbanduhr und das Handy an die Reihe, die sie in die Seitentasche ihres Bordcase wegpackte.
Zwei Minuten später hatte auch Mike die Station und den Mann mit dem Metalldetektor passiert. Anna und er waren gerade dabei, im Gehen die Ausweise und Reiseunterlagen neu zu verstauen, als Mike aus den Augenwinkeln zwei Bundespolizisten bemerkte, die auf sie zuhielten. Zuerst dachte er, dass sich ihre Wege nur zufällig kreuzten. Dieser Gedanke erledigte sich im nächsten Moment von selbst, als die beiden vor ihnen anhielten und Mike erwartungsvoll anschauten.
„Herr Thiebes, Michael Thiebes?“, fragte ihn der Ältere von beiden. Er hatte weniger Haare als Mike auf dem Kopf, was etwas heißen wollte.
„Ja?“, kam Mikes einsilbige Gegenfrage zurück.
„Herr Thiebes, wir möchten Sie bitten, uns rüber zum Büro zu begleiten. Es dauert nicht lange.“ Der Mann zeigte mit der Hand nach rechts und Mikes Blick folgte ihr automatisch.
„Warum denn?“ Mehr fiel Mike nicht ein. Verdattert schaute er den Polizisten an.
Auch Anna schien ihre Zunge verschluckt zu haben. Mucksmäuschenstill und mit großen Augen stand sie neben Mike und schien ebenso überrascht wie er.
„Keine Sorge, es dauert nicht lange“, sagte jetzt auch der jüngere Polizist. „Kommen Sie bitte.“
Immer noch überrascht, schaute Mike zu Anna. Er glaubte in ihren Augen etwas zu entdecken, das er als Angst deutete. In dem Moment wusste er, woran sie dachte. Dass die Sache mit Island längst nicht ausgestanden war und dass die Dinge sie hier und jetzt wieder einholten. Als er es realisierte, fühlte er, wie sich das Adrenalin in seinem Körper bemerkbar machte. Ganz plötzlich spürte er auch das dumpfe Gefühl im Nacken, das ihn häufig beschlich, wenn sich Ärger ankündigte.
„Es dauert sicher nicht lange, Liebes“, wiederholte Mike annähernd das, was beide Polizisten gesagt hatten. Er hoffte, dass es stimmte. Er sah Annas sorgenvollen Blick und darin auch ein Quäntchen Unmut, so unvermittelt aus ihrer Urlaubsstimmung gerissen zu werden. Sie suchte immer noch nach ihrer Fassung.
„Die Tür da vorn“, meinte der Jüngere. Sein Finger zeigte auf eine graue Tür nahe einer Flurecke. „Ihre Begleitung kann dort drüben auf Sie warten.“ Er sah Anna an und deutete in Richtung der Glasschiebetür, durch die es in den Abflugbereich ging. „Keine Sorge. Ihr Flug wird ja erst in einer halben Stunde aufgerufen. Bis dahin ist Herr Thiebes längst wieder bei Ihnen“, sagte er mit einem freundlichen Lächeln zu ihr.
Damit ließ er sie stehen. Er wandte sich Mike zu, nickte ihm auffordernd zu und wies ihm mit der Hand den Weg zur Tür. Mike sah Anna an, nickte ihr zu und versuchte ein beruhigendes Lächeln. Dann schritt er, eskortiert von den beiden Polizisten, auf die Tür zu.
Woher verdammt noch mal weiß der Bursche, wann mein Flieger geht, ging Mike durch den Kopf, bis der ältere Polizist vor ihn trat und den Türgriff betätigte. Die Tür schwang halb auf. Der Polizist trat ein wenig zur Seite und machte eine auffordernde Geste. Mike atmete tief durch. Er trat über die Schwelle - und sah Tom Becker.
„Der Tom … .“ Ihm verschlug es für einen Moment die Sprache. „Dat jit et endoch jar net“, kam es erstaunt aus seinem Mund. Er starrte Tom an, der verschmitzt lächelte, während er auf ihn zukam. Er klopfte Mike zur Begrüßung auf die Schulter und hielt ihm die Hand hin.
Mike schüttelte sie, sichtlich erleichtert über die neue Entwicklung. „Du hast mich ganz schön erschreckt“, fiel ihm ein und er warf Tom einen tadelnden Blick zu. Da Tom direkt vor ihm stand, musste er dafür den Kopf in den Nacken legen.
Tom grinste kurz und wandte sich an die beiden Polizisten, die hinter Mike auf der Schwelle warteten. „Danke, Jungs“, sagte er in ihre Richtung.
Mike warf einen Blick über die Schulter und sah, wie der ältere Polizist die Tür von außen zuzog.
„Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Dich und Anna“, meldete sich Tom wieder.