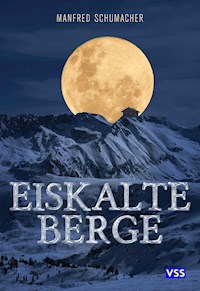5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Island, 2040: Aliens, die von anderen Aliens verfolgt werden, verschlägt es auf die Insel im Nordmeer. Einige Einheimische, denen sie ein besonderes Lebenselixier versprechen, verstecken sie. Deren Hilfe haben sie bitter nötig, weil ihnen nicht nur eindlich gesinnte Außerirdische an den Kragen wollen. Auch eine zusammengewürfelte Truppe amerikanischer „Weltraumpolizisten“, die sie einkassieren will, bevor es die internationale Konkurrenz tut, ist ihnen auf den Fersen. Aber sie erhalten auch unerwartet Hilfe - von zwei Menschen mit ganz speziellen Kräften. Die dreibändige Engelsjünger-Saga präsentiert in einzigartiger Weise Science Fiction, die nahezu ausschließlich auf der Erde stattfindet. Ein Epos, das eine neuartige E.T.-Story für Erwachsene entrollt mit Aliens, die nach Hause wollen und vor ihren Verfolgern auf der Hut sein müssen. Jeder Band der Engelsjünger-Saga ist in sich abgeschlossen und nahezu unabhängig von den anderen Bänden lesbar. Manfred Schumacher lebt in Rheinhessen, studierte Anglistik/Amerikanistik, Politik und Philosophie und promovierte über ein literaturwissenschaftliches Thema. Später leitete er eine PR-Agentur. Im vss-Verlag erschienen bereits von ihm der historische Roman Der Hurenwagen (2021), der Katastrophen-Thriller Eiskalte Berge (2022) sowie – in Zusammenarbeit mit seiner Tochter Eva Vanessa Nagel unter dem Pseudonym E.M. Schumacher - der 1. Band der dreibändigen Engelsjünger-Saga mit dem Titel Das Geheimnis der Wächter (ebenfalls 2022), sowie als alleiniger Autor mit dem Titel Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Kristall den zweiten Band der Saga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Ähnliche
Die Flucht nach Megoy Ta
Band 3 der Engelsjünger-Saga
Impressum
Die Engelsjünger-Saga
Band 3
Die Flucht nach Megoy Ta
Manfred Schumacher
Impressum
Impressum
Copyright: vss-verlag
Jahr: 2023
Lektorat/ Korrektorat: Peter Altvater
Covergestaltung: Sabrina Gleichmann
Verlagsportal: www.vss-verlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig.
VORWORT
In Island nahm alles vor Jahren seinen Anfang, nachdem ein Asteroid auf die Erde gekracht war. Ein paar Deutsche, die einen Flugzeugabsturz überlebten, fanden wenig später an einem abgelegenen See eine abgestürzte Rettungskapsel und darin tote Außerirdische. Durch die nachfolgenden Ereignisse eines Besseren belehrt, wurde ihnen bald klar, dass hinter dem Asteroidenaufprall mehr steckte. Andere wussten es auch. Die Wahrheit war, dass kein riesiger Gesteinsbrocken, sondern ein großes Raumschiff auf die Erde geschmettert war. Zur Wahrheit gehörte auch, dass die fremden Besucher, von denen die meisten wie Engel aus der Bibel aussahen, einen ganz besonderen Tauschhandel mit den Menschen im Sinn gehabt hatten.
Nicht alle Außerirdischen, die sich beim Anflug auf die Erde an Bord befanden, starben beim Aufprall. Zwei von ihnen, die es ebenfalls in einer Rettungskapsel vor dem Aufschlag aus dem Raumschiff schafften, überlebten. Sie versteckten sich und suchten, von einer Gruppe militärischer Weltraumwächter gejagt, nach einer Möglichkeit, von der Erde wegzukommen. Es gelang ihnen mit Hilfe einiger weniger Personen, die ihnen auf die eine oder andere Art halfen.
Jetzt, nach Jahren, werden diese Leute wieder in die Geschichte hineingezogen. Erneut tauchen plötzlich Alien-Schiffe am Rande unseres Sonnensystems auf. Das wirft sofort wichtige Fragen auf. Warum sind sie diesmal da? Und - sollten wir sie und ihre Technologie nicht einkassieren, bevor es die Konkurrenz tut? - Wieder einmal wird Island zum Schauplatz der Geschichte.
PROLOG
Zwölf Jahre zuvor
Notteri, Sardinien – 26. September, 2028
Der überschaubare Ort an der Südspitze Sardiniens versprühte an diesem Dienstagmorgen rein gar nichts von seinem mediterranen Charme, weswegen ihn Touristen fast rund ums Jahr aufsuchten. Das Wetter war trüb, der Himmel bedeckt und trist. Es nieselte stark und das Wasser in den Buchten ringsum war bleigrau und stumpf. Auch die Lagune, die sich abseits vom Strand bei Notteri am Südzipfel der Insel ausbreitete und ihr den Namen gab, Stagno di Notteri, lag dunkel hinter einem grauen Nebelschleier. Mariedda Sanna bemerkte es, als sie nach links aus dem Wagenfenster blickte. Sie schaute hinüber auf das Wasser, dessen Oberfläche sich im Regen kräuselte. Jenseits davon fiel ihr Blick auf die Kuppe an der Westspitze der Landzunge, wo sie die dunklen, schemenhaften Umrisse der alten Festung wahrnahm.
Sie sah wieder nach vorn, blickte auf den nassen Straßenbelag und lauschte dem quietschenden Geräusch der Scheibenwischer, die über die Frontscheibe kratzten. Sie reckte den Hals und suchte im Rückspiegel das verschlafene, blonde Gesicht ihrer Tochter auf der Rückbank. Mariella schien noch vor sich hin zu dösen. Mariedda löste ihren Blick von der Kleinen und ihre Augen wanderten im Spiegel hinüber zu Alessio, dessen von schwarzen Locken eingerahmtes Gesicht an der Seitenscheibe klebte. Er starrte gelangweilt auf die Lagune, die an ihm vorbeizog. Mariedda seufzte und sah wieder nach vorn auf die Straße.
Während sie den Bogen um die Lagune nahm, machte sie sich zum zigsten Mal Gedanken darüber, wie Mariella wohl im Instituto mit den anderen Kindern, ihren neuen Schulkameradinnen, zurechtkommen würde. Es war noch viel zu früh, etwas darüber zu sagen, gestand sie sich ein. Mariella war erst vor wenigen Tagen frisch eingeschult worden, und Mariedda hatte auf die Fragen, wie es denn in der Schule gewesen war, wenig aus ihr herausbekommen. Am nahen Wasser staksten ein paar einsame Flamingos herum, die der Regen nicht davon abhielt, in der seichten, brackigen Brühe der Lagune nach Nahrung zu stochern. Das lenkte Mariedda von ihren Gedanken ab. Sie setzte den Blinker nach links und bog auf die Via dei Ginepri. Vielleicht hätten sie doch vor Jahren in den Westen der Insel ziehen sollen, kam ihr plötzlich wieder in den Sinn. Sie strich sich eine dunkle Locke ihres langen Haars aus der Stirn, das ihr tief über den Rücken fiel. Es fröstelte sie auf einmal und sie zog sich die Strickjacke fester um die Schultern. Sie hatte sich die Frage seither öfter gestellt.
Sergio und sie hatten es sich damals überlegt, nachdem Sergios Vater gestorben war. Seine Mutter lebte seither allein in einem recht großen Haus und hätte sich gewiss darüber gefreut, wenn sie zu ihr nach Nebida gezogen wären, das ja auch Sergios frühere Heimat war. Sie hätten es vielleicht tun sollen, ging Mariedda durch den Kopf. Sie bog in die Via dei Giunchi ab. Vielleicht hätten sie es damals wirklich tun sollen. Das Leben in den Bergen des Südwestens verlief anonymer und einsamer als an der Südspitze mit Nachbarn ringsherum, die sich gern hinter vorgehaltener Hand über anderer Leute Dinge den Mund zerredeten. Über Mariella hatten sie es getan, sehr früh sogar. Hauptsächlich wegen ihres fremdartigen Aussehens. Jetzt mit sechs war sie im Vergleich zu Gleichaltrigen, auch den Jungs, lang wie eine Latte und hatte flachsblondes Haar. Schwerer fiel noch ein anderer Unterschied ins Gewicht. Die anderen Kinder hänselten sie wegen ihrer langen Finger. Es hatte im Kindergarten angefangen. Sie habe Finger wie eine Spinne, hatte sie ihr zu Hause traurig erzählt. Spinnenfinger würden sie sie nennen. Mariella Spinnenfinger. Habe ich wirklich viel zu lange Finger, Mama, hatte sie ängstlich gefragt. Mariedda hatte sie immer wieder beruhigt, aber die Hänseleien waren geblieben. Mariedda hoffte, dass es jetzt in der Grundschule besser würde. Dass sich ihre kleine Tochter in ihrer neuen Klasse wohlfühlen würde. Mariedda reckte erneut den Hals und warf im Rückspiegel einen kurzen Blick auf Mariella. Dann schaute sie wieder nach vorn, sah das vor wenigen Jahren neu erbaute Instituto Comprensivo von Villasimius vor sich und lenkte den weißen Fiat Punto in den Hof.
Sie steuerte den Wagen auf den Bedienstetenparkplatz links von dem grün und weiß gestrichenen Gebäude. Glücklicherweise wusste keiner von Mariellas Kräften, schoss es ihr durch den Kopf, als sie den Motor ausschaltete und die Wagentür öffnete. Der Heiligen Mutter Gottes sei Dank! Sie unterdrückte den Impuls, das Kreuzzeichen zu schlagen, und stieg aus. Alessio hatte die hintere Wagentür bereits aufgedrückt und war eifrig damit beschäftigt, sich die Riemen seines Schulranzens über die Schultern zu streifen. Er war noch mitten in der Bewegung, als er sich bereits zum Hof hin umdrehte und quer über den breiten Asphaltplatz auf den Eingang zueilte. Zwei gleichaltrige Jungen nahmen ihn in Empfang und die drei verschwanden im Gebäude. Nur Sergio und sie wussten von den Kräften, dachte Mariedda erneut, als sie den Blick von der breiten gläsernen Eingangstür abwandte. Der Gedanke erfüllte sie mit Erleichterung. Und Sergios Mutter, korrigierte sie sich. Ihre Schwiegermutter ebenfalls, weil Mariella sie vor zwei Jahren mit ihrem außergewöhnlichen Handauflegen von einem ekligen Bandscheibenleiden befreit hatte. Auch Alessio hatte es an dem Tag, als sie Mariella in der Bucht gefunden hatten, mitbekommen. Erstaunt dreingeschaut hatte er, als seine künftige kleine Schwester das lädierte Handgelenk seiner Mutter geheilt hatte. Aber er war noch zu klein gewesen, um es im Gedächtnis zu behalten. Er hatte es einfach vergessen und nie mehr danach gefragt. Mariedda strich sich ihren Rock glatt und umrundete den Punto. Sie öffnete die hintere Wagentür und warf Mariella einen auffordernden Blick zu. „Na, komm schon! Du wirst hier bestimmt viele Freundinnen finden, mein Schatz“, munterte sie ihre Tochter auf, während sie die Beifahrertür aufriss. Sie schnappte sich die geräumige Umhängetasche und klappte die Tür zu.
Mariella war schweigsam, während ihr Mariedda dabei half, die Riemen des bunten Scout-Ranzens über die Schultern zu bekommen. Lustlos arbeitete Mariella daran mit, und sie blieb schweigsam, bis sie die Treppe zum oberen Stockwerk betraten.
„Ella ist ganz nett“, sagte sie plötzlich, als sie den Treppenabsatz erreichten. Sie schaute zu ihrer Mutter hoch.
Mariedda hielt an. „Ist das die Kleine, neben der du sitzt?“, fragte sie mit ehrlicher Neugier. Andere Kinder, die meisten von ihnen älter als ihre Tochter, drängten sich an ihnen vorbei.
Mariella schüttelte den Kopf. „Das ist Lina. Die ist komisch.“ Sie verzog das Gesicht, um deutlich zu machen, was sie von ihr hielt.
„Lina?“, wiederholte Mariedda. „Lina Pilloni? Deren Vater hier unterrichtet.“ Mariedda sah ihre Tochter interessiert an.
Mariella zuckte mit den Schultern. „Weiß nicht.“ Damit setzte sie sich wieder in Bewegung.
Wenig später waren sie am Eingang von Mariellas Klasse angelangt. Die Zeiger der Uhr, von der es, groß und rund wie eine Bahnhofsuhr, in jedem Stockwerk eine gab, zeigten 7 Uhr 53. Kinder strömten durch den Flur und steuerten auf ihre Klassenzimmer zu. Mariedda strich ihrer Tochter zärtlich über das helle Haar. Rasch entzog sich Mariella ihrer Berührung, warf ihr einen letzten Blick zu und verschwand in das Zimmer. Auf der Treppe kam Mariedda Luisa Ricci entgegen. Sie war Mariellas Klassenlehrerin und noch jung, kaum fünfundzwanzig. Sie stammte vom Festland und war im zweiten Jahr an der Schule. Sie trug eine blaue verwaschene Jeansjacke über einem geblümten Kleid und hatte einen hellen, speckigen Lederrucksack auf dem Rücken, der mindestens genauso abgenutzt wie die Jeansjacke aussah.
„Ciao, Mariedda!“, begrüßte Luisa sie.
Mariedda erwiderte die Begrüßung. „Ich …“, begann sie.
„Die ersten Tage sind für sie alle schwer“, ersparte Luisa ihr den verlegenen Versuch, sich erklären zu wollen. Sie garnierte es mit einem wissenden Lächeln. Sie ruckte mit dem Kopf zur Seite, als sie einen Riemen des Rucksacks zurechtrückte, und im Halblicht des Treppenhauses glänzte ihr kurzgeschnittenes Haar wie schwarze Seide. „So viel Neues und Ungekanntes, das auf sie einströmt“, erklärte sie. „Die ersten Tage sind für alle nicht einfach. Aber das legt sich ganz schnell. Du wirst sehen.“
„Ja, sicher.“ Mariedda warf ihr einen dankbaren Blick zu. „Wir sehen uns.“
„Ja“, hörte sie in ihrem Rücken Luisas Antwort, als sich beide Frauen bereits wieder in entgegengesetzte Richtungen entfernten. Mariedda trat von der Treppe auf den Flur des unteren Stockwerks. Sie schritt durch den Flur, der frisch gewischt und noch feucht war. Unterwegs zum Sekretariat begegnete sie Lehrern und Schülern, die zu ihren Klassen und zum Lehrerzimmer eilten. Sie grüßte hier und da, öffnete die Tür zum Sekretariat und hatte den Geruch von frisch gekochtem Kaffee in der Nase. Sie wünschte Andria, die gerade ein Blatt sorgfältig auf die Glasplatte des Fotokopierers legte, einen guten Morgen. Im nächsten Moment beförderte sie die Umhängetasche in einen Spind, der sich neben einem der hohen Fenster befand. Sie ging zu einem Schreibtisch, der direkt hinter dem Tresen stand, und setzte sich auf den Stuhl davor. Sie saß kaum, da beugte sie sich auch schon nach vorn und startete den PC. Während der Rechner noch geräuschvoll hochfuhr, wechselte Mariedda einige Worte mit Andria, um dann die Kaffeemaschine anzusteuern.
Knapp zwei Stunden später rasselte die Pausenklingel deutlich vor der ersten großen Pause los. Mariedda und Andria sahen sich erstaunt an. Während sie noch rätselten, erlöste sie die Stimme von Direktorin Saba aus ihrer Ungewissheit.
„Alle Klassen versammeln sich zügig auf dem Schulhof. Folgt den Anweisungen eurer Lehrerinnen und Lehrer“, tönte eine unangenehm laute und etwas kratzige Frauenstimme aus dem Raumlautsprecher. „Wir haben das geübt. Macht es so, wie wir es geübt haben. Alle Klassen sofort auf den Schulhof. Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung.“ Die Stimme der Schulleiterin verstummte. Dafür waren jetzt auf dem Flur Geräusche zu hören. Stimmen ertönten, die durcheinanderredeten. Die Tür zum Lehrerzimmer öffnete sich und Maestra Saltini, eine der älteren Lehrerinnen, eilte herein. Sie schien erregt und verwirrt, stützte beide Ellbogen auf den Tresen und sah die beiden Frauen mit großen Augen an.
„Was ist denn los?“, wollte Andria sofort von ihr wissen.
„Die Comando Stazione der Carabinieri hat eben angerufen“, antwortete Signora Saltini hastig. „Alte Minen haben sich vom Meeresboden gelöst und treiben gerade auf die Mole vom Hafen zu.“ Ihre Augen waren jetzt noch größer, ganz so, als sähe sie bereits das Unheil, das allen drohte. „Sie befürchten, dass die an den Mauern im Wasser explodieren und Trümmer unsere Schule treffen“, brachte sie das Unheil im nächsten Moment auf den Punkt.
„Und was soll jetzt passieren?“, fragte Mariedda mit hochgezogenen Brauen. Sie hatte sich erhoben, spürte die Anspannung, die in ihr aufstieg. Alessio und Mariella waren ebenfalls im Gebäude und der Gedanke daran verursachte ihr eine Gänsehaut. Auch Andria hielt den Blick starr auf die Lehrerin gerichtet.
„Signora Saba meint, dass wir uns draußen sammeln und dann die Klassen geordnet die Lagune hoch bis zur Piazza begleiten“, erwiderte Signora Saltini. „Dort sollen wir erst mal bleiben, bis … .“ Weiter kam sie nicht. Vom Hafen her dröhnte eine gewaltige Explosion, die die Scheiben erzittern ließ. Es gab dumpfe Einschläge, Steine prasselten und irgendwo klirrten Scheiben. Nachdem sich die Frauen von ihrem ersten Schreck erholt hatten, stürmten sie an die Fenster und spähten neugierig hinaus. Der Schulhof war mit kleineren Betonbrocken übersäht, und im Straßenbelag vor dem Hof klaffte ein Loch so groß wie eine Wellness-Badewanne.
„Alle bleiben im Gebäude“, schrillte die sich überschlagende Stimme der Direktorin aus dem Lautsprecher. „Ich wiederhole. Alle bleiben im Gebäude.“ Signora Saba schnappte hörbar nach Luft. „Die Kolleginnen und Kollegen sorgen bitte unbedingt dafür“, erfüllte ihre hektische Stimme erneut den Raum. „Unbedingt!“ Dann: „Keiner verlässt das Schulgebäude!“
Die Frauen warteten. Doch der Lautsprecher blieb stumm. Die Sekretariatstür wurde aufgestoßen und Uccio Pilloni, der Klassenlehrer der 1A, stürzte herein und eilte an den Tresen. Die Brille saß ihm tief auf der schmalen Nase. Er fasste sie an beiden Bügelenden und rückte sie zurecht. Im nächsten Moment umklammerte er den Tresen, als schwankte der Boden unter ihm. Er beugte den Oberkörper nach vorn und blickte angespannt in die Runde. „Was geht denn da draußen ab?“ Sein fragender Blick hing auf dem Gesicht von Andria und wanderte dann zu der Lehrerin. „Ein Seebeben kann´s doch nicht sein. Das muss was anderes gewesen sein“, bastelte er sofort an seiner eigenen Erklärung. „Bei uns gibt´s überhaupt keine Vulkane. Weder im Wasser noch an Land.“ Er kniff die Lippen zusammen und sein Gesicht zeigte plötzlich einen fast trotzigen Ausdruck.
Signora Saltini, die sich anscheinend verpflichtet fühlte, ihm zu antworten, klärte ihn auf.
„Minen?“, stammelte er fassungslos. „Aber wie …?“ Er brach ab. Ihm fehlten die Worte. Er schüttelte den Kopf und breitete die Arme aus. „Minen?“, wiederholte er ungläubig.
„Ja, Minen“, bestätigte Mariedda ihm. „Die gibt es da draußen seit dem Zweiten Weltkrieg.“
Die anderen starrten sie neugierig an.
„Vor gut fünf Jahren hat die Marine doch schon mal Minen vor der Küste entdeckt“, klärte sie sie auf. „Das ging damals durch die Presse.“
Die Lehrerin nickte, während Uccio unwissend die Schultern hob und Andria fassungslos dreinschaute.
„Ich erinnere mich, jetzt wo Sie es erwähnen, Mariedda“, sagte Signora Saltini. „Die haben sie damals bei einer NATO-Übung entdeckt.“
Mariedda nickte zustimmend.
„Die wurden aber doch anschließend entschärft“, fuhr Signora Saltini fort.
„Anscheinend nicht alle“, entgegnete Uccio trocken. „Und eine davon hat womöglich eben die Kaimauer zerlegt.“ Sein Blick flog umher und blieb an Andria hängen. Dann stieß er ein „Buff!“ aus und machte mit den Händen eine Bewegung, die eine Explosion verdeutlichen sollte.
Während sich alle noch schweigend anstarrten, knackste es im Lautsprecher. Die Stimme der Direktorin meldete sich zurück, die diesmal weniger aufgeregt als vorher wirkte: „Alle begeben sich sofort hinüber in den Keller. Ich wiederhole. Alle begeben sich sofort in den Keller.“ Als sie den Satz nahezu identisch wiederholte, betonte sie das Wörtchen „sofort“ so, als hätte sie es an einer Tafel dreimal unterstrichen.
Uccio presste die Lippen zusammen und sah von Signora Saltini zu Mariedda. „Ich muss in meine Klasse. Ihr habt es gehört.“ Er schlug wie zum Abschied mit den Handflächen auf den Tresen, drehte um und eilte zur Tür. Er riss sie auf und Lärm schlug ihnen entgegen. Als er um die Ecke verschwand, kam auch Bewegung in die Frauen.
„Der Keller ist besser“, stieß Andria hervor, während sie sich auf die Armlehnen stützte und sich aus dem Stuhl hochstemmte. „Besser als hier im Gebäude oder mit ihnen unter freiem Himmel ins Dorf zu marschieren.“
Der Keller war wirklich besser, fuhr es Mariedda durch den Kopf. Sie dachte daran, welchen Schutz das alte, mächtige Gemäuer Alessio und Mariella, welchen Schutz es ihnen allen bot. Der Gedanke beruhigte sie ein wenig. Der Keller war der Rest einer alten Olivenmühle und befand sich hinter der Schule unter dem Kräutergarten. Mariedda war schon ein oder zwei Mal dort gewesen und hatte deshalb eine grobe Vorstellung von dem, was sie und die Kinder unten erwartete. Ein Tunnel, aus schweren Granitsteinen gemauert, verband die Kellerräume des Instituto mit dem Gewölbekeller der alten Olivenmühle. Aus irgendeinem Grund hatten sie den Gang damals beim Bau der Schule nicht zerstört. Ein glücklicher Umstand, der ihnen jetzt zugutekam.
„Kommst du?“ Andria stand im Türrahmen und warf Mariedda einen auffordernden Blick zu.
„Gleich!“, gab Mariedda mit gepresster Stimme zurück. Sie gab ihrem Stuhl einen Schubs, dass er gegen den Schreibtisch polterte, eilte zu dem hohen schmalen Spind und schnappte sich ihre Umhängetasche. Sie warf sich den Tragegurt über die Schulter und dachte an das Obst und das belegte Fladenbrot, das sie sich morgens für die Arbeit eingepackt hatte. Die Kinder und sie bekämen dort unten vielleicht Hunger, weil es womöglich länger dauerte, bis sie Entwarnung gaben. Mit diesem Gedanken hastete sie aus dem Sekretariat. Die Geräuschkulisse im Flur war gewaltig. Erwachsene riefen Anweisungen und Kinder eilten hinter oder vor ihnen her in Richtung der Treppen. Manche nörgelten, viele drängelten und alle folgten dem Strom aus Leibern wie eine Herde ängstlicher blökender Lämmer. Mariedda schaute sich nach allen Seiten um, konnte jedoch in dem Pulk, in dem sie sich voran schob, nirgends Alessio oder Mariella entdecken. Auch von Andria war nichts mehr zu sehen.
„Haltet euch am Geländer fest, wenn ihr runtergeht!“, ertönte vorne an der Treppe eine Frauenstimme. Mariedda entdeckte Andria und winkte ihr zu, als Andria sich umdrehte und in ihre Richtung schaute. Andria winkte kurz zurück, wandte sich um und war im nächsten Augenblick im Gewühl aus Köpfen und Schultern verschwunden. Auch Mariedda stoppte und drehte sich um. Ihr suchender Blick huschte durch den Korridor. Doch sie erspähte weder Mariella noch Alessio. Enttäuscht folgte sie dem Strom der Schutzsuchenden.
„Die Größeren drängeln nicht!“, hallte dieselbe Stimme wie vorhin von der Treppe herüber. „Nehmt Rücksicht auf die Kleineren unter euch!“
Die Treppe, die es hinunterging, war alt und aus Stein. Die Stufen waren abgetreten und glatt. Unten angekommen, hasteten sie an wandhoch gestapelten Tischen und Stühlen vorbei. Nach wenigen Metern zeichnete sich der breite Bogeneingang der Tunnelmündung ab, wo es hinüber zum alten Gewölbekeller ging. Mariedda fröstelte in der kühlen Kellerluft und Neonleuchten, die den Tunnel in ein kaltes Licht tauchten, verstärkten die Empfindung noch. Der Gang, dem sie folgten, war recht breit, die Decke hoch, aber das Granitsteinmauerwerk wirkte dennoch beengend. Die Stimmen der Kinder hallten laut von den Wänden wider und das Geräusch veränderte sich, als sie endlich den riesigen Gewölbekeller erreichten. Auch hier hingen Neonleuchten an der hohen Decke und tauchten den großen hohen Raum in ein künstliches Licht.
Die Kinder drängten sich bereits in Grüppchen zusammen. Links erteilten zwei Lehrerinnen inmitten eines ganzen Pulks von Kindern Anweisungen. Eine davon war die mollige Signora Brandi mit dem Herzgesicht. Sie gestikulierte wild und war von Schülerinnen und Schülern umringt. Mariedda erkannte einige von ihnen. Sie gehörten zur Klasse ihres Mannes, den Signora Brandi heute wohl vertrat.
„Wir stellen uns nach Klassen auf!“, schrillte von irgendwoher die Stimme der Direktorin, die das laute Stimmengewirr, das durch den Keller hallte, zu übertönen versuchte. „Sind alle da?“, kreischte sie erneut aus Leibeskräften. „Abzählen!“, schallte ihre aufgeregte Anweisung durch den Raum.
„Abzählen! … Abzählen!“, wiederholten andere Stimmen, wahrscheinlich die der Klassenlehrer.
„Eins … zwei … drei …“, meldeten sich Kinderstimmen, und aus einer anderen Kellerecke klang es „Eins … zwei … drei …“ zurück, als sei es ein Echo. Mariedda ließ ihren Blick schweifen. Etwas weiter hinten entdeckte sie Uccio mit seiner 1A. Rechts, fast in der Kellerecke, erspähte sie den lockigen Haarschopf ihres Sohnes. Er unterhielt sich gestikulierend mit zwei Jungen. Er brauchte sie jetzt nicht, entschied Mariedda. Wahrscheinlich war das, was gerade passierte, für ihn und seine Kumpel ein Riesenspaß. Sie ließ ihren Blick erneut durch den Keller wandern, bis sie vorne links, am äußeren Ende des mächtigen Gewölbes, die blassblaue Jeansjacke und den schwarzen Bubikopf von Luisa Ricci entdeckte. Eine Sekunde später hatte sie auch Mariellas flachsgelben Haarschopf ausgemacht, der sich deutlich von der dunklen Haarfarbe ihrer Klassenkameradinnen und -kameraden abhob. An verschiedenen Stellen wurde immer noch abgezählt.
Mariedda drängte sich durch das Gewimmel der Kinder und deren aufgeregtes Geschnatter zu ihnen durch. Sie nickte Luisa zu, die ihr Kommen bemerkte. Dann trat sie zu ihrer Tochter und drückte sie, was die Kleine hastig und etwas verlegen abwehrte.
„Mama!“, stöhnte sie genervt und sah Mariedda missbilligend an, während sie sich von ihr löste.
Mariedda stand sekundenlang schweigend und reglos neben Mariella, umgeben von anderen Kindern, von denen einigen die Angst in den Augen stand. „Du musst dich nicht fürchten, Schatz“, sagte sie, während sie sich zu ihrer Tochter runterbeugte.
„Das tu´ ich nicht“, entgegnete Mariella ruhig. Sie sah ihrer Mutter fest in die Augen, bis die sich wieder aufrichtete.
Mariedda tastete nach Mariellas Hand und fand sie. Sie drückte sie, hielt sie fest, und Mariella ließ sie gewähren.
„Ihr braucht keine Angst zu haben“, beruhigte jetzt auch Luisa ihre Klasse. „Wir sind hier sicher.“
Wenn Sergio bloß da wäre, dachte Mariedda. Aber ausgerechnet heute war er auf einer Fortbildung in Cagliari. Sie blickte auf den Boden und bemerkte erst jetzt, zwei Meter von ihren Füßen entfernt, das runde Metallgitter. Darunter klaffte ein Loch im Boden, groß wie ein altes Speichenrad. Es bedeckte, solange Mariedda sich erinnern konnte, den ehemaligen Brunnenschacht.
Sie hatten die Brunnenmauer, nachdem der Brunnen bereits im vorletzten Jahrhundert dauerhaft ausgetrocknet war, beim Bau des Fundaments für die Olivenmühle entfernt. Nur über ihnen in der gewölbten Decke hatte man aus unerfindlichen Gründen die ursprüngliche Brunnenöffnung mit Resten der ehemaligen Mauer belassen. Oben in dem von den Schülern versorgten Kräutergarten ragte die Rundmauer der ehemaligen Wasserversorgung wie ein schmucker Zierbrunnen einen knappen Meter in die Höhe. Als Abdeckung diente heute ein alter zentnerschwerer Mahlstein der ehemaligen Mühle.
Auf dem starken Gitter, das den Schacht bedeckte, tummelte sich eine kleine Gruppe Kinder. Zwei von ihnen, Mädchen aus Mariellas Klasse, deren Namen Mariedda kannte, tuschelten miteinander und schauten ängstlich nach unten.
„Das Gitter ist aus dickem Eisen, Giuanna“, beruhigte Mariedda die Kleine, die ihr am nächsten stand. „Da passiert euch nichts.“
„Keiner bricht ein, Kinder“, beteiligte sich Luisa, die Marieddas Worte mitbekommen hatte. „Stochert aber nicht mit den Füßen in den Gitterritzen herum, hört ihr!“
Mariedda wandte den Blick von der Gruppe ab und drehte sich zur Seite. Sie blickte auf ihre Tochter hinunter, die reglos und scheinbar gleichgültig neben ihr wartete. Sie spürte ihre kleine warme Hand in ihrer, atmete tief durch und roch den modrigen Geruch von Erde und altem Gemäuer. Dann legte sie den Kopf in den Nacken und sah nach oben. Schräg über ihr drang durch einen kleinen Spalt zwischen Mahlstein und Brunnenrand ein wenig Tageslicht in das Gewölbe. Sie glaubte, die frische Seeluft zu riechen, die durch den Spalt hereinströmte, tat es aber im nächsten Augenblick als bloße Einbildung ab. Sekunden später entdeckte sie irgendwo rechts Andria, die sich inmitten einer Traube lärmender, wuselnder Kinder befand. Sie unterhielt sich mit Signora Saltini, die es anscheinend aufgegeben hatte, ihre Klasse zu beruhigen. Mariedda winkte Andria zu und sie winkte zurück.
„Alles gut?“, fragte Mariedda, während sie sich ein wenig zu ihrer Tochter hinunterbeugte.
Mariella nickte stumm zu ihr hoch.
Sie warteten. Warteten auf das Schellen der Schulklingel, die hoffentlich bald Entwarnung gab, und irgendwann warteten sie auf die Busse, die alle aus dem Gefahrenbereich wegbringen sollten. Auf die Busse warteten sie, nachdem die kleine Direktorin plötzlich auf zwei alten, übereinandergestapelten Paletten gestanden und die anstehende Evakuierung bekanntgegeben hatte. Während sie warteten, hörten sie gedämpft eine entfernte Sirene. Dann war es wieder still, doch die Stille wurde gleich darauf wieder gestört. Ein dumpfes Dröhnen wie von einer nicht allzu weit entfernten Explosion war zu hören. Als alle noch erstaunt lauschten und aufgeregt untereinander tuschelten, krachte es direkt über ihnen fürchterlich. Alle Blicke flogen hinauf, Stimmen kreischten und Kinder zeigten mit den Fingern nach oben.
Mariedda glaubte, ihr Herz setze aus, als sie sah, wie sich die Decke bewegte. Sie brach auf und dichter Rauch drang durch den sich öffnenden Spalt nach unten. Im nächsten Moment, als sich der rauchige Nebel etwas lichtete, trudelte ihnen allen etwas Dunkles, Massives entgegen. Der Mahlstein, durchfuhr es Mariedda im nächsten Augenblick und die Erkenntnis ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. „Weg!“, kreischte sie wie von Sinnen. „Weg!“ Einige Bruchteile einer Sekunde starrte sie dem fallenden Stein entgegen, dann sprang sie hastig zur Seite, wollte Mariella aus der Gefahrenzone stoßen. Doch Mariella war nicht mehr da. Mariedda hielt nicht mehr ihre Hand, sah sie nicht mehr am vermuteten Platz.
Sie entdeckte sie, als sie blitzschnell herumfuhr. Starr vor Schock, realisierte sie, dass ihre Tochter fast auf dem Gitter stand, sich unmittelbar unter dem herabstürzenden Mahlstein befand. – Doch der Stein stürzte nicht mehr. Er schien in der Luft zu schweben, wie von unsichtbaren Seilen gehalten, die von oben plötzlich seinen Sturz verhinderten. Mit offenem Mund und aufgerissenen Augen sah Mariedda, dass ihre Tochter die Arme hochgestreckt hatte und sie dem jetzt in der Luft ruhenden Koloss entgegenhielt. Wie eine Schlangenbeschwörerin schien sie unsinnigerweise auf ihn einwirken zu wollen.
„Weg!“, brüllte jetzt auch Luisa Ricci ganz in der Nähe, so laut sie konnte.
In die Kinderschar, die wie erstarrt und reglos unter dem Mahlstein verharrte, der sie jederzeit zu zerschmettern drohte, kam plötzlich Bewegung. Mädchen und Jungen stürmten und hasteten, von spitzen Schreckenslauten untermalt, in Richtung des Tunnels, pressten sich dort mit den anderen an die Kellerwände. Die Kinder, die auf dem Gitter gestanden hatten, stoben davon weg. Eines der Kinder rammte Mariedda, dass sie nach hinten taumelte. Aus den Augenwinkeln entdeckte sie die immer noch erhobenen Arme ihrer Tochter. Mariella befand sich nach wie vor als Einzige an ihrem vorherigen Platz. Mariedda sah, oder glaubte zu sehen, dass die Kleine beide Hände ruckartig nach vorn stieß. Im selben Moment beschrieb der Mahlstein einen leichten Bogen und knallte mit ohrenbetäubendem Schlag auf den Boden. Sein Aufprall an der gerade erst geräumten Stelle ließ das Mauerwerk erbeben. Staub wirbelte auf, drang in Münder und Nasen und ließ viele husten und spucken.
Zögernd und ungläubig lösten sich die Kinder von den Wänden, an die sie sich vorher gedrückt hatten. Hatte zuvor Angst in ihren Augen gestanden, so machten sich jetzt Unverständnis und Neugier darin breit. Einige besonders Wagemutige wagten sich dicht heran und besahen sich den Stein, der unter der Wucht seines eigenen Gewichts in zwei Teile zerbrochen war. Kleinere Gesteinsbrocken waren mit heruntergekommen und lagen verstreut um die beiden Hälften herum. Oben in der kuppelartigen Decke gähnte ein großes Loch, durch das das Licht einfiel. Es regnete immer noch leicht und Regentropfen rieselten in den Keller herab. Mariella war längst wieder bei ihrer Mutter, hatte nach ihrer Hand gegriffen und drückte sich jetzt eng an sie.
„Mir ist komisch, Mama“, sagte sie, als Mariedda, immer noch verwirrt, zu ihrer Tochter herunterschaute. Mariedda nicke abwesend. Sie strich ihr über das helle Haar und zog sie an sich.
„Mariella hat die Zeit angehalten“, rief eines der Kinder, die um sie herumstanden. Es war ein Mädchen, und es zeigte mit dem Finger auf Mariella. „Ich hab´s gesehen“, schickte die Kleine hinterher und schaute triumphierend zu ihrer Klassenlehrerin. „Dann hat sie sie wieder losgelassen und der Stein plumpste da hin.“ Ihr Finger wanderte augenblicklich zu den Trümmern des ehemaligen Mahlsteins.
„Nein, das hat sie nicht“, entgegnete Mariedda bestimmt.
Luisa sah erst Mariedda und dann Mariella an.
„Ich hab´s auch gesehen“, meldete sich ein Junge. Er sah die junge Lehrerin aufgeregt an. „Sie hat ihn angehalten und dann auf den freien Platz geschleudert.“ Er schlenkerte die Hände in die Luft, um den Flug des Steins zu verdeutlichen.
Luisa zuckte mit den Schultern. „Ich habe nichts mitbekommen.“ Sie lächelte gewinnend. „Ich habe Emilio und Elene mit nach hinten gezogen und bin über irgendwelche Füße gestolpert.“ Ihr Blick flog in Richtung eines Mädchens, das ihr bestätigend zunickte. „Als ich wieder auf den Beinen stand … .“ Sie brach ab, machte eine Geste, die wie eine Entschuldigung aussah. „Nun, ja.“ Wieder ein Schulterzucken. „Außerdem … was erzählt ihr denn da für einen Unsinn?“ Sie lächelte Mariedda bedeutungsvoll zu, und Mariedda lächelte zaghaft zurück.
Kapitel 1
Cagliari, Sardinien – 18. März, 2040
Die blonde junge Frau um die zwanzig steuerte mit umgebundener Servierschürze und einem Tablett auf einen Tisch zu. Daran saß ein älterer Herr mit Brille und zurückgekämmtem, weißem Haar. Die Krücke des schwarzen Gehstocks hatte er gegen den Tisch gelehnt. Die Serviererin ließ den Blick schweifen, während sie auf ihn zuhielt. Er flog über einige der um diese Zeit noch mäßig besetzten Tische und glitt hinaus auf die belebte Straße. Auf der Via Roma, auf die sie durch die schmale Fensterfront des Cafés schaute, herrschte das um diese Tageszeit übliche Treiben. Ihr Blick folgte einen Moment lang Passanten, einige von ihnen bereits um diese Jahreszeit Touristen, die durch die langen Arkaden flanierten.
Gegenüber in einem kleinen Park an der Piazza Giacomo Matteotti sah sie ältere Männer, in Gespräche vertieft, auf Bänken sitzen. Vom Hafen wehte der salzige Geruch von Meerwasser herüber und drang durch die angelehnte Tür und die gekippten Fenster ins Innere. Die blutrote Markise, die draußen über der Terrasse hing, flatterte leicht im Wind, der auch die Blätter der hohen Palmen entlang der Via Roma sanft schüttelte. Die Serviererin wandte den Blick ab und sah wieder nach vorn. Der ältere Gast erwartete sie bereits. Die Blonde setzte das Tablett auf dem Tisch ab und stellte das Gedeck mit Caffė und einem Cornetto mit geübtem Lächeln vor ihm ab. Der Mann bedankte sich. Während er sich seinem Hörnchen zuwandte, suchte der Blick der Serviererin ihre Kollegin. Sie entdeckte sie am Besteckkasten, in den sie eine Handvoll Gabeln einsortierte. Sie hielt auf sie zu.
„Übernimmst du für mich?“, fragte sie, als sie die etwa gleichaltrige Frau erreichte. „Ich habe nachher ein Vorstellungsgespräch.“
„Klar. Emilio sagte vorhin schon so was.“
„Er weiß Bescheid“, sagte die Blonde. „Danke, Elene!“, fügte sie hinzu, während sie das Haargummi, das ihren Pferdeschwanz zusammenhielt, löste. Elene lächelte und nickte. Dann entschwand sie in Richtung Kuchentheke. Die Blonde, deren glattes Haar jetzt, als es ihr locker auf die Schulter fiel, wie reifer Flachs glänzte, band sich die dunkelrote Servierschürze ab. Sie legte sie einigermaßen ordentlich zusammen und verstaute sie in einem Fach unterhalb des Besteckkastens. Dann eilte sie in einen kleinen Nebenraum, griff sich aus einem Schrank, der schmal und dünn wie eine Pappschachtel war, einen dunkelgrünen Blouson. Sie streifte ihn sich über und fuhr sich vor dem kleinen, zerkratzten Spiegel, der an der Innenseite der Tür hing, mit den Fingern durchs Haar. Danach verließ sie das kleine Eckcafé, überquerte die Straße und bog, nachdem sie gut fünfzig Meter nach links gelaufen war, in eine Seitenstraße ein.
Von weitem schon sah sie das hohe Gebäude. Als sie es erreichte, ließ sie ihren Blick über die Fassade wandern. Über der ebenerdigen Etage, die fast nur aus getöntem Glas bestand, prangte in breiten, grünen Plastiklettern der Schriftzug „Banco di Sardegna“. Darüber Stockwerke mit unzähligen Fenstern, schmal und hoch. Sie waren genauso getönt wie der Eingangs- und Filialbereich im unteren Stock. Die junge Frau nahm den Nebeneingang, wie es in der Einladung gestanden hatte. Sie schritt durch einen mit gelblichem Marmor gefliesten Flur und fand einen Aufzug. „Amministrazione BDS“ stand neben dem Knopf für die fünfte Etage. Sie drückte und die Kabine surrte hoch. Sie gelangte auf einen ebenfalls gelblich gefliesten Flur und klingelte an einer hohen, doppelflügligen Glastür, auf die im Logogrün der Bank „Amministrazione“ draufgepinselt war. Der Summer ertönte und der rechte Türflügel sprang auf. Die Flachsblonde drückte ihn ganz auf und trat ein.
Das erste Zimmer links war die Anmeldung und sie ging hinein. Zum Vorstellungsgespräch müsse sie den Flur ganz durch, dann oben links und in der kleinen Lounge warten, beschied ihr eine ältere Dame, deren Brille an einer dünnen Kette vor ihrer Brust baumelte. Die Blonde begab sich dorthin und traf auf zwei junge Frauen in etwa ihrem Alter. Sie begrüßten sich flüchtig. Die eine hatte schwarze Locken und war schlank wie die Blonde, wenn auch bei weitem nicht so hoch aufgeschossen wie sie. Die andere war klein und dick wie ein Fass. Die Blonde war kaum da, da wurden die drei von einer Frau im Hosenanzug aufgefordert mitzukommen. Sie folgten ihr und landeten im Büro eines fast glatzköpfigen Mannes mit wuchtigem Gesicht. Er stellte sich als Signor Bertuccio aus der Personalabteilung vor und schritt von einer zur anderen, um sie per Handschlag zu begrüßen.
Die Mollige stellte sich vor. Der Lockenkopf stellte sich ebenfalls vor. „Mariella Sanna“, sagte die Blonde als Letzte, als er schließlich vor ihr stand, ihr die Hand entgegenstreckte und ihr erwartungsvoll ins Gesicht schaute. Er bat sie alle, Platz zu nehmen, und fuhr sich wiederholt über seinen struppigen Schnauzer, während er seine Einführung gab. Bevor es an die schriftlichen Tests ginge, sollten sie einen kurzen Einblick in den Alltag bei einer Bank bekommen, führte er als Nächstes aus. Das „Hands-on-Geschäft“, wie er großspurig tönte. Dazu bat er sie hinunter in die Filiale. Sie rauschten alle vier mit dem Aufzug nach unten.
„Unsere heutigen Kandidatinnen für die Azubi-Stellen“, stellte er die drei mit einer fahrigen Handbewegung der Filialleiterin vor, die er zuerst aufsuchte. Gemeinsam mit ihr, einer fülligen Mitvierzigerin mit üppigem Busen und zu hohen Absätzen, spazierten sie einige Stationen ab, begleitet von eingeübten Erklärungen des Personalmenschen zum jeweiligen Aufgabengebiet. Sie waren längst im Kassenbereich angelangt und hatten sich erneut einen langatmigen Vortrag von Signor Bertuccio angehört, als mit einem Mal ein ohrenbetäubender Knall ertönte. Das ganze Gebäude schien zu erzittern, Scheiben zerbarsten und dicke, weißgraue Rauchschwaden quollen durch die zerbrochenen Fenster. Die Leute im Schalterraum riss es von den Beinen. Schmerzensschreie waren zu hören.
„Im Keller brennt´s“, rief von irgendwoher eine aufgeregte Stimme. „Ruft die Feuerwehr“, eine andere. Eine Alarmsirene schrillte los. Signor Bertuccio rappelte sich auf, sein Gesicht voller Staub und Dreck. Alle Gesichter waren voller Staub. Auch die Haare und die gesamte Kleidung waren mit Staub überzogen. Eine junge Frau rieb sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Ellbogen. Ein älterer Mann richtete sich benommen auf. Er hatte eine breite Risswunde über der Stirn.
„Wir müssen raus“, besann sich die Filialleiterin, nachdem sie wieder torkelnd auf ihren Pfennigabsätzen stand. „Alles auf die Straße!“
„Was war das bloß?“, fragte eine krächzende Stimme.
„Bestimmt die Gasleitung“, rief eine andere. Die dazugehörige Frau taumelte durch den Rauchnebel auf den Ausgang zu.
Der Personaler suchte den Blick der Filialleiterin. Als sich ihre Blicke trafen, nickte er. „Hinter dem Haus buddeln sie seit gestern mit einem Bagger rum“, schob er hinterher. „Vielleicht hat der die Leitung erwischt.“ Er tat einen Schritt auf sie zu. „Kommen Sie!“, forderte er sie auf. „Die Feuerwehr sollte gleich da sein.“
Auch Mariella war wieder auf den Beinen. Sie fuhr sich durch das Haar, strich Staub und abgeblätterte Farbe daraus und bürstete mit der Hand über ihren Blouson. Sie half der molligen Mitbewerberin hoch, die sie mit geweiteten Augen ansah, hustete und keuchte. Mariella wollte mit ihr zum Ausgang, als sie hinter sich in einem der rückwärtigen Räume ein Geräusch hörte. Während sie noch lauschte, drangen von dort erneut Geräusche herüber. Jemand stöhnte vor Schmerz.
„Bring du sie raus!“, wies sie die andere Mitbewerberin an und übergab ihr die Mollige. Mariella eilte dorthin, von wo das Stöhnen gekommen war. Der Raum war total verwüstet. Im Boden und in der Wand klafften breite Löcher. Durch sie quoll Rauch herein, von dem ein Großteil durch zwei völlig zerborstene Fenster entwich, an denen bereits Feuer hochzüngelte. In der Ecke saß eine Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht vor einem hohen, grünen Blechschrank an der Wand. Ihr dunkles, silbersträhniges Haar hing ihr wirr in der Stirn. Ihr Atem ging stoßweise und aus einem Mundwinkel rann Blut. Ein fingerdicker, rostiger Eisenstab ragte schräg aus ihrem Bauch, das Ende krumm und mit Betonbrocken daran. Mariella beugte sich über die Frau. Als sie hinter ihren Rücken schielte, durchfuhr sie ein eisiger Schauer. Der Eisenstab war am Rücken der Frau ausgetreten und hing anscheinend tief im Blech des Schranks.
Mariella überlegte krampfhaft. „Ich muss leider versuchen, den Stab aus Ihnen rauszubekommen“, sagte sie entschlossen, wobei sie in das ängstliche Gesicht der Frau schaute.
Die Frau stöhnte, sagte aber nichts.
„Haben Sie das verstanden?“, fragte Mariella.
Die Frau stöhnte erneut und nickte.
„Ich mache das jetzt, okay?“ Fragend blickte Mariella auf das angestrengte Gesicht der Frau hinunter.
Die Verletzte antwortete nicht.
„Wie heißen Sie?“
„Ell … Ella“, stieß die Frau stöhnend hervor.
„Ich muss das Eisen rausziehen, Ella“, sagte Mariella fast flehentlich. „Der Rauch bringt Sie um, und außerdem ist da das Feuer.“
Die Frau nickte.
„Jetzt?“
Wieder nickte die Frau und verzog in Erwartung der bevorstehenden Schmerzen das Gesicht. Mariella umfasste den Stab an der Stelle, wo die Betonreste daran hafteten. Im nächsten Moment zog sie mit aller Gewalt und der Kraft, die ihr von Natur aus zur Verfügung stand. Ella stieß einen markerschütternden Schrei aus, doch Mariella zog weiter, konzentrierte sich auf den vermaledeiten Stab, der unbedingt aus der Schwerverletzten herausmusste. Während die unglückliche Ella weiter schrie, registrierte Mariella mit großer Erleichterung, wie das Blech hinter Ellas Rücken das Eisen mit knirschendem Geräusch freigab. Der Stab glitt blutig aus dem Bauch der Frau heraus. Sie sackte in sich zusammen, das Schreien hörte abrupt auf. Sie war ohnmächtig geworden.
„Scheiße!“, zischte Mariella, fing sie auf und ließ sie vorsichtig zu Boden gleiten. „Scheiße, scheiße, scheiße!“ Hastig blickte sie nach allen Seiten. Es war niemand zu sehen. Rasch beugte sie sich über die leblose Frau, legte ihr die Hände übereinander auf die klaffende Wunde, aus der das Blut hervorquoll. Sie drückte aber nicht so, als wollte sie die Wunde abdrücken. Ihre Hände schienen eher leicht auf der verletzten Stelle aufzuliegen, während Mariella konzentriert, als hätte sie alles um sich herum vergessen, auf ihre Handrücken starrte. Darunter wurde es plötzlich hell. Die Helligkeit wurde zu einem gleißenden Licht, dass sich wie ein Tintenfleck auf Löschpapier auf dem Bauch der Bewusstlosen ausbreitete. Der ganze Vorgang dauerte nicht mehr als ein paar Sekunden. Die Frau erbebte, atmete stotternd aus. Dann ging ihr Atem gleichmäßig. Sie schlief.
Mariella schob ihre Hände unter sie und wuchtete sie hoch. Als sie sich keuchend mit ihrer Last umdrehte, vernahm sie ein Geräusch, das aus der Richtung eines kopfüber liegenden Schreibtischs kam. Eine Frau um die fünfzig mit schwarzen Haaren stemmte sich hinter der Tischplatte hoch. Ein Ärmel ihrer pfirsichfarbenen Bluse war blutig. Sie schaute Mariella mit großen Augen an.
„Alles gut?“
Die Frau nickte, wischte sich Staub und Tränen aus dem Gesicht.
Auch Mariellas Augen tränten. „Der Rauch“, krächzte sie. „Wir müssen schleunigst raus.“
Die Frau nickte verstört.
„Helfen Sie mir!“, forderte Mariella sie auf. „Sie die Beine und ich den Rest.“ Sie wies mit dem Kinn auf die halb bewusstlose Frau, die sie in den Armen hielt. Zu zweit schafften sie es mit ihr hinaus und wurden dort von dem Personaler und der Filialleiterin in Empfang genommen. Sirenen waren zu hören und Blaulicht näherte sich vom Hafen hoch. Viele der Leute, die vor ihnen aus der Bank geeilt waren, hockten in einer Seitenstraße auf Stühlen und Bänken vor einem Stehcafé. Zwei Personen lagen auf Decken auf dem Boden. Mariella und ihre Begleiter steuerten dorthin.
„Wir brauchen noch Decken für die Frau hier“, schnaubte der Personaler keuchend, obwohl er nur sein eigenes Gewicht zu tragen gehabt hatte. Eine ältere Frau brachte eine Bankauflage, auf die Mariella und ihre Begleiterin die noch immer benommene Frau vorsichtig betteten.
„Hat jemand ein bisschen Wasser für mich?“, fragte Mariella in die Runde, nachdem sie sich aufgerichtet hatte. Wie zum Beweis streckte sie ihnen ihre blutigen Hände entgegen. Ein junger Mann reichte ihr eine angebrochene Mineralwasserflasche.
„Schütten Sie ein bisschen drüber!“, bat sie ihn und formte mit den Handflächen eine Schale. Er schüttete Wasser hinein, bis sie sich bedankte und die Hände wegzog. Sie rieb die Handflächen aneinander und beobachtete einen Moment lang, wie das rötlich gefärbte Wasser zwischen ihren Fingern hindurch auf das graue Bordsteinpflaster rann. Mariellas Blick glitt zu der Frau auf der Bankauflage hinüber, als die sich bemerkbar machte. Sie war aufgewacht. Sie stöhnte leicht, sah sich verwirrt um.
„Was ist passiert?“ Sie atmete schneller. „Mein Bauch … die Stange.“ Sie tastete ihren Bauch ab, schüttelte verwundert den Kopf. Mariella stand hastig auf und ging eilig davon.
„Aber Sie müssen bleiben“, rief ihr der Personaler nach. „Wegen der Aussage. Die Polizei will sicher gleich unsere Aussagen.“
„Ich … ich muss mal was trinken“, rief Mariella ihm über die Schulter zu. „Ich bin gleich … .“
„Aber das gibt es doch hier“, unterbrach er sie.
„Ja, klar. Aber ich … ich komme wieder.“ Sie ging weiter. Als sie eben um eine Ecke biegen wollte, spürte sie eine Hand an ihrem Arm. Erschrocken fuhr sie herum. Es war die schwarzhaarige Frau aus dem verwüsteten Raum.
„Was wollen Sie von mir?“, fragte Mariella eisig, während sie sie verwirrt und ein wenig ängstlich ansah.
„Keine Angst“, beruhigte die Frau sie. „Aber … ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe gesehen, was Sie da drin gemacht haben.“
„Sie … ha! Was wollen Sie denn gesehen haben?“, stieß Mariella eilig hervor.
„Das Handauflegen, das Licht, und dass es ihr wieder besser geht.“
Mariella fühlte, wie Panik in ihr aufstieg. „Lassen Sie mich in Ruhe!“, entgegnete sie barsch. „Das fantasieren Sie nur. Die ganze Aufregung und der Schreck, das ist es.“ Sie bemühte sich um ein abfälliges Lächeln.
Die Frau schüttelte den Kopf, lächelte ebenfalls. „Ich kenne das, hab´ das schon mal erlebt.“ Sie sah Mariella mit schwerem Blick an. „Mein Bruder ist wie Sie. Er kann das auch.“
Mariella starrte sie erstaunt an.
„Ja, wirklich“, beteuerte die Frau. „Er hat vor vielen Jahren unsere alte Tante gesund gemacht, als er zu Besuch war. Der Arzt hatte sie schon aufgegeben, schlimme Lungenentzündung, wissen Sie. Und ins Hospital wollte sie nicht mehr.“ Sie stockte einen Moment, sah Mariella bedeutungsvoll an. „Er hat ihr die Hände aufgelegt, und da war auch das Licht, und danach ging es ihr besser.“ Ihre Augen strahlten, während sie erzählte, und sie hob und senkte die Hände, als prüfe sie das Gewicht der Luft. „Vorher war sie todkrank“, fuhr sie fort, „und danach stand sie wieder auf, und es war, als hätte sie nicht wochenlang mit dem Tod gerungen.“ Sie machte wieder eine kurze Pause. „Ich habe es zufällig gesehen, weil ich draußen im Garten war, und da hab´ ich es durchs Fenster gesehen.“
„Er kann so was auch?“, krächzte Mariella verblüfft.
„Ja. … Ich hab´ ihn danach gefragt, gesagt, dass ich es beobachtet hatte, und er hat mir gebeichtet, dass er es schon paarmal gemacht hat.“ Der Blick der Frau lag schwer wie Blei auf Mariella. „Er ist sowieso besonders“, sagte sie dann. „Er war schon immer … besonders.“ Auf ihr weiches Gesicht trat plötzlich ein seltsamer Ausdruck.
„Besonders?“
„Ja. Fast schon übermenschlich stark und robust. Wie Sie anscheinend.“ Sie warf Mariella einen bezeichnenden Blick zu, ihre dunklen Augen blitzten dabei triumphierend. „Und er hat Ihre Finger.“
„Meine Finger?“
„Ja, Ihre extrem langen Finger.“
Mariellas Blick ging instinktiv zu ihren Händen und sie ballte die Finger zu Fäusten.
Die Frau legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. „Sie müssen ihn kennenlernen. … Unbedingt“, fügte sie mit Nachdruck hinzu. „Er wird das auch wollen. Was für eine Geschichte?“ Sie verdrehte kurz die Augen. „Er hat immer gedacht, er ist der Einzige mit diesen Dingen, und jetzt treffe ich Sie, und Sie sind anscheinend genauso.“
Mariella sagte nichts darauf, sah sie nur stumm an.
„Lisa“, sagte die Frau und streckte ihr die Hand hin. „Lisa Manca.“
„Mariella“, erwiderte Mariella, während sie die Hand ergriff und schüttelte.
„Matteo und seine Familie besuchen uns über Ostern.“
Mariella sah die Frau fragend an.
„Matteo, mein Bruder, und seine Frau Katrina“, erklärte Signora Manca. „Sie kommen mit unserer Nichte über Ostern zu uns. Wollen Sie uns dann vielleicht mal besuchen, Mariella? Das wäre schön, und Matteo wollte es bestimmt auch. Wir wohnen seit einigen Jahren hier in der Oberstadt. Und Sie?“
„In Villasimius“, antwortete Mariella. „Noch bei meinen Eltern“, fügte sie hinzu. Dann schalt sie sich sogleich innerlich dafür, weil das die ihr fremde Frau eigentlich überhaupt nichts anging.
„Ach, das ist ja fast nur ein Katzensprung“, entgegnete Signora Manca, wobei ein Lächeln ihren Mund umspielte.
Ach was, ist doch egal, dachte Mariella. „Eigentlich Stiefeltern“, gab sie zusätzlich preis. Sie versuchte ein harmloses Lächeln, obwohl sie ihre eigene Offenheit verwirrte.
Lisa Manca reckte das Kinn vor und sah Mariella eigentümlich an. „Noch eine Gemeinsamkeit“, sagte sie nachdenklich. „Jetzt, wo Sie es erwähnen, Mariella. … Matteo und ich sind auch keine leiblichen Geschwister. Papa und Mama haben ihn angenommen, als er noch ganz klein war.“
„Angenommen?“
„Ja, angenommen. Adoptiert. Papa hat ihn als kleinen Kerl aus dem Wasser gezogen. Aus einer blinkenden Kiste.“ Sie warf Mariella einen ungläubigen Blick zu. Ein fast belustigtes Lächeln zog sich über ihr Gesicht, doch Mariellas Miene blieb ernst.
Kapitel 2
Cagliari – 1. April
„Sie glauben gar nicht, wie gespannt ich darauf war, Sie kennenzulernen, Mariella“, sagte der Mann, der sich Mariella am frühen Nachmittag als Matteo Piga vorgestellt hatte. Er hatte sie in Villasimius mit dem Wagen abgeholt. Dann hatten sie lange in der Altbauwohnung an der Kaffeetafel gesessen. Sie waren alle sehr nett und herzlich um sie bemüht gewesen, sowohl Lisa und ihre Familie als auch Matteo und die seine. Jetzt saßen Mariella und Matteo allein um einen kleinen, runden Tisch in Lisas Schlafzimmer. Sie nutzte es ab und an als Arbeitszimmer, wie sie erwähnt hatte. Lisa hatte ihnen eine Schale mit den kleinen traditionellen Käsetörtchen hingestellt, die auf der Insel als Ostergebäck beliebt waren. Doch keinen von beiden gelüstete es nach der reichhaltigen Kaffeetafel danach.
„Nachdem Lisa mir erzählt hatte, was für eine erstaunliche junge Frau sie in der Bank getroffen hatte“, fuhr Matteo fort. Um seine Lippen spielte ein Lächeln und sein Blick lag weiter interessiert auf ihr. „Sie wollen also bei der Bank ein duales Studium machen?“
„Na, ja … immerhin gibt es jetzt einen zweiten Anlauf“, erwiderte Mariella mit einem amüsierten Grinsen. „Nachdem der erste buchstäblich in der Luft zerplatzte“, schob sie glucksend hinterher. Auch um Matteos helle Augen bildeten sich amüsierte Lachfältchen. Mariellas Blick glitt über sein Gesicht, dann hoch zu den Haaren. Sie hatten dieselbe Farbe wie ihre, auch wenn sich darin die ersten silbernen Fäden zeigten. Er war auch hochaufgeschossen wie sie. Nein, er war noch größer. Sie schätzte ihn auf einen Meter fünfundneunzig, und für seine weit über fünfzig Jahre sah er noch sehr athletisch aus. Neben dem Geheimnis, das sie anscheinend miteinander teilten, schien sie auch äußerlich irgendetwas zu verbinden. Mariella wandte den Blick von seinem Gesicht, sah auf ihre Finger. Dann schaute sie auf seine Hände, die auf der Tischplatte ruhten, und ihr Blick heftete sich auf seine Finger. Er bemerkte ihren Blick, lächelte wissend, sagte jedoch nichts.