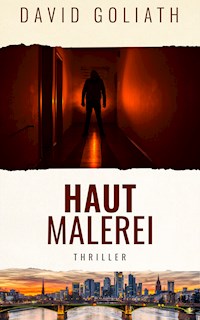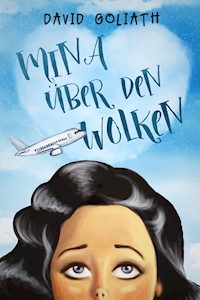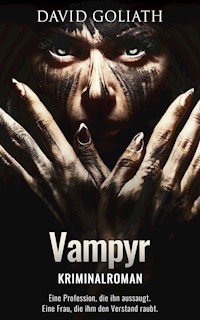Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Heiligland, eine Nordseeinsel vor der Deutschen Küste, wird von einem Sturm und einem toten Mädchen heimgesucht. Isoliert vom Festland und nahezu vollständig evakuiert, muss die kleine Polizeistation den Spagat zwischen Inselschutz und Tätersuche vollbringen. Die Auswüche des stärksten Unwetters seit Jahrzehnten vermischen sich mit der Tatsache, dass die Genitalien des Mädchens verstümmelt wurden - inmitten des Sturms auf einer fast verlassenen Insel. Zurückgelassen mit dem harten Kern aus renitenten Insulanern beginnt die Jagd.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Goliath
Der Hymenjäger
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Haftungsausschluss
Teil 1
Sturm
Leuchtturm
Jungfrau
Möwe
Bunker
Jacht
Teil 2
Jäger
Suche
Flucht
Versteck
Himmel
Teil 3
Pranger
Sprung
Hype
Impressum neobooks
Haftungsausschluss
Fiktiv.
Teil 1
„Green es deät Lun,
Rooad sen deät Bru´n,
Wit es deät Sun.“
Heiligländer Friesisch
[Grün ist das Land,
Rot ist die Kant,
Weiß ist der Sand.]
Wahlspruch und Wappenfarben der Nordseeinsel Heiligland. Bru´n, oder Kant, meint die markanten Feuersteinklippen.
Sturm
Sie hämmern gegen unsere Tür, wie wildgewordene Tiere oder blutrünstige Zombies. Es ist mitten in der Nacht. Erst dachte ich, dass es der Orkan sei, der uns seit Sonnenuntergang in Atem hält. Man gewöhnt sich so schnell an das stetige Klappern, Klopfen und Pfeifen, dass man sich neue Einschlafrituale suchen muss, wenn der Orkan irgendwann abflaut.
Widerwillig drehe ich mich zum Nachttisch, wo mein Diensthandy liegt. Ich taste nach einer irgendeiner Taste und weiß, dass ich erfolgreich war, als ich geblendet werde, obwohl ich die Lider halb geschlossen halte. Die Geisterstunde ist längst vorüber. Mein verschwommener Blick kann die Zahlen nicht genau erfassen. Eine fette Null führt die unchristliche Uhrzeit an.
Das Hämmern hört nicht auf. Es könnte der Orkan sein, aber dann müssten auch die Fensterladen hier oben im Schlafzimmer lauter klappern. Es erscheint zu lokal, zu fokussiert auf die Haustür.
Enna, meine Frau, würde mich normalerweise wachrütteln, aber sie liegt nicht neben mir.
Schlaftrunken widme ich mich dem Handy. Kein Anruf. Kann es dann so dringend sein, wenn ich keinen Anruf verpasst habe? Blinzelnd prüfe ich die Balken, die den Funkempfang darstellen. Der schwächste und kleinste Balken wechselt sich mit dem Piktogramm ab, das ein fehlendes Funknetz anzeigt. Offenbar beeinträchtigt der Orkan auch die Moderne, mit ihren schnelllebigen Informationen und Verbindungen.
Das aufdringliche Klopfen wird eindringlicher. Zwischen den zischenden Windböen, die sich im Dach verfangen und es am liebsten am Stück forttragen würden, mache ich Laute aus – Rufe. Die Ruhestörer scheinen mich zu rufen.
Stöhnend hieve ich mich aus dem Bett, denn es ist mein Job.
Ich schlüpfe in meine Uniform, grabsche mein Diensthandy und eile nach unten, vorbei am Kinderzimmer, wo normalerweise Ivo, 7, und Fee, 5, gemeinsam schlummern, denn wir leben in bescheidenen Verhältnissen in kleinen Häusern aus den 50ern, schnell aufgebaut, nachdem die abziehenden Briten ein gesprengtes, vermintes Trümmerfeld hinterlassen hatten und es lange nicht so aussah, dass Heiligland jemals wieder zu Deutschland gehören würde oder überhaupt bewohnbar wäre. Normalerweise, denn auch meine beiden Kinder sind nicht da. Zusammen mit meiner Frau sind sie gestern Abend mit der letzten Fähre zum Festland geflüchtet, auf Geheiß des Bürgermeisters, der hier in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten den Inselschutz, oder Katastrophenschutz, übernimmt.
Im Erdgeschoss ziehe ich meine wasserdichte Wetterjacke drüber, schnappe den Generalschlüsselbund und werfe noch einen Kaugummi ein.
»Kommissoor!«, höre ich aufgeregte Stimmen von draußen, die gegen die Böen ankämpfen. Dazwischen poltern Fäuste und Fingerknöchel unablässig gegen die Haustür. Sie hätten auch einfach anrufen können, über das kabelgebundene Festnetztelefon zum Beispiel, aber das Inselvolk hat so manch eigensinnige Angewohnheiten.
Als Festlandmensch muss man sich, daneben, auch erst einmal an die beharrliche Verwendung des Inseldialektes gewöhnen. Nach mittlerweile zehn Jahren im unermüdlichen Einsatz rutsche ich manchmal schon selbst ins Halunder ab – wie der Heiligländer Friesendialekt heißt.
»Moin!«, grüße ich eine nervöse Menschenschar, die sich nachts vor meinem Haus versammelt hat – biSkitwedder, bei Schlechtwetter - und die Kapuzen der Ponchos festhalten muss, die sich sonst wie Segel mit Wind aufpumpen und den Träger mitreißen würden.
Sofort raubt mir der Sturm die Luft. Beschleunigte Regentropfen dellen mein Gesicht ein. Ich muss meine Augen zusammenkneifen – Wind und Wasser fordern nach einer Schutzbrille. Die Laternen wackeln unheilvoll. Man hofft, dass alles niet- und nagelfest verankert ist. Land unter, könnte man sagen, aber dann wäre von der Insel nicht mehr viel übrig.
Die Menschenschar ist die Mehrheit der Sturköpfe, die auf der dem Orkan schutzlos ausgelieferten Aufschüttung verharrt. Eigentlich hätte man alles und jeden von Heiligland herunterholen müssen, aber die Angst vor Piraterie, Plünderung und Anarchie ist zu groß. Ich hatte keine Wahl – es ist mein Job.
»Hallo!«, »Hallo!«, »Hallo!«, »Hallo!«, »Hallo!«, »Hallo!«, grüßt man mich nacheinander zurück. Jeder nickt mit dem Kopf, was auch auf den Einfluss der Windkapriolen zurückzuführen sein könnte. Hände schüttelt man generell nicht – wo würde das hinführen, wenn man sich an einem Tag ständig über den Weg läuft. Mein nordisches »Moin!« wird toleriert, auch wenn ich meine inselferne Herkunft dadurch betone. Meine Stellung, meine Arbeit und mein Durchhaltevermögen werden honoriert. Da überhört man den Lapsus gern.
Ich kenne jeden persönlich, wie auch mich jeder persönlich kennt. Heiligland ist klein. Knapp 1500 Einwohner zählt das durch eine Sturmflut vor 300 Jahren zweigeteilte Eiland, rund 70 Kilometer vor der Deutschen Küste.
Neben dem Bürgermeister, dem Leuchtturmwärter, dem Feuerwehrkommandanten und dem Chef-Ornithologen schauen mich noch die Pfarrerin und die Fremdenführerin an. Bis auf den Leuchtturmwärter alles Einheimische seit Geburt. Und der greise Leuchtturmwärter bediente schon das Leuchtfeuer, als meine Eltern noch nicht einmal daran dachten, überhaupt Nachwuchs in die Welt zu setzen. Abgesehen vom selbsternannten Inselschutz gehört dem Rest eine Backpfeife verpasst, denn weder ein Vogelkundler noch eine Gottesbotschafterin, noch eine Tourismuskauffrau sollten ihr Leben riskieren, um dem Orkan die kalte Schulter zu zeigen.
»Kommissoor Jansen, wir haben ein Problem«, will mich der Bürgermeister mit gepresster Stimme einweihen und geht auf Tuchfühlung, da der Orkan die Unterhaltung sabotiert. Er kommt so nah wie möglich und lehnt sich dramatisch zu mir, begünstigt durch den Wind. Seine Brillengläser taugen nicht mehr zur Durchsicht, denn nasser Belag erneuert sich fortwährend. »Mord.«
Erstaunt hebe ich die Augenbrauen, versuche zu ergründen, ob dies ein Scherz sei, doch niemand lacht. Im Gegenteil, fahle, erschrockene Grimassen fixieren mich. Angesichts der Uhrzeit, der unwirtlichen Witterung und der zusammengewürfelten Gruppe kann ich einen makabren Streich ausschließen. Den letzten Mord gab es vor 300 Jahren, kurz vor der Sturmflut, als weibliche Eifersucht einer Nebenbuhlerin das Leben kostete – mit der dreizackigen Forke durch die Gurgel, wie das dünne Strafregister dokumentiert hat. Die Delinquentin wurde hingerichtet. Als die Sturmflut folgte, betete man dafür, dass sie keine Hexe war, die einen Fluch ausgesprochen hatte. Dämme und Wälle brachen. Häuser wurden hinfort gerissen. Menschen verschwanden. Die schäumende See teilte die Insel. Aus Ehrfurcht ist die Erwähnung ihres Namens verboten.
»Kum!«, winkt mich der Leuchtturmwärter lautstark auf die Straße. Er humpelt voran, gegen den Sturm gelehnt. Der Tross folgt ihm wackelig.
Auf dem Weg reden wir nicht viel. Die Böen schlucken jedweden Ansatz; der Regen ertränkt unsere Worte. Sie müssen mir nicht sagen, wohin es geht. Ich folge ihnen blind. Wenn selbst der Bürgermeister aus dem Bett geklingelt wurde, muss es einen triftigen Grund geben.
Vom industriell geprägten Hafenbecken in Deelerlun, dem Unterland im Süden, geht es durch Meddellun, dem beschaulichen, kargen Mittelland, aufwärts ins Bopperlun, dem plateauähnlichen Oberland und Tagestouristenmagnet, gleichzeitig Aushängeschild und Naturschutzgebiet. Nach den Treppen hinauf ins Bopperlun steuern wir den aufragenden Leuchtturm an, dessen Leuchtfeuer 30 Meter über uns unbeirrt seine Runden dreht, dabei die Dunkelheit im Turnus von fünf Sekunden im horizontalen Duktus durchschneidet, Seefahrer vor den Feuersteinklippen warnt und unser Lebenszeichen ist. Selbst in der schwärzesten Nacht und im heftigsten Sturm zeigt es der Deutschen Bucht, dass wir standhalten, weit draußen auf offener See.
Ich bin weder überrascht vom Schritttempo noch davon, dass der buckelige Leuchtturmwärter voranmarschiert, ohne Ermüdungserscheinungen. Heiligland ist praktisch autofrei. Hier läuft man jeden Tag. In 30 Minuten ist man auf der Hauptinsel vom Südzipfel bis zur Nordspitze gelaufen, wo sich unser Postkartenfelsturm Nathurn gegen Verwitterung und Brandung aufbäumt, eines Tages aber verlieren wird und einstürzt, wie das Gestein um ihn herum bereits zuvor.
Bis auf den durch die Membranjacke geschützten Oberkörper werde ich vom Niederschlag komplett eingeweicht. Würde ich eine Dienstwaffe tragen, würden die Kammern mit Wasser volllaufen und ihren Dienst versagen. So erspare ich mir die aufwendige Zerlegung und Trocknung. Heiligland ist nicht nur autofrei, sondern auch waffenfrei – normalerweise.
Im Leuchtturm angekommen sind wir alle froh, aus dem nächtlichen Schauer zu sein. Die ersten Sekunden vergehen damit, dass sich jeder wie ein nasser Hund schüttelt, damit die Feuchtigkeit nicht auch noch in die letzte Ritze dringt.
»Hiir lang«, führt uns der Leuchtturmwärter weiter ins Gebäude. Bis auf mich und den Bürgermeister bleibt der Rest im Eingangsbereich zurück. Das Schluchzen der Damen kommt nicht vom Wetter, sondern vom Schock. Anscheinend hat jeder der Anwesenden vor mir erfahren, was mir offenbar gleich gezeigt wird.
Es geht in den Atomschutzbunker, der den Sockel des Leuchtturmes bildet. Hätten die Alliierten damals ganze Arbeit geleistet, wäre auch dieses Relikt im Bombenhagel zerstört worden. So erfreuen wir uns, neben den Touristenmassen, an dem einzigen Vorkriegsgebäude in Lun, wie wir Heiligland nennen. Die heiligen Hallen des Leuchtturms darf allerdings niemand betreten, da die alte Technik zu störanfällig ist. Führungen oder Besichtigungen bleiben dem inneren Zirkel der Insel vorbehalten – uns.
Bevor der Leuchtturmwärter den Bunker öffnet, schaut er mich verschwörerisch an.
»Sek en skreklig Soak hi wi do no aal miin Doag ni sen´n«, sagt er mit bebender Stimme. So eine schreckliche Sache habe er sein Lebtag noch nicht gesehen. Dann schüttelt er sein graubärtiges Haupt. »Muurt. Deät heart ni tu Lun.«
Mord. Das gehört nicht zu Heiligland. Ich nicke. Ich habe verstanden und bin seiner Meinung.
Er öffnet die schwere Stahltür und bittet uns hinein, bleibt aber selbst außerhalb. Der Bürgermeister geht vor, sich seine Brille an der offensichtlich hastig gebundenen Krawatte säubernd, die er durch eine Regenjacke vor dem Sturm schützte. Die Krawatte ist sein Markenzeichen, zusammen mit der ultraflachen, teuer wirkenden Brille. Ein Halunder, aber seinem Amt entsprechend weltmännisch gekleidet, oftmals verwechselt mit den hohen Herren der Windkraftindustrie, die sich hier öfter blicken lassen.
Im Bunker erwartet uns trister Stahlbeton. Dicke Wände schotten uns mit einem Mal ab. Ein kleines Deckenlicht springt an. Die Stromversorgung ist durch unser inseleigenes Kraftwerk gesichert, gespeist durch die Offshore-Windparks, weit draußen vor den Steilklippen, oder den Notstromdiesel, der für die jetzige, deutlich geschrumpfte Einwohnerzahl für mindestens ein Jahr halten würde.
Mir stockt der Atem.
In der Mitte des Raumes liegt ein Mädchen, eine junge Frau, auf dem Rücken. Unter Kopf und Schultern hat sich eine Blutlache gebildet, schon halb vertrocknet. Sie trägt ein helles Kleid, das sich im oberen Brustbereich mit Blut vollgesogen hat.
»Grausam«, flüstert der Bürgermeister neben mir, der sich abwendet, das Bild aber scheinbar heute nicht zum ersten Mal sieht.
»Grausoam«, echot der Leuchtturmwärter vor der Tür.
Ich mustere den Raum, suche nach Abweichungen. Die Tür, durch die wir kamen, ist der einzige Zugang. Doch Schleifspuren oder Blutspuren kann ich nicht entdecken. Lediglich dutzende Fußabdrücke, die sich in den dreckigen Staub auf dem grauen Steinboden gestanzt haben – mutmaßlich die Schuhsohlen der Gruppe, die mich geweckt hat.
Auch Blutspritzer sehe ich nicht an den Wänden oder um das Opfer herum. Als hätte man sie friedlich abgelegt und über einen sanften Zugang am Hals leerlaufen lassen.
Sie ist blass. An ihren nackten Waden haben sich an der unteren Seite bereits rot-violette Flecken gebildet – abgesacktes Blut. Sie ist tot. Der saubere Kehlschnitt bestätigt die erste Sichtung. Aus der offenen Halswunde sickert kein Blut mehr. Ich fühle mich plötzlich wie der junge Kieler Polizeischüler, der die Abschnitte bei der Kriminalpolizei mit Ausflügen in die Pathologie erlebt – und nicht mehr vergisst.
»Ist Isak informiert?«, frage ich den Bürgermeister, der mit dem Rücken zu mir steht, durch die Tür in die Eingangshalle des Leuchtturmes starrt und schwer atmet.
»Ja«, krächzt er. »Er müsste gleich da sein.«
Draußen peitscht der Sturm die Wellen gegen die Klippen, auf denen wir uns befinden. Die Natur zeigt ihre rohe Seite. In solchen Moment wird man sich gewahr, wie hilflos man doch ist.
Bevor ich die Leiche umkreise, mache ich Bilder mit meinem Diensthandy, oder Alleskönner. Ich weiß nicht, wie lange der Orkan noch wütet, aber wenn er es schon mehrere Stunden kann, dann kann er es auch mehrere Tage. Kriminalpolizei und Spurensicherung vom Festland können nicht herkommen, solange die Fähr- und Flugverbindungen naturbedingt gekappt sind. Demnach liegt es an mir, alles in die Wege zu leiten. Zwar steht ein Seenotkreuzer im Hafen von Lun, doch ich will niemandem den haarsträubenden Wellengang zumuten, selbst wenn die Seenotretter genau für solche Situationen ausgestattet und ausgebildet sind.
Zeitgleich fertige ich mir erste Notizen an.
Ich kenne das Mädchen. Viele kennen sie.
Lotte Fisker. Die Tochter einer angestammten Fischerfamilie, die mittlerweile ein kleines Hotel betreibt. Ich weiß, dass sie gerade erst in den Familienbetrieb eingestiegen ist, nachdem sie die Schule beendet hatte.
Vor über zehn Jahren hatte ich den letzten Kontakt zu einem Gewaltverbrechen dieses Ausmaßes – auf dem Festland. Seitdem schlage ich mich hier mit prügelnden Sauftouristen, Taschendieben, jugendlichen Klingelstreichen und Bombenentschärfungen herum. Die meiste Zeit kann man auf Heiligland die Ruhe genießen, wenn die Tagestouristen in der Sommersaison abends die Insel verlassen oder wie jetzt in der Wintersaison gar nicht erst auftauchen, und das milde Klima, das uns trotz der Stürme und des Nebels mit Hitze und Kälte verschont und im Mittel einige Sonnenstunden schenkt.
Ich versuche mich zu erinnern, versuche den Katalog abzuarbeiten, den ich vor allem in der Ausbildung beigebracht bekam, als ich noch in der alten hanseatischen Heimat richtige Polizeiarbeit lernte und anwendete. Wichtig sind Fotos, Zeugen und Uhrzeiten – und menschliche Spuren, wenn man die Ausstattung, das Wissen und das Labor dafür hätte. Die nicht vorhandene Kameraüberwachung und die störanfälligen Funkmasten werden mir keine Hilfe sein, wenn ich Lun von einem Scheusal befreien soll.
Mord.
Der Bürgermeister hat wohl oder übel Recht. Es sieht nach einem grausamen Mord aus. Etwas, das die Idylle der Insel auf den Kopf stellen kann – mehr als dieser Orkan.
Apathisch fotografiere ich das Mädchen aus allen Winkeln. Dabei taste ich sie vorsichtig ab. Ihr enges Kleid kann nichts verbergen. Außer ihrer Unterwäsche spüre ich keine Gegenstände an ihr. Für den stürmischen Herbst ist sie viel zu dünn gekleidet, aber ich vermute, dass sie eine Jacke trug. Portemonnaie und Handy dürften in dieser verschollenen Jacke stecken, oder in der ebenfalls verschollenen Handtasche, die sie möglicherweise bei sich hatte.
»Jansen«, tönt es hinter mir abfällig.
Die bekannte Stimme aus der Hölle. Ich verwehre mein Antlitz und verweigere den Gruß. Dr. Isak stürmt an mir vorbei, schnurstracks zum Opfer. Doktor. Pah!, Hochverrat an der Zunft, mit deren Titel er sich schmückt.
»Tod durch Blutverlust nach Schnittverletzung am Hals«, lautet seine messerscharfe Diagnose nach kurzer Begutachtung. Er würdigt mich keines Blickes.
»Ein Messer, würde ich sagen«, fügt er fachmännisch hinzu.
Sein ekelhaftes Parfüm flutet den Raum, als wäre es eine Nachhut, die mich foltern will – aus Vergnügen. Isak schnauft. Anscheinend ist er durch den Regen gerannt. Bei seiner Wampe hat der Kreislauf ordentlich zu rackern.
Der Chirurg, der in der Nordseeklinik im kargen Meddellun sonst nur leichtsinnige Touristen einrenkt und zusammennäht, mustert das hübsche, tote Mädchen, mit übergestreiften Einweghandschuhen. Er leuchtet in ihre glanzlosen, geschrumpften Stecknadelpupillen, um den Lichtreflex zu testen – mutmaßlich ausbleibend. Danach studiert er ihren ausgetrockneten Mundraum. Anschließend sucht er nach weiteren Verletzungen, angefangen beim Schädel, über den Torso, bis zu den Fußknöcheln, oberhalb der Schuhe. Es sieht professionell aus, doch ich kenne seine Qualitäten. Er ist nicht auf Heiligland, um seine ärztliche Reputation zu stärken. Er ist hier, weil er die kalte, klare, jod- und sauerstoffreiche Seeluft braucht, damit seine Lungen nicht kollabieren, zerstört vom jahrelangen, exzessiven Nikotinkonsum. Immerhin ist Heiligland ein zertifiziertes Seeheilbad. Medizinisch ist er kein Wellenbrecher, eher eine bauchige Boje ohne Verankerung, sprich Rückgrat. Mein Bestreben ist es, den Kontakt mit ihm zu minimieren. Als Polizeichef ist das nicht so einfach, aber ich habe meine Leute und kommuniziere gern über unverfängliche Nachrichtenkanäle.
Ich bitte ihn, Lotte genauer abzutasten. Schließlich trägt er die Handschuhe und filzt sie gerade. Vielleicht versteckt sie ihren Ausweis, Geldscheine oder ihre EC-Karte in einem dünnen Etui, eingeklemmt in ihrer Unterwäsche, wie das manche Mädchen heutzutage tun. Mosernd kommt Isak dem nach.
Während er das Mädchen seziert, alarmiere ich außerhalb des durch meterdicken Beton abgeschotteten Bunkers meine drei Kollegen. Zu viert sind wir rund um die Uhr erreichbar und für die Sicherheit auf und um die Insel herum verantwortlich – zu Fuß, mit den zwei sondergenehmigten Fahrrädern, mit dem Sonderausnahme-Elektro-Golf oder per Boot. In den Sommermonaten, wo auf die 1500 Einwohner noch täglich das Doppelte an Touristen kommt, stockt man unsere Station auf sechs Polizeibeamte auf. Die Auffüller sind Freiwillige vom Festland, die in der Hauptsaison ihren Horizont erweitern wollen. Die meisten kommen danach nicht wieder. Nicht wegen der fehlenden Inselzulage, die die Erschwernisse der Abgeschiedenheit entschädigen könnten, sondern wegen dem eintönigen Alltag aus Tourismus und Enthaltsamkeit.
»Nichts«, nuschelt Isak, um meine Bitte zu enttäuschen. »Ich gehe davon aus, dass ich die Leichenschau übernehme?« Er erhebt sich und zieht die Handschuhe aus. Nicht einmal einen Arztkoffer hat er dabei. Oder hat man ihm schon berichtet, dass es aussichtslos ist?
Ich murmele die Bestätigung.
»Liege ich richtig in der Annahme, dass es eilt?«, richtet er das Wort an mich. Sein gefühlskalter Blick trifft mich zum ersten Mal in dieser schroffen Nacht. Mich wundert, dass ihn der Anblick der Leiche nicht berührt. Entweder er ist wirklich so kaltherzig wie ich ihn einschätze oder er ist abgestumpft, wie ich es auch wäre, hätte ich meine Polizeikarriere in Kiel weitergeführt – keine Verbrechenshauptstadt, aber definitiv mehr Fallzahlen, Kriminalität und Gewalt als auf unserem Fleckchen Erde.
Mein Nicken ist bewusst abweisend, garniert mit einer geringschätzigen Miene. Wir wissen beide, was wir voneinander halten. Ich sehe ihm an, dass er keine Lust hat, seinen Schönheitsschlaf einem toten Mädchen zu opfern. Aber wenn er jetzt ablehnt, sorge ich dafür, dass er seine Zulassung verliert. Isak weiß, dass ich auf so eine Gelegenheit warte, um ihn von der Insel zu jagen.
»Bringen Sie Lotte in die Klinik«, gibt er mir Anweisung, auch er hat sie identifiziert. »Unverzüglich!«, schiebt er hochnäsig nach, als er an mir vorbeistolziert. Offensichtlich will er dem Bürgermeister imponieren, der kreidebleich an der Tür verharrt.
Ich knirsche mit den Zähnen. Meine Fingergelenke knacken, als ich sie überdehne. Die Antipathie stelle ich hinten an, zugunsten der viel wichtigeren Mordaufklärung.
Leuchtturm
Als meine Kollegen – Sven, der Alte, Ole, der Mittlere, und Meitje, die Junge – zusammen mit dem Rettungswagen, der für seinen Verbrennungsmotor eine Ausnahmegenehmigung hat, eintreffen, beginnen wir direkt mit den Befragungen, nachdem wir den vermeintlichen Tatort in einer Gemeinschaftsaktion vermessen und nummeriert haben. Währenddessen laden die beiden letzten verbliebenen Sanitäter Lotte in einen Leichensack und verladen sie.
Die Fremdenführerin, verheiratet mit dem Vogelkundler, und die Pfarrerin – durch den Menschenauflauf aufmerksam geworden, als sie zu unchristlicher Uhrzeit die ersten Psalmen las - kennen nur die Geschichte, haben aber nichts gesehen, noch nicht einmal den Fundort.
»Ensküllige«, entschuldigt sich die Fremdenführerin, die mit den Nerven am Ende ist und sich selbst in die Nordseeklinik einweist, wo sie bis auf Isak, eine Aushilfskrankenschwester und eine Rettungswagenbesatzung niemanden finden wird.
Die Fremdenführerin wurde von ihrem Mann geweckt, den der Leuchtturmwärter als erstes verständigt hatte – beides gute Freunde. Die hatten dann wiederum den Feuerwehrkommandanten herausgeklingelt, der als einzige hauptamtliche Kraft einen Sonderstatus genießt, denn im Ernstfall rekrutiert sich die Feuerwehr aus Freiwilligen, die dann alle herangesprintet kommen, um die nächsten Ausnahmegenehmigungen beim Thema Verbrennungsmotor zur Einsatzstelle zu bringen.
Und so ging es weiter über den Bürgermeister bis zu mir. Der Verzicht auf fahrbare Untersätze – mit Ausnahme der Tretroller, oder seit Neuestem E-Scooter, die im Gegensatz zu Fahrrädern erlaubt sind – und viele andere Annehmlichkeiten – regelmäßige Postzustellung oder Auswahl und Vorrat im Supermarkt, zum Beispiel – bewirkt, dass man auch auf den Komfort direkter Telefonverbindung verzichtet. Wenn Entschleunigung, dann richtig.
Am Ende bleibt der Leuchtturmwärter übrig, der das Mädchen fand.
»Kontrol om deät fleegende Stürrem«, antwortet er, weshalb er des Nachts im Bunker gewesen sei. Er machte einen Kontrollgang wegen des heftigen Sturms. Da entdeckte er sie.
»Wer hat einen Schlüssel?«, frage ich, der selbst einen Schlüssel für dieses Gebäude hat, allerdings nur für das Schlüsseldepot vorm Gebäude, worin ein Generalschlüssel für Notfälle hängt. Jede Öffnung des Schlüsseltresors wird als Einbruch- oder Sabotagealarm an unsere Polizeistation gesendet – zusätzlich bekommen alle Inselpolizisten eine Nachricht auf ihre Diensthandys. Nicht geschehen in dieser Nacht.
»Man ik«, sagt er schulterzuckend und klimpert zum Beweis mit dem Schlüsselbund. Nur er.
Um sicherzugehen, teste ich das Schlüsseldepot, das draußen im Orkan wartet. Schräg gegen den kräftigen Wind gelehnt, mit einer Hand gesichert am Kasten, führe ich den durchnässten Schlüssel in das rutschige Schloss ein. Kurz nach der Depotöffnung vibriert mein Telefon – wahrscheinlich der Öffnungsalarm. Der Funkmast stemmt sich ebenso gegen den Orkan, da mein Handy wieder versorgt wird. Im Depot selbst leuchte ich mit meiner handlichen Taschenlampe den am Haken hängenden Generalschlüssel an. Alles in Ordnung. Zur Kontrolle prüfe ich die Nachricht auf meinem Telefon – eine automatisierte Mitteilung vom Schlüsseldepot, das geöffnet wurde. Flugs flüchte ich wieder ins Gebäude. Langsam kriechen Nässe und Kälte ins Mark.
Nach einer Stunde haben wir alle Aussagen, wonach wir den Bunker versiegeln. Was wir nicht zerstört oder gefunden haben, können die Profis von der Spurensicherung in ein paar Tagen sicherstellen, sollten wir dann immer noch keinen Täter haben und das Wetter wieder einen Transfer erlauben.
Aufgrund des Orkans hätten wir die Ermittlungen verschoben, aber bei einem möglichen Mord müssen wir auch bei gefährlichen Sturmböen Klinkenputzen. Das ist kein Einbruch oder Diebstahl. Ein Menschenleben wurde genommen und der Täter weilt wahrscheinlich noch unter uns.
Da wir keine Anwesenheitslisten führen, wissen wir nicht, wer tatsächlich noch auf der Insel ist. Die verrammelten Häuser sprechen zwar Bände, doch ob sich hinter der Barrikade jemand versteckt, gilt es herauszufinden.
Erste Anlaufstelle ist das Hotel Fisker,Lottes Familienbetrieb. Zusammen mit der Pfarrerin und dem Rettungswagen, der eben noch Lottes Leichnam in den Kühlkeller der Klinik brachte, überbringe ich die traurige Nachricht vom Tod der Tochter. Ihre Familie trotzt dem Orkan, aus Sorge um Eigentum, Einnahmequelle und Lebensgrundlage.
Lottes Mutter bricht zusammen, sowieso mit den Nerven am Ende, angesichts des Orkans und der verwüstenden Folgen. Lottes Brüder schwören Rache. Lottes Vater verarbeitet auf seine Weise: Schnaps, Schweigen, Schwermut. Einen ihrer Brüder muss ich in Gewahrsam nehmen, ehe er sich bewaffnet und einen Mob mit brennenden Fackeln über Heiligland geführt hätte, trotz Unwetter. Er akzeptiert die Rücksitzbank im E-Golf, wo er seine Trauer mit Wut niederringt. Gitter und Plexiglasscheibe bekommen ein paar derbe Hiebe ab. Lottes Mutter begleitet unsere Wegstrecke, allerdings mit Sauerstoffmaske und Infusion im Rettungswagen. In Meddellun trennen sich unsere Wege, im Schritttempo ohne Blaulicht, denn wir wollen niemanden wecken oder erschrecken, schon gar nicht jemanden überfahren, der vom plötzlichen Autoverkehr überrumpelt wird. Die Scheibenwischer arbeiten am Anschlag, nahezu nutzlos. Ich fahre weiter nach Deelerlun zur Polizeistation. Der Rettungswagen biegt in Meddellun zur Nordseeklinik ab. Die Pfarrerin, die mit ihren einfühlsamen Worten schlimmeres Unheil verhindern konnte, setzte ich bereits in Bopperlun an ihrem Pfarrhaus neben der Kirche ab, wenige Meter vom Hotel Fisker entfernt.
An der Polizeistation hat sich Lottes Bruder beruhigt. Durch Tränen kann er den Schmerz kanalisieren. Trotzdem will er ein paar Stunden in der Arrestzelle verbringen. Um sich abzukühlen, wie er sagt. Auch die offenen Wolkenschleusen hindern ihn daran, einfach zurückzulaufen. Im Hotel gibt es ohnehin nicht viel zu tun. Außerhalb der sommerlichen Hauptsaison gibt es dort nur ein paar Buchungen, die für die Offshore-Windparks und die Meeres- sowie Vogelforschungsinstitute reserviert seien, was eindeutig die angenehmeren Gäste sind.
Da seine Mutter ohnmächtig wurde, sein Vater alles in sich vergrub und die anderen Geschwister blanken Hass schürten, konnte ich nicht viel über Lotte in Erfahrung bringen.
Nach einer abgehackten Meldung an das übergeordnete Festlandrevier in Büsum, das das Wetter als unüberwindbares Hindernis für die erforderlichen Spezialisten vom Landeskriminalamt verfluchte, mir aber immerhin einen Freifahrtschein vom Gericht und der Staatsanwaltschaft versprach, versorge ich Lottes Bruder mit warmem Kamillentee und erhoffe mir Informationen über ihre letzten Stunden.
Wegen des angekündigten Unwetters sei Lotte gestern Abend mit der letzten Fähre zum Festland gefahren, sagt er gefasster.
Die letzte Fähre, die auch meine Frau und Kinder nahmen.
Seitdem kamen keine Schiffe mehr an, addiere ich in Gedanken. Wie eine blau aufgedunsene Wasserleiche sah sie nicht aus. Es muss auf festem Boden geschehen sein. Hat sie ihre Familie angelogen? Wegen einer Liebelei? Hat sie die Insel womöglich gar nicht verlassen?
»Kann ich sie sehen?«, hakt er nach.
»Die Obduktion läuft noch«, blocke ich ab. Ich hoffe, dass Isak noch irgendwo verborgene Talente hat, ein schlaues Buch oder einen versierten Kollegen in Übersee, der ihn anleitet. Sven, der die Obduktion begleitet, mag zwar Krimiserien - hauptsächlich, um die schlecht recherchierte Polizeiarbeit anzukreiden -, aber ob er Tipps geben kann, bezweifle ich. Isak wird sich von einem belesenen Polizeibeamten sowieso nicht ins Werk pfuschen lassen.
»Dann könnte sie noch leben? Gott sei Dank! Wer weiß, welches arme Mädchen das Opfer ist«, haucht er erleichtert.
Ich schaue ihn durch die Gitterstäbe an. »Wollen Sie den Verstand von drei Personen anzweifeln, die Ihre Schwester identifiziert haben?«
»Welk?«, erfragt er, wer die Personen sind.
»Unter anderem der Bürgermeister und der Polizeichef«, zähle ich auf und mich mit. Den Arzt lasse ich außen vor, sonst müsste ich ihm noch etwas zu Gute kommen lassen.
»Sie kennen meine Schwester?«
»Djong, wir sind in Lun. Man geht aus der Tür und sieht alle Halunder, wenn man sich einmal um die eigene Achse dreht. Willst du mir sagen, dass du jemanden nicht kennst?«
Der Junge, wie ich ihn betitelte, starrt zu Boden. »Gesehen hat man jeden schon, aber ich könnte sie nicht alle beim Namen nennen.«
»Das musst du auch nicht. Es genügt, wenn das der Bürgermeister und der Polizeichef können. Glaube mir, wenn ich dir sage, dass deine Schwester einem Verbrechen zum Opfer fiel.«
Ich lasse ihm ein paar Sekunden. Er ist alt genug, um zu verstehen, dass es sich hier weder um einen harmlosen Nachbarschaftsstreit noch um eine verstaubte Familienfehde handelt. Die Fotos der Toten will ich ihm ungern unter die Nase halten. Kein schöner Anblick. Wenn sie nach der Obduktion zusammengenäht ist, werde ich die Angehörigen zu ihr führen.
»Ist Lotte ganz sicher gestern mit der letzten Fähre aufs Festland gefahren?«, starte ich die Befragung mit Nachdruck.
Er nickt gewissenhaft. »Ganz sicher. Ich stand am Steg und hab ihr gewunken.«
»Und sie ist nicht wieder zurückgekommen?«
»Es war die letzte Fähre abends.«
»Wo wollte sie hin?«
»Zu einer Freundin in Büsum.«
Ich gebe ihm Zettel und Stift. »Name, Adresse, bestenfalls noch Telefonnummer.«
Er kritzelt auf dem Papier herum und gibt es mir wieder. Neele Schmidt. Der Name ist vollständig; bei der Adresse klaffen Lücken bei Straße und Hausnummer; eine Telefonnummer vermisse ich gänzlich.
»Sorry«, weicht er betrübt aus.
»Ole!«, rufe ich durch die Station.
»Ja, Öppers«, hüpft der Gerufene nach einem Moment mit einem dampfenden Kaffee um die Ecke.
»Hör auf, mich Öppers zu nennen«, flüstere ich ihm zu, doch er lächelt spitzbübisch. Öppers bedeutet Boss. Wir sind im selben Alter. Kinder und die Beförderung zum Oberkommissar fehlen ihm noch, um an meinen Erfahrungsschutz heranzureichen. Ich gebe ihm den Zettel.
»Überprüf das. Und schaut euch die Passagierliste der letzten Fähre gestern Abend an. Klingelt die Leute raus, wenn nötig, aber sagt nicht, worum es geht. Wir wollen keine Panik verbreiten.«
»Geht klar, Öppers.«
»Ach, Ole«, stoppe ich seinen Abgang. »Prüft auch, ob es nach der letzten Fähre noch irgendwelche Ankünfte gab: Privatboote, Flugzeuge et cetera.«
»Uun Odder!«
In Ordnung. Seine Ausrufe kenne ich, seit ich den ersten Fuß auf die Insel gesetzt habe.
»Geben Sie mir Lottes Handynummer«, bitte ich den Bruder freundlich und notiere die Zahlen, merke jedoch, dass er sich allmählich eingesteht, dass seine Schwester tot ist. Lethargisch scheint er die Gitterstäbe zu zählen, die uns trennen.
»Was trug sie, als sie Lun gestern verließ?«
Er überlegt, kratzt sich am Kopf, reibt in seinem Gesicht. »Ein helles Kleid und eine dunkle Jacke.«
Ich notiere. Dann suche ich ein Foto vom Fundort, worauf man ihr Kleid sieht, jedoch weder Blut noch die offene Schnittwunde am Hals.
»Dieses Kleid?«, zeige ich ihm das entschärfte Foto.
Er nickt traurig. »Ist sie das?«
»Ja.«
»Kann ich sie sehen?«, wiederholt er, diesmal allerdings auf die Bilder aus.
»Nein. Das sind verstörende Bilder. Behalten Sie Lotte so in Erinnerung, wie sie war.«
Er sieht es ein, senkt seinen Kopf, inhaliert den Kamillendampf aus der Tasse.
»Hatte sie eine Handtasche bei sich?«
»Nein, warum?«
»Also hat sie ihre Habseligkeiten in der Jackentasche?«
Ich ernte fragende Blicke.
»Handy, Portemonnaie?«
»Ach so, ja. Meistens in ihrer Jacke.«
»Hatten Sie mit ihr Kontakt, nachdem sie fuhr?«
Er schüttelt den Kopf. Gleichzeitig offeriert er hilfsbereit sein Handy. »Schauen Sie selbst.«
Ich durchstöbere Nachrichten und Anrufe. Dankbar gebe ich ihm seinen Begleiter wieder.
»Können Sie mir ein aktuelles Bild von ihr schicken?«
»Natürlich.« Er klickt durch seinen Speicherort.
Die Zieladresse muss ich ihm nicht nennen. Jeder Halunder hat die Kontakte der Polizei irgendwo vermerkt. Bald vibriert mein Diensthandy. »Danke«, weil ich davon ausgehe, dass es das aktuelle Bild von Lotte ist.
Nachdem ich ihn noch nach dieser Neele Schmidt, Lottes Gewohnheiten und ihren anderen Kontaktpersonen ausgefragt habe – ohne nennenswerte Ergebnisse, die aber trotzdem eine ganze Seite in meinem Notizblock füllen -, bringe ich ihm Kissen und Decke. Die Zellentür lehne ich an, damit er eigenständig auf die Toilette gehen kann. Nach seiner emotionalen Ausnüchterung ist er schließlich nur noch freiwilliger Zellengast.
Folgend hacke ich alle bisherigen Erkenntnisse in den Computer ein. Das Schreiben ist mir nicht fremd, nur Fülle und Ursache verlangen mir einiges ab. Neben mir drückt der Orkan gegen das Fenster, als wolle er mir über die Schultern schauen. Unstet prasselt Regen an die Scheibe, wie Maschinengewehrsalven. Im durch eine Flutmauer geschützten Hafenbecken, wo unsere Polizeistation für Wasserschutz und Zivilschutz unscheinbar angrenzt, schaukeln die Boote gespenstisch. Ich kann das Rasseln der Ankerketten und das Schleifen der Taue hören. Durch den sturmbedingten Nebel und die Nacht sehe ich vereinzelt Reflexionen und Lichter – Signallichter, Warnlichter -, doch ansonsten frisst die Dunkelheit alles auf.
Jungfrau
Vier Stunden nach dem Auffinden der Leiche, noch vor Sonnenaufgang, gibt es die erste Sondersitzung in der Polizeistation. Außer uns vieren sind noch der Bürgermeister, der Feuerwehrkommandant und der Kuurfutsker dabei, den Sven nach der Obduktion mitbrachte. Kurpfuscher, weil Heiligland ein Kurort und Isak, meiner Meinung nach, ein pfuschender Quacksalber ist.
Der Kurpfuscher wiederholt seine Aussage zur Todesursache. Den Todeszeitpunkt konnte er mittels Körperkerntemperatur auf zwei bis vier Stunden vor dem Auffinden eingrenzen, womit eine mögliche Flucht des Täters mit der letzten Fähre gestern Abend ausgeschlossen ist. Ich bin erleichtert, denn Enna, Ivo und Fee sind nicht mit einer Bestie zum Festland gereist.
»Ein gewöhnlicher Mord an einem ungewöhnlichen Ort«, scherzt er unangebracht. Keiner lacht. Nach der fruchtlosen Pointe ergänzt er überheblich, mit erhobenem Finger: »Allerdings gibt es eine Abweichung.«