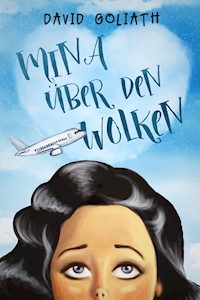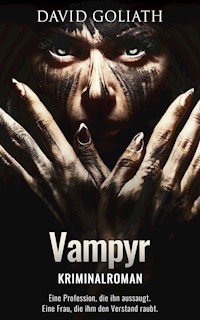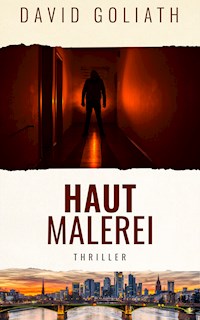
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Teufel wird zum Racheengel, denn das personifizierte Böse übernimmt Selbstjustiz – Nazis sterben. Die Mordkommission Frankfurt sieht sich einem mutmaßlich hünenhaften Tätowierer gegenüber, der seine Opfer genüsslich stigmatisiert. Unterm Radar moderner Ermittlungsarbeit bewegt sich das Phantom im toten Winkel von Kameras, Funkmasten und Bürgern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Goliath
Hautmalerei
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Haftungsausschluss
Schwarz
Verortung
Nacht & Nebel
Tinte & Schmerz
Xander & Ysop
Hafen & Kante
Ehe & Ende
Stuhl & Eimer
Schwarz
Engel & Staub
Schutz & Sieb
Wolf & Rose
Teufel & Schande
Presse & Justiz
Schwarz
Panzer & Alpha
Schnitzel & Soße
Turm & Babel
Schwarz
Sünde & Sühne
Feuer & Pause
Höhle & Löwe
Cola & Skalpell
Medien & Rummel
Folter & Drache
Keks & Krümel
Balz & Reue
Schwarz
Herz & Kehle
Hund & Narben
Netz & Zungen
Diktat & Brutus
Kaffee & Kuchen
Rendezvous & Déjà-vu
Schwarz
Fund & Farce
Fantasie & Wirklichkeit
Waffe & Gewalt
Schwarz
Kunst & Tod
Beweis & Dienst
Früher & Heute
Kalm & Stieglitz
Rechts & Links
Impressum neobooks
Haftungsausschluss
Fiktiv.
Schwarz
„Schwarz wird der Teufel stets gemalt.“
Finnisches Sprichwort
Verortung
Gegenwart.
In der Nähe von Frankfurt am Main.
Nacht & Nebel
M wie Manie. Macht. Martyrium.
M wie Melancholie und Monotonie.
M wie Metamorphose und Mutation.
M wie Maskerade und Massaker, Mortalität und Meisterwerk.
M wie Maler. Misanthrop. Monstrum. Mephisto.
M wie Mörder.
M wie Meinereiner.
Ich blicke in den dreckigen, gesprungenen Spiegel. Eine flackernde Glühbirne über mir kämpft gegen die Schatten, vor allem gegen den Schatten, der in meinem Gesicht liegt, geschützt von der Kapuze des Pullovers. Der Rest der heruntergekommenen Einzimmerwohnung im Souterrain ist dunkel. Fenster fehlen. Mehr als die Nacht wäre ohnehin nicht hereingekommen. Ein Keller mit einem abgewetzten Schlafsofa und einem schmierigen Waschbecken, daneben ein Eimer für die Notdurft.
Da sind wir wieder.
Ich ziehe einen Mundwinkel nach oben, ein schiefes, bösartiges, einseitiges Grinsen. Kaum zu erkennende Schemen.
Es hat mir gefallen.
Ich wasche meine Hände. Das Wasser spült fremdes Blut, schwarze Tinte und Camouflage-Make-up von meiner Haut, die selbst mit schwarzer Tinte gefüllt ist. Ein verformtes Stück Seife hilft bei hartnäckigen Stellen. Das Becken färbt sich schwarz, rot, gelb. Immer wieder protestiert der Wasserhahn. Immer wieder folgen braune Ablagerungen einem Stakkato an Strahlunterbrechungen. Trotzdem reibe ich meine eingeseiften Hände unter dem Schmutzwasser in einem konditionierten Muster – als hätte ich es jahrelang trainiert, verinnerlicht, automatisiert. Innen. Außen. Fingerknöchel, Fingerknochen, Fingerspitzen. Nägel, Nagelbetten. Handgelenke. Unterarme. Nach dem minutenlangen Ritual und mehreren Nachschlägen bei der Seife drehe ich den Hahn zu. Zuletzt hatte sich das Wasser durchweg braun verfärbt. Das löchrige Handtuch wischt die Nässe trocken, saugt sie auf, verschmiert sie. Ich hänge es zurück an den krummen Haken, der sich langsam aus dem Fliesenspiegel löst. Er wackelt, als ich das Handtuch an seinen angestammten Platz bringe, hält aber wacker die Stellung. Danach fixiere ich mein unbehelligtes Antlitz in den verästelten Bruchfragmenten des Spiegels.
Endlich. Ich habe es vermisst.
Ich fasse mit der linken Hand nach der flackernden Glühbirne über mir und ziehe sie zu mir. Meine gewaschene Hand ist durchzogen von Tinte: ein feixender Totenkopf auf dem Handrücken, umgeben von Blutrinnsalen, die weiter den Arm hochkraxeln, und lateinische Phrasen der Länge nach auf jedem Finger.
Malum in se – „Übel in sich“. Auf dem Daumen. Er zeigt auf die Person, die das Böse in sich trägt. Er zeigt auf mich. Meinereiner.
Das Licht fällt auf den Spiegel, der die Strahlen reflektiert und mein Gesicht beleuchtet, soweit es die Kapuze zulässt. Die Augen bleiben im Verborgenen. Ein glattrasierter Kiefer. Fremde Blutspritzer haften darauf. Ein unscheinbarer Mund. Speichel, Schweiß und Sekret haben das Cover-Make-up partiell abgetragen, was die darunter versteckte Schwärze hervorblitzen lässt. Doch im Ganzen kann man die Zierde noch nicht sehen.
Recte faciendo neminem timeas – „Tue Recht und scheue niemand“. Auf dem Zeigefinger. Erhoben zur Warnung, erhoben zur Anklage. Zeigt auf denjenigen, der die Strafe verdient.
Ich bin müde. Es war eine lange Nacht. Meine Gelenke schmerzen. Mir fehlt die Kraft der Jugend. Ich muss mir meine Energie einteilen, bin nicht mehr so agil wie vor ein paar Jahren. Trotzdem ist der Durst wieder geweckt – und gestillt, fürs Erste.
Demon est deus inversus – „Der Teufel ist die Kehrseite Gottes“. Auf dem Mittelfinger. Den kann ich in die Höhe recken und zeigen, was ich von Gott und der Welt, vom Mensch und seinem Irrweg halte.
Ich streife die Kapuze nach hinten, mit der rechten Hand. Auch dort, Tätowierungen. Allerdings ein weinender Totenkopf auf dem Handrücken, im schaurigen Kontrast zu seinem Genossen links, und skelettierte Finger. Der Ärmel des Pullovers verbirgt weitere Details, aber im Ansatz erkennt man brennende Erde.
Rigor mortis – „Totenstarre“. Auf dem Ringfinger der linken Hand, die die Glühbirne umfasst. Der unbeweglichste aller Finger als Sinnbild für den nach dem Tod erstarrten Leib, den ich für meine Kunst benutze. Manchmal auch noch nicht erstarrt – je nachdem, wo ich bin und wie viel Zeit mir bleibt, mein Kunstwerk zu vollenden.
Im Schein des hinter einer Glasphiole glühenden Drahtes offenbart sich mein Konterfeit, das unergründlich in den Spiegel starrt. Blutspritzer zieren Kinn, Wangen und Nase. Bis auf Augenbrauen und Wimpern fehlen meinem Kopf weitere Haare - Schädel und Bart sind glattrasiert. Meine Haut wirkt blass, porös, künstlich. Eingetrocknete Schweißperlen waren beim Versuch das Geheimnis zu lüften gescheitert. Sie konnten lediglich ein paar Ansätze offenlegen, die wie Dreckpartikel aussehen.
Mortua manus – „tote Hand“. Der kleine Finger bildet den Abschluss, das Ende. Die in die Haut gravierten Zeilen stigmatisieren mich bis in den Tod und darüber hinaus. Erst der unrühmliche Verfall wird die Schrift mit der Haut zersetzen. Auf meinen Knochen werden dann nur noch die Spuren der Nadelstiche zu finden sein, die zu tief eingedrungen sind.
Ich löse den Griff von der Glühbirne. Das Stromkabel von der Decke holt sich ihr Eigentum zurück und bremst den flackernden Auswuchs pendelnd, während das warme Birnenglas Striemen auf der Innenfläche meiner linken Hand hinterlassen hat. Dann drehe ich den Wasserhahn wieder auf, forme meine Hände wie ein Gefäß, sammele Nässe, beuge mich über das Waschbecken und schwappe sie in mein Gesicht. Mehrmals. Fremdes Blut und Make-up lösen sich. Schließlich tauche ich wieder vor dem Spiegel auf. Wasserperlen laufen mir von der Fratze, die das Nass offenbart hat. Nase und Ohren sind vollkommen schwarz tätowiert. Flüchtig könnte man meinen, sie existieren nicht. Auf den Lippen prangen eingespritzte Zahnreihen, breiter als die ursprüngliche Anatomie. Ein farbloser Skelettmund. Das Rot der Sinnesorgane abhandengekommen, ausgelöscht. Meine Augen ähneln schwarzen Höhlen – ein Oval zwischen Braue, Jochbein und Nasenbein. Wäre die weiße Sklera nicht zwischen Tintenklecks und Pupille, könnte man sich in den Tiefen der Finsternis verlieren. Ich fasse hinein, nehme etwas zwischen Daumen und Zeigefinger in die Schraubzwinge und hole es aus meinem Auge. Die Kontaktlinse verhält sich wie Wackelpudding auf meinen Fingern, als würde sie darum betteln wieder zurück in die feuchte Höhle zu dürfen. Dabei ist es keine Wohltat. Es fühlt sich an wie ein Sandkorn und reibt in mir, während es mich in den Wahnsinn treibt. Zudem schränkt es mein Sichtfeld ein, was für Pirsch und Jagd nicht unbedingt zuträglich ist, aber notwendig, um meine Identität zu schützen. Als ich das andere Sehorgan von der artifiziellen Applikation befreit habe, blicke ich mit gänzlich schwarzen Augen in den Spiegel. Die weiße Sklera wurde bereits vor sehr langer Zeit mit schwarzer Tinte geschwängert. Die Nadeln fliegen in jährlichem Zyklus über mich hinweg, damit die verbleichende Schwärze neue Intensität erlangt.
Ich lösche das Licht. Meine spärlichen Habseligkeiten liegen nicht im Weg herum. Ich finde mein Nachtlager blind, streife die Klamotten ab und lege mich nackt in mein durchgesessenes Schlafgemach. Mit geschlossenen Lidern und vor der Brust ineinander abgelegten Händen liege ich auf dem Rücken. Die vollkommene Dunkelheit umschließt mich. Es fühlt sich wohlig, geborgen und sicher an. Ein Maulwurf in seinem Tunnel. Ein Straußenkopf im Sand.
Diesem Bastard habe ich die Abreibung verpasst, die er verdient hat. Zwar nicht mein bestes Werk, aber für meine Auferstehung, meine Renaissance, nicht schlecht. Eine Fingerübung zum Warmwerden. Dieser Kick war einfach unglaublich. Wie sie mich angeschaut haben, diese fremdelnden, unschlüssigen Menschen. Wie sie an mir vorbeigeschlichen sind, unsicher, ob sie ihrem Drang nach Voyeurismus nachgeben sollten. Unsicher, ob sie die Polizei rufen sollten. Unsicher, ob sie mutig nachfragen sollten, wie es dem Mann, der bäuchlings auf der Brüstung der Brücke lag, ging, und was ich denn hier mache. Sie sahen nicht, dass dem Mann unablässig Wasser aus dem Mund tropfte. Wasser, das außen an der Brüstung hinunter in den Fluss tropfte. Sie sahen nicht, dass der Mann längst erlöst war.
Doch sie alle schlichen vorbei. Keiner machte ein Foto. Keiner traute sich, das Mobiltelefon mit der hochauflösenden Kamera zu zücken. Sie alle waren erschrocken über die Offenherzigkeit, die ich an den Tag legte – oder vielmehr in die Nacht. Die dezent ausgeleuchtete Alte Brücke verschaffte mir Schatten, in denen ich mich austoben konnte. Historisch romantische Beleuchtung nennen die Stadtplaner die wenigen Laternen, die an die graue Vorzeit erinnern sollen. Schummeriges Licht mit altem Stein im Kontrast zu den Glasfassaden und Flutlichtern der Hochhäuser des Bankenviertels in Sichtweite. Spaziergänger – Touristen und einheimische Nachtschwärmer – sollen auf dem Pflaster der Vergangenheit für gut 200 Meter die Hektik der Moderne vergessen, verdrängen oder ausblenden, selbst wenn sie sich die Passage mit vier Fahrspuren teilen müssen, zwischen pulsierenden Stadtvierteln voller Vergnügen, Laster und Sünde.
Und dann sahen sie mich, wie ich einem Mann die Haut auf dem entblößten Rücken mit 6000 Nadelstichen pro Minute verschönerte. Das kunstvolle Muster entging ihnen natürlich, wegen der seltsamen Wahl von Ort und Zeit. Ich hatte mich für einen abstrakten Reichsadler entschieden, dessen Kopf, Klauen und je ein Flügel gekreuzt abgewinkelt in alle vier Richtungen deuteten – eine Swastika sozusagen, oder Hakenkreuz. Neben diversen völkischen und antisemitischen Motiven auf dem Körper des Mannes fühlte sich der Vogel recht wohl. Meine versierte Vorgehensweise im Halbdunkel und das Selbstverständnis, das ich versprühte, verblüfften die Menschen so sehr, dass sie mein Handeln nicht in Frage stellten. Sie gingen einfach weiter, wunderten sich über diesen merkwürdigen Straßenkünstler und den bereitwilligen Mann, der das hell erleuchtete Panorama der Großstadt genoss, während man seinen Rücken malträtierte. Die glanzlosen Augen des Rassisten konnten die blitzlichtaffinen Schlitzaugen nicht sehen, da lediglich der Hinterkopf grüßte.
Manchmal lächelte ich einen dieser Menschen an, aus Spaß. Ich wollte die Reaktion testen. Die meisten erschraken, senkten den Kopf und huschten schnell an mir vorbei. Einer lächelte zurück. Ich sah seine glasigen Pupillen, die mich nicht fixieren konnten, stattdessen um mich herumschwirrten wie Fliegen um einen Freiluftabort. Torkelnd und lallend passierte er mich, ohne mich zu belästigen. Vielleicht hatte er die ratternde, akkubetriebene Tätowiermaschine in meiner Hand zucken sehen und vibrieren hören oder war irritiert von den Blutspritzern, die mein Gesicht besprenkelten, oder den schwarzen Tintenbächen, die von Werkzeug und Latexhandschuhen herunter platschten. Oder er war schlicht von Sinnen, fokussiert auf den Gehweg, ständig am Lächeln.
Vorbeifahrende Autos hielten nicht an. Die Insassen beachteten mich nicht. Zu dieser späten Sunde staute sich der Verkehr auch nicht mehr an beiden Ufern. Es gab also keinen Grund den Bürgersteig fernab von Übergängen unter die Lupe zu nehmen. Selbst Polizeistreifen ließen mich achtlos liegen. Straßenkunst kennt in dieser Stadt so viele komische Formen, dass man es vermeidet, sich mit allen Abartigkeiten zu belasten. Einmal winkte ich dem Einsatzfahrzeug sogar, ohne Resonanz zu erhalten. Die Nacht schützte mich sehr gut.
Als ich fertig war, stellte ich mich lässig an die Brüstung, um mein Umfeld zu beobachten. Ich hatte keine Lust die Beine in die Hand zu nehmen, weshalb ich einen günstigen Moment abpasste, in dem mich bauliche Wölbung der Alten Brücke, Uneinsehbarkeit durch Vegetation und abebbendes Nachtgewimmel für einen Moment zur einsamsten Person auf der Flussüberquerung machten. Dann warf ich einen letzten Blick auf das Tattoo – so wie er es wollte, dachte ich – und den Bastard in den Main. Neben dem Ruderverein plumpste er ins kalte Wasser und verschwand in der Tiefe. Ich wartete noch ein paar Minuten, lauschte dem Verkehr, dem entfernten Rauschen aus Nachtleben, Glockenspiel und Sirenen, das der seichte Wind zu mir trug. Niemand hatte den Sturz gesehen. Niemand hatte den Aufschlag vernommen. Also packte ich meine Sachen zusammen, klappte den Rollstuhl auseinander, mit dem ich den Körper geschoben hatte, setzte mich hinein und kurvte gemütlich von dannen, mit sauberen Händen an den Greifreifen, denn die Handschuhe hatte ich - die schmutzige Seite ineinander gestülpt - ausgezogen und eingesteckt. Passanten schenkten mir mitleidige Blicke – mir, meinen schlaffen Beinen, auf denen ich einen leeren Eimer balancierte, und dem ächzenden Rollstuhl. Ich lugte unter der Kapuze hervor, an der Kamera für Verkehrsüberwachung und öffentliche Sicherheit vorbeirollend, die mich als blinden Fleck aufzeichnete. Mein Adrenalinrausch näherte sich der Klimax und nährte sich von Geltungssucht, Sadismus, Exhibitionismus und Selbstjustiz.
Tinte & Schmerz
Ich erwache.
Ich weiß nicht, wie spät es ist. Der Keller ist dunkel. Mein Zeitgefühl sagt mir, dass die Nacht vorüber ist. Mein Körpergefühl sagt mir, dass ich ausgeschlafen habe. Ich taste mich zum Lichtschalter. Als ich ihn drücke, zündet die Leuchtstoffröhre durch, Quecksilberdampf und Argon bilden ein leitfähiges, strahlendes Plasma, und die fluoreszierende Röhrenbeschichtung aus Luminophor erhellt schließlich den kargen Keller.
Ich strecke mich. Meine Arme erreichen die Decke – ein dickes Betonfundament. Mein Gardemaß von einem Meter 90 macht aus dem Untergeschoss ein klaustrophobisches Gefängnis, das ich aus freien Stücken wählte. Wie mich eine cannabisverseuchte Gebärmutter und ein alkoholgeschwängerter Samenstrang schufen, stehe ich in dem kleinen Verlies. Mein Gemächt grüßt den Morgen. Die schwarz tätowierte Rüstung auf breiter Brust und flachem Bauch bietet den idealen Hintergrund für die hautfarbige Schlange, die sich auf den Sonnenanbeter versteift. Auf meinen Armen setzen sich die tätowierten Motive fort. Links ein Horrorclown mit Reißzähnen und Blutaugen – eine der ersten Hautmalereien, die ich mir gegönnt habe. Nicht selten wünsche ich mir ein unter die Haut geschobenes Audioabspielgerät, das ein grauenhaftes Gelächter abspielt, wenn ich den Muskel anspanne, weil ich die Menschen um mich herum abschrecken will, ehe sich meine Faust in deren hässliche Visagen rammen muss, weil sie mir auf die Pelle rücken. Den restlichen Arm zieren Äxte, Kettensägen, Macheten und Blutrinnsale. Mein kleines, persönliches Folterkabinett. Auf dem rechten Arm erinnert mich der Sensenmann an meine Sterblichkeit. Ausdruckslos verweilt er auf meinem Oberarm, die schartige Sense wie ein Mahnmal neben sich. Um sich hat er Fliegen, Grabmäler und brennende Erde gescharrt. Unter meiner Gürtellinie folgt ein Potpourri aus Fegefeuer, den vier apokalyptischen Reitern, Atompilzen und schwarzen Engeln. Ach ja, auf meinem gesamten Rücken liegen schwarze Schwingen an. Und auf meinem Hals befindet sich gemalter Stacheldraht. Rundherum. Manchmal fühle ich die Metalldornen, wie sie meine Kehle belagern und sich am liebsten in Halswirbel und Schlagadern bohren wollen.
Mit dem Waschlappen wasche ich mich. Die groben Fasern schleifen wie Sandpapier über die tätowierte Haut. Es plätschert in das Waschbecken. Ich stöhne, weil das Wasser so kalt ist. Kernseife löst den Schmutz von mir. Eine Tinktur aus ätherischen Ölen und Alaunstein überdeckt zuverlässig meinen Körpergeruch – für ein paar Stunden. Ich hasse meinen Körpergeruch! Stattdessen dufte ich nach einer Gebirgswiese – bis die Geißen darauf urinieren.
Eine lange Hose und bequeme Schuhe gestatte ich mir. Meinem dezent trainierten Oberkörper spendiere ich ein vorsätzlich gelöchertes Top. Die Kunden sollen schließlich Vertrauen in meine Arbeit gewinnen, indem sie sich an meinen Tätowierungen ergötzen.
Durch die quietschende Stahltür geht es nach oben. Der Krach warnt mich vor ungebetenen Gästen. Oben erwartet mich der Tag. Mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Der Tag ist angebrochen, jedoch noch nicht sehr weit fortgeschritten. Ich betrete ein Tattoo-Studio – mein Tattoo-Studio. Zwei Räume, getrennt durch einen Vorhang. Vorn der Empfang – ein Tresen, ein Klo hinter einer einflügeligen Western-Saloontür und eine schlecht gepolsterte Sitzmöglichkeit, äußerst spartanisch. Hinten meine Folterbank: ein altertümliches Holzgestell mit Eisenketten und –manschetten, getrocknetes Blut inklusive – könnte man meinen, doch es handelt sich um täuschend echte Farbe, falls jemand fragt. Dort beackere ich die Kundschaft. Man bezahlt nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Show.
Tintenschmerz heißt das Kind, indem ich eine im Abendland seltene Technik perfektioniert habe. Zwar kann ich damit keinen Fotorealismus auf die Haut zaubern, weil es eher grobschlächtig daherkommt, aber Erfahrung, Erinnerung, Haptik und außergewöhnliche Einmaligkeit lassen die Limitierung im Rausch in Rauch vergehen. Ink Rubbing nennt die sogenannte Fachpresse die Vorgehensweise, wo durch das Ritzen der Haut und das Einreiben von farbgebenden Materialien in die entstehenden Narben Kontur und Struktur geschaffen wird. Ich nutze Asche, am liebsten die Asche Verstorbener. Ein Kontakt im Krematorium versorgt mich mit Nachschub. Den Angehörigen wird dann eine Vermengung von Mensch und Schweingebein in die Urne gefüllt. Natürlich ist es ein Gerücht, dass ich mit Totenasche arbeite, aber weder kommentiere noch dementiere ich. Die Mundpropaganda beschert mir mehr Anfragen als ich abarbeiten kann. Prüfungen durch das Gesundheitsamt verlaufen stets ohne Beanstandungen, dank Buschfunk und guter Refugien. Zu der grauen (Toten-)Asche mische ich noch etwas schwarzes, gemahlenes Schießpulver. Das Skalpell öffnet die Haut und ich bringe das Gemisch ein, knete mit den Händen wie der Bäcker den Teig, reibe mit den Fingerbeeren wie die zierliche Masseuse vorm Happy End. Es ist recht blutig, aber die Kunden schreckt das nicht ab. Im Gegenteil, der Verzicht auf filigrane Kunst wird ersetzt durch die masochistische Faszination der legitimierten, offensichtlichen Körperverletzung. Das Resultat sind vernarbte, wulstige, schattierte Körperpartien, verziert mit einfachen Motiven, Sprüchen oder grotesken Formen. Noch mehr als Skalpell und Einrieb schmerzt die Desinfektion nach der Staubapplikation. Die verzerrten Gesichter der Kunden sehen nicht mein feixendes Konterfeit, wenn ich das bakterizide, fungizide, tuberkulozide, viruzide, bläuliche Mittelchen über sie kippe. Sie zucken wie Stroboskope im Dauerfeuer, wehren sich gegen die Eisenbewehrung meiner Folterbank. Die Ketten rasseln. Sterbende Schlossgespenter. Ich liebe meine Arbeit!
Aret ist noch nicht da. Sie ist meine rechte Hand, eine echte Notwendigkeit im alltäglichen Dschungel aus Kundenakquise, Networking, Social Media, Haftungsausschlüssen und Buchhaltung. Ohne sie wäre ich verloren. Ohne sie könnte ich mich nicht entfalten. Der Kram, den sie erledigt, nervt mich. Ich will nur die Haut, kann auf das Drumherum verzichten. Dafür erhält sie einen guten Lohn, der sich auch ihre Verschwiegenheit erkauft. Die kolportierte Totenasche ist lediglich ein Bruchteil meiner Sonderbarkeiten.
Die Kaffeemaschine bekommt Wasser und Pulver. Ich verabscheue Nikotin, aber ich brauche Koffein. Schon beginnt das Gerät zu brummen und dampfen – ein kleiner Morgenmuffel, der meinen Morgen in Schwung bringt. Während der Apparat kocht, schließe ich den Laden auf. Zuerst entriegele ich innen die Glastür, dann den Aluminiumpanzer davor, den ich nach oben schieben muss. Draußen empfängt mich eine leere Reihe von Parkplätzen, wo ich drei Stellflächen für das Studio reserviert habe. Aret stellt sich immer auf die erste Stellfläche davon. Sie nutzt den honiggelben Firmenwagen – ein schnittiges, leistungsfähiges Cabriolet mit dem Tintenschmerz-Schriftzug, den Kontaktdaten und einem kecken Spruch: geht unter die Haut! Die zwei anderen Parkplätze stehen den Kunden zur Verfügung. Einer für den zu behandelnden Kunden, der zweite für den interessierten Kunden, der sich den Pranger der Pein anschauen möchte. Über ein Gässchen zu erreichen. Kiefern, Buchen und Eichen säumen die Umgebung. Eine fehlende Überflutungsfläche verkürzt meinen Weg zu dem mittelgroßen Fluss – derselbe, den ich zur Entsorgung der Leiche benutzte. Die Strömung fließt zur Großstadt hin gen Westen, also wird der Körper in die andere Richtung getrieben und nicht vor mein Studio. Ich rechne außerdem jede Nacht mit der strafenden Sintflut, weil mein Schlafkeller unterhalb des Wasserpegels liegt, aber bis jetzt bin ich immer wieder aufgewacht. Das letzte Hochwasser, welches nicht durch die Staustufen reguliert werden konnte, trat vor meiner Zeit in diesem kleinen, dörflichen Stadtteil über die aufgeschütteten Ufer mit ihren mickrigen Flutmauern.
Die Sonne gewinnt an Stärke. Ich spüre die Strahlung auf meiner veränderten Hautoberfläche beim Kontrollgang außerhalb. Ein paar Getränkebecher liegen herum, zusammen mit einigen gerauchten Kippen. Die vorlaute, despektierliche Jugend hat sich offenbar herumgetrieben. Ich werfe den Müll in den öffentlichen Abfalleimer keine zehn Meter entfernt und nutze die Gelegenheit über den Parkplatz bis zur Böschung zu schlendern. Die sonstige Stellfläche gehört zur Fähre, die täglich der Strömung auf 130 Meter Breite trotzt, und dabei fahrbare Untersätze bis dreieinhalb Tonnen chauffiert, genauso wie Fußgänger.
Erste Radfahrer schießen an mir vorbei, denn direkt am Fluss führt ein beliebter, frequentierter Radweg entlang. Das Grün der Vegetation beruhigt mich. Ich blicke über das fließende Wasser. Gegenüber liegt ein Campinggelände, das von Flora geschützt wird. Richtung Westen folgt ein kleiner Bootshafen. Mit der Sonne auf der zweiten Gesichtshälfte tapse ich zurück zu meiner Liegenschaft. Ich drehe den Kopf in beide Richtungen. Auf der einen Seite sehe ich die dreiflüglige Schlossanlage, die mittlerweile mit Eigentumswohnungen vollgepumpt ist, und den angrenzenden Schlosspark. Auf der anderen Seite sehe ich ein dünnes Gewerbegebiet, an das sich ein Naturschutzgebiet anschließt, zentriert von einer gefluteten Kiesgrube, an deren Zipfel sich ein niedliches Strandbad anhängt.
Während ich flaniere, bleibt die Ladentür sperrangelweit geöffnet. Etwas frische Luft vertreibt den Muff aus dem Kabuff. Auf dem Rückweg betrachte ich die bescheidene Selbstständigkeit, die Monat für Monat meine Schulden begleicht. Und die Nachbarschaft. Provinzialer Einzelhandel, der sich gegen das Internet und die geballten Einkaufszentren stemmt, abhängig von den wenigen Stammkunden aus dem unmittelbaren Umfeld. Darüber ein paar Wohnungen. Neugierige Augen erspähen mich. Sie blinzeln durch die antiquierten Gardinen hindurch und denken, ich sehe sie nicht. Dabei weiß ich ganz genau, wie das Rentnerehepaar der Nachbarschaftswache über mich und mein Treiben denkt. Am meisten schreckt sie meine Erscheinung ab, vor allem meine dunklen Augen, bei denen man nicht sieht, wohin ich eigentlich schaue, weil einfach alles schwarz ist. Ich winke freundlich und gehe in mein Geschäft. Erwidert wird die Geste nicht. Jeder von beiden hat sein eigenes Fenster. Der eine hockt im Wohnzimmer; die andere in der Küche; beide starren den halben Tag hinaus zum grünen Ufer, an dem dutzende Blechkisten parken. Ich stelle mir vor, dass sie sich fromm bekreuzigen, wenn sie mich sehen.
Der Kaffee ist durchgelaufen. Ich gönne mir eine Tasse. Schlürfend prüfe ich den Briefkasten – Werbeflyer, trotz des eindeutigen Aufklebers, der darum bittet, auf den Einwurf von Werbung zu verzichten. Vielleicht sollte ich einen mehrsprachigen Aufkleber anbringen - oder plakative Piktogramme, die selbst dressierte Affen verstehen. Dann schlurfe ich durch den Laden und sichte das Inventar. Zuerst mein Arbeitsmaterial: Skalpelle, Tupfer, Mullbinden, Kompressen, Formaldehyd und Peressigsäure für die Sterilisation der Geräte, Propanol als Desinfektionsmittel für Wunden und Hände, Hautcreme, Asche und Schießpulver in Töpfen, außerdem noch Beißkeile, Kokain als Lokalanästhetikum und Morphium als Analgetikum. Die Betäubungssubstanzen lagern in einem Geheimfach unter der Sitzfläche meines gepolsterten, höhenverstellbaren Drehhockers und werden als Ultima Ratio angesehen. Besitz und Anwendung sind nicht konform mit dem Gesetz, aber manche Kunden trauen sich mehr zu als sie aushalten. Bevor ich reanimieren muss, sediere ich lieber. Die geringe Dosis verhindert eine Abhängigkeit, rede ich mir ein. Vielleicht ist das auch ein weiterer Grund, warum so viele Wiederholungstäter auf der Matte stehen. Meine Bezugsquelle behalte ich besser für mich. Aret kennt das Spiel, weshalb ich für ihren geschlossenen Mund auch so gut bezahle. Früher bezahlte man sie schlechter, für einen geöffneten Mund. Schlucken ohne Mucken musste sie trotzdem.
Mein Arbeitsplatz ist vom Boden bis zur Decke gefliest – schlichtes Weiß mit weißen Fugen. Gut für Blut. Erleichtert die Reinigung. Es gibt keine Bilder, Skizzen oder Fotos. Nur die Holzbank mit den Eisenbeschlägen, eine alte Kommode mit verglasten Türen für meine Utensilien und Holztüren, wohinter die autarke Tätowiermaschine lagert, die ich auswärts nutze. Außerdem ein Abwurfbehälter für blutiges Verbandszeug und ein Waschbecken aus Edelstahl für Desinfektion und Sterilisation. An der abgehängten Decke beäugen mich dutzende Einbaustrahler, die als Publikum beobachten und als Tribunal verurteilen.
Nach dem morgendlichen Rundgang blättere ich Kalender und Aufträge durch. Heute kommen zwei Kunden. Ein Frischling und ein Dauergast. Bevor der Kaffee kalt wird, trinke ich die Tasse aus. Der Frischling will mir seinen äußeren Oberarm zur Verfügung stellen. Er gibt mir die Freiheit, mich auszutoben, schränkte jedoch das Thema ein: maritim. Ein Seepferdchen würde mir gefallen. Mal sehen, was da für ein Schmalhans kommt. Da Aret den Erstkundenkontakt übernimmt, weiß ich nie, wer mich erwartet. Sie kennt mich und meine Gepflogenheiten, weshalb sie den Interessierten genau sagen kann, was ihnen bevorsteht. Das Wichtigste ist sowieso der Haftungsausschluss. Körperverletzung mit Einwilligung. Der Dauergast ist ein längerfristiges Projekt: Rosenranken vom großen Fußzeh, über Spann, Knöchel, Wadenbein, Knie, Oberschenkel, Hüfte, Po, Rücken und Schulter bis zum Nacken. Es ist der dritte Termin. Den ersten Termin mussten wir wegen der Schmerzen abbrechen. Die zarte Frau kämpfte zudem mit ihrem Kreislauf. Ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk und ein Schokoriegel halfen. Beim zweiten Termin war sie vorbereitet – mental und körperlich. Bis zu ihrem hübschen Hinterteil sind wir gekommen. Heute wird sie mir den Rest ihres ansehnlichen Körpers zeigen, wenn wir uns vom Po bis zum Nacken hocharbeiten. Möglicherweise muss ich heute eine Prise Morphium spendieren. Da kaum Fettpolster vorhanden sind, werde ich nah an ihren Knochen herumsäbeln.
Bis meine Adjutantin eintrifft, setze ich mich nach vorn in den Empfangsbereich. Der Getränkekühlschrank summt leise und die Wanduhr tickt. Ich atme vor mich hin, zähle die Radfahrer, Kinderwagen und angeleinten Hunde, die vorm Laden vorbeihuschen.
Erinnerungen an die letzte Nacht fluten meinen Geist. Als ich dem verkappten Nationalsozialisten in einer schlecht beleuchteten, mies belüfteten, leicht zugänglichen Parkgarage auflauerte, ihn mit Engelsstaub (PCP – ähnlich halluzinogen wie LSD, aber in der richtigen Dosierung einschläfernd) als Aerosol gefügig machte, ihn und sein Mobiltelefon in einem Eimer mit frischem Flusswasser ertränkte, ihn in dessen übermotorisierten SUV hievte und zur Alten Brücke kutschierte, wo ich einen Behindertenparkplatz in der Nähe besetzte. Er kam gerade aus dem Büro aus einem der Wolkenkratzer im Bankenviertel, mit feinem Zwirn und schicker Aktentasche. Ich passte ihn ab, hockte wie ein Kobold mit dem Eimer voll Wasser zwischen den parkenden Autos. Heute würde ihn die Investmentbank, für die er Bioreservate und Bodenschätze auf ärmeren Kontinenten für größtmögliche Rendite opferte, als vermisst melden. Seine Familie könnte die Vermisstenmeldung bereits in der Nacht abgeben haben, mit dem höflichen Hinweis der Polizeidienststelle, dass ein bekannter Trinker auch mal ein paar Stündchen auf einer Parkbank dösen könne, bevor er wieder erreichbar sei, und man noch etwas abwarten solle. Vielleicht wird er aber auch gefunden – von Seeleuten oder Morgenathleten, die Knie und Wirbelsäule über das harte Stadtpflaster prügeln, in engen, atmungsaktiven Mischfasern, mit erschreckender Umweltbilanz.
Der Nazi kannte mich. Ich kannte ihn. Laute Diskussionen mit Aret riefen mich auf den Plan. Ich unterbrach eine Session, zog den Vorhang ruppig zur Seite und brüllte nach vorn, was das Affentheater soll. Der Nazi bestand darauf, dass ich ihm einen Spruch von Schlüsselbein zu Schlüsselbein einfräse: Meine Ehre heißt Treue. Ein Wahlspruch der Waffen-SS im Dritten Reich. Nicht zu vereinbaren mit meiner Kunst, meiner Überzeugung, meinem Verständnis von Menschlichkeit, auch wenn ich die Menschen nicht mag. Ich hasse nicht nur Nazis, ich hasse die meisten Menschen. Ich lehnte ab und komplimentierte ihn hinaus. Statt zu gehen wedelte er mit einem Stück Papier, einem Geschenkgutschein, den ihm seine Kameraden überreicht hätten. Ich wusste, dass diese Aktion eines Tages nach hinten losgehen würde, aber Aret war von der PR-Sache mit den Gutscheinen überzeugt. Als ob ich nicht genug Kunden hätte. Aret meinte, dass wir unseren Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz steigern könnten, aber ich wusste, dass sie insgeheim mitschneiden wollte. Ständig schaut sie mir über die Schulter. Ich bin mir sicher, dass sie heimlich übt. Sie denkt, sie könnte einen zweiten Arbeitsplatz neben meiner Folterbank einrichten und dann ihren Stil verbreiten. Doch ich brauche sie vorn an der Theke, auch als Schutzschild, nicht zu meinem Schutz, sondern zum Schutz der Anderen.
Jedenfalls war mein Jagdfieber geweckt. Ich zerriss den Gutschein, plusterte mich auf, um die zwei Meter auf Zehenspitzen zu erreichen, und näherte mich dem renitenten Rechten. Man sah ihm die idiotische Ideologie kaum an. Die Kleidung verdeckte alles, auch wenn er stets langarm tragen musste. Ich sah es in seinen Augen aufblitzen. Er wollte einen kurzen Moment rebellieren, doch dann schien er sich einzugestehen, dass aus unserer Beziehung kein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis werden konnte. Mir und Aret einen giftigen Blick zuwerfend verließ er das Studio. Als der Gestank von Verblendung verzogen war, hob ich den zerstückelten Gutschein auf und prägte mir seinen Namen ein. Ein paar Abende und Nächte später hatte ich genug über ihn in Erfahrung gebracht, damit ich mein neuestes Projekt in Angriff nehmen konnte.
Richard Wagner hieß der Böse. Ein unbedeutender Hedgefonds-Manager. Er vermehrte das Vermögen der Reichen, verwehrte es den Armen und zwackte sich einen guten Prozentsatz ab – zwei Prozent Verwaltungsgebühr und 20 Prozent Gewinnbeteiligung. Eines von vielen Rädchen im Unternehmen. Er war unauffällig, arbeitseifrig und höflich, wie man es von Serienkillern und Amokläufern immer hört. In seiner Freizeit war er Vorsitzender einer unscheinbaren Kameradschaft, die deutschem Bier und Allmachtfantasien in einem kleinen Schrebergarten frönte. Freitags traf man sich, um dem Alltag aus Arbeit, Ehefrau und Kindern zu entkommen. Dann wurde in der Dämmerung die Reichskriegsflagge gehisst. Nebenan liegen Parzellen mit kroatischen und italienischen Flaggen, aber niemanden störte der kriegstreiberische Nationalismus. Das Dutzend Springerstiefel grölte rechte Parolen, marschierte um das Lagerfeuer und salutierte militärisch – Rumpelstilzchen für Despoten. Im Hintergrund liefen altdeutsche Schmonzetten auf Schallplatte, die ruhmreiche Soldatenhelden und rechtsradikales Gedankengut priesen. Im Schutz von Eichenstämmen und Stachelbeersträuchern gaben sich die Mannen dem Rassismus hin, den sie im Alltag unterdrückten. Ich sah mir dieses Schauspiel ein paar Mal an. Bald wurde es zu einem Ritus, freitags hinaus in die Gärten zu schleichen und den Biergestank herunterzuwürgen, der aus den heiseren, eisernen Kehlen strömte.
Dem Wagner folgte ich nach Hause, wo er Frau und Kind autokratisch beherrschte. Alkoholisiert war dieser Mensch nicht zu ertragen, weshalb sich seine Frau mit dem Sohn im Kinderzimmer einschloss. Sie tat so, als würde sie schlafen, wenn er gegen die Tür pochte. Der Kleine wachte zum Glück nicht auf. Weil sich Wagner bereits mit den Kameraden ausgetobt hatte, fehlte ihm die Kraft Dummheiten anzustellen. Er legte sich stinkend ins Bett. Die Erdgeschosslage der wichtigen Räumlichkeiten ermöglichte mir eine ausgiebige Erkundungstour. Wahrscheinlich zog Wagners Frau die Rollläden nicht komplett zu, damit sie im Notfall gesehen und gehört würde. Ein schönes Haus. Ich imaginierte wie ich darin leben würde. Kind und Frau würde ich adoptieren, wenn das zum Gesamtpaket gehört.
Ich verfolgte das Familienleben auch, als Wagner nüchtern den Patriarchen gab. Er schrie seine Frau weder an noch schlug er sie, aber diese subtile Spannung, dieses Machtgefälle, das er jeden Tag ausreizte, belastete die Ehe. Ich belächelte die gestellten Fotos an den Wänden. Hochzeit. Urlaub. Ausflüge. Derart im Übermaß, dass man erschlagen wurde, wenn man das von außen gut situiert wirkende Haus betrat. Jeder sollte sehen, wie harmonisch die Familie Wagner ihrem Dasein fristete. Ich muss gestehen, dass ich die Frau auch einmal halbnackt erwischt hatte. Sie kam aus der Dusche. Ihr Bademantel fiel günstig und legte eine Tätowierung frei. Ihre Scham interessierte mich nicht, aber die Zahl am Oberschenkel krallte sich meinen Fokus: 444 – DdD im Alphabet, Deutschland den Deutschen. Schlecht gestochen und längst verblasst. Wahrscheinlich ein jugendlicher Vorstoß in ihrer Sturm-und-Drang-Phase, wo sie im Milieu ihrem Zukünftigen über den Weg gelaufen war. 666 würde ich daraus machen wollen – die Zahl des Antichristen. Ich haderte kurz mit dem Gedanken, wie ich sie mir schnappe, sie entführe, verschönere und wie ein ungeliebtes Haustier aussetze, konzentrierte mich dann aber wieder auf die zerrüttete Ehe und den verkappten Ehemann, den ich durch mich ersetzen könnte.
Mein Sinn für Rechtschaffenheit hatte genug gesehen. Früher mordete ich schon für sehr viel weniger. Ich wollte die Familie vom Scheusal erlösen. Erbe und Witwenrente würden für ein anständiges Leben genügen. Liebe existierte nur zwischen Mutter und Sohn. Theoretisch hatte schon sein Abgang aus dem Studio gereicht, als er sich eine Zigarette anzündete, nachdem ich ihn hinauskomplimentiert hatte. Zuerst zog der Dunst in den Laden und dann warf er den Stummel achtlos auf den Boden, demonstrativ könnte man meinen, und ließ diesen ausglühen. Mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen war er vom Parkplatz gerauscht. Den Kies, den er dabei aufgewirbelt hatte, hat das Firmenfahrzeug abbekommen. Steinschläge im Frontbereich. Manche schlucken das herunter. Andere erstatten Anzeige. Ich richte.
»Guten Morgen!«
Aret reißt mich aus den Gedanken.
Mit ihr kommt die Sonne ins Geschäft. Egal wie hart ihre Nacht war, oder wie beschissen die Männer, die sie benutzten, belogen und betrogen, sie lächelt stets, wenn sie durch die Glastür kommt. Andere Menschen würden dieses Lächeln nicht deuten können, würden von einem mulmigen Gefühl befallen werden, weil Aret mit ihren ausrasierten Kopfseiten, dem Metall im Gesicht und dem auffälligen Kobra-Tattoo, das vom Hals bis ins flachbrüstige Dekolletee reicht, eher abschreckend als vertrauenserweckend wirkt. Harte Schale, weicher Kern, gebrochene Seele.
»Wie geht´s, Chefchen?«
Ich hasse diesen Ausdruck, aber ich kann ihr nicht böse sein. Ich mache ihr Platz und bringe ihr einen Pott Kaffee, während sie die Unterlagen des Tages durchblättert.
»Wie war die Nacht?«
Ihre Standardfloskeln für den Gesprächseinstieg kommen mir schon so vertraut vor, dass ich sie unbeantwortet im Raum stehen lasse. Sie meint es ohnehin rhetorisch. Denn sie weiß, wie es mir geht und sie weiß, wie meine Nächte sind – dunkel und einsam, gleich meinem Innersten.
Ich nicke, als sie mir die anstehenden Termine nennt, die ich mir bereits angeschaut hatte. Dann prüft sie den Getränkevorrat und das Polster an Schokoriegeln, checkt die E-Mails, die Social-Media-Accounts, schaltet das Studiotelefon an und testet den Drucker. So ein fleißiges Bienchen. Selbst meinen Arbeitsbereich nimmt sie unter die Lupe, inklusive des geheimen Kokain- und Morphiumlagers unter meinem runden Drehhocker. Währenddessen beobachte ich sie, ihre enganliegende Kleidung, die Begierde weckt, und ihren sehnigen Körper. Ihre knappen Shirts zeigen viel Haut und lassen erahnen, was darunter liegt. Dazu trägt sie meistens Pants und Overknee-Strümpfe. Sie kann es sich leisten. Anerkennend mustere ich sie jeden Morgen. Ich kann nicht glauben, dass es Männer gibt, die so eine hübsche Frau belügen und betrügen. Wäre ich nicht ihr Chefchen und wäre ich nicht zu Höherem berufen, würde ich mit Blumen und Kerzenschein um sie werben. Im Status quo erfreue ich mich einfach an ihrer Schönheit, die ebenso männliche wie weibliche Klientel anspricht. Platt gesprochen, ein gutes Aushängeschild für Tintenschmerz.
Wir trinken zusammen Kaffee. Dabei beantwortet sie Anfragen und Kommentare, veröffentlicht ein paar Schnappschüsse meiner Arbeiten und prüft die Finanzen.
Dann tritt der maritime Debütant ein. Ein Hänfling mit Brille und Vogelnest auf dem Kopf. Ein Student, vermute ich, irgendwas Naturwissenschaftliches. Der Strickpullover von der Oma ist so obsolet, dass er bald wieder modern wird.
»Hallo«, sagt der junge Mann zurückhaltend, sichtlich eingeschüchtert von der zierlichen Frau, die viel Haut präsentiert, und mir, dem gruselig Tätowierten, der ihn mit durchweg schwarzen Augen löchert. »Ich habe einen Termin.«
Wortlos gehe ich nach hinten, um alles vorzubereiten. Ich höre wie Aret den Burschen begrüßt und mit dem Rechtlichen vertraut macht. Danach folgen Unterschriften und unsicheres Räuspern des Gastes. Der Kronkorken eines koffeinhaltigen Erfrischungsgetränkes zieht ein Zischen nach sich. Aret versorgt den Klapperstorch mit einem ersten Schuss. Ein Zeichen für mich. Vorsorglich fülle ich eine Spritze mit flüssigem Kokain. Bevor der mutmaßliche Student nach hinten kommt, spanne ich einen Mundschutz um und schlüpfe in schwarze Latexhandschuhe, die ich auf meine Haut klatschen lasse. Aret versteht den Wink und fragt nach einer etwaigen Latexallergie. Der Kunde verneint und wird von ihr zu mir geführt. Die Rückfallbox mit den latexfreien Nitrilhandschuhen bleibt unangetastet.
Sie hat sich bei ihm eingefädelt, was ihn noch nervöser macht. Auch sie mag das kompromittierende Spiel mit den Gefühlen der Menschen.
»Eine Wette«, erklärt sie mir an seiner statt. »Es ist sein Erstes.«
Der Mundschutz verbirgt meine schmalen Lippen. Die Aussicht auf einen vor Schmerz kreischenden Jüngling verdirbt mir die Stimmung. So wie er sich verhält, wird er den ganzen Häuserblock zusammenschreien. Ich greife unter meinen Sitz und umschließe das Morphium. Eine zweite Spritze muss her.
Während Aret den Kunden auf der Holzbank so fixiert, dass er den auserkorenen Arm nicht mehr bewegen kann, bereite ich die zweite Spritze vor. Als er mit entblößtem Oberkörper halb aufrecht auf der unnachgiebigen Holzbank sitzt und mich mit furchtsamen Augen anschaut, ramme ich ihm das Kokain der ersten Spritze in den Brustmuskel.
»Was ist das?«, will er aufgeregt wissen.
Ich blicke zu Aret. Eine Aufforderung.
Sie tätschelt ihn. »Eine Betäubung. Und wenn die Schmerzen zu groß werden, bekommst du noch eine.«
Sein Zittern legt sich. Er entspannt sich und lächelt sogar, wenn auch fremdbestimmt durch die Droge.
Ich nicke Aret zu. Sie geht nach vorn, den Vorhang hinter sich schließend. Folgend schmiere ich eine Salbe auf den Arm, den ich beschneiden werde. Ein gebräuchliches Lokalanästhetikum. Die fensterlose Nische wird lediglich durch die Deckenstrahler erhellt. Das Tageslicht schirmt der Vorhang ab, auch wenn an den Rändern leichter Schimmer zu sehen ist.
»Welches Motiv?«, stammelt er benommen. Das Kokain entfaltet seine ganze Wirkung. Der Spargeltarzan rutscht in eine Art Wachkoma.
Ich beginne. Die ersten Schnitte setze ich flach an, damit ich sehe wie seine Haut beschaffen ist. Schon kommt mir das erste Blut entgegen, das ich mit dem Tupfer aufsauge. Das gewählte Mosaikseepferdchen hat viele gerade Kanten, weshalb ich zügig vorankomme. Unter mir häuft sich ein Berg aus vollgesogenen Tupfern an. Als ich merke, wie der Mann wegknickt, verpasse ich ihm eine saftige Ohrfeige. Er schüttelt sich und ist wieder beisammen, wenn auch eingeschränkt und zugedröhnt. Ich beeile mich. Eine zweite Dosis Kokain könnte heftigere Auswirkungen haben, bei diesem jungfräulichen Hänfling. Nachdem ich alle erforderlichen Schnitte getätigt habe, packe ich eine Kompresse darauf und studiere den Kunden, der schläfrig und glückselig zum Vorhang starrt. Die seitlichen Sonnenschimmer scheinen ihm zu gefallen. Wahrscheinlich denkt er, dass er im Himmel sei. Ohne das Morphium wage ich mich an die Desinfektion, die wahnsinnig brennt, aber gleichzeitig auch die Gerinnung fördert, sofern er an keiner Gerinnungsstörung leidet – ein Punkt, den das Vorgespräch und das Infoblatt thematisieren, und hoffentlich ausschließen. Ich nehme die blutige Kompresse ab und schütte das Propanol über den Oberarm. Der Mann zuckt, bleibt aber ruhig. Sein Arm ist sowieso fest fixiert. Im nächsten Schritt reibe ich die grauschwarze Mischung aus Asche und Schießpulver ein. Je nach Stelle mehr oder weniger, um Schattierung und Form zu schaffen. Einige Häufchen werden von den Wunden aufgenommen, andere fallen nach unten – der normale Ausschuss. Um einer Sepsis vorzubeugen beaufschlage ich die Furchen erneut mit Propanol. Dabei werden zwar weitere Pulverreste ausgewaschen, aber in verschwindend geringer Anzahl, denn die Haut hat sich den Großteil schon einverleibt. Später bekommt er noch ein Breitbandantibiotikum rektal von Aret eingeführt. Den meisten Kunden gefällt die kleine Prostataeinlage. Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit Kokain oder Morphium wurden mir noch nicht mitgeteilt. Bisher hat es jeder überlebt. Die Anzahl der Wiederholungstäter spricht für sich.
Mundschutz und Handschuhe landen im Abfalleimer auf den gebrauchten Handschuhen der letzten Nacht, genauso wie die vollgesogenen Tupfer und Kompressen. Das Skalpell lege ich in eine separate Metallschachtel, um es später zu reinigen. Ich betrachte den geschwollenen, fleckigen Arm, lockere die Bebänderung, weil sich das Blut staut. Das Seepferdchen ist mir gelungen. Abstrakt und martialisch, aber einzigartig und faszinierend. Der Blutfluss ebbt ab. An den Wundrändern bildet sich Schorf. Die Hautkrater verschließen sich schon bald wieder. Die Bohnenstange hat den Eingriff überstanden, wenn auch flach atmend, mit glasigem Blick und Schweiß auf der Stirn.
Aret kommt. Sie hatte mein Aufräumen mitbekommen. Ihre zarten Hände schlüpfen in schwarze Latexhandschuhe, Größe XS, und holen angekündigtes Zäpfchen aus dem Schrank. Ihr Lächeln sagt alles. Sie freut sich auf ihr Mitwirken. Wir drehen den Mann in Seitenlage. Ich halte ihn fest. Aret legt den Po frei. Das Zäpfchen erhält Gleitgel. Sie zieht die schlaffen Pobacken auseinander, visiert das Loch an und schiebt das Antibiotikum hinein. Ein kurzes Stöhnen bestätigt, dass der Schüchterne wieder etwas spürt. Die Betäubung lässt nach.
Wir lassen ihn noch eine Weile liegen, seinen Rausch auskurieren. Aret hat immer ein Auge auf ihn. Ich gönne mir ein stilles Wasser. Für den Rest ist sie zuständig. Foto, Folienverband, Belehrung, Gesundheitshinweise, Verhaltenstipps. Beglückwünschen, abkassieren, anlächeln, heimschicken.
Xander & Ysop
Jasmin Xander fuhr zur Arbeit. Wie jeden Morgen. Und wie jeden Morgen wälzte sie sich durch den stockenden Pendlerverkehr. Hunderte vor ihr, hinter ihr, neben ihr. Das Radio dudelte immer dieselben Lieder herunter, die Witze dazwischen wurden stetig schlechter und die Wettervorhersage stimmte sowieso nicht. Ihr Thermobecher mit dem selbstgemachten Kaffee von zuhause stand in der Halterung zwischen Armaturenbrett und Armlehne. Sie gönnte sich alle paar Meter einen Schluck. Bis zum Polizeipräsidium würde er leer sein.
Das Pistolenholster lag im Beifahrerfußraum; die Pistole im Handschuhfach. Nicht dass jemand auf dumme Gedanken kam. Neben dem Holster befand sich ein Blaulicht mit Magnetfuß – von der füßigen Klimaanlage angepustet. Das Kabel steckte im Zigarettenanzünder. Daneben war ein digitales Funkgerät eingebaut, gekoppelt mit der Freisprecheinrichtung. Sie hatte den Frequenzempfänger ausgeschaltet. Für dringende Fälle hatte sie ihr Dienstmobiltelefon dabei, ebenfalls gekoppelt mit der Freisprecheinrichtung.
Sie spielte mit ihrem Ehering, drehte ihn mit dem Daumen um den Finger. Die eingearbeiteten Steine glitzerten im Sonnenlicht, doch der Glanz der Fassung war längst ermattet. Sie fragte sich, ob sie das Richtige getan hatte. Überstürzt geheiratet, weil sie schwanger war. Zehn Jahre waren seitdem vergangen. Mitten im Studium gab es diesen Moment der Unachtsamkeit. Ein Streit auf einer Party. Eifersüchteleien. Zur Versöhnung landeten sie im Bett. Harter, unerbittlicher, unsittlicher Sex, wie sie ihn noch nie vollzogen hatten. Beide ließen ihrer Wut freien Lauf – bis die Ladung mit Wucht ins Schwarze traf. Der Alkohol vernebelte. Erst am nächsten Morgen starrten sich beide an, als wüssten sie, dass sie ein Kind gezeugt hatten. Vier Wochen später kam die Gewissheit, neun Monate später ihr Sohn. Den kriminalistischen Verwaltungsfachwirt konnte sie noch abschließen, aber die Abschnitte bei der Bereitschaft, der Streife und der Kriminalistik wurden ihr untersagt. Sie schwebte im Vakuum, bis der Mutterschutz nach acht Wochen ablief. Zur Wiedereingliederung durfte sie in den Innendienst: Aktenablage, Beweismittelsicherung, Berichtswesen. Als die erfolgreiche Rückbildung ärztlich attestiert wurde und ihr Baby nachweislich eine Tagesmutter hatte, durfte sie im Schnellverfahren Schießtraining, Festnahmen, Nahkampf und Einsatztaktik durchlaufen. Mit der Brustfütterung hatte es ohnehin nicht funktioniert – Saugverhalten passte nicht mit Warzenkonstellation überein, irgendein ärztliches Fachchinesisch. Und bevor sie daran zerbrach, dass sie ihrem eigenen Kind keine stillende Mutter sein konnte, stürzte sie sich in den Staatsdienst. Nicht ganz unerheblich war der Hauskredit, den sie abbezahlen mussten. Sie brauchten zwei volle Gehälter. Die Immobilienentscheidung kam in der Schwangerschaft – Nestbautrieb. Jasmin haderte, neben der Vermählung, auch mit diesen beiden Weggabelungen in ihrem Leben, trotz der bedingungslosen Liebe für ihren Sohn.
Der Autokorso zog sich. Sie konnte schon die Silhouetten der Hochhäuser sehen, die die Stadt prägten. Irgendwo dahinter kauerte das Präsidium in einem flacheren Ausläufer vom Postkartenmotiv der Stadt. Ihr Blick schweifte zum Blaulicht. Sollte sie sich diesen Vorteil verschaffen? Das eingebaute Signalmodul, vorn hinterm Kühlergrill, würde die Akustik, die sie über einen eingebauten Schalter neben der Klimaanlage betätigen könnte, zum blauen Blitzlichtgewitter liefern, das durch die LEDs in der Sonnenblende, die sie herunterklappen müsste, und versteckt im Kühlergrill verstärkt werden würde. Jetzt wünschte sie sich einen Notfallanruf, um die Verkehrsteilnehmer auf die Probe zu stellen und die Rettungsgasse zu erzwingen.
Nach einer Dreiviertelstunde Berufsverkehr erreichte sie endlich die Tiefgarage unter dem Steinquader, der avantgardistische Architektur und triste Transparenz vereinen sollte. Das oberirdisch sechsgeschossige Raumschiff lag an einer wichtigen Ausfallstraße vom Stadtzentrum kommend nach Norden, umschloss acht Innenhöfe und vereinnahmte einen ganzen Straßenblock. Neben der gesamten Führungsriege der städtischen Polizeibehörde beherbergte das Gebäude Einsatzzentrale, 3. Polizeirevier, Polizeigewahrsam, Spezialeinheiten, Schießanlage, Hubschrauberlandeplatz, Sporthalle, Verwaltung, Zentrale Dienste, Kriminalmuseum, sowie Kriminaldirektion - ihr Ziel.
Jasmin ließ den Aufzug beiseite und nutzte die Treppen. Als berufstätige Mutter hatte man keine Zeit für Sport in der Freizeit, oder eher freien Zeit. Der Kleine war zwar schon in der Schule, aber der Haushalt machte sich nicht von allein. Wenigstens hatten sich die Geldsorgen erledigt, als ihr Mann einen gutbezahlten Job annahm. Fürsorge und Verfügbarkeit nahmen ab, Konto und Reizbarkeit nahmen zu. Distanziert lebte man mittlerweile nebeneinander, gaukelte dem Kind Idylle vor und fragte sich, wo das hinführte. Dann beschwichtigte man sich, indem man sich vor Augen führte, wie gut es einem ging. Man hungerte nicht. Man fror nicht. Man kränkelte nicht. Und Sex holte man sich woanders.
Im Büro exerzierte sie ihre Routine durch, wenn der Tag, wie heute, ohne Vorkommnisse begann.
Ankommen.
Setzen.
Durchatmen.
Meditieren.
Sie schloss die Augen, konzentrierte sich auf ihre Atmung, verlangsamte diese und lauschte dem gedämpften Trubel, der von der Straße durch die Fensterfassade waberte. Die Bürotür hatte sie vorsorglich geschlossen. Milchglas hinderte Flurgänger an eindringlichen Blicken. Sie zählte hoch und wieder herunter. Ihre Schuhe hatte sie ausgezogen. Die Zehen spürten die leichte Vibration des Bodens, wenn Flugzeuge über die Stadt flogen, Müllwagen unten vorbeifuhren oder die Putzkolonne den Putzmittelwagen über den Flur schob. Ihre Finger legte sie auf die ledernen Armlehnen des Stuhls, fühlte die abweisende Kälte, die sich mit der Zeit in glatte Wärme verwandelte. Sie atmete bewusst tief in die Brust.
Danach benutzte sie den Wasserkocher und setzte Tee auf. Ein großer Becher Kaffee im Auto genügte ihr, sonst würde sie wie ein Gummiball durch die Gegend springen. Währenddessen schaltete sie ihr Mobiltelefon wieder laut und legte es auf ihren Schreibtisch. Ein Bild ihres lachenden Sohnes prangte auf dem leuchtenden Display, das ihr außerdem Uhrzeit, Datum, Netzstärke und Akkustand zeigte. Was fehlte, war eine Nachricht ihres Mannes, der gestern nicht nach Hause gekommen war. Es gab solche Phasen, in denen er sich nicht meldete, sich irgendwo volllaufen ließ und bei einem Kumpel pennte. Dafür bunkerte er in seinem Büro mehrere Anzüge, Hemden, Krawatten und Hygieneartikel. Jasmin rechnete eigentlich jeden Tag damit, dass er Schluss machte – so einfältig und unreif das auch klang. Das Feuer zwischen beiden war längst erloschen. Zuerst blieb man zusammen wegen dem positiven Schwangerschaftstest, dann wegen Kind und Kredit. Beides war aus dem Gröbsten raus. Es gab keinen Grund, die Scheinehe aufrecht zu erhalten. Sie selbst hatte vor einem Jahr den ersten Schritt gewagt – sie hatte ihren Mädchennamen wieder angenommen: Xander.
In der Schule wurde sie gehänselt. Zander oder Filet hatte man sie genannt. Nicht schlimm, aber auch nicht gerade erbaulich für ein labiles Küken, das um Anerkennung kämpfte und gegen die Schmähungen Gleichaltriger, die sich über ihren frühen, enormen Brustumfang amüsierten. Mit der Bürde ihres Namens driftete sie ab. Ein paar Jugendliche mit dummen Ideen fingen sie auf. Ein altes Tattoo auf ihrem Oberschenkel zeugte von der Sünde, zu der sie sich hinreißen lassen hatte, um ihrem jetzigen Mann zu gefallen. Um zu rebellieren. Die Bedeutung wurde ihr erst später bewusst. Sie wollte es sich schon seit Ewigkeiten mittels Laser entfernen lassen, aber der törichte Lapsus vernarbte unschön wegen der schnörkelhaften Methode des unerfahrenen Tätowierers und einer darauffolgenden Infektion, weshalb ein Lasereinsatz lediglich die Tinte zerstören würde. Die Hügel auf ihrer Haut gehörten aber zu ihr wie die Muttermale ringsherum.
Als sie die interne Post durchsiebte, betrat ihr Ermittlungspartner das Büro, das sie sich mit ihm teilte. Da er immer später als sie zum Dienst erschien, genoss sie die paar Minuten Einsamkeit.
Nathanael Ysop telefonierte mit gerunzelter Stirn. Er trat ein und schloss die Tür, was er sonst nie tat. Dann stierte er zu seiner Kollegin, während er dem Sprechenden lauschte.
Jasmin fühlte sich immer noch unwohl in seiner Gegenwart, obwohl es schon einige Jahre her war. Damals, als ihre Ehe mal wieder einen Tiefpunkt am Scheideweg erreichte, fing Nathan sie auf, half ihr auf die Knie, und vögelte den Schmerz aus ihr heraus. Einige Wochen ritten sie gemeinsam, meistens von hinten, ohne in das Gesicht des anderen blicken zu müssen. Sie redeten nicht darüber, küssten sich nicht auf die Lippen und ließen den Akt stumm geschehen. Selbst das Stöhnen unterdrückten sie. Jasmin unterdrückte sogar Tränen – Tränen der Lust, Tränen der Befreiung. Ihr Kollege zog sein Ding durch, respektvoll, still und stilsicher, wie ein Kavalier, der sich seiner Funktion als Druckventil bewusst ist.
Nathan sträubte sich zuerst gegen die Intimität, die sie nonverbal einforderte. Er füllte sie ab, bis sie schläfrig wurde, bombardierte sie mit Dokumenten, die sie durchackern wollte, und hörte ihr zu, wenn es aus ihrem Mund sprudelte. Schließlich konnte er aber nicht anders, besorgt um das Wohl seiner beruflichen Partnerin. Eine wortlose Übereinkunft. Unbedeutender, zwangloser Sex. Das Licht blieb aus. Sie fühlten sich, begrapschten sich, befriedigten sich. Auch Nathan trug ein Päckchen mit sich herum. Gescheiterte Beziehungen, mal länger, mal kürzer. Aufgelöste Verlobungen. Geplatzte Hochzeiten. Einseitige Seitensprünge. Lügen. Enttäuschungen. Narben. Die Allzeitbereitschaft des Jobs ist ein Beziehungskiller. Die Abgründe menschlicher Perversionen sind Emotionskiller. Mordkommission bedeutet, ein vergangenes Kapitalverbrechen ohne Vorwissen zu analysieren und anhand sichergestellter Spuren in akribischer Ermittlungsarbeit einen oder mehrere Tatverdächtige einzugrenzen, ihren Bewegungsablauf zu rekonstruieren und sie im besten Falle anhand eines Geständnisses oder erdrückender Beweislage zu überführen. Ein Puzzle ohne Blaupause. Immer wieder die Reise durch die Psyche kranker, kalter Menschen.
Er nahm das Mobiltelefon vom Ohr, steckte es ein und setzte sich Jasmin gegenüber. Auch bei ihm lösten ihre hohen Wangenknochen Gefühle aus, jedoch versöhnlicher als bei seiner Kollegin, die Gesicht von Geschlecht trennen konnte.
»Es gibt eine Leiche«, begann Nathan leise. Dabei beobachtete er seine Partnerin.
Jasmin nickte und schnappte sich ihre Utensilien – Holster, Jacke, Telefon. Sie wunderte sich, warum sie als Einzige in Bewegung verfiel.
Nathan überlegte, wie er einfühlsam an die Sache herangehen konnte. Er war sich nicht sicher, was der Beamte in der Leitung beschrieben hatte, aber bevor er sie gegen die Wand laufen ließ, wollte er sie lieber vorher aus dem Verkehr ziehen.
»Ich glaube, wir sollten den Fall abgeben«, schlug er deshalb vor.
Sie schüttelte den Kopf. »An Kurz und Klein? Kannst du vergessen! Die zwei Nieten sollen ruhig auf ihren faulen Ärschen hocken bleiben!«
Wie Jasmin den Türgriff in die Hand nahm, erhob Nathan die Stimme, aber nicht, um sie zu rügen, sondern, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, sie zu bremsen. »Wie geht es deinem Mann?«
Er kannte diesen Sozialversager, der Frau und Kind wie Marionetten behandelte, flüchtig, hatte ihn ein paar Mal gesehen, ihm die Hand geschüttelt und Small Talk gehalten. Er konnte diesen Businessschmarotzer nicht leiden, weil der sich mit Blutdiamanten schmückte. Außerdem hörte er eine gewisse Gesinnung heraus, die seinem Demokratieverständnis widerstrebte. Er fragte sich sowieso, wie Jasmin ihr schwarzes Schaf, das eigentlich braun war, vor der Dienststelle geheim halten konnte. Aber da mischte er sich nicht ein. Vielleicht diente sie dem Staatsschutz als Informantin. Andersherum gab es mehr Reibungspunkte. Denn ihr Mann musste die Ehe zu einer Polizistin rechtfertigen, verteidigen. Als Aussteigerin schlugen ihr sicherlich auch diverse Anfeindungen entgegen, außer sie beherrschte das Rodeo männlicher Eitelkeiten ebenso wie das Ballett polemischer Rhetorik.
Jasmin erkannte den Ton ihres Partners. Die Frage klang weder leicht noch interessiert. Es hörte sich nach einer Warnung an. Sie entfernte die Hand vom Türgriff. Das Mobiltelefon hatte immer noch nicht vibriert. Ihr Mann hatte sich noch immer nicht gemeldet. Und Nathan lehnte sonst auch keine Leiche ab, oder reichte sie an Kurz und Klein weiter, die wie Hyänen darauf warteten, dass die Löwen keinen Hunger mehr haben und die Beute freigeben.
»Was ist los?« Schwer von Begriff zu sein gehörte nicht zu ihren Tugenden. Die Aufklärungsrate vom Gespann Xander & Ysop lag bundesweit unter den ersten fünf. Regelmäßig horchten Bundes- und Landeskriminalamt nach, ob man zu einem Stellenwechsel bereit sei. Doch beide scheuten den Neuanfang, obwohl er beiden gut zu Gesicht gestanden hätte.
»Bin mir nicht sicher«, zauderte Nathan.
»Kannst du in ganzen Sätzen antworten und mir endlich sagen, was los ist?« Jetzt wurde Jasmin lauter. Unruhe befiel sie.
»Die Beschreibung der Leiche passt auf deinen Ehemann«, packte Nathan aus. Er hatte sich noch nicht vom Stuhl hochbequemt. Aber er schaute demütig zu Boden, so als würde er heftigen Gegenwind erwarten.
Im Flur trampelten Leute vorbei. Gesprächsfetzen drangen ins Büro, das plötzlich eisig und steinig wirkte. Karge Tundra mit Permafrostboden.
Jasmins Augen huschten umher, unschlüssig, was sie fixieren sollten. Computer, Pflanzen, Schränke, Lampen. Nichts konnte ihren Blick binden. Sie musste das Gehörte erst verdauen. Im Affekt kramte sie ihr Mobiltelefon heraus und suchte vergebens nach einer neuen Nachricht. Die letzten geschriebenen Worte von ihrem Mann datierten von gestern: bin unterwegs. Kein Emoticon, keine Sehnsuchts- oder Liebesbekundung. Nur ein schlichter Halbsatz, der besagte, dass er auf dem Weg nach Hause sei und sie das Essen vorbereiten solle. Sofern es keinen akuten Einsatz gab, war Jasmin lange vor ihm zuhause, hatte eingekauft, die Hausaufgaben des Kleinen kontrolliert, aufgeräumt, die Wäsche angeschmissen und den Müll rausgebracht. Eine brave Hausfrau, der man den harten Job bei der Kripo nicht zutrauen würde.
Oder eine Tarnung, um Neider und Gegner zu besänftigen.
Auf den einfallslosen Satz ihres Mannes hatte sie nicht geantwortet. Vergebliche Liebesmüh. Er hätte es eh nicht gelesen. Die letzten Herzchen oder Küsschen stammten aus den Anfängen der Beziehung, als noch analog gefunkt wurde. Danach kamen nur noch Standardmitteilungen über den Füllstand des Kühlschrankes, wichtige Termine beim Kinderarzt oder der Schulleitung. Manchmal auch wütende Nachfragen, wo er denn bliebe. Und seltener auch besoffene Antworten, dass sie sich um ihren eigenen Scheiß kümmern solle.
Sie steckte das Telefon zurück in das Fach am Holster unterm Jackett, gegenüber der Dienstwaffe, seitlich zwischen großem Busen und Arm versteckt. Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollte, Nathan hatte ein ähnliches Gespür wie sie. Wenn er sagte, dass etwas im Argen lag, dann lag da auch etwas im Argen. Und wenn er sagte, dass die Beschreibung einer gefundenen Leiche auf ihren Ehemann passte, dann konnte sie davon ausgehen, dass er entweder Recht hatte, oder dass zumindest eine frappierende Ähnlichkeit vorlag, die in ihr Betroffenheit auslösen könnte, gefolgt von Befangenheit. Kurz und Klein stünden parat.
»Ist er wieder nicht nach Hause gekommen?«, kombinierte Nathan Jasmins unschlüssigen Blick auf ihr Mobiltelefon und die Stille, die sie umwehte.
Sie nickte nachdenklich.
»Hast du ihn heute schon erreicht?«
»Hab es zweimal versucht«, erwiderte Jasmin mit ungutem Gefühl, »Aber er ist nicht rangegangen.«
Nathan deutete zum Büro nebenan, getrennt durch eine Wand. »Soll ich Kurz und Klein schicken?«
Jasmin musste nicht lange überlegen. Ihre Ehe mit einem selbsternannten Übermenschen, sofern dieser das Zeitliche gesegnet hatte, ging die Kollegen nichts an. Wie es weiterginge, wenn die getraute Verbindung Kreise zog, blendete sie aus. »Nein!« Sie drückte den Türgriff nach unten und schwang das Türblatt auf. »Malen wir nicht den Teufel an die Wand. Lass uns erstmal hinfahren.«
Hafen & Kante
Mit dem Zivilfahrzeug samt Sondersignal, aufgesetztem Blaulicht, blitzenden LEDs in den heruntergeklappten Sonnenblenden und aus dem Gitter vorm Fahrzeugkühler heizten sie durch die Stadt. Für die fünf Kilometer benötigten sie gerade einmal zehn Minuten. Nathan beherrschte das Vehikel. Vorausschauend rechnete er stets mit der Überforderung der anderen Vehikel, inklusive unkalkulierbarer Kurzschlussreaktionen. Rote Ampeln, Abbiegespuren, Straßenbahnschienen und Fußgängerüberwege kreuzte er behutsam. Seine Pupillen flogen hin und her, und sein rechter Fuß schwebte bremsbereit über dem Pedal. Noch drängte sich der Berufsverkehr durch die überlasteten Straßenkapillaren der Großstadt, doch Nathan kurvte um die Hindernisse wie ein Rennfahrer. Jasmin hielt sich am Türgriff fest. Sie vertraute ihrem Partner, zweifelte seine Fahrkünste keineswegs an, aber ihrem kaffeegetränkten, ansonsten nüchternen Magen gefiel die urbane Rallye nicht.
Als sie den möglichen Tatort am Westhafen erreichten, mussten sie sich vorsichtig ihren Weg durch Schaulustige, Journalisten, Absperrungen und uniformierte Polizisten bahnen. Jasmin pflegte dabei die Angewohnheit, sich die Gesichter der Anwesenden einzuprägen, zumindest die derer, die in sozio-ökonomische Täterprofile passten. Der erzgebirgische Fotograf mit dem 70er-Jahre-Schnauzbart, wie man ihn aus Erwachsenenfilmen kennt. Der unrasierte Eisverkäufer aus dem Schwarzwald, der einen Zwischenstopp einlegt, obwohl die abschmierende Kühlung des vollgepackten Wagens die wertvolle Fracht gefährdet. Der berliner Ballonverkäufer mit dem Clownsgesicht. Der westfälische Trinkhallenstammkunde im Schlabberlook, der zu lang auf die gesicherte Dienstwaffe des Streifenpolizisten an der Absperrung schielt, weil er sein tägliches Pensum schon erreicht hat. Der friesische Student mit dem Fahrrad, der mit einem Werbegeschenkrucksack Ornithologie betreibt. Der frankfurter Möchtegerngangster, dem erst kürzlich die Ohrhärchen ausgebrannt wurden und der mit seinem goldenen Smartphone sich und das Ereignis im besten Licht ablichten will. Der fränkische Vollbärtige, dessen Name immer falsch ausgesprochen wird und der ständig unter Generalverdacht steht. Die meisten Täter sind Männer im zeugungsfähigen Alter mit deutscher Staatsbürgerschaft, wenn man von Taschendiebstahl absieht. Das ist nicht rassistisch, sondern statistisch.
Die schmale, künstliche Halbinsel war zum Glück schlecht einsehbar, abgeschieden und nur von zwei Seiten zugänglich – eine befahrbare Brücke vorn und ein begehbarer Steg am Ende. Das 4. Revier, einen Katzensprung vom Ort des vermeintlichen Verbrechens entfernt, hatte die Brücke mit zwei Beamten und einem blau blitzenden Streifenwagen probat gesperrt, mit Flatterband von beiden Spiegeln zu einem Laternenmast auf der einen Seite und zu einem Baum auf der anderen Seite. Der kleine Steg, 400 Meter gen Westen, konnte mit einem Beamten gesichert werden. Mittendrin, auf der Strecke zwischen Brücke und Steg, standen weitere Streifenwagen, ein längliches Fahrzeug eines Bestattungsunternehmens, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen. Die zwölf Luxusapartmenthäuser, die man in Fluchtrichtung nebeneinander auf die Halbinsel gebaut hatte, müssten allesamt abgeklappert werden, zur Zeugenbefragung, sollte sich ein Verbrechen herauskristallisieren. Die Breite des Flusses an dieser Stelle genügte, damit die gegenüberliegende Uferseite nicht zu einer Aussichtsplattform verkam. Ein paar Voyeure dürften das Schauspiel mit Feldstechern oder guten Objektiven behelligen, aber mehr als einen provisorischen Sichtschutz aus schwarzer Zeltplane, den die Kollegen bereits um das Opfer gebaut hatten, bot sich nicht. Auch die Anwohner der drei Apartments direkt an der Fundstelle dürften sich über das Spektakel freuen, oder ärgern, weil sie die vorübergehende Ausgangssperre in die eigenen vier Wände kerkerte. Ein privater Sicherheitsdienst patrouillierte griesgrämig um Einsatzfahrzeuge und Absperrung herum.
»Der Mann wurde vor etwa 50 Minuten gefunden«, begrüßte sie ein Beamter des 4. Reviers, hochgerüstet mit Schussweste, Einsatzgürtel und weißem Plastikschallschlauch im Ohr, der die Gespräche vom Funkgerät heimlich in den Gehörgang übertrug.
Nathan staunte über den Fortschritt bei der Ausrüstung. Als er noch junger Kadett gewesen war, schickte man sie mit Freundschaftsaufklebern und gebügelten Anzughosen los. Schirmmütze und Lederjacke sorgten für ein schickes, repräsentatives Auftreten. Die Schutzwesten reichten nicht für alle Kollegen und die meisten verzichteten, angesichts von Wärmestau und fehlender Bewegungsfreiheit. Heutzutage setzte man die Schirmmütze nur noch bei offiziellen Anlässen auf. Die gebügelten Hosen waren praktischen Cargohosen mit Seitentaschen gewichen. Und Freundschaftsaufkleber ersetzte man durch Pfefferspray, Schlagstock sowie Kabelbinder. Einsatzhandschuhe, Messer, Achter und Taschenlampe vervollständigten den gefüllten Einsatzgürtel, der den Kollegen um mindestens fünf Kilogramm schwerer machte, inklusive der P30, einer 9mm-Selbstladepistole, samt Reservemagazin.
Nathan holte trotzdem seinen Dienstausweis hervor, auch stellvertretend für Jasmin, obwohl ihr blinkendes Zivilfahrzeug eigentlich zur Identifizierung reichte. Der Streifenpolizist nickte nur.
Bestatter, Rettungssanitäter und Notarzt warteten mit gebührendem Abstand bei ihren Fahrzeugen. Davor befand sich eine zweite Absperrung, der innere Ring sozusagen.
»Haben wir telefoniert?«, fragte Nathan den martialisch wirkenden Schutzmann.
»Die Leitstelle hat uns verbunden, ja«, bestätigte dieser, der sogleich zu einem Zivilisten zeigte, etwa eine Wurfweite entfernt, mit Dackel an der Leine und Polizeieskorte. »Dieser Gassigänger hat ihn gefunden.«
Jasmin schnappte die Information auf. Sofort begab sie sich zu dem Rentner, der trotz der Entdeckung einen gefassten Eindruck machte. Lediglich das Hündchen schien genervt von den vielen bunten Menschen und den blauen LEDs.
Der auskunftsfreudige Polizist begleitete Nathan zum Fundort. Sie zwängten sich durch einen engen, verwinkelten Durchgang, den der aufgestellte Sichtschutz offen ließ, ohne Einblick zu gewähren. Das Gelände war abschüssig. Die Ständer, an denen die Plane hing, waren in den Boden getrieben und verzurrt worden. Nathan musste aufpassen, dass er nicht wegrutschte.
»Gute Arbeit!«, lobte er den Beamten für das offene Zelt.
In dem neun Quadratmeter großen Bereich lag besagter Mann, oben ohne, mit durchnässter Hose und fehlenden Schuhen, auf dem Rücken, die Arme zur Seite gestreckt wie ein erschöpfter Schwimmer.
»Wurde er so angespült?«, hakte Nathan ungläubig nach.
»Nein, der Gassigänger hat ihn an der Böschung hochgezogen, weil er dachte, der Mann sei am Ertrinken.«
Der Kripo zog den Vergleich zwischen Gewicht des Toten und Konstitution des Rentnerretters.
Der Schupo bemerkte die Zweifel. »Er sagt, er hatte Hilfe beim Hochziehen.«
»Wer hat ihm geholfen?«
Schulterzucken. »Das müssen Sie ihn fragen.«
»War der Notarzt schon dran?«