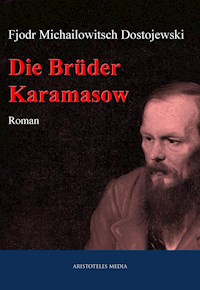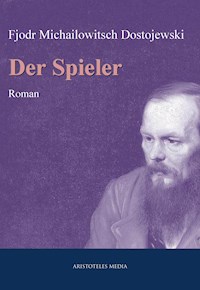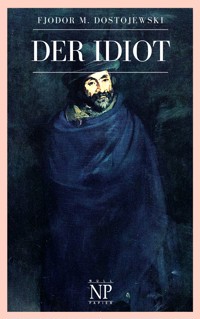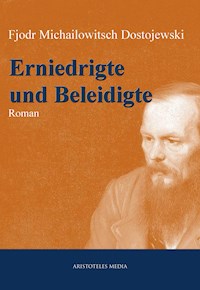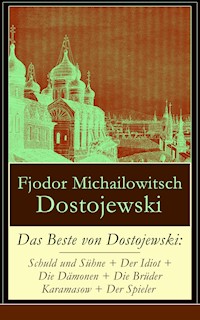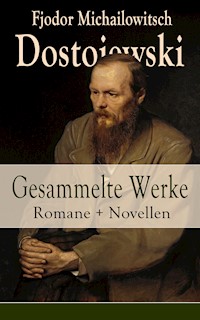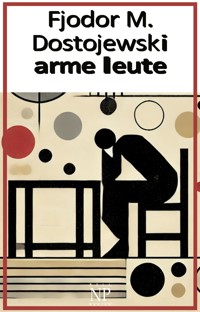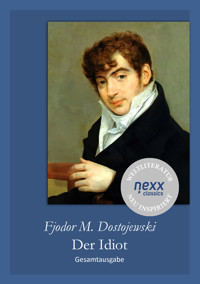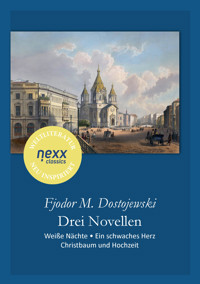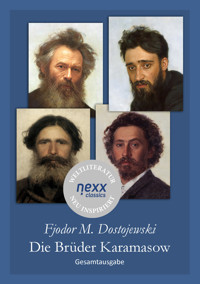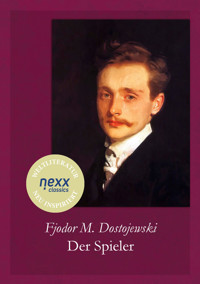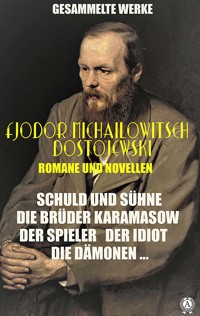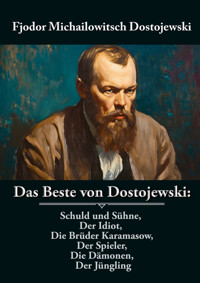Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Der Idiot Fjodor Michailowitsch Dostojewski - Der Idiot gehört zu den fünf bekanntesten Romanen Fjodor Dostojewskis, die zur Weltliteratur gezählt werden. Er wurde von Dostojewski in Genf 1867 begonnen und in Mailand 1868 beendet und erschien von Januar 1868 bis Februar 1869 in der Zeitschrift Russki Westnik.Der junge Fürst Myschkin, Titelheld des Romans, kehrt nach einem jahrelangen Aufenthalt in einer Schweizer Heilanstalt nach Sankt Petersburg zurück. Er leidet an Epilepsie (wie auch Dostojewski selbst), ist zwar den Jahren nach erwachsen, gleicht aber in emotionaler Hinsicht einem unerfahrenen Kind. Viele seiner Eigenschaften, die in der damaligen russischen Gesellschaft als idiotisch angesehen werden, beruhen schlicht auf Myschkins eigenwilliger Ehrlichkeit und Vertrauensseligkeit. Er zeigt sich großmütig und ist immer bereit, gelassen zu verzeihen und das Beste in den Menschen zu sehen und zu fördern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1209
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PUBLISHER NOTES:
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
LyFreedom.com
Erster Teil
I
Es war gegen Ende des November, bei Tauwetter, als sich um neun Uhr morgens ein Zug der Petersburg-Warschauer Bahn in voller Fahrt Petersburg näherte. Das Wetter war so feucht und neblig, daß das Tageslicht kaum zur Geltung kam; man konnte rechts und links von der Bahn aus den Fenstern der Wagen nur auf zehn Schritte mit Mühe etwas erkennen. Unter den Passagieren waren einige, die aus dem Ausland zurückkehrten; am meisten gefüllt waren aber die Abteile dritter Klasse, und zwar fast ausschließlich mit kleinen Geschäftsleuten, die aus nicht sehr weiter Entfernung kamen. Alle waren, wie das so zu sein pflegt, müde; allen waren während der Nacht die Augenlider schwer geworden, alle fröstelten, alle Gesichter waren gelblich, von derselben Farbe wie der Nebel.
In einem Wagen dritter Klasse saßen einander seit dem Morgengrauen dicht am Fenster zwei Passagiere gegenüber: beides junge Leute, beide fast ohne Gepäck, beide nicht elegant gekleidet, beide mit recht interessanten Gesichtern und beide von dem Wunsch erfüllt, endlich miteinander in ein Gespräch zu kommen. Wenn sie beide voneinander gewußt hätten, wodurch sie gerade in diesem Augenblick interessant waren, so hätten sie sich gewiß darüber gewundert, daß der Zufall sie so seltsam in einem Wagen dritter Klasse der Petersburg-Warschauer Eisenbahn einander gegenübergesetzt hatte. Der eine von ihnen war von kleiner Statur, etwa siebenundzwanzig Jahre alt und hatte krauses, fast schwarzes Haar und kleine, graue, aber feurige Augen. Seine Nase war breit und plattgedrückt, die Backenknochen traten stark hervor; die schmalen Lippen verzogen sich fortwährend zu einem dreisten, spöttischen dies alles genau, zum Teil weil er nichts anderes zu tun hatte, und fragte schließlich mit jenem taktlosen Lächeln, durch das manchmal in so ungenierter, geringschätziger Weise das Vergnügen der Leute über das Mißgeschick des Nächsten zum Ausdruck kommt:
»Ist Ihnen kalt?«
Er machte dabei Bewegungen mit den Schultern.
»Ja, sehr kalt«, antwortete der Reisegenosse mit großer Bereitwilligkeit, »und sehen Sie, dabei haben wir noch Tauwetter. Wie wäre es erst, wenn wir Kälte hätten? Ich hatte gar nicht gedacht, daß es bei uns so kalt wäre. Ich bin es nicht mehr gewohnt.«
»Sie kommen wohl aus dem Ausland?«
»Ja, aus der Schweiz.«
»Füt! Nun sehen Sie einmal an!«
Der Schwarzhaarige tat einen Pfiff und lachte.
Es kam ein Gespräch in Gang. Die Bereitwilligkeit des blonden jungen Mannes in dem Schweizermantel, auf alle Fragen seines schwarzhaarigen Gefährten zu antworten, war erstaunlich; er merkte in seiner Harmlosigkeit offenbar gar nicht, daß manche dieser Fragen sehr geringschätzig klangen und höchst unpassend und müßig waren. Bei seinen Antworten teilte er unter anderem mit, daß er tatsächlich lange Zeit nicht in Rußland gewesen sei, über vier Jahre; man habe ihn wegen einer Krankheit ins Ausland geschickt, wegen einer eigentümlichen Nervenkrankheit nach Art der Epilepsie oder des Veitstanzes, die sich in Zuckungen und Krämpfen geäußert habe. Der schwarzhaarige junge Mann lächelte beim Zuhören einige Male, namentlich lachte er auf, als auf die Frage: »Na, sind Sie denn nun geheilt?« der Blonde erwiderte: »Nein, geheilt bin ich nicht.«
»Haha! Da haben Sie also Ihr Geld vergebens bezahlt, und wir hier schenken jenen Leuten Vertrauen!« bemerkte der Schwarzhaarige spöttisch.
»Ja, das ist durchaus richtig!« mischte sich ein danebensitzender schlecht gekleideter Herr in das Gespräch, so eine Art von geriebenem Amtsschreiber, etwa vierzig Jahre alt, kräftig gebaut, mit roter Nase und einem Gesicht voller Pickel. »Das ist durchaus richtig; sie saugen uns Russen das Mark aus, ohne selbst etwas dafür zu leisten!«
»Oh, wie Sie sich in meinem Fall irren!« erwiderte der Schweizer Patient in ruhigem, versöhnlichem Ton. »Ich kann ja allerdings nicht darüber disputieren, weil ich keinen Gesamtüberblick habe, aber mein Arzt hat mir von dem wenigen, was er besaß, noch das Geld für die Fahrt hierher gegeben, und fast zwei Jahre lang hat er mich dort aus seinen eigenen Mitteln unterhalten.«
»Wie? Hatten Sie wirklich niemand, der für Sie bezahlte?« fragte der Schwarzhaarige.
»Nein. Herr Pawlischtschew, der die Kosten meines dortigen Aufenthalts getragen hatte, ist vor zwei Jahren gestorben; ich schrieb dann hierher an die Generalin Jepantschina, eine entfernte Verwandte von mir, habe aber keine Antwort erhalten. So bin ich denn hergereist.«
»Wo gedenken Sie denn zu bleiben?«
»Sie meinen, wo ich Wohnung nehmen werde?... Das weiß ich noch nicht, wirklich nicht... es ist noch ungewiß...«
»Darüber haben Sie noch keinen Entschluß gefaßt?«
Beide Zuhörer brachen von neuem in ein Gelächter aus.
»Und dieses Bündelchen enthält wohl Ihre ganze Habe?« fragte der Schwarzhaarige.
»Ich möchte wetten, daß es so ist«, fiel mit sehr zufriedener Miene der rotnasige Beamte ein, »und daß Sie kein weiteres Gepäck im Gepäckwagen haben. Obwohl Armut keine Schande ist, wie man immer wieder bemerken muß.«
Es stellte sich heraus, daß es sich wirklich so verhielt: der blonde junge Mann gestand dies sofort mit großer Bereitwilligkeit ein.
»Ihr Bündelchen hat trotzdem einen gewissen Wert«, fuhr der Beamte, nachdem er sich satt gelacht hatte, fort (bemerkenswert war, daß auch der Eigentümer des Bündelchens selbst schließlich beim Anblick der beiden mitzulachen anfing, was deren Heiterkeit noch vergrößerte). »Man möchte zwar wetten, daß keine Rollen mit ausländischen Goldstücken, wie Napoleondors, Friedrichsdors oder holländischen Dukaten, darin sind; das kann man zum Beispiel schon aus Ihren ausländischen Gamaschen schließen, aber wenn man zu Ihrem Bündelchen noch eine solche Verwandte hinzunimmt wie die Generalin Jepantschina, dann gewinnt auch das Bündelchen gewissermaßen einen höheren Wert, selbstverständlich nur in dem Fall, wenn die Generalin Jepantschina wirklich Ihre Verwandte ist und Sie sich nicht aus Zerstreutheit irren... was einem außerordentlich leicht passieren kann... sagen wir: infolge eines Übermaßes von Phantasie.«
»Oh, Sie haben wieder das Richtige getroffen«, erwiderte der blonde junge Mensch, »denn ich befinde mich wirklich beinah in einem Irrtum, das heißt sie ist kaum meine Verwandte; ja ich habe mich tatsächlich damals gar nicht darüber gewundert, daß ich keine Antwort nach der Schweiz bekam. Ich hatte das eigentlich auch so erwartet.«
»Da haben Sie das Geld für die Frankierung des Briefes unnütz ausgegeben. Hm!... Nun, wenigstens sind Sie offenherzig und aufrichtig, und das ist löblich! Hm!... Den General Jepantschin kenne ich, im Grunde weil er eine allgemein bekannte Persönlichkeit ist, und den verstorbenen Herrn Pawlischtschew, der Sie in der Schweiz unterhalten hat, habe ich ebenfalls gekannt, vorausgesetzt, daß es sich um Nikolai Andrejewitsch Pawlischtschew handelt, denn es waren zwei Vettern. Der andere befindet sich noch auf der Krim. Nikolai Andrejewitsch aber, der Verstorbene, war ein sehr achtbarer Mann, hatte gute Verbindungen und besaß seinerzeit viertausend Seelen...«
»Ganz richtig, er hieß Nikolai Andrejewitsch Pawlischtschew.« Nachdem der junge Mensch diese Antwort gegeben hatte, betrachtete er unverwandt und mit lebhaftem Interesse den Herrn, der sich über alles so gut orientiert zeigte.
Diese Herren Alleswisser begegnen einem manchmal, und in einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht sogar ziemlich häufig. Sie wissen alles; der ganze unruhige Forschungstrieb ihres Verstandes und ihre gesamten Fähigkeiten streben unaufhaltsam nach einer Seite hin, natürlich infolge des Mangels an wichtigeren Lebensinteressen und Anschauungen, wie ein moderner Denker sich ausdrücken würde. Bei dem Ausdruck »sie wissen alles« muß man übrigens an ein ziemlich beschränktes Gebiet denken: wo der und der angestellt ist, mit wem er bekannt ist, wieviel Vermögen er besitzt, wo er Gouverneur gewesen ist, was für eine Frau er genommen hat, wieviel Mitgift er dabei erhalten hat, wer sein Vetter und sein entfernterer Vetter ist und so weiter und so weiter, und sonst noch allerlei von dieser Art. Großenteils gehen diese Alleswisser mit durchgestoßenen Ellbogen umher und bekommen siebzehn Rubel Gehalt monatlich. Die Leute, über die sie alle möglichen Einzelheiten wissen, würden natürlich nicht sagen können, warum jene an ihnen ein derartiges Interesse haben, und dabei finden viele dieser Alleswisser an diesem Wissen, das einer ganzen Wissenschaft gleichkommt, ein ausgesprochenes Vergnügen und gelangen dadurch zu Selbstachtung und sogar zu einem sehr hohen Grad seelischer Zufriedenheit. Und es ist auch eine verführerische Wissenschaft. Ich habe Gelehrte, Literaten, Dichter und Staatsmänner gekannt, die in dieser Wissenschaft ihre größte Befriedigung, ihr höchstes Ziel fanden und sogar ausgesprochen nur hierdurch Karriere machten.
Im weiteren Verlauf dieses Gesprächs gähnte der schwarzhaarige junge Mensch, blickte ziellos durchs Fenster und wartete mit Ungeduld auf das Ende der Reise. Er war etwas zerstreut, sogar sehr zerstreut, beinah aufgeregt; ja er benahm sich einigermaßen sonderbar: manchmal hörte er zu, ohne recht zuzuhören, sah, ohne recht zu sehen, und lachte, ohne im nächsten Augenblick zu wissen und sich zu erinnern, worüber er eigentlich gelacht hatte.
»Aber gestatten Sie die Frage: mit wem habe ich die Ehre?« wandte sich auf einmal der Herr mit dem Gesicht voller Pickel an den blonden jungen Mann mit dem Bündelchen.
»Fürst Lew Nikolajewitsch Myschkin«, antwortete dieser, ohne zu zögern, mit größter Bereitwilligkeit.
»Fürst Myschkin? Lew Nikolajewitsch? Kenne ich nicht. Nicht einmal vom Hörensagen«, antwortete der Beamte nachdenkend. »Das heißt, ich meine nicht den Namen; der Name ist ja historisch und in Karamsins Geschichte Rußlands zu finden; ich meine Ihre Person, und überhaupt begegnen Fürsten Myschkin einem nirgends mehr; man hört von ihnen nicht einmal reden.«
»Wie könnte es auch anders sein!« versetzte der Fürst sogleich. »Fürsten Myschkin gibt es jetzt außer mir gar keine mehr; ich glaube, ich bin der letzte. Und was meinen Vater und meinen Großvater anlangt, so besaßen die nur ein einziges Gut, auf dem sie zurückgezogen lebten. Mein Vater war übrigens Leutnant bei der Linie, vorher Fähnrich. Und nun weiß ich nicht, in welcher Weise die Generalin Jepantschina zu den Myschkinschen Fürstentöchtern gehört; sie ist ebenfalls die Letzte in ihrer Art...«
»Hahaha! Die Letzte in ihrer Art! Haha! Wie Sie das gedreht haben!« kicherte der Beamte.
Auch der schwarzhaarige junge Mann lächelte. Der Blonde war etwas verlegen, daß es ihm gelungen war, ein allerdings ziemlich einfaches Wortspiel zu machen.
»Seien Sie überzeugt, ich habe es ganz ohne Absicht gesagt«, erklärte er schließlich einigermaßen befangen.
»Sehr begreiflich, sehr begreiflich!« stimmte ihm der Beamte heiter bei.
»Haben Sie denn dort auch Wissenschaften betrieben, Fürst, bei Ihrem Professor?« fragte unvermittelt der Schwarzhaarige.
»Ja... allerdings...«
»Ich für meine Person habe nie etwas studiert.«
»Auch ich nur ein klein wenig«, fügte der Fürst in einem Tone hinzu, der beinah wie eine Bitte um Entschuldigung klang. »Mir einen regulären Unterricht zu erteilen, hielt man in Anbetracht meiner Krankheit nicht für möglich.«
»Kennen Sie die Familie Rogoshin?« fragte der schwarzhaarige junge Mensch schnell.
»Nein, ich kenne sie nicht, gar nicht. Ich kenne in Rußland überhaupt nur wenige Menschen. Ist Ihr Name Rogoshin?«
»Ja, ich heiße Rogoshin, Parfen Rogoshin.«
»Parfen? Sind Sie da nicht vielleicht ein Mitglied eben jener Familie Rogoshin...«, begann der Beamte mit noch gesteigerter Wichtigtuerei.
»Jawohl, eben jener, eben jener«, unterbrach ihn schnell und mit unhöflicher Ungeduld der Schwarzhaarige, der überhaupt dem Beamten mit dem Gesicht voller Pickel nie Beachtung geschenkt, sondern gleich von Anfang an immer nur zu dem Fürsten gesprochen hatte.
»Ja ... ist es möglich?« rief der Beamte starr vor Staunen, die Augen traten ihm beinah aus den Höhlen, und sein ganzes Gesicht nahm sogleich einen ehrerbietigen, knechtischen, ja erschrockenen Ausdruck an. »Sind Sie ein Sohn eben jenes erblichen Ehrenbürgers Semjon Parfenowitsch Rogoshin, der vor einem Monat starb und ein bares Kapital von zwei und einer halben Million hinterließ?«
»Woher haben Sie denn erfahren, daß er ein bares Kapital von zwei und einer halben Million hinterlassen hat?« unterbrach ihn der Schwarzhaarige, der sich auch diesmal nicht dazu herabließ, den Beamten anzusehen. »Nun sehe mal einer den Kerl an!« (Er zwinkerte dem Fürsten zu.) »Und was haben die Leute nur davon, daß sie sich sofort mit Schmeicheleien an einen heranmachen? Aber wahr ist, daß mein Vater gestorben ist und ich jetzt einen Monat nachher beinah ohne Stiefel von Pskow nach Hause fahre. Weder mein niederträchtiger Bruder noch meine Mutter haben mir Geld oder eine Benachrichtigung geschickt nichts haben sie mir geschickt! Als ob ich ein Hund wäre! Einen ganzen Monat lang habe ich in Pskow im Fieber gelegen!«
»Aber jetzt werden Sie mehr als ein Milliönchen mit einemmal bekommen, mindestens soviel, o mein Herrgott!« rief der Beamte und schlug die Hände zusammen.
»Na, was geht ihn das an? Sagen Sie bitte selbst!« sagte Rogoshin, wieder mit dem Kopfe auf ihn hindeutend, in gereiztem und ärgerlichem Ton. »Ich werde Ihnen ja doch nicht eine einzige Kopeke geben, und wenn Sie sich vor mir auf den Kopf stellen und auf den Händen gehen.«
»Das werde ich tun, das werde ich tun!«
»Da haben wir's! Aber ich werde Ihnen nichts geben, gar nichts, und wenn Sie eine ganze Woche lang tanzen!«
»Sie brauchen mir nichts zu geben! Das verlange ich auch gar nicht! Sie brauchen mir nichts zu geben! Aber ich werde doch tanzen. Meine Frau und meine kleinen Kinder werde ich im Stich lassen und vor Ihnen tanzen. Aus reiner Liebenswürdigkeit!«
»Pfui über Sie!« sagte der Schwarzhaarige und spuckte aus. »Vor fünf Wochen befand ich mich in demselben Zustand wie Sie jetzt«, wandte er sich an den Fürsten. »Mit einem einzigen Bündelchen entfloh ich vor meinem Vater nach Pskow zu einer Tante, und dort habe ich am Fieber krank gelegen, und er ist in meiner Abwesenheit gestorben. Ein Schlagfluß hat ihm den Garaus gemacht. Ich wünsche dem Verstorbenen die ewige Ruhe; aber er hat mich damals fast zu Tode geprügelt. Sie können es mir glauben, Fürst, bei Gott! Wäre ich damals nicht davongelaufen, so hätte er mich auf dem Fleck totgeschlagen.«
»Hatten Sie ihn durch irgend etwas gereizt?« fragte der Fürst und betrachtete mit einem gewissen besonderen Interesse den Millionär im Schafpelz.
Aber obgleich schon in dem Begriff einer zu erbenden Million möglicherweise etwas Merkwürdiges lag, so war da doch noch etwas anderes, was den Fürsten in Verwunderung versetzte und sein Interesse weckte; und auch Rogoshin selbst unterhielt sich aus irgendeinem Grund gern mit dem Fürsten, wiewohl er anscheinend mehr ein mechanisches als seelisches Bedürfnis nach Unterhaltung hatte, sozusagen mehr aus Zerstreutheit als aus Gutherzigkeit, aus Unruhe und Aufregung, um nur jemanden anzusehen und über irgendeinen Gegenstand die Zunge in Bewegung zu setzen. Es schien, daß er auch jetzt noch Fieber hatte, wenigstens in einem gewissen Grade. Was den Beamten anlangt, so hing dieser ordentlich an Rogoshins Mund, wagte kaum zu atmen und fing jedes Wort auf und legte es gleichsam auf die Waage, als hielte er es für einen Brillanten.
»Er war zornig, gewiß, ja, und vielleicht nicht ohne Grund«, antwortete Rogoshin, »aber wer sich am schlimmsten gegen mich benahm, das war mein Bruder. Von meiner Mutter will ich nichts sagen; sie ist eine alte Frau, liest die Lebensbeschreibungen der Heiligen, sitzt mit alten Weibern zusammen, und was Bruder Senka anordnet, das muß geschehen. Aber er, warum hat er mich seinerzeit nicht benachrichtigt? Na, begreifen läßt es sich schon! Es ist wahr, ich lag damals ohne Besinnung. Und es war auch ein Telegramm abgeschickt, sagen sie. Und es ist auch ein Telegramm bei der Tante angekommen. Aber sie ist seit dreißig Jahren Witwe und sitzt immer vom Morgen bis zum Abend mit Gottesnarren zusammen. Sie ist beinah eine Nonne, oder eigentlich noch schlimmer als eine Nonne. Vor Telegrammen hat sie von jeher Angst gehabt, und so hat sie auch dieses uneröffnet auf der Polizei abgeliefert, und da wird es wohl noch liegen. Erst Konew, Wassilij Wassiljewitsch Konew, hat sich meiner angenommen und mir alles geschrieben. Von der Brokatdecke auf dem Sarge des Vaters hat der Bruder bei Nacht die massiv goldenen Quasten abgeschnitten und gesagt: ›Die sind einen tüchtigen Batzen Geld wert.‹ Schon allein dafür kann er nach Sibirien kommen, wenn ich will, denn das ist Heiligtumsschändung. He, Sie Vogelscheuche!« wandte er sich an den Beamten. »Wie steht es im Gesetz: ist das Heiligtumsschändung?«
»Jawohl, Heiligtumsschändung, Heiligtumsschändung!« stimmte ihm der Beamte sogleich bei.
»Und kommt einer dafür nach Sibirien?«
»Gewiß, nach Sibirien, nach Sibirien! Ohne weiteres nach Sibirien!«
»Bei mir zu Hause denken sie bestimmt, daß ich noch krank sei«, fuhr Rogoshin, zu dem Fürsten gewendet, fort. »Aber ich habe mich, ohne ein Wort zu sagen, obwohl ich noch nicht hergestellt bin, still auf die Bahn gesetzt und fahre jetzt hin. Nun mach mir das Tor auf, Bruder Semjon Semjonowitsch! Er hat mich bei meinem verstorbenen Vater verpetzt, das weiß ich. Aber daß ich wirklich durch die Geschichte mit Nastasja Filippowna damals den Vater aufgebracht habe, das ist wahr. Da habe ich allein schuld. Das habe ich in einem Augenblick der Unbedachtsamkeit getan.«
»Durch die Geschichte mit Nastasja Filippowna?« sagte dir Beamte in kriecherischem Tone, wie wenn er etwas überlegte.
»Die Dame kennen Sie nicht!« schrie ihn Rogoshin ungeduldig an.
»Und ich kenne sie doch!« erwiderte der Beamte triumphierend.
»Ach was! Es gibt viele Damen, die Nastasja Filippowna heißen! Und ich muß sagen: was sind Sie für ein unverschämtes Subjekt! Na, das habe ich doch gleich gewußt, daß sich irgend so ein Subjekt an mich hängen wird!« fuhr er, zum Fürsten gewendet, fort.
»Aber vielleicht kenne ich sie doch!« versetzte der Beamte beharrlich. »Da müßte ich nicht Lebedew sein, wenn ich sie nicht kennen sollte! Euer Durchlaucht belieben mir einen Vorwurf zu machen; aber wie, wenn ich Ihnen den Beweis liefere? Also es ist dieselbe Nastasja Filippowna, um derentwillen Ihr Vater Sie mit einem Haselstock ermahnen wollte; es ist Nastasja Filippowna Baraschkowa, sozusagen sogar eine vornehme Dame und in ihrer Art eine Fürstin, und sie hat ein Verhältnis mit einem gewissen Tozkij, mit Afanassij Iwanowitsch Tozkij, ausschließlich mit diesem einen, einem Gutsbesitzer und Großkapitalisten, Mitglied verschiedener Handelsgesellschaften, der infolge dieser seiner kommerziellen Tätigkeit mit dem General Jepantschin in sehr freundschaftlicher Beziehung steht...«
»Na, nun sieh mal an!« rief Rogoshin, wirklich erstaunt, aus. »Pfui Teufel, er weiß wahrhaftig genau Bescheid.«
»Er weiß alles! Lebedew weiß alles! Auch Alexaschka Lidiatschows Begleiter bin ich zwei Monate lang gewesen, Euer Durchlaucht, und zwar ebenfalls nach dem Tode seines Vaters, und ich kenne alle, geradezu alle seine Heimlichkeiten, und es kam so weit, daß er ohne mich keinen Schritt tat. Jetzt sitzt er im Schuldgefängnis; aber damals hatte ich Gelegenheit, auch Fräulein Armance und Fräulein Coralie und die Fürstin Pazkaja und Nastasja Filippowna kennenzulernen, und auch vieles, vieles zu erfahren, hatte ich Gelegenheit.«
»Nastasja Filippowna? Hat sie etwa mit Lichatschow...«, rief Rogoshin und blickte den Redenden böse an; sogar seine Lippen waren blaß geworden und zitterten.
»N-ein! N-ein! Entschieden nein!« beeilte sich der Beamte, schnell gefaßt, zu erwidern. »Bei der konnte Lichatschow durch kein Geld zum Ziele gelangen! Nein, die ist von anderer Art als Fräulein Armance. Da ist Tozkij der einzige. Abends sitzt sie im Großen Theater oder im Französischen Theater in ihrer eigenen Loge. Die Offiziere reden ja da unter sich allerlei; aber auch die können nichts beweisen. ›Da ist die berühmte Nastasja Filippowna‹, sagen sie, aber das ist auch alles; sonst ist da nichts zu sagen! Weil eben nichts vorliegt.«
»Ja, so verhält sich das alles«, bestätigte Rogoshin mit trüber, finsterer Miene. »Auch Saljoshew hat es mir damals gesagt. Ich ging damals, Fürst, in einem Schnurrock, den mein Vater schon vor zwei Jahren abgelegt hatte, über den Newskij Prospekt, und sie kam aus einem Laden heraus und stieg in ihren Wagen. Da stand ich auf der Stelle in Flammen. Ich begegnete meinem Freunde Saljoshew; der sah anders aus als ich; er geht wie ein Friseurgehilfe, immer die Lorgnette im Auge; wir aber mußten bei unserm Vater in Schmierstiefeln gehen und uns mit fastenmäßiger Kohlsuppe amüsieren. ›Die ist nichts für dich‹, sagte er; ›das ist‹, sagte er, ›eine Fürstin, sie heißt Nastasja Filippowna, mit dem Familiennamen Baraschkowa, und lebt mit Tozkij; Tozkij aber weiß jetzt nicht, wie er von ihr loskommen soll, weil er nämlich schon ganz in die soliden Jahre hineingekommen ist (er ist fünfundfünfzig alt) und eine der ersten Schönheiten von Petersburg heiraten will.‹ Dann teilte er mir noch mit, daß ich Nastasja Filippowna an demselben Tage im Großen Theater wiedersehen könne, im Ballett; sie werde in ihrer Parterreloge sitzen. Bei uns zu Hause, bei unserm Vater, da hätte es mal einer probieren sollen und sagen, er wolle ins Ballett gehen; der Vater hätte kurzen Prozeß gemacht und ihn halbtot geprügelt! Ich schlich mich indessen still für ein Stündchen weg und sah Nastasja Filippowna wieder. Die ganze folgende Nacht konnte ich nicht schlafen. Am andern Morgen gab mir der Vater zwei fünfprozentige Staatsschuldscheine, jeden zu fünftausend Rubel, und sagte: ›Geh hin und verkaufe sie; dann trage siebentausendfünfhundert Rubel zu Andrejew aufs Kontor und bezahle sie dort; und was du von den zehntausend noch übrig hast, das bring geradeswegs hierher und liefere es mir ab; ich werde auf dich warten.‹ Die Staatsschuldscheine verkaufte ich und empfing das Geld dafür; aber zu Andrejew aufs Kontor begab ich mich nicht, sondern ich ging, ohne mich umzusehen, nach dem Englischen Magazin und suchte dort für das ganze Geld ein Paar Ohrgehänge aus, jedes mit einem Brillanten fast von Nußgröße; vierhundert Rubel blieb ich noch schuldig; ich nannte meinen Namen, und man gab mir Kredit. Mit den Ohrgehängen ging ich gleich zu Saljoshew: ›So und so, Bruder‹, sagte ich, ›wir wollen zu Nastasja Filippowna gehen.‹ Wir gingen hin. Was ich damals unter den Füßen und vor mir und rechts und links hatte, weiß ich nicht; daran habe ich keine Erinnerung. Wir traten bei ihr gleich in den Salon ein, und dann kam sie selbst zu uns. Ich ließ übrigens damals nicht bekannt werden, daß ich selbst der Geber sei, sondern Saljoshew sagte: ›Von Parfen Rogoshin, der Sie gestern gesehen hat, ein kleines Andenken; haben Sie die Gewogenheit, es anzunehmen!‹ Sie öffnete das Etui, betrachtete den Schmuck und lächelte. ›Sagen Sie Ihrem Freund Herrn Rogoshin meinen Dank‹, sagte sie, ›für seine liebenswürdige Aufmerksamkeit!‹ Dann verneigte sie sich und ging hinaus. Na, warum bin ich damals nicht dort auf dem Fleck gestorben! Aber wenn ich fortging, so tat ich es mit dem Gedanken: ›Lebendig komme ich doch nie wieder her!‹ Was ich aber am schwersten als Kränkung empfand, das war, daß diese Kanaille, der Saljoshew, sich angemaßt hatte, alles allein zu reden und zu tun. Ich bin von kleiner Statur und war wie ein Plebejer gekleidet und hatte dagestanden, sie angestarrt und geschwiegen, weil ich mich schämte; er aber in modischem Anzug, mit pomadisiertem und gekräuseltem Haar, mit seinem frischen Teint und seiner karierten Krawatte hatte den Liebenswürdigen gespielt und ein Mal über das andere gedienert, und aller Wahrscheinlichkeit nach hatte sie ihn für mich genommen! ›Na‹ sagte ich, als wir hinausgegangen waren, ›du wage nicht, dich wieder bei mir blicken zu lassen, verstehst du?‹ Er lachte: ›Aber wie wirst du jetzt vor deinem Vater Semjon Parfenytsch Rechenschaft ablegen?‹ Die Wahrheit zu sagen, ich hatte damals schon vor, ohne erst nach Hause zu gehen, mich ins Wasser zu stürzen; aber ich dachte: ›Es ist ja doch ganz gleich!‹ und kehrte wie ein armer Sünder nach Hause zurück.«
»O weh, o weh!« sagte der Beamte und schnitt dabei eine Grimasse; ja er schüttelte sich sogar mit dem ganzen Leibe. »Und der Selige war imstande, nicht nur wegen zehntausend, sondern schon wegen zehn Rubel einen ins Jenseits zu spedieren.« Er nickte dem Fürsten zu. Der Fürst sah Rogoshin mit lebhaftem Interesse an; es schien, als sei der in diesem Augenblick noch blasser.
»Dazu war er imstande!« wiederholte Rogoshin. »Aber was wissen Sie davon?« Dann erzählte er dem Fürsten weiter: »Er erfuhr sogleich alles; Saljoshew hatte es jedem, der ihm begegnete, ausgeschwatzt. Der Vater nahm mich, schloß mich im oberen Stockwerk ein und prügelte mich eine ganze Stunde lang. ›Und das ist nur eine Vorbereitung für dich‹, sagte er. ›Heute abend komme ich, um dir gute Nacht zu sagen.‹ Sollte man's glauben? Der alte Mann fuhr zu Nastasja Filippowna, verbeugte sich tief vor ihr und flehte sie unter Tränen an; endlich holte sie ihm das Etui herbei, warf es ihm hin und sagte: ›Da hast du deine Ohrringe, alter Graubart; sie sind für mich jetzt um das Zehnfache im Wert gestiegen, nun ich weiß, daß Parfen sie einem so strengen Vater zum Trotz beschafft hat. Grüße Parfen Semjonytsch von mir und bestelle ihm meinen Dank!‹ Na, ich hatte unterdessen mich von meiner Mutter segnen lassen und mir von Sergej Protuschin zwanzig Rubel geborgt; damit setzte ich mich auf die Bahn und fuhr nach Pskow, wo ich fiebernd ankam. Dort langweilten mich die alten Frauen durch das Vorlesen von Gebeten aus dem Kirchenkalender rein zu Tode, und ich saß betrunken dabei; als ich mein letztes Geld in den Kneipen vertrunken hatte, lag ich die ganze Nacht bewußtlos auf der Straße, und am Morgen hatte ich dann das Fieber; und außerdem hatten mich in der Nacht auch noch die Hunde angefressen. Nur mit Mühe habe ich mich erholt.«
»Nun, nun, jetzt wird aber Nastasja Filippowna in einer andern Tonart zu uns reden!« kicherte der Beamte und rieb sich dabei die Hände. »Was ist jetzt an jenem Ohrgehänge gelegen, mein Herr! Jetzt werden wir ihr solche Ohrgehänge zum Ersatz schenken, daß ...«
»Hören Sie mal, wenn Sie nur noch ein einziges Mal ein Wort über Nastasja Filippowna sagen, dann gnade Ihnen Gott! Ich werde Sie durchprügeln, wenn Sie auch mit Lichatschow verkehrt haben!« schrie Rogoshin und packte ihn kräftig am Kragen.
»Aber wenn Sie mich durchprügeln, so bedeutet das, daß Sie mich nicht von sich stoßen! Prügeln Sie mich! Gerade dadurch gewinnen Sie mich zum Freunde! Wenn Sie mich durchgehauen haben, so haben Sie gerade dadurch unsere Freundschaft besiegelt... Aber da sind wir angelangt!«
Sie fuhren tatsächlich in den Bahnhof ein. Obgleich Rogoshin gesagt hatte, daß er ganz in der Stille abgereist sei, erwarteten ihn doch schon mehrere Menschen. Sie riefen und winkten ihm mit den Mützen.
»Nun sieh mal, Saljoshew ist auch da!« murmelte Rogoshin, indem er mit einem triumphierenden, sogar etwas boshaften Lächeln nach ihnen hinblickte; dann wandte er sich auf einmal zum Fürsten. »Fürst, ich weiß nicht, weswegen ich dich liebgewonnen habe. Vielleicht, weil ich dich in einem solchen Augenblick getroffen habe; aber den hier habe ich doch auch getroffen« (er wies auf Lebedew), »und den habe ich nicht liebgewonnen. Komm zu mir, Fürst! Wir werden dir diese Gamaschen ausziehen; ich werde dir den besten Marderpelz kaufen, dir den schönsten Frack machen lassen, eine weiße Weste oder was für eine du sonst wünschst; ich werde dir die Taschen voll Geld stopfen, und...dann wollen wir zu Nastasja Filippowna fahren! Wirst du kommen oder nicht?«
»Gehen Sie darauf ein, Fürst Lew Nikolajewitsch!« fügte Lebedew in eindringlichem, feierlichem Tone hinzu. »Lassen Sie sich das ja nicht entgehen! Lassen Sie sich das ja nicht entgehen!«
Fürst Myschkin stand auf, streckte Rogoshin höflich die Hand hin und sagte freundlich zu ihm:
»Ich werde mit dem größten Vergnügen kommen und danke Ihnen herzlich dafür, daß Sie mich liebgewonnen haben. Ich werde sogar vielleicht heute schon kommen, wenn ich Zeit finde. Denn ich sage Ihnen aufrichtig: auch Sie haben mir sehr gefallen, und besonders als Sie von den Brillantohrgehängen erzählten. Aber auch schon vor den Ohrgehängen haben Sie mir gefallen, obwohl Sie eine so düstere Miene haben. Ich danke Ihnen auch für die versprochenen Kleider und den Pelz; denn ich werde wirklich Kleider und einen Pelz bald nötig haben. An Geld besitze ich in diesem Augenblick kaum eine Kopeke.«
»Geld wird dasein, zum Abend wird Geld dasein; komm nur!«
»Es wird dasein, wird dasein«, echote der Beamte. »Zum Abend, noch vor Sonnenuntergang, wird welches dasein!«
»Sind Sie ein großer Freund des weiblichen Geschlechts, Fürst? Sagen Sie es mir schon vorher!«
»Ich? N-n-nein! Ich bin ja ... Sie wissen vielleicht nicht, ich kenne ja infolge meiner angeborenen Krankheit die Frauen überhaupt nicht.«
»Nun, wenn's so ist«, rief Rogoshin, »so bist du ja ein richtiger Gottesnarr, Fürst, und solche Menschen wie dich liebt Gott.«
»Und solche Menschen liebt Gott der Herr«, wiederholte der Beamte.
»Und Sie können mir folgen, Sie Schmeißfliege!« sagte Rogoshin zu Lebedew, und alle verließen den Bahnwagen.
Lebedew hatte also schließlich doch sein Ziel erreicht. Bald entfernte sich der lärmende Haufe in Richtung des Wosnessenskij Prospekts. Der Fürst mußte sich nach der Litejnaja wenden. Es war feucht und naß; der Fürst erkundigte sich bei Vorübergehenden: er hörte, daß es bis zum Ende seines Weges etwa drei Werst seien, und entschied sich dafür, eine Droschke zu nehmen.
II
Der General Jepantschin wohnte in seinem eigenen Hause, etwas seitwärts von der Litejnaja, nach der Preobrashenskij-Kathedrale zu. Außer diesem stattlichen Hause, von dem fünf Sechstel vermietet waren, besaß General Jepantschin noch ein gewaltiges Haus in der Sadowaja, das gleichfalls einen sehr hohen Ertrag brachte. Außer diesen beiden Häusern hatte er dicht bei Petersburg ein sehr bedeutendes, einträgliches Gut und ferner im Petersburger Kreise eine Fabrik. In früheren Zeiten hatte General Jepantschin, wie allgemein bekannt war, sich auch an Branntweinpachtungen beteiligt. Jetzt war er Mitglied mehrerer solider Aktiengesellschaften und hatte dort eine sehr gewichtige Stimme. Er galt als ein Mann mit großem Vermögen, ausgedehnter Tätigkeit und einflußreichen Verbindungen. darstellt, ein Lebensalter, von dem eigentlich erst das richtige Leben beginnt. Seine Gesundheit, seine frische Gesichtsfarbe, die kräftigen, wenn auch schwarzen Zähne, der stämmige, untersetzte Körperbau, der ernste Ausdruck morgens im Dienste und die heitere Miene abends beim Kartenspiel oder bei seiner Erlaucht: all dies trug zu seinen gegenwärtigen und künftigen Erfolgen bei und bestreute den Lebensweg Seiner Exzellenz mit Rosen.
Der General erfreute sich einer blühenden Familie. Allerdings gab es hier für ihn nicht lauter Rosen; aber dafür war so manches da, worauf schon seit längerer Zeit die wichtigsten Hoffnungen und Bestrebungen Seiner Exzellenz in ernster, herzlicher Empfindung gerichtet waren. Und welche Bestrebungen im Leben könnten auch wichtiger und heiliger sein als die elterlichen? Woran soll jemand sein Herz hängen, wenn nicht an die Familie? Die Familie des Generals bestand aus seiner Gattin und drei erwachsenen Töchtern. Der General hatte in sehr jugendlichem Alter geheiratet, als er noch im Range eines Leutnants stand, und zwar ein mit ihm fast gleichaltriges Mädchen, das weder Schönheit noch Bildung besaß und ihm nur fünfzig Seelen mitbrachte, die allerdings als Grundlage für die weitere günstige Entwicklung seiner Vermögensverhältnisse dienten. Aber der General murrte in der Folgezeit nie über seine frühe Heirat, betrachtete sie nie als einen unglücklichen Jugendstreich, und seine Gattin schätzte er so hoch und fürchtete sich vor ihr manchmal so sehr, daß er sie sogar liebte. Die Generalin stammte aus der fürstlichen Familie Myschkin, einer zwar nicht glänzenden, aber sehr alten Familie, und war auf ihre Herkunft sehr stolz. Eine damals einflußreiche Persönlichkeit, einer jener Gönner, welche die Gönnerschaft nichts kostet, hatte die Freundlichkeit, sich für die Ehe der jungen Prinzessin zu interessieren. Er öffnete dem jungen Offizier ein Türchen zur Karriere und gab ihm einen Stoß nach vorwärts; der aber hätte gar nicht einmal eines Stoßes, sondern nur eines einzigen Gnadenblickes bedurft – er wäre nicht zugrunde gegangen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, verlebten die Gatten die ganze Zeit ihrer langen Ehe in voller Einmütigkeit. Schon in sehr jungen Jahren hatte es die Generalin verstanden, als eine geborene Prinzessin und als die Letzte ihres Geschlechts, vielleicht auch durch ihre persönlichen Eigenschaften, einige sehr hochgestellte Gönnerinnen zu finden. In der Folgezeit begann sie bei dem Reichtum und dem bedeutenden Dienstrang ihres Gatten sich in diesem hohen Kreis sogar einigermaßen einzuleben.
In diesen letzten Jahren waren die Generalstöchter alle drei herangewachsen und herangereift: Alexandra, Adelaida und Aglaja. Allerdings trugen sie alle drei nur den Namen Jepantschin; aber mütterlicherseits waren sie doch von fürstlicher Abkunft; sie hatten eine bedeutende Mitgift und einen Vater, der vielleicht Aussicht hatte, später noch eine sehr hohe Stelle zu erhalten, und, was ebenfalls sehr wichtig war, sie waren alle drei recht hübsch, auch die älteste, Alexandra, nicht ausgenommen, die bereits fünfundzwanzig Jahre alt war. Die mittlere war dreiundzwanzig, und die jüngste, Aglaja, eben erst zwanzig geworden. Diese jüngste war sogar eine wirkliche Schönheit und begann schon in der Gesellschaft großes Aufsehen zu erregen. Aber auch das war noch nicht alles: alle drei zeichneten sich durch Bildung, Verstand und Talente aus. Es war bekannt, daß sie einander innig liebten und sich gegenseitig in jeder Hinsicht behilflich waren. Man sprach sogar von gewissen Opfern, die die beiden älteren zugunsten der jüngsten, die der Abgott des ganzen Hauses war, gebracht haben sollten. In Gesellschaft neigten sie nicht dazu, sich vorzudrängen, sondern waren sogar allzu bescheiden. Niemand konnte ihnen den Vorwurf der Hoffart oder des Dünkels machen; aber doch wußte man, daß sie ihren Stolz hatten und ihren eigenen Wert kannten. Die älteste war musikalisch, die mittlere eine begabte Malerin; aber davon wußte viele Jahre lang fast niemand, und es war erst in der letzten Zeit und nur zufällig an die Öffentlichkeit gekommen. Kurz, es wurde über sie außerordentlich viel Lobendes gesprochen. Indessen fehlte es auch nicht an Übelwollenden. Mit Schrecken redeten diese davon, wie viele Bücher die jungen Damen gelesen hätten. Mit dem Heiraten hatten sie es nicht eilig; sie legten zwar Wert auf den Verkehr in einem gewissen Gesellschaftskreise, aber alles nur mit Maßen. Das war um so bemerkenswerter, als jedermann die Richtung, den Charakter, die Ziele und die Wünsche ihres Vaters kannte.
Es war schon gegen elf Uhr, als der Fürst an der Wohnung des Generals klingelte. Der General wohnte im zweiten Stockwerk und hatte eine ziemlich bescheidene, wiewohl seinem Range entsprechende Wohnung. Dem Fürsten wurde von einem Diener in Livree geöffnet, und es bedurfte langer Auseinandersetzungen mit diesem Menschen, der ihn und sein Bündelchen gleich von Anfang an mißtrauisch betrachtete. Endlich, nachdem er ihm wiederholt auf das bestimmteste erklärt hatte, daß er wirklich Fürst Myschkin sei und unbedingt den General in einer notwendigen Angelegenheit sprechen müsse, führte ihn der erstaunte Diener in ein kleines Vorzimmer vor dem eigentlichen, beim Arbeitszimmer gelegenen Empfangszimmer und übergab ihn dort einem andern Diener, der vormittags in diesem Vorzimmer den Dienst versah und dem General die Besucher anzumelden hatte. Dieser zweite Diener trug einen Frack, war über vierzig Jahre alt und hatte eine ernste, wichtige Miene; er stand Seiner Exzellenz zur speziellen Verfügung, wenn derselbe sich im Arbeitszimmer befand, und war sich infolgedessen seines Wertes bewußt.
»Warten Sie im Empfangszimmer, und lassen Sie Ihr Bündelchen hier!« sagte er, indem er sich langsam und würdevoll in seinen Lehnstuhl setzte und mit einem strengen, erstaunten Blick den Fürsten ansah, der sich ebendort mit seinem Bündelchen in der Hand neben ihm auf einen Stuhl niederließ.
»Wenn Sie erlauben«, sagte der Fürst, »möchte ich lieber hier bei Ihnen warten; was soll ich dort so ganz allein?«
»Im Vorzimmer können Sie nicht bleiben, da Sie ein Besucher, das heißt ein Gast, sind. Wollen Sie zum General selbst?«
Der Diener konnte sich offenbar nicht mit dem Gedanken befreunden, daß er einen solchen Besucher vorlassen solle, und hielt es daher für gut, ihn noch einmal zu fragen.
»Ja, ich habe ein Anliegen ...«, begann der Fürst.
»Ich frage Sie nicht, von welcher Art Ihr Anliegen ist; meine Sache ist nur, Sie zu melden. Aber ohne den Sekretär kann ich nicht hingehen und Sie melden.«
Das Mißtrauen dieses Mannes schien immer mehr zu wachsen: der Fürst war doch auch dem Typ der täglichen Besucher gar zu unähnlich. Zwar kam es ziemlich oft, fast täglich, zu bestimmter Stunde vor, daß der General, namentlich in Geschäftsangelegenheiten, Gäste empfing, die manchmal sehr verschiedenartig aussahen; aber trotz dieser Gewohnheit und der recht weitherzigen Instruktion war der Kammerdiener in großem Zweifel; die Vermittlung des Sekretärs schien ihm für die Anmeldung doch unumgänglich notwendig.
»Sind Sie wirklich ... aus dem Ausland gekommen?« fragte er schließlich fast unwillkürlich und wurde dabei verlegen. Er wollte vielleicht fragen: ›Sind Sie wirklich Fürst Myschkin?‹
»Ja, ich komme direkt von der Bahn. Mir scheint, Sie wollten fragen, ob ich wirklich Fürst Myschkin bin, taten dies aber aus Höflichkeit nicht.«
»Hm! ...« brummte der Diener erstaunt.
»Ich versichere Ihnen, daß ich Sie nicht belogen habe, und daß Sie mit meiner Anmeldung nichts Unverantwortliches begehen. Daß ich aber in solchem Anzug und mit einem Bündelchen herkomme, dabei ist nichts zu verwundern; meine Vermögensverhältnisse sind augenblicklich nicht glänzend.«
»Hm! Ich habe in dieser Hinsicht keine Befürchtungen, sehen Sie! Ich bin verpflichtet, Sie zu melden, und dann wird der Sekretär zu Ihnen herkommen, außer wenn Sie ... Aber das ist es eben: außer wenn ... Wenn es gestattet ist, möchte ich mir erlauben zu fragen: Sie beabsichtigen nicht, aus Bedürftigkeit den General um eine Unterstützung zu bitten?«
»O nein, seien Sie darüber ganz beruhigt! Ich habe ein anderes Anliegen.«
»Nehmen Sie es mir nicht übel; aber ich fragte im Hinblick auf Ihr Äußeres. Warten Sie auf den Sekretär; der General selbst ist jetzt mit einem Oberst beschäftigt, und dann wird auch der Sekretär kommen ... es ist der Sekretär von einer Aktiengesellschaft.«
»Wenn ich also lange werde warten müssen, so möchte ich Sie fragen: kann man hier nicht irgendwo rauchen? Eine Pfeife und Tabak habe ich bei mir.«
»Rauchen?« versetzte der Kammerdiener, ihn geringschätzig und erstaunt anstarrend, als ob er seinen Ohren nicht traute. »Rauchen? Nein, hier können Sie nicht rauchen, und Sie sollten sich schämen, auch nur daran zu denken. Haha ... Sonderbar!«
»Oh, ich meinte ja nicht in diesem Zimmer; daß das nicht geht, weiß ich ja; sondern ich würde irgendwohin gehen, wohin Sie mich weisen würden; denn ich bin daran gewöhnt und habe jetzt schon drei Stunden lang nicht geraucht. Übrigens, wie Sie es für gut halten; wissen Sie, es gibt ein Sprichwort: Kommst du in ein fremdes Kloster, so suche da nicht deine eigene Ordnung einzuführen.«
»Na, wie soll ich Sie melden, so einen eigentümlichen Besucher?« murmelte der Kammerdiener beinah unwillkürlich. »Erstens gehört es sich nicht, daß Sie sich hier aufhalten; Sie sollten im Empfangszimmer sitzen, weil Sie selbst sich als Besucher, das heißt als Gast bezeichnen; da wird Rechenschaft von mir gefordert werden ... Wie ist es? Beabsichtigen Sie etwa, bei uns zu wohnen?« fügte er hinzu, noch einmal nach dem Bündel des Fürsten hinschielend, das ihm offenbar keine Ruhe ließ.
»Nein, das beabsichtige ich nicht. Selbst wenn ich dazu aufgefordert würde, würde ich nicht hierbleiben. Ich bin ganz einfach nur hergekommen, um mich mit den Herrschaften bekannt zu machen, weiter nichts.«
»Wie? Um die Bekanntschaft zu machen?« fragte der Kammerdiener erstaunt und mit verdreifachtem Mißtrauen. »Wie konnten Sie dann aber zuerst sagen, Sie kämen mit einem Anliegen?«
»Oh, ich kann kaum sagen: mit einem Anliegen! Das heißt, wenn Sie wollen, habe ich auch ein Anliegen, das aber nur darin besteht, daß ich um einen Rat bitten möchte. In der Hauptsache aber bin ich gekommen, um mich vorzustellen, da ich Fürst Myschkin bin und die Generalin Jepantschina gleichfalls die letzte Fürstentochter aus der Familie Myschkin ist und es außer mir und ihr keine Myschkins mehr gibt.«
»Also sind Sie gar noch ein Verwandter?« rief der erschrockene Diener, den ordentlich ein Schauder überlief.
»Auch das ist kaum richtig. Übrigens, wenn man es genau nimmt, gewiß, wir sind Verwandte, aber so entfernte, daß wir uns eigentlich kaum als solche betrachten können. Ich habe mich einmal vom Ausland aus brieflich an die Generalin gewandt; aber sie hat mir nicht geantwortet. Ich habe es aber doch für notwendig gehalten, bei meiner Rückkehr hier Beziehungen anzuknüpfen. Ihnen aber setze ich das alles jetzt auseinander, um Ihre Zweifel zu zerstreuen; denn ich sehe, Sie beunruhigen sich immer noch. Melden Sie nur, daß Fürst Myschkin da ist, und der Anlaß meines Besuches wird schon aus der Meldung ersichtlich sein. Empfangen sie mich – gut; empfangen sie mich nicht – auch gut, vielleicht sogar sehr gut. Aber ich glaube, sie werden nicht anders können, als mich empfangen; die Generalin wird gewiß wünschen, den einzigen noch lebenden Repräsentanten ihres Geschlechts zu sehen; denn wie ich mit Bestimmtheit gehört habe, legt sie auf ihre Herkunft großen Wert.«
Es hätte scheinen können, daß diese Mitteilungen des Fürsten höchst einfach und natürlich waren; aber je einfacher und natürlicher sie an sich waren, um so absonderlicher kamen sie im gegenwärtigen Augenblick heraus, und der erfahrene Kammerdiener konnte nicht umhin, in ihnen etwas zu finden, was, von einem Menschen zu einem andern Menschen gesagt, durchaus angemessen, aber von einem Gast zu einem Diener gesagt, völlig unangemessen war. Aber da die Diener weit verständiger sind, als die Herrschaften gewöhnlich glauben, so ging es auch dem Kammerdiener durch den Kopf, daß hier zwei Fälle möglich seien: entweder war der Fürst ein Herumtreiber und jedenfalls gekommen, um bei der Herrschaft um ein Almosen zu bitten, oder er war einfach ein Narr und ohne Ehrgefühl, da ein vernünftiger Fürst, der Ehrgefühl besitzt, nicht im Vorzimmer sitzen und mit einem Diener über seine Angelegenheiten reden würde. Hatte er sich also nicht in dem einen wie in dem andern Fall für die Anmeldung zu verantworten?
»Aber Sie sollten sich doch in das Empfangszimmer begeben«, bemerkte er möglichst energisch.
»Wenn ich da gesessen hätte, hätte ich Ihnen das alles ja nicht auseinandersetzen können«, versetzte der Fürst in heiterem Tone, »und somit würden Sie sich immer noch beim Anblick meines Mantels und meines Bündelchens beunruhigen. Aber jetzt halten Sie es vielleicht nicht einmal mehr für nötig, auf den Sekretär zu warten, sondern gehen einfach selbst hin und melden mich an.«
»Ich darf einen Besucher wie Sie ohne den Sekretär nicht anmelden, und außerdem hat der General selbst noch vorhin ausdrücklich verboten, daß er von irgend jemand gestört wird, solange der Oberst da ist; nur Gawrila Ardalionytsch geht ohne Anmeldung hinein.«
»Ist das ein Beamter?«
»Gawrila Ardalionytsch? Nein. Er ist bei einer Aktiengesellschaft angestellt. Legen Sie doch wenigstens Ihr Bündelchen hin!«
»Ich habe selbst schon daran gedacht. Wenn Sie also erlauben, tue ich es. Sagen Sie, soll ich auch den Mantel ablegen?«
»Gewiß! Sie können doch nicht im Mantel zu ihm hineingehen.«
Der Fürst erhob sich, zog sich eilig den Mantel aus und stand nun in einem ziemlich anständigen, gut gearbeiteten, wiewohl schon abgetragenen Jackett da. Über die Weste zog sich eine stählerne Uhrkette hin. An der Kette war eine silberne Genfer Uhr sichtbar.
Obgleich der Fürst ein Narr war (zu dieser Ansicht war der Diener bereits gelangt), schien es dem Kammerdiener des Generals schließlich doch unpassend, dieses Privatgespräch mit dem Besucher länger fortzusetzen, obwohl der Fürst ihm aus irgendeinem Grunde gefiel, natürlich nur so in seiner Art. Aber von einem andern Gesichtspunkte aus erweckte er bei ihm ein entschiedenes, starkes Mißfallen.
»Und wann empfängt die Generalin?« fragte der Fürst, indem er sich wieder auf seinen früheren Platz setzte.
»Das gehört nicht zu meinem Dienst. Sie empfängt zu verschiedenen Zeiten, je nach der Persönlichkeit. Die Schneiderin wird schon um elf Uhr vorgelassen. Gawrila Ardalionytsch wird ebenfalls früher empfangen als andere, sogar zum ersten Frühstück.«
»Hier bei Ihnen ist es in den Zimmern im Winter wärmer als im Ausland«, bemerkte der Fürst, »aber dafür ist es dort auf den Straßen wärmer als bei uns. So ist es einem Russen kaum möglich, im Winter dort in den Häusern zu wohnen, weil er da nicht seine gewohnte Wärme hat.«
»Wird da nicht geheizt?«
»O doch, aber die Häuser sind anders gebaut, das heißt die Öfen und die Fenster.«
»Hm! Sind Sie denn lange im Ausland gereist?«
»Vier Jahre. Übrigens habe ich fast immer an einem Orte stillgesessen, auf dem Lande.«
»Da sind Sie wohl unsere Verhältnisse nicht mehr gewöhnt?«
»Das ist richtig. Können Sie es glauben: ich wundere mich über mich selbst, daß ich das Russischsprechen nicht verlernt habe. Während ich jetzt mit Ihnen spreche, denke ich: ›Aber ich spreche ja noch ganz gut.‹ Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich soviel spreche. Wirklich, seit gestern habe ich fortwährend Lust, russisch zu sprechen.«
»Hm! Haha! Haben Sie früher in Petersburg gewohnt?« (Trotz seiner Vorsätze brachte der Diener es doch nicht fertig, ein so höflich und bescheiden geführtes Gespräch seinerseits abzubrechen.)
»In Petersburg? Fast gar nicht, nur bei Durchreisen. Auch habe ich früher hier eigentlich nichts gekannt; und jetzt gibt es hier, höre ich, so viel Neues, daß, wie man sagt, auch wer vorher alles gekannt hat, jetzt alles von neuem lernen muß. Es wird hier jetzt viel von den Gerichten geredet.«
»Hm! ... Die Gerichte. Die Gerichte, ja, ja, die Gerichte. Aber wie ist es dort? Geht es da beim Gericht gerechter zu oder nicht?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe über die unsrigen viel Gutes gehört. Da ist ja nun bei uns die Todesstrafe wieder abgeschafft.«
»Aber dort finden Hinrichtungen statt?«
»Ja. Ich habe in Frankreich bei einer zugesehen, in Lyon. Schneider hatte mich mitgenommen.«
»Hängen sie die Menschen auf?«
»Nein, in Frankreich werden immer die Köpfe abgeschlagen.«
»Schreit denn der Betreffende dabei?«
»Bewahre! Es geht in einem Augenblick vor sich. Sie legen den Menschen hin, und dann fällt mittels einer Maschine (Guillotine heißt sie) so ein breites Messer mit einem schweren, kräftigen Schlag herunter ... Der Kopf fliegt ab, ehe man nur mit den Augen blinken kann. Die Vorbereitungen sind allerdings peinlich. Wenn das Urteil verkündet ist, machen sie den Hinzurichtenden zurecht, binden ihn und führen ihn auf das Schafott; das ist schrecklich! Das Volk läuft zusammen, sogar die Weiber, obwohl man es dort nicht gern hat, daß Weiber dabei zusehen.«
»Die haben dabei auch nichts zu suchen.«
»Gewiß, gewiß! Solche Qualen mit anzusehen! ... Der Verurteilte war ein gebildeter, unerschrockener, kräftiger Mann, schon bei Jahren. Legros war sein Name. Nun, sehen Sie, ich sage Ihnen, ob Sie es nun glauben oder nicht: als er auf das Schafott heraufkam, da weinte er und sah weiß aus wie ein Blatt Papier. Ist das möglich? Ist das nicht entsetzlich? Wer weint denn vor Angst? Ich hätte nicht gedacht, daß jemand, der kein Kind ist, vor Angst weinen könnte, ein Mann, der nie geweint hat, ein Mann von fünfundvierzig Jahren. Was mag mit der Seele in diesem Augenblick vorgehen? In was für krampfhafte Zuckungen wird sie versetzt? Es ist eine Peinigung der Seele, weiter nichts! Es gibt ein Gebot: ›Du sollst nicht töten!‹, und da tötet man nun, weil jemand getötet hat, auch ihn? Nein, das darf nicht sein! Es ist jetzt schon einen Monat her, daß ich das gesehen habe; aber es ist mir bis heute, als ob ich es vor Augen hätte. Ich habe fünfmal davon geträumt.«
Der Fürst war beim Sprechen aufgelebt, eine leichte Röte war auf sein blasses Gesicht getreten, obgleich er äußerlich so still und ruhig redete wie vorher. Der Kammerdiener hörte ihm mit teilnahmsvollem Interesse zu und wünschte, wie es schien, nicht mehr, sich von dem Gespräch loszumachen; vielleicht war auch er ein Mensch mit Einbildungskraft und einem Hange zum Nachdenken.
»Es ist wenigstens noch gut, daß nicht viel Quälerei dabei ist, wenn der Kopf abfliegt«, bemerkte er.
dem Tode nicht entgehen kann, und eine schlimmere Qual als diese gibt es auf der Welt nicht. Man führe einen Soldaten in der Schlacht einer Kanone gerade gegenüber und stelle ihn dorthin und schieße auf ihn; er wird noch immer hoffen; aber man lese diesem selben Soldaten das Urteil vor, das ihn mit Sicherheit dem Tode weiht, und er wird den Verstand verlieren oder zu weinen anfangen. Wer kann denn glauben, daß die menschliche Natur imstande sei, dies zu ertragen, ohne in Irrsinn zu geraten? Wozu eine solche gräßliche, unnütze, zwecklose Marter? Vielleicht gibt es auch einen Menschen, dem man das Todesurteil vorgelesen hat, den man sich hat quälen lassen, und zu dem man dann gesagt hat: ›Geh hin; du bist begnadigt!‹ Ein solcher Mensch könnte vielleicht erzählen. Von dieser Qual und von diesem Schrecken hat auch Christus gesprochen. Nein, so darf man mit einem Menschen nicht verfahren!«
Obgleich der Kammerdiener all dies nicht hätte so ausdrücken können wie der Fürst, verstand er doch, wenn auch nicht alles, so doch die Hauptsache, was sogar an seiner gerührten Miene wahrzunehmen war.
»Wenn Sie so sehr wünschen zu rauchen«, sagte er, »so würde das vielleicht auch gehen; nur müßten Sie es sehr bald tun. Denn er könnte auf einmal nach Ihnen fragen, und dann wären Sie nicht da. Sehen Sie, dort unter der kleinen Treppe ist eine Tür. Gehen Sie in die Tür hinein, rechts ist ein Kämmerchen; da können Sie rauchen; nur müssen Sie die Luftklappe aufmachen, denn das Rauchen ist hier doch nicht in der Ordnung.«
Aber der Fürst kam nicht mehr dazu fortzugehen und zu rauchen. In das Vorzimmer trat ein junger Mann mit Papieren in der Hand. Der Kammerdiener nahm ihm den Pelz ab. Der junge Mann schielte nach dem Fürsten hin.
»Der Herr da sagt mir, Gawrila Ardalionytsch«, begann der Kammerdiener in vertraulichem, beinah familiärem Ton, »daß er ein Fürst Myschkin und ein Verwandter der gnädigen Frau sei; er ist mit dem Zuge aus dem Ausland gekommen, mit einem Bündelchen in der Hand, aber ...« Das Weitere konnte der Fürst nicht verstehen, da der Kammerdiener zu flüstern anfing. Gawrila Ardalionowitsch hörte aufmerksam zu und betrachtete den Fürsten mit großem Interesse; schließlich hörte er nicht mehr weiter zu und trat ungeduldig an ihn heran.
»Sie sind Fürst Myschkin?« fragte er sehr freundlich und höflich. Es war ein sehr schöner junger Mann, ebenfalls etwa achtundzwanzig Jahre alt, schlank, blond, von Mittelgröße, mit einem kleinen Napoleonsbärtchen und einem verständigen, sehr hübschen Gesicht. Nur war sein Lächeln bei all seiner Liebenswürdigkeit ein wenig zu schlau; die Zähne traten dabei ein wenig zu perlenartig heraus; der Blick war trotz all seiner Heiterkeit und scheinbaren Offenherzigkeit etwas zu scharf und forschend.
Der Fürst hatte die Empfindung: ›Wenn er allein ist, sieht er wahrscheinlich ganz anders aus und lacht vielleicht nie.‹
Der Fürst setzte ihm alles, was er in der Geschwindigkeit konnte, auseinander, fast dasselbe, was er schon vorher dem Kammerdiener und noch früher seinem Reisegefährten Rogoshin auseinandergesetzt hatte. Gawrila Ardalionowitsch schien unterdessen in seinem Gedächtnis etwas zu suchen.
»Haben Sie nicht«, fragte er, »vor einem Jahre oder vor noch kürzerer Zeit einen Brief, wie mir scheint, aus der Schweiz an Lisaweta Prokofjewna geschickt?«
»Ganz richtig.«
»Dann kennt man Sie hier und wird sich Ihrer sicherlich erinnern. Sie wollen zu Seiner Exzellenz? Ich werde Sie sofort melden ... Er wird gleich frei sein. Nur sollten Sie ... Sie sollten bis dahin ins Empfangszimmer gehen ... Warum ist der Herr hier?« wandte er sich in strengem Ton an den Kammerdiener.
»Ich sagte schon, der Herr wollte selbst nicht ...«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Arbeitszimmers, und ein Offizier mit einem Portefeuille unter dem Arm kam laut redend und sich verabschiedend heraus.
»Du bist hier, Ganja?« rief eine Stimme aus dem Arbeitszimmer. »So komm doch herein!«
Gawrila Ardalionowitsch nickte dem Fürsten zu und begab sich eilig in das Arbeitszimmer.
Ungefähr zwei Minuten darauf öffnete sich die Tür von neuem, und Gawrila Ardalionowitschs wohlklingende, höfliche Stimme rief:
»Bitte treten Sie näher, Fürst.«
III
Der General Iwan Fjodorowitsch Jepantschin stand mitten in seinem Arbeitszimmer und betrachtete mit größter Neugier den eintretenden Fürsten; er ging ihm sogar zwei Schritte entgegen. Der Fürst trat zu ihm heran und stellte sich vor.
»Sehr wohl«, antwortete der General, »womit kann ich dienen?«
»Ein dringliches Geschäft habe ich nicht; meine Absicht war einfach, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich möchte nicht stören, da ich weder Ihren Empfangstag noch Ihre Dispositionen kenne ... Aber ich komme eben von der Bahn ... ich bin aus der Schweiz hergereist.«
Der General war nahe daran zu lächeln, aber er überlegte und hielt inne; dann überlegte er noch ein wenig, kniff die Augen zusammen, musterte seinen Gast noch einmal vom Kopf bis zu den Füßen, bot ihm dann schnell einen Stuhl an, setzte sich selbst schräg gegenüber und wandte sich in ungeduldiger Erwartung zum Fürsten hin. Ganja stand in einer Ecke des Arbeitszimmers am Schreibtisch und blätterte in Papieren.
»Für neue Bekanntschaften habe ich im allgemeinen nur wenig Zeit«, sagte der General, »aber da Sie gewiß dabei Ihre Absicht haben, so ...«
»Ich habe es mir vorher gedacht«, unterbrach ihn der Fürst, »daß Sie in meinem Besuch jedenfalls irgendeine besondere Absicht sehen würden. Aber bei Gott, außer dem Vergnügen, mit Ihnen bekannt zu werden, habe ich keinerlei besondere Absicht.«
»Das Vergnügen ist sicherlich auch für mich ein sehr großes, aber man kann sich nicht immer dem Vergnügen widmen; es kommen manchmal auch Geschäfte vor, wie Sie wissen werden ... Außerdem vermag ich bis jetzt absolut keine gemeinsame Beziehung zwischen uns zu erkennen ... sozusagen einen triftigen Grund...«
»Ein triftiger Grund ist unstreitig nicht vorhanden und gemeinsame Beziehungen gewiß nur wenige. Denn daß ich Fürst Myschkin bin und Ihre Gemahlin aus unserem Geschlecht stammt, ist selbstverständlich kein triftiger Grund. Das sehe ich sehr wohl ein. Aber doch liegt darin der ganze Anlaß meines Besuches. Ich bin ungefähr vier Jahre nicht in Rußland gewesen, mehr als vier Jahre, und als ich wegfuhr, war ich beinah nicht bei Sinnen! Damals kannte ich nichts in der Welt, und jetzt noch weniger. Ich bedarf des Verkehrs mit guten Menschen; und dann habe ich da auch noch eine geschäftliche Angelegenheit, und ich weiß nicht, wohin ich mich hinsichtlich derselben um Rat wenden soll. Schon in Berlin dachte ich: ›Das sind beinah Verwandte von mir; mit denen werde ich den Anfang machen, vielleicht passen wir zueinander, sie zu mir und ich zu ihnen, – wenn sie gute Menschen sind.‹ Und daß Sie gute Menschen sind, hatte ich gehört.«
»Ich bin Ihnen sehr verbunden«, versetzte der General verwundert. »Gestatten Sie mir die Frage: wo sind Sie abgestiegen?«
»Ich bin noch nirgends abgestiegen.«
»Also sind Sie geradeswegs von der Bahn zu mir gekommen? Und ... das Gepäck?«
»Als ganzes Gepäck habe ich ein kleines Bündelchen mit Wäsche bei mir, weiter nichts; das trage ich gewöhnlich in der Hand. Ich werde am Abend noch Zeit haben, mir ein Zimmer zu nehmen.«
»Also beabsichtigen Sie auch jetzt noch, in einen Gasthof zu gehen?«
»Ja, gewiß.«
»Nach Ihren Worten hatte ich beinah geglaubt, daß Sie einfach bei mir Quartier nehmen wollten.«
»Das wäre doch nur möglich, wenn Sie mich einlüden. Ich gestehe indessen, daß ich auch im Fall einer Einladung nicht hierbleiben würde, nicht aus irgendeinem besonderen Grunde, sondern nur, weil das so in meinem Charakter liegt.«
»Nun, da trifft es sich ja gut, daß ich Sie nicht eingeladen habe und nicht einladen werde. Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung, Fürst, um gleich mit einem Male alles klarzulegen: da wir uns soeben darüber ausgesprochen haben, daß von einer Verwandtschaft zwischen uns nicht die Rede sein kann, obwohl eine solche für mich selbstverständlich sehr schmeichelhaft sein würde, so folgt daraus ...«
»So folgt daraus, daß ich aufstehen und weggehen soll?« sagte der Fürst sich erhebend und lachte dabei trotz der schwierigen Lage, in der er sich offenbar befand, ganz heiter. »Und bei Gott, General, obwohl ich absolut keine praktische Kenntnis davon habe, was hier Brauch ist und wie hier überhaupt die Menschen leben, so hatte ich mir doch gedacht, daß zwischen uns die Sache genau den Verlauf nehmen werde, den sie jetzt wirklich genommen hat. Nun, vielleicht ist es so auch ganz in der Ordnung ... Ich habe ja auch damals auf meinen Brief keine Antwort bekommen ... Nun also, leben Sie wohl, und entschuldigen Sie, daß ich gestört habe!«
Die Miene des Fürsten war in diesem Augenblick so freundlich und sein Lächeln so frei von jeder Beimischung irgendeines verborgenen, feindseligen Gefühls, daß der General plötzlich stutzte und seinen Gast in anderer Weise ansah; die ganze Veränderung seiner Ansicht vollzog sich in einem Moment.
»Wissen Sie, Fürst«, sagte er in ganz anderem Ton, »ich kenne Sie ja noch gar nicht, und auch Lisaweta Prokofjewna wird vielleicht den Wunsch haben, ihren Namensvetter zu sehen ... Warten Sie doch ein Weilchen, wenn Sie wollen und Ihre Zeit es erlaubt.«
»Oh, meine Zeit erlaubt es schon; meine Zeit steht ganz zu meiner Verfügung.« (Der Fürst legte sogleich seinen weichen, rundkrempigen Hut auf den Tisch.) »Ich muß bekennen, ich hatte auch darauf gerechnet, daß Lisaweta Prokofjewna sich vielleicht an das, was ich ihr geschrieben habe, erinnern werde. Vorhin, als ich dort bei Ihnen wartete, argwöhnte Ihr Diener, daß ich gekommen sei, um Sie um eine Unterstützung zu bitten; ich merkte das, und Sie werden wohl in dieser Hinsicht strenge Instruktionen erteilt haben; aber ich bin wirklich nicht deswegen hergekommen, sondern wirklich nur, um mit Menschen zusammenzukommen. Ich fürchte nur, Ihnen lästig geworden zu sein, und das beunruhigt mich.«
»Hören Sie, Fürst«, sagte der General mit einem heiteren Lächeln, »wenn Sie wirklich ein solcher Mensch sind, wie es den Anschein hat, so wird die Bekanntschaft mit Ihnen vielleicht ganz angenehm sein; nur, sehen Sie, ich bin von Geschäften stark in Anspruch genommen und muß mich gleich wieder hinsetzen und dies und das durchsehen und unterschreiben, und dann begebe ich mich zu Seiner Erlaucht und dann in den Dienst; so kommt es, daß, wenn mir auch der Verkehr mit guten Menschen Freude macht ... das heißt ... aber ... Übrigens bin ich von Ihrer vortrefflichen Erziehung so fest überzeugt, daß ... Aber wie alt sind Sie eigentlich, Fürst?«
»Sechsundzwanzig.«
»Oh! Ich hatte Sie weit jünger geschätzt.«
»Ja, man sagt mir, daß ich ein jugendliches Gesicht habe. Aber Sie nicht zu stören, das werde ich schon lernen und bald begreifen, weil es mir selbst sehr zuwider ist, jemanden zu stören ... Und schließlich sind wir, wie mir scheint, dem Äußern nach in vielerlei Hinsicht so verschiedene Menschen, daß wir wohl nicht viele Berührungspunkte haben können. Aber wissen Sie, an diese letzte Bemerkung glaube ich selbst nicht recht; denn sehr oft scheint es nur so, daß keine Berührungspunkte vorhanden seien, und sie sind doch in Menge da ... Das kommt von der menschlichen Trägheit, indem die Menschen einander nur nach dem äußeren Schein klassifizieren und dabei keine Ähnlichkeiten finden können ... Aber ich langweile Sie wohl schon? Es kommt mir vor, als ob Sie ...«
»Nur zwei Worte: besitzen Sie wenigstens etwas Vermögen? Oder beabsichtigen Sie vielleicht, irgendeine Beschäftigung anzunehmen? Verzeihen Sie, daß ich so ...«
»Aber ich bitte Sie, ich finde Ihre Frage sehr natürlich und begreiflich. Ich besitze zur Zeit gar kein Vermögen und habe vorläufig auch keine Beschäftigung, möchte aber eine solche haben. Ich habe jetzt von fremdem Geld gelebt; mein Professor Schneider, bei dem ich in der Schweiz eine Kur machte und mich wissenschaftlich weiterbildete, hat mir das Reisegeld gegeben, und zwar nur gerade ausreichend, so daß ich jetzt nur einige Kopeken übrig habe. Allerdings habe ich da eine geschäftliche Angelegenheit, in der ich einen guten Rat gebrauchen könnte, aber ...«
»Sagen Sie, wovon beabsichtigen Sie denn zunächst zu leben und welches sind Ihre Pläne für die Zukunft?« unterbrach ihn der General.
»Ich wollte irgendwie arbeiten.«
»Och, Sie sind offenbar ein Philosoph; indessen ... besitzen Sie nach Ihrem eigenen Urteil irgendwelche Talente oder wenigstens einige Fähigkeiten, das heißt solche, durch die man sich sein tägliches Brot verdienen kann? Verzeihen Sie wieder ...«
»Oh, es bedarf keiner Entschuldigung! Nein, ich besitze meiner Meinung nach weder Talente noch besondere Fähigkeiten; im Gegenteil, ich habe sogar, weil ich ein kranker Mensch bin, keinen regulären Unterrichtsgang durchgemacht. Was das tägliche Brot anlangt, so möchte ich meinen ...«