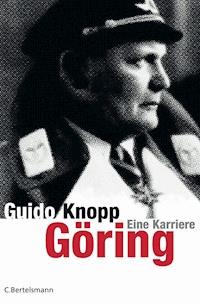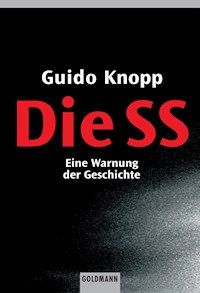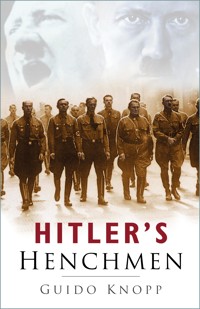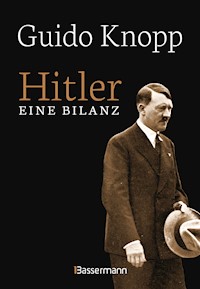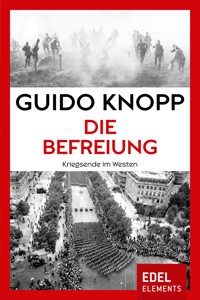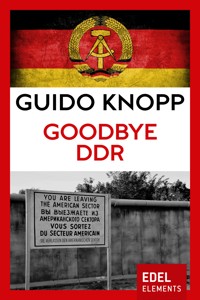4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Zweite Weltkrieg – ein Jahrhundertkrieg, dem rund 50 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Ein Krieg, der deutlich machte, was Menschen ihresgleichen antun können. Erstmals nun haben Deutsche und Amerikaner, Briten und Russen, Polen und Franzosen unter der Leitung von Guido Knopp und unterstützt von renommierten Historikern dieses schmerzlichste Kapitel ihrer Geschichte gemeinsam aufgearbeitet. Eindrucksvolle Erlebnisberichte von Zeitzeugen verdeutlichen die Ereignisse an verschiedenen Kriegsschauplätzen: im »U-Boot-Krieg« im Atlantik, im »Wüstenkrieg« in Afrika oder im »Krieg der Bomber« am Himmel über England und Deutschland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Guido Knopp
Der Jahrhundertkrieg
Edel eBooks
Inhalt
Vorwort
Versenkt die »Bismarck«!
Tödliche Falle
Mythos Rommel
Das Duell
Die Schlacht um England
Der Feuersturm
Literaturverzeichnis
Personenregister
Ortsregister
Autor
Prof. Dr. Guido Knopp, Jahrgang 1948, arbeitete nach dem Studium als Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und als Auslandschef der „Welt am Sonntag“. Von 1984 bis 2013 war er Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte. Seitdem moderiert er die Sendung History Live auf Phoenix. Als Autor publizierte er zahlreiche Sachbuch-Bestseller. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Jakob-Kaiser-Preis, der Europäische Fernsehpreis, der Telestar, der Goldene Löwe, der Bayerische und der Deutsche Fernsehpreis, das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und der Internationale Emmy.Vorwort
Vor über fünf Jahrzehnten ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. 50 Millionen Menschen fielen ihm zum Opfer – auf den Schlachtfeldern zwischen Normandie und Kaukasus, im U-Boot-Krieg, der im Atlantik tobte, im Bombenhagel, der auf die Städte niederging, im Holocaust, dem unsagbaren Verbrechen hinter der Front. Es war ein Krieg, der deutlich machte, wozu Menschen fähig sind und was sie ihresgleichen antun können. Alles, was das 20. Jahrhundert ausmacht, spiegelt sich in diesem Krieg: der Machtkampf zweier totalitärer Ideologien; der Sieg der Demokratie über die Diktatur, der Triumph der Technik in der Kriegsführung und deren Missbrauch bei der systematischen Vernichtung von Menschen – und schließlich durch Hiroshima der Nachweis, dass die Menschheit nun imstande war, sich selbst auszulöschen. Ein Krieg als Focus und als Menetekel: der Jahrhundertkrieg.
Dieses Buch beruht auf den Recherchen für ein Filmprojekt, das den Zweiten Weltkrieg noch einmal umfassend darstellt. Noch einmal? Zum letzten Mal? In gewisser Hinsicht wohl zum ersten Mal. Bislang wurde dieser Krieg in der Regel nur aus jeweils nationaler Sicht geschildert. Heute, da die Zeitgenossen hoch betagt sind, ist es an der Zeit, dass einst verfeindete Nationen gemeinsam zeigen, was den Zweiten Weltkrieg ausmacht. Einen Krieg, der uns nach wie vor (und mehr denn je) bewegt. Eine Reihe ausländischer Partner, Fernsehsender ebenso wie Wissenschaftler, arbeiten hierfür mit uns zusammen. Zum Zweiten Weltkrieg eine Filmreihe aus Deutschland für ein internationales Publikum? Noch vor zehn Jahren wäre dies nicht vorstellbar gewesen.
Zehntausende von Kilometern haben unsere Teams auf den Spuren des Jahrhundertkriegs zurückgelegt, Tonnen von Archivbeständen haben sie durchstöbert, meterlange Filmrollen gesichtet, hunderte von Zeitzeugen befragt – in dem beflügelnden Bewusstsein, dies zur rechten Zeit zu tun. Zum einen sind in den Archiven weltweit gerade in den letzten Jahren neu entdeckte Quellen vorzufinden, die uns neue Einsichten gewähren. Zum andern sind die Menschen, die den Krieg erlebt haben, die berichten können, »wie es war«, jetzt noch am Leben. Und noch haben wir die Chance, ihnen zuzuhören, wenn sie von der Grenzerfahrung ihres Lebens sprechen: Deutsche und Amerikaner, Briten und Russen, Polen und Franzosen.
Dieses Buch ist keine chronologische Erörterung. Es konzentriert sich, wie die Filmreihe, auf die zentralen Phasen des Jahrhundertkriegs: die Schlacht im Atlantik, Rommels Kämpfe in der Wüste, den Bombenkrieg, der anfangs über England und dann über deutschen Städten tobte.
* * *
Es beginnt mit einer Jagd. Die »Bismarck«, ein Koloss aus Kruppstahl, galt als das mächtigste Schlachtschiff der Welt. Sie sollte die Wende in der Atlantikschlacht erzwingen – noch bevor die Amerikaner in den Krieg eintreten würden. Es galt, die Versorgungslieferungen aus der Neuen in die Alte Welt zu unterbrechen – ein vergebliches Unterfangen. Zwar gelang es der »Bismarck«, den Stolz der britischen Marine, das Schlachtschiff »Hood«, zu versenken. Dank neuer Radartechnik aber konnten die Briten das deutsche Schlachtschiff bei schwerem Wetter im Nordatlantik orten. Zwar riss der Kontakt wieder ab – doch der deutsche Admiral Lütjens sandte ausgerechnet in jenen Minuten einen längeren Funkspruch an Hitler und verriet dadurch die Position seines Schiffes. Der Torpedo eines antiquierten britischen Doppeldeckers vom Flugzeugträger »Ark Royal« besiegelte schließlich das Schicksal der »Bismarck«. Knapp 1000 Meilen von der rettenden französischen Küste entfernt konnte sie nur noch im Kreis fahren. Wenig später begannen die herbeigeeilten britischen Schlachtschiffe und Kreuzer mit der »Exekution« des angeschlagenen Gegners, der bis zum Schluss keine Anstalten machte, den sinnlosen Kampf zu beenden. In seinem letzten fanatischen Funkspruch teilte Admiral Lütjens nach Berlin mit: »Wir kämpfen bis zur letzten Granate. Es lebe der Führer!« Die Selbstversenkung des deutschen Panzerschiffs »Graf Spee« vor Montevideo war in Hitlers Marine als »Schmach«empfunden worden. Lütjens wollte nicht, dass man auch ihn als »Versager« verspottete. Für eine solche Gesinnung opferte er seine Besatzung. Am 27. Mai 1941 sank die »Bismarck«. Von 2221 Mann wurden nur 115 gerettet.
Alle Hoffnungen Hitlers ruhten nun auf dem U-Boot-Krieg. Auf den Konvoirouten von Amerika folgte Schlacht auf Schlacht. Ziel der U-Boot-Waffe war, so viele alliierte Handelsschiffe wie möglich zu versenken, um England auszuhungern. Zum Teil gelang dies mit großem Erfolg. Nach dem Krieg bekannte Winston Churchill: »Das einzige, was mich in ständiger Furcht hielt, waren die U-Boote.«
Mitte 1941 gelang den Briten der große Coup: Sie bombardierten U110 und zwangen das Boot zum Auftauchen. Die Beute, die sie dabei machten, trug zur Kriegsentscheidung bei: Enigma, der Schlüssel zum geheimen deutschen Wehrmachtscode. Die Maschine verriet den Entschlüsselungsspezialisten, welche Befehle Dönitz seinen Kommandanten über Funk gab; vor allem aber, wo sich die U-Boote befanden. Die Deutschen ahnten nichts. Immer öfter gelang es Briten und Amerikanern, ihre Konvois um die lauernden U-Boot-Rudel herumzuleiten; immer seltener spürten Dönitz’ Boote alliierte Konvois auf.
Der Mai 1943 markierte schließlich die Wende: Hatten die Deutschen noch im März 21 Schiffe aus zwei Geleitzügen versenkt, so schalteten die Alliierten nun auf einen Schlag 43 deutsche Boote aus. Über 2000 U-Boot-Männer starben. Fortan galt Dönitz’ Sorge der »Moral der Besatzungen«. Anzeichen von »schwindendem Kampfgeist« mehrten sich. Der Fanatismus des Marinechefs geriet zum Selbstzweck. Dönitz schickte seine Männer bis zum Ende in den aussichtslosen Kampf. Allein im Frühjahr 1945 starben noch 5000 U-Boot-Männer.
Die Bilanz des U-Boot-Kriegs war erschreckend: 2900 alliierte Schiffe, 33 000 alliierte Seeleute fielen ihm zum Opfer. Von 1167 deutschen U-Booten gingen 757 verloren, davon 429 mit ihrer gesamten Besatzung. Von fast 50 000 deutschen U-Boot-Fahrern waren über 30 000 in den Tod gegangen.
* * *
Ein anderes Bild vermittelt uns der Wüstenkrieg. Keiner hat ihn so geprägt wie Erwin Rommel. Die NS-Propaganda stilisierte ihn zu einem Mythos, der langlebiger war als das Reich, dem er zu dienen glaubte. Die Legende vom genialen Feldherrn des »Afrika-Korps« findet auch heute noch Anhänger bei »Freund« und »Feind«. Auf dem Höhepunkt seiner Erfolge ersetzte sein Ruf, so schien es manchen Zeitgenossen, ganze Divisionen. Zum Dank beförderte ihn Hitler zum damals jüngsten Feldmarschall der Wehrmacht. Dann kamen die Niederlagen, am Ende das Zerwürfnis.
Inzwischen mehren sich die Stimmen, welche die Fassade vom »ritterlichen Krieg« in der Wüste bröckeln lassen: Ein überzeugter Nazi sei »Hitlers Lieblingsgeneral« gewesen; ein »Kriegsverbrecher« gar, der später mit rücksichtslosen Befehlen zehntausende von italienischen Soldaten in den Tod getrieben habe. Alles andere als ein Mann des Widerstands – einer, der am Ende selbst den Freitod dem offenen Kampf gegen Hitler vorgezogen habe.
Dem wahren Rommel werden solche Überzeichnungen ebenso wenig gerecht wie alle Anflüge von Heroisierung in den vergangenen Jahrzehnten. Rommel war ein Kind seiner Zeit. Seit Beginn der Hitler-Diktatur verschlossen führende Offiziere die Augen vor dem wachsenden Terror der Nazis. Unter Führung ihrer Generalität war die Wehrmacht bei Kriegsbeginn ein verlässliches Instrument. Im Rausch der ersten Siege hofften viele Offiziere auf Ruhm, Anerkennung, Beförderung und Belohnung. Die mahnenden Worte General Becks, der soldatische Gehorsam habe dort »eine Grenze, wo ihr Wissen, Gewissen und ihre Verantwortung die Ausführung eines Befehls« verbiete, waren nur wenige bereit zu akzeptieren.
Im Spannungsfeld zwischen Gehorsam und Gewissen, Verdrängung und Protest zog sich Rommel bis in den Sommer 1944 ganz auf seine militärische Funktion zurück. Eine uneheliche Tochter hatte ihm als jungen Leutnant die Karriere verbaut. Er kompensierte die demütigende Benachteiligung mit lebenslangem Ehrgeiz.
Gleichwohl war es nicht Rommels militärisches Genie, es war der Nachschub, der über Sieg und Niederlage im Afrikakrieg entschied.
Der »Wüstenfuchs« war ein brillanter Taktiker – die andauernde Unterlegenheit seiner Truppe ließ ihm keine andere Wahl, als immer wieder anzugreifen. Eine Strategie, die im Untergang enden musste. Dem Offizier fehlte die fundierte Ausbildung des Generalstabs. Doch der neuerdings erhobene Vorwurf, Rommel sei ein »Kriegsverbrecher« gewesen, trifft fehl. Wie kaum ein zweiter General hat er nachweislich verbrecherische Befehle seines »Führers« unterbunden. Während sich die Wehrmacht in Russland in Verbrechen verstricken ließ, kämpften die Soldaten des Afrika-Korps in der Regel einen »ritterlichen Kampf« – sofern man dieses Wort für einen Krieg, erst recht für diesen Krieg, zu akzeptieren vermag.
Das Leben der ihm anvertrauten Soldaten stellte Rommel über die direkten Befehle Hitlers. Wohl seine größte militärische Leistung war der monatelange Rückzug seiner Streitkräfte von El Alamein bis nach Tunesien. Seine Umsicht rettete Zehntausenden deutscher Soldaten das Leben – unter anderem auch das meines Vaters. Ein Mann des Widerstands war Rommel nicht – wiewohl er vom geplanten Attentat wusste. Doch keiner widersprach dem Diktator so offen wie er. Erst im letzten Augenblick schloss auch er sich Hitlers Gegnern an. Dafür zahlte er mit seinem Leben. Rommel wollte nichts sein als ein guter Soldat. In einer kriminellen Diktatur war dies auf Dauer nicht möglich. Darin liegt die Tragik Erwin Rommels. Sein Name aber bürgt dafür, dass die Erinnerung an den von ihm geführten Krieg in Afrika auf anderen Fundamenten ruht als der verdammte Krieg in Russland.
* * *
Am Beginn des Bombenkriegs stand die »Luftschlacht um England«. Ihr Resümee ist zwiespältig. Weder gelang es den Deutschen, die angestrebte völlige Luftherrschaft zu erringen, noch die britische Luftrüstungsindustrie auszuschalten. Allenfalls nachts übten Görings Bomber 1940/41 zeitweise die Lufthoheit über der Insel aus. Doch die Kriegswirtschaft Großbritanniens war nie ernsthaft gefährdet, die Moral der Bevölkerung wurde nicht gebrochen. Im Gegenteil: Ohne die Entscheidung erzwingen zu können, bezahlte die deutsche Luftwaffe einen hohen Preis: Zahlreiche Soldaten verloren im Luftkrieg ihr Leben, zahlreiche deutsche Flugzeuge wurden abgeschossen oder stürzten ab. Der größte Erfolg der Briten aber war psychologischer Art. Die »Luftschlacht um England« brachte das Ende vom Mythos der »unbesiegbaren deutschen Luftwaffe«. Und sie entfachte den Wunsch, es den Deutschen »heimzuzahlen«. Der Bombenkrieg, so hofften die entsprechenden Strategen, könne die Wende des Krieges bringen: »Machen wir Schluss mit dem Krieg, indem wir den Deutschen die Seele aus dem Leib schlagen«, formulierte es Luftmarschall Sir Arthur Harris. Während die Briten ab 1942 gezielt die Wohngebiete von Städten in nächtlichen Angriffen bombardierten, »um die Moral der Bevölkerung zu schwächen«, griffen tagsüber amerikanische Verbände Industrieanlagen und Raffinerien an. Ab Anfang 1943 luden nahezu rund um die Uhr britische und amerikanische Bomber ihre todbringende Fracht über Deutschland ab. Bis Anfang 1945 waren 45 der wichtigsten 60 deutschen Städte weitgehend zerstört.
Die qualvollen, angsterfüllten Nächte in den Bombenkellern, der Verlust von Hab und Gut, die alltägliche Konfrontation mit dem Tod gerieten zum Trauma für eine ganze Generation. Was diesen Krieg so anders machte, war die Hilflosigkeit, mit der seine Opfer ihm ausgeliefert waren. Vor dem Tod aus der Luft gab es keine Möglichkeit des Entkommens, er schlug kaum vorhersehbar und unterschiedslos zu. Doch den Verlauf des Krieges haben weder deutsche noch alliierte Luftangriffe wesentlich beeinflusst. Der strategische Wert der Luftflotten außerhalb ihres Einsatzes an den Fronten sank in gleichem Maße wie die Bereitschaft stieg, den Bombenkrieg auch gegen Zivilisten zu forcieren.
Als britische Bomber in der Nacht zum 14. Februar 1945 in mehreren Wellen ihre tödliche Last über Dresden abwarfen, verwandelte sich die barocke Residenzstadt an der Elbe in eine Hölle. Orkanartige Feuerstürme wirbelten durch die Straßen, meterhohe Flammen loderten aus den Häusern, in den Kellern erstickten und verbrannten Menschen. Der Feuerschein war noch in 350 Kilometern Entfernung zu sehen. Im gespenstischen Licht der untergehenden Stadt waren selbst in 6700 Metern Höhe noch Einzelheiten des Infernos zu erkennen: »Zum ersten Mal«, bekannte ein britischer Pilot, »fühlte ich Mitleid mit der Bevölkerung dort unten.« Am Tag darauf folgten die amerikanischen Bomberverbände und vollendeten das Vernichtungswerk. Dresden war das Fanal eines beispiellosen Bombenkriegs, dem 450 000 deutsche Zivilisten zum Opfer fielen. Der Feuersturm kehrte dorthin zurück, wo er einst entfacht worden war. An den Folgen leiden wir noch heute.
* * *
Was bleibt als Bilanz? Ein krimineller Tyrann vermochte den halben Kontinent in Brand zu setzen. Für den Kriegsherrn Hitler war der Krieg nicht nur Staatsziel, er war Selbstzweck, und der Überlebenskampf das Gesetz jeder Existenz: der Wahn des Usurpators, für den es nur Entweder-Oder gab – Siegen oder Untergehen. Er fand genügend Generäle, die ihm folgten. Millionen von Soldaten wurden nicht gefragt. Krieg aber ist kein Kartenspiel von Generälen und Strategen, ausgeführt von gut gedrillten Helden, sondern Dreck und Blut und Tod. Und nie leiden nur Soldaten, sondern immer auch »Zivilisten«. Und was heißt schon »Zivilisten« im totalen Krieg? Stets sind es am Ende die Schwachen, die dem mörderischen Kampf zum Opfer fallen – Frauen, Kinder, alte Menschen. Ob es die jungen Matrosen der »Bismarck« sind, die der bornierte Wahn ihres Admirals in den Tod geschickt hat; die alliierten Seeleute auf jenen Tausenden von Handelsschiffen, die von deutschen U-Booten versenkt wurden; ob die U-Boot-Männer selbst, von denen mehr als jeder zweite starb; ob die Familien, die im Londoner East End Opfer deutscher Bomber wurden; ob die Toten in den Feuerstürmen, der in deutschen Städten tobte; ob jene Deutschen, Briten, Italiener und Australier, die im Wüstenkrieg ihr Leben lassen mussten – alle sind sie Opfer eines Krieges, der gezeigt hat, was sich Menschen antun können, die besessen sind von blindem Hass und von, so meinen sie, gerechtem Zorn.
Was hoffen lässt, sind einzelne Berichte über Menschlichkeit inmitten grausamer Geschehnisse. Ob es deutsche oder britische Matrosen waren, die ihre hilflos im Wasser treibenden Gegner vor dem Ertrinken gerettet haben; ob Soldaten, die im Wüstenkrieg, obwohl selbst unter schwerem Beschuss, gefangene Feinde mit Wasser und Essen versorgten; ob deutsche Zivilisten, die abgeschossene alliierte Flieger vor der Wut des Mobs in Sicherheit gebracht haben – ihnen ist die Filmreihe gewidmet. Und dieses Buch.
Sie galt als das mächtigste Schlachtschiff der Welt. Die »Bismarck«, ein gewaltiger Koloss aus Kruppstahl, sollte die Wende in der Atlantikschlacht herbeiführen – bevor die Amerikaner endgültig in den Krieg eintreten würden. Ende Mai 1941 gelang es den Briten jedoch, die »Bismarck« nach einem Rudertreffer in schwerem Wetter im Nordatlantik zu orten. Knapp 1000 Meilen vor der rettenden französischen Küste musste sich der Stolz der deutschen Marine geschlagen geben. Die »Bismarck« sank. Von 2221 Mann Besatzung konnten nur 115 gerettet werden.
Gdingen, 5. Mai 1941: Überraschend hatte sich in dem verschlafenen Ostseehafen, der nun »Gotenhafen« hieß, hoher Besuch angesagt. Der »Führer« des »Großdeutschen Reichs« besichtigte den Stolz der deutschen Kriegsmarine: die beiden neuen Schlachtschiffe »Bismarck« und »Tirpitz«, die sich in den sicheren Gewässern auf ihren Einsatz vorbereiteten. Es waren gewaltige Kolosse, gepanzert mit speziellem Stahl des Typs »Wotan hart«, bewaffnet mit je acht 38-cm-Kanonen, jedem feindlichen Schiff ihrer Zeit überlegen. Die Besatzungen waren an Deck angetreten, alles war auf Hochglanz poliert. Hitler schien die Visite an jenem sonnigen Tag nur wenig genossen zu haben. Die See und alles Maritime blieben ihm zeitlebens fremd – trotz der beeindruckenden Leistung seiner Waffenschmieden. Schweigend und ein wenig bleich im Gesicht hatte sich Hitler die gewaltigen Schiffe vorführen lassen. Am Ende blieb jedoch seine Skepsis, ob ein Einsatz dieser wertvollen Einheiten im Atlantik nicht doch zu riskant sei.
Mein Vater ist auch bei der Marine gewesen. Er hat mich einmal in Hamburg besucht. Nachdem wir die »Bismarck« besichtigt hatten, sagte er zu mir: »Auf diesem Schiff kann dir nichts passieren. Das kann gar nicht untergehen.« Karl Kuhn, Besatzungsmitglied der »Bismarck«
Nach anderthalb Jahren Krieg stand das »Dritte Reich« auf dem Höhepunkt seiner Macht: Ein Land nach dem anderen war von der Wehrmacht in atemberaubend schnellen Feldzügen niedergeworfen worden. Im April 1941 hatten die deutschen Armeen auch den Balkan überrollt und die Briten vom Kontinent vertrieben. Jetzt endlich konnte Hitler »seinen« Krieg beginnen: den Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion, der seit dem Sommer 1940 vorbereitet wurde. Während sich Hitlers Interessen nach Osten richteten, war Großadmiral Erich Raeder ganz auf den Kriegsschauplatz im Westen konzentriert. Für den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine war der Angriff auf die Sowjetunion ein törichter Fehler. England war für ihn der Hauptgegner, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. Und jetzt endlich, so Raeder, habe die kleine deutsche Kriegsmarine mit der »Bismarck« zum ersten Mal ein Instrument in der Hand, mit dem sie die Royal Navy das Fürchten lehren konnte!
Wir alle hatten das Gefühl auf dem stärksten Schiff der Welt zu fahren und unsinkbar zu sein. Otto Peters, Maschinist auf der »Bismarck«
1938 hatte sich bereits abgezeichnet, dass Hitler die Briten in seinem außenpolitischen Hasardspiel als möglichen Kriegsgegner ansehen musste. Fieberhaft war die Marineleitung darangegangen, Pläne für einen Kampf gegen Großbritannien auszuarbeiten und sich Gedanken über die Zusammensetzung einer neuen »Großdeutschen« Flotte zu machen. Für Raeder lag die Schlussfolgerung aus dem Ersten Weltkrieg auf der Hand: Das »Deutsche Reich« konnte sich nicht auf den direkten Kampf Schlachtschiff gegen Schlachtschiff einlassen, sondern musste sich des so genannten Kreuzerkriegs bedienen: Es galt mit allen verfügbaren Kriegsschiffen gezielte Schläge gegen die lebenswichtigen britischen Versorgungslinien zu führen. Mächtige Schlachtschiffe sollten dabei den Geleitschutz der feindlichen Frachter niederkämpfen und so die Vernichtung ganzer Konvois ermöglichen.
Wir waren gerade am Heck versammelt, als der 1. Offizier der »Emden« uns mitteilte, dass England Deutschland den Krieg erklärt hatte. Es war kein glücklicher Augenblick. Wir erinnerten uns daran, dass unsere Väter uns erzählt hatten, wie sie bei der Kriegserklärung gejubelt hatten, aber jetzt wusste niemand, was er sagen sollte. Wir alle dachten: »Jetzt sitzen wir drin im Schlamassel.« Werner Schünemann, Seekadett auf dem Kreuzer »Emden«
Raeder, der den Versprechungen Hitlers, es werde vor 1944 keinen Krieg gegen Großbritannien geben, glaubte, stürzte sich in gigantische Flottenbauprogramme, die erst nach Jahren abgeschlossen sein würden. Die Kriegserklärung Englands am 3. September 1939 traf ihn daher völlig unvorbereitet. Seine Marine war auf einen solchen Konflikt in keiner Weise vorbereitet. Wie sollten die wenigen deutschen Kriegsschiffe dem maritimen Giganten ernsthaft Schaden zufügen können, wenn dies mit ungleich stärkeren Mitteln schon im Ersten Weltkrieg nicht gelungen war? Konsterniert notierte Raeder, die Marine könne derzeit allenfalls beweisen, dass sie in der Lage sei, »in Ehren unterzugehen«. In der Tat war das Kräfteverhältnis bei Kriegsbeginn deprimierend: 2 Schlachtschiffen, 10 Kreuzern und 22 Zerstörern auf deutscher Seite standen 15 Schlachtschiffe, 63 Kreuzer und 168 Zerstörer auf britischer Seite gegenüber.
Im September 1939 kreuzten die beiden Panzerschiffe »Deutschland« und »Admiral Graf Spee« weit draußen im Atlantik. Die Marineleitung hatte sie Ende August angesichts des bevorstehenden Angriffs auf Polen vorsorglich in See geschickt; die von den Briten kontrollierten Nordseeausgänge hatten sie längst unbemerkt passiert. Am 26. September kam der Befehl, den Kampf gegen die britische Handelsschifffahrt aufzunehmen. Die Jagdzüge der »Deutschland« waren wenig erfolgreich. Innerhalb von sechs Wochen konnte sie im Nordatlantik nur zwei Frachter versenken, bevor sie von Raeder zurückgerufen wurde. Erfolgreicher war die »Admiral Graf Spee« im Südatlantik und im Indischen Ozean. Bis Anfang Dezember konnte sie neun Handelsschiffe vernichten. Briten und Franzosen boten eine gewaltige Armada auf, um den »Raider« in der Weite des Ozeans aufzuspüren und zu zerstören. Doch Kapitän Langsdorff konnte seinen Verfolgern immer wieder entkommen.
Anfang Dezember entschloss sich Langsdorff, vor der Mündung des Rio de la Plata nach neuer Beute zu suchen. Diesmal waren die Briten allerdings vorbereitet. Als die »Graf Spee« am Morgen des 13. Dezember 1939 im Seegebiet vor Uruguay auftauchte, traf sie nicht – wie erhofft – auf wehrlose Handelsschiffe, sondern auf drei britische Kriegsschiffe, die mit hoher Fahrt auf die Deutschen zuliefen: die beiden Leichten Kreuzer »Ajax« und »Achilles« und der Schwere Kreuzer »Exeter«. Kapitän Langsdorff nahm das Gefecht weisungswidrig an und hoffte, mit seinen schweren 28-cm-Geschützen den Gegner niederkämpfen zu können. Nach einem heftigen Artillerieduell musste die »Exeter« schwer getroffen ablaufen. Auch die Kreuzer »Ajax« und die »Achilles« waren beschädigt, aber nicht außer Gefecht gesetzt. Und die »Graf Spee«? Mehrere Geschütze der Mittelartillerie waren ausgefallen, die Kombüse war zerstört, die Besatzung hatte 36 Tote und 59 Verwundete zu beklagen. Langsdorff, der keine Möglichkeit sah, mit dem beschädigten Schiff die Heimat erreichen zu können, steuerte den nächsten neutralen Hafen an, um dort die Gefechtsschäden auszubessern. Am Abend des 13. Dezember lief die »Graf Spee« in Montevideo ein. Die probritische Regierung Uruguays bestand auf der strikten Einhaltung der Neutralitätsgesetze. Das hieß: Nach 72 Stunden musste das deutsche Kriegsschiff den Hafen verlassen oder es würde interniert werden. Langsdorff saß in der Falle. In der kurzen Zeit konnten die Gefechtsschäden unmöglich ausgebessert werden. Hinzu kam, dass verschiedene – tatsächlich aber gefälschte – Meldungen eine hohe Konzentration britischer Kräfte vor der Küste verkündeten. Schiff und Besatzung befanden sich in einer aussichtslosen Lage. Nach Ablauf der Frist ließ Kapitän Langsdorff am 17. Dezember 1939 die Besatzung von Bord gehen und die »Graf Spee« in der Mündung des Rio de la Plata versenken. Langsdorff selbst erschoss sich drei Tage später. Die Besatzung des Schiffes wurde interniert. Etlichen Männern gelang es dennoch, auf abenteuerlichen Wegen Deutschland zu erreichen.
Keine Hoffnung, auf hohe See zu kommen und die Fahrt nach den Heimatgewässern zu erzwingen. Funkspruch von Langsdorff an Raeder, 16. Dezember 1939
Keine Internierung in Uruguay. Versuchen Sie wirkungsvolle Zerstörung, wenn Schiff versenkt werden muss. Funkspruch von Raeder an Langsdorff, 16. Dezember 1939
Die Kriegsmarine hatte ihren ersten schweren Verlust zu beklagen. Gewiss, die »Graf Spee« hatte wochenlang mit der Royal Navy Katz und Maus gespielt, neun Handelsschiffe versenkt und drei Kreuzer beschädigt. Doch während Raeder mit ihr eines seiner wertvollen Schiffe verloren hatte, waren die deutschen Erfolge, gemessen an der Stärke Englands, nur kleine Nadelstiche. Die Bilanz des ersten halben Jahres war aus deutscher Sicht also eher ernüchternd.
Ich allein trage die Verantwortung für die Versenkung des Panzerschiffs »Graf Spee«. Ich bin glücklich, mit meinem Leben zahlen zu können, um die Ehre der Fahne rein zu halten. Abschiedsbrief von Kapitän Langsdorff
Die nächsten Monate veränderten die Lage jedoch grundlegend: Im Frühjahr 1940 besetzte die Wehrmacht Norwegen und überrannte im Mai und Juni auch Frankreich. Die Marine war jetzt nicht mehr im »Nassen Dreieck« der Nordsee eingeschlossen, sondern verfügte mit Norwegen über eine ungleich günstigere geografische Ausgangsbasis. Im Spätherbst des Jahres 1940 ging Raeder daran, alle verfügbaren Kriegsschiffe in die Weiten des Atlantik zu schicken – der Handelskrieg gegen die Briten sollte beginnen. Den Anfang machte das große Panzerschiff »Admiral Scheer«. Am 23. Oktober verließ das Schwesterschiff der »Graf Spee« Gotenhafen, lief durch den Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee und tankte in einem Fjord bei Stavanger noch einmal ihre Bunker auf. In einem weiten Bogen wurde zunächst die britische Insel umfahren. Danach gab es zwei Möglichkeiten, in den Atlantik vorzustoßen: entweder durch die Island-Faröer-Enge oder durch die zwischen Island und Grönland gelegene Dänemarkstraße. Beide Gebiete wurden von britischen Kriegsschiffen bewacht, es war der gefährlichste Teil des ganzen Unternehmens. Die »Admiral Scheer« hatte Glück: Während eines wilden Orkans durchbrach sie in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November 1940 unbemerkt die Dänemarkstraße. Nur wenige Tage später stieß sie auf einen nur schwach gesicherten britischen Geleitzug und versenkte sechs Schiffe. Vergeblich suchte die Royal Navy nach dem wildernden Wolf. Die »Scheer« setzte sich nach Süden ab, wo sie vom Flottentanker »Nordmark« versorgt wurde. In den nächsten Monaten führte sie im Mittel- und Südatlantik Krieg gegen britische Versorgungsschiffe, im Februar 1941 stieß sie gar bis zu den Seychellen vor. Hier entging sie nur knapp ihren britischen Verfolgern, die sie mit einem Bordflugzeug bereits gesichtet hatten. Am 1. April 1941 erreichte die »Scheer« nach einer sechsmonatigen Kaperfahrt unbeschadet Kiel. 17 Schiffe waren ihr zum Opfer gefallen.
Tut mir Leid, Captain, ich muss Ihr Schiff versenken. Es ist Krieg. Kapitän Langsdorff an den Kapitän des britischen Dampfers »Clement«
Nach der »Scheer« hatte Raeder den Schweren Kreuzer »Admiral Hipper« in den Atlantik geschickt. Im Dezember 1940 durchlief auch er unbemerkt die Dänemarkstraße. Allerdings stellte sich bald heraus, dass das Schiff für lange Atlantikoperationen kaum geeignet war. Die hochempfindliche Maschinenanlage machte immer wieder Probleme, brach zeitweise sogar völlig zusammen. Außerdem verbrauchte das schnelle Schiff derart viel Heizöl, dass es immer wieder bei einem im Atlantik kreuzenden Versorgungsschiff nachtanken musste. Am Weihnachtsmorgen des Jahres 1940 stieß die »Hipper« dann auf einen schwer gesicherten Geleitzug mit zwanzig Truppentransportern. Diese Beute war eine Nummer zu groß. Nach einem kurzen Gefecht mit den Bewachern konnte sich die »Hipper« absetzen und erreichte zwei Tage später Brest. In dem ehemaligen französischen Kriegshafen hatten sich die Deutschen mittlerweile häuslich eingerichtet. Die »Hipper« konnte hier – sozusagen vor der Haustür der britischen Versorgungslinien – repariert und neu ausgerüstet werden. Anfang Februar 1941 lief sie wieder in den Atlantik aus, brach wild um sich schießend in einen ungesicherten Geleitzug ein und versenkte sieben Handelsschiffe.
Bislang hatten die Deutschen also nur einzelne Kreuzer in den Atlantik gesandt. Diese freilich demonstrierten, dass es der mächtigen Royal Navy nicht möglich war, sie zu fassen. Für Raeder war die Folgerung eindeutig: Musste der Erfolg nicht ungleich größer sein, wenn er Schlachtschiffe einsetzen würde, die auch gut gesicherte Konvois vernichten könnten? Wären die Briten dann nicht sogar gezwungen, ihren lebenswichtigen Geleitzugverkehr zeitweise ganz einzustellen? Raeders Problem dabei war nur, mit welchen Schiffen er diese zukünftigen Operationen durchführen sollte. Das Schlachtschiff »Bismarck« war noch nicht einsatzbereit. Am 24. August 1940 war es zwar in Dienst gestellt worden, durchlief aber immer noch eine intensive Erprobungs- und Ausbildungsphase. Das Schwesterschiff »Tirpitz« stand erst kurz vor der Fertigstellung. Immerhin waren die während des Norwegen-Feldzugs beschädigten Schlachtschiffe »Scharnhorst« und »Gneisenau« wieder einsatzbereit, schnelle Schiffe, die allerdings nur mit neun 28-cm-Geschützen bewaffnet waren, während die britischen Schlachtschiffe meist 38-cm-Kanonen trugen. Flottenchef Admiral Lütjens bekam daher folgende Anweisungen: Er sollte mit der »Scharnhorst« und der »Gneisenau« britische Handelsschiffe versenken – möglichst beladene Frachter, die auf dem Weg von Kanada nach England waren. Überlegenen britischen Seestreitkräften sollte er aber unbedingt ausweichen, um die eigenen Schiffe nicht zu gefährden.
Am 22. Januar 1941 lief der Verband aus dem Hafen von Kiel aus. Das Unternehmen »Berlin« hatte begonnen. Bereits beim Passieren des Großen Belt wurden die Schiffe von britischen Agenten gesichtet, die Londoner Admiralität war gewarnt. Die »Home Fleet« bezog südlich von Island eine Auffangposition. Von all dem ahnte Lütjens nichts. Er hatte am 27. Januar das Nordmeer erreicht und entschloss sich, den Durchbruch durch die Island-Faröer-Enge zu versuchen, da die Dänemarkstraße im Winter durch das Grönlandeis recht schmal war und somit leicht überwacht werden konnte. Mit hoher Geschwindigkeit stampften die beiden deutschen Schlachtschiffe bei guter Sicht durch die See, der wartenden »Home Fleet« direkt in die Arme. Bald kam der feindliche Kreuzer »Naiad« in Sicht – Lütjens war auf die britische Auffanglinie gestoßen. »Scharnhorst« und »Gneisenau« waren entdeckt! Lütjens, der sofort kehrtmachen ließ, konnte die »Naiad« gleich wieder abschütteln. An dieser Stelle schien der Durchbruch in den Atlantik nicht zu schaffen, die Gewässer südlich von Island waren einfach zu gut bewacht.
Lütjens ergänzte zunächst im Nordmeer aus einem deutschen Tanker Treiböl und versuchte es in der schmalen Dänemarkstraße. Am 4. Februar passierte der Verband die Nordküste Islands, ortete mit den Radargeräten ein feindliches Schiff, wich ihm erfolgreich aus und ließ wenig später die gefährliche Enge hinter sich. Admiral Lütjens hatte es doch noch geschafft, unbemerkt durchzubrechen. Nur vier Tage später sichtete die »Scharnhorst« auf dem Dampferweg Kanada-England einen großen Geleitzug: HX 106. Gleichzeitig kamen jedoch auch die Mastspitzen eines Kriegsschiffs in Sicht. Auf der Brücke war die Enttäuschung groß. Der Gegner war das britische Schlachtschiff »Ramillies« – ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, doch mit seinen acht 38-cm-Kanonen weit überlegen. Da Lütjens strikte Order hatte, sich nicht auf einen ungleichen Kampf mit dem Gegner einzulassen, drehte er ab und verschwand in der Weite des Atlantik. Vergeblich suchten Lütjens’ Schiffe in den nächsten Wochen den erhofften großen, schwach gesicherten Geleitzug. Weit auseinander gezogen kreuzten die beiden Schiffe östlich von Neufundland auf und ab. Doch kein Dampfer kam in Sicht – nichts, nur eine endlose Wasserwüste. Nach vier Wochen vergeblichen Suchens gab Lütjens die Hoffnung auf, im Nordatlantik noch auf einen Konvoi zu stoßen. Der Flottenchef entschloss sich, sein Glück weiter im Süden, in den Gewässern um die Kapverdischen Inseln, zu versuchen. Und tatsächlich, am Morgen des 7. März stieß er auf einen schwer beladenen Geleitzug – und auf das Schlachtschiff »Malaya«. Es war wie verhext. Eine Woche später kreuzte er südöstlich von Neufundland und konnte immerhin einige Einzelfahrer zerstören. Nach der Versenkung von 22 Handelsschiffen nahm Lütjens Kurs auf Brest.
Die Briten waren der deutschen Kampfgruppe inzwischen mit ihrem Gibraltargeschwader, der »Force H«, auf den Fersen. Besonders die Torpedobomber des Flugzeugträgers »Ark Royal« waren für die deutschen Schiffe eine Gefahr. Am Abend des 20. März wurden die »Scharnhorst« und die »Gneisenau« von Aufklärern des »Ark Royal« gesichtet, der nur 300 Kilometer entfernt von den deutschen Schiffen kreuzte. Lütjens erwartete für den nächsten Tag einen Luftangriff, die Besatzungen waren in höchster Alarmbereitschaft. Doch wieder einmal hatte der Kommandant Glück: Schlechtes Wetter verschluckte seine beiden Schlachtschiffe, die Flugzeuge der »Ark Royal« konnten ihn nicht mehr orten. Zwei Tage später erreichte sein Verband Brest. Die erste Atlantikoperation der deutschen Schlachtschiffe war damit erfolgreich beendet worden.
Seit einem halben Jahr kämpften deutsche Überwasserschiffe nun schon im Atlantik. Sie hatten ohne eigene Verluste 48 Schiffe mit fast 270 000 Bruttoregistertonnen (BRT) versenkt. Immer wieder war der Durchbruch der britischen Bewacherlinien gelungen, auch die Versorgung der Schiffe auf See durch ein ganzes Netz von Tankern hatte reibungslos funktioniert. Und endlich war auch das Schlachtschiff »Bismarck« einsatzbereit. Ende April sollte es zusammen mit der »Gneisenau« im Atlantik operieren. Wenn die »Scharnhorst« im Juli ihre Maschinenüberholung abgeschlossen haben würde, so hoffte Raeder, könnte sie ebenfalls dazustoßen. Dann wäre es auch endlich möglich, Geleitzüge mit Schlachtschiffsicherung anzugreifen.
Die »Bismarck« war ein waffentechnisches Meisterwerk. Man war sehr erfreut darüber, in einem erstklassig artillerietechnisch ausgerüsteten Schiff seinen Dienst zu tun. Burkard Freiherr von Müllenheim-Rechberg, 4. Artillerieoffizier der »Bismarck«
Die Briten sahen natürlich nicht tatenlos zu, wie sich vor ihrer Haustür eine tödliche Bedrohung zusammenbraute. Gegen die »Bismarck«, deren Besatzung gerade in der Ostsee ihre Ausbildung abschloss, konnten sie vorerst nichts unternehmen. Die »Scharnhorst« und die »Gneisenau« allerdings lagen in Brest praktisch vor der Haustür. Dem »Bomber Command« wurde eine neue Aufgabe zugewiesen: »Angriff auf die deutschen Schlachtschiffe.« Erstaunlicherweise hatte die Kriegsmarine kaum Maßnahmen getroffen, um einen ihrer wichtigsten Häfen gegen feindliche Luftangriffe zu schützen. So kam, was kommen musste. Am Morgen des 6. April 1941 fegte ein steifer Nordostwind über die Bretagne. Die Sicht war schlecht, nur etwa 1000 Meter, die Wolken hingen tief. Die »Gneisenau« lag am Kai, Torpedoschutznetze waren nicht vorhanden. Plötzlich stieß ein einzelner britischer Torpedobomber aus den Wolken und raste auf das Schiff zu. Die Flak eröffnete das Feuer, deutlich war zu sehen, wie die Geschosse in dem Flugzeug einschlugen. Doch kurz bevor die Maschine abgeschossen wurde, klinkte der Pilot noch seinen Torpedo aus, der das Schiff wenige Augenblicke später achtern traf. Zu allem Übel wurde die »Gneisenau« vier Tage später von vier weiteren Bomben getroffen. Die geplante Atlantikoperation des Schlachtschiffs fiel damit aus. In den folgenden sechs Monaten wurde das Schiff repariert.
Als Ersatz für die »Gneisenau« sollte nun der neue Schwere Kreuzer »Prinz Eugen«, ein Schwesterschiff der »Hipper«, die »Bismarck« begleiten. Lütjens hielt allerdings nicht viel davon, mit zwei so ungleichen Schiffen zu operieren. Die Einsätze der »Hipper« hatten gezeigt, welch große Probleme diese Kreuzer mit ihrer Antriebsanlage hatten. Für eine monatelange Operation eigneten sie sich daher nicht, allenfalls für kurze, schnelle Vorstöße. Er wollte daher lieber warten, bis im Herbst das zweite große Schlachtschiff, die »Tirpitz«, nach Abschluss der Testfahrten einsatzbereit sein würde. Dann könnte er mit vier Schlachtschiffen eine Kampfgruppe bilden, der die Royal Navy so schnell nichts Gleichwertiges entgegensetzen konnte. Doch Raeder war nicht bereit, so lange zu warten. Er wollte die Briten auf jeden Fall weiter in Atem halten. Kapitän Topp, der Kommandant der im Februar in Dienst gestellten »Tirpitz«, wollte die »Bismarck« unbedingt begleiten und meldete, dass sein Schiff bereits einsatzbereit sei. Raeder ließ sich allerdings nicht darauf ein, das noch nicht eingefahrene Schlachtschiff vorzeitig in den Atlantik zu schicken. Die Zeit der »Tirpitz« würde später kommen.
Lütjens erhielt also den Befehl, nur mit der »Bismarck« und der »Prinz Eugen« in See zu stechen. Er soll die Besprechung mit Raeder kreidebleich verlassen haben, kannte er die Risiken, die vor ihm lagen, doch nur zu gut. Gewiss, bislang war immer alles gut gegangen und die »Bismarck« brauchte kein feindliches Schiff zu fürchten. Doch konnte man wirklich so sicher sein, dass das Glück anhalten würde? Besonders jetzt, da der Sommer nahte, die Nächte immer kürzer und das Wetter immer besser werden würden? Schon der Durchbruch der »Gneisenau« und der »Scharnhorst« in den Atlantik war wegen der Meldungen britischer Agenten beinahe gescheitert, und beim Rückmarsch nach Brest war es nur dem schlechten Wetter zuzuschreiben, dass man einem Angriff britischer Torpedobomber entgangen war. Trotz aller Bedenken war Lütjens jedoch nicht gewillt, seinem Oberbefehlshaber Raeder zu widersprechen. Seine beiden Vorgänger waren in Ungnade gefallen. Er wollte nicht der dritte Flottenchef sein, dem das Oberkommando der Marine Unfähigkeit vorwarf.
Churchill wusste, wie gefährlich ein Schiff von der Größe der »Bismarck«, ihrer Geschwindigkeit und ihres Zerstörungspotenzials für uns werden könnte. Mit der Vernichtung unserer Versorgungskonvois, die Nahrung, Waffen, Munition und Öl aus Amerika lieferten, wäre für England die Fortsetzung des Krieges erheblich erschwert worden. Die »Bismarck« war die größte Bedrohung der britischen Seemacht, die es in diesem Krieg gab. Sir Ludovic Kennedy, Offizier auf dem Zerstörer »Tartar«
So begann am 18. Mai 1941 das Unternehmen »Rheinübung«: »Bismarck« und »Prinz Eugen« sollten den Erfolg des Unternehmens »Berlin« wiederholen und im Atlantik feindliche Handelsschiffe jagen, möglichst ganze Konvois vernichten. Dabei war es nun auch endlich gestattet, mit der »Bismarck« feindliche Schlachtschiffsicherungen anzugreifen.
Als die »Bismarck« unter den Klängen der Flottenkapelle in Gotenhafen ablegte, herrschte an Bord gespannte Erwartung. Nach der langen achtmonatigen Ausbildung ging es endlich in den Einsatz, jetzt würden die Männer zeigen können, wozu sie und ihr Schiff fähig waren. Die Gedanken kreisten um das, was die nächsten Tage bringen würden. Entscheidend würde sein, dass man unbemerkt in den Atlantik vorstoßen konnte. Bei herrlichem Sommerwetter passierte der deutsche Verband den Großen Belt. »Hätten wir nur nicht durch eine solche Unzahl dänischer und schwedischer Fischkutter hindurch müssen – noch dazu in so klarer Sichtweite der schwedischen Küste«, so Kapitänleutnant Müllenheim-Rechberg, 4. Artillerieoffizier auf der »Bismarck«. Für feindliche Agenten musste es bei diesem Wetter ein Leichtes sein, das Auslaufen der deutschen Schiffe festzustellen. Gegen Mittag kam auch noch der schwedische Kreuzer »Gotland« in Sicht. Lütjens war überzeugt, dass er entdeckt worden war – und er sollte Recht behalten. Die Sichtmeldung der »Gotland« gaben Mitarbeiter des schwedischen Geheimdienstes an den britischen Militärattaché in Stockholm, Captain Henry Dunham, weiter, der umgehend die Admiralität in London informierte.
Unterdessen setzten die »Bismarck« und die »Prinz Eugen« ihren Ausmarsch fort. Es ging weiter nach Norden durch das Kattegat, hinein in die Nordsee. Am Abend des 20. Mai kam für kurze Zeit die norwegische Südküste in Sicht. An Bord ahnte niemand, dass an der Küste der norwegische Widerstandskämpfer Viggo Axelssen die beiden deutschen Kriegsschiffe mit seinem Fernglas ausgemacht und seine Meldung sogleich nach London gefunkt hatte. Die Briten waren somit gleich mehrfach gewarnt. Lütjens entschloss sich, plangemäß Bergen anzulaufen, um hier die Treibölbunker der »Prinz Eugen« aufzufüllen. Ein direkter Weitermarsch war nur vorgesehen, falls ideale Durchbruchsbedingungen herrschten, denn noch war das Wetter zu gut. Bei strahlendem Sonnenschein lief die »Bismarck« am Morgen des 21. Mai in die Schärengewässer bei Bergen und ankerte im Fjöranger Fjord, bestaunt von zahlreichen Norwegern, die neugierig am Ufer standen. Gegen Mittag gab es Fliegeralarm, doch kein britischer Bomber war zu sehen, »nur« ein hochfliegender Aufklärer, der auch bald wieder verschwand. Während man sich an Bord über den kurzen Zwischenfall kaum Gedanken machte, hatte die britische Admiralität nun eine endgültige Bestätigung für die Anwesenheit der deutschen Kampfgruppe. Flying Officer Michael Suckling hatte mit seiner »Spitfire« aus 8000 Meter Höhe bei herrlichem Wetter hervorragende Fotos von der »Bismarck« und der »Prinz Eugen« geschossen.
Wahrscheinlich waren wir von der norwegischen Küste aus beobachtet worden, aus kleinen Häuschen, die an den Bergen standen. Die Norweger waren zwar offiziell unsere Freunde, doch sie haben alles versucht, um die Schiffsbewegungen den Engländern zu melden. Otto Peters, Maschinist auf der »Bismarck«
Das Oberkommando der Marine entzifferte unterdessen eine feindliche Funkmeldung, aus der hervorging, dass britische Aufklärer nach zwei Schlachtschiffen auf Kurs Nord suchen sollten. »Dies ist der Beweis dafür«, schrieb die Seekriegsleitung in ihr Kriegstagebuch, »dass die Auslaufbewegung der ›Bismarck‹-Gruppe erkannt ist.« Man wusste allerdings nicht genau, wie die Briten vom Auslaufen erfahren hatten, vermutete aber Agentenmeldungen von Beobachtungsposten im Großen Belt. Der Seekriegsleitung war bekannt, dass hier schon die »Scharnhorst« und die »Gneisenau« entdeckt worden waren. Um so erstaunlicher ist es, dass man die »Bismarck« denselben Weg nehmen ließ und sie nicht durch den Nord-Ostsee-Kanal westlich an Dänemark vorbeischickte. In der südlichen Nordsee war allerdings die Minengefahr sehr viel größer, ebenso die Wahrscheinlichkeit von U-Boot- oder Luftangriffen. Einen echten Königsweg gab es also im Grunde nicht.
Unterdessen hatte die »Prinz Eugen« ihre Treibölbunker wieder aufgefüllt. Dass die »Bismarck« nicht nachtankte, sollte fatale Folgen haben. Kurz vor Mitternacht des 21. Mai 1941 machten die deutschen Schiffe Anker auf und schlichen sich aus dem schützenden Fjord. Hinter sich erkannten sie den Lichterschein von Detonationen – die Briten hatten 18 Bomber entsandt, die nun blind ihre Fracht über den Fjorden abluden. Am nächsten Morgen wurden die vier Begleitzerstörer entlassen, die den Verband bislang gegen feindliche U-Boote gesichert hatten. Die »Bismarck« und die »Prinz Eugen« waren nun allein und steuerten Kurs Nord.
Ich war auf dem Oberdeck, als eine »Spitfire« durch die Wolkendecke schoss. So schnell wie sie gekommen war, war sie auch wieder verschwunden. Mir ist damals nicht der Gedanke gekommen, dass sie uns fotografiert hat. Aber sie hat uns fotografiert. Otto Peters, Maschinist auf der »Bismarck«
Nachdem die Seekriegsleitung erfahren hatte, dass die »Bismarck« entdeckt worden war, kam es nun darauf an, möglichst schnell festzustellen, welche Gegenmaßnahmen die Briten ergriffen hatten. Am 20. Mai war es einem deutschen Aufklärer gelungen, den Flottenstützpunkt der »Home Fleet« in Scapa Flow im hohen Norden Schottlands zu fotografieren. Deutlich war zu erkennen, dass die britischen Kriegsschiffe ihren Hafen noch nicht verlassen hatten. Am nächsten Tag verhinderte das schlechte Wetter einen weiteren Flug. Erst am 22. Mai kreiste wieder ein deutsches Flugzeug über Scapa Flow. Diesmal schaffte es die Besatzung jedoch nicht, das Allerheiligste der britischen Flotte zu fotografieren. Sie meldete, was sie mit bloßem Auge gesehen zu haben glaubte: »Vier schwere Einheiten, darunter möglicherweise ein Flugzeugträger.« Die »Home Fleet« lag demnach also noch immer im Hafen, Gegenmaßnahmen waren offenbar noch nicht getroffen worden. »Diese Tatsache stellt eine wesentliche Beruhigung für die operative Führung dar«, bemerkte die Seekriegsleitung. Sie ahnte nicht, dass sich die Beobachter der Luftwaffe getäuscht hatten. Ihnen war entgangen, dass die beiden Schlachtschiffe »Prince of Wales« und »Hood« nicht mehr in Scapa Flow lagen. Der Befehlshaber der »Home Fleet«, Admiral Tovey, hatte sie am Abend des 21. Mai unter dem Kommando von Vizeadmiral Holland auslaufen lassen, nachdem er erfahren hatte, dass die »Bismarck« mit einem Schweren Kreuzer in einem Fjord bei Bergen lag. Am 22. Mai meldete ein britischer Aufklärer aus Bergen, dass die Liegeplätze der deutschen Schiffe leer seien. Tovey stach nun auch mit dem Rest seiner Streitkräfte in See, dem Schlachtschiff »King George V«, dem Schlachtkreuzer »Repulse«, dem Flugzeugträger »Victorious«, vier Kreuzern und sieben Zerstörern. »Versenkt die ›Bismarck‹«, hieß die Losung.
Erfahrungsgemäß ist der Mai der ungünstigste Monat für Passieren der Dänemarkstraße. Operationsbefehl für »Bismarck« und »Prinz Eugen« vom 22. April 1941