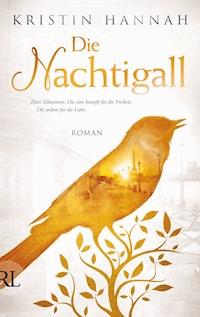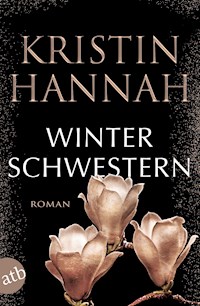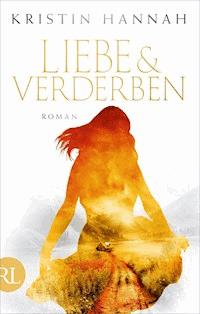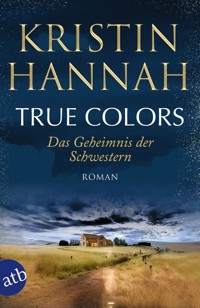9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Familiengeschichte von Kristin Hannah, der Autorin des Weltbestsellers „Die Nachtigall“.
Es ist der Alptraum einer jeden Familie: Die passionierte Reiterin Mikaela wird von ihrem Pferd abgeworfen – und ihr kleiner Sohn Bret gibt sich die Schuld dafür. Als Mikaela in ein tiefes Koma fällt, glaubt ihr Mann Liam fest daran, dass er sie mit seiner Liebe ins Leben zurückholen kann. Gleichzeitig muss er sich jedoch um seine beiden Kinder kümmern, die mit dem Unfall ihrer Mutter zu kämpfen haben. Vor allem Bret ist schwer traumatisiert. Und dann stößt Liam auf ein lang gehütetes Geheimnis seiner Frau …
»Kristin Hannah ist meine absolute Lieblingsautorin. Ihre Romane sind zum Weinen schön!«Susan Elizabeth Phillips
Dieser Roman erschien erstmals unter dem Titel "Wenn Engel schweigen" und wurde für die Neuausgabe neu übersetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Es ist der Tag vor Halloween, und der neunjährige Bret möchte seiner Mutter Mikaela eine Freude bereiten. Er steht im Morgengrauen auf, kocht ihr Kaffee und sattelt ihr Pferd; dann aber wird er Zeuge, wie seine Mutter beim Sprung über ein Hindernis stürzt und schwer verletzt wird. Mikaela fällt in ein tiefes Koma, und die Ärzte geben der Familie wenig Hoffnung. Doch ihr Mann gibt den Kampf um die Frau, die er über alles liebt, nicht auf. Dabei wird auch die Sorge um seine Kinder immer größer – vor allem der kleine Bret verhält sich, von Schuldgefühlen geplagt, immer auffälliger. Schließlich entdeckt Liam ein Geheimnis seiner Frau, das ihre Familie zerstören könnte ...
Über Kristin Hannah
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der USA und lebt mit ihrem Mann im Pazifischen Nordwesten der USA. Nach zahlreichen Bestsellern waren es ihre Romane »Die Nachtigall« und »Die vier Winde«, die Millionen von Leser:innen in über vierzig Ländern begeisterten und Welterfolge wurden.Im Aufbau Taschenbuch liegen ebenfalls ihre Romane »Die andere Schwester«, »Das Mädchen mit dem Schmetterling«, »Die Dinge, die wir aus Liebe tun«, »Die Mädchen aus der Firefly Lane«, »Liebe und Verderben« und »Winterschwestern« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kristin Hannah
Der Junge von Angel Falls
Wenn Engel schweigen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil II
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Teil III
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil IV
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Dank
Anmerkungen der Übersetzerin
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Teil I
Was hätte sein können und was gewesen ist
Weisen auf ein stets gegenwärtiges Ende.
In der Erinnerung widerhallen Schritte
Den Gang entlang, den wir niemals beschritten,
Gegen die Tür zum Rosengarten hin,
Die wir nie geöffnet.
T. S. Eliot, Burnt Norton
Kapitel 1
Im Nordwesten des Bundesstaats Washington ragt das gewaltige Kaskadengebirge in die Höhe, das sich über tausend Kilometer von British Columbia bis hinunter nach Kalifornien zieht. Zu seinen Füßen erstrecken sich Wälder, in denen die Bäume mitunter so dicht stehen, dass das Sonnenlicht kaum durch ihr Laubdach dringt, und Ortsunkundige Gefahr laufen, sich zu verirren.
In einem Tal der Nordkaskaden findet man Last Bend, eine Ortschaft, die wie aus der Zeit gefallen scheint. Besucher, die zum ersten Mal dorthin kommen, fühlen sich in Gegenden versetzt, von denen sie dachten, sie existierten nur noch in ihrer Phantasie oder in den Erzählungen ihrer Großeltern. Vielleicht kommen ihnen auch Szenen in den Sinn, die sie vor langer Zeit im Kino oder auf Fotos in alten Zeitschriften gesehen haben. Sie schmecken wieder selbst gemachte Limonade, hören das Knarren eines Schaukelstuhls auf einer Veranda, haben plötzlich längst vergessene Lieder im Kopf.
Last Bend wurde von einem Schotten namens Ian Campbell gegründet. Ein Mann wie ein Bär. Noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte er Schottland auf der Suche nach einer anderen und besseren Welt verlassen.
Seine Suche führte ihn nach Amerika, zunächst von der Ostküste bis zum Mittleren Westen des Landes. Als er weiterreiste, kam er an die schneebedeckten Berge der Rocky Mountains und nahm sich vor, sich eines Tages in der Nähe solcher Giganten niederzulassen. Er durchquerte Colorado, Wyoming, Idaho und Montana.
Schließlich erreichte er Washington und entdeckte an der Grenze zu Kanada die großartige Landschaft der Nordkaskaden. Es war eine Gegend, von der die amerikanischen Ureinwohner geglaubt hatten, dass in den tiefen Wäldern Tiermenschen hausten, riesige Wesen, von Kopf bis Fuß behaart.
Campbell beschloss, dort zu bleiben.
Unter dem Homestead Act, dem Bundesgesetz zum Landerwerb, steckte er seinen Claim ab, ein vierzig Hektar großes Stück Land, das sich als Weideland eignete. Dahinter begann der Wald und etwas weiter entfernt erhob sich der Mount Baker mit seinen schroffen Felsen und dem eisbedeckten Gipfel.
Sein erstes Haus baute Campbell auf einer Ecke des großen Grundstücks. Es war nur eine Blockhütte. Sie wurde auf einer Seite von einem Feldweg begrenzt, aus dem sehr viel später einmal der malerische Mount Baker Highway werden sollte.
Sein Haus nannte Campbell »Last Bend«, weil er das Land, auf dem es stand, an der letzten Biegung seiner abenteuerlichen Wanderung durch die Berge entdeckt hatte.
Es dauerte nicht lang, bis andere ihm folgten. Warum, wusste Campbell nicht zu sagen, vielleicht war es einfach an der Zeit, dass die Leute sich wieder nach einem Leben in der Natur sehnten. Nach einer Weile fand er auch eine Frau, die bereit war, mit ihm in einer Blockhütte ohne Strom und fließendem Wasser zu leben – eine temperamentvolle Irin namens Fiona. Zusammen bewirtschafteten sie das Land.
Mit Fiona verwirklichte Campbell auch seinen Traum, an dem noch unberührten Ufer des Angel Lake einen Ort namens Last Bend zu gründen. Zu dem Zweck legte er zunächst einen Weg an. Den nannte er Main Street, pflanzte an beiden Seiten Zuckerahornschösslinge und malte sich die groß gewachsenen Bäume und dahinterliegenden Häuser und Geschäfte aus. Die entstanden dann auch nach und nach.
Anfang der sechziger Jahre rissen Ian und Fiona die Blockhütte ab und bauten ihr Traumhaus, ein großes, halbrundes Holzhaus, das sie auf der Anhöhe des Grundstücks am Waldrand errichteten. Hohe Douglasfichten und Zedern schützten ihre Obstbäume vor den kalten Winden, die von den Bergen herunterwehten, und an klaren Tagen schien der Mount Baker zum Greifen nah.
Aus den Bergen kam auch der Angel Creek, der an dem Grundstück vorbeifloss. Im Sommer war er ein ruhig plätscherndes Gewässer, im Winter ein reißender Bach, der einige Meilen vom Haus entfernt zu einem wild schäumenden Wasserfall namens Angel Falls wurde.
*
Inzwischen lebte Campbells Sohn Liam in dem Blockhaus, zusammen mit seiner Frau Mikaela und den beiden Kindern, Jacey und Bret. Die sechzehnjährige Jacey kam ganz nach ihrer Mutter, inklusive dem rabenschwarzen Haar, während der neunjährige Bret den kupferfarbenen Schopf seines Großvaters geerbt hatte.
Direkt unter dem Dach lag Brets Schlafzimmer, das in vielerlei Hinsicht dem eines jeden kleinen Jungen ähnelte. Der Rahmen seines Betts war geformt wie eine Corvette, an den schrägen Holzwänden hingen Batman-Poster. Auf dem Fußboden verteilt lagen zahlreiche bunte Comichefte, in einem Regal stapelten sich ein paar Gänsehaut-Bücher daneben jede Menge Star-Wars-Figuren sowie Dinosaurier und Schlangen aus Plastik.
Früh an einem kalten Samstagmorgen, an Halloween, verfolgte Bret vom Bett aus die blinkenden Zahlen seines Digitalweckers.
5:30–5:31–5:32 …
Am Vorabend hatte er den Wecker stellen wollen, aber er hatte vergessen, wie man das machte. Hätte er seine Eltern oder seine Schwester um Hilfe gebeten, hätten sie wissen wollen, warum er an einem Samstag so früh aufstehen wollte, und dann wäre die Überraschung verdorben gewesen. Zum Glück war er vor lauter Aufregung von allein wach geworden.
5:45.
Bret knipste die Nachttischlampe an und kletterte aus dem Bett. Leise holte er die Tragetasche aus dem Schrank und breitete den Inhalt auf seinem Bett aus.
Sein Halloween-Kostüm.
Seit Wochen schaute er es sich immer wieder an, es war einfach das großartigste Kostüm, das man sich denken konnte. Andächtig strich er über die einzelnen Teile. Die Cowboystiefel hatte seine Mutter mit ihm in einem Secondhand-Laden ausgesucht und solange geputzt, bis sie wieder glänzten. In dem Geschäft hatten sie auch die Weste und das karierte Hemd gefunden. Die Jeans dagegen war neu, und die Chaps aus Filz hatte seine Mutter selbst genäht. Aber mit Abstand das Beste an dem Kostüm waren der silberne Sheriffstern, der Cowboyhut, die Pistole und der Pistolengürtel aus dem Spielzeugladen, die sein Vater ihm gekauft hatte. Anschließend hatte Dad ein Seil passend zugeschnitten und daraus ein Lasso geknüpft, das man am Gürtel befestigen konnte.
Bret zog Jeans, Flanellhemd und Weste an und schlüpfte in die Stiefel, den Rest brauchte er noch nicht. Nur den Sheriffstern steckte er schon an. Und er nahm den Zettel mit, auf dem er notiert hatte, wie er seinen Plan Schritt für Schritt in die Tat umsetzen wollte. Dann öffnete er leise seine Zimmertür.
Im Flur war es dunkel. Die Türen zum Schlafzimmer seiner Eltern und zu dem seiner Schwester waren geschlossen, und es drang kein Licht unter ihnen hervor. Jacey würde wahrscheinlich bis Mittag schlafen, das tat sie immer, wenn sie freitagabends bei einem Footballspiel ihrer Schulmannschaft gewesen war. Sein Vater war nachts noch zu einem Patienten gerufen worden, und Bret hatte ihn nicht zurückkommen hören. Er würde auch noch schlafen. Nur seine Mutter würde gleich aufstehen.
Er musste sich beeilen.
In der Küche konsultierte er seinen Zettel zum ersten Mal und las nach, wie seine Mutter ihren Kaffee am liebsten mochte. Er füllte die Kaffeemaschine mit der richtigen Menge Kaffeepulver und Wasser und schaltete sie an.
Vorsichtig öffnete er die Haustür, machte einen Schritt hinaus auf die Veranda und schrak zurück. Stand da draußen jemand? Dann fiel es ihm wieder ein. Es war die Strohpuppe mit dem ausgehöhlten Kürbiskopf, die er gestern Abend mit seiner Mutter gebastelt und dort aufgestellt hatte. Mist. Beinah hätte er sich wie ein Baby benommen statt wie ein echter Cowboy.
Bret lief die Einfahrt hinunter bis zum Gäste-Cottage, das momentan leer stand. Er bog ab, kletterte über einen Zaun und rannte über die Wiese.
Vor ihm tauchte die Scheune auf, die sein Großvater gebaut hatte, und die groß genug war, um auch den Pferdestall zu beherbergen. Bret hatte seinen Großvater nicht mehr kennengelernt, aber er wusste, dass Ian Campbell ein berühmter Mann gewesen war. Er hatte den Ort Last Bent getauft, und eine Straße, das Krankenhaus und die Highschool waren nach ihm benannt worden.
Seit Bret denken konnte, hatte man ihm von dem abenteuerlichen Leben seines Großvaters erzählt, von seiner Willensstärke und Schaffenskraft. Er träumte davon, einmal genau so zu werden wie er. Manchmal übte er schon dafür und dachte sich erste eigene Abenteuer aus, zum Beispiel, am Nachtritt zu den Angel Falls teilzunehmen.
Bret schob den schweren Eisenriegel des Scheunentors hoch, öffnete das Tor einen Spaltbreit und schlüpfte hindurch. Er mochte den Geruch der Scheune. Seine Mutter roch manchmal auch so. Wenn er später einmal in die Welt zog, um, genau wie sein Großvater, fremde Länder zu bereisen und unbekanntes Terrain zu erkunden, dann müsste er nur Heu, Leder oder Pferde riechen, und er würde das Gefühl haben, seine Mom wäre bei ihm.
Die Pferde in den Boxen wieherten leise und stampften mit den Hufen. Vielleicht dachten sie, Bret wäre gekommen, um sie zu füttern. Er schaltete die Deckenbeleuchtung ein und betrat die Sattelkammer. Auf dem Holzbock lag der Springsattel. Bret hob ihn hoch. Er war schwerer als erwartet. Stolpernd schleppte er ihn zu der Box, in der Silver Bullet, das Pferd seiner Mutter, untergebracht war.
Bret fragte sich, wie er den Sattel auf den Pferderücken bekommen sollte, der höher war als er selbst. Aber er konnte jetzt nicht aufgeben – sein Großvater hätte es auch nicht getan.
Er holte einen Eimer, drehte ihn um und stieg vorsichtig darauf. Trotzdem dauerte es noch eine Weile, bis er den Sattel erfolgreich auf den Pferderücken gewuchtet und den Gurt geschlossen hatte. Vielleicht lag er nicht fest genug an, aber ihm fehlte die Kraft, ihn noch enger zu zurren.
Bret schaute auf seinen Spickzettel und kehrte in die Sattelkammer zurück. Er hatte das Zaumzeug vergessen. Um es anzulegen, brauchte er wieder den Zettel. Die Gebissstange in das Maul eines Vollblutpferdes wie Silver Bullet zu schieben, traute er sich allerdings nicht.
Bret öffnete die Box und führte das Pferd an den Zügeln hinaus. Auf dem Gang blieb es stehen, senkte den Kopf und schnaubte.
»Brav, Silver Bullet, brav«, sagte Bret, so wie es seine Mutter immer tat. Jetzt nur keine Angst. Seine Mutter hatte ihm erklärt, man könne auch ein störrisches Pferd durch gutes Zureden für sich gewinnen, man müsse nur ruhig sprechen und geduldig sein.
Bret hörte Stiefelschritte, die sich von draußen näherten. Das Scheunentor erzitterte und wurde aufgeschoben.
Seine Mutter erschien auf der Schwelle. Hinter ihrem Rücken deutete sich am Horizont das erste Tageslicht an. Wie gebannt betrachtete Bret die dunkle Figur, die von einem hellen Schimmer umgeben war. Sie trat ein und blieb überrascht stehen. »Bret«, sagte sie. »Was machst du denn hier?«
Bret wollte Silver Bullet zu ihr führen, doch das Pferd machte sich von allein auf den Weg.
Mom stemmte die Fäuste in die Seiten und betrachtete Bret mit gerunzelter Stirn. Sie sah wunderschön aus, doch Bret wünschte, sie würde ihn anlächeln.
»Ich habe Silver Bullet gesattelt und aufgezäumt. Bloß die Gebissstange habe ich nicht reingekriegt.«
»Und in der Küche hast du die Kaffeemaschine angeworfen.« Mom legte den Kopf schief und musterte Bret. »Und das schon in aller Herrgottsfrühe. Gibt es dazu einen Grund?«
Bret zuckte mit den Schultern. »Ich wollte dir eine Freude machen.«
Seine Mutter beugte sich zu ihm hinab und schaute ihm in die Augen. Bret wollte den Kopf wegdrehen, doch Mom hielt sein Kinn fest und fragte: »Ist das der einzige Grund?« Sie richtete sich wieder auf. »Mir scheint, es steckt noch mehr dahinter.«
Das war das Problem mit Mom. Man konnte ihr nichts vormachen. Sein Dad sagte immer, sie könne in Menschen lesen wie in einem Buch.
»Ich möchte mit Scotty beim Nachtritt zu den Angel Falls mitmachen«, gestand Bret. Scotty war das einzige Pferd, das er reiten durfte.
Seine Mutter zog die Brauen hoch. »Jetzt schon? Mit neun?«
Bret nickte. »Vor einem Jahr hast du gesagt, dass ich mitreiten darf, wenn ich älter bin. Jetzt bin ich älter. Ich kann Scottys Box allein sauber machen, ihn bürsten, die Hufeisen reinigen und – «
Seine Mutter lachte. »Und nun kannst du auch noch Kaffee kochen und Silver Bullet satteln.«
Bret schlang die Arme um sie und schaute flehend zu ihr auf.
Mom seufzte. »Ich finde, du willst viel zu schnell erwachsen werden.«
Sie drückte ihn an sich und wuschelte ihm durch die Haare. Das mochte er, denn das tat sie nur, wenn sie gut gelaunt war.
Es war auch schön, wenn sie ihn wie jetzt auf die Stirn küsste. Wenn sie ihn zur Schule brachte, ließ er das nicht mehr zu. Er wollte nicht, dass die anderen Kinder ihn auslachten und »Muttersöhnchen« nannten.
»Tja«, sagte Mum, »ich schätze, jemand, der so viel kann wie du, der ist tatsächlich groß genug, um am Nachtritt teilzunehmen.«
Bret spürte, wie sein Herz einen freudigen Satz machte. »Darf ich wirklich?«
»Ich bin ja auch dabei«, sagte Mom.
»Darf ich?«, fragte Bret noch einmal.
»Du darfst.« Mom tätschelte seine Wange. »Und jetzt ist erst mal Schluss mit dem Thema, ich muss Silver Bullet bewegen. In einer Stunde kommt der Tierarzt und entwurmt die Pferde.«
»Kriegen sie wieder Spritzen?«
»Diesmal nicht.« Seine Mutter zog ein Paar Reithandschuhe aus ihrer Hosentasche und streifte sie über.
»Darf ich dir zusehen?«
Mom hob einen Zeigefinger. »Sag mir, an welche Regeln man sich beim Zusehen halten muss.«
Bret stöhnte. »Die habe ich doch schon hundertmal wiederholt.«
»Und ich möchte sie zum hundert und ersten Mal hören. Sicherheit geht vor.«
Bret verdrehte die Augen. »Man hält den Mund und bleibt am Zaun.«
»Genau.« Seine Mutter zog den Gurt um Silver Bullet fester. »Hol bitte mal meinen Helm.«
Bret lief in die Sattelkammer und nahm den Helm aus der großen Kiste, in der Moms Reitutensilien aufbewahrt wurden – Bürsten, Führseile, Hufnägel, Insektensprays, Sattelseife und Lederfett.
Als er zurückkam, hatte seine Mutter Silver Bullet schon auf die Reitbahn geführt und sich in den Sattel geschwungen. Ihre Hände lagen locker auf dem Widerrist des Pferds.
Bret trat an den Zaun. Seine Mutter ritt zu ihm, beugte sich herab und nahm den Helm entgegen.
Bret hockte sich auf die oberste Querstange des Zauns.
Um Silver Bullett aufzuwärmen, ritt seine Mutter zuerst im Kreis.
Dann kamen die Gangarten an die Reihe – Schritt, Trab, Mitteltrab, starker Trab, Schaukelgalopp, Galopp. Es sah aus, als würden seine Mutter und Silver Bullet eine Einheit bilden.
Bret wusste, wann sie zum Sprung ansetzte. Er hatte ihr oft genug zugeschaut, um die Anzeichen genau zu kennen. Im Galopp ritt sie das erste Hindernis an, eine Mauer aus Ziegelsteinen. Also würde es ein Steilsprung werden.
Brets Blick fiel auf einen dunklen Gegenstand und sein Magen verkrampfte sich. »Mom, nicht«, rief er, »hinter der Mauer liegt ein Ast.«
Doch seine Mutter hörte ihn nicht. Silver Bullet hatte gescheut, und sie war damit beschäftigt, ihn wieder in einen kontrollierten Galopp zu bringen.
»Brav, Silver Bullet, ganz ruhig.«
Das Pferd gehorchte, und Brets Mutter steuerte erneut das Hindernis an.
»Nein, Mom, nicht springen«, rief Bret, als sie an ihm vorbei galoppierte. Er wollte zu ihr laufen und mit den Armen wedeln, doch er durfte nicht auf die Koppel, während dort jemand ritt. Sie hatte es ihm hundertmal eingeschärft.
Er rief wieder, obwohl auch das ja eigentlich nicht erlaubt war. Sie reagierte nicht.
In Brets Kopf schoben sich die Warnungen, die er seiner Mutter zurufen wollte, zu einem einzigen Wort zusammen, MomNeinMomPassAuf, das seinen Kopf ausfüllte. Er wollte schreien, brüllen, wenn nötig, doch sein Mund gehorchte ihm nicht.
Silver Bullet setzte zum Sprung an, bäumte sich auf – und sprang.
Bret sah angespannt zu.
Seine Mutter lachte vor Freude.
Das Pferd kam hinter der Mauer auf – stolperte über den Ast und blieb wie angewurzelt stehen.
Bret sah, dass der Mund seiner Mutter noch zu einem Lachen verzogen war. Im nächsten Moment flog sie im hohen Bogen durch die Luft. Über das Geräusch seines eigenen Aufschreis hinweg hörte er, wie ihr Kopf gegen einen Zaunpfosten knallte, so heftig, dass der ganze Zaun wackelte. Dann blickte er auf seine Mutter, die reglos auf der Erde lag.
Einen Moment lang war in der kühlen Morgenluft nur Brets keuchender Atem zu hören. Silver Bullet stand ruhig neben seiner Reiterin, als wäre nichts geschehen.
Bret sprang vom Zaun und stürzte zu seiner Mutter. Blut sickerte unter ihrem Helm hervor.
Er fasste ihre Schulter und schüttelte sie leicht. »Mom, bitte steh auf.«
Er kniete sich hin und beugte sich über sie. Ihr linkes Auge stand offen, schien ihn jedoch nicht zu sehen.
Bret schrie, so laut er konnte, um Hilfe.
Einen Moment später kam Jacey über die Wiese gerannt. Sie hatte die dicke Daunenjacke ihres Vaters über ihren Schlafanzug gezogen. »Bret«, rief sie, »warum schreist du so?«
Als sie den Zaun erreichte, sah sie ihre Mutter reglos auf dem Erdboden liegen. »Fass sie nicht an, Bret«, sagte sie. »Ich hole Dad.«
Bret setzte sich zu seiner Mutter, den Blick auf ihr Gesicht geheftet. Er wagte es nicht, auch nur einen Moment wegzuschauen. Er betete unablässig, sie möge aufwachen. Er tat es stumm, denn er brachte keinen Laut über die Lippen.
Endlich kam sein Vater angerannt, mit Jacey im Schlepptau. Dad hatte seinen schwarzen Arztkoffer dabei. Auch er trug noch seinen Schlafanzug.
Bret wollte etwas sagen, erklären, was passiert war, doch sein Vater hatte nur Augen für Mom.
Bret trat ein paar Schritte zurück. Er bekam keine Luft mehr, ihm war nach Weinen zumute, doch die Tränen kamen nicht. Er konnte nur zusehen, wie sich die Blutlache um den Kopf seiner Mutter immer weiter ausbreitete.
Sein Vater stellte den Arztkoffer ab und kniete sich neben Mom. »Ich bin da, Mikaela«, sagte er und nahm ihr vorsichtig den Helm ab. Dann öffnete er ihren Mund und schob seine Finger zwischen ihre Zähne. Mom hustete und spuckte Blut.
Jacey trat zu Bret und legte einen Arm um ihn.
Bret sah das Blut auf der Hand seines Vaters, sogar der Ärmel seiner Schlafanzugjacke hatte rote Flecke abbekommen.
»Halte durch, Mika«, sagte Dad. »Wir sind bei dir. Bitte, bleib bei uns.«
Bret wurde übel. ›Bleib bei uns‹, das sagte man doch in Filmen immer, wenn jemand nicht sterben sollte. Hatte sein Vater Angst, Mom könnte sterben?
Dad richtete seinen Blick auf Jacey. »Geh ins Haus und ruf einen Krankenwagen.«
Jacey rannte los.
Wie durch Watte hörte Bret, dass sein Vater immerfort mit Mom sprach. Sie reagierte nicht.
Er sah, wie der Krankenwagen um die Ecke bog und schlitternd auf dem Schotter neben dem Pferdeanhänger zum Stehen kam. Die Türen flogen auf und zwei Sanitäter sprangen heraus. Plötzlich hatten sie eine Trage in den Händen, auf die sie seine Mutter legten. Sie darf nicht sterben, wollte Bret ihnen zurufen, aber als er den Mund öffnete, kam nur eine weiße Atemwolke heraus, die immer größer wurde und dann verpuffte.
Er schlang die Arme um sich und schloss die Augen. Er wollte nichts mehr sehen von einer Welt, in der sich auf einen Schlag alles ändern konnte.
*
Sie wird sterben, das spürt sie ganz deutlich.
Bilder ziehen an ihr vorüber. Bei einem riecht sie den lieblichen Duft von Rosen nach einem warmen Sommerregen, bei einem anderen das Meer. Sie schmeckt wieder ihren ersten Kuss – den ersten, der zählte. Andere Bilder – zu viele – werden von einem Gefühl des Bedauerns begleitet.
Jemand hebt sie hoch. Nein, es sind zwei Personen. Sie wird getragen, dann festgeschnallt. Ihre Lider sind so bleiern, dass sie die Augen nicht öffnen kann. Ein Motor springt an, sie spürt die Bewegung eines anfahrenden Autos. Ihr Gesicht tut weh.
Sie hört eine Stimme – Liam – und erinnert sich an geflüsterte Liebesworte, die seit Jahren ein fester Bestandteil ihres Lebens sind. Ihre Kinder müssen ebenfalls da sein, auch wenn sie keinen Ton von sich geben. Wahrscheinlich sind sie starr vor Schreck, mit weit aufgerissenen Augen. Sie will ihnen etwas Tröstliches sagen, oder auch nur einen beruhigenden Laut von sich geben, irgendein Zeichen, das ihre Angst lindert. Doch sie kann es nicht.
Tränen rinnen aus ihren Augenwinkeln, sammeln sich hinter ihren Ohren und befeuchten das harte Kissen unter ihrem Kopf, das unangenehm nach Desinfektionsmittel riecht. Sie will nicht weinen, die Kinder sollen von ihr keine Tränen sehen, doch ihr fehlt die Kraft, sich zusammenzureißen.
Doch dann weiß sie nicht mehr, ob es Tränen sind, die aus ihren Augen sickern, oder es bereits das Leben ist, das sie verlässt.
Kapitel 2
Nach der Highschool hatte Liam Campbell nur einen Wunsch, nämlich Last Bend so schnell wie möglich zu verlassen. Die kleine Stadt war ihm zu eng geworden, erstickte ihn, als hätte sein Vater ihn mit der Hand umschlossen und zugedrückt. Seinem Vater wollte er am allermeisten entkommen. Zeit seines Lebens hatte man Liam mit ihm verglichen, meistens mit dem Ergebnis, dass er nicht an ihn heranreichte. Auch zu Hause spielte er nur die zweite Geige. Seine Eltern liebten einander mit einer Hingabe, die für ein Kind kaum etwas übrig ließ. Also zog Liam sich in sich selbst zurück, las viel und hörte Musik. Er entdeckte seine Liebe zur klassischen Musik, bat seine Eltern um ein Klavier, war fleißig im Klavierunterricht und träumte davon, ein berühmter Pianist zu werden.
Er war begabt – im kleinen Last Bend hielt man ihn für ein Genie – und bewarb sich nach der Schule an mehreren Musikhochschulen. Er arbeitete sich hoch, von einem unbedeutenden College in Washington zum Seattle Piano Institute. In einem letzten großen Sprung schaffte er es an das berühmte Julliard Konservatorium in New York. Doch schon in den ersten Monaten dort wurde ihm klar, dass er zwar sehr gut, aber nicht gut genug war. Sein Talent hätte ausgereicht, um an einer teuren Privatschule Klavierunterricht zu geben oder als Performer halbwegs erfolgreich zu sein, aber er besaß nicht die intensive Leidenschaft der besten Konzertpianisten, und wenn er eines nicht ertragen konnte, dann das Gefühl, mittelmäßig zu sein. Davon hatte er in seiner Kindheit mehr als genug gehabt.
Es dauerte eine Weile, bis er die Enttäuschung verwunden hatte, doch dann begrub er seinen Traum und entschied sich, Medizin zu studieren. Wenn er die Menschen nicht mit seinem Klavierspiel beglücken konnte, wollte er lernen, wie man ihre Krankheiten heilte.
Für dieses zweite Studium war sein Vater nicht mehr bereit zu zahlen. Liam bewarb sich an einer kleinen Medizinischen Hochschule in Massachusetts und erhielt ein Stipendium.
Nach seinem Abschluss entschied er sich, nach New York zurückzukehren und eine Stelle an einem Medizinischen Zentrum in der Bronx anzunehmen, das eine Abteilung für HIV-Infektionen eingerichtet hatte. Das war zu Beginn der achtziger Jahre. Die Epidemie befand sich damals erst im Anfangsstadium; die Übertragungswege waren noch nicht bekannt und die Angst, sich anzustecken, war groß. Liam betrachtete diese Bedingungen als Herausforderung und wollte sehen, ob er das Zeug hatte, sie zu meistern.
Er hielt lange durch. In Krankenzimmern, in denen Verzweiflung, Apathie und Tod herrschten, tat er sein Bestes, um den Kranken die letzten Monate ihres Lebens leichter zu machen. Doch heilen konnte er sie nicht.
Er verordnete Medikamente, die höchstens kurzzeitig wirkten – andere gab es damals noch nicht –, und hielt Hände, die immer schwächer wurden. Er sah infizierte Neugeborene und wusste, wie gering ihre Überlebenschancen waren. Er stellte Totenscheine aus.
Als seine Mutter an einem Herzinfarkt starb, kehrte Liam nach Last Bend zurück, um sich um seinen alt und dement gewordenen Vater zu kümmern. Nach dessen Tod, so war sein Plan, würde er wieder fortgehen und sich einen Ort weit weg von Last Bend suchen, an dem er leben und arbeiten wollte.
Doch dann lernte er Mikaela kennen.
Mika.
Da wusste er, dass er angekommen war.
Und nun wartete er vor der Intensivstation und fragte sich, ob sie überleben würde.
Seine Kinder saßen im Wartebereich des Krankenhauses. Jacey hatte den Auftrag, auf Bret zu achten und ihn, wenn nötig, zu beruhigen.
Stephen Penn, Chefarzt der Neurologie und Liams Freund, kam durch die Tür.
Liam sprang so hastig auf, dass sein Stuhl umfiel.
Genau wie Liam war Stephen vor kurzem fünfzig geworden, doch in diesem Augenblick wirkten beide Männer älter.
Liam taxierte die Miene seines Freundes. »Wie sieht es aus?«
»Komm mit«, antwortete Stephen. Seiner Miene war nichts zu entnehmen.
Sie durchquerten den Flur, vorbei an der Schwesternstation. Liam nickte den Schwestern hinter der Glasscheibe zu. Sie wichen seinem Blick aus. Liams Magen zog sich zusammen. Er fühlte sich mit einem Mal wie einer der unzähligen Angehörigen, denen er selbst schon Hiobsbotschaften überbracht hatte.
Stephen hielt ihm die Tür zu einem Krankenzimmer auf. Wie eine ramponierte Puppe lag Mikaela im Bett, das Gesicht verfärbt und geschwollen. Sie war an Geräte angeschlossen, die ihre Vitalfunktionen überwachten, von der Frequenz ihres Herzschlags bis zum Innendruck ihres Schädels. Ein Respirator atmete für sie, und über einen Tropf wurde ihr eine Nährlösung zugeführt. In dem stillen Raum glaubte Liam, den Herzschlag seiner Frau zu hören.
»Ihr Gehirn arbeitet«, sagte Stephen. »Wir wissen nur noch nicht, wie gut. Auf Schmerzreize reagiert sie leider nicht.« Er schlug die Decke zurück und stach mit einer Stecknadel in Mikaelas rechten Fuß, um es Liam zu demonstrieren. Mikaela regte sich nicht. Stephen deckte sie wieder zu. »Wir können nur abwarten. In der Zwischenzeit tun wir alles, was in unserer Macht steht, und überwachen sie rund um die Uhr.«
Zum ersten Mal seit dem Abschluss seines Medizinstudiums wünschte Liam, er wäre nicht Arzt, würde die Bedeutung dessen, was Stephen sagte, nicht verstehen und könnte sich einreden, alles werde gut. So konnte er sich nur damit trösten, dass Mika in den besten Händen war, denn Stephen war ein angesehener Neurologe, der sich, ebenso wie einst Liams Vater, ganz bewusst für das Leben an einem Ort fernab der großen Städte entschieden hatte.
»Die Ungewissheit macht mich verrückt«, sagte Liam und fasste Stephen am Arm. »Ohne Mikaela kann ich nicht – können auch die Kinder nicht leben.«
Stephens Blick war mitfühlend. »Morgen wissen wir mehr. Wir werden jetzt noch einige Tests machen, und ich schaue mir die Halswirbelsäule an. Danach müssen wir abwarten, wie sie die Nacht übersteht.«
Als zwei Krankenpfleger das Zimmer betraten, schob Stephen Liam sanft zur Seite.
Liam sah zu, wie seine Frau zur nächsten Untersuchung aus dem Zimmer gerollt wurde.
Auf dem Weg zu seinen Kindern überlegte Liam, was er ihnen sagen sollte. Wie er es ihnen sagen sollte. Und ob er die Kraft hatte, so stark zu bleiben, dass sie nicht merkten, wie beunruhigt er war.
Um sich abzulenken, konzentrierte er sich auf die praktischen Dinge, die er zu erledigen hatte. Er überlegte, welche Formulare er für die Krankenversicherung ausfüllen musste, ob er für Mikaela einen kleinen Koffer packen sollte und was dort hineinmüsste. Dann ging er im Geist die Termine durch, die er in den nächsten Tagen absagen musste, falls er seine Praxis nicht für ein paar Tage ganz schließen würde. Ach, und natürlich musste er Mikaelas Mutter anrufen, die am anderen Ende von Washington State lebte.
Liam trat auf eine kleine Terrasse, wo er Empfang hatte, und versuchte, seine Schwiegermutter übers Handy zu erreichen. Als sie sich nicht meldete, hinterließ er auf ihrer Voicemail die Bitte, sie möge ihn zurückrufen.
Im Wartebereich saßen nur seine Kinder. Jacey blätterte lustlos in einer zerfledderten Zeitschrift. Bret hockte auf dem Fußboden, umgeben von Spielsachen für viel kleinere Kinder, die er aus einer bunten Kiste herausgekippt hatte.
Einen Moment lang wusste Liam nicht, wohin mit seinen Händen. Er zwang sich, die Arme locker baumeln zu lassen. Leise sagte er die Namen seiner Kinder.
Jacey ließ die Zeitschrift fallen und sprang auf. Liam sah ihre bebenden Lippen, die vom Weinen geschwollenen Augen und den Pulli mit den roten Punkten, den sie in der Hast am Morgen verkehrt herum angezogen hatte. Der Anblick schnürte ihm die Brust ab. Er versuchte, seine Tochter beruhigend anzulächeln, bezweifelte jedoch, dass es ihm gelang.
Bret stand nicht auf. Er nahm zwei Bauklötze und schleuderte sie in eine Ecke. Dann wischte er sich über die Augen und sagte wütend: »Ich weiß schon, dass Mom tot ist.«
Liam zog ihn hoch und strich ihm die verschwitzten roten Locken aus der Stirn. »Sie ist nicht tot, Bret, wie kommst du darauf?« Er nahm das Gesicht des Jungen zwischen seine Hände und zwang ihn, ihm in die Augen zu sehen – zwang sich selbst, dem schmerzerfüllten Blick seines Sohns standzuhalten. »Deine Mutter ist nicht tot, okay?« Brets Augen füllten sich mit Tränen, doch er deutete ein Nicken an.
Als wäre er noch ein Kleinkind, hob Liam Bret hoch und setzte ihn auf einen Stuhl. Dann zog er sich selbst einen Stuhl heran und ließ sich den Kindern gegenüber nieder. Er wünschte, er hätte eine Zauberformel, mit der er ihre Angst verjagen konnte, doch er besaß nichts außer seinen armseligen Worten.
»Ihr wisst, dass Mom vom Pferd gestürzt ist.«
Die beiden nickten.
»Sie hat sich am Kopf verletzt und liegt im Koma.«
Bret runzelte die Stirn.
»Koma bedeutet, dass Mom schläft«, sprach Liam weiter. »Dr. Penn, den ihr beide gut kennt, kümmert sich um sie. Und wir werden beten, dass es ihr bald wieder besser geht. Ist das so weit verständlich?«
Jacey nickte erneut, doch in ihrem Blick las er, dass die ganze Situation für sie alles andere als leicht zu verstehen war. Ihre Welt war aus den Fugen geraten, und obwohl sie es weniger deutlich zeigte als ihr kleiner Bruder, war auch Jacey zutiefst verunsichert.
Bret stand auf, kletterte auf Liams Schoß und steckte sich den Daumen in den Mund.
Liam betrachtete ihn konsterniert. Bret hatte im Alter von drei Jahren aufgehört, am Daumen zu lutschen, doch nun nuckelte er mit Hingabe und kuschelte sich in Liams Arme, als wäre er wieder viel jünger.
Während er seinen Sohn hielt, ging Liam durch den Kopf, dass seine Kinder gerade eine Wahrheit erfuhren, die er und Mikaela ihnen noch für lange Zeit hatten ersparen wollen, nämlich dass im Leben sehr beängstigende Dinge geschehen konnten, dass ein einziges Ereignis eine heile Welt zerstören und man die Menschen, die einem alles bedeuteten, verlieren konnte.
*
Stundenlang saß Liam mit seinen Kindern im Wartebereich und hoffte auf neue Informationen über den Zustand seiner Frau.
Es wurde Abend. Keiner von ihnen sagte mehr etwas, doch sie alle behielten die große Wanduhr im Auge. Mit jeder Minute, die verstrich, ohne dass jemand kam und erklärte, Mikaela sei aufgewacht, wuchs ihre Sorge.
Liam hätte gern etwas Tröstliches gesagt, doch er hatte Angst, dass es das Falsche sein würde. Worte hatten Gewicht, sie konnten Schaden anrichten.
Dann waren auf dem Flur Schritte zu hören.
Liam beugte sich vor und betete, dass es nicht Stephen war, der kam, um ihnen schlechten Neuigkeiten mitzuteilen.
Es war Mark, Jaceys Freund. Mit großen Schritten kam er in den Wartebereich gelaufen und brachte einen Schwall frischer Herbstluft mit. Liam mochte den Jungen, doch hier, im stillen Wartebereich und umgeben von grauen Wänden, empfand er ihn als zu energiegeladen, zu bunt in seinem gemusterten Pulli und der roten Jogginghose. »Jacey!«, sagte Mark zu laut. »Ich habe es gerade erst erfahren.«
Jacey stand auf und lief in seine Arme. »Wir durften noch nicht zu ihr und wissen nicht, wie es ihr geht.«
Die beiden setzten sich auf ein altersschwaches Sofa in der Ecke, steckten die Köpfe zusammen und unterhielten sich leise. Ihr Gemurmel war das einzige Geräusch im Raum.
Bret nuckelte am Daumen.
Dann erschien Stephen und winkte Liam zu sich.
Liam trat zu seinem Freund auf den Flur hinaus.
»Ihr Zustand ist unverändert«, sagte Stephen. Er legte Liam eine Hand auf die Schulter. »Fahr mit den Kindern nach Hause, heute Nacht können wir für Mikaela nichts mehr tun. Versuch ein bisschen zu schlafen. Falls etwas ist, rufe ich dich sofort an. Sonst sehen wir uns morgen.«
Stephen hatte recht, doch die Vorstellung, ohne Mikaela nach Hause zu fahren, war Liam nahezu unerträglich.
»Komm schon«, sagte Stephen, als hätte er Liams Gedanken gelesen. Er klopfte Liam auf die Schulter und entfernte sich über den Flur.
Liam kehrte in den Wartebereich zurück. »Eure Mutter schläft noch«, sagte er mit belegter Stimme. »Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Morgen fahren wir wieder her.«
Jacey sah aus, als graute auch ihr davor, nach Hause zu gehen.
Mark warf Liam einen vorsichtigen Blick zu. »Ein paar aus unserer Klasse feiern heute eine Halloween-Party. Vielleicht darf Jacey mitkommen.«
Jacey schüttelte den Kopf. »Nein, ich möchte nicht mit.«
»Geh doch ruhig«, schlug Liam ihr vor. »Wenn etwas sein sollte, melde ich mich bei dir.«
Jacey wirkte unschlüssig.
»Geh mit Mark«, beharrte Liam. »Du hilfst deiner Mutter nicht, indem du zu Hause sitzt und auf eine Nachricht aus dem Krankenhaus wartest. Lenk dich ein bisschen ab.«
Jacey schlang die Arme um sich. »Aber nur ganz kurz.«
»Dad«, sagte Bret, als Jacey mit Mark verschwunden war. »Ich habe Hunger.«
»Ich auch«, sagte Liam. Als Bret den Daumen wieder in den Mund stecken wollte, hielt Liam seine Hand fest. »Du musst nicht am Daumen lutschen, zu Hause mache ich uns etwas zu essen.«
Bret stand auf.
Erst in diesem Augenblick nahm Liam den sonderbaren Aufzug seines Sohns wahr – das karierte Hemd, die Jeans, die Weste mit dem Sheriffstern. Der Junge hatte am Morgen sein Halloween-Kostüm angezogen, von dem er seit Wochen sprach, und heute war der Tag, auf den er sich so lange gefreut hatte.
Inzwischen würden die anderen Kinder von Last Bend seit Stunden unterwegs sein und als Astronauten, Superhelden, Hexen und Prinzessinnen verkleidet die Häuser abklappern und Süßigkeiten verlangen.
Liam erinnerte sich vage, dass seine Frau Bret sogar Chaps genäht hatte. »Willst du zu Hause die anderen Cowboysachen anziehen und mit deinen Freunden durch – «
»Nein«, fiel Bret ihm ins Wort. »Ich habe Hunger.«
»Aber deine Mutter hat die Hose extra für Halloween genäht.«
»Ich will die Sachen nicht anziehen«, rief Bret zornig, und Liam begriff, dass Halloween für ihn keine Rolle mehr spielte.
»Okay«, sagte er mit einem schweren Seufzer. »Dann mal los.«
Draußen atmete Liam begierig die frische Luft ein, die nach regenfeuchter Erde und nassem Herbstlaub roch. »Nach der Krankenhausluft tut das richtig gut«, sagte er betont munter.
Bret antwortete nicht.
Auch auf der Fahrt nach Hause sprach der Junge kein Wort, und in der Garage stieg er wortlos aus dem Wagen und lief ins Haus.
Liam folgte ihm, schaltete in den unteren Räumen das Licht an und wünschte, es wäre nicht so verdammt still.
In der Küche saß Bret schon am Tresen und sah Liam anklagend an.
Richtig, der Junge wollte essen.
In dem Moment klingelte das Telefon. Liam zuckte zusammen und nahm den Hörer des Wandapparats ab. Doch am anderen Ende war nicht das Krankenhaus, sondern seine Sprechstundenhilfe.
»Liam«, sagte sie, »Carol hier. Ich habe es eben erst erfahren. Wie um alles in der Welt konnte das passieren? Und wie geht es Mika?«
Liam erzählte ihr, was passiert war. Mittendrin stand Bret auf, lief an ihm vorbei ins Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa fallen, wo er sich in die gelbe Wolldecke seiner Mutter kuschelte. Dann stellte er den Fernseher an und drehte die Lautstärke bis zum Anschlag auf.
Liam verabschiedete sich von Carol, griff sich die Fernbedienung und stellte den Ton leiser, wobei er den vernichtenden Blick seines Sohns ignorierte.
Er ging in die Küche und überlegte, was er zum Abendessen machen sollte. Er schaute in den Kühlschrank. In einem Plastikbehälter war ein Rest Tomatensoße, daneben fand er Klarsichttüten mit Gemüse, eine Packung Käse, eine mit Schinkenspeck und vier Eier. Er öffnete die Kühltruhe und entdeckte auf den ersten Blick nur eine Menge Tupperdosen, jede mit einem Zettelchen beklebt, auf dem Datum und Inhalt angegeben waren. Nirgendwo stand, wie etwas davon zubereitet wurde.
Dann läutete das Telefon wieder. Diesmal war es Mikas Reitfreundin Marion, die wissen wollte, was geschehen war. Liam gab eine ungeduldige Kurzfassung ab. Als sie ihm versprach, für Mika zu beten, bedankte er sich knapp und legte auf.
Beim dritten Anruf ging er nicht mehr ran.
Er trat ins Wohnzimmer und erklärte Bret, dass er Pizza bestellen werde.
Bret verdrehte die Augen. »An Halloween kommt der Pizzabote nicht. Außerdem gibt es heute geschnetzeltes Huhn. Mom hat es gestern in die Soße gelegt, um es zu marinieren. Steht im Kühlschrank.«
»Aha«, sagte Liam. »Interessant.« In der Küche warf er noch einmal einen Blick in den Kühlschrank und entdeckte den Topf, in dem tatsächlich Hähnchenteile marinierten.
»Wetten, dass du nicht weißt, wie es geht«, rief Bret aus dem Wohnzimmer.
»Wie wär’s, wenn du mir hilfst?«, fragte Liam.
»Ich weiß auch nicht, wie es geht«, antwortete Bret, doch er schaltete den Fernseher aus und schwang sich am Küchentresen auf einen Hocker.
»Ich kann Blinddärme entfernen, Wunden nähen und Brüche schienen, ein geschnetzeltes Huhn ist für mich ein Klacks.«
»Zum Huhn gehört noch Gemüse. Das ist auch im Kühlschrank. Das in den Klarsichttüten ist schon gewaschen.«
Liam holte die Gemüse-Tüten aus dem Kühlschrank, legte ein Hackbrett auf den Tresen und nahm ein Messer aus der Schublade.
Er öffnete die Tüte mit den Pilzen und kippte sie auf das Brett.
»Ich mag keine Pilze«, sagte Bret.
Liam füllte sie wieder in die Tüte und deutete auf den Blumenkohl. »Ist der genehmigt?«
Bret schüttelte den Kopf.
Das Telefon klingelte.
»Verdammt.« Liam warf die Tüten mit Pilzen und Blumenkohl zurück in den Kühlschrank und schlug die Tür zu.
»Warum gehst du nicht ans Telefon?«, fragte Bret.
»Weil ich es leid bin, immer die gleiche Geschichte zu erzählen.«
»Und was ist, wenn jemand aus dem Krankenhaus anruft? Oder Jacey?«
»Okay, Bret, beim nächsten Mal gehe ich ran.« Er hielt den Broccoli hoch. »Darf der es sein?«
»Ja, aber ohne den dicken Stiel.«
Liam legte den Broccoli auf das Brett und griff nach dem Messer.
»Nicht schneiden«, sagte Bret. »Mom zupft die Röschen ab.«
»Willst du sie abzupfen?«
Bret schüttelte den Kopf.
»Na also.« Unter Brets vorwurfsvollem Blick hackte Liam den Broccoli klein.
»Du musst Öl in den Wok geben.«
Als das Telefon das nächste Mal klingelte, nahm Liam den Hörer ab. Es war Mikas Reitfreundin Shaela. Sie wusste schon Bescheid und fragte, ob sie helfen könne. Liam verneinte dankend. Als Shaela zum wiederholten Mal: »Ich kann es immer noch nicht fassen«, sagte, legte er entnervt auf.
Bret hatte eine Flasche Öl und den elektrischen Wok hervorgeholt und auf den Tresen gestellt. Liam stöpselte den Wok ein, füllte eine Tasse mit Öl und kippte sie hinein.
Bret runzelte die Stirn. »Das ist zu viel Öl.«
Die nächste Anruferin war Mabel vom Pferdeschutzverein. Bei ihr legte Liam auf, nachdem sie ein halbes Duzend Mal »Das ist einfach schrecklich!«, gesagt hatte.
»Du hast das Öl zu heiß gemacht«, sagte Bret.
»Es muss so heiß sein«, antwortete Liam und gab das marinierte Huhn in den Wok. Das Öl spritzte nach allen Seiten. Liam schabte den Broccoli dazu. Ein Spritzer heißen Öls traf ihn an der Wange, und wieder klingelte das Telefon.
Dann schrillte der Rauchmelder. Liam stöpselte den Wok aus und riss das Küchenfenster auf.
»Ihr könnt mich mal«, sagte er, als das Telefon wieder ging, nahm den Hörer ab und knallte ihn auf.
»Das Huhn ist angebrannt«, sagte Bret. »So was passiert Mom nie.«
»Nein, natürlich nicht.« Liam wischte Ölspritzer vom Tresen und versuchte, tief und ruhig zu atmen.
»Ich habe Hunger.« Bret fing an zu weinen.
Liam nahm ihn in den Arm. »Das Huhn ist nicht angebrannt. Die kleinen schwarzen Stellen kratzen wir ab, okay?«
Bret wischte sich über Augen und Nase und nickte resigniert.
Kapitel 3
Jacey kehrte schon früh von der Halloween-Party zurück und wirkte noch immer verstört. Sie sagte nicht viel, drückte Liam nur einen Gutenachtkuss auf die Wange und verschwand in ihr Zimmer.
Ein wenig später, als Liam sich vergewissert hatte, dass seine Kinder schliefen, betrat er das Arbeitszimmer seiner Frau und knipste die Schreibtischlampe an.
In der Luft lag noch ein Hauch von Mikaelas Parfum. Es roch nach Meer, Minze und etwas Lieblichem, das er nicht näher bestimmen konnte. Auf dem Schreibtisch türmten sich Zettel, Notizblöcke und Broschüren. Vor seinem inneren Auge sah er seine Frau an dem Tisch sitzen und eines ihrer zahlreichen Schreiben zugunsten vernachlässigter Pferde verfassen, neben sich einen dampfenden Becher Kaffee.
Wenn er in solchen Momenten eintrat und sie sich zu ihm umdrehte, war ihre Miene stets bedrückt. Ich möchte noch ein Pferd aufnehmen, Liam. Es gibt eine Stute, die vor Hunger so entkräftet ist, dass sie kaum noch stehen kann. Du hast doch nichts dagegen, oder?
Liam hob einen Zeitschriftenstapel vom Schreibtischstuhl und ließ sich nieder. Er schaltete den PC ein und suchte im Internet nach »Kopfverletzung« und »Koma«, in der Hoffnung, auf Erfahrungsberichte zu stoßen, in denen Menschen beschrieben, wie sie nach kürzester Zeit wieder vollständig genesen waren.
Stattdessen fand er eine Horrorstory nach der anderen. Als ihm die Lektüre zu viel wurde, verlegte er sich auf die Suche nach einschlägiger Fachliteratur, überflog die Inhaltsverzeichnisse mehrerer Bücher, notierte die Titel. Es waren hilflose Aktionen, denn zum einen konnte Stephen ihm alle gewünschten Auskünfte geben, und zum anderen wusste Liam auch als Allgemeinmediziner, dass er im Moment nicht mehr tun konnte als abzuwarten. Er schaltete den PC aus.
Danach streifte er eine Zeit lang ziellos durch die Räume im Erdgeschoss, bis er sich schließlich im Wohnzimmer einen doppelten Tequila einschenkte und in einem Zug hinunterkippte. Als die gewünschte Wirkung ausblieb, wiederholte er das Ganze. Endlich ließ der Druck in seinem Kopf ein wenig nach, die Gegenstände ringsum verschwammen an den Rändern, und er konnte einfach dasitzen und den Tränen, die sich in ihm aufgestaut hatten, freien Lauf lassen.
Leicht schwankend trat er schließlich an das große Fenster, das zur Koppel hinausging. Irgendwo da draußen waren die Pferde, die nicht im Stall untergestellt wurden. Inzwischen dürfte es ein Dutzend Tiere sein, die Mikaela gerettet hatte. Sie kamen von Privatbesitzern, von Reitställen, die Konkurs angemeldet hatten, von aufgegebenen Farmen. Die meisten waren bei ihrem Eintreffen ungepflegt, abgemagert und matt. Mikaela ließ sie von ihrem Tierarzt untersuchen, päppelte sie auf, striegelte sie, bis ihr Fell wieder glänzte und sprach ihnen bei jeder Gelegenheit gut zu. Wenn ein Pferd wiederhergestellt war, gab sie es an Menschen weiter, von denen sie wusste, dass es bei ihnen gut aufgehoben sein würde. Mikaela hatte ein großes Herz für Tiere, es gehörte zu den Eigenschaften, die Liam an seiner Frau liebte.
Er setzte sich wieder aufs Sofa und starrte vor sich hin. Wann hatte er Mikaela eigentlich zum letzten Mal gesagt, dass er sie liebte? Vor Wochen? Monaten? Es fiel ihm nicht ein.
Er war kein Mann vieler Worte, das wusste seine Frau. Aber hatte er ihr seine Liebe wenigstens oft genug auf andere Weise gezeigt? Und wenn ja, hatte Mikaela das auch wahrgenommen?
Er wünschte, er könnte sich zumindest daran erinnern, wann er ihr zum letzten Mal ein Kompliment gemacht hatte.
Liam füllte sein Glas wieder auf.
Sie könnte sterben.
Nein, diese Richtung durften seine Gedanken nicht einschlagen. Mika würde aufwachen, jeden Augenblick konnte es so weit sein. Und am Morgen würde er ihr erzählen, welche Angst er um sie gehabt hatte, und sie würden darüber lachen.
Und was wäre, wenn es doch zum Schlimmsten kam?
Wieder versuchte er, seine Gedanken umzulenken, doch sie waren wie Raubtiere, die eine Fährte aufgenommen hatten und sich nicht beirren ließen.
Liam schloss die Augen und malte sich aus, seine Frau säße an seiner Seite. Sie trug die verschlissene Jeans, die eigentlich viel zu löchrig war, um sie noch zu tragen, und ihren schwarzen Lieblingspullover, in den sie zweimal hineingepasst hätte.
Er wünschte, er könnte ihr sagen, dass ihm an ihr sogar die alte Jeans und der ausgeleierte Pullover gefielen. Er sehnte sich danach, seine Frau in den Armen zu halten und zu küssen. Mikaela war ein Teil von ihm, ohne sie fühlte er sich nur noch wie ein halber Mensch. Nein, weniger als das. »Wenn du mich heute in der Küche gesehen hättest«, sagte er. »Du hättest dich kaputtgelacht.«
»Dad?«, erklang eine Kinderstimme. »Mit wem sprichst du?«
Mikas Bild löste sich auf.
Liam öffnete die Augen und rappelte sich hoch.
Oben an der Treppe stand Bret und trug nur eine Unterhose und ein violettes T-Shirt mit dem Bild eines Dinosauriers auf der Brust. Es war die Notlösung, auf die sie sich geeinigt hatten, als sie keinen frischen Schlafanzug fanden.
»Ich spreche mit niemandem.«
»Ich kann nicht mehr schlafen.«