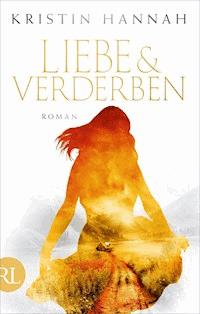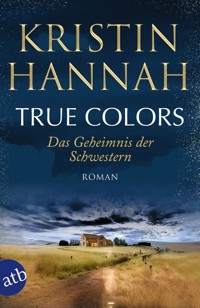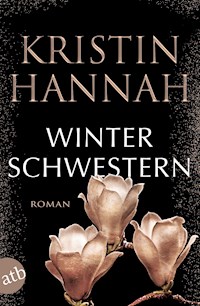
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großer Roman über die Stärke der Frauen.
Noch kurz vor seinem Tod nimmt ihr Vater den Schwestern Nina und Meredith das Versprechen ab, sich um die pflegebedürftige Mutter zu kümmern. Doch der Versuch, dieses Versprechen einzulösen, gerät zur Zerreißprobe – die Mutter war ihr Leben lang kalt und abweisend zu ihren Töchtern, was bei Meredith und Nina tiefe Spuren hinterlassen hat. Denn auch sie haben Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen, und drohen die Liebe ihrer Männer zu verlieren. Doch dann kommen sie dem Geheimnis der Mutter auf die Spur, das sie in eine weit entfernte Vergangenheit führt ...
Bestsellerautorin Kristin Hannah erzählt vom unermesslichen Leid einer Familie im Zweiten Weltkrieg und von seinen Nachwirkungen über Generationen hinweg.
Dieses E-Book erschien früher unter dem Titel "Ein Garten im Winter" und wurde nun neu übersetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Als ihr Vater stirbt, verlieren die ungleichen Schwestern Meredith und Nina Whitson ihren größten Rückhalt. Und er hinterlässt ihnen eine Bürde: Noch kurz vor seinem Tod nimmt er ihnen das Versprechen ab, sich um die pflegebedürftige Mutter zu kümmern, die ihr Leben lang keine Nähe zu ihren Töchtern zugelassen hat. Die Aufgabe gerät zur Zerreißprobe für die Familie – die Distanz zur Mutter scheint unüberwindbar. Und sie hat Spuren in der nächsten Generation hinterlassen, denn auch Meredith und Nina gelingt es nicht, sich denjenigen, die ihnen am nächsten stehen, zu öffnen. Dann aber finden sie Hinweise, was sich hinter dem Schweigen der Mutter verbergen könnte. Was sich ihnen offenbart, ist eine Geschichte unfassbaren Leids – und zugleich ein Zeugnis der Stärke der Frauen ebenso wie der Macht der Liebe.
Über Kristin Hannah
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der USA und lebt mit ihrem Mann im Pazifischen Nordwesten der USA. Nach zahlreichen Bestsellern waren es ihre Romane »Die Nachtigall« und »Die vier Winde«, die Millionen von Leser:innen in über vierzig Ländern begeisterten und Welterfolge wurden.Im Aufbau Taschenbuch liegen ebenfalls ihre Romane »Die andere Schwester«, »Das Mädchen mit dem Schmetterling«, »Die Dinge, die wir aus Liebe tun«, »Die Mädchen aus der Firefly Lane« und »Liebe und Verderben« vor.Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug unter anderem Mary Basson, Imogen Kealey und Gill Thompson ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kristin Hannah
Winterschwestern
Ein Garten im Winter
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Prolog — 1972
Kapitel 1: 2000
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog — 2010
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meinen Mann Benjamin, wie immer. Für meine Mutter. Ich hätte Dir öfter zuhören sollen, wenn Du aus Deinem Leben erzählt hast, damals, als es noch möglich war. Für meinen Vater und Debbie. Danke für die beste Reise aller Zeiten, an die ich mich noch lange erinnern werde. Für Tucker, den ich liebe und auf den ich stolz bin. Dein Abenteuer hat gerade erst begonnen.
Nein, das bin nicht ich, das leidet jemand anderes. Ich könnte das so nicht. Und das, was geschah, Sollen schwarze Tücher bedecken, Und man soll die Laternen forttragen … Nacht.
Anna Achmatowa, Requiem
Prolog
1972
Die Plantage Bjelyje Notschi, Weiße Nächte, lag nahe dem Ufer des mächtigen Columbia River. In diesen Tagen, in denen jeder Atemzug in der eisigen Luft sichtbar wurde, herrschte dort Stille. Kahle Apfelbäume erstreckten sich in endlosen Reihen, so weit das Auge reichte, die kräftigen Wurzeln tief in der gefrorenen Erde verborgen. Je kälter es wurde, desto farbloser wurden Himmel und Erde, bis man in der verblichenen Landschaft glaubte, winterblind geworden zu sein. Ein Tag glich dem anderen, alles gefror und wurde zerbrechlich.
Doch nirgends waren Stille und Kälte so spürbar wie in Merediths Elternhaus. Meredith war erst zwölf Jahre alt, dass es ihrer Familie aber an etwas mangelte, spürte sie deutlich. Sie wünschte, ihre Familie sei wie jene im Fernsehen, fröhlich und harmonisch. Niemand, noch nicht einmal ihr Vater, den sie über alles liebte, verstand, wie verloren sie sich in den Mauern ihres Zuhauses fühlte, wie unsichtbar.
Morgen Abend jedoch würde all das anders werden.
Dann würde sie ihren Plan umsetzen und auf der Weihnachtsfeier ihr Theaterstück aufführen. Sie hatte es nach einem der russischen Märchen geschrieben, die ihre Mutter immer erzählte. Wenn sie Glück hatte, wäre es danach genauso wie in einer Fernsehfamilie.
»Warum darf ich nicht die Hauptrolle spielen?«, fragte Nina. Es war mindestens das zehnte Mal, dass sie fragte.
Meredith drehte sich zu ihrer Schwester um, die auf dem Fußboden kniete und gerade dabei war, ein mintgrünes Schloss auf ein altes weißes Bettlaken zu malen.
Das Schloss sah merkwürdig aus, irgendetwas daran stimmte nicht. Meredith versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Nina, bitte, wie oft sollen wir noch darüber reden?«
»Warum kann ich nicht das arme Mädchen sein, das den Prinzen heiraten darf?«
»Du weißt, warum. Du bist erst neun Jahre alt, und Jeff, der den Prinzen spielt, ist dreizehn. Als Paar würdet ihr komisch aussehen.«
Nina stellte ihren Pinsel in eine leere Suppendose und hockte sich auf die Fersen. Sie hatte ein herzförmiges Gesicht, kurzes schwarzes Haar, grüne Augen und einen blassen Teint. Meredith fand, dass ihre Schwester einem Kobold ähnelte. »Darf ich das arme Mädchen im nächsten Jahr spielen?«
»Ja«, erwiderte Meredith. Voller Freude stellte sie sich vor, wie das Theaterstück zu einer Tradition ihrer Familie würde. All ihre Freunde und Freundinnen hatten solche Traditionen, nur sie nicht. Bei ihnen gab es keine Verwandten, die an Feiertagen zu Besuch kamen, an Thanksgiving keinen Truthahn, Ostern keinen Festbraten, weder gemeinsame Tisch- noch Abendgebete. In ihrer Familie wusste man nicht einmal genau, wie alt die Mutter war.
Ihr Vater sagte, das liege daran, dass ihre Mutter Russin sei und in Amerika keine Angehörigen habe. Ihre Mutter sagte dazu nichts, sie sprach ohnehin nur selten über sich.
Nach einem kurzen Klopfen an der Tür kamen ihr Vater und Jeff ins Zimmer.
Jeff. In seiner Gegenwart kam Meredith sich stets wie eines dieser bunten Schlauchmännchen vor, die mit jedem neuen Luftstoß per Kompressor ihre Form veränderten. Sie waren Freunde seit dem vierten Schuljahr, doch seit Kurzem war alles anders, wenn sie zusammen waren, aufregender. Und manchmal, wenn er sie ansah, raubte es ihr schlicht den Atem. »Du kommst genau richtig zur Probe.«
Jeff bedachte sie mit einem Lächeln, bei dem sich ihr Puls beschleunigte. »Erzähl bloß niemandem, dass ich mitspiele. Ich will nicht, dass man sich in der Schule über mich lustig macht.«
»Was das angeht …« Ihr Vater trat näher, noch im Overall, den er immer beim Arbeiten trug, braun mit orangefarbener Steppnaht, in den Händen die getippten Seiten des Theaterstücks. Er blickte sie ernst an, und anders als sonst war auf seinen Lippen unter dem dichten, schwarzen Schnurrbart kein Lächeln zu erkennen. »Das ist also dein Theaterstück.«
»Ja.« Meredith stand auf. »Glaubst du, es wird Mom gefallen?«
Auch Nina erhob sich. »Was meinst du, Dad?«
Die drei sahen sich über das mintgrüne Schloss und die bereitliegenden Theaterkostüme hinweg an, und dabei dachten sie wohl alle dasselbe, nämlich, dass Anja Whitson eine kalte Frau war, bei der niemand sagen konnte, ob ihr etwas gefiel. Das wenige an Wärme, das sie in sich trug, wurde ihrem Mann zuteil, für ihre Töchter blieb kaum etwas übrig. Früher hatte Merediths Vater diesen Zustand zu überspielen versucht, hatte seine Töchter wie ein Zauberer mit seiner Liebe von der Realität ablenken wollen. Doch irgendwann war sie zum Vorschein gekommen, wie bei allen Illusionen.
Und so wussten die beiden Mädchen und ihr Vater nur zu gut, wie die Antwort auf Merediths Fragen ausfallen könnte.
»Ich weiß es nicht.« Ihr Vater griff in seine Hosentasche, holte eine Packung Zigaretten hervor. »Die Geschichten deiner Mutter …«
»Es ist so schön, wenn Mom sie erzählt«, fiel Meredith ein.
»Weil das die einzigen Momente sind, in denen sie wirklich mit uns spricht«, sagte Nina.
Ihr Vater steckte sich eine Zigarette an und stieß eine Rauchwolke aus. »Vielleicht.« Er zog die Brauen zusammen. »Es ist nur …«
Meredith machte einen Schritt auf ihn zu, darauf bedacht, nicht auf das grüne Schloss zu treten. Ihr war klar, weshalb er den Satz nicht beendet hatte. Keiner von ihnen konnte jemals vorhersagen, wie ihre Mutter auf etwas reagieren würde. Doch dieses Mal war Meredith sich ihrer Sache sicher. Wenn es etwas gab, das ihre Mutter liebte, dann war es das Märchen, das ihr als Vorlage für ihr Theaterstück gedient hatte. Es handelte von einem armen Mädchen, das es wagte, sich in einen Prinzen zu verlieben. »Es ist nur eine kurze Aufführung, Dad. Und sie wird jedem gefallen.«
»Also gut.«
Eine Mischung aus Hoffnung und Stolz stieg in Meredith auf. An diesem Weihnachtsfest würde sie nicht in einer Wohnzimmerecke sitzen und lesen oder in der Küche den Abwasch machen. Die Aufmerksamkeit ihrer Mutter würde ihr gelten, sie hätte bewiesen, dass sie jedes ihrer seltenen Worte gehört hatte, selbst die, die sie leise und im Dunkeln gewispert hatte.
In der darauffolgenden Stunde führte Meredith ihre beiden Schauspieler durch das Stück, obwohl nur Jeff ihrer Anleitung bedurfte. Sie und Nina kannten das Märchen seit Jahren in- und auswendig.
Nach der Probe fertigte Meredith ein Plakat mit der Überschrift Nur heute Abend: das große Theaterstück zum Fest. Darunter listete sie die drei Mitwirkenden auf, sich selbst, Nina und Jeff. Anschließend besserte sie Ninas Bühnenbild aus. Retten konnte sie es nicht, wie immer hatte Nina über die vorgegebenen Ränder hinausgemalt.
Sie brachte das Machwerk ins Wohnzimmer und befestigte es an dem Ständer, an dem bei Diavorführungen die Leinwand hing. Dann nähte sie noch Pailletten auf den Tüllrock ihres Prinzessinnenkleids und ging erst gegen zwei Uhr morgens zu Bett, doch überdreht wie sie war, dauerte es noch lange, bis sie in den Schlaf fand.
Der nächste Tag schien sich endlos zu dehnen. Gegen sechs Uhr abends trafen die ersten Gäste ein, nicht viele und nur die, die jedes Jahr kamen: die Männer und Frauen, die auf der Apfelplantage und im Lagerhaus arbeiteten, zusammen mit ihren Familien, dazu eine Handvoll Nachbarn und Tante Dora, die Schwester ihres Vaters und seine einzige noch lebende Verwandte.
Meredith hatte sich oben auf die Treppe verzogen, blickte hinunter zum Eingang und überlegte, wann sie das Theaterstück ankündigen sollte.
Sie wollte sich gerade erheben, als von unten blechernes Getöse erklang.
O nein.
Sie sprang auf und rannte die Treppe hinunter. Es war zu spät.
In der Küche war Nina dabei, mit einem Löffel auf einen Topf zu schlagen und ein ums andere Mal »Es geht los!« zu rufen. Wie so oft hatte sie Meredith die Schau gestohlen.
Einige der Gäste lachten und betraten das Wohnzimmer, wo das Bühnenbild zwischen dem Kamin und dem hohen Weihnachtsbaum hing, den Meredith und ihre Schwester mit Lichterketten und selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck bestückt hatten.
Davor befand sich ihre »Bühne« mit einer Straßenlaterne aus Pappmaché darauf, an der mit Klebestreifen eine Taschenlampe befestigt war.
Als alle Gäste saßen, schaltete Meredith die Wohnzimmerlampen aus und die Taschenlampe ein.
Sie huschte hinter das Bühnenbild, wo Jeff und Nina in ihren Kostümen warteten. Sie hatten nicht viel Platz. Hätte sich Meredith auch nur ein Stück zur Seite gebeugt, hätten die Gäste sie gesehen, aber es war besser als nichts.
Das Stimmengemurmel verstummte. Meredith holte tief Luft und begann die Einführung zu sprechen, an der sie so lange gearbeitet hatte. »Ihr Name lautet Vera. Sie ist ein armes Mädchen, ein Niemand. Sie lebt in einem Zauberland mit Namen Schneekönigreich, doch die Welt, die sie liebt, ist dabei, unterzugehen. Das Böse ist in ihr Land gekommen, rollt in schwarzen Kutschen durch die Gassen. Der Schwarze Ritter hat die Kutschen ausgesandt. Er will das Schneekönigreich und seine Bewohner vernichten.«
Nun trat Meredith hinter dem Bühnenbild hervor, vorsichtig, damit sie nicht über den Saum ihres langen Rocks stolperte. Sie blickte ins Publikum. Ihre Mutter saß ganz hinten, in der Hand ein Cocktailglas, und selbst inmitten ihrer Gäste wirkte sie isoliert. Einen Moment lang verbarg der aufsteigende Zigarettenrauch ihr schönes Gesicht, dann sah sie Meredith direkt an. Etwas, das nur selten vorkam.
»Komm, Schwester«, sagte Meredith und bewegte sich auf die Straßenlaterne zu. »Die Kälte soll uns nichts anhaben.«
Nina trat ebenfalls hervor. Sie trug ein altes Nachthemd und ein Kopftuch. Händeringend schaute sie zu Meredith. »Glaubst du, es ist der Schwarze Ritter?«, rief sie viel zu schrill. Im Publikum wurde gelacht. »Ist es sein böser Zauber, der für diese Kälte sorgt?«
»Nein.« Meredith schüttelte den Kopf. »Mich fröstelt, weil unser Vater fort ist. Wann bloß wird er wiederkommen?« Meredith hob die Hände und seufzte dramatisch. »Überall sind Kutschen, und der Schwarze Ritter wird immer mächtiger. Vor unseren Augen lösen sich Menschen in Rauch auf.«
»Sieh nur!« Nina wies auf das grüne Schloss. »Da ist der Prinz.« Es gelang ihr, ehrfürchtig zu klingen.
Jeff kam auf die Bühne, in Jeans, blauem Sakko und mit einer goldenen Papierkrone auf dem weizenblonden Haar. In der Hand hielt er zwei Seidenrosen. Er war so schön, dass Meredith kurz vergaß, was sie zu sagen hatte.
Auch er schwieg für einen Moment und fühlte sich sichtlich unwohl, die Röte in seinem Gesicht verriet es deutlich. Er hatte nur mitgemacht, weil er so ein guter Freund war. Doch dann lächelte er, als wäre Meredith tatsächlich seine Liebste.
Er hielt ihr die beiden Seidenblumen hin. »Ich habe dir Rosen mitgebracht.«
Sie berührte seine Hand, und plötzlich wusste sie wieder, wie ihr Text lautete. Aber bevor sie den Mund öffnen konnte, war ein lautes Klirren zu hören.
Meredith fuhr herum und sah ihre Mutter mitten im Publikum stehen, regungslos, mit bleichem Gesicht und blitzenden blauen Augen. Blut floss ihr über die Finger, und selbst von ihrem Platz erkannte Meredith, dass eine Scherbe in der Hand ihrer Mutter steckte. Sie musste ihr Cocktailglas zerdrückt haben.
»Genug«, sagte sie scharf. »Das ist keine Unterhaltung für ein Weihnachtsfest.«
Die Gäste sahen aus, als wüssten sie nicht, was sie tun sollten. Keiner von ihnen sagte etwas, einige standen auf.
Merediths Vater trat zu ihrer Mutter, legte einen Arm um sie und wollte sie an sich ziehen. Sie versteifte sich. Nicht einmal ihm zuliebe war sie bereit, nachzugeben.
»Ich hätte euch diese kindischen Märchen nicht erzählen sollen«, sagte sie. In ihrem Zorn wurde ihr russischer Akzent stärker. »Ich hätte daran denken müssen, wie gedankenlos und gefühlsduselig Mädchen sind.«
Gedemütigt senkte Meredith den Kopf.
Ihr Vater führte ihre Mutter in die Küche, wahrscheinlich, um ihre Hand von den Scherben zu befreien und das Blut abzuwaschen.
Die Gäste verließen das Haus, eilig, als wäre es die Titanic und die Rettungsboote warteten vor der Tür.
Jeff sah Meredith mitfühlend an. »Meredith«, sagte er, in der Hand noch die beiden Rosen.
Sie stürmte an ihm vorbei aus dem Raum. Erst in der Dunkelheit des Flures blieb sie schwer atmend und mit brennenden Augen stehen. Sie hörte ihren Vater, der in der Küche versuchte, seine aufgebrachte Frau zu beruhigen.
Gleich darauf fiel die Haustür ins Schloss. Jeff war gegangen.
Und dann war Nina da. »Was hat Mom denn?«, fragte sie.
»Wer weiß das schon?« Meredith zuckte mit den Schultern. »Sie ist so eine blöde Kuh.«
»So was darf man nicht sagen.«
Meredith hörte das Beben in Ninas Stimme und wusste genau, wie schwer es für sie war, nicht zu weinen. Sie nahm die Hand ihrer Schwester.
»Was sollen wir denn jetzt tun?«, flüsterte Nina. »Sagen, dass es uns leidtut?«
Meredith erinnerte sich an das letzte Mal, als sie ihre Mutter wütend gemacht und sich dafür entschuldigt hatte. »Das wird sie nicht interessieren. Das kannst du mir glauben.«
»Aber was sollen wir sonst tun?«
Meredith wollte sich stark fühlen, wie vor Beginn der Aufführung, doch sie hatte ihren Mut und ihr Selbstvertrauen verloren. Sie sagte sich, dass ihr Vater später in ihr Zimmer kommen würde. Er würde sie zum Lachen bringen, sie in die Arme nehmen und ihnen erklären, dass ihre Mutter sie liebe. Und Meredith würde sich wünschen, sie könnte ihm glauben. Wieder einmal.
»Ich kann dir sagen, was ich tun werde.« Sie ging in Richtung Küche, bis sie ein Stück ihrer Mutter sah – das schmal geschnittene schwarze Samtkleid, einen blassen Arm und ihre schneeweißen Haare. »Ich werde ihr nie mehr zuhören, wenn sie uns eins ihrer kindischen Märchen erzählt.«
Wir wissen nicht, wie man Abschied nimmt. Wandern weiter, Schulter an Schulter. Langsam wird es dunkel. Du bist in Gedanken, ich schweige.
Anna Achmatowa, Die weiße Schar
Kapitel 1
2000
Sah man so mit vierzig aus? Anscheinend. Wurde sie deshalb seit einer Weile nicht mehr mit »Miss«, sondern als »Ma’am« angeredet? Ohne Übergang war es dazu gekommen. Weitaus schlimmer war jedoch, dass die Spannkraft ihrer Haut nachließ und sich in ihrem Gesicht erste Fältchen zeigten. Zudem war ihr Hals voller geworden. Nur grau war sie nicht geworden, das war ein Trost. Ihr kastanienbraunes Haar, das sie in einem einfachen, schulterlangen Bob trug, war noch immer dicht und glänzend. Und doch war es ihr Blick, der sie endgültig verriet; er wirkte müde, ganz gleich um welche Uhrzeit.
Meredith wandte sich vom Badezimmerspiegel ab, zog das lange T-Shirt aus, das sie nachts getragen hatte, streifte Jogginghose, Sweatshirt und Socken über. Ihr Haar fasste sie am Hinterkopf zu einem kurzen dicken Pferdeschwanz zusammen.
Als sie durch das dunkle Schlafzimmer tappte, hörte sie ihren Mann leise schnarchen und wäre am liebsten wieder zu ihm ins Bett gekrochen. Früher hätte sie es getan und sich unter der warmen Decke an ihn gekuschelt.
Lautlos zog sie die Schlafzimmertür hinter sich zu. Im Flur sorgten uralte Nachtlichter für trübe Beleuchtung. Sie ging an den geschlossenen Türen der Kinderzimmer vorbei, deren ehemalige Bewohnerinnen nun schon lange keine Kinder mehr waren. Ihre Tochter Jillian war neunzehn und studierte an der University of California in Los Angeles Medizin im zweiten Studienjahr. Maddy, Merediths »Baby«, war achtzehn. Sie hatte vor Kurzem ihr Studium an der Vanderbilt University in Nashville aufgenommen.
Seitdem ihre Töchter fort waren, kam Meredith das Haus – ebenso wie ihr Leben – stiller und leerer vor, als sie es erwartet hätte. Zwanzig Jahre lang hatte sie alles getan, um ihren Töchtern die Mutter zu sein, die sie selbst nicht gehabt hatte. Und es war ihr geglückt, alle drei waren sie einander eng verbunden. Doch nun, da die beiden nicht mehr da waren, fühlte Meredith sich ziellos, vielleicht sogar nutzlos. Was lächerlich war, sie hatte genug zu tun. Aber die Mädchen fehlten ihr.
Man muss es nehmen, wie es kommt, sagte sie sich. Das schien ihr bereits seit einer Weile die beste Devise zu sein.
Unten im Wohnzimmer knipste sie die elektrischen Kerzen des Weihnachtsbaums an. Im Flur sprangen ihr die beiden Huskys, Luke und Leia, kläffend und schwanzwedelnd entgegen.
»Runter!«, befahl sie, kraulte die Hunde hinter den Ohren und öffnete ihnen die Hintertür. Kalte Luft schlug ihr entgegen. In der Nacht hatte es wieder geschneit, und der Schnee schimmerte wie Perlmutt auf den Feldern.
Als Meredith in den dunklen Morgen hinaustrat, konnte sie ihren Atem sehen. Im tiefen Grau des Himmels deuteten sich die ersten hellen Streifen an.
Zehn nach sechs.
Genau die richtige Zeit.
Meredith lief langsam los, gewöhnte sich an die Kälte. Sie trabte die unbefestigte Straße hinunter, die am Haus ihrer Eltern vorbeiführte, und wurde schneller. Von dort ging es über einen Feldweg und einen Hügel hinauf, am Golfplatz vorbei und wieder zurück. Alles in allem vier Meilen. Beinahe jeden Morgen legte sie die Strecke zurück, was blieb ihr auch anderes übrig? Sie war hochgewachsen, ihr Körperbau stämmig, mit breiten Schultern, ausladenden Hüften und großen Füßen. Sogar in ihrem ovalen Gesicht mit dem hellen Teint wirkten die einzelnen Bestandteile überdimensioniert – der breite Mund, die großen braunen Augen, die buschigen Augenbrauen und dazu das dicke Haar. Wenn sie einigermaßen attraktiv sein wollte, musste sie auf ihr Äußeres achten, musste joggen und Diät halten.
Als sie den Rückweg einschlug, wurde es heller, die weißen Schneegipfel der bergigen Kaskadenkette traten leuchtend aus dem Grau des frühen Morgens hervor.
Die zahllosen kahlen Apfelbäume unten in der verschneiten Plantage sahen aus, als hätte jemand ein weißes Tuch mit braunem Faden bestickt. Dieses fruchtbare Stück Land war seit fünfzig Jahren im Besitz ihrer Familie. In der Mitte stand das Haus, in dem Meredith aufgewachsen war. Bjelyje Notschi. Sogar im dunstigen, blassen Licht des frühen Morgens wirkte es pompös, fehl am Platz.
Auf dem Weg hinauf zu ihrem eigenen Haus beschleunigte Meredith ihren Schritt erneut, wurde so schnell, dass sie kaum noch Luft bekam und Seitenstechen spürte.
Vor der Veranda hielt sie keuchend inne und genoss ein letztes Mal den Blick über das Tal.
Im Haus fütterte sie die Hunde, stellte ihnen frisches Wasser hin und eilte nach oben. Als sie das Bad betreten wollte, kam Jeff ihr mit um die Hüfte geschlungenem Handtuch und nassem Haar entgegen. Er drehte sich wortlos zur Seite, um sie vorbeizulassen. Sie tat das Gleiche.
Um zwanzig nach sieben föhnte sie ihr Haar trocken. Punkt halb acht war sie fürs Büro angekleidet, mit schwarzer Hose und grüner Bluse. Lidstrich, Wimperntusche, Rouge und ein Hauch Lippenstift, und sie war fertig.
Am Küchentisch saß Jeff auf seinem Stammplatz und las die New York Times. Die Hunde schliefen zu seinen Füßen.
Jeff hatte Kaffee gekocht. Meredith schenkte sich eine Tasse ein. »Möchtest du noch einen Schluck?«
»Nein, danke«, antwortete er, ohne aufzusehen.
Sie rührte Sojamilch in ihren Kaffee und beobachtete, wie sich die Kaffeefarbe veränderte. Wie distanziert sie und Jeff in letzter Zeit miteinander umgingen. Wie Fremde oder ein Paar, das sich über seine Beziehung keine Illusionen mehr machte. Sie sprachen über die Arbeit oder ihre Töchter, andere Themen schien es nicht mehr zu geben. Halbherzig versuchte Meredith, sich zu erinnern, wann sie zum letzten Mal miteinander geschlafen hatten. Es fiel ihr nicht ein.
Vielleicht war das normal. Ganz sicher sogar. Wenn man seit so langer Zeit verheiratet war, gab es fraglos Phasen, in denen man sich nicht viel zu sagen hatte. Doch wenn sie daran dachte, wie innig und leidenschaftlich ihre Liebe einmal gewesen war, stimmte der jetzige Zustand sie traurig.
Bei ihrem ersten Date war sie vierzehn gewesen. Sie und Jeff hatten im Kino Frankenstein Junior gesehen, noch immer einer ihrer Lieblingsfilme. Danach hatte sie für andere Jungs keine Augen mehr gehabt. Wie seltsam, dachte sie, sie war eigentlich nie der romantische Typ gewesen, doch irgendwann hatte sie sich hoffnungslos in Jeff verliebt. Zuvor war er nur ihr bester Freund gewesen.
Sie hatten jung geheiratet, vielleicht zu jung. Dann waren sie zum Studium nach Seattle gezogen, wo sie abends und an den Wochenenden in verrauchten Bars jobbte. Jeff und sie wohnten im Studentenviertel, in einem winzigen Apartment, das sie geliebt hatte. Im letzten Studienjahr war sie schwanger geworden. Zuerst war sie in Panik geraten, hatte Angst gehabt, wie ihre Mutter zu werden und das Kind abzulehnen. Doch schon bald hatte sie erleichtert festgestellt, dass sie ganz anders war als ihre Mutter. Sie liebte ihre Tochter, und vielleicht war es gut, dass sie bei ihrer Geburt noch so jung war, denn ihre Mutter war alles andere als eine junge Mutter gewesen.
Nun sah sie, dass Jeff den Kopf schüttelte. Es war eine kaum merkliche Geste, doch sie hatte seine Regungen von jeher wahrgenommen. Die Distanz zwischen ihnen schien ihr zuletzt wie ein Pfeifton, auf einer so hohen Frequenz, dass nur sie ihn hören konnte.
»Was ist?«, fragte sie.
»Nichts.«
»Du hast den Kopf doch nicht wegen nichts geschüttelt.«
»Ich hatte dich etwas gefragt.«
»Ich habe es nicht gehört. Frag noch mal.«
»War nicht wichtig.«
»Dann eben nicht.« Sie ging ins Esszimmer.
Zahllose Male war sie diesen Weg schon gegangen, doch als sie unter der altmodischen Deckenleuchte stand, an der ein sinnloser künstlicher Mistelzweig hing, sah sie sich im Geist selbst: eine vierzigjährige Frau mit einer Kaffeetasse in der Hand. Sie betrachtete den Esstisch. Zwei Plätze waren nun leer, nur sie und ihr Mann nahmen noch daran Platz.
Einen Moment lang fragte sich Meredith, welches andere Leben sie hätte führen können. Was, wenn sie nicht hierher zurückgekehrt wäre, um die Apfelplantage zu übernehmen und ihre Töchter großzuziehen? Was, wenn sie nicht so früh geheiratet hätte? Was für eine Frau wäre aus ihr geworden?
Dann war sie wieder in der Realität, und dieses andere mögliche Leben zerplatzte wie eine Seifenblase.
»Bist du zum Abendessen da?«, rief sie in die Küche.
»Bin ich das nicht immer?«
»Punkt sieben.«
»Was wären wir ohne feste Uhrzeit?« Sie hörte, wie ihr Mann eine Zeitungsseite umblätterte.
* * *
Punkt acht Uhr saß Meredith an ihrem Schreibtisch. Wie üblich war sie die erste im Lagerhaus. Sie durchquerte das Großraumbüro im zweiten Stock und schaltete die Beleuchtung ein. Vor dem Büro ihres Vaters, das nun leer war, blieb sie stehen und betrachtete die Plaketten an der Tür. Dreizehn Mal war er zum Apfelbauern des Jahres gewählt worden, und noch immer baten seine ehemaligen Konkurrenten ihn um Rat. Zwar hatte er sich vor zehn Jahren zur Ruhe gesetzt und kam nur selten ins Büro, trotzdem war er das Gesicht von Bjelyje Notschi, der Mann, der Anfang der sechziger Jahre dem Golden Delicious den Weg bereitet hatte, zehn Jahre später dem Granny Smith, und sich in den Neunzigern für den Braeburn und den Fuji starkgemacht hatte. Seine Technik der Kaltlagerung hatte die Branche revolutioniert und den weltweiten Export ihrer Äpfel ermöglicht.
Aber auch Meredith hatte ihren Anteil am wachsenden Erfolg des Unternehmens. Sie hatte das Kaltlager vergrößert, seitdem bestand ein Gutteil ihres Geschäfts darin, das Obst anderer Apfelbauern zu lagern. Aus dem alten Verkaufsstand an der Straße hatte sie einen Laden gemacht, in dem nicht nur Äpfel, sondern auch regionales Kunsthandwerk, Delikatessen und Souvenirs aus Bjelyje Notschi angeboten wurden. Zu dieser Jahreszeit, in der zahllose Menschen den nicht weit entfernten Weihnachtsmarkt von Leavenworth besuchten, würde auch ihr Laden davon profitieren.
Meredith schaute auf ihre Uhr. In Tennessee war es jetzt zehn Uhr, und sie konnte ihre Tochter anrufen.
»Hallo«, murrte Maddy.
»Auch dir einen schönen guten Morgen«, sagte Meredith betont munter. »Klingt, als hätte jemand verschlafen.«
Ein Seufzer. »Bin spät ins Bett gekommen – musste lernen.«
»Madison Elizabeth«, sagte Meredith streng.
Der nächste Seufzer. »Okay, ich war auf der Party einer Studentenverbindung.«
»Ich weiß, wie viel Spaß so was macht und wie sehr du jeden Moment deiner Collegezeit genießen solltest, aber was ist mit der Prüfung nächste Woche? Dienstagmorgen, wenn ich mich nicht irre.«
Ein Stöhnen.
»Die Zeit, in der du lernst, und die Zeit, in der du dich amüsierst, müssen im Gleichgewicht sein. Oder du musst lernen, wie man die Nacht durchmacht und morgens trotzdem fit ist. Und nun schwing deinen Hintern aus dem Bett, Maddy.«
»Ist doch kein Weltuntergang, wenn ich mal eine Stunde Spanisch versäume.«
»Madison!«
Maddy lachte. »Okay, ich steh auf. Hasta la vista … baby.«
»Nächste Woche rufe ich wieder an, und dann will ich hören, wie die Prüfung gelaufen ist. Und melde dich bitte bei deiner Schwester. Sie macht sich Sorgen wegen eines Tests in organischer Chemie und braucht jemanden, der ihr gut zuredet.«
»Okay, Mom, hab dich lieb.«
»Ich dich auch, Schätzchen.«
Nach dem Telefonat fühlte Meredith sich besser. Sie begann mit der Arbeit. Als sie dabei war, den jüngsten Erntebericht zu lesen, brummte ihre Gegensprechanlage.
»Meredith«, sagte ihre Assistentin. »Dein Vater ist auf Leitung eins.«
Sie nahm den Anruf entgegen. »Hallo, Dad.«
»Meredith, deine Mutter und ich haben uns gefragt, ob du heute zum Mittagessen kommen möchtest.«
»Dad, ich ersticke in Arbeit.«
»Bitte.«
Hatte sie ihrem Vater jemals eine Bitte abschlagen können? »Also gut, aber um eins muss ich wieder im Büro sein.«
»Sehr schön«, sagte er, und sie hörte an seiner Stimme, dass er zufrieden lächelte.
Sie vertiefte sich wieder in den Erntebericht. Zurzeit war das Angebot größer als die Nachfrage, die Preise würden also sinken, gleichzeitig waren Export- und Transportkosten gestiegen. Sie würde sich etwas einfallen lassen müssen.
Im Laufe des Vormittags bekam sie Kopfschmerzen, die immer schlimmer wurden. Schließlich stand sie auf, um zu ihren Eltern zu fahren. Als sie durch das Großraumbüro lief, musste sie sich zwingen, ihre Angestellten anzulächeln.
Wenig später stellte sie den Wagen vor der Garage ihrer Eltern ab und stieg aus.
Einen Moment lang betrachtete sie das Haus, das aussah, als wäre es einem russischen Märchen entsprungen. Die Holzgeländer an Veranda und Balkon waren mit verspielten Schnitzereien verziert und, ebenso wie die Dachrinne, mit Lichterketten geschmückt. Das Dach aus gehämmertem Kupfer war vor ein paar Jahren erneuert worden und wirkte an diesem trüben Tag matt, doch wenn die Sonne schien, leuchtete es rotgolden. Flankiert von hohen, schlanken Pappeln und auf einer leichten Anhöhe gelegen, von der man das Tal überblicken konnte, hatte das Gebäude eine gewisse Berühmtheit erlangt, so dass gelegentlich Touristen auf der Durchfahrt anhielten, um es zu fotografieren.
Meredith schüttelte den Kopf. Wenn es darum ging, etwas so Absurdes wie eine riesige russische Datscha inmitten des Staates Washington zu errichten, konnte man sich auf ihre Mutter verlassen. Auch der Name Bjelyje Notschi war Unsinn – Weiße Nächte. Die Nächte in dieser Gegend waren schwarz wie frisch gegossener Teer.
Nicht, dass ihre Mutter das gekümmert hätte. Sie hatte ihren Willen durchsetzen wollen, und das war ihr gelungen. Und wenn Anja Whitson ein Märchenschloss haben wollte und für eine Apfelplantage einen Namen wählte, den niemand aussprechen konnte, dann richtete ihr Mann sich danach.
Meredith klopfte kurz an der Hintertür und betrat das Haus. In der Küche war niemand, doch auf dem Herd köchelte ein großer Topf Suppe.
Im Wohnzimmer fiel das Licht durch den halbrunden Glasvorbau herein, der an einer Ecke des Hauses bis unter das Dach reichte. Vielleicht wartete ihre Mutter dort auf die Weißen Nächte.
Der Holzfußboden glänzte, er wurde regelmäßig mit Bienenwachs poliert. Auch das war eine Marotte ihrer Mutter. Ob der Boden nachher so glatt war, dass man kaum wagte, auf Socken darüber zu laufen, interessierte sie nicht. Eine Wand wurde von dem riesengroßen Kamin beherrscht, davor gruppierten sich Sessel und ein Sofa. Über dem Kamin hing ein Gemälde, das eine russische Troika zeigte, eine verschnörkelte Kutsche, die drei gleich aussehende Pferde über ein Schneefeld zogen. Doktor Schiwago lässt grüßen, dachte Meredith. An einer anderen Wand waren Bilder russisch-orthodoxer Kirchen zu sehen, darunter die »heilige Ecke« ihrer Mutter, ein Tischchen mit historischen Ikonen in Ständern, vor ihnen ein ewiges Licht.
Dann entdeckte Meredith ihren Vater. Er hatte es sich auf der weinroten Ottomane neben dem Weihnachtsbaum bequem gemacht. Nun legte er das Buch, in dem er gelesen hatte, zur Seite und richtete sich auf.
Gerührt betrachtete Meredith das schüttere Haar ihres Vaters, die Falten in seinem Gesicht, die Leberflecke, die er den vielen Arbeitsstunden unter der Sonne verdankte. Im Alter hatte sein Blick etwas Wehmütiges bekommen, auch wenn er, wie jetzt, lächelte. Fünfundachtzig Jahre alt war er inzwischen und wurde in seiner Liebenswürdigkeit von jedermann gemocht.
Er drückte Merediths Hand. »Du bist gekommen. Das wird deine Mutter freuen.«
»Na klar.« Es war das alte Spiel. Dad tat, als liebte seine Frau ihre Töchter, und Meredith tat, als würde sie ihm glauben. »Ist sie oben?«
»Sie wollte in den Garten.«
»Ich hole sie.«
Meredith ging durch die Küche zum Esszimmer. Einen Moment lang verharrte sie in der Sprossentür und genoss den Ausblick über das weite Tal, wo sich die verschneite Plantage mit den Reihen kahler Apfelbäume erstreckte. Direkt vor ihr, unter den mit Eiszapfen bewehrten Ästen einer fünfzig Jahre alten Magnolie, lag der kleine rechteckige Garten. Um den schmiedeeisernen Zaun, der ihn einfasste, wanden sich braune Weinranken, im Sommer würden sie voller Blätter und weißer Blüten sein. Nun glitzerte der Raureif darauf.
Und da war sie: In eine Wolldecke gehüllt saß ihre über achtzigjährige Mutter reglos auf einer schwarzen Bank in ihrem Wintergarten, wie sie diesen Ort nannte. Die bizarren Konturen der gestutzten Sträucher und der frei stehenden Vogeltränke, die unter dem Schnee verborgen lagen, verliehen dem Garten ein seltsames, fast unheimliches Aussehen. Selbst als es nun leicht zu schneien begann und die Schneeflocken die Landschaft zu einem impressionistischen Gemälde verwischten, rührte sich ihre Mutter nicht.
Als Kind hatte das Verlorene, das von ihrer Mutter ausging, Meredith verstört. Später wurde es ihr peinlich, inzwischen ging es ihr auf die Nerven. Sie verstand auch nicht, warum eine Frau ihres Alters unbedingt allein in der Kälte sitzen und auf den Schnee starren musste. Ihre Mutter hätte wahrscheinlich gesagt, dass sie ohnehin nur Schwarz, Weiß und Grautöne wahrnehme, insofern könne sie auch den Schnee betrachten. Diese Sehschwäche war eine ihrer bevorzugten Entschuldigungen, auch wenn es keinen Sinn ergab.
Meredith trat hinaus in die Kälte, die kleine Steintreppe hinab.
Ihre Stiefel versanken knöcheltief im Schnee, und unter ihren Schritten knirschten vereiste Stellen. Kurz vor der Bank ihrer Mutter wäre sie beinahe ausgeglitten.
»Warum sitzt du hier?«, fragte sie. »Willst du dir eine Lungenentzündung einfangen?«
»Die Temperatur ist kaum unter dem Gefrierpunkt. Da holt man sich keine Lungenentzündung.«
Meredith verdrehte die Augen. Wieder eine dieser unsinnigen Antworten. »Komm ins Haus und lass uns essen. In einer Stunde muss ich wieder im Büro sein.« An diesem idyllischen Ort mit den sanft rieselnden Schneeflocken klang ihre Stimme umso schärfer. Sie wünschte, ihr Ton wäre freundlicher ausgefallen. Wie schaffte ihre Mutter es nur, stets das Schlechte in ihr hervorzubringen? »Oder weißt du nicht, dass Dad mich zum Mittagessen eingeladen hat?«
»Natürlich weiß ich das.«
Sie log, Meredith hörte es an dem gleichgültigen Tonfall.
Ihre Mutter stand auf, majestätisch wie eine Königin, der man huldigen musste.
Meredith betrachtete das Gesicht ihrer Mutter, den feinen, nahezu durchscheinenden Teint. Ihr Gesicht war auffallend glatt und makellos, die Konturen beneidenswert schön geschwungen, doch das wirklich Faszinierende waren ihre Augen – aquamarinblau mit goldenen Einsprengseln –, der Wimpernkranz noch immer dicht. Nur wenige, die in diese Augen geblickt hatten, dürften sie je vergessen. Wie widersinnig es war, dass ihre Mutter ausgerechnet mit dieser markanten Schönheit keine Farben erkennen konnte.
Meredith fasste den Ellbogen ihrer Mutter, um sie auf dem Weg ins Haus zu stützen.
»Mom«, sagte sie erschrocken, »deine Hände sind eisig. Warum hast du keine Handschuhe angezogen?«
»Du weißt nicht, was wahre Kälte bedeutet.«
Meredith half ihr die Treppenstufen hinauf. »Wie auch immer. Vielleicht nimmst du ein heißes Bad, um wieder warm zu werden.«
»Ich muss nicht warm werden, wir haben den 14. Dezember.«
»Wie du meinst.«
In der Küche ließ ihre Mutter die Wolldecke, die sie umhüllt hatte, achtlos auf den Boden fallen. Zitternd vor Kälte rührte sie die Suppe um.
Meredith raffte die Wolldecke auf, legte sie zusammengefaltet auf einen Stuhl und deckte den Küchentisch. Die Geräusche, die sie und ihre Mutter verursachten, ersetzten die Unterhaltung.
Merediths Vater betrat die Küche und sagte: »Meine Mädchen.«
Wie blass und dünn er ist, dachte Meredith. Wie schmal die ehemals breiten Schultern geworden sind.
»Es ist so schön, wenn wir gemeinsam zu Mittag essen.«
»Das finde ich auch«, sagte Merediths Mutter.
»Dem kann ich mich nur anschließen«, log Meredith.
»Wunderbar.« Ihr Vater ließ sich am Tisch nieder. Meredith setzte sich zu ihm.
Ihre Mutter stellte ein Brett auf den Tisch. Darauf lag ein noch warmes Maisbrot mit Feta gebacken. Zerlaufene Butter sickerte heraus. Dann brachte sie für jeden eine gefüllte Suppenschale.
»Vorhin habe ich einen Rundgang durch die Plantage gemacht«, sagte Merediths Vater.
»Ich nehme an, du hast gesehen, was hinten in Bereich A los ist?«, fragte Meredith.
Ihr Vater nickte. »Der war von jeher ein Problem.«
Meredith schnitt sich eine Scheibe Brot ab. »Wir kümmern uns darum. Mach dir um die Ernte keine Gedanken.«
»Mache ich nicht. Ich habe an etwas anderes gedacht.«
Meredith nahm einen Löffel Suppe. Sie schmeckte wunderbar. Hausgemachte Lammfleischknödel und Eiernudeln in einer würzigen Safranbrühe. Wenn sie nicht aufpasste, würde sie zu viel davon essen und am Nachmittag noch einmal joggen müssen. »Und woran?«
»Ich möchte dort Wein anbauen.«
»Was?« Meredith ließ ihren Löffel sinken.
»Unser Golden Delicious ist längst nicht mehr das Beste, was wir anbieten könnten.«
Meredith wollte widersprechen, doch ihr Vater machte eine abwehrende Handbewegung. »Ich weiß, was du sagen willst. Dem Golden Delicious verdanken wir unseren Erfolg, aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt ist Wein gefragt. Wir könnten uns auf Eiswein und eine Spätlese spezialisieren.«
»In diesen Zeiten, Dad? Auf den asiatischen Märkten ist es eng geworden, dort hat die Konkurrenz zugenommen. Hinzu kommen die hohen Transportkosten. Im vergangenen Jahr haben wir zwölf Prozent weniger Gewinn gemacht, und in diesem Jahr sieht es nicht viel besser aus. Wir kommen gerade so über die Runden.«
»Du solltest deinem Vater zuhören«, sagte ihre Mutter.
»Bitte, Mom«, entgegnete Meredith gereizt. »Du warst seit ewigen Zeiten nicht mehr im Lagerhaus, und ich wüsste nicht, dass du dir jemals die Zahlen angesehen hättest.«
»Das reicht.« Ihr Vater seufzte. »Ich möchte keinen Streit.«
»Ich muss zurück ins Büro.« Verärgert stand Meredith auf und wusch ihre Suppenschale aus. Die Suppe aus dem großen Topf füllte sie in ein Frischhaltegefäß, verstaute es in dem übervollen Kühlschrank und wusch auch den Kochtopf ab. Mit einem Knall stellte sie ihn auf das Abtropfbrett. »Das Essen war köstlich, Mom, vielen Dank.«
Im Flur streifte sie ihren Mantel über und verließ das Haus.
Draußen atmete sie mehrmals tief durch.
Hinter ihr öffnete sich die Tür. Ihr Vater war ihr gefolgt.
»Du weißt, wie sie im Dezember und Januar ist. Die Winterzeit macht ihr zu schaffen.«
»Ja, weiß ich.«
Er zog sie an sich. »Du musst dir mehr Mühe mit ihr geben.«
Wie oft sie das schon gehört hatte, dachte Meredith übellaunig. Warum konnte er nicht ein einziges Mal sagen, ihre Mutter müsse sich mehr Mühe geben? »Ja, Dad.« Sie spielten die altbekannte Szene, doch in Wahrheit war stets sie diejenige, die es mit ihrer Mutter immer wieder aufs Neue versuchte, auch wenn sie wusste, dass es zwecklos war. Sie würden sich nie nahekommen, dazu war zu viel vorgefallen.
Sie drückte ihrem Vater einen Kuss auf die Wange. »Du bist ein Schatz, Dad.«
»Du auch. Denk über den Weinanbau nach.« Er lächelte. »Vielleicht kann ich vor meinem Tod noch Winzer werden.«
Meredith mochte solche makabren Sprüche nicht. »Sag so was nicht.«
Als sie ihren Wagen wendete, sah sie ihre Eltern noch einmal durchs Wohnzimmerfenster. Ihr Vater nahm ihre Mutter in die Arme, küsste und wiegte sie. Dann machten die beiden ein paar Tanzschritte, obschon vermutlich keine Musik erklang. Die brauchte ihr Vater nicht. Er sagte immer, sein Herz sei voller Liebeslieder.
Den ganzen Tag lang blieb ihr diese Szene im Gedächtnis. Sogar während sie die Zahlen studierte, während sie hin und her überlegte, wie sie die Kosten senken könnte, oder mit ihren Abteilungsleitern diskutierte, immer wieder kam ihr in den Sinn, wie innig ihre Eltern gewirkt hatten.
Sie hatte nie verstanden, wie eine Frau ihren Mann so hingebungsvoll lieben konnte und gleichzeitig in der Lage war, ihre Kinder derart kalt zurückzuweisen. Nein, zurückweisen war das falsche Wort. Sie waren ihr einfach egal.
»Meredith!«
Sie blickte von ihrem Schreibtisch auf. Meredith war so tief in Gedanken gewesen, dass sie vergessen hatte, wo sie war. In ihrem Büro. Bei der Lektüre eines Schädlingsberichts. Und nun stand ihre Assistentin vor ihr.
»Entschuldige, Daisy, ich habe dein Klopfen nicht gehört.«
»Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt Feierabend mache.«
»O Gott, ist es schon so spät?« Meredith warf einen Blick auf die Uhr. Achtzehn Uhr siebenunddreißig. »Scheiße – ich meine, Mist. So lange wollte ich gar nicht bleiben.«
Daisy lachte. »Du bleibst immer zu lange.«
»Fahr vorsichtig, draußen ist es glatt.« Meredith räumte ihre Unterlagen zusammen. »Und denk dran, morgen früh kommt die Apple Commission. Um neun wollen sie hier sein. Besorg bitte genügend Donuts.«
»Natürlich. Bis morgen, Meredith.«
Auch Meredith machte sich auf den Weg nach Hause.
Es schneite noch stärker als am Mittag. Im Wagen stellte sie die Scheibenwischer auf die höchste Stufe, trotzdem blieb die Sicht schlecht, und die Scheinwerfer der entgegenkommenden Autos blendeten sie. Zwar kannte sie den Lauf der Straße in- und auswendig, dennoch fuhr sie langsam und blieb am rechten Rand. Sie musste daran denken, wie sie Maddy einmal hatte zeigen wollen, wie man auf verschneiten Straßen fuhr. Im Geist hörte sie die Stimme ihrer Tochter. Es ist nur Schnee, Mom, kein Glatteis. Man muss nicht so langsam fahren, dass man von Fußgängern überholt wird.
So war Maddy. Nie konnte es ihr schnell genug gehen.
Zu Hause eilte Meredith als Erstes in die Küche. Sie hatte sich verspätet. Wieder einmal.
»Jeff?«
»Ich bin hier«, rief er aus dem Wohnzimmer.
Sie ging zu ihm. Er stand an der Bar, die sie vor Jahren eingebaut hatten, und war dabei, sich etwas zu trinken zu machen. »Entschuldige, Jeff, im Schnee konnte ich nicht – «
Er winkte ab, wusste ebenso wie sie, dass sie zu lange im Büro geblieben war. »Möchtest du etwas trinken?«
»Ja, ein Glas Weißwein.« Als sie ihn ansah, hätte sie nicht sagen können, was sie empfand. Er war noch immer attraktiv. Das blonde Haar hatte gerade erst begonnen, sich an den Schläfen grau zu färben, seine Kinnpartie war kräftig wie eh und je, seine grauen Augen klar. Sport treiben musste er nicht, er konnte essen, so viel er wollte, ohne ein Gramm zuzunehmen.
Er reichte ihr ein Glas Wein. »Wie war’s im Büro?«
Meredith trank einen Schluck. »Ich war bei meinen Eltern. Mein Vater möchte plötzlich Wein anbauen, und meine Mutter saß bei dem Wetter in ihrem Wintergarten. Offenbar will sie sich eine Lungenentzündung holen.«
»Deine Mutter ist kälter als alles Eis, ihr kann gar nichts passieren.«
In diesem Moment wurde Meredith sich wieder der langen Zeit bewusst, die sie einander kannten. Jeff hatte sich seine Meinung über ihre Mutter vor über zwanzig Jahren gebildet, und seitdem war nichts geschehen, das seine Ansicht geändert hätte.
Meredith ließ sich auf das Sofa sinken. Der Druck, unter dem sie seit Wochen stand, die Hektik, die jeder Tag mit sich brachte, all das machte sich bemerkbar. Sie schloss die Augen.
»Ich habe heute ein Kapitel geschrieben. Nicht viel, nur sieben Seiten. Mir scheint, sie sind ganz gut geworden. Ich habe dir eine Kopie geschickt. Meredith?«
Sie öffnete die Augen und sah, dass Jeff den Blick auf sie gerichtet hatte. Zwischen seinen Brauen hatte sich eine Falte gebildet. Sie überlegte, ob er etwas gesagt hatte, versuchte, sich zu erinnern, und schaffte es nicht. »Entschuldige, ich hatte einen langen Tag.«
»Von denen scheint es in letzter Zeit einige zu geben.«
War das nur eine Feststellung, oder hörte sie da einen vorwurfsvollen Unterton heraus? »Du weißt doch, wie es im Winter ist.«
»Und im Frühling, im Sommer und im Herbst.«
Eindeutig ein Vorwurf. Noch vor einem Jahr wäre sie darauf eingegangen, hätte ihn gefragt, was bei ihnen im Argen lag. Sie hätte ihm erklärt, wie mürbe der graue Alltag sie mache und dass sie ihre Töchter vermisse. Doch auf einmal schien diese Art Offenheit nicht mehr möglich zwischen ihnen. Sie vermochte nicht zu sagen, wie es dazu gekommen war, geschweige denn, wann; alles, was sie wusste, war, dass die Distanz sich zwischen ihnen ausbreitete wie verschüttete Tinte, die umso mehr verfärbte, je mehr Meredith sie fortzuwischen versuchte.
»Ich gehe runter ins Arbeitszimmer.« Jeff nahm seine Jacke von der Stuhllehne.
»Jetzt noch?«
»Warum nicht?«
War das eine ernst gemeinte Frage? Wollte er, dass sie ihn bat, bei ihr zu bleiben, oder wollte er fort von ihr? Sie wusste es nicht, und es war ihr auch egal. Sie wollte ein heißes Bad nehmen und noch ein Glas Wein trinken, ohne sich überlegen zu müssen, worüber sie und Jeff beim Essen reden könnten. Sie hatte sowieso keine Lust zu kochen. »Nur so.«
»Dachte ich mir.« Er gab ihr einen Kuss auf die Wange und verschwand.
Kapitel 2
Tagelang waren sie im Dschungel unterwegs gewesen, bis sie das verstümmelte Tier schließlich auf einer Lichtung entdeckten. Es war das Surren der Insekten, das sie aufmerksam gemacht hatte. Und der Geruch.
Nina verharrte neben dem Guide, der sie hergeführt hatte, und einen schrecklichen Augenblick lang nahm sie diese Szene des Todes allzu deutlich wahr. Die wimmelnden Maden, die unruhige weiße Flecke auf dem blutigen Kadaver bildeten. Die Stille um sie herum, die ihr verriet, dass sie von Raubtieren und Aasgeiern beobachtet wurden.
Dann gewann die Fotografin in ihr die Oberhand, und sie begann, das Bild zu strukturieren. Mit dem Belichtungsmesser prüfte sie die Helligkeit, wählte von den drei Fotoapparaten, die um ihren Hals hingen, den passenden und fokussierte den abgeschlachteten Berggorilla.
Klick.
Sie umrundete das Tier, schoss ein Foto nach dem anderen. Wechselte den Fotoapparat, überprüfte die Lichtverhältnisse erneut, justierte die Blende. Adrenalin rauschte durch ihre Adern, und ihr wurde wieder bewusst, dass sie sich nur in solchen Momenten richtig lebendig fühlte.
Sie vermochte die Welt wie durch die Linse der Kamera wahrzunehmen, was eine ebensolche Begabung war wie ihre Fähigkeit, sich auf den Moment einzulassen und jegliche Störfaktoren auszublenden. Eines hing vom anderen ab, beides machte ihr Talent aus. Denn um eine großartige Fotografin zu sein, musste man zuerst sehen, dann fühlen.
Sie strich sich noch mehr Eukalyptussalbe unter die Nase und rückte näher an den Stumpf des Halses heran. Hinter ihr übergab sich jemand, wahrscheinlich der junge Journalist, der sie begleitete. War sein Problem.
Klick. Klick.
Die Wilderer wollten nur Kopf, Hände und Füße der Tiere. Das waren die Teile, die Geld einbrachten. Irgendwo auf der Welt dienten Affenhände reichen Arschlöchern als Aschenbecher.
Klick. Klick.
In der nächsten Stunde wählte Nina immer neue Bildausschnitte, knipste, wechselte Fotoapparate und Objektive, verstaute volle Filme wieder in ihren Dosen und diese in den Taschen ihrer Safariweste.
Gegen Abend machten sie sich auf den langen, feuchtheißen Rückweg. Die Stille war längst von den Geräuschen des Dschungels abgelöst worden – Insektensummen, Vogellaute und dem Gebrüll der Affen. Zwischen den Bäumen leuchtete der Himmel blutrot, die Sonne sah aus wie eine Riesenorange.
Auf dem Hinweg hatten sie sich unterhalten, der Rückweg verlief in ernstem Schweigen.
Als der Adrenalinschub langsam seine Wirkung verlor, überfiel das Bild des hingemetzelten Gorillas Nina mit Macht. Der Moment unmittelbar danach war stets das Schlimmste. Denn bei ihren Fotoreportagen gab es so manchen Anblick, der sich nicht vergessen ließ. Das Erlebte kehrte in Form von Alpträumen zurück, ließ sie nur allzu oft aus dem Schlaf schrecken und krampfhaft nach Luft ringen.
Am Fuß des Bergs lag der Außenposten, der in diesem entlegenen Teil Ruandas bereits als Siedlung galt. Sie stiegen in den Jeep, den sie dort abgestellt hatten.
Stunden später erreichten sie das Naturschutzzentrum, wo sie die Wilderei in Ruanda mit dem Leiter diskutierten und Nina weitere Fotos schoss.
Sie hörte, wie jemand ihren Namen rief. Es war Dimonsu, der Fremdenführer des Zentrums. Trotz ihrer Müdigkeit zwang sie sich, ihn anzulächeln.
»Tut mir leid, Sie zu stören«, sagte er, »aber ich habe eine Nachricht für Sie. Mrs. Sylvie hat um Ihren Anruf gebeten.«
»Danke.«
Nina holte ihr klobiges Satellitentelefon heraus und brachte ihr ganzes Material in die Mitte des Lagers zu einer Lichtung, wo sie Empfang hatte.
»Sylvie«, sagte sie, als ihre Redakteurin sich meldete. »Wilderer sind Dreckschweine, aber ich habe die Fotos im Kasten. In zehn Tagen hast du sie.«
»In sechs Tagen bitte. Das könnte unser Cover werden.«
Cover. Ein schöneres Wort kannte Nina nicht. Cover waren für sie das Höchste, am besten auf einer Ausgabe der Time oder National Geographic. Ihr größter Traum waren ein Cover und eine dazugehörige Fotoreihe mit der Überschrift »Kriegerinnen aus aller Welt«. Eines Tages würde sie freiberuflich arbeiten und mit diesem Herzensprojekt beginnen, das hatte sie sich fest vorgenommen. »In Ordnung. Morgen bin ich in Namibia. Danny wird auch da sein.«
»Du Glückliche. Hab Sex für mich mit. Und sieh zu, dass du noch vor Weihnachten nach Sierra Leone kommst. Dort eskaliert die Gewalt gerade wieder, und die Friedensgespräche werden im Sand verlaufen.«
»Geht klar.«
»Sollte es dort Krieg geben, melde ich mich. Und viel Spaß mit Danny. Lieber Himmel, ich weiß kaum noch, was Sex ist.«
* * *
Ein paar Tage später war Nina in Namibia und mietete einen Geländewagen. Damit sie die Hände zum Fotografieren frei hatte, übernahm Danny, der Kriegsberichterstatter war, das Steuer.
Bereits um sieben Uhr morgens stand die Sonne am Himmel. Gegen Mittag würde die Temperatur bis auf dreißig Grad steigen. Die Straße, falls man sie so nennen konnte, war ein ausgetrocknetes Flussbett aus weichem rötlichem Sand. Immer wieder sanken die Reifen ein oder der Jeep scherte aus. Nina hielt sich an der Wagentür fest und versuchte, das Schlingern mit dem Körper abzufangen.
Mit der anderen Hand hielt sie den Fotoapparat von sich, damit der Trageriemen ihr nicht in den Hals schnitt. Um den Apparat vor dem aufwehenden Staub zu schützen, hatte sie ihn in ein T-Shirt eingeschlagen, was nicht sehr professionell war, aber den Vorteil hatte, dass sie das T-Shirt rasch herunterreißen konnte, sobald sich ihr ein interessantes Motiv bot.
Sie ließ ihren Blick über die unwirtliche Landschaft gleiten. Je weiter sie sich von der Zivilisation entfernten, je tiefer sie in die Wildnis eindrangen, desto mehr hungernde und durstende Tiere sah sie. Hilflos standen sie am Rand wasserloser Flussbetten, die Hitze des Sommers ließ sie in den Knien einknicken und würde sie bald verenden lassen. Überall lagen ausgebleichte Knochen.
»Willst du wirklich zu den Himba?«, fragte Danny, wobei der Jeep wieder ins Rutschen geriet und beinahe im Sand stecken geblieben wäre. »Seit Monaten haben wir kaum Zeit füreinander.«
Nina wandte sich zu ihm um. Der Staub auf seinem Gesicht brachte seine blauen Augen und weißen Zähne zum Leuchten. Auch sein überlanges, schwarzes Haar und sein T-Shirt waren staubbedeckt.
Die Straße, wenn man das, worauf sie zu fahren versuchten, denn so nennen wollte, wurde besser. Nina enthüllte ihren Fotoapparat und betrachtete Danny durch den Sucher. Sie vergrößerte das Bild, studierte sein Gesicht, als sähe sie ihn zum ersten Mal – einen gut aussehenden Iren von neununddreißig Jahren mit ausgeprägten Wangenknochen und einer Nase, der man ansah, dass sie schon mehrfach gebrochen worden war. Kneipenschlägereien in jungen Jahren, hatte er gesagt. Um seinen Mund hatten sich winzige Falten gebildet. Mit gerunzelter Stirn konzentrierte er sich auf den Weg, den man ihnen empfohlen hatte und von dem er nicht sicher war, ob es der richtige war. Falls er sich Sorgen machte, würde er das jedoch für sich behalten. Ein Kriegsberichterstatter wie er ging für eine gute Story durch die Hölle, auch wenn es in diesem Fall Ninas Story war.
Sie drückte auf den Auslöser.
Klick. Klick. Er grinste. »Wenn du das nächste Mal einheimische Frauen fotografieren willst, werde ich darauf bestehen, dass du dich mit den Bedienungen am Hotelpool begnügst.«
Nina lachte und ließ den Fotoapparat sinken. »Für die Fahrt zu den Himba hast du bei mir was gut. Ist das nichts?«
»Darf ich heute Abend darauf zurückkommen?«
Nina lehnte sich zurück und zwang sich, die Augen offen zu halten. Sie war todmüde. Vor der Verfolgung der ruandischen Wilderer hatte sie in Angola fotografiert, wo ein Bürgerkrieg tobte.
Dennoch liebte sie ihre Arbeit an den Brennpunkten der Welt. Es gab keine Orte, an denen sie sich lieber aufhielt, und nichts war für sie schöner, als dort zu fotografieren. Die Suche nach dem perfekten Shot, der Moment, in dem sie das Adrenalin überkam, nichts davon wollte sie missen, ganz gleich, wie viel sie dieser Art zu leben opfern musste.
Vor sechzehn Jahren, als sie ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, war sie mit einem Rucksack und einer gebrauchten Kamera losgezogen, um das zu tun, wozu sie sich berufen fühlte.
Eine Zeit lang nahm sie jeden Auftrag an, bis sie 1985 ihren großen Durchbruch hatte. Bei dem Live-Aid-Konzert gegen den Hunger in der Welt gelang es ihr, eine Frau namens Sylvie Porter, die gerade bei Time angefangen hatte, von ihrem Können zu überzeugen. Eine so renommierte Zeitschrift bedeutete für Nina damals eine ganz neue Dimension. Ihr erster Auftrag für das Nachrichtenmagazin führte sie nach Äthiopien, und was sie dort sah, veränderte alles.
Statt reine Bilder zu kreieren, begann sie, mit ihren Fotos Geschichten zu erzählen. Als Thailand 1989 von einem Taifun erfasst wurde und über hunderttausend Einwohner obdachlos wurden, schaffte es eines von Ninas Fotos auf das Cover der Time. Es zeigte eine Frau bis zur Brust im Wasser eines über die Ufer getretenen Flusses, die ein weinendes Baby über ihrem Kopf hielt. Zwei Jahre später erhielt Nina für ihre Fotoreportage über die Hungersnot im Sudan den Pulitzerpreis.
Doch ihre Karriere forderte ihren Tribut.
Ähnlich wie die Himba Namibias führte sie das Leben einer Nomadin. Bequeme, saubere Betten und fließendes Wasser waren ein Luxus, auf den sie zu verzichten gelernt hatte.
»Schau!« Danny deutete auf einen Berghang.
Zuerst sah Nina nur rote, von der Sonne verbrannte Erde und darüber den vom Staub verschleierten orangeroten Himmel. Dann roch sie den Rauch eines Feuers. Gleich darauf entdeckte sie die dunklen Silhouetten auf dem Hang, aus denen dünne, hoch aufgerichtete Menschen wurden, die dem staubverkrusteten Jeep mit seinen verdreckten Insassen entgegenblickten.
»Sind sie das?«, fragte Danny.
»Ich nehme es an.«
Danny fuhr auf die Hügelkette zu, bis das Flussbett eine Biegung machte und kleine, runde Lehmbauten – Rondavels – sichtbar wurden. Ein Kral.
Er stellte den Motor aus. Sie verließen den Jeep.
Die Himba beobachteten sie reglos, bevor sie sich langsam an den Abstieg machten.
Danny ging Nina voraus. Sie wussten, der Häuptling würde sich von allein zeigen.
Vor dem Rundhaus des Ältesten blieben sie stehen. Man erkannte es daran, dass davor das heilige Feuer brannte. Das war der Rauch, den sie gerochen hatten.
Nina und Danny verneigten sich zum Feuer hin und achteten darauf, nicht vor ihm entlangzulaufen; es wäre respektlos gewesen.
Von irgendwoher tauchte der Häuptling auf und trat zu ihnen. In stockendem Swahili boten Danny und Nina ihm den Fünfzig-Liter-Kanister Wasser in ihrem Jeep für eine Fotoerlaubnis an. Für einen Stamm, der für einen Eimer Wasser Meilen zurücklegen musste, war es ein guter Tausch. Nina und Danny wurden wie Freunde willkommen geheißen. Eine Horde Kinder schwirrte kichernd um sie herum.
Wenig später nahmen sie an einem Mahl aus Maisbrei und Sauermilch teil, wobei sie sich mit ihren Gastgebern so gut es ging unterhielten.
Als das Mondlicht den Nachthimmel bläulich färbte, wies man ihnen eins der kleinen Rundhäuser zu, mit einer Matte, die aus Blättern und Gras gewebt war. Die Luft roch süß nach geröstetem Mais und trockener Erde.
Nina drehte sich zu Danny um. In dem trüben Licht, das durch die Öffnung des Eingangs fiel, wirkte sein Gesicht so jung. Allein sein Blick war der eines Mannes, der in seinem Leben zu viel gesehen hatte, zu viel Grausames. Und doch war es das, was sie zusammengeführt hatte. Sie beide wurden von dem Verlangen getrieben, die Welt zu sehen, einschließlich des Schrecklichen, das zu ihr gehörte.
Sie hatten sich vor vier Jahren kennengelernt, in der Demokratischen Republik Kongo während des Befreiungskriegs. Nina hatte sich in eine verlassene Hütte zurückgezogen, um einen neuen Film einzulegen, und dort war sie Danny begegnet, der dabei war, eine Schulterwunde zu bandagieren, während draußen gekämpft wurde.
»Das sieht übel aus«, sagte sie. »Soll ich deine Schulter verbinden?«
»Meine Gebete wurden erhört«, erwiderte Danny und grinste schief. »Der Herr hat mir einen Engel geschickt.«
Von da an waren sie in der ganzen Welt gemeinsam unterwegs – im Sudan, in Simbabwe, Ruanda, Afghanistan, Nepal, Bosnien und wieder in der Demokratischen Republik Kongo. Sie wurden zu Afrikaexperten. Jeder hatte eine Wohnung in London, in der sich Staub und Postwurfsendungen sammelten. Doch oft zogen sie ihre unterschiedlichen Schwerpunkte in ganz verschiedene Ecken – Danny berichtete über Bürgerkriege, Nina über humanitäre Katastrophen –, und so kam es vor, dass sie einander über Monate nicht sahen. Nina war es recht, die Distanz machte die Beziehung für sie immer wieder von Neuem interessant. Genau wie den Sex.
»Nächsten Monat werde ich vierzig«, sagte Danny nun.
Nina liebte seinen irischen Akzent, er hatte etwas aufregend Raues.
»Mach dir keine Sorgen, die Frauen werden immer hinter dir her sein. Es ist dieser Ich-hab-früher-in-einer-Rockband-gespielt-Look.«
»Es war eine Punkband.«
Sie schmiegte sich an ihn, küsste seinen Hals und fuhr mit der Hand über seine Brust. Es dauerte nicht lange, bis sein Körper reagierte, er sich auf sie schob und sie sich liebten.
Hinterher zog er sie an sich. »Warum gehst du nicht auf das ein, was ich gesagt habe?«
»Warum, was hast du gesagt?«
»Dass ich vierzig werde.«
»War das ein Gesprächsauftakt? Und was soll ich darauf antworten? Dass ich siebenunddreißig bin?«
»Könnte es nicht sein, dass ich dich vermisse, wenn wir nicht zusammen sind?«
Nina seufzte. »Darüber haben wir ganz zu Anfang gesprochen. Du weißt, wie ich bin.«
»Das war vor über vier Jahren. Die Welt verändert sich fortwährend, aber du nicht?«
»Richtig.« Sie dachte daran, wie sicher sie sich in seinen Armen immer gefühlt hatte, selbst dann, wenn ringsum geschossen wurde und Menschen schrien. Nun war außer dem knisternden Lagerfeuer und summenden Insekten nichts zu hören.
Sie wollte ein Stück von ihm abrücken, doch er hielt sie fest.
»Ich habe keineswegs etwas von dir verlangt«, sagte er leise.
Doch, du weißt es nur nicht, dachte Nina unbehaglich und schloss die Augen.
* * *
Früh am nächsten Morgen hockte Nina auf einem Hang über dem Flussbett. Die Sonne war aufgegangen und durchzog den blaugrauen Himmel mit orangeroten Streifen.
Zu ihren Füßen durchquerte eine Himba-Frau den Kral, trug ein schweres Gefäß auf dem Kopf und in einem bunten Tragetuch einen Säugling an der Brust.
Nina hob den Fotoapparat und holte die Frau mit dem Teleobjektiv näher heran. Wie die anderen Himba-Frauen trug auch sie nur einen kurzen Rock aus Ziegenleder. Ihre Kette aus großen weißen Muscheln – ein wertvoller Besitz, der von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde – zeigte, dass sie verheiratet war. Um sich vor der Sonne zu schützen, hatte sie ihren Körper mit einer Mischung aus Butterfett und rotem Ocker eingerieben, so dass ihre Haut die Farbe alter Ziegelsteine hatte. Ihre Fußknöchel, die intimste Stelle ihres Körpers, waren unter Reihen dünner Metallreifen verborgen, die bei jedem Schritt klimperten.
Am Flussbett blieb die Frau stehen und starrte in die rissige Furche, durch die kein Wasser mehr floss. Sie strich dem Säugling zärtlich über den Kopf, doch ihr Gesicht zeigte einen Ausdruck tiefer Verzweiflung. Diesen Blick kannte Nina von anderen Frauen in Gebieten, in denen es Krieg, Hungersnot oder eine Naturkatastrophe gegeben hatte. Die Frauen fürchteten um das Leben ihrer Kinder.
Nina fotografierte, bis die Frau sich vor einer Lehmhütte im Kreis anderer Frauen niederließ, die schwatzend roten Ocker mit Steinen zermahlten.
Nina stand auf und lockerte ihre steif gewordenen Beine. In den vergangenen Stunden hatte sie mehrere Hundert Fotos geschossen, aber schon jetzt wusste sie, dass das mit der Frau und dem Baby unten am Flussbett von allen das beste war.
In Gedanken sah sie es in ihrer Wohnung gerahmt zwischen den anderen hängen, die ihr die liebsten waren. Eines Tages würden ihre Porträts der Welt zeigen, wie stark und widerstandsfähig diese Frauen waren – und wie hoch der Preis war, den sie dafür zahlten, was in ihren Gesichtern nur allzu deutlich zu lesen war.
Später verteilte Nina im Kral Bonbons, bunte Bänder und einfachen Schmuck, Dinge, die sie in Afrika stets im Gepäck hatte, und fotografierte die Frauen, die aus der Schwitzhütte kamen, wo sie sich in diesem wasserarmen Land gereinigt hatten. Ihr gelang es, ein Bild des Zusammenhalts einzufangen, auf dem sie sich an den Händen hielten und lachten.
Sie hörte, wie Danny an sie herantrat. »Hey, du.«
Sie lehnte sich an ihn, voller Stolz auf die Bilder, die sie hatte machen können. »Diese Frauen sind einfach großartig«, sagte Nina. »Ihr Leben ist so hart, aber sie gehen so zärtlich und liebevoll mit ihren Kindern um. Es berührt mich zutiefst.«
Danny zog die Augenbrauen hoch. »Seit wann interessierst du dich für liebende Mütter? Ich dachte, du hättest dich auf kämpferische Frauen spezialisiert.«
Nina zuckte mit den Schultern. »Das eine schließt das andere nicht aus. Ich fotografiere Frauen, die mit widrigen Lebensbedingungen fertigwerden müssen. Warum sollten das nicht auch Mütter sein?«
»Mir war nicht klar, dass in dir eine Romantikerin schlummert.«
»Nun weißt du’s.«
»Sollen wir weiterfahren?«
Nina nickte. »Ich habe alles, was ich brauche.«
»Und wir werden jetzt eine Woche lang faul am Hotelpool liegen?«
»Nichts lieber als das.«
Nina verstaute ihr Gepäck und ihre Ausrüstung im Jeep und versuchte, Sylvie zu erreichen, die sich jedoch nicht meldete. Nina hinterließ ihr eine Nachricht und versprach, sich wieder zu melden, wenn sie in Sambia war.