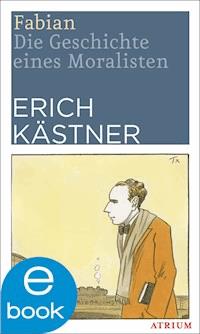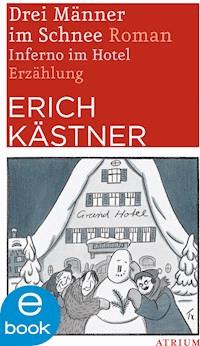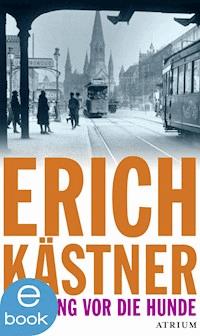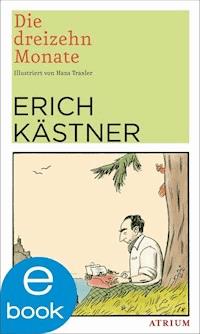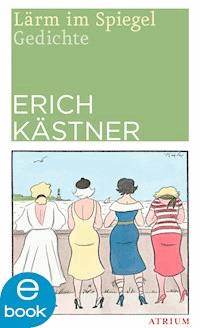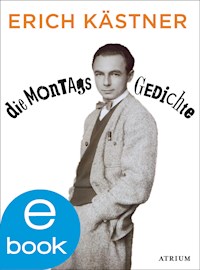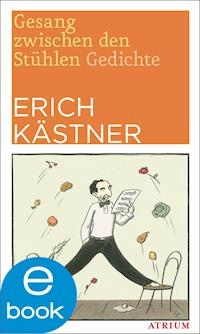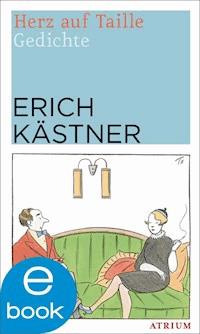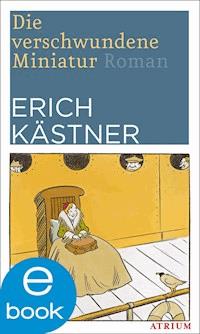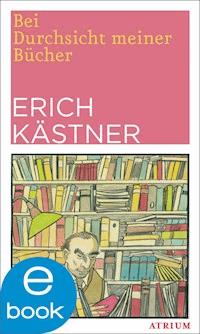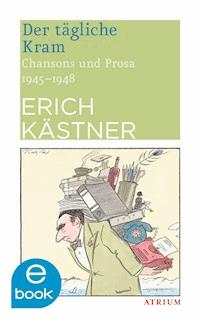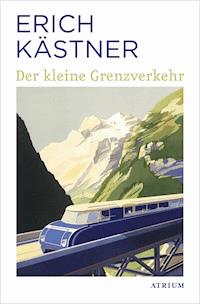
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine rasante Liebesgeschichte vor Salzburger Kulisse. 1937: Der junge Schriftsteller Georg aus Berlin bekommt eine Einladung zu den Salzburger Festspielen. Zugleich verweigert ihm die zuständige Behörde jedoch die Devisen. Georg quartiert sich daraufhin kurzerhand in Bad Reichenhall ein, um auf dem Weg des "kleinen Grenzverkehrs" doch noch in den ersehnten Kunstgenuss zu kommen. Schon bald steckt er in Schwierigkeiten, doch zum Glück eilt ihm eine junge Dame zu Hilfe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Erich Kästner
Der kleine Grenzverkehr
Vorwort an die Leser
Als ich dieses kleine Buch, während der Salzburger Festspiele Anno 1937, im Kopf vorbereitete, waren Österreich und Deutschland durch Grenzpfähle, Schlagbäume und unterschiedliche Briefmarken »auf ewig« voneinander getrennt. Als das Büchlein im Jahre 1938 erschien, waren die beiden Länder gerade »auf ewig« miteinander verbunden worden. Man hatte nun die gleichen Briefmarken und keinerlei Schranken mehr. Und das kleine Buch begab sich, um nicht beschlagnahmt zu werden, hastig außer Landes.
Habent sua fata libelli, wahrhaftig, Bücher haben auch ihre Schicksale. Jetzt, da das Buch in einer neuen Auflage herauskommen soll, sind Deutschland und Österreich wieder voneinander getrennt. Wieder durch Grenzpfähle, Schlagbäume und unterschiedliche Briefmarken. Die neuere Geschichte steht, scheint mir, nicht aufseiten der Schriftsteller, sondern der Briefmarkensammler. Soweit das ein sanfter Vorwurf sein soll, gilt er beileibe nicht der Philatelie, sondern allenfalls der neueren Geschichte.
Der Verleger, der Autor und der Illustrator des Buches[*] lebten früher einmal in derselben Stadt. In einer Stadt namens Berlin. Nun haust der eine in London, der andere in München und der Dritte in Toronto. Sie haben, jeder auf seine Weise, mancherlei erlebt. Klio, die gefährliche alte Jungfer, hat sie aus ihren Häusern, Gewohnheiten und Träumen getrieben und zu Zigeunern gemacht. Wenn sie voneinander Briefe bekommen, mit seltsamen Marken und Stempeln, lächeln sie und schenken die Kuverts irgendwelchen kleinen Jungen. Denn ob in England, Deutschland oder Kanada – kleine Jungen, die Briefmarken sammeln, findet man immer.
Zürich, im Frühjahr 1948Erich Kästner
Vorrede an die Leser
Dieses Salzburger Tagebuch, das ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, stammt von meinem besten Freunde. Georg Rentmeister heißt der junge Mann. Als er, vor nunmehr einem Jahr, von Berlin nach Salzburg reiste, musste er eine Landesgrenze überschreiten, die es heute nicht mehr gibt.
Da fällt mir ein, dass Sie meinen Freund Rentmeister noch gar nicht kennen. Deshalb sollen Sie, bevor Sie seine Aufzeichnungen lesen, erst einmal einiges über ihn selber erfahren. Das ist Ihr gutes Recht, und schaden kann es auch nicht, denn Georg ist ein Kapitel für sich. Zum Beispiel: seit wir befreundet sind, nunmehr fünfzehn Jahre, betätigt er sich als Schriftsteller, ohne dass bis heute auch nur eine Zeile von ihm erschienen wäre.
Woran das liege, werden Sie fragen. Er besaß von Anfang an den imposanten Fehler, sich Aufgaben zu stellen, deren jede einzelne als Lebenszweck angesprochen werden muss.
Ich will Ihnen ein paar seiner Arbeiten, die mit Grund kein Ende finden, aufzählen und bin halbwegs sicher, dass Sie ihm die rückhaltlose Bewunderung, die er verdient und in die sich wohl gar ein leiser Schauder mischen dürfte, nicht länger vorenthalten werden.
Georg arbeitet unter anderem an einem Buch ›Über den Konjunktiv in der deutschen Sprache, unter Berücksichtigung des althochdeutschen, des mittelhochdeutschen und des frühneuhochdeutschen Satzbaus‹.
In einem seiner fünf Arbeitszimmer türmen sich, in Kisten und Kästen gestapelt, die auf dieses Thema bezüglichen Exzerpte aus den Werken älterer und neuerer Schriftsteller, und an der Tür des Konjunktiv-Zimmers hängt ein Schild mit der drohenden Aufschrift: »Consecutio temporum!«
An der Nebentür liest man: »Antike und Christentum!« Und auch hinter dieser Tür stehen randvoll beladene Schränke, Kisten und Kästen. Hier birgt Georg die Ergebnisse und Erkenntnisse für das von ihm geplante Fundamentalwerk ›Über die mutierenden Einflüsse der Antike und des Christentums auf die mitteleuropäische Kunst und Kultur‹.
Soviel ich verstanden habe, handelt es sich um die Darstellung des Verlaufs zweier eingeschleppter Krankheiten, die seit je, manchmal gleichzeitig, manchmal zyklisch auftretend, an einem Organismus namens Mitteleuropa zehren. Ungefähr seit dem Jahr 1000 p.Chr.n. sei der genannte geographische Bezirk für den Kulturhistoriker ein pathologischer Fall, behauptet Georg.
Der arme Mensch!
An der dritten Tür steht das Wort »Stenographie!« Georg arbeitet seit zehn Jahren an einer funkelnagelneuen Kurzschrift, welche die Mängel der bisherigen Systeme beseitigen und unabsehbare Vorzüge hinzufügen soll. Georgs Augenmerk richtet sich auf die Erhöhung der pro Minute schreibmöglichen Silbenzahl, und zwar mit Hilfe der Methode, ganze Sätze in einem ununterbrochenen Schriftzuge niederzuschreiben. Er glaubt zuversichtlich, dass man dann in der Minute bequem wird dreihundert Silben stenographieren können. Da nun auch der hastigste Redner nicht mehr als zweihundertfünfzig Silben spricht, leuchtet mir die Bedeutung des Projekts, dreihundert zu schreiben, freilich nicht ganz ein. Aber Georg hat sich in die Sache verrannt. Er ist ein Sisyphus, der sich freiwillig gemeldet hat.
Es wird niemanden überraschen, dass auch diese Arbeit noch in den Kinderschuhen steckt.
Der Wortlaut der übrigen Türschilder ist mir nicht gegenwärtig. Eins aber steht fest: In jedem der fünf Arbeitszimmer befindet sich, außer den einschlägigen Büchern, den Schränken, Kisten und Kästen, je ein Schreibtisch.
Fünf Schreibtische also, fünf Schreibtischstühle, fünf Tintenfässer, fünf Schreibblocks und fünf Terminkalender! Und so wandert denn Georg, der Unheimliche, zwischen seinen unvollendeten Lebenswerken, bald an dem einen, bald am andern arbeitend, äußerst gedankenvoll hin und her. Die Sekretärin, die er hat und »die kleine Tante« nennt, macht einen leicht verwirrten Eindruck. Das ist verzeihlich.
Glücklicherweise kann Georg es sich leisten, seinen kostspieligen geistigen Begierden nachzugeben. Er ist der Miterbe einer sehr großen Fabrik, in der Badewannen aus Zink hergestellt werden; Wannen, in denen man sitzen, Wannen, in denen man liegen, und winzige Wannen, in denen man kleine Kinder ein- und abseifen kann. Die Fabrik liegt in einem romantischen deutschen Mittelgebirge; und der ältere Bruder, der das blühende Unternehmen leitet, zahlt Georg jede Summe, vorausgesetzt, dass dieser den Zinkbadewannen fernbleibt.
Georg bleibt fern.
Er wohnt in Berlin und kommt selten aus seinen fünf Studierzimmern heraus. Im vergangenen Spätsommer, da verließ »Doktor Fäustchen«, wie wir ihn nennen, allerdings den Konjunktiv, die Antike, die Stenographie und das Christentum, um sich zu erholen. Als er, einige Wochen später, zurückkam, drückte er mir das Tagebuch in die Hand, das er während der Ferien geführt hatte. Es ist begreiflich, dass ein Mann wie er nicht hatte untätig sein können; und ich fand’s erfreulich, dass er endlich einmal eine Arbeit, wenn auch nur ein Ferientagebuch, zu Ende gebracht hatte.
Ich las das Manuskript und schickte es meinem Verleger. Dem gefiel’s, und er ließ es drucken. Ihn und mich würde es freuen, wenn das Buch auch dem Publikum gefiele.
Erich KästnerBerlin, Sommer 1938
P.S. Mein Freund Georg hat übrigens keine Ahnung, dass sein Tagebuch gedruckt worden ist, und wird aus allen Wolken fallen.
Vorrede an den Verfasser
Mein lieber Georg!
Du hast keine Ahnung, dass Dein Tagebuch gedruckt worden ist, und wirst aus allen Wolken fallen. Ich besaß Deine Erlaubnis nicht, das Manuskript aus der Hand, geschweige in Druck zu geben. Doch was willst Du? Warum sollst Du es besser haben als andere Schriftsteller?
Ich hoffe, dass Dir das einleuchtet. Immerhin bin ich, ehrlich gestanden, froh, dass Du, während das Buch erscheint, nicht in Berlin, sondern auf Ceylon weilst. Die Vorstellung, die ich mir von Deiner Überraschung mache, genügt meinem Sensationshunger vollkommen. Der Erfahrung kann ich in diesem Falle, wie auch in vielen anderen Fällen, durchaus entraten. Möge Dein Zorn, bis Du heimkehrst, verraucht sein und womöglich der sanften Genugtuung darüber Platz gemacht haben, so dass Du ohne eigenes Zutun begonnen hast, ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft zu werden.
Grüße Deine junge Frau von mir! Es ist mir nach wie vor unverständlich, dass dieses hinreißende Geschöpf Dich heiraten konnte. Gewiss, Du bist gescheit, gesund, wohlhabend, hübsch, ein bisschen verrückt und von heiterem Gemüte – aber sind das ausreichende Gründe? Doch ich ahne, woran es zuletzt gelegen hat, dass sie Dich nahm. Du wirst gefragt haben, ob sie Dich nehmen wolle! (Ich vergesse jedes Mal zu fragen und werde demzufolge Junggeselle bleiben. Denn wenn man in den Wald nicht hineinruft, braucht man sich nicht zu wundern – doch Du weißt schon, was ich sagen will.)
Eurer baldigen Heimkunft sieht in edler Fassung entgegen
Euer Erich
P.S. In den Briefen des J.M.R. Lenz habe ich einige Konjunktivsätze gefunden, die Dich interessieren werden. Ich habe sie der kleinen Tante zur Abschrift gegeben, und Du kannst das Exzerpt zu den übrigen legen, falls in Deinen Kisten noch Platz ist.
N.B. Als Schriftsteller und Mensch wirst Du mit Befriedigung feststellen, dass der Wortlaut Deines Manuskriptes nicht angetastet worden ist. Ich habe mir lediglich erlaubt, das Tagebuch durch Kapitelüberschriften zu gliedern.
Entschuldige, Fäustchen!
Das Salzburger Tagebuch des Georg Rentmeister oderDer kleine Grenzverkehr
Geschrieben im August und September des Jahres 1937 (nach Christi Geburt)
Motto: »Hic habitat felicitas!«[*]
Die Vorgeschichte
Karl hat mir aus London geschrieben und fragt, ob ich ihn Mitte August in Salzburg treffen will. Er ist von der Leitung der Salzburger Festspiele eingeladen worden, da man ihn fürs nächste Jahr als Bühnenbildner gewinnen möchte. Diesmal wollen sie sich ihn und er soll sich einige Aufführungen anschauen. Man hat ihm für eine Reihe von Stücken je zwei Karten in Aussicht gestellt. Ich war lange nicht im Theater und werde fahren.
Ich darf nicht vergessen, ein Devisengesuch einzureichen. Denn da Salzburg in Österreich liegt, muss ich die Grenze überschreiten; und wer zur Zeit die Grenze überschreitet, darf, pro Monat, ohne weitere Erlaubnis höchstens zehn Reichsmark mitnehmen. Nun habe ich mathematisch einwandfrei festgestellt, dass ich in diesem Fall an jedem Tag – den Monat zu dreißig Tagen gerechnet – genau 33,3333 Pfennige ausgeben kann, noch genauer 33,3333333 Pfennige. Was zu wenig ist, ist zu wenig! Das Gesuch um die Bewilligung einer größeren Summe ist unerlässlich. Ich werde es noch heute der kleinen Tante diktieren und abschicken.
Karl ist schon seit Tagen in Salzburg und hat, ungeduldig wie er ist, depeschiert. Er will wissen, warum ich noch nicht dort bin und wann ich wohl eintreffe. Daraufhin habe ich die Devisenstelle angerufen und mich erkundigt, ob ich in absehbarer Zeit auf eine Beantwortung meines Gesuchs rechnen könne; ich bäte, meine Neugierde zu entschuldigen, aber die Salzburger Festspiele gingen programmgemäß am 1. September zu Ende. Der Beamte hat mir wenig Hoffnung gemacht. Die Gesuche, meinte er, türmten sich in den Büros; und es gäbe begreiflicherweise dringlichere Anträge als solche von Vergnügungsreisenden. Nun habe ich also die Erlaubnis des Wehrkreiskommandos und die der Passstelle: Ich darf für vier Wochen nach Österreich.
Doch was nützt mir das, solange ich nur zehn Mark mitnehmen kann?
Karl bombardiert mich mit Depeschen. Ob ich glaubte, dass die Festspiele meinetwegen verlängert würden, telegrafiert er, und er sei bereit, mit Toscanini wegen einer Prolongation zu verhandeln; ich müsse nur noch angeben, wann ich genauestens zu kommen gedächte; ob schon im November oder erst im Dezember.
Was kann ich tun? Die Devisenstelle hat noch keinen Bescheid geschickt. Und ich traue mich nicht, schon wieder anzurufen. Die Leute haben schließlich andre Dinge im Kopf als meine Ferien.
Erich hat mich auf eine Idee gebracht, die nicht übel ist. Ich habe anschließend mit dem Hotel Axelmannstein in Bad Reichenhall telefoniert und ein Zimmer mit Bad bestellt. Ich kenne das Hotel von früher. Sehr komfortabel; Golfplatz, Schwimmbad, Tennisplätze, alles im Hause. Um die Fahr- und Bettkarte ist die kleine Tante unterwegs. Sie ist auch angewiesen, mir die Antwort der Devisenstelle nachzusenden. Heute Abend kann die Reise losgehen.
Der Plan
Mir ist recht verschmitzt zumute. Es ist Nacht. Der Zug donnert durch Franken. Ich liege im Bett, trinke eine halbe Flasche Roten, rauche und freue mich auf Karls dummes Gesicht.
Er wird kein klügeres ziehen als vor wenigen Stunden der alte Justizrat Scheinert am Anhalter Bahnhof. »Hallo, Doktor«, rief er, als er mich sah, »wo fahren Sie denn hin?«