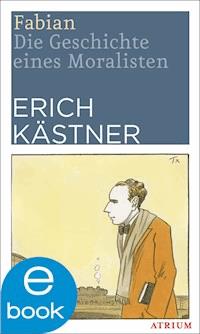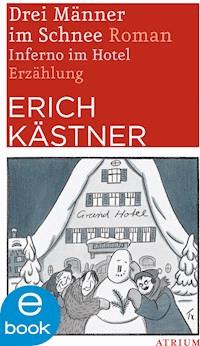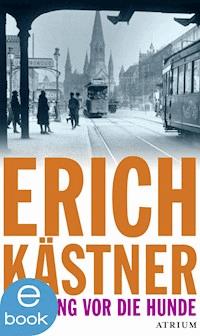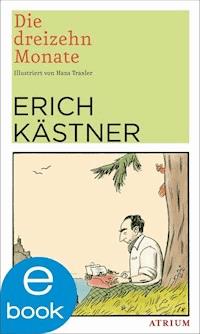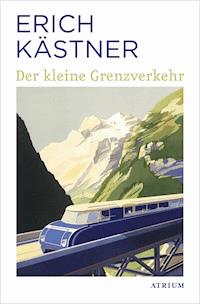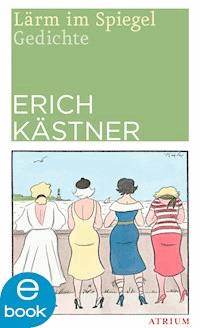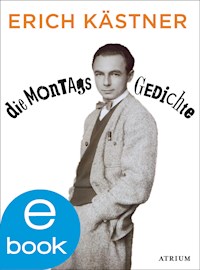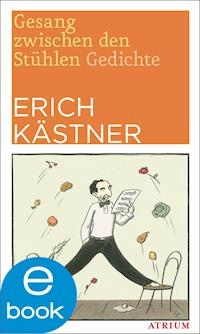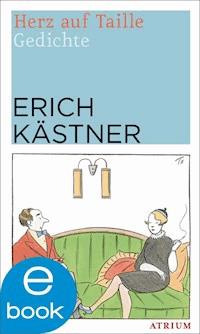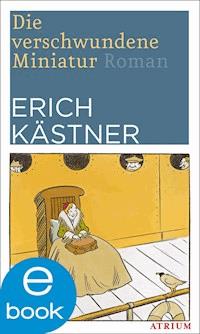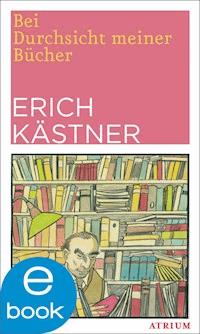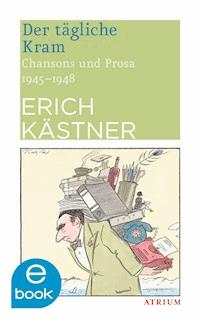
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Zürich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1945: Deutschland liegt in Trümmern - und Erich Kästner setzt sich wieder an den Schreib- tisch. Seine brillanten Satiren und feinfühligen Reportagen über "den täglichen Kram" bilden ein einzigartiges Kaleidoskop des Lebens in Deutschland in den Jahren nach dem Zusammenbruch. Kurz nach Ende des Krieges übernimmt Erich Kästner die Leitung des Feuilletons der Neuen Zeitung in München; er gibt die Zeitschrift Pinguin heraus und schreibt für Kabarett und Hörfunk. Mit seinen Texten aus dieser Zeit - Glossen, Kritiken, Chansons, Szenen, Tagebuchnotizen - erweist sich Erich Kästner einmal mehr als hellwacher Chronist deutscher Nachkriegsgeschichte, der in seinen Betrachtungen des "täglichen Krams" immer wieder auf Erhellendes und Erschreckendes, Unerhörtes und Ungeheuerliches stößt. "Es handelt sich um eine bunte, um keine willkürliche Sammlung. Sie könnte, im Abglanz, widerspiegeln, was uns in den drei Jahren nach Deutschlands Zusammenbruch bewegte. Worüber man nachdachte. Worüber man lächelte. Was uns erschütterte. Was uns zerstreute." Erich Kästner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kleine Chronologie statt eines Vorworts
März 1945
Mit einem Handkoffer, einem Rucksack, einer Manuskriptmappe, einer Reiseschreibmaschine und einem Regenschirm fort aus Berlin. Sogar mit den erforderlichen Ausweisen. Als angebliches Mitglied einer Filmproduktionsgruppe, die in Tirol angeblich Aufnahmen machen will. Die Russen stehen bei Küstrin. Die Nationalsozialisten errichten, in voller Uniform und in vollem Ernst, geradezu kindische Straßensperren. Nachtfahrt über Potsdam, Dessau, Bamberg nach München. Beiderseits der Autobahn von Tieffliegern lahmgeschossene Fahrzeuge. Unterwegs, vier Uhr morgens, beginnt der Wagen zu brennen. Wir löschen mit Schnee. Auf einem Gut bei München schieben wir das angebratene Auto in eine Scheune. Mit der Eisenbahn geht es weiter. In Innsbruck Luftwarnung. Die Innsbrucker wandern, mit Klappstühlchen und Ruhekissen, in die Felshöhlen. Wie Tannhäuser in den Hörselberg.
April 1945
Der Ortsgruppenleiter von Mayrhofen im Zillertal beordert die dreißig Männer der Filmgruppe – Architekten, Schreiner, Kameraleute, Autoren, Friseure, Schauspieler, Dramaturgen, Beleuchter, Aufnahmeleiter, Tonmeister – zum Volkssturm nach Gossensaß in Südtirol. Er tut’s auf besonderes Betreiben der Direktion des ins Hochgebirge »ausgewichenen« Lehrerinnenseminars, das die Hotels bevölkert. Die energische Pädagogin ist mit dem Gauleiter Hofer befreundet, der in Bozen residiert. Obwohl der Kontakt mit Berlin unterbrochen ist, gelingt es dem Produktionsleiter, unsere Einberufung rückgängig zu machen. Wir kaufen von den Bauern fürs letzte Geld Butter in gelben Klumpen und zehnpfundweise Schweizerkäse. Nur das Brot ist knapp. Lottchen strickt für eine Kellnerin Wadenstrümpfe mit Zopfmuster. Die Kellnerin beschafft uns Brot. Wir bewundern den Bergfrühling, pflücken Enzian und Trollblumen und treffen die ersten über die Pässe herunterkletternden Soldaten der am Po endgültig geschlagenen deutschen Südarmee. Der Bürgermeister und der Ortsgruppenleiter kommen abends ins Haus, um unserer Wirtin mitzuteilen, dass nun auch ihr letzter Sohn gefallen ist. Sie und die Tochter schreien die halbe Nacht. Wie Tiere im brennenden Stall. Dann wirft die Mutter das Hitlerbild in den Vorgarten. Im Morgengrauen holen sie es wieder herein.
Mai 1945
Großdeutschland hat kapituliert. Der Ortsgruppenleiter ist über Nacht spurlos verschwunden. Die Seminardirektorin hat sich, auf einem Hügel vorm Ort, mit vier Kolleginnen und Kollegen umgebracht. Die Verdunkelung wird aufgehoben. Als wir abends durch die erleuchteten Gässchen gehen, sehen wir hinter den hellen Fenstern die Bäuerinnen an der Nähmaschine. Sie haben das Hakenkreuz aus den Fahnen herausgetrennt und nähen weiße Betttücher neben die rote Bahn. Denn Weiß-Rot sind die Farben der österreichischen Freiheitspartei. Zwei amerikanische Panzer halten beim Kramerwirt, der nun, als Freund Schuschniggs, Bürgermeister geworden ist. Immer mehr deutsche Soldaten kommen über die Berge. Die Pfade zu den Schneegipfeln sind mit fortgeworfenen Waffen, Orden und Rangabzeichen besät. Teile der »Rainbow-Division« übernehmen die militärische Verwaltung des Tals. Beim Kramerwirt verhandeln Offiziere des Stabs der Wlassow-Armee, der nach Hintertux geflüchtet ist, mit einem amerikanischen Obersten wegen der Übergabe. Wir müssen uns in der Dorfschule melden und werden von amerikanischen Soldaten registriert. Auf einem einsamen Waldspaziergang begegnen wir einem riesigen Negersergeanten, der, ein aufgeklapptes Messer vorsorglich in der Hand haltend, vergnügt »Grrrüß Gott!« ruft. Die Lokalbahn fährt nicht mehr. Die Seminaristinnen wandern, ihre schweren Koffer schleppend, talab. Endlich dürfen sie heim. Nach Innsbruck. Zum Brenner. Ins Pustertal.
Juni 1945
Unsere Bewegungsfreiheit ist sehr beschränkt. Unsere neuen Ausweise gelten nur fünf Kilometer im Umkreise. Überall stehen Schilderhäuser und Kontrollposten. Der Briefverkehr hat aufgehört. Wir sind isoliert. Die Radioapparate sind umlagert. Was soll werden? Unsere Filmhandwerker bauen sich Wägelchen für ihr Gepäck. Schlimmstenfalls wollen sie nächstens zu Fuß nach Berlin zurück. Zu ihren Kindern und Frauen. Und zu den Russen. Aus Innsbruck fahren amerikanische Spezialisten vor und beschlagnahmen das gesamte Filminventar. Kurz darauf tauchen in verstaubten Jeeps die ersten Amerikaner und Engländer aus München auf. Es sind Kulturfachleute, Emigranten darunter. Alte Kollegen. Sie fahren kreuz und quer durchs Land und suchen festzustellen, wer von uns den Krieg überlebt hat, sowie, wer nach ihrer Meinung wert ist, ihn überlebt zu haben.
Juli 1945
Ich fahre, auf nicht ganz legale Art, in die Nähe von München. Zu fachlichen Besprechungen. Wildes Plänemachen und heftiges Misstrauen lösen einander ab. Ewig kehrt die Frage wieder: »Warum sind Sie nicht emigriert, sondern in Deutschland geblieben?« Dem, der es nicht versteht, kann man’s nicht erklären. Anschließend acht Tage vergeblichen Wartens, auf einem Gut im Dachauer Moos, dass das Auto aus Tirol zurückkommt. Eisenbahn, Post, Telegraf, Telefon – alles ist tot. Gäste und Gastgeber werden nervös. Endlich fährt der Wagen in den Hof. Nun geht’s wieder hinauf in die Zillertaler Alpen. Die Filmgruppe befindet sich in Auflösung. Es ist kein Geld da. Die Firma existiert nicht mehr. Der Produktionsleiter fährt heimlich fort, um irgendwo Geld aufzutreiben. Er wird unterwegs verhaftet. Monatelang wird man von ihm nichts mehr hören. Die Berliner Filmschreiner, Filmschlosser, Friseure, Elektrotechniker und Schneider verdingen sich. Verdienen ihren Unterhalt mit Feldarbeit. Oder als Handwerker. Oder als Zwischenhändler von Zigaretten, Butter, Käse und Kaffee. Die Zillertaler sind ungeduldig. Wenn wir Kurgäste wären, ja, aber so? Hinaus mit den Berlinern, der alte, ewig junge Schlachtruf ertönt. Im Rathaus erscheinen zwei französische Offiziere. Die Amerikaner übergeben Tirol den Marokkanern, heißt es. Auf einen Lastwagen gepfercht, mit einer hoffentlich noch gültigen Order, verlassen wir die Zillertaler Alpen und rattern, über Kufstein, ins Bayrische.
August 1945
Zwischenstation am Schliersee. Keine Verbindung mit Berlin, Leipzig, Dresden, nicht einmal mit München. Es ist, als läge die übrige Welt auf dem Mond. Mein letztes Paar Schuhe ist hin. Ein abgemusterter deutscher Leutnant hilft mir aus. Ein amerikanischer Sergeant, Pelzhändler von Beruf, freundet sich mit uns an. Er erzählt von Kanada und Alaska, von Pelzjägern, Hundeschlitten und Eskimobräuchen. Unser letztes Geld ist bis zum allerletzten Geld zusammengeschrumpft. Wir stecken hilflos fest, wie Nägel in einer Wand. Wer wird uns herausziehen? Und wann? Da, eines Tages, hält ein wackliges Auto vor dem Bauernhaus. Man holt uns für ein paar Tage nach München. Einige Schauspieler wollen dort ein Kabarett eröffnen. Daraus wird, wie sich bald zeigt, nichts werden. Wenn sich alle Pläne dieser Wochen verwirklichten, gäbe es bald mehr Kabaretts und Theater als unzerstörte Häuser. Immerhin, wir sind endlich wieder in einer Großstadt. Schliersee sieht uns auf Jahre hinaus nicht wieder.
September 1945
München ist »der« Treffpunkt derer geworden, die bei Kriegsende nicht in Berlin, sondern in West- oder Süddeutschland steckten. Mitten auf der Straße fallen sie einander um den Hals. Schauspieler, Dichter, Maler, Regisseure, Journalisten, Sänger, Filmleute – tags und abends stehen sie im Hof der Kammerspiele, begrüßen die Neuankömmlinge, erfahren Todesnachrichten, erörtern die Zukunft Deutschlands und der Zunft, wollen nach Berlin, können’s nicht, wägen ab, ob’s richtiger sei, hier oder in Hamburg anzufangen. In den Kammerspielen etabliert sich, zunächst noch sehr improvisiert, das Kabarett »Die Schaubude«. In der Reitmorstraße beginnt man, ein zerbombtes Theater für kommende Programme herzurichten. Die Stadt und der Staat ernennen Intendanten für erhaltene und noch im Bau befindliche Bühnen. Alle Welt scheint am Werke, einen Überfrühling der Künste vorzubereiten. Dass man wie die Zigeuner leben muss, hinter zerbrochnen Fenstern, ohne Buch und zweites Hemd, unterernährt, angesichts eines Winters ohne Kohle, niemanden stört das. Keiner merkt’s. Das Leben ist gerettet. Mehr braucht’s nicht, um neu zu beginnen. Die ersten Briefe von zu Hause treffen ein. Nicht per Post. Sie werden hin- und hergeschmuggelt. Die Besorgung eines Briefes nach Berlin oder Dresden kostet zwanzig bis fünfzig Mark. Es ist ein neuer Beruf. Manche dieser geheimnisvollen Boten stecken das Geld ein und die Post ins Feuer. Hans Habe kreuzt auf. Als amerikanischer Captain. Er soll, in den Restgebäuden des »Völkischen Beobachters«, im Auftrage der Militärregierung eine Millionenzeitung für die amerikanische Zone starten. Ob wir die Feuilletonredaktion übernehmen wollen? Einverstanden. Im Auto fahren wir im Land umher und trommeln Mitarbeiter zusammen. Wo kriegen wir Bücher her? Woher ein Archiv? Woher einen Musikkritiker? Woher ausländische Zeitschriften? Wir arbeiten Tag und Nacht. Es geht zu wie bei der Erschaffung der Welt. Besprechungen in Stuttgart wegen der Gründung einer Jugendzeitschrift. Wegen des Neudrucks von im Jahre 1933 verbrannten Büchern. In der Reitmorstraße wächst die »Schaubude« Stein um Stein. Auf geht’s!
Am 18. Oktober 1945 erschien die erste Nummer der »Neuen Zeitung«. Am 1. Januar 1946 erschien bei Rowohlt in Stuttgart das erste Heft des »Pinguin«, unserer Jugendzeitschrift. Wenig später eröffneten wir mit einem neuen Programm das Kabarett »Die Schaubude« im eigenen Haus.
Das vorliegende Buch enthält eine Auswahl aus meinen zahlreichen Beiträgen für die »Neue Zeitung«, den »Pinguin« und die »Schaubude« aus den Jahren 1945 bis 1948. Chansons, Couplets, Glossen, Kritiken, Attacken, Märchen, Szenen, Tagebuchnotizen, Lieder, Aufsätze, Leitartikel, Repliken, Umfragen. Es handelt sich um eine bunte, um keine willkürliche Sammlung. Sie könnte, im Abglanz, widerspiegeln, was uns in den drei Jahren nach Deutschlands Zusammenbruch bewegte. Worüber man nachdachte. Worüber man lächelte. Was uns erschütterte. Was uns zerstreute. Gelegentlich werden kurze Kommentare die Absicht des Buches unterstützen. Dem gleichen Zwecke dient die chronologische Reihenfolge der Arbeiten.
Erich Kästner
Herbst 1948,
noch immer zwischen
Krieg und Frieden.
(Im Oktober 1945 in der »Neuen Zeitung«.) Dieser nach zwei Seiten durchgeführte Angriff war dringend notwendig. Überall fehlte es an den richtigen Männern am richtigen Platz.
Talent und Charakter
Als ich ein kleiner Junge war – und dieser Zustand währte bei mir ziemlich lange –, glaubte ich allen Ernstes folgenden Unsinn: Jeder große Künstler müsse zugleich ein wertvoller Mensch sein. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass bedeutende Dichter, mitreißende Schauspieler, herrliche Musiker im Privatleben sehr wohl Hanswürste, Geizhälse, Lügner, eitle Affen und Feiglinge sein könnten. Die damaligen Lehrer taten das Ihre, diesen holden »Idealismus« wie einen Blumentopf fleißig zu begießen. Man lehrte uns zusätzlich die Weisheit des alten Sokrates, dass der Mensch nur gescheit und einsichtsvoll genug zu werden brauche, um automatisch tugendhaft zu werden. So bot sich mir schließlich ein prächtiges Panorama: Ich sah die Künstler, die gleichzeitig wertvolle Menschen und kluge Köpfe waren, ich sah sie dutzend-, ja tausendweise in edler Vollendung über die Erde wallen. (Damals beschloss ich, Schriftsteller zu werden.)
Später boten sich mir dann in reichem Maße vortreffliche Gelegenheiten, meinen schülerhaften Köhler- und Künstlerglauben gründlich zu revidieren. Es dauerte lange, bis ich den damit verbundenen Kummer verwunden hatte, und noch heute, gerade heute, bohrt er manchmal wieder, wie der Schmerz in einem Finger oder einer Zehe bohren soll, die längst amputiert worden ist.
Als mich im Jahre 1934 der stellvertretende Präsident der Reichsschrifttumskammer, ein gewisser Doktor Wißmann, in sein Büro zitierte und sich erkundigte, ob ich Lust hätte, in die Schweiz überzusiedeln und dort, mit geheimen deutschen Staatsgeldern, eine Zeitschrift gegen die Emigranten zu gründen, merkte ich, dass er über den Zusammenhang von Talent und Charakter noch rigoroser dachte als ich. Er schien, durch seine Erfahrungen im Ministerium gewitzigt, geradezu der Ansicht zu sein, Talent und Charakter schlössen einander grundsätzlich aus.
Glücklicherweise hatte dieser goldene Parteigenosse nicht recht. Es gab und gibt immer begabte Leute, die trotzdem anständige Menschen sind. Nur eben, sie sind selten und seltener geworden. Die einen verschlang der Erste Weltkrieg. Andere flohen ins Ausland, als Hitler Hindenburgs Thron bestieg. Andere blieben daheim und wurden totgeschlagen. Viele fraß der Zweite Weltkrieg. Manche liegen noch heute, zu Asche verbrannt, unter den Trümmern ihrer Häuser. – Der Tod, der den Stahlhelm trägt und die Folterwerkzeuge schleppt, gerade dieser Tod hat eine feinschmeckerische Vorliebe für die aufrechten, begabten Männer.
Und nun, wo wir darangehen wollen und darangehen dürfen und darangehen müssen, neu aufzubauen, sehen wir, dass wir angetreten sind wie eine ehemals stattliche Kompanie, die sich, acht Mann stark, aus der Schlacht zurückmeldet.
Aber wir bemerken noch etwas. Wir beobachten Zeitgenossen, die der frommen Meinung sind, der Satz: »Es gibt Talente mit Charakter!« ließe sich abwandeln in einen anderen, ebenso schlüssigen Satz, welcher etwa lautet: »Aufrechte Männer sind besonders talentiert!« Das wäre, wenn es häufig zuträfe, eine musterhafte, meisterhafte Fügung des Schicksals. Der Satz ist nur leider nicht wahr. Wer ihn glaubt, ist abergläubisch. Und dann gibt es einen weiteren gefährlichen Irrtum. Einen Irrtum, der, von vielen begangen, vielerlei verderben könnte, auch wenn man ihn gutgläubig beginge. Ich meine die Mutmaßung, gerade diejenigen, die mit eiserner Beharrlichkeit auf ihre besondere Eignung für wichtige Stellungen im Kulturleben hinweisen, seien tatsächlich besonders geeignet! Man darf solchen Leuten nicht unbedingt glauben. Sie täuschen sich womöglich in sich selber. So etwas kommt vor. Oder sie gehören zu den Konjunkturrittern, die, wenn ein Krieg vorbei und verloren ist, klirrend ins Feld zu ziehen pflegen!
Nicht so sehr ins Feld wie in die Vor- und Wartezimmer. Sie hocken auf den behördlichen Stühlen wie sattelfeste, hartgesottene Kavalleristen. Nicht jeder Künstler ist ein solcher Stuhl- und Kunstreiter. Gerade viele der Besten haben weder die Zeit noch die Neigung, Rekorde im Sich-Anbieten aufzustellen. Es widert sie an, vor fremden Ohren ihr eigenes Loblied zu singen. Sie pfeifen aufs Singen und arbeiten lieber daheim als im Schaufenster. Das ist aller Ehren wert und dennoch grundfalsch und eine Sünde.
Diese weiße Weste soll für uns keine Ordenstracht sein und auch keine neue Parteiuniform, sondern eine Selbstverständlichkeit. Sowenig wie die Qualität des Sitzfleisches ein Gesichtspunkt für die Verleihung verantwortlicher Stellungen sein darf, sowenig darf Heinrich Heines Hinweis unbeachtet bleiben, dass es auch unter braven Leuten schlechte Musikanten gibt. Denn schlechte Musikanten, und wenn sie noch so laut Trompete blasen, können wir nicht brauchen. Man soll ihnen meinetwegen die weiße Weste 2. Klasse oder die weiße Weste 1. Klasse verleihen, oder die weiße Weste mit Eichenlaub, an einem weißen Ripsband um den Hals zu tragen! Das wird sie freuen und tut keinem weh.
Aber mit wichtigen Schlüsselstellungen darf man ihre saubere Gesinnung und Haltung nicht belohnen. Für solche Späße ist die Zeit zu ernst. Nicht die Flinksten, nicht die Ehrgeizigsten, auch die nicht, die nichts als brav sind, sollen beim Aufbau kommandieren, sondern die tüchtigsten Kommandeure! Menschen, die außer ihrer weißen Weste das andere, das Unerlernbare, besitzen: Talent!
Sie müssen ihr Zartgefühl überwinden. Erwürgen müssen sie’s. Vortreten müssen sie aus ihren Klausen. Aufspringen müssen sie von ihren Sofas. Hervorschieben müssen sie sich hinter ihren Öfen, in denen das selbst geschlagene Holz behaglich knistert.
Jetzt geht es wahrhaftig um mehr als um privates Zartgefühl oder gar ums Nachmittagsschläfchen! Es ist Not am Mann. Es geht darum, dass auf jedem Posten der tüchtigste Mann steht. Es geht darum, dass die tüchtigsten Männer Posten stehen!
(Weihnachten 1945 in der »Neuen Zeitung«, Kinderbeilage.) Hier wäre allenfalls darauf hinzuweisen, dass dieser Abend für Millionen Deutsche gleich schmerzlich verlief und dass das Feuilleton nur deshalb geschrieben wurde.
Sechsundvierzig Heiligabende
Fünfundvierzigmal hintereinander hab ich mit meinen Eltern zusammen die Kerzen am Christbaum brennen sehen. Als Flaschenkind, als Schuljunge, als Seminarist, als Soldat, als Student, als angehender Journalist, als verbotener Schriftsteller. In Kriegen und im Frieden. In traurigen und in frohen Zeiten. Vor einem Jahr zum letzten Mal. Als es Dresden, meine Vaterstadt, noch gab. Diesmal werden meine Eltern am Heiligabend allein sein. Im Vorderzimmer werden sie sitzen und schweigend vor sich hinstarren. Das heißt, der Vater wird nicht sitzen, sondern am Ofen lehnen. Hoffentlich hat er eine Zigarre im Mund. Denn rauchen tut er für sein Leben gern. »Vater hält den Ofen, damit er nicht umfällt«, sagte meine Mutter früher. Mit einem Male wird er »Gute Nacht« murmeln und klein und gebückt, denn er ist fast achtzig Jahre alt, in sein Schlafzimmer gehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!