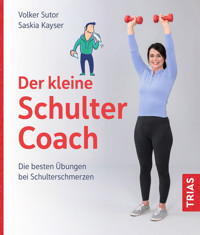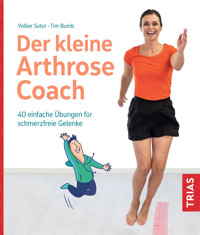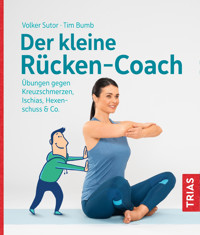21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TRIAS
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Der kleine Coach
- Sprache: Deutsch
Hüftbeschwerden aktiv angehen
Schmerzen und Beschwerden in der Hüfte können verschiedene Ursachen haben und große Probleme bereiten. Dann lautet die Diagnose häufig: Coxarthrose, Schleimbeutelentzündung oder Sportlerleiste. Doch Betroffene können ihre Hüftprobleme selbst in die Hand nehmen, weil diese von vielen Faktoren abhängig sind, die sie selbst beeinflussen können. Um die Beschwerden wieder in den Griff zu bekommen, hilft ein regelmäßig und konsequent durchgeführtes Programm aus gezielter Bewegung und Belastung.
Und hier kommt der kleine Coach ins Spiel, der es Ihnen einfach macht, konsequent dranzubleiben:
- Wissen, das hilft: Warum bereitet die Hüfte so oft Probleme? Was kann ich selbst tun? Was ist bei akuten und chronischen Beschwerden sinnvoll?
- Individuelles Training: Wie fit ist Ihre Hüfte und wo sitzen Ihre Probleme? Entdecken Sie das für Sie passende Übungsprogramm!
- Übungen mit Extra-Motivation: Der kleine Coach zeigt passende Übungen, gibt hilfreiche Tipps und motiviert Sie. So kommen auch Couch Potatoes in Bewegung.
Kleiner Coach, großer Motivator!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der kleine Hüft-Coach
Die besten Übungen bei Beschwerden in Hüftgelenk, Muskeln und Sehnen
Volker Sutor, Saskia Kayser
1. Auflage 2026
120 Abbildungen
Liebe Leserin, lieber Leser,
egal, ob wir gehen, laufen, springen, uns anziehen oder aufstehen möchten – wir brauchen unsere Hüfte ständig. Viele Menschen in allen Altersklassen kämpfen mit Hüftproblemen. Der kleine Hüft-Coach unterstützt Sie durch wertvolle Tipps und Tricks dabei, Ihre Hüftschmerzen anzugehen. Patientinnen und Patienten, die sich auch selbst helfen können, zeigen in Untersuchungen eine höhere Zufriedenheit und bessere Ergebnisse.
Erfahren Sie in diesem Buch, wie die Hüfte funktioniert und warum sie so häufig Beschwerden macht. Verstehen Sie, warum es zu akuten und chronischen Hüftbeschwerden kommen kann und wie Sie diese selbst positiv beeinflussen können.
Wer seine Beschwerden nachhaltig in den Griff bekommen möchte, sollte langfristig seinen Lebensstil verändern und konsequent trainieren. Der kleine Coach gibt Ihnen praktikable Tipps, wie Sie Ihren Alltag optimieren können, sowie zahlreiche Anregungen, wie Sie Ihr Training optimal steuern können.
Testen Sie, wie fit Ihre Hüfte ist und wo Ihre Potentiale liegen. Entdecken Sie darauf basierend die für Sie passenden Übungen. Da alle Übungen mit Alltagsgegenständen umsetzbar sind, können Sie diese direkt in Ihr Leben integrieren. Beobachten Sie langfristig mithilfe des Trainingstagebuchs Ihre Fortschritte.
Werden Sie selbst aktiv!
(Quelle: © H. Münch/Thieme)
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Liebe Leserin, lieber Leser,
Hintergründe von Hüftproblemen
Sie sind nicht allein!
Wer ist hauptsächlich betroffen?
Persönliche Probleme
Die generelle Gesundheit leidet
Individuelle Anforderungen im Alltag
Ein »0815«-Programm reicht nicht aus
Wann ist ein Besuch beim Arzt angesagt?
Bildgebung
Wann sind Bilder sinnvoll?
Das Gesamtbild
Zusammenhang mit den Beschwerden
Aufbau und Funktion der Hüfte
Das Hüftgelenk
Knochen, Knorpel und Bänder
Muskeln und Sehnen
Warum die Hüfte so häufig Probleme macht
Bewegung und Belastung fehlen
Fehlender Ausgleich und Überlastung
Zusammenhang mit Problemen aus anderen Gelenken
Die Gelenkanlage der Hüfte
Krankheitsbilder
Adduktorenbedingter Leistenschmerz
Hüftbeuger-/iliopsoasbedingter Leistenschmerz
Bauchmuskelbedingter Leistenschmerz
Hüftbedingter Leistenschmerz
Impingement
Dysplasie
Schambeinbedingter Leistenschmerz
Inguinalassoziierter Leistenschmerz
Übungen als Therapie der Wahl
Durch Organe
Durch Tumoren und Metastasen
Hüft-/Coxarthrose
Probleme
Entstehungsmechanismen
Therapie
Künstliches Hüftgelenk (Totalendoprothese)
Wie lange hält die neue Hüfte?
Wann ist der optimale Operationszeitpunkt?
Nachbehandlung
Meilensteine
Faktoren, die Hüftschmerzen beeinflussen
Das biomechanische Denkmodell reicht nicht aus
Die fünf Bereiche des Treibermodells
Nozizeptive Treiber
Neuropathische Treiber
Komorbiditätstreiber
Kognitiv-emotionale Treiber
Kontexttreiber
Ernährung
Der Eatwell-Guide
Eiweiß
Wundheilung
Die Phasen der Wundheilung
1. Entzündungsphase
2. Proliferationsphase
3. Reparationsphase
Einflussfaktoren auf die Heilung
Mit dem Thermometer die Heilung verfolgen
Welche Konsequenz hat die Temperaturmessung für mich?
Entzündungsphase
POLICE
Umgang mit akuten Schmerzen
Schmerzampel
Muskelkater
Schmerzmittel
Mentales Training
Training des gesunden Beines
Ausdauer- und Krafttraining
BFR-Training
Proliferationsphase
Ausdauertraining
Koordinationstraining
Gleichgewichtstraining
Training unter Strom
Training in Ketten
Hinkmechanismen
Gangtraining
Remodellierungsphase
Krafttraining
Sturzprophylaxe
Sprünge, schnelle Richtungswechsel
Umgang mit chronischen Schmerzen
Triggerpunkte
Die Übungsprogramme
Testen Sie Ihre konkreten Potenziale
Beweglichkeitstests
Thomas-Griff
Gleichgewichtstest
Zweibeinstand
Tandemstand
Einbeinstand
Koordinations- und Krafttests
Wandkniebeuge
Brücke
Einbeinige tiefe Kniebeuge
Unterarmstütz
Alltagsfunktionen testen
4 mal 10 Meter schnelles Gehen
6-Minuten-Gehtest
Treppentest
30-Sekunden-Aufstehtest
Aufstehen und Losgehen
Einbeinsprung
Auswertung der Tests
Welches Programm soll ich durchführen?
Tipps und Tricks gegen den inneren Schweinehund
Setzen Sie sich Ziele
Überfordern Sie sich nicht
RPE-Skala: Wie anstrengend soll das Training sein?
Intervalltraining
Die Übungsprogramme
Aufbau der Programme
Bücken im Sitzen
Hüftstreckung
Päckchen
Seitsitz
Schraube
Halbkniestand
Ja-Sager
Um sich kreisen
Rückwärts zählen
Kreuzschritte
Nein-Sager
Augen zu
Volltreffer!
Hüftstrecker
Außen- und Innenseite
Gestrandeter Käfer
Erweiterte Muschel
Tiefe Ausfallschritte
Brücke
Boden wischen
Russische Drehungen
Seitliches Bein anheben
Oberes Bein
Unteres Bein
Flasche ablegen
Beckenschaukel
Unterarmstütz
Kopenhagener Stütz
Kniebeugen am Stuhl
Slalomlauf
Einkaufs- oder Wäschekorb aufheben
Wasserkiste tragen
Seitlicher Hindernislauf
Treppe gehen
Sprünge
Schnelle Richtungswechsel
Literaturverzeichnis
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Impressum
Quelle: © H. Münch/Thieme |
Hintergründe von Hüftproblemen
Wie kommt es zu Schmerzen in der Hüfte oder Leiste? Erfahren Sie, wie die Hüfte aufgebaut ist und was die Ursachen von Hüft- und Leistenschmerzen sein können.
Sie sind nicht allein!
Hüftbeschwerden sind verbreitet. Ursachen und Symptome sind vielfältig. Die Probleme im Alltag schränken die Betroffenen fast immer am meisten ein.
Wer Hüftbeschwerden hat, ist damit in bester Gesellschaft. Wenn Sie mal genauer darüber nachdenken, fallen Ihnen bestimmt einige Bekannte ein, die mit ähnlichen Problemen kämpfen.
Wer ist hauptsächlich betroffen?
Egal ob jung oder alt – von Hüftproblemen und Leistenschmerzen kann jeder betroffen sein.
Junge Menschen mit Hüftbeschwerden sind meist sportlich. In Sportarten wie Fußball, Eishockey und Basketball gehören Hüftverletzungen zu den Top Ten aller Verletzungen. Im weiblichen Amateurfußball ist die Hüfte mit fast 20 % vor Knie und Knöchel sogar der Bereich, der am häufigsten verletzt ist. In der Bevölkerung meinen viele, dass man sich in Mannschaftssportarten meistens durch ein Foul verletzt. Fast 70 % der Hüftblessuren im Fußball entstehen ohne Fremdeinwirkung. Der Sportler verletzt sich also selbst bei zum Beispiel schnellen Richtungswechseln, Sprints oder Abbremsbewegungen. Übrigens werden mehr als die Hälfte der vorsaisonalen Verletzungen in der kommenden Saison wieder auftreten. Die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn die Probleme schon lange bestehen.
Bei Personen mittleren und höheren Alters steigt die Häufigkeit von degenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel die Arthrose, an. Am häufigsten leiden Menschen zwischen 45 und 74 Jahren, mit einem Hoch zwischen 60 und 64 Jahren, darunter. Unter 35 Jahren sind nur absolute Ausnahmefälle mit einer Vorerkrankung betroffen. Die Zahl der an Hüftarthrose erkrankten Personen hat in den letzten 30 Jahren in fast allen Ländern enorm zugenommen. Es wird erwartet, dass sich der steigende Trend aufgrund der zunehmenden Alterung der Weltbevölkerung zukünftig fortsetzen wird.
Zwischen Frauen und Männern gibt es keinen nennenswerten Unterschied, aber in der Herkunft: In der westlichen Welt, also in Nordamerika, Westeuropa und der Region von Australien und Neuseeland, sind weltweit die meisten Menschen betroffen. In Regionen wie Asien, Nordafrika, dem mittleren Osten und Ozeanien leiden deutlich weniger unter einer Hüftarthrose. Es scheint also auch einen Zusammenhang zum westlichen Lebensstil und der Genetik zu geben.
Persönliche Probleme
Bei Leistenschmerzen steht oft zunächst die ärztliche Diagnose im Vordergrund. Häufig fallen Begriffe wie »Arthrose«, »Adduktoren«, »Sportlerleiste« oder »Schleimbeutelentzündung«. Doch egal welche Diagnose steht, Betroffene haben im Alltag oft ähnliche Schwierigkeiten. Es genügt nicht, die Beschwerden auf Schmerzen zu reduzieren, denn die persönlichen Probleme sind vielschichtiger: Wenn ein leidenschaftlicher Hobby-Fußballer wegen seiner Hüfte nicht trainieren kann, wird der Kontakt zu Mannschaftskameraden weniger. Betroffene hinken oft, brauchen zum Teil Gehhilfen und kommen kaum aus dem Haus. Manche können kaum aufstehen, länger stehen oder sitzen oder Treppen gehen.
Egal ob bei der Gartenarbeit, im Haushalt, dem Beaufsichtigen der Kinder oder Enkel, dem Autofahren oder Anziehen – Betroffene sind ständig auf Hilfe angewiesen und scheitern an tagtäglichen Aufgaben. Das schafft ein ungutes Gefühl und verändert die Beziehung zu den Angehörigen. Wenn jemand ständig krankgeschrieben ist, kommen oft auch finanzielle Sorgen hinzu. Manche versuchen ihre Probleme zu verbergen, weil sie sich dafür schämen. Deshalb meiden sie persönliche Kontakte zum Beispiel beim wöchentlichen Kaffeeklatsch oder der Chorprobe.
Die generelle Gesundheit leidet
Wer bei Bewegung Schmerzen hat, geht nicht mehr zum Sport, der Wanderurlaub wird zum Strandurlaub … Bewegungsmangel und Übergewicht sind oft die Folgen. Viele wachen nachts vor Schmerzen auf und sind deshalb nie richtig erholt. In Kombination mit der ständigen Einnahme von Schmerzmitteln fördert das die Entstehung zahlreicher weiterer Erkrankungen wie Osteoporose, Bluthochdruck oder Diabetes mellitus.
Individuelle Anforderungen im Alltag
Jeder Mensch hat im Alltag andere Anforderungen an seine Hüfte. Wer beruflich den ganzen Tag auf den Beinen ist und in der Freizeit viel Sport treibt, ist mit den gleichen Einschränkungen viel früher beeinträchtigt, wie jemand, der im Büro arbeitet und in der Freizeit am liebsten liest. Beruf, Freizeitgestaltung, aber auch unser soziales Umfeld, Alter und Voraussetzungen zum Beispiel finanzieller Art sowie psychologische Faktoren beeinflussen neben den strukturellen Veränderungen maßgeblich, wie stark uns die Beschwerden einschränken. Insgesamt sinkt aber bei allen die Lebensqualität.
Ein »0815«-Programm reicht nicht aus
Betroffene müssen deshalb immer individuell behandelt werden. Es reicht in der Regel nicht aus, wenn jeder Hüftpatient das gleiche Übungsprogramm durchführt. Eine reine Behandlung der verletzten Struktur ohne Beachtung der individuellen weiteren Faktoren ist nur selten zielführend. Persönliche und umweltbedingte Faktoren müssen unbedingt mitbeachtet werden, denn meist erfordert eine langfristige Genesung Veränderungen des Lebensstils. Das Hauptziel einer Behandlung sollte immer sein, dass der Betroffene wieder (ohne Schwierigkeiten) Aktivitäten im Alltag, Beruf und der Freizeit meistern kann.
Wann ist ein Besuch beim Arzt angesagt?
Vielleicht ist Ihnen mittlerweile schon bewusst geworden, dass Hüftbeschwerden in der Regel erstmal kein Grund zur großen Sorge sind und noch seltener die Notwendigkeit für einen sofortigen Arztbesuch besteht. Meist steckt hinter Hüftschmerzen kein ernsthaftes Problem. Sie leiden nicht automatisch unter einer schlimmen Erkrankung, wenn eins oder mehrere dieser Symptome bei Ihnen auftreten. Es können aber Hinweise auf Probleme sein, denen Veränderungen des Lebensstils und Training allein nicht gerecht werden. Hier ist eine ärztliche Abklärung unbedingt erforderlich. Wenn diese Beschwerden alle nicht auf Sie zutreffen, ist das ein gutes Zeichen und Sie können direkt mit den Übungen beginnen.
In diesen Fällen ist eine medizinische Abklärung wichtig:
zunehmende unerklärliche Verschlechterung der Probleme
unerklärliche starke Schmerzen in der Hüfte
Schwellung oder Schmerzen beim Husten, Niesen oder Pressen in der Leistenregion
(starke) Schmerzen in Ruhe und Schwellungen (ohne Trauma in der Vorgeschichte)
Nach Einsetzung eines oder mehrerer künstlicher Gelenke:
Fieber ≥ 38,5 °C
Die Wunde bleibt stark geschwollen und gerötet.
Die Wunde sondert anhaltend übermäßig viel Flüssigkeit aus.
Sie haben plötzlich starke Schmerzen in dem Gelenk, in dem sich die Prothese befindet.
Sie können nicht mehr auf dem Bein stehen, obwohl es schon ging.
Der Unterschenkel ist rot und schmerzhaft.
Bildgebung
Was sind bildgebende Verfahren und wann sollten sie zum Einsatz kommen? Eine schwierige und fachlich immer wieder diskutierte Frage, die man an dieser Stelle nicht umfassend darstellen kann.
Die Untersuchungen haben das Ziel, Strukturen des Körpers in einem Bild darzustellen. Dabei gibt es große Unterschiede in der Genauigkeit der Darstellung unterschiedlicher Strukturen, bei der Belastung für den Körper und den Kosten. Zu den bildgebenden Verfahren gehören: Ultraschall, Röntgen, Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT), Angiografie, Thermografie u. v. m.
Wann sind Bilder sinnvoll?
Grundsätzlich sollte immer individuell von einer Ärztin oder einem Arzt entschieden werden, ob ein bildgebendes Verfahren notwendig ist. Es gibt aber doch ein paar Anhaltspunkte, die helfen können, eine Entscheidung zu treffen.
Das Gesamtbild
Die Anatomie der Leistenregion ist komplex. Es können ein oder mehrere Probleme gleichzeitig vorliegen und so zum Beschwerdebild beitragen. Es sollte immer das Gesamtbild (Befragung, körperliche Untersuchung des Patienten und bei Bedarf bildgebende Verfahren) zu einer Diagnosestellung führen. Eine reine Beurteilung der Problematik anhand von bildgebenden Verfahren ist bei Hüftbeschwerden nicht angebracht.
Zusammenhang mit den Beschwerden
Auch Menschen ohne jegliche Hüftbeschwerden können Auffälligkeiten in der Bildgebung zeigen. Im Gegensatz dazu sind manchmal bei Personen mit Schmerzen und Einschränkungen keine strukturellen Veränderungen nachweisbar. Die Bildgebung des Hüftgelenks kann manchmal nicht sicher zwischen symptomatischen Patienten und Patienten ohne Beschwerden unterscheiden. Es ist zudem unklar, inwieweit Befunde in der Bildgebung die Prognose beeinflussen. Sie beeinflussen aber den persönlichen Umgang mit den Beschwerden. Es sollte daher von Bildern abgesehen werden, wenn es lediglich darum geht zu beurteilen, wie sich die Beschwerden und das Gelenk zukünftig entwickeln werden.
Was sagt uns dieses Ergebnis? Es sagt uns auf keinen Fall, dass bildgebende Verfahren überflüssig sind. Man sollte sich aber vor solchen Untersuchungen genau überlegen, welches Ziel man damit verfolgt und ob das Ergebnis potenziell eine Konsequenz hat. Unnötige Untersuchungen führen zu hohen Kosten und fehlenden Ressourcen für notwendige Untersuchungen. Eine Bildgebung sollte also nicht routinemäßig erfolgen.
Folgende klinische Zeichen können Hinweise für die Notwendigkeit einer weiteren Abklärung durch den Arzt/die Ärztin mittels bildgebender Verfahren sein:
Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung und
wenn sich hüftbezogene oder Leistenschmerzen durch eine konservative Therapie (also ohne OP) nicht bessern.
Je nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen sollte dann zunächst eine Röntgen- und/oder Ultraschall-Untersuchung durchgeführt werden. Erst wenn diese ebenfalls nicht ausreichen, sollte ein MRT und/oder CT gemacht werden.
Aufbau und Funktion der Hüfte
Unsere Hüften verbinden unsere Beine mit dem Rumpf. Sie ermöglichen uns viele alltägliche Tätigkeiten wie zum Beispiel Sitzen, Stehen, Gehen, Laufen oder Tanzen.
Jeder Mensch hat zwei Hüftgelenke. Im Gegensatz zu anderen Gelenken wie dem Hand- oder Kniegelenk lässt sich unsere Hüfte aber nicht ertasten. Daher haben viele keine Vorstellung, wo sie genau liegt: Auf die Ansage »hüftbreiter Stand« stellen einige ihre Beine viel zu weit auseinander. Denn entgegen der Vorstellung von manchen haben die Hüftgelenke selbst mit den Beckenknochen, die sich unterhalb der Taille befinden, wenig zu tun. In Wahrheit sitzen unsere Hüftgelenke jeweils in der Mitte der Leiste. Wenn man einen Finger auf die Leistenmitte legt, lässt sich hier ein Puls erspüren. Genau hierunter liegt das Hüftgelenk.
Das Hüftgelenk
Das Hüftgelenk liegt in direkter Nachbarschaft zu Becken, Lendenwirbelsäule und Kniegelenk und ist nach dem Kniegelenk das zweitgrößte Gelenk unseres Körpers. Die Hüfte besteht einerseits aus einer Pfanne am vorderen unteren Teil von unserem Becken und andererseits aus dem Oberschenkelkopf. Damit ist sie ein Kugelgelenk und gehört zu unseren beweglichsten Gelenken.
Knochen, Knorpel und Bänder
Der Oberschenkelknochen ist der längste Knochen des menschlichen Skeletts. An seinem körperfernen Ende befindet sich das Kniegelenk. An seinem körpernahen Ende geht er zunächst in den Schenkelhals über. Dieser ist vielen bekannt, da er bei älteren Menschen mit porösen Knochen für Brüche prädestiniert ist. Den Abschluss des Oberschenkelknochens bildet der kugelförmige Hüftkopf, der in die Hüftpfanne mündet.
Der Hüftkopf ist zu mehr als der Hälfte von der Hüftpfanne überdacht. Die Hüftpfanne umgreift den Hüftkopf also wie eine Schale – wie bei einer Walnuss. Man spricht auch von einem Nussgelenk. Das schränkt die Beweglichkeit zwar ein, bietet aber Stabilität.
Die Knochen des Hüftgelenks (links) und Kapsel und Bänder des Hüftgelenks (rechts)
Die Gelenkflächen liegen am Hüftkopf (gehört zum Oberschenkelknochen) und der Hüftgelenkpfanne (Teil des Beckens) und passen gut zueinander. Auf der Hüftgelenkpfanne liegt zusätzlich eine elastische Gelenklippe, das Labrum. Es vergrößert die Kontaktfläche zwischen Hüftkopf und Pfanne und sorgt dafür, dass der Hüftkopf bei Bewegung nicht aus der Pfanne rutscht.
Die beiden Gelenkpartner Hüftkopf und Hüftpfanne sind wie in jedem anderen Gelenk mit Gelenkknorpel überzogen. Obwohl das Hüftgelenk insgesamt ein großes Gelenk ist, ist die Knorpelfläche, die beim Gehen, Stehen und Tragen die Lasten aufnehmen muss, aber relativ klein. Die Belastung auf dieser kleinen Knorpelfläche ist dadurch im Vergleich zu anderen Gelenken sehr hoch. Knorpel ist nicht durchblutet und enthält keine Nerven, was die Heilungsfähigkeit einschränkt. Da sich im ganzen Gelenkinnenraum Synovialflüssigkeit (im Volksmund Gelenkschmiere) befindet, reiben die Knorpelflächen bei Bewegung und Belastung nicht aneinander, sondern gleiten perfekt aufeinander. Die Reibung von Knorpel ist geringer als die von zwei Eisflächen aufeinander. Das zeigt, wie perfekt der menschliche Körper konstruiert ist.
Die Gelenkkapsel ist eine bindegewebige Schicht um das Hüftgelenk. Sie bildet eine Hülle um das Gelenk, in der ein Unterdruck herrscht. Das stabilisiert das Hüftgelenk. Zudem produziert die Schleimhaut der Gelenkkapsel auch die Synovialflüssigkeit. Diese verteilt sich durch Bewegung im Gelenk und versorgt den Gelenkknorpel mit Nährstoffen. Der Knorpelstoffwechsel wird zudem über Druck und Zug stimuliert. Somit sind Bewegung und Belastung auch für den Knorpelerhalt und -aufbau unerlässlich.
Der Oberschenkelhals ist schraubenförmig von sehr starken hüftkapselverstärkenden Bändern umwickelt. Damit ist der Kapsel-Band-Apparat der Hüfte der kräftigste des menschlichen Skeletts. Wir benötigen dadurch kaum Kraft, um stehen zu können. Die Schleimbeutel befinden sich zwischen den verschiedenen Strukturen und reduzieren die Reibung.
Muskeln und Sehnen
Die Nussgelenkform, das Labrum, der negative Gelenkinnendruck und der Kapsel-Band-Apparat zentrieren zusammen mit den ca. 20 hüftgelenkumgebenden Muskeln und deren Sehnen das Hüftgelenk. Die Muskeln werden nach ihrer Funktion in Beuger (Flexoren), Strecker (Extensoren), Abspreizer (Abduktoren) und Heranführer (Adduktoren) sowie Außen- und Innenrotatoren eingeteilt. Sie ermöglichen uns alle aktiven Bewegungen.
Hüftmuskulatur von vorne (links), Hüftmuskulatur von hinten (rechts)
Die Muskeln sorgen auch maßgeblich für die Belastung des Hüftgelenks. Denn diese entsteht nicht, wie die meisten denken, in erster Linie durch unser Körpergewicht, das auf der Hüfte lastet. Vielmehr ist hauptsächlich die aktive Muskulatur für die Gelenkbelastung verantwortlich: Patienten mit Hüftproblemen wundern sich oft, warum sie beim Stehen keine Schmerzen haben, hingegen aber das Becken in Rückenlage kaum anheben oder nachts die Decke mit dem betroffenen Bein nicht zur Seite streifen können oder beim Aufstehen und Hinsetzen Schwierigkeiten haben. Erklären lässt sich das über die Muskulatur: Im Stand sind verglichen mit anderen Aktivitäten nur wenige Muskeln aktiv. Bei vielen Alltagstätigkeiten strengen wir unsere Muskeln viel mehr an, wodurch die Belastung auf das Hüftgelenk auf ein Vielfaches des Körpergewichts ansteigen kann. Beim Aufstehen von einem Stuhl lasten beispielsweise ca. 190 %, beim Treppe heruntersteigen über 250 %, beim Radfahren auf der Ebene jedoch nur 50 % vom Körpergewicht auf dem Hüftgelenk. Die Hüfte kann mehr als das zehnfache des Körpergewichtes an Belastung ohne Probleme vertragen (Sprint, Sprünge). Das zeigt, wie groß die Belastbarkeit dieses Gelenkes ist.
Warum die Hüfte so häufig Probleme macht
Ein Drittel der Weltbevölkerung bewegt sich zu wenig, dabei hat gerade Bewegung so viele Vorteile für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.
Bewegung und Belastung fehlen
Unser westlicher Lebensstil führt dazu, dass viele in unserer Gesellschaft körperlich nicht gerade fit sind und die in Studien als optimal empfohlenen 8000–10 000 Schritte bei Weitem nicht erreichen. Unser Körper passt sich aber immer der Belastung an, die wir ihm geben. Laufen, springen, tragen wir zu wenig, so werden in der Hüfte unsere Bänder und Muskeln schwächer, die Knorpelschicht dünner und die Knochen poröser. Schlechte Angewohnheiten, die mit Bewegungsmangel häufig einhergehen, wie eine unausgewogene Ernährung, gestörter Schlaf oder Rauchen, verstärken diese Vorgänge weiter und führen langfristig gemeinsam zu einer gesundheitlichen Abwärtsspirale – in Bezug auf die Hüfte, aber auch auf andere Herz-Kreislauf- und Systemerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus.