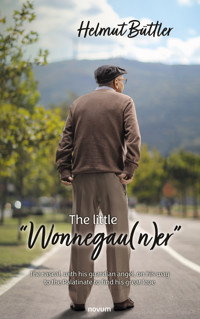19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Wonnegau in Rheinhessen – darauf bezieht sich auch der Titel dieses Buches – beginnt diese Geschichte. Es handelt sich um die Lebensgeschichte eines Menschen, der im Laufe der Zeit so manches Hindernis überwinden muss, der es jedoch schafft, durch Glauben und Ehrgeiz, durch Demut und Ausdauer, durch Disziplin und Zuversicht, aber auch durch die manchmal durchaus tatkräftige Mithilfe seines Schutzengels jede Menge Hindernisse zu überwinden und letztendlich sowohl im Privatleben als auch im Beruf seine Erfüllung findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0259-6
ISBN e-book: 978-3-7116-0260-2
Lektorat: Leon Haußmann
Umschlagfoto: Ljupco | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen:
Bild 1 und Bild 5: © Foto H. Lenke, Photo Schmitt,
Bild 2: © Foto W. Waltz,
Bild 3: © Foto Schilke,
Bild 4: © Foto H. Lenke
Autorenfoto: Rosemarie Büttler
www.novumverlag.com
Vorwort
Dieses Buch handelt von einem Jungen des Jahrgangs 1946 aus dem „Wonnegau“ in Rheinhessen auf seinem langen Weg in die „Pfalz“, der letztendlich dort sein großes Glück in der Liebe und gute Freunde findet.
Viele Hindernisse gab es bis dorthin zu überwinden, die er jedoch ohne seinen Schutzengel, seinen Glauben und Ehrgeiz, seiner Ehrfurcht, Demut sowie Ausdauer, Disziplin und Zuversicht, seinem Fleiß und seiner absoluten Loyalität sowie Standhaftigkeit wohl nie hätte unversehrt überwinden können.
Hier wiedergegebene – weder ersonnene, noch ersponnene – tatsächlich so geschehene Anekdoten und Ereignisse, die den Leser zum Nachdenken, Verstehen und Lernen animieren sollen, zeigen, wie ein Mensch, der nicht unbedingt das große „Wirtschaftswunder“ hat auskosten können, geradeaus seinen Weg gemacht hat, indem er Missgunst und Neid gegenüber anderen nie hat aufkommen lassen und sich seine eigene Existenz mit Sparsamkeit, starkem Willen und Durchhaltevermögen geschaffen hat.
Der Leser wird auf Inhalte aufmerksam gemacht, die nicht als ganz jugendfrei eingestuft werden könnten und gebeten, eine gewisse FSK in Erwägung zu ziehen. Da nichts, aber auch gar nichts weder geschönt noch verharmlost, absolut identisch ist, weist der Autor darauf hin, dass es beim Lesen zu Schmunzeln, Lachen, Tränen, Augenzwinkern, Kopfschütteln sowie Kopfnicken, Verständnis und Unverständnis, sogar zum mit dem Zeigefinger an die Stirn tippen kommen kann.
Dennoch, viel Spaß beim Lesen!
Der kleine „Wonnegau(n)er“
„VomLausbub, durch seine große Liebe in der Pfalz,zum Allroundtalent, Buchautor und Schriftsteller“.(Freude, Leid, Glück und Gottes Fügung)
Auto-Biografie eines 1946ers
Schon vor einigen Jahren fasste ich den Entschluss, für meine nachfolgenden Generationen die eine oder andere Anekdote niederzuschreiben, von der ich meine, sie unbedingt weitergeben zu müssen, da sich darin so manche lustige, bedenkliche, öfter auch gefährliche Situation widerspiegelt.
Ganz klar, dass der mittlerweile große und schon etwas ältere Junge, Helmut, also meine Wenigkeit, aus dem Wonnegau, einem kleinen Bezirk in Rheinhessen, Rheinland-Pfalz, sich nicht mehr an seine allerersten Lebenstage und Lebensjahre zurückerinnern kann, über die Zeit, so weit sein Langzeitgedächtnis jedoch zurückreicht und das ist, so finde ich, bis zum dritten Lebensjahr schon ganz beträchtlich, soll hier berichtet werden.
Mit meiner Geburt am 21.08.1946 als Sohn eines Schreinermeisters und einer in den Kriegswirren in einer Lederfabrik in Worms gelernten Laborantin und späteren Hausfrau und „Mädchen für Alles“ wurden mir zwar nicht die allerbesten, verhältnismäßig aber doch ganz annehmbare Voraussetzungen mit in die „Wiege“ gelegt.
Mit einer „Wiege“, einem vom Vater selbst gebauten Kinderbettchen, in dem auch ich und meine zwei Jahre ältere Schwester schon liegen durften, begannen meine Erinnerungen, die mich mein ganzes Leben lang begleiteten.
Im Kindergarten mit Apfel
Die Geburt meines Bruders
Zuerst wurde meine zwei Jahre ältere Schwester und ich von unseren Eltern nahezu dazu gedrängt, Zucker über die weiß lackierte, einige Lackschäden aufweisende Fensterbank ihres Schlafzimmers nach draußen zu streuen, damit der Klapperstorch kommen möge, uns doch bitte noch ein Brüderchen oder Schwesterchen zu bringen. Dann sollte meine Schwester für ein paar Tage zu Tante Mariechen in unserem Wohnort und ich zur Tante Katharina nach Zell in der Pfalz gebracht werden, da es unser Geschwisterchen sehr eilig hatte auf die Welt zu kommen und die Geburt im Haus vonstatten gehen sollte.
Meine Schwester hatte überhaupt nichts dagegen einzuwenden zu dieser Tante zu gehen, erinnerte sie sich doch sehr genau an die guten Sachen, die es dort stets zu essen gab, während ich mich mit aller Macht sträubte, in die Pfalz, nach Zell, zu reisen.
Noch heute habe ich es vor Augen, wie ich den mit weißen Kalksteinen übersäten Weg des Berghangs, an dem das Haus meiner Tante stand, hinunter auf eine dicht bewachsene Hecke zu rannte, um wieder nach Hause zu gelangen. Doch es nutzte nichts, denn bald hatte man mich wieder eingeholt und zurückgebracht. Kein Tränchen und Betteln konnte es verhindern, dass ich bei meiner Tante bleiben musste. Na ja, mit der Zeit gefiel es mir da sogar und trotz des zur Schlafenszeit unheimlichen, schrillen Pfeifens und Heulens des Windes, in den Drähten einer Freileitung, die direkt vor dem Haus und dem Schlafzimmerfenster entlang verlief, dachte ich überhaupt nicht mehr an zu Hause. Vielleicht war es ja auch der überaus nette Onkel Emil, der mich mit seinem lustigen Trillerpfeifen, dem rollenden Gesang eines Kanarienvogels gleich, ganz ohne Hilfsmittel, und mit seinen sonstigen Späßen immer wieder zum Lachen brachte? Auch die unterschiedlichsten Holzklötzchen, mitunter bunt, mal rund oder eckig, mal mit und mal ohne Loch, die er mir aus der nahegelegenen Möbelfabrik, in der er arbeitete, mitbrachte, begeisterten mich stets aufs Neue.
Oder war es gar der feine Geruch, den ich ständig in der Nase hatte und dessen Ursprung ich unbedingt nachgehen musste?
Es war das Stück Seife, das die Tante benutzte, mich zu waschen. – Pfui! Das schmeckte aber gar nicht so wie es roch und in hohem Bogen spuckte ich aus, was ich da heimlich, genüsslich probieren wollte. Und dennoch schmeckte und roch diese Seife, so kam mir ins Gedächtnis, total anders als unsere daheim. Unsere Seife war auch nicht so schön farbig, wie die der Tante, es handelte sich dabei um die, in damaligen Haushalten überall vorzufindende Kernseife.
Es war eine der ersten Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen musste, nämlich, dass nicht alles so gut schmeckt, wie es riecht oder aussieht.
So vergingen die wenigen Tage bei Onkel Emil und Tante Katharina, auch Tante Käthchen genannt, und ich sollte wieder nach Hause. Zurücklassen die schöne Aussicht über das Zeller-Tal, den lieben trällernden Onkel und die sehbehinderte Tante mit ihrer Brille und den sehr starken Gläsern, die ihre Augen ganz klein zu sein schienen ließ und natürlich mit ihrer wohlriechenden Seife. „Da wirst du aber unsere süßen Trauben gar nicht mehr essen können, wenn du jetzt schon heim gehst!“, waren die Worte meines Onkels, indem er auf die sich bereits bildenden Früchte an den sattgrünen Reben des Weinstockes, die den ganzen Hof an dafür gespannten Drähten überrankten, zeigte. „Aber du musst mir versprechen, wiederzukommen, wenn die Trauben reif sind“, meinte er ergänzend und mit seinem unvergleichlichen lieben Lächeln.
Ja, es war doch sehr schön hier im Hof und im kühlenden Schatten unter dem Blätterdach aus Weintraubenlaub im Juli 1950, ich hatte mich sehr sehr wohl gefühlt.
Wieder zu Hause angekommen, durfte ich gleich mein Brüderchen sehen. Ach, war das so lieb und knuddelig, mit dem werde ich bestimmt noch sehr viel Spaß haben, dachte ich und war gleichzeitig sehr besorgt um meine Mama, die im Bett lag und krank zu sein schien: „Warum liegst du denn im Bett, Mama?“, fragte ich sie, „Bist du sehr krank?“ „Der Klapperstorch hat mich ins Bein gebissen“, waren ihre Worte, wobei sie mir ihr sehr dick umwickeltes Bein zeigte: „Das geht aber bald wieder vorüber und die Mama ist ganz schnell wieder gesund. Da musst du dir gar keine Sorgen machen“.
Zwar war ich durch diese Worte etwas beruhigt, von da an musste ich aber annehmen, dass Klapperstörche gar nicht so harmlos sind, wie man mir immer erzählt hatte. Wäre mir dies etwas früher bewusst gewesen, ich hätte ganz bestimmt keinen Zucker auf die Fensterbank gestreut.
Später erfuhr ich, dass es sich bei der damaligen Bettlägerigkeit meiner Mutter um eine Venenentzündung im rechten Bein handelte.
Oft noch krabbelte ich die steile Stiege mit ihren grauen Stufen und dem knallroten Handlauf empor ins Elternschlafzimmer, um nach Mama und dem Brüderchen zu sehen.
Außer dem braunen massiven Holz-Doppelbett, den beiden Nachttischchen daneben, die zusammen die ganze Breite des Schlafzimmers einnahmen, dem riesigen Kleiderschrank, dessen Tür, ganz links, oft von alleine aufging und dabei schrecklich knarrte und quietschte, dem Kinderbettchen und einem grünen Ofen in der Ecke, fiel mir ein Kreuz mit Korpus und ein Bild ganz besonders auf, welche immer wieder meinen Blick auf sich zogen. Auf meine Frage, was das wohl wäre, meinte Mama: „Das ist ein Kreuz und da hängt das liebe Gottchen dran.“ „Und warum hängt das daran?“, wollte ich wissen. „Den haben die bösen Männer da dran gemacht“, erwiderte sie.
So ging das Frage- und Antwortspiel noch eine Weile weiter und ich konnte trotz der vielen Antworten nicht verstehen, um was es sich eigentlich dabei handelte. Eines aber habe ich noch in Erinnerung, dass es mich immer wieder grauste, wenn ich das Kreuz betrachtete.
Ganz anders war, wie das Bild auf mich wirkte. Es zeigte eine Berglandschaft mit einem reißenden Fluss und einer Brücke, über die ein Junge und ein Mädchen gehen, begleitet von einem großen menschlichen Wesen mit riesigen Flügeln und einer sehr liebevollen Ausstrahlung. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, war nicht erkennbar. Die Brücke war stark beschädigt. Es fehlten einzelne Bretter im Boden und andere, auch tragende Teile, waren sogar angebrochen. Und, als müsste man den Kindern zurufen, nicht darüber zu gehen, schienen sie sich in der Obhut der Begleitung absolut sicher zu fühlen.
Das sei ein Schutzengel, der die Kinder sicher über die Brücke geleitetet und immer bei ihnen ist, damit nichts Schlimmes passiert. Diese Erklärung und dass er auch bei jedem Menschen zugegen sei und auf ihn aufpasste, wollte mir lange nicht in den Sinn kommen. Denn erstens hatte ich nie die Anwesenheit eines Engels verspürt und zweitens, wenn da einer gewesen sein sollte, musste es ein ganz besonderer gewesen sein. Es kam mir nämlich ein Leben lang so vor, als führte dieser mich bewusst ins Unheil, um mich dann wieder genussvoll da herauszuholen.
Ja, so wie der Engel trotz der offensichtlichen Gefahr mit den Kindern über die Brücke geht, anstatt sie davon abzuhalten und einen anderen Weg zu suchen, so ähnlich erging es mir sehr oft im Leben. Zuerst in eine missliche Lage gelangen und wenn wieder draußen meinen, na, wieder einmal Glück gehabt – Oder hatte ich dieses Glück einzig und allein meinem Schutzengel zu verdanken?
Papa der Künstler
Ja, mein Papa war in meinen Augen ein Künstler. Er konnte sehr schön zeichnen und malen. Ganz besonders gefielen mir die Portraits, die er von uns Kindern kreierte. Ein Bild malte er auf unser Bitten hin immer wieder gerne, und zwar einen Mann mit sehr langen Haaren und einem Herzen auf der Brust, was er dann das „Herz Jesu“ nannte. Auch Tierköpfe, wie zum Beispiel einen Pferdekopf, vermochte er perfekt zu zeichnen, wobei wir Kinder das Werden durch nur ein paar Striche gespannt mitverfolgten.
Nicht nur den Weg des Stiftes auf dem Papier hatte ich stets im Auge, auch wie Papa sich dabei verhielt, hatte mir großen Spaß bereitet, ja, manchmal musste ich sogar darüber lachen.
Als zeichnete er Bilder in die Luft, kreiste er mehrmals über dem Papier, bis endlich mal ein Strich zu sehen war. Auch sein Mund, den er dabei ganz zuspitzte, sah ziemlich ulkig aus. Übrigens nicht nur über seinen Mund, auch über seine dicke, große Nase, die wie eine reife Erdbeere aussah, und seine großen, abstehenden Ohren, wovon das linke etwas mehr abstand als das rechte, machte ich mich ständig lustig. Und wenn ich ihn deswegen ansprach, auch ob er an dem einen Ohr öfter einmal von seinem Lehrer gezogen worden wäre, weil er nicht artig war, meinte er lachend: „Warte nur einmal ab, bestimmt hast du das alles von mir vererbt bekommen!“, und, dass ihn sein Lehrer ganz bestimmt nicht misshandelt hätte, da er ein sehr braver Junge gewesen sei. Im Nachhinein muss ich gestehen, dass er mit seiner Vererbungs-Vermutung nicht einmal allzu sehr Unrecht hatte. „Gib doch Papa mal ein Küsschen!“ Oh je, wenn Mama darum bat, verspürte ich eher eine große Abneigung, dies zu tun. Nach einigem Zögern gab ich ihm aber ihr zuliebe oft trotz der sehr stacheligen Angelegenheit, seiner rauen Bartstoppeln wegen, dann doch einen Schmatzer.
Ja, es war eigentlich immer wieder ein sehr schönes Beisammensein auf engstem Raume. Über Jahre hinweg war unsere Küche zugleich auch Wohnzimmer. Ganz in der linken hinteren Ecke stand ein Kanapee, vornehmlich für Papas Mittagsschläfchen. Davor ein großer Tisch mit fünf Stühlen und über diesem hing eine sehr praktische Zuglampe an der Decke. Rechts in der hinteren Ecke befand sich ein Wasserhahn mit einer Spüle und einem Unterschrank, an der nicht nur Geschirr gespült, sondern sich auch gewaschen wurde. Ein Warmwasserboiler sorgte dafür, dass stets und schnell warmes Wasser zur Stelle war. Rechts vorne stand ein großer emaillierter Kohleherd mit vier Kochplatten, einem Backofen und rechts oben darüber ein Wasserbehälter mit Deckel, auch Schiffchen genannt. Ein silbernes Ofenrohr, das gelegentlich, nach dem Bepinseln mit Silberbronze, ganz ekelig stank, ragte bis fast zur Decke aus dem Herd empor und mündete rechts in den Schornstein. Links neben dem Herd, dort wo später einmal ein Kühlschrank hinkommen sollte, stand ein kleines Schränkchen, auf dem sich ein Elektrokocher mit zwei Platten befand. Des Weiteren hing in der Ecke hinten an der linken Außenwand eine Uhr und unweit davon gegenüber der Eingangstür ein Kreuz an der Wand. Links vorne, neben der Eingangstür, stand ein Küchenschrank und daneben hing, ganz hinten in der Ecke, ein kleiner Medizinschrank. Nicht weit davon war, in etwa 1,80 Meter Höhe, eine Konsole für ein Radio angebracht. Ja, und ein wahres Wunder damals, ein Radio gab es auch. Der Fußboden war mit Kiefernholzbohlen belegt und musste von Zeit zu Zeit eingewachst und mit einem großen weichem Drahtschwamm gebohnert werden, was durch den sehr starken Wachsgeruch in der ganzen Wohnung eine gewisse Festtagsstimmung aufkommen ließ, da diese Aktion hauptsächlich kurz vor großen Festen und Feiertagen vorgenommen worden ist.
Eigentlich war alles vorhanden, was man zum Leben brauchte. Nur Oma, Papas Mutter, die mit nahezu 80 Jahren mit im Haus wohnte und von den wenigen Zimmern zwei für sich beanspruchte, konnte durch ihre herrische Art gelegentlich dieses Idyll gewaltig stören. Stets hatte sie etwas zu bemängeln, indem sie mit den sich ständig wiederholenden Worten: „Ach Gott – ach Gott“ in ihren Filzpantoffeln (Schlappen) in der Wohnung hin und her schlurfte. Mama war für sie einzig und alleine nur da, ihr eine Magd zu sein, dabei hatte sie genug mit uns Kindern zu tun. Sie kümmerte sich nebenbei noch um den Garten, die Arbeiten auf den Äckern, das zu versorgende Hausschwein und alle übrigen Hausarbeiten. Auch wenn ihr Papa aus seiner Schreinerwerkstatt auf dem hinteren Teil unseres Anwesens zurief, dass er Hilfe benötigte, war sie stets zur Stelle.
Oma hatte eigentlich mit ihren beiden Zimmern ihr eigenes Reich. Ein kleines Zimmer als Küche und Wohnzimmer und einen größeren Raum als Schlafzimmer.
Sie hatte schon sehr früh ihren Mann verloren, konnte jedoch mit einer kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft ihre beiden Söhne einen soliden Beruf, nämlich Bau und Möbelschreiner, erlernen und die Meisterprüfung machen lassen. Papa eröffnete im Heimatort und sein älterer Bruder in einem nicht weit entfernten Städtchen, Pfeddersheim, eine Schreinerei.
Die Schreinerei
Nicht einfach war es für meinen Vater, die sehr kleine Schreinerwerkstatt seines Vaters, die noch ein echter Handwerksbetrieb war, so zu erweitern, dass auch größere Maschinen aufgestellt werden konnten. Nötig war der Abriss des alten Kuhstalls und die Errichtung eines Anbaus.
Einige Werkzeuge hatte mein Vater von Großvater übernehmen können, als da waren: Eine Werkbank, mehrere Hobel, Handsägen, Stemmeisen, Schraubzwingen und einiges mehr.
Noch gut kann ich mich an das Betonieren des Werkstattbodens und des Sockels für den Motor der Hobelmaschine erinnern. „Was macht ihr denn da?“, fragte ich Papa und Onkel Hans, der in einer Maschinenfabrik in Worms arbeitete. „Wir machen Öl“, war die Antwort und ich bemerkte auch sofort, dass sie an den neuen Motor eine Maschine angeschlossen hatten, in die sie etwas hineinschütteten und bei der aus einem Loch eine Flüssigkeit herauslief und aus einem anderen Loch eine dunkle Masse wie kleine Würstchen hervorquoll. „Kann man das denn essen?“, fragte ich beide und sie meinten, dass ich es ja einmal versuchen könnte. Gesagt getan, ich probierte diese Würstchen und wusste im ersten Moment nicht, was ich sagen sollte. „Schmeckt irgendwie seltsam“, meinte ich und rümpfte dabei etwas die Nase. Am Lachen der beiden konnte ich erkennen, dass dies nicht das von mir gewünschte Produkt, nämlich etwas Leckeres, sondern ein prima Schweinefutter war, was sie mir alsdann auch lachend bestätigten. Die Flüssigkeit war das begehrte Etwas, und auch das durfte ich versuchen. Und ich muss sagen, also ich hätte nicht unbedingt entscheiden können, was nun für den Menschen und was für die Schweine das Bessere war. Einzig das Aussehen hätte mich eher zu der Flüssigkeit tendieren lassen. Waren doch die Würstchen mit kleinen Fasern durchzogen und hatten hin und wieder grüne Stellen vorzuweisen, was gar nicht so sehr appetitlich aussah. Der Saft hingegen war goldgelb, fast wie Honig, nur sehr viel dünnflüssiger. Ich sollte später noch erfahren, dass es sich dabei um Rapsöl handelte.
Schon eine geraume Zeit, bevor die Hobelmaschine geliefert wurde, hatte mein Vater sich selbst aus massivem Holz das Gestell für eine große Kreissäge mit starkem Drehstrom-Motor gebaut. Es bestand aus vier aufrechten Pfosten, zwischen denen etwa 20 Zentimeter vom Fußboden entfernt und ganz oben, auch aus solchem Vierkantholz, Verbindungen geschaffen waren. Unten war noch ein zusätzliches Stück eingesetzt. Auf diesem und den drei äußeren Stücken waren Bretter geschraubt, auf die der Motor gesetzt und befestigt worden war. Obenauf befand sich eine solide hochklappbare Holzplatte mit einem Schlitz für das Sägeblatt. Am oberen Rahmen waren die Lager für die Welle und hinten war eine Vorrichtung für einen Schlitten zum Hin- und Herfahren angebracht. An der Welle befand sich am hinteren Ende ein Spannfutter, in das spezielle Fräsbohrer für das Einfräsen der Löcher für Tür-, beziehungsweise Fensterbeschläge und andere benötigte Langloch-Bohrungen eingesetzt werden konnten. In die trapezförmigen zwei Stangen, die rückseitig aus der Maschine ragten, wurde der Schlitten, der unterhalb auch zwei trapezförmige Leisten besaß, eingehängt beziehungsweise eingeschoben. Mit einer Spindel, an deren unteren Ende eine tellerähnliche Platte aus Holz montiert war und mit einem großen Rad am oberen Ende konnte ein Werkstück sicher und relativ leicht eingespannt werden. Die Entfernung zwischen Motor und Welle betrug ca. 80 Zentimeter, die Kraft wurde mittels eines flachen starken Lederriemens übertragen. Ein wiederum hölzerner Anschlag, der parallel zum Sägeblatt genauestens fixiert werden musste, wurde mit zwei großen Schrauben, an deren Ende ein runder Drehgriff angebracht war, befestigt.
So stark diese Maschine war, so gefährlich war es auch, mit ihr umzugehen. Und dem kleinen Helmut war strengstens verboten, in ihre Nähe zu kommen, während sich die große Maschine in Betrieb befand.
Es hatte mich damals gelegentlich schon einmal gereizt, ein Stück Holz damit zu schneiden, doch sollte es noch eine ganze Weile dauern, bis der große Tag gekommen sein würde. Aber wenn ich sah, wie Papa mit den Händen nur zentimeterweit ein Holzstück an dem blitzenden Metall vorbei schob, wurde mir stets angst und bange.
Nun endlich war auch die Hobelmaschine eingetroffen und in Betrieb genommen worden. Der Antriebsriemen war mindestens drei- bis viermal so lang wie der der Kreissäge. Er trieb die drei Wellen – einmal die Welle mit den Messern und zweimal die Antriebswellen – an, die die Holzstücke bei der Dickenhobelung durch die Maschine transportierten. Von unten ragten auch zwei Wellen in den Dickenraum, die aber nur geleitende Funktion hatten.
Am meisten aber faszinierte mich an dieser Maschine der sehr tiefe Betriebston, der beim Anschalten in der ersten Schaltstufe sehr tief war und mit zunehmender Drehgeschwindigkeit der Wellen, erst recht bei der zweiten Schaltstufe, etwas höher wurde.
Und wie das roch, wenn die verschiedenen Holzarten gehobelt wurden. Es dauerte nicht lange und ich konnte alleine schon am Geruch die einzelnen Holzarten erkennen.
Mit der Zeit wurde auch eine große Fräsmaschine angeschafft. Deren drei Meter langer, wegen der horizontalen Antriebs- mit der vertikalen Arbeitswelle zueinander verdrehte Antriebsriemen, beim Laufen der Maschine, in einem ganz bestimmten Takt, ein klatschendes Geräusch erzeugte, und durch ein langes Holzgestell abgesichert war.
Das rasselnde und ratternde Geräusch einer Kettenfräse war das für mich unangenehmste und ich war immer froh, wenn diese Maschine nicht in Betrieb war.
Mehrere kleine Maschinen kamen später noch hinzu: Eine große Tellerschleifmaschine, ein Schwingschleifer, eine Handfräse, eine Handkreissäge sowie Bohrmaschinen.
Große Angst hatte ich auch um Papas Hände und Finger, und zwar dann, wenn er mit einer etwa 20 Zentimeter langen zylinderförmigen Wachsstange die Riemen wachste. Da kam er doch ziemlich oft ganz nah an die Antriebsräder und er benötigte eine große Menge Geschick und Kraft, damit ihm die Stange nicht aus der Hand gerissen wurde.
Und wieder entdeckte ich einen eigenartigen Geruch, der bei der hohen Reibungstemperatur des Wachses entstand – ei, und was machte der kleine Helmut? Richtig geraten! Er musste mal wieder unbedingt davon kosten – pfui, wie grässlich, dieser Geschmack. Gegen den war der des kalten Holzleims und erst recht der des im Kaltzustand geperlten Heißleims eine Delikatesse.
Selbstverständlich wird für eine Schreinerei auch Holz benötigt. Dieses lagerte an der Seite der scheunenartigen Einfahrt zu unserem Grundstück, zum Teil an der Wand angelehnt oder auf dem Boden, je nach Art und Stärke gestapelt. Auch große Glaskisten mit den unterschiedlichsten Gläsern und Glasstärken standen an der Wand.
„Wie schmeckt das denn, was du da im Mund hast, Papa?“ Diese Frage musste ihm unbedingt einmal gestellt werden, wenn er mit dem Langhobel Holzstücke hobelte: „Versuch es doch selbst“, war seine Antwort, und bevor solch ein lockenartiges Ding auf den Boden fiel, fing er es auf und steckte es mir in den Mund. „Na, und wie schmeckt es?“, fragte er lächelnd. „Hehe“ antwortete ich vorsichtig, darauf bedacht, die Lippen nicht zu öffnen, damit mir dieser Hobelspan nicht aus dem Mund fallen konnte. Im ersten Moment kam ich mir wirklich wie ein ganz Großer vor und während Papa mich aus seinen Augenwinkeln beobachtete und noch nachrief „Aber nicht runterschlucken!“, trottete ich von dannen, um auch Mama zu zeigen, was ich da habe. Doch kam es nicht mehr so recht dazu. Noch bevor ich es ihr zeigen konnte, hatte ich genug von dem bitteren Saft, der sich allmählich aus dem Holz löste und mit mehreren „Pfui – Pf – Pf“ versuchte ich, die kleinen Spänchen aus dem Mund zu bekommen und auszuspucken. Mama war wieder einmal meine Rettung, denn mit einem Glas Wasser war das Zeug im Nu ausgespült.
Am Abend konnte ich hören, wie Mama Papa große Vorwürfe deswegen machte: „Was da hätte alles passieren können?!“, äußerte sie sich erregt: „Wenn ihm das in den Hals gekommen wäre!“
Fürs Erste hatte ich genug von solchem Geschmack. Aber, ich muss gestehen, mit der Zeit noch oft die eine oder andere Holzart derart erschmeckt zu haben.
Mit zunehmendem Alter durfte ich nun immer öfter in die Werkstatt und ständig war ich dort auf Entdeckungstour und konnte Papa schon so manche Handreichung machen. „Darf ich dir etwas helfen?“ Und nie kam Papa in Verlegenheit, eine Beschäftigung für mich zu finden: Aus der Hobelmaschine mit einer langen Leiste die Späne herausstreichen, heruntergefallene Nägel oder Schrauben aus den Spänen am Boden fischen, zu versuchen, diese teils sehr krummen Stifte mit dem Hammer wieder gerade zu biegen, und vieles mehr. Da ging auch schon einmal ein Hammerschlag neben den Nagel auf die Finger. Aber mit der Zeit klappte das ganz gut, ja, allmählich wurde mir diese Arbeit langweilig und ich hätte viel lieber an den Maschinen gearbeitet.
Wenn Papa einmal nicht zu Hause war, schlich ich mich in die Werkstatt, legte die große Tellerschleifmaschine auf den Rücken, schaltete sie an und schliff und spitzte, was mir gerade so in die Hände kam. Beim ersten Mal hatte ich dabei großes Glück gehabt. Diese Maschine hatte eine solch hohe Anlaufgeschwindigkeit, dass sie mir schier von der kleinen Werkbank, auf der sie lag, herunterfiel.
Ujujui, da wäre ganz bestimmt das Aluminium-Guss-Gehäuse zu Bruch gegangen. Und, da die Maschine sehr groß war, hätte ich sie noch nicht einmal mehr hochheben und zurückstellen können. Glück gehabt!
Das Umfeld
Helmut und Kurt auf der Schaukel
Allmählich kam die Zeit, in der ich mehr und mehr mein weiteres Umfeld kennen lernte. Dinge wahrnahm, die mir bisher völlig unbekannt waren.
Mir wurde erstmals klar, in welch schönem Dörfchen ich wohnte. Zwar war hier noch manches im Werden: Die Straßen im Dorf und auch die zwischen den einzelnen Ortschaften waren noch nicht befestigt, lediglich mit sehr grobem grauem Schotter bedeckt und gewalzt. Nur ein kleiner Streifen an den Seiten war etwas mit feinerem Splitt belegt und somit glatter, sodass hier ein sichereres Gehen oder mit dem Rad zu fahren gegeben war. Auch ein ständiges Stolpern oder eine Reifenpanne wurde so eher unterbunden. Längere Wege zwischen den einzelnen Ortschaften wurden ja noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt.
Es gab noch keine Kanalisation und das Regenwasser wurde in mit Pflastersteinen befestigten Rinnen, an den Häusern entlang in einen unser Dorf durchziehenden Bach geleitet. Für andere Abwässer aus den Häusern oder Ställen gab es Gruben auf den jeweiligen Grundstücken, die anfangs noch sehr mühevoll mit Schöpfeimern entleert werden mussten. Eigentlich gab es zum Abtransport große Fässer auf Wägen, die auf den umliegenden Äckern entleert wurden. Doch nutzten manche Anlieger die Gelegenheit, bei Regen ihre Jauche auszuschöpfen und sich ihr somit mit geringerem Aufwand über die Straßenrinne (Flösschen) zu entledigen.
Für uns unbedarfte Kinder war es jedoch ein willkommener Spaß, barfüßig durch diese herrlich warme braune Brühe zu waten. Davon konnte uns auch nicht der sie begleitende sehr unangenehme stechende und beißende Geruch abhalten. Dank jener Person, den sie auch „de Rundhut“ nannten, mit seinem „Puhlschöpper“.
Telefone waren zu dieser Zeit noch sehr vereinzelt vorhanden. Aber gerade sie sollten noch eine ganz große Rolle in meinem Leben spielen.
Auch gab/gibt es eine schöne Bonifatius geweihte große barocke Kirche mit Kirchgarten, angrenzendem Pfarrgarten und dem Pfarrhaus. Auch ein Schwesternhaus mit Hof grenzte an, in dem die schwarz gekleideten Frauen wohnten und in dem auch der Kindergarten untergebracht war, in den ich ab jetzt gehen durfte. Durfte?! – Na ja, durfte ist wohl nicht ganz der richtige Ausdruck. Es sollte eher heißen musste. Die schwarz gekleideten Frauen, auch Nonnen genannt, welche auf mich irgendwie unheimlich, ja sogar beängstigend wirkten, waren nämlich sehr streng und das war etwas, was ich bisher nie kennen gelernt hatte. Wieso eigentlich musste ich sie mit Schwester anreden? Ich hatte doch eine Schwester und das war doch etwas ganz anderes. Aber, die Tante Maria! – Hm, eigentlich war sie auch gar nicht meine Tante. Sie war noch sehr jung und als weltliche Kraft und Kindergärtnerin unsere – na Tante eben. Die Tante war viel netter als die Schwestern. Sie lachte mit uns Kindern und wenn mal keine Schwester anwesend war, machte sie so manches Späßchen mit uns.
„So Kinder und jetzt wieder ganz still sitzen!“ – „Hände auf den Tisch!“ Dieser Ton, diese Miene, na klar, die Schwester war mal wieder da: „Und es werden mir keine Dummheiten gemacht!“
Einmal, so erinnere ich mich, es war in der Osterzeit, da wurde im Kindergarten angekündigt, der Osterhase würde uns besuchen. Alle Kinder mussten mal wieder auf ihre Plätze und schön artig die Hände auf den Tisch legen. Eine ganze Weile saßen wir so da und warteten und warteten. Plötzlich ein Schrei! „Da, da ist der Osterhase!“ „Wo denn!?“, wollten viele wissen. – „Da, am Fenster, da war er eben!“ „Ich habe seine Ohren gesehen!“, rief ein Mädchen. – „Hä, da war doch gar nichts“, dachte ich bei mir, machte einen Satz von meinem Stuhl, und da mein Platz nahe am Fenster war, war ich auch sofort am Fenster. Ich hörte hinter mir noch einen Warnruf: „Bleibst du da weg – sofort wieder auf deinen Platz!!“ Aber, es war zu spät. Seit jenem Moment war der Osterhase für mich und etliche andere Kinder gestorben. Konnte ich doch aus dem Fenster einen Hasenkopf und in dem Darunter die Kleidung einer Schwester sehen. „Das ist ja die Schwester, das ist ja die Schwester!“, rief ich, teils erschrocken und dennoch heiter. Ich war aber gar nicht so sehr überrascht deswegen, hatte doch meine zwei Jahre ältere Schwester schon so oft zu mir gemeint: „Bäh – du glaubst ja noch an den Osterhasen.“
Ob es nun der Osterhase war oder nicht wurde anschließend heftig diskutiert und ganz besonders die Mädchen zweifelten an meiner Aussage. Die einen glaubten immer noch daran und sahen mich sogar böse an deswegen, weil ich ja die Unwahrheit gesagt hätte. Andere, besonders die mit älteren Geschwistern, standen ganz auf meiner Seite.
Oh je, was ist das für eine Welt?, fragte ich mich. Mir schien plötzlich alles so verwirrt. Was kommt denn da noch so alles auf mich zu? Und mit zunehmendem Alter musste ich mir diese Frage immer öfter stellen.
Da gab es Onkels, die nicht meine Onkel waren. Da gab es Tanten, die nicht meine Tanten waren. Es gab Schwestern, die nicht meine Schwestern waren – und Osterhasen gab es auch keine – lieber Gott, was gibt es denn überhaupt?, fragte ich mich. Na ja, ein kleiner Trost blieb mir ja noch, es gab ja noch das Christkind. Oder sollte es das am Ende auch nicht geben? Es taten sich mir einige Zweifel deswegen auf, hatte doch meine Schwester diesbezüglich auch schon einige Andeutungen gemacht.
Das mit dem Osterhasen war schnell vergessen und die Kindergartenzeit doch gegen Ende hin sehr schön. Endlich merkte ich, dass es da ja noch viele andere Kinder im Dorf gab und ich mit den wenigen, die ich bisher kennen gelernt hatte, nicht die einzigen waren.
Auch war nun die Zeit gekommen, da ich erkannte, dass es noch andere Menschenarten auf dieser Welt gab.
Bei Einkaufsfahrten mit der Eisenbahn in die nahe gelegene Stadt Worms sah ich etwas, das ich trotz Erklärungen meiner Eltern lange Zeit nicht verstanden hatte. Da gab es sehr viele total zerstörte Häuser und nur hier und da stand noch eines, das nicht beschädigt war. Ich gab mich vorerst zufrieden auf die Antwort meiner Eltern, dass das im Krieg die Flieger mit ihren Bomben gewesen waren. Weshalb dies so war, hatte mich damals eigentlich gar nicht interessiert, darum ich auch weiter keine Fragen mehr stellte. Vermutlich auch deswegen, weil ich wusste, es eh nicht zu verstehen.
Wieder zur Rückreise am Bahnhof angekommen, setzten wir uns, da es noch einige Zeit dauerte, bis der Zug abfuhr, unsere in der Stadt gekauften Laugenbrezeln essend, in das riesengroße Zweite-Klasse-Wartezimmer. Nie zuvor sah ich solche Menschen, die hier in großer Anzahl saßen, Bier tranken und Zigaretten rauchten. Gesicht, Hände, alles ganz braun, manche sogar fast schwarz. Ich hatte sehr große Angst, was auch sofort meine Mutter bemerkte, indem sie meinte: „Du brauchst keine Angst zu haben, die tun dir nichts.“ Da, jetzt kam sogar einer auf mich zu. Er musste bemerkt haben, dass ich mich fürchtete und lächelte mich ganz lieb an. Verlegen senkte ich meinen Blick und von unten herauflinsend bemerkte ich, wie er sich mit tänzelndem Schritt wieder entfernte. „Das ist ein amerikanischer Soldat“, sagte meine Mutter, indem sie ihm noch eine Weile hinterher schaute.
Hätte er in dem Moment, als er vor mir stand, anstatt mich anzulächeln, „Buh“ gesagt, ich glaube, ich wäre vor Schreck vom Stuhl gefallen.
Neger, so durften sie damals noch genannt werden, hatte ich zuvor schon einmal auf einem Bild gesehen. Da war ein Dorf mit eigenartigen Hütten und eine aus Holzpfosten errichtete Mauer drumherum. Alle Menschen, die zu sehen waren, auch die Kinder, hatten eine dunkle Hautfarbe. Sie mussten sehr arm gewesen sein, denn sie hatten fast nichts anzuziehen. Die Frauen hatten große, ganz weiße Knochen, in die Haare gesteckt. Und – he, Moment mal – an dieser Stelle sollten mir doch auch die großen, nackten Brüste in Erinnerung sein? Nee, nichts. Entweder ich hatte gerade einen Blackout gehabt oder ich habe mir damals bei ihrem Anblick überhaupt noch nichts gedacht und sie einfach übersehen.
Was mich jedoch am meisten auf dem Bild beeindruckte, war der große Topf in der Mitte eines Platzes, in dem ein weißer Mann mit Hut saß. Die schwarzen Männer hatten Holz unter den Topf gelegt und es angezündet. Sie tanzten um den Topf herum und schienen sich schon sehr auf ihre Mahlzeit zu freuen. Dem Mann in dem Topf aber schien das alles gar keine Freude zu bereiten. An seinem bangen Gesicht und den Schweißtropfen auf der Stirn konnte man erkennen, dass das Wasser so langsam anfing, heiß zu werden.
Nicht gerade die beste Art, Kindern beizubringen, dass es noch andere Menschenarten auf dieser Welt gibt. Bis zu jener Begegnung im Wormser Bahnhof blieb dieses Bild in meinem Kopf als Vorurteil, alle Schwarzen müssten Menschenfresser sein.
Na ja, vielleicht war das Bild auch nur für Erwachsene bestimmt und ich hatte es rein zufällig in die Hände bekommen? Aber auch bei Erwachsenen könnten sich daraus doch Vorurteile gebildet haben?
Der Bahnhof Worms war bisher eigentlich oft der Ort seltsamer Begegnungen für mich. Einmal, ich saß wieder mit meiner Mutter da, auf den Zug wartend, da sprangen maskierte Leute, auf Besen reitend, laut schreiend umher und auf die Tische zu. Jedoch, obwohl die Hexenmasken sehr furchterregend aussahen, hatte ich überhaupt keine Angst, da ich wusste, es ist Fastnachtszeit und da maskieren sich die Leute eben. Ich selbst war ja zu Hause auch schon als Cowboy verkleidet und mit einem echten „Pulverblättchen“-Revolver bewaffnet. Die Hexen seien total harmlos und es wären verkleidete Wormser Straßenfeger, versicherte mir meine Mutter rechtzeitig.
Ja, Fasching, das war, neben Weihnachten, Ostern und Kirchweih, eines der größten Feste für mich. Mit den einfachsten Mitteln zurechtgemacht zogen wir Kinder am Fastnachtsdienstag los, um von den Einwohnern ein paar Pfennige zu erhaschen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Mama mir ein kariertes Hemd anzog, ein buntes Tuch um den Hals legte und von den beiden Enden her den Teil mit den Reibflächen einer Streichholzschachtel, darüber schob. Ein Streichholz wurde angezündet und ein Stück abbrennen lassen, um mit dem verbrannten Schwarz mir einen Schnurrbart unter die Nase zu malen. Dann nahm sie einen Fetzen rotes Krepppapier, feuchtete es mit Spucke an und machte mir damit die Wangen rot.
„Ich bin ein armer König, geb‘ mir nicht so wenig. Lass mich nicht so lange steh’n, denn ich muss noch weiter geh’n. Geld heraus, Geld heraus, sonst schlag ich euch ein Loch ins Haus.“ So hieß der Spruch, den wir an der Haustür aufzusagen pflegten. Hat man etwas geschenkt bekommen, hieß es: „Die/der gute Frau/Herr hat uns was gegeben, nächstes Jahr um diese Zeit da soll sie/er auch noch leben.“ Mir war echt Angst davor, nichts zu bekommen. Keineswegs, weil ich nun mal nichts bekommen hatte, sondern, nicht das Ende des darauffolgenden Spruches, der endete: „… soll sie/er nicht mehr leben“, sagen zu müssen. Aber zum Glück war dieser Fall nie eingetreten.
Eines jedoch machte mich auf unserer Tour stets wütend. Wenn die Leute, die wir besuchten, fragten: „Wie heißt du denn? Wer sind denn deine Eltern?“ Und je nachdem, wer die Eltern waren, entsprechend spendabel ihre Geldbörsen öffneten. Wieder auf der Straße, hatten wir nämlich jedes Mal verglichen, was jeder von uns bekommen hatte.
Egal, was es in dieser Zeit war, das ich in die Hände bekam und mit Fastnacht zu tun hatte, es hatte mich immer wieder fasziniert. Die bunten Luftschlangen, das Konfetti, ein Hütchen, das die Eltern von einer Karnevalssitzung mit nach Hause brachten, etc., ich war einfach immer hin und weg. Und wenn Papa bunte Papierreste mit nach Hause brachte, die er bei seiner Hilfe zum Herrichten der Umzugswagen aufgehoben hatte, war die Freude riesengroß. Zum Teil auch für die bald anstehende Schmückung der Stabausstecken fanden sie noch sehr gute Verwendung. Fehlte dann nur noch eine große Brezel auf der Stabspitze und schon konnte losgezogen werden, vornehmlich zu den Verwandten, um dort mit einem Liedchen deren Wohlgefallen zu wecken. Und dann hieß es: „So, moin Buu, unn weil du jetzt so schee gesung hoscht, krieschde aach wass.“
Ja, bei uns im Ort, da wurde und wird das rheinhessische Platt gesprochen. Jeder verstand jeden, nur, wer meinte etwas Besseres zu sein, versuchte sich in Hochdeutsch. Da wurde ich schon das eine oder andere Mal von einer Tante ermahnt, doch schöner zu sprechen. „Awwer, isch hab mer do nix saa geloss unn so wie immer weitergebabbelt!“ Denn, weshalb sollte ich so reden, wie mich auf der Straße eh keiner verstand? Außer im Kindergarten wurde auch in der Kirche hochdeutsch gesprochen und gesungen. Nur manchmal konnte man eine Sprache überhaupt nicht verstehen, Latein. War wohl nur für die Erwachsenen, weil wir Kinder es nicht verstehen sollten, dennoch, mit „blablabla“ ist einfach nachgeäfft worden. Wäre dies nicht so gewesen, die bald beginnende Schulzeit wäre so manchem Schüler noch sehr viel schwerer gefallen. Denn aus dem „Dippsche“ wurde ein Töpfchen, aus dem „Hawwe“ ein größerer Topf, die kleine Schwester davon war das „Häwwelsche“. Auch den Unterschied zwischen einer Kartoffel und einer „Grumbeer“ konnte man erfahren – es gab nämlich gar keinen.
Unser Wohnhaus
Unser Wohnhaus mit Schreinerei befand sich ziemlich genau in der Mitte unseres Wohnortes in einer schmalen Gasse, die „Kleine Belzgasse“. Papa hatte es von seiner Mutter vererbt bekommen, da er sich bereit erklärte, im Alter für sie zu sorgen.
Das Wohnhaus war direkt an die Straße gebaut und im hinteren Teil des Grundstücks befand sich die Werkstatt, ein großer Stall, der umgebaut und zur Werkstatt hinzugenommen wurde, ein kleiner Schweinestall und ein Klohäuschen. Etwas außerhalb der Mitte des Hofes nach rechts war ein großes viereckiges Loch im Boden, in das der Schweinemist und mancher Küchenabfall verbracht wurde. Ja, sogar das „Nachtdippche“ wurde dort entleert, wobei der eher feste Inhalt mit etwas Stroh zugedeckt wurde.
Im Erdgeschoss des Wohnhauses war die Küche, ein größeres und ein kleines Zimmer. Im ersten Stock gab es ein großes und zwei kleine Schlafzimmer. Über dem großen Zimmer im Erdgeschoss gab es einen weiteren Raum, der nicht ausgebaut war und an dem zur Einfahrt hin eine Wand fehlte. Dort und auch über der Hofeinfahrt war früher das Stroh und Heu für das Vieh und später mehrere Särge gelagert, die schon fast fertig angeliefert wurden.
An der Einfahrt befand sich ein riesengroßes hölzernes zweiflügeliges Hoftor. Von innen betrachtet war der rechte Flügel einmal am Boden mit einem Riegel und einmal an der Wand mit einer langen Eisenstange befestigt. Der linke Flügel wurde von dem rechten durch einen Falz, der über den Falz des anderen Flügels ging, zugehalten. In dem linken Flügel war eine kleinere Eingangstür eingebaut. Die eiserne Haltestange diente uns Kindern als willkommenes Turngerät. Konnten an ihr doch die tollsten Glimmzüge gemacht werden.
Heutzutage nicht mehr vorstellbar, aber der Schlüssel des Hoftores hing bei Abwesenheit stets hinter dem Klappladen am Fenster des kleinen Zimmers, das zur Straße ging, und der Schlüssel zur Haustür lag auf der Fensterbank eines kleinen Fensterchens direkt neben der Tür.
Am hinteren Ende der Hofeinfahrt lag oben, in etwa 4 Meter Höhe, quer ein großer dicker Balken. Um ihn war eine starke Kette gewickelt, die nach unten hing und seitlich an der Wand befestigt war. An diese Kette hängte der Metzger beim Schlachten die Schweine. An dem aufrechten Balken, an der Seitenwand der Einfahrt, die in Fachwerk gebaut war, steckten mehrere Sicheln und Bau-Stahlklammern. Zudem bündelweise lange papierene Schnüre, mit einem runden Holzstückchen am jeweiligen Ende. Diese dienten bei der Getreideernte zum Binden der Garben.
Auch von unserer Küche ging ein Fenster in die Einfahrt. Leute, die zu Papa in die Werkstatt wollten, kamen immer erst an dieses Fenster und klopften. Noch heute höre ich meine Mutter sagen: „Er iss dehinne“. Was so viel heißt wie: Gehen sie nur hinter, mein Mann ist in der Werkstatt.
Von der Einfahrt führten zwei Stufen ins Wohnhaus. Hier saßen gelegentlich die armen Männer und Frauen, die umherzogen und bettelten. Mama gab ihnen etwas zu essen und an einen, den sie auch „De Bisquit“ nannten, kann ich mich noch besonders gut erinnern. Er sang zum Dank immer, teils sogar jodelnd, ein Liedchen.
Im Hausflur ging es gleich links neben der Eingangstür eine steile Treppe nach oben zu den Schlafzimmern. Links hinter der Treppe befand sich die Küche, von der ein weiteres Fenster nach hinten in den Hof ging. Von hier hatte man den besten Blick über den Misthaufen auf die Werkstatt. Zum Haus hin war jedoch an der Mistgrube eine Mauer, die etwa einen halben Meter hoch war, auf die Mama alljährlich Blumen stellte. Überhaupt hatte sie im Hof stets mehrere Kübel – vornehmlich mit Geranien – stehen, sodass die hässliche Grube fast ganz verdeckt war.
Von der Küche ging eine Tür in einen kleinen Raum, in dem Wäsche gewaschen und Vorräte aufbewahrt wurden. Von diesem Raum führte eine Betontreppe hinab in einen kleinen Keller. Hier lagerten Kohlen, Briketts und Kartoffeln und in der Ecke gab es einen Sandkasten, in den Karotten und andere Wurzelgemüse über den Winter eingeschlagen waren. An der Wand war ein Regal befestigt, auf welchem Gläser mit Obst oder Marmelade und nach einer Schlachtung auch die Dosenwurst standen.
Dieser Keller hatte für mich als kleines Kind immer etwas Unheimliches an sich. Da es dort unten noch kein elektrisches Licht gab, musste mit einer Kerze runter gegangen werden. Und, man war nicht einmal die Treppe ganz drunten, war diese Kerze bereits erloschen. Womöglich war das kleine Kellerfenster, das auf Lüftung gestellt war, die Ursache.
Im Hof rechts, ganz nah beim Haus, befand sich das Klohäuschen. Eine Tür, die von außen mit einem Riegel und von innen mit einem Haken geschlossen wurde, war aus Brettern angefertigt, durch deren Schlitze man gut nach draußen sehen konnte. Ein Herzchen weiter oben in der Mitte der Tür diente wohl zur Be- beziehungsweise Entlüftung, sowie dazu, dass etwas Licht ins Innere fiel. Seitlich, auf einem Holzkasten mit Sitz, Deckel und einem großen Loch in der Mitte, waren stets alte Zeitungen gestapelt. Wozu? Da braucht man nicht lange zu raten.
Zum Glück mussten wir kleinen Kinder dieses Klo nicht benutzen. Dafür gab es noch ein Töpfchen mit Deckel, das im Falle der Notdurft im kleinen Raum hinter der Küche jederzeit zur Hand gewesen war. Verrichtet worden ist dann in der Küche.
Stets war Eile angesagt, hätte doch jederzeit jemand zu Besuch kommen können, was selbstverständlich hin und wieder auch geschah. Dann das Töpfchen unter den Hintern geklemmt und ab, in das kleine Kämmerchen nebenan. Das konnte schon eine ganze Weile dauern, bis man dieses Versteck wieder verlassen konnte. Mit der Zeit kam das sogar so, dass ich, ob ich nun auf dem Töpfchen saß oder nicht, bei Besuch schleunigst in dieses Kämmerchen verschwand.
Und wenn dann noch die alte Frau, „Es Gretasche“, die uns fast täglich besuchte und nicht nur mir beinahe zu einer Plage wurde, war die Not groß. Meistens kam sie kurz vor dem Mittagessen, vermutlich um sich mal wieder zum Essen einladen zu lassen und nervte total mit ihrem ständigen: „Isch geh jetzt“, „Aller donn, isch werr jetz mol geh.“ Und ich saß im Kämmerchen und dachte: „Ei wonn se doch emol endlisch geh det!“, denn so konnte sich das Spielchen eine ganze Weile hinziehen. Und wenn ich es da drinnen nicht mehr aushielt und dann doch herauskam, meinte sie mit einer erhöhten Stimme: „Ach, wu kimmschden du jetz her?“, und mir fehlten dann oft die Worte, sodass sich Mama mal wieder etwas hat einfallen lassen müssen.
Eben diese Frau hatten mein Bruder und ich so sehr ins Herz geschlossen, dass wir jederzeit dazu bereit waren, ihr einen Schock fürs Leben zu versetzen. Na ja, die Zeit kam und es wurden mal wieder neue Särge angeliefert. Und bevor sie hoch ins Lager geschafft wurden, standen sie noch eine Weile in der Hofeinfahrt.
Seitlich den Deckel angehoben, eingestiegen, Deckel zu und gewartet. Es war nicht unbedingt Zufall, dass wir genau die Zeit gewählt hatten, als sie mal wieder unterwegs war. Das Tor ging auf, sie kam herein, ich im Sarg machte: „Buuhbuuh“ und hob den Deckel. Ein Schrei war zu hören und dann dennoch ein lautes Gelächter: „No, wass henn er misch awwer jetz veschreckt“, meinte sie noch, mit einem abschließendem „Hihihi“.
Wir hatten zwar unseren Spaß gehabt, doch den Eindruck, dass es für sie ein Schock war, hatten wir nicht. Na, jedenfalls besuchte uns die alte Dame weiterhin sehr regelmäßig und die Särge waren bald wieder aus der Einfahrt verschwunden.
Auch wenn die Särge wieder ins Lager verbracht waren, machte die kleine Marga stets, wenn sie ihre Oma in der Vorstadt besuchte, einen großen Bogen um unser Anwesen. Hatte doch irgendwann auf dem Weg dorthin wieder einmal unser Hoftor aufgestanden und, der reinste Horror für sie, es waren gerade neue Särge angeliefert worden.
Nein, dies konnte nicht für sie der Anlass gewesen sein, in späteren Jahren in die USA auszuwandern.
Hier, in der Einfahrt, gab es noch einen meiner ganz besonderen Lieblingsplätze. Hinter den an der Wand anlehnenden Holzdielen und Brettern hatte Papa alte Glaskisten gestapelt. Holzwolle, welche ursprünglich in den frisch gelieferten Kisten das Glas vor dem Umfallen und somit Bruch schützte, war zu eventuellen späteren Zwecken in die obere Kiste gestopft und dort aufgehoben worden. Eine Leiter, die eigentlich zum Hochsteigen in das Sarglager diente, lehnte dort, ganz offenbar aus Erwachsenensicht unverantwortlich, neben dem Langholz an der Wand. Für mich ideal zum Einsteigen in die Kiste. Das war von nun an mein Reich. Was für andere ein Baumhaus ist oder war, das bedeutete für mich die Holzwolle gefüllte Glaskiste. Waren irgendwelche Geräusche zu hören, die andeuteten, dass sich jemand näherte, verharrte ich ganz still da oben, wobei ich durch die freien Spalten die Umgebung beobachtete. Manchmal durften sogar Jungs und Mädchen aus der Nachbarschaft, die mutig genug waren, mit dort hinauf, in mein geliebtes gemütliches „Hochhaus“. Nie, wenigstens, dass ich es mitbekommen hätte, ist mein geheimes Reich entdeckt worden. Ich möchte nicht unbedingt behaupten, dass ich, was meine Kletterkünste anging, der Mutigste war. Aber, so manch interessante Orte auf unserem Anwesen wurden zwar unbedacht, aus reiner Neugier jedoch stets ganz vorsichtig erklettert. Zwar ließ ich mir für das Wann und Wo stets Zeit, irgendwann einmal aber kam die Gelegenheit und ich war körperlich dazu imstande.
So war meine nächste – nicht ganz ungefährliche – Tour, ohne Leiter hoch über das Sarglager auf den oberen Speicher zu gelangen. Dazu bot sich das große direkt angrenzende Hoftor mit seinen waagerechten, von innen unverkleideten Holzrahmen, perfekt an. Zuerst mit dem linken Fuß auf den unteren, waagerechten Rahmen des kleinen Tors, dann mit dem rechten Fuß auf die Türklinke, dann mit dem linken Fuß auf den oberen Rahmen, dann auf eine Strebe des großen Tors, ein Griff zu einem Balken nach links, jetzt nur noch hochziehen und oben war ich. Erst jetzt kamen mir Bedenken, wie ich wohl wieder da hinunterkommen würde, aber, das hatte ja noch Zeit. Oben, auf dem Boden des Sarglagers, lehnte an der Wand eine alte Tragbahre, mit der zu früheren Zeiten angefertigte Türen und Fenster zu den Kunden transportiert wurden. Auch für den Transport von Särgen musste sie gelegentlich dienlich sein. Hier oben, für ihren letzten Zweck, war sie in erster Linie dazu gedacht, dem Schornsteinfeger zuerst auf den Dachboden und weiter hoch auf das Dach zu helfen. Die Bahre bestand aus zwei Längs- und drei Querteilen. Die Querteile dienten als Leitersprossen und waren eigentlich für einen kleinen Kerl wie mich in einem zu großen Abstand zueinander angeordnet.
Dennoch, mein Vorhaben gelang. Auch musste ich hier nicht allzu große Bedenken haben, was einen eventuellen Sturz betroffen hätte. Lag doch unter dieser Leiter dermaßen viel altes Stroh, sodass ich nicht sehr hart hätte fallen können.
Oben angekommen, sah ich, dass es da auf das Dach ja noch ganz gut weiter ging. Auf dem Boden stand eine Kiste, auf die eine größere Person steigen und durch das Dachfenster auf das Dach gelangen hätte können. Doch alles Hochhangeln half nichts, es war einfach noch nicht zu schaffen. Da musste ich wohl noch ein, zwei Jahre warten, bis das gelingen könnte.
Die Mühe hatte sich aber trotzdem gelohnt. Fand ich doch auf dem Dachboden so manchen Gegenstand, der an Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum alljährlich wieder auftauchte: Die Puppenküche meiner Schwester, meinen Kaufladen mit allem möglichem Zubehör und einige andere Dinge. Aha, jetzt erkannte ich auch, wie diese Sachen hierhergebracht wurden. Auf dem Boden war eine große Holzplatte aus mehreren Brettern bestehend. Als ich sie anhob und hinunterschaute, konnte ich zu meiner Verwunderung auf die Treppe zum Flur vom Erdgeschoss ins Obergeschoss schauen. Behutsam und mit einiger Mühe schloss ich diese für mich doch sehr schwere Klappe wieder und war somit eine große Erfahrung reicher. Ich wusste, hier herauf würde ich noch häufiger klettern.
Doch nun stand noch der erste große Abstieg bevor. Auch hatte man mich im Haus schon vermisst und nach mir gerufen. Aber ich wusste, wenn ich mich nun melden würde, hätte ich mir ziemlich unliebsame Fragen anhören müssen. „Wo hast du dich denn wieder herumgetrieben?“, hätte wohl eine der Fragen gelautet. Und als ehrlicher Junge, der ich immer war, wäre mein Geheimnis schnell keines mehr gewesen.
Es klappte eigentlich prima mit dem Runterklettern. Außer am letzten Abschnitt, hier hatte ich ein Problemchen. Irgendwie hatte ich den falschen Fuß zuerst nach unten gesetzt und so hing ich da über dem kleinen Hoftor und konnte nicht mehr nach oben zurück, um einen neuen Anlauf zu nehmen. Also blieb mir nur, nach unten zu springen. War auch nicht so schlimm, wie ich zuerst angenommen hatte. Ein letzter Blick noch nach oben, ein erleichterter Schnaufer dazu und ich war in diesem Moment der stolzeste Junge der ganzen Welt.
Ach ja, die lieben Mädchen. Mit gerade einmal 4 Jahren hat man zu Mädchen eine ganz andere Einstellung als in späteren Jahren. Da schien noch eher ein gewisser Instinkt im Vordergrund stehen, sie zu betrachten, zu berühren oder gar zu beschnuppern. Ja und es gab die ersten festgestellten Unterschiede zwischen ihnen. War mein Geruchssinn damals schon sehr ausgeprägt, stellte ich fest, dass eins der Mädchen einem Geruch nahe kam, der jemandem anhaftete, wenn im elterlichen Betrieb Land- Viehwirtschaft betrieben wurde. Das andere Mädchen hatte da schon einen total anderen Geruch anhaften, der in meiner Nase ganz anders, angenehmer, leckerer und interessanter wirkte. Und tatsächlich sollte sich alsbald herausstellen, wes Ursprungs dieser Duft wohl sein mag. Nahm mich doch jenes Mädchen mit zu sich nach Hause, was nicht einmal hundert Meter von unserem Haus entfernt war, und zeigte mir ihr Aquarium, welches auf einem Schränkchen im Flur stand, mit sehr vielen kleinen rot, blau und grün schimmernden Fischlein. Sie gab mir eine kleine Büchse mit Futter für die lieben Tierchen und ich war sehr, sehr begeistert, dass ich dies tun durfte, die Fischlein zu füttern.
Hmmm! Und sie dufteten, die kleinen Futterflöckchen, echt, sehr lecker. Es fiel mir plötzlich wie Schuppen von den Augen, ich hatte die Quelle des dem Mädchen anhaftenden Geruchs entdeckt.
Noch heute, wenn mir dieser Duft einmal wieder in die Nase strömt, muss ich an jenes süße kleine, appetitanregende Mädchen mit den schwarzen Haaren und an die Futterflöckchen denken; und, dieser Duft ist mir immer noch ein eher willkommener.
Besuch von Tante Katharina und Edgar
Immer wieder freuten wir uns über den Besuch unserer Tante aus der Pfalz. Eigentlich kam sie in erster Linie, um ihre Mutter, meine Oma, zu besuchen. Ganz gespannt warteten wir Kinder schon auf das, was sie uns mitgebracht haben könnte. Nie waren wir enttäuscht, denn sie brachte stets Bonbons und Schokolade mit, was wir von unseren Eltern aus finanziellen Gründen doch eher vorenthalten bekamen.
Die Tante war stets lustig, sie plapperte wie ein Wasserfall, aber sie stellte uns auch Fragen, ohne uns damit in Verlegenheit zu bringen. Ganz besonders fiel mir an ihr auf, dass sie in vielen Gesichtszügen meinem Vater sehr ähnlich war. Irgendwie verzog sie eigenartig ihren linken Mundwinkel beim Sprechen und ihre Sprache war ganz anders als unsere. Wir sagten zum Beispiel: „Mer henn“, also: „Wir haben“, sie: „Mer hunn“, wir: „Mer sinn“, also: „Wir sind, sie: „Mer soin“. Immer, wenn sie diese Worte benutzte, wurde ich an einen Satz erinnert, den mein Onkel Emil, ihr Mann, bei einem Besuch bei ihnen einmal zu mir gesagt hatte, ich aber die Zusammenhänge erst sehr viel später verstand: „Hunnsche gesie, wie se gebohrmeißelt hunn?“ Also: Hast du gesehen, wie sie gebohrmeißelt haben? Und meinte damit zwei Vögel, ich nehme an, es waren Spatzen, die sich auf einem Baum gerade paarten. Zu jener Zeit dachte ich noch, die Vögel spielten miteinander.
Die Tante forderte uns, wenn sie bei uns zu Besuch war, immer wieder auf, mit ihr Spiele zu machen. Ihr Lieblingsspiel neben „Mensch ärgere dich nicht“ war „Spitz pass auf“. Bei diesem Spiel wurden an die Spielfiguren des „Mensch ärger dich nicht“ etwa 60 bis 70 Zentimeter lange Schnüre gebunden, die kleinen Püppchen in der Mitte des Tisches beisammen hingestellt oder gelegt, die Schnüre dann zu jedem Mitspieler hingelegt und von diesem in die Hand genommen. Ein Mitspieler hatte einen Becher in der Hand und wenn er rief: „Spitz pass auf!“ und mit dem Becher versuchte die Püppchen zu fangen, mussten alle blitzschnell an der Schnur und sie somit vom Tisch ziehen. Wessen Püppchen gefangen wurde, musste ein Pfand hinterlegen. Dazu wurde etwas verwendet, das in größerer Anzahl im Haus vorhanden war. In unserem Falle waren das getrocknete Bohnen. Auch Erbsen oder Knöpfe kamen hierfür in Frage. Wer zuerst alle seine Pfände, die vorher ausgeteilt wurden, abgegeben hatte, war der Verlierer des Spiels.
Einmal zeigte uns die Tante einen tollen Trick mit Knöpfen. Sie nahm einen Knopf mit Löchern, steckte durch ein Loch einen dünnen, etwa 70 bis 80 Zentimeter langen Nähfaden und dann zu einem anderen Loch wieder zurück. Die beiden Enden verknotete sie miteinander und schob den Knopf in die Mitte. Dann der große Moment. Sie schob die rechte Seite der Fadenschlaufe über den rechten Daumen und die linke Schlaufe über den linken Daumen. Dann ließ sie das Ganze etwas locker, so dass der Knopf nach unten hing, und mit einer kreisenden Schleuderbewegung der beiden Hände brachte sie den Knopf dazu, sich wie in einem großen Rad zu drehen und dabei die beiden rechts und links von ihm befindlichen Fäden miteinander zu verdrallen. Dann zog sie auf beiden Seiten, lies wieder los, zog wieder, lies wieder los und wiederholte diesen Vorgang ständig – hei, war das eine Freude, wie sich der Knopf dabei mal in die eine, dann in die andere Richtung drehte. Je nachdem, wie fest sie an den Enden zog, veränderte sich der Summton und das Aussehen des Knopfes. Viele verschiedene Knöpfe hatten wir noch ausprobiert und einen großen Spaß dabei gehabt.
Tantes Sohn, mein fünf Jahre älterer Cousin Edgar, hatte es ganz besonders gerne mit mir zu tun. Immer wieder erdachte er sich Möglichkeiten aus, mich bei guter Laune zu halten.
Einmal, es war an einem wunderschönen Früh-Sommertag. Die Sonne stand schon so hoch, dass sie über die hohen Wände und Dächer um unser Anwesen strahlte. Edgar besuchte mal wieder unsere Oma, die er Mutter nannte, weil seine Mutter sie auch so anredete. Wir spielten Verstecken und Nachlaufen. In unserem Hof kam er auf die Idee, mit mir Cowboy und Indianer zu spielen. Er als Cowboy und ich als Indianer.
Auf diese Idee gekommen zu sein, sollte ihm noch sehr leid tun. Ich bin mir sicher, dass es ihm hinterher, obwohl er es nicht zeigte, sehr weh getan hatte.
Er holte nämlich einen Stuhl aus der Küche, stellte ihn mitten in den Hof, dann nahm er ein Seil, das an der Wand an einem Balken hing und irgendwoher, ich meine, von hinten, hinter dem Schweinestall, da, wo das Brennholz gelagert war, hatte er plötzlich ein Beil geholt. Er setzte sich auf den Stuhl und ließ sich, unter seiner Mithilfe, von mir festbinden. Zuvor zeigte er mir noch, was ich nach der Fesselung machen sollte, nämlich, mit dem Beil in der einen Hand und mit der anderen Hand immer wieder auf den Mund schlagend um den Stuhl tanzen, sodass dabei ein typisches Indianergeheul ertönen sollte.
Gesagt getan, Edgar saß gefesselt auf dem Stuhl und Helmutchen tanzte mit dem Beil in der Hand heulend um ihn herum.
Ja, das musste ziemlich indianermäßig ausgesehen haben. Aber Edgar war das noch nicht echt genug. Er forderte mich auf, ihm Angst zu machen, indem ich auf ihn losgehen sollte, um ihm seinen Skalp zu holen. Machte ich – und bums, Edgar hatte das Beil am Kopf. Ich wollte ihm gar nicht weh tun, das ergab sich eben so. Edgar befreite sich schnell von seinen Fesseln und lief ins Haus, die vermutlich entstehende Beule mit Wasser zu benetzen.
Ich war doch sehr besorgt um ihn, dann aber nicht weniger erleichtert, als er wieder zurückkam und mir versicherte, es habe überhaupt nicht weh getan. Eine Rötung und kleine Schwellung meine ich aber doch gesehen zu haben.
Edgar war mir dieser Blitzattacke wegen nie nachtragend. Ganz im Gegenteil, er schien sogar riesigen Spaß dabei gehabt zu haben.
Mit Mama im Garten
Große Freude machte es mir, mit Mama in den Garten zu gehen, durfte ich mich doch, als ich noch kleiner war, auf dem Weg dorthin in unser Handwägelchen setzen.
Im Garten auf die „Huschhusch“ warten, war stets eine Besonderheit. Wenn Mama sagte: „Schnell, geh hoch, äwe kimmt se!“, bin ich ganz schnell hoch an den Zaun gerannt und habe gewartet. Schon wenn sie im circa dreihundert Meter entfernten Bahnhof losfuhr, hörte man sie schnaupen und stampfen. Wenn sie dann kurz Fahrt aufgenommen hatte, hörte man am Bahnübergang einen lauten Pfiff.
Und da kam auch schon das schwarze Ungetüm. Dampfend und qualmend kam es immer näher und ich hatte schon ein wenig Angst, das schwere Ding würde mal den zwei Meter hohen Bahndamm herunterfallen. Mamas Aufforderung: „Hopp, wink doch emool!“, machte mich überglücklich, wenn die Leute im Zug zurückwinkten oder gar, wie einmal geschehen, der ganz schwarz angezogene Mann einen kurzen Pfiff seiner Dampflok hören ließ und mir zuwinkte. Mama meinte dann noch: „Hörschdes? Jetz fährt se de Buckel enuff, no Gundem, unn do macht se, Pefferdittsche helf mer bissje, Pefferdittsche helf mer bissje, unn waad emol, wonn se nochher widder de Berg erunner kimmt, macht se, isch habs geschafft, isch habs geschafft.“ – Und, was soll ich sagen, es hatte tatsächlich gestimmt, genauso hatte es sich auch angehört.
Noch sehr oft ging ich mit Mama in den Garten, während mein kleiner Bruder zu Hause bei Oma bleiben musste. An unserem kleinen Brunnen sitzen und im Wasser planschen machte stets große Freude. Nur die Tiefe konnte ich damals noch nicht so richtig abschätzen und ich hatte höllisch Angst, da hineinzufallen und zu ertrinken.
Tatsächlich war das Wasser aber höchstens einen halben Meter tief und schwankte in der Höhe mit dem Grundwasserspiegel.
Eins jedoch musste ich irgendwann einmal feststellen, wie schwer nämlich so eine Lokomotive wirklich ist. Zuerst legte ich Schnecken, die ich eingesammelt hatte, auf die Gleise und dann kleine Steine. Die Schnecken, die es nicht schafften, die Flucht zu ergreifen, die waren platt wie – ja, noch platter als – ein Pfannkuchen. Und die Steine, da war nur noch Staub und Mehl übrig.
Irgendwann einmal entgleiste ganz in der Nähe am Bahnübergang ein Zug, und da wurde mir erst bewusst, dass ja auch solche Steine dies hätten bewirken können und ich hörte mit einem Grausen im Nacken mit diesen Spielchen sofort auf. Na ja, redete ich mir, mein Gewissen zu erleichtern, ein, dass es doch nur sehr kleine Steine gewesen sind.
Mama hatte keine Ahnung, was ich da oben so trieb. Sie sagte immer nur: „Kumm erunner, sunschd bassiert noch ebbes wonn de Zuuch kimmt!“
Die Einschulung
Mein erstes Schuljahr
Einer der ganz großen Tage in meinem Leben war die Einschulung in die katholische Bekenntnisschule und somit mein erster Schultag.