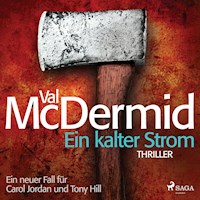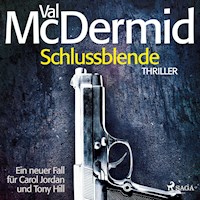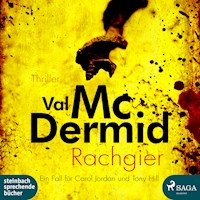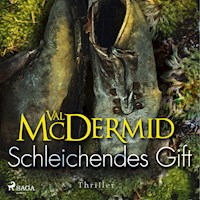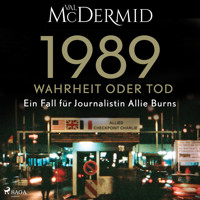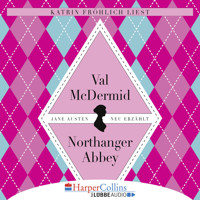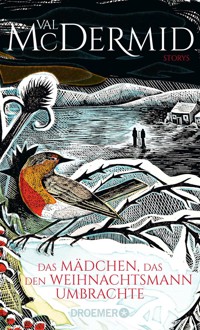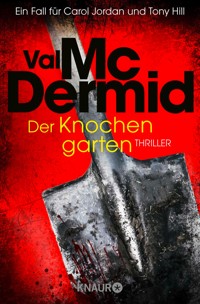
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carol Jordan und Tony Hill
- Sprache: Deutsch
Die berühmte wie spannende Thriller-Reihe um Detective Chief Inspector Carol Jordan und Profiler Tony Hill geht weiter! Die Neuerscheinung der Thriller-Queen Val McDermid: der 11. Fall des kultigen Ermittlerduos sorgt selbst bei hartgesottenen Thriller-Fans für schlaflose Nächte. Auf dem Gelände eines ehemaligen katholischen Waisenhauses für Mädchen wird ein grausiger Fund gemacht: Bauarbeiten fördern insgesamt vierzig Skelette zutage, die offenbar über Jahrzehnte unter dem Rasen und dem Nutzgarten vergraben wurden – zu einer Zeit, als Nonnen dort ungestört ihr unerbittliches Regime ausüben konnten. Handelt es sich bei den Toten um Mädchen aus dem Waisenhaus? Das Major Incident Team aus Yorkshire würde zu gern auf die Erfahrung und untrüglichen Instinkte von Carol Jordan und Profiler Tony Hill zurückgreifen, doch Carol hat gekündigt, und Tony verbüßt eine vierjährige Haftstrafe … Keine guten Voraussetzungen, um die grauenhaften Verbrechen aufzuklären. Was wurde all den jungen Menschen angetan? Die britische Bestseller-Autorin Val McDermid genießt unter Fans psychologischer Thriller längst Kult-Status. Raffinierte Plots und starke Charaktere zeichnen ihre spannende Thriller-Reihe aus, die auch immer wieder auf aktuelle gesellschaftliche Themen Bezug nimmt. Val McDermid ist mit ihren Thrillern eine Klasse für sich! Denglers Buchkritik Val McDermid (...), die dunkle Königin der schottischen Kriminalliteratur, hat seit Mitte der achtziger Jahre gefühlt hundert absolut einwandfreie Thriller geschrieben. Tagesspiegel online Die Thriller der spannenden Jordan/Hill-Reihe: Bd. 1: Das Lied der Sirenen Bd. 2: Schlussblende Bd. 3: Ein kalter Strom Bd. 4: Tödliche Worte Bd. 5: Schleichendes Gift Bd. 6: Vatermord Bd. 7: Vergeltung Bd. 8: Eiszeit Bd. 9: Schwarzes Netz Bd. 10: Rachgier Bd. 11: Der Knochengarten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Val McDermid
Der Knochengarten
Thriller
Aus dem Englischen von Ute Brammertz
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Auf dem Gelände eines ehemaligen katholischen Waisenhauses für Mädchen wird ein grausiger Fund gemacht: Bauarbeiten fördern insgesamt vierzig Skelette zutage, die offenbar über Jahrzehnte unter dem Rasen und dem Nutzgarten vergraben wurden – zu einer Zeit, als Nonnen dort ungestört ihr unerbittliches Regime ausüben konnten. Handelt es sich bei den Toten um Mädchen aus dem Waisenhaus? Das Major Incident Team aus Yorkshire würde zu gern auf die Erfahrung und untrüglichen Instinkte von Carol Jordan und Profiler Tony Hill zurückgreifen, doch Carol hat gekündigt, und Tony verbüßt eine vierjährige Haftstrafe … Keine guten Voraussetzungen, um die grauenhaften Verbrechen aufzuklären. Was wurde all den jungen Menschen angetan?
Der 11. Fall für das legendäre Ermittlerduo – von Englands unangefochtener Queen of Crime.
»Val McDermid ist mit ihren Thrillern eine Klasse für sich!« denglers-buchkritik.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
Danksagung
Zitatnachweise
Für unsere Freunde in East Neuk
Prolog
Wir alle sind Gewohnheitstiere. Sogar Mörder. Laufen die Dinge gut, machen wir einen Talisman für unseren Erfolg verantwortlich. Eine Glück bringende Hose; sich nicht zu rasieren; die immer gleichen Handlungen in der richtigen Reihenfolge auszuführen; das immer gleiche Frühstück; auf der rechten Straßenseite zu gehen. Wenn Mörder uns ihre Talismane enthüllen, nennt man das eine Signatur.
Aus: Verbrechen lesenvon DR. TONYHILL
An Mord hatte Mark Conway an diesem Samstagnachmittag nicht im Entferntesten gedacht. Obwohl er sich gern als Fachmann auf dem Gebiet sah, war er dennoch in der Lage, die verschiedenen Teilbereiche seines Lebens voneinander getrennt zu halten. Und heute ging es für ihn ausschließlich um Fußball. Er stand vor der Glaswand des Vorstandszimmers von Bradfield Victoria, ließ geistesabwesend den Rotwein in seinem großzügig bemessenen Kelch kreisen und betrachtete die Massen, die ins Stadion strömten.
Er wusste, was sie fühlten. Conway hatte früher selbst zum einfachen Volk gehört. Ein Spieltag bedeutete abergläubische Rituale. Seit dem Nachmittag vor zwanzig Jahren, als die Vics den League Cup gewonnen hatten, hatte er immer dasselbe Paar schwarzer Strümpfe mit einem tanzenden Snoopy getragen. Das tat er immer noch, auch wenn er das unangemessene Design heutzutage unter feiner schwarzer Seide verbarg. Millionenschwere Geschäftsmänner trugen keine Cartoon-Socken.
Ein Spieltag bedeutete auch ein leichtes Kribbeln der Vorfreude in Brust und Magen. Selbst bei Spielen, die keine Auswirkungen auf die Tabellenplatzierung oder die nächste Runde des Cups hatten, vibrierte die Aufregung in ihm, eine elektrische Ladung in seinem Blut. Wer würde fürs Team aufgestellt werden? Wer würde bei der Partie Schiedsrichter sein? Welche Überraschung würde das Wetter bereithalten? Würde das Ende des Nachmittags Freudentaumel oder brennende Enttäuschung mit sich bringen?
Das bedeutete es, ein Fan zu sein. Und obwohl Mark Conway jetzt Mitglied im Aufsichtsrat des Vereins war, zu dessen Fans er von Kindesbeinen an zählte, blieb er genau das – ein Fan. Er hatte sich heiser geschrien, während sie aufstiegen – und einmal auf unvergessliche Weise abgestürzt waren –, durch die Ligen bis zu ihrer aktuellen Platzierung als Sechste in der Premier League. Es gab nur eines, was ihm einen noch größeren Kick gab als ein Sieg der Vics.
»Glauben Sie, wir haben heute eine Chance?«
Die Stimme an seiner Schulter brachte Conway dazu, sich von der Aussicht abzuwenden. Der Commercial Director war hinter ihn getreten. Conway kannte den Beweggrund: Der Mann versuchte bereits, die Bandenwerbung für die nächste Saison unter Dach und Fach zu bringen, und er hätte lieber früher als später Conways Namen auf einem Vertrag und sein Geld auf dem Bankkonto. »Heutzutage ist es schwer, die Spurs zu schlagen«, sagte Conway. »Aber Hazinedar ist in Topform. Vier Tore in den letzten drei Spielen. Eine Chance müssen wir haben.«
Der Commercial Director setzte zu einer ausführlichen Analyse beider Teams an. Small Talk lag ihm nicht, und innerhalb von zwei Sätzen verflüchtigte sich Conways Aufmerksamkeit, und sein Blick schweifte durch den Raum. Als er Jezza Martinu erblickte, zuckten seine Lippen im Anflug eines Lächelns. Dies war ein Mann, der als Verkörperung der Fangemeinde hätte dienen können. Jezza war sein Cousin, ihre Mütter waren Schwestern. Laut Familienlegende war »Vics« das erste Wort, das Jezza gesagt hatte.
»Entschuldigen Sie mich bitte.« Conway leerte seinen Drink und trat an dem Commercial Director vorbei. Er ging an die Bar, wo die junge Frau, die die Drinks servierte, unvermittelt alle anderen Wartenden ignorierte und ihm ein frisches Glas Wein eingoss, das sie ihm mit einem raschen, angespannten Lächeln reichte. Er ging durch den übervollen Sitzungssaal auf seinen Cousin zu. Jezza war offensichtlich aufgeregt und redete auf den armen Kerl ein, den er am Buffett in die Enge getrieben hatte. Bradfield Victoria war seine Obsession. Gäbe es eine Kirche, in der Jezza dem Verein huldigen könnte, hätte er dort das Amt des Erzbischofs innegehabt.
Als Mark Conway seinem Cousin erzählt hatte, man habe ihn in den Aufsichtsrat berufen, hatte er geglaubt, Jezza werde in Ohnmacht fallen. Sämtliche Farbe war aus seinem Gesicht entwichen, und einen Augenblick war er ins Taumeln geraten. »Du kannst mit mir in die Vorstandsloge kommen«, hatte Conway hinzugefügt. Seinem Cousin waren Tränen in die Augen getreten.
»Wirklich?«, hatte er gehaucht. »Ist das dein Ernst? In die Vorstandsloge?«
»Und vor und nach dem Spiel in den Sitzungssaal des Vorstands. Du wirst die Spieler kennenlernen.«
»Ich fasse es nicht. Das ist alles, was ich mir je erträumt habe.« Er hatte Conway in eine Umarmung gezogen, ohne zu merken, dass jener zusammenzuckte. »Du hättest dir jeden aussuchen können«, war Jezza fortgefahren. »Jemanden, den du beeindrucken willst. Jemanden von der Arbeit, den du belohnen willst. Aber du hast mich ausgesucht.« Er hatte nochmals zugedrückt und dann losgelassen.
»Ich habe gewusst, was es dir bedeuten würde.« Was vollkommen der Wahrheit entsprach.
»Dafür kann ich mich niemals revanchieren.« Unwirsch hatte Jezza sich über die Augen gewischt. »Herrgott, Mark, ich liebe dich, Mann!«
Das war der Moment, auf den seine Planungen hingezielt hatten. An diesen begehrten Aufsichtsratssitz heranzukommen, hatte ihn eine beachtliche Geldinvestition gekostet und viele Schmeicheleien gegenüber Menschen, die er verachtete. Doch er wusste, wenn er Jezza Martinu erst einmal das goldene Ticket ausgehändigt hätte, würde sein Cousin alles dafür tun, um es zu behalten. Der letzte Baustein seiner Absicherungsstrategie für den Fall, dass seine ehrgeizigen Pläne nicht aufgingen. Conway hatte gelächelt. Es hatte aufrichtig gewirkt, weil es das auch gewesen war. »Ich werde mir schon etwas einfallen lassen«, hatte er gesagt.
Doch das hatte er längst getan.
1
Als eine kleine Gruppe FBI-Agenten die Idee zum Profiling hatte, wussten sie eines mit Sicherheit: dass sie nicht genug über die Gedankengänge derer wussten, die immer weiter töteten. Darum suchten sie an dem einen Ort, an dem zweifellos Experten zu finden waren: hinter Gittern.
Aus: Verbrechen lesen von DR. TONYHILL
Es war der Geruch, sobald er aufwachte, der ihm gewaltsam bewusst machte, wo er sich befand. Völlig unmöglich war ein ganz allmähliches Erwachen mit diesem momentanen Gefühl der Desorientierung, dieser halb wachen Frage: Wo bin ich? Zu Hause? Hotel? In jemandes Gästezimmer? Sobald sich sein Bewusstsein einstellte, tat das auch dieses Miasma, das Dr. Tony Hill ins Gedächtnis rief, dass er im Gefängnis war.
Jahre der Gespräche mit Patienten in geschlossenen psychiatrischen Kliniken bedeuteten, dass ihm der unangenehme Cocktail nicht fremd war. Schaler Schweiß, schaler Rauch, schale Leiber, schaler Essensgeruch, schale Fürze. Die säuerliche Note von Kleidung, die zu lange zum Trocknen gebraucht hatte. Der leicht vanillehafte Moschusgeruch von zu viel Testosteron. Und unter allem der scharfe Geruch billiger Reinigungschemikalien. In der Vergangenheit war er immer froh gewesen, dem Geruch der Inhaftierung zu entkommen und in die Welt draußen zurückzukehren. Heutzutage gab es kein Entkommen.
Er hatte geglaubt, er werde sich daran gewöhnen. Dass er nach einer Weile abgehärtet wäre. Doch auch nach sechs Monaten seiner vierjährigen Haftstrafe war da immer noch an jedem einzelnen Tag dieses schonungslose Bewusstsein. Da er klinischer Psychologe war, fragte er sich unwillkürlich, ob es irgendeinen tief sitzenden Grund für das gab, was sich allmählich wie eine übersteigerte Wahrnehmung anfühlte. Oder vielleicht besaß er einfach einen besonders ausgeprägten Geruchssinn.
Was auch immer der Grund war, er hatte angefangen, sich darüber zu ärgern. Für ihn gab es keine Momente des Halbschlafs, in denen er sich vorstellen konnte, wie er in seiner Koje auf dem Kanalboot erwachte, das zu seinem Stützpunkt geworden war, oder in der Gästewohnung von Carol Jordans renovierter Scheune, wo er genug Zeit verbracht hatte, um sie als sein zweites Zuhause zu betrachten. Diese verträumten Fantasien waren ihm verwehrt. Er hegte nie Zweifel daran, wo er war. Dazu reichte ein einziger Atemzug.
Wenigstens hatte er jetzt eine Zelle für sich. Als er erschöpfende Monate lang in Untersuchungshaft gewesen war, hatte er eine Reihe von Zellengenossen gehabt, deren persönliche Angewohnheiten allein schon eine besonders empfindliche Strafe dargestellt hatten. Dazza mit seiner unermüdlichen Hingabe ans Wichsen. Ricky mit seinem schleimerstickten Raucherhusten und ständigem Auswurf in die Stahltoilette. Marco mit seinen Nachtschrecken, den Schreien, die den halben Zellenflur aufweckten und ihre Nachbarn zu Gebrüll und Gefluche provozierten. Tony versuchte, mit Marco über dessen schlechte Träume zu sprechen. Doch der aggressive kleine Liverpooler war aufgesprungen und ganz dicht an ihn herangetreten, um mithilfe des größten Schimpfwortarsenals, das Tony je untergekommen war, abzustreiten, dass er jemals einen verfluchten Albtraum gehabt hätte.
Am allerschlimmsten war Maniac Mick gewesen. Er hatte darauf gewartet, vor Gericht gestellt zu werden, weil er einem rivalisierenden Drogenhändler die Hand abgehackt hatte. Als Mick herausfand, dass Tony mit der Polizei zusammengearbeitet hatte, war seine erste Reaktion gewesen, ihn am Hemd zu packen und gegen die Wand zu knallen. Spucke flog durch die Luft, während er Tony erläuterte, warum man ihn Maniac nannte und was er mit jedem beschissenen Wichser tun würde, den die beschissenen Bullen in der Tasche hatten. Seine Faust – diejenige, auf deren Fingerknöcheln C-U-N-T eintätowiert war – hatte ausgeholt, bereit zu dem Schlag, der, wie Tony wusste, etwas in seinem Gesicht brechen würde. Er hatte die Augen geschlossen.
Nichts passierte. Er hatte ein Auge geöffnet und einen Schwarzen mittleren Alters erblickt, der eine Hand zwischen Mick und Tony geschoben hatte. Die Gegenwart dieser Hand war wie ein magisches Kraftfeld gewesen. »Er ist nicht, was du denkst, Mick.« Seine Stimme war leise, beinahe intim.
»Er ist Abschaum«, spuckte Mick aus. »Was kümmert’s dich, ob der Wichser kriegt, was er verdient?« Sein Mund war zu einem höhnischen Grinsen verzogen, doch seine Augen waren weniger sicher.
»Er hat mit solchen wie uns nichts am Hut. Diebe oder Drogenbarone oder lügende, intrigante Arschlöcher wie wir sind ihm scheißegal. Dieser Mann« – der offenkundige Retter deutete ruckartig mit dem Daumen auf Tony –, »dieser Mann hat Abschaum ins Gefängnis gebracht. Die Tiere, die zum Vergnügen morden und foltern. Nicht zu ihrem finanziellen Vorteil, nicht aus Rache, nicht um zu beweisen, was für einen großen Schwanz sie haben. Sondern bloß zum Spaß. Und die Menschen, die sie umbringen? Völlig wahllos. Könnte deine Alte sein, könnte mein Kind sein, könnte jeder sein, dessen Visage ihnen in den Kram passt. Nur irgendein armes Schwein, das dem falschen Monster über den Weg läuft. Dieser Mann stellt keine Gefahr für richtige Kriminelle wie dich und mich dar.« Er drehte sich um, damit Mick sein Gesicht sehen konnte, während ein freundliches Lächeln seine Wangen in Falten legte.
»Mick, wir sollten stinksauer sein, dass er hier drin ist. Denn die Menschen, die wir lieben, sind sicherer, wenn er da draußen sein Ding macht. Glaub mir, Mick, dieser Mann steckt nur die Art Tiere in den Knast, die ein Gefängnis nie von innen zu sehen kriegen, weil sie die mehrfachen lebenslangen Haftstrafen, zu denen sie verurteilt wurden, in der Klapse absitzen. Lass ihn in Ruhe, Mick.« Er benutzte den Namen des Mannes wie eine Liebkosung. Doch Tony spürte die Drohung dahinter.
Mick bewegte den Arm zur Seite, als wäre es eine bewusste Bewegung, ein gewolltes Dehnen der Muskeln. Dann ließ er ihn sinken. »Ich nehme dich beim Wort, Druse.« Er trat zurück. »Aber ich werde mich umhören. Und wenn es nicht so ist, wie du sagst …« Er fuhr sich mit dem Finger über die Kehle. Das Lächeln, das die Geste begleitete, sorgte dafür, dass Tonys Magen sich verkrampfte. Maniac Mick stolzierte den Flügel entlang, zwei seiner Kumpane im Schlepptau.
Tony atmete lange aus. »Danke«, brachte er krächzend hervor.
Druse hielt ihm die Hand hin. Es war der erste Handschlag, der Tony in den vierzehn Monaten, die er im Knast war, angeboten wurde. »Ich bin Druse. Ich weiß, wer Sie sind.«
Tony schüttelte die Hand. Sie war trocken und fest, und Tony schämte sich für den Schweiß, den er darauf hinterließ. Er lächelte schief. »Und trotzdem haben Sie mich gerettet.«
»Ich komme aus Worcester«, antwortete Druse. »Meine Schwester war im gleichen Englischkurs wie Jennifer Maidment.«
Der Name löste eine Reihe von Bildern aus. Opfer im Teenageralter, herzzerreißende Verbrechen, ein Antrieb, so verschlungen wie eine DNA-Doppelhelix. Damals hatte er selbst mit einer sein Leben auf den Kopf stellenden Enthüllung zu kämpfen gehabt. Seine eigene Vergangenheit aufzudröseln, wie er es so oft bei Straftätern getan hatte, hatte ihn beinahe dazu getrieben, allem den Rücken zu kehren. Doch dieser Mann namens Druse, wer immer er sein mochte, konnte davon nichts wissen. Vielleicht kannte er nicht viel mehr als die Schlagzeilen. Tony nickte. »Ich erinnere mich an Jennifer Maidment.«
»Und ich erinnere mich daran, was Sie getan haben. Jetzt geben Sie sich bloß keiner Illusion über mich hin, Tony Hill. Ich bin ein sehr schlechter Mensch. Aber selbst schlechte Menschen können manchmal Gutes tun. Solange Sie hier drin sind, wird Ihnen keiner zu schaffen machen.« Dann hatte er sich mit einem Finger an den imaginären Schirm einer imaginären Mütze getippt und war fortgegangen.
Tony hatte noch nicht begriffen, wie sich Informationen in einem Gefängnis ausbreiteten. Insgeheim hatte er geglaubt, dass Druse viel mehr versprach, als er halten konnte. Doch zu seiner großen Freude hatte er sich in dieser Hinsicht getäuscht. Der ständige Sog der Angst, der den Untersuchungshaftflügel erfüllte, ließ allmählich nach, ohne jedoch je vollständig zu verschwinden. Tony hatte sorgfältig darauf geachtet, weiterhin Vorsicht walten zu lassen; er blieb sich ständig der Anarchie bewusst, die dicht unter der Oberfläche brodelte. Und Anarchie war nicht dafür bekannt, dass sie jemandes Ruf respektierte.
Noch überraschender war, dass Druse’ Schutz ihm irgendwie in das Gefängnis der Kategorie C gefolgt war, in das man ihn nach dem Urteilsspruch verlegt hatte. Dass ihm das organisierte Verbrechen Schutz böte, war das Letzte, was er von seiner Inhaftierung erwartet hatte.
Druse hatte sich zu einem Puffer auf der einen Seite entwickelt; Tonys Vergangenheit als forensischer Profiler hatte ihm ein ähnliches Bollwerk auf der anderen beschert. Hätte man ihn jemals gefragt, wäre er davon ausgegangen, dass er sich im Lauf seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Innenministerium mehr Feinde als Freunde in hohen Positionen gemacht hatte. Doch wie sich herausstellte, hatte er sich auch in der Hinsicht getäuscht. Zu Beginn der Untersuchungshaft hatte er einen Laptop beantragt. Weder er noch seine Anwältin hatten damit gerechnet, dass dem Antrag stattgegeben würde.
Wieder falsch. Eine Woche später war ein ramponiertes altes Gerät aufgetaucht. Natürlich kam man damit nicht ins Internet. Die einzige installierte Software war ein primitives Textverarbeitungsprogramm. Da er zu der Zeit in einer Zweierzelle untergebracht war, hatte er den Vollzugsbeamten, der die Bücherei führte, überredet, ihn den Laptop dort aufbewahren zu lassen. Anderenfalls wäre der Computer von einem seiner Zellengenossen zerschmettert, gestohlen oder als Offensivwaffe eingesetzt worden. Das schränkte die Zeit ein, die Tony an dem Gerät verbringen konnte, was ihn allerdings dazu zwang, konzentrierter zu arbeiten, wenn er einmal Zugriff darauf hatte. Und so war der einzige Mensch mit einem Grund, sich über Tonys Gefängnisstrafe zu freuen, sein Verleger, der schon die Hoffnung aufgegeben hatte, dass Verbrechen lesen jemals fertiggestellt, geschweige denn veröffentlicht werden würde.
Das alles hatte bei Tony ein unangenehmes Gefühlschaos hinterlassen. Sich ins Schreiben zu stürzen, hatte es ihm ermöglicht, die Angst loszulassen, die vom ersten Moment seiner Inhaftierung wie ein elektrischer Strom durch seine Adern geflossen war. Es war eine unsagbare Erleichterung gewesen. Daran bestand kein Zweifel. Jegliches Bewusstsein für seine Umgebung zu verlieren, während er an der Tastatur saß und versuchte, sein Wissen und seine Erfahrung zu einer zusammenhängenden Schilderung zu strukturieren, war ein Segen. Was diese Annehmlichkeiten beeinträchtigte, waren seine Schuldgefühle.
Er hatte jemandem das Leben genommen. Dies war ein Bruch des grundlegendsten Tabus seines Berufsstands gewesen. Dass er es getan hatte, um zu verhindern, dass die Frau, die er liebte, es selbst tun musste, war keine Entschuldigung. Ebenso wenig war es ihre gemeinsame Überzeugung, dass durch den Tribut dieses einen Lebens andere Leben bewahrt worden waren. Der Mann, den Tony umgebracht hatte, hätte immer wieder gemordet, und wer wusste schon, ob es jemals auch nur den leisesten handfesten Beweis gegen ihn gegeben hätte. Doch das schmälerte nicht das ungeheure Ausmaß dessen, was Tony getan hatte.
Demzufolge hatte er es verdient zu leiden. Seine Tage sollten durch einen gewissen Schmerz und durch Vergeltung gekennzeichnet sein. Doch der einzige Kummer, den er sich vorstellen konnte, war, Carol zu vermissen. Und wäre er gewillt gewesen, hätte er sie jedes Mal sehen können, wenn ihm eine Besuchserlaubnis gewährt wurde. Ihr die Gelegenheit zu verwehren, bei ihm zu sitzen, war eine Wahl, die er, wie er sich sagte, um ihretwillen traf. Vielleicht war das seine Form der Buße. Falls dem so war, war es wahrscheinlich ein niedrigerer Preis, als ihn jeder andere zahlte, mit dem er eingesperrt war.
Wenn er darüber nachdachte, was seine Mitgefangenen verloren hatten, ließ sich nicht leugnen, dass ihn das Gefühl beschlich, er habe Glück. Um sich herum erblickte er den Verlust der Existenzgrundlage, den Verlust eines Zuhauses, von Familien, von Hoffnungen. All dem war er entronnen, aber es fühlte sich dennoch falsch an. Sein Entrinnen ging mit ständig nagenden Schuldgefühlen einher.
Folglich hatte er beschlossen, dass er eine konstruktivere Art finden müsse, um das zu entrichten, was gemeinhin unbedachterweise die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft genannt wurde. Er würde seine Begabungen für Empathie und Kommunikation einsetzen, um zu versuchen, etwas im Leben der Männer zu verändern, die derzeit unter derselben Adresse wie er logierten. Und zwar ab sofort.
Doch bevor er sein Vorhaben in Angriff nehmen konnte, musste er sich auf etwas viel Schlimmeres vorbereiten.
Seine Mutter kam zu Besuch. Anfangs hatte er ihr die Bitte verweigert. Vanessa Hill war ein Monster. Das war ein Wort, dessen Gewicht er verstand, und er benutzte es nicht leichtfertig. Sie hatte seine Kindheit zerstört, ihn der Möglichkeit beraubt, seinen Vater kennenzulernen, versucht, ihn um sein väterliches Erbe zu bringen. Das letzte Mal, als er sie gesehen hatte, hatte er gehofft, es würde das letzte Mal sein.
Doch Vanessa ließ nicht zu, dass ihre Pläne so einfach durchkreuzt wurden. Sie hatte über seine Anwältin eine Nachricht geschickt. »Ich habe schon immer gewusst, dass wir gleich sind, du und ich. Jetzt weißt du es auch. Du schuldest mir etwas, und auch das weißt du.« Sie wusste immer noch, wie sie ihn in Rage brachte. Gegen seinen Willen hatte er den Köder geschluckt.
Samt Haken.
2
Um das psychologische Profiling rankt sich eine Art Mythos, nicht zuletzt weil manche der frühen Verfechter außerordentliche Selbstdarsteller waren. Sie schrieben Bücher, hielten Vorträge, gaben Interviews, in denen sie in ihrer Fähigkeit, die Gedanken von Verbrechern zu lesen, beinahe gottähnlich wirkten. In Wahrheit sind Profiler nur so gut wie das Team, mit dem sie zusammenarbeiten.
Aus: Verbrechen lesen von DR. TONYHILL
Die großen Ballungsräume Nordenglands bestehen auf ihrer Individualität. Doch ein unbestrittenes Charakteristikum haben sie gemeinsam: Keiner von ihnen ist weit weg von atemberaubend schöner Landschaft. Ein Viertel der Bevölkerung Englands lebt höchstens eine Autostunde vom Nationalpark Peak District entfernt, beteuern Leute, die solche Dinge austüfteln. Unter normalen Umständen hätte Detective Inspector Paula McIntyre es genossen, einen Tag in den bewaldeten Ausläufern des Dark Peak auf verschlungenen Pfaden durch etwas zu wandern, das sich beinahe wie Wildnis anfühlte. In den düsteren Hochmooren weiter oben hatte man schnell das Gefühl, die Zivilisation befände sich viel weiter weg als nur jenseits der nächsten Hügelkette.
Doch dies waren keine normalen Umstände. Mit Mühe zog Paula ihren Fuß aus den Fängen einer schlammigen Pfütze. Er tauchte mit einem widerwärtigen Schmatzen auf. »Lieber Himmel, sieh dir an, wie der ausschaut!«, klagte sie und starrte wütend auf ihren dreckverschmierten Wanderschuh.
Detective Constable Stacey Chen, der es dank Paulas Missgeschick gelungen war, die Pfütze zu umgehen, verzog angewidert das Gesicht. »Ist was in deinen Schuh reingelaufen?«
Paul wackelte mit den Zehen. »Ich glaub nicht.« Sie ging weiter auf dem kaum erkennbaren Pfad, dem sie folgten. »Verfluchte Teambuilding-Aktion, so ein Scheiß.«
»Wenigstens hattest du schon eine Ausrüstung. Ich musste ein Vermögen ausgeben, um mich passend auszustaffieren. Wer hätte gedacht, dass ein Waldspaziergang so viel kosten würde?« Müde und genervt stapfte Stacey hinter Paula her.
Paula lachte glucksend. »Die meisten von uns leisten sich nicht mal eben schnell eine Spitzen-Outdoor-Garderobe. Sieh dich nur mal an.« Sie machte eine halbe Drehung und wedelte mit der Hand in Richtung Stacey, die von Kopf bis Fuß in Funktionskleidung steckte. »Die Königin von Merino und Goretex.«
»Das kannst du alles haben, sobald wir den heutigen Tag überstanden haben. Ich will das Zeug nie wieder anziehen.« Der Pfad endete an einer Abzweigung, von der in zwei Richtungen breitere Pfade wegführten. »In welche Richtung gehen wir jetzt?«
Paula zog die Landkarte aus der Tasche und fuhr ihre Route mit einem Finger nach. »Wir gehen nach Norden.«
»Das hilft mir herzlich wenig.«
»Schau dir die Bäume an.«
»Das sind große hohe hölzerne Dinger. Mit Nadeln. Die im Gegensatz zu Kompassnadeln nicht hilfreich magnetisch sind.«
Paula schüttelte in gespielter Verzweiflung den Kopf. »Sieh dir das Moos an. An der Nordseite des Stamms wächst es stärker.« Sie trat näher an eine der Waldkiefern heran, die an der Weggabelung in einer Gruppe standen. »Schau. Man kann den Unterschied sehen.« Sie wies nach links. »Wir gehen da lang.«
»Woher weißt du so was?«
»Aus dem gleichen Grund, weshalb du sämtliche Feinheiten des Internets kennst. Notwendigkeit plus Erfahrung. Wahrscheinlich habe ich mit dem Wandern angefangen, als du deinen ersten Computer bekommen hast.« Paula sah auf ihre Armbanduhr. »Wir sollten überpünktlich am Treffpunkt ankommen. Du hattest Glück, dass du mit mir in einem Team gelandet bist, wir werden Pluspunkte einheimsen, weil wir gut in der Zeit liegen.«
»Einen Tag auf diese Weise zu verbringen ist der reinste Irrsinn. Wir hören ständig nur, es gebe eine Budgetkrise. Ganzen Kategorien von Verbrechen wird überhaupt nicht nachgegangen, weil uns die Ressourcen fehlen. Aber wir vergeuden einen Tag damit, durch den Wald zu marschieren, anstatt zu versuchen, Verbrechen aufzuklären. Ich begreife wirklich nicht, wo da der Sinn sein soll«, maulte Stacey, als sie wieder weitergingen in einem Tempo, das Paula für angemessen hielt. Für Stacey war es eher ein Geländemarsch.
»Ich auch nicht. Aber wir sind nicht mehr in Kansas.«
»Ich glaube noch nicht mal, dass DCI Rutherford und Carol Jordan auf dieselbe Polizeihochschule gegangen sind. Carol hätte uns das hier niemals angetan. Wir mussten kein Teambuilding betreiben, wir waren ein Team.«
Darüber ließ sich nicht streiten. Die Mitglieder des ReMIT – das Regional Major Incident Team, das DCI Carol Jordan zusammengestellt hatte – waren sorgfältig nach den Fähigkeiten der Einzelnen und ihrer individuellen Herangehensweise an die Arbeit ausgewählt worden. Vor allem aber wussten sie, wie man mit anderen zusammenarbeitete. Solange die anderen am selben Strang zogen. Doch Carol war fort, und dem ReMIT war erst jetzt, nach Monaten der Untätigkeit, neues Leben eingehaucht worden. Laut der hässlichen Schwestern – Klatsch und Tratsch – hatte beträchtlicher Zweifel am Wert einer Einheit bestanden, die etliche unterschiedliche Polizeibehörden überspannte. Wer ursprünglich dafür gewesen war, hatte sich die Finger verbrannt, wohingegen diejenigen, die verhaltener reagiert hatten, nun paradoxerweise mehr Begeisterung an den Tag legten. Wenn es bei der Ermittlungsarbeit zu Katastrophen kommen sollte, so dachten sie, war es besser, die Schuld auszulagern.
Während also einmal hü und einmal hott gesagt wurde, hatte man Paula zurück nach Bradfield, ihre Heimatdienststelle, versetzt. Sie war zeitweilig zu einer Langzeitermittlung zu Menschenhandel und sexueller Ausbeutung abgestellt worden, einer Operation, die emotional härter gewesen war als alles, was sie zuvor erlebt hatte. Der Rückruf zum ReMIT war ihr wie eine Erlösung vorgekommen.
Stacey war der Met unterstellt worden, um im Bereich der Finanzkriminalität zu arbeiten. Am schwierigsten war für sie gewesen, nicht zu vergessen, dass sie nicht zeigen durfte, wie viel sie eigentlich konnte. Die Zusammenarbeit mit Carol Jordan, zuerst in Bradfield und dann beim ReMIT, hatte Stacey absolute Freiheit gewährt, im Internet überall dorthin zu gehen, wohin sie wollte, und zu tun, was immer nötig war. Sie hatte ein Talent für die nachträgliche Bestätigung von Dingen entwickelt, in die sie ihre Nase eigentlich nicht hätte stecken sollen. Solange das Endergebnis sauber aussah, hatte Carol ihr freie Hand gelassen.
Es hatte drei Tage gedauert, bis sie begriffen hatte, wie frustrierend es war, Dinge auf offiziellem Weg zu erledigen. Schlimmer noch, sie fand es langweilig. Das hatte sie zu der Erkenntnis gezwungen, dass sie trotz ihres scheinbaren Faibles für Konventionen tatsächlich mehr mit den Outlaws als den Gesetzestreuen gemeinsam hatte. »Das einzig Gute daran ist, dass ich so viel freie Denkkapazitäten habe, dass ich eine nette kleine App entwickelt habe, mit der sich berechnen lässt, wie viele Kalorien pro Tastenanschlag am Computer verbraucht werden«, hatte sie Paula bei einem chinesischen Essen vom Lieferdienst in Bradfield anvertraut.
»Warum sollte das jemand wissen wollen?« Verwirrt hatte Paula das Wan-Tan-Teilchen betrachtet, das sie gerade mit einem Stäbchen aufgespießt hatte.
»Fitness- und Diätfreaks wollen alles wissen. Vertrau mir, bei denen hat Narzissmus eine ganz neue Qualität. Man muss das Geschäft weiterentwickeln, Paula. Das da draußen ist ein Haifischbecken. Wenn man nicht weiterschwimmt, stirbt man.« Es war ein verstohlener Hinweis gewesen, dass Staceys Polizeigehalt nur einen Bruchteil ihres Einkommens ausmachte. Ihr erstes kommerzielles Programm hatte sie noch während des Studiums entwickelt, und seitdem hatte sie ihre Firma stillschweigend und erfolgreich ausgebaut. Das war der Grund, weshalb sie es sich leisten konnte, die am besten gekleidete Polizistin in ganz Nordengland zu sein. Für ihr Bankkonto waren Merino und Goretex Peanuts.
Nun schritt sie neben Paula her. »Mit der Firma werde ich jetzt besonders vorsichtig sein müssen«, sagte sie.
»Hast du Angst, dass Rutherford es herausfinden könnte?«
»Es ist nicht gerade ein Geheimnis. Aber er ist so ein Paragrafenreiter, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er ein Auge zudrückt.«
»Aber du führst die Firma in deiner Freizeit. Es gibt keinerlei Interessenskonflikte.«
Stacey zuckte mit den Schultern. »Es ließe sich argumentieren, dass ich Wissen und Erkenntnisse anwende, die ich bei der Arbeit sammle.«
»Ich hätte gedacht, der Wissenstransfer ginge in die andere Richtung. Aber es wäre nicht das Ende der Welt, wenn du gehen müsstest, oder?«
»Langweilig wär mir nicht, das ist mal sicher. Da draußen gibt es reichlich Herausforderungen, die mich auf Trab halten würden. Aber ich würde die Arbeit wirklich vermissen.« Sie warf ihrer Freundin einen Seitenblick zu. »Das hab ich noch nie jemandem anvertraut. Aber ich liebe es, dass das Polizistendasein einen dazu ermächtigt, im Leben anderer Leute herumzuschnüffeln. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit weit übers Erlaubte hinausgehe, und theoretisch könnte ich damit weitermachen, wenn ich bei der Polizei ausscheide. Mir stehen immer noch sämtliche Hintertüren offen. Aber dann hätte ich keine Rechtfertigung mehr dafür.« Sie stieß ein spöttisches Lachen aus. »Das hört sich verrückt an, aber so bin ich wohl erzogen worden. Traditionelle chinesische Werte. Oder so was Ähnliches.«
»Klingt logisch, finde ich. Bleiben wir also auf der Hut, bis wir den DCI besser einschätzen können. Wir wissen ja beide, dass die Lücke zwischen dem, was die hohen Tiere sagen, und dem, was sie tun, ziemlich groß sein kann. Wenn wir erst mal mittendrin stecken, wird er vielleicht genauso ein Auge zudrücken wie Carol.«
»Hast du in letzter Zeit was von ihr gehört?« Stacey kramte in einer ihrer Taschen herum und zog eine Tafel Edelschokolade heraus. Sie brach zwei Rippen ab und reichte eine Paula.
»Mmm, Ingwer.« Paula war glücklich. »Ich versuche, alle vierzehn Tage hinzufahren. Bloß um zu sehen, wie es ihr geht. Ich komm mir vor, als wär ich in diplomatischer Mission zwischen Nord- und Südkorea unterwegs. Erst besuche ich Tony im Gefängnis, dann besuche ich Carol in einer anderen Art von Gefängnis.«
»Er weigert sich immer noch, sie zu sehen?«
»Er ist davon überzeugt, dass sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Was offen gesagt keine Frage ist. Er hat ihr gesagt, keine Besuchserlaubnis, bis sie sich behandeln lässt.«
»Und tut sie das? Sich behandeln lassen?«
Paula lachte. »Kannst du dir vorstellen, Carol Jordan das zu fragen? ›Also, Boss, wie läuft’s mit der PTBS? Machst du schon ’ne Therapie?‹ Das würde super ankommen.«
»Aber wenn du zwischen den Zeilen liest. Findest du, sie macht Fortschritte?«
»Sie trinkt nicht. Was in Anbetracht der Geschehnisse unglaublich ist. Aber was den Rest betrifft …«
Was immer Paula noch sagen wollte, wurde durch einen kurzen, heftigen Schrei aus dem Wald westlich von ihnen unterbrochen. »Was zum Teufel?«, entfuhr es ihr.
Es folgte ein wortloser Schrei, der jäh verstummte. Dann das Geräusch von Füßen, die durchs Unterholz brachen. Schon war Paula unterwegs, lief um die Bäume herum in die Richtung, die ihrer Meinung nach die richtige war. Stacey, die im direkten Einsatz weniger erfahren war, zögerte kurz, presste dann den Mund zu einer grimmigen Linie zusammen und stürzte ihr nach.
Paula rannte weiter. Nur kurz blieb sie stehen, um zu überprüfen, ob sie immer noch in Richtung dessen lief, was sich nach einer lauten Verfolgungsjagd anhörte. Sie orientierte sich um und lief wieder los. Als der Lärm unvermittelt verstummte, blieb Paula stehen und hob eine Hand, um Stacey Einhalt zu gebieten. Dann pirschte sie sich so verstohlen wie möglich vorwärts. Nach einer knappen Minute erreichte sie den Rand einer Lichtung.
In wenigen Metern Entfernung wurde eine junge Frau in Laufkleidung von einem massigen Mann in Jeans und Kapuzenpulli gegen einen Baum gedrückt. In der rechten Hand hielt er ein Messer, das er gegen ihre Kehle drückte.
3
Keiner von uns ist immun gegen Traumata. Manche Menschen scheinen die schrecklichen Dinge, die das Leben ihnen beschert, einfach abschütteln zu können; das ist eine Illusion, und zwar eine, deren Wurzeln tief in ihrer Vergangenheit in Form von ungelöstem Grauen liegen. Als Dr. Gwen Adshead noch im Hochsicherheitskrankenhaus Broadmoor arbeitete, pflegte sie zu sagen: »Unsere Patienten kommen als Katastrophenopfer zu uns. Allerdings sind diese Menschen die Katastrophen in ihrem eigenen Leben.« Selbst die Taten von Psychopathen werden von ihren eigenen persönlichen Traumata beeinflusst …
Aus: Verbrechen lesen von DR. TONYHILL
Trotz Navi bereitete es Carol Jordan Mühe, Melissa Rintouls Adresse zu finden. Sie war erst zweimal in Edinburgh gewesen und hatte die New Town in vager Erinnerung als Ort voller breiter Straßen, hoher grauer georgianischer Gebäude und privater Grünanlagen, die mit Eisengeländer umfasst waren, dazu gedacht, Unbefugte aufzuspießen. Doch hinter diesen Fassaden gab es anscheinend Irrgärten aus Hintergassen und schmalen Höfen mit ehemaligen Stallungen, deren Wagenschuppen jetzt schmucke kleine Apartments beherbergten. Oder kleine Unternehmen wie dasjenige, nach dem Carol gerade Ausschau hielt.
Sie hatte ein paar Straßen weiter einen bemerkenswert teuren Parkplatz für ihren Land Rover gefunden und verbrachte die halbe Stunde vor ihrem Termin damit, durch das Viertel zu streifen. Neuerdings machte sie sich gern mit möglichen Fluchtrouten vertraut. In die Enge wollte sie sich nie wieder treiben lassen.
Melissa Rintoul arbeitete in einem zweistöckigen Cottage in einer hübschen schmalen Gasse mit Kopfsteinpflaster zwischen mehreren Wohnblöcken. Töpfe mit Lavendel, Rosmarin und Hortensien säumten den schmalen Gehweg und zwangen Fußgänger dazu, mit einem Fuß im Rinnstein zu gehen. Beinahe hätte Carol das diskrete Schild übersehen, das das Recovery Centre auswies, gelegen zwischen einer Praxis für Fußpflege und einer Boutique, in der Lampen verkauft wurden, die aus umgestalteten Maschinenteilen gefertigt waren.
Es war noch nicht zu spät. Sie musste das hier nicht tun. Sie konnte weiter ihre eigene Last mit sich herumschleppen. Schließlich konnte sie damit überleben. Doch die Stimme in ihrem Kopf, die Stimme, die sie so gut kannte wie ihre eigene, ließ sich nichts vormachen. »Überleben reicht nicht.« Als sie das letzte Mal persönlich mit Tony Hill gesprochen hatte, hatte er genau das gesagt. Und hinzugefügt: »Die Menschen, denen an dir liegt, möchten, dass du dein Leben in vollen Zügen lebst. Überleben sollte dir nicht genügen.« Die Worte hallten in ihrem Kopf wider und übertrumpften ihre Bedenken.
Carol holte tief Luft und stieß die Tür auf. Eine Frau Mitte zwanzig, deren Kleidung an Yoga denken ließ, saß an einem kleinen Tisch in der Ecke eines winzigen Empfangsbereiches. Ihr gegenüber standen zwei bequem aussehende Sessel. Mit einem Lächeln blickte sie von ihrem Laptopbildschirm auf. »Hi, willkommen im Recovery Centre«, sagte sie. »Was kann ich für Sie tun?«
Carol kämpfte gegen den Drang an, die Flucht zu ergreifen. »Ich habe einen Termin bei Melissa Rintoul.«
Noch ein Lächeln. »Sie müssen Carol sein.«
»Ja. Muss ich.« Sie schenkte ihr ein mattes Lächeln. »Mir bleibt keine andere Wahl.«
Ein Zucken der Augenbrauen. Die Frau erhob sich in einer fließenden Bewegung und klopfte an eine Tür in der Nähe ihres Tisches. Sie öffnete sie ein paar Zentimeter weit. »Carol ist hier«, sagte sie. Die Antwort war gedämpft, doch die junge Frau machte die Tür einladend auf und lächelte noch einladender. »Melissa hat Zeit für Sie.«
Das Zimmer, das Carol betrat, war in einem blassen Graugrün gestrichen, den Boden bedeckte ein Teppich, der ein paar Farbnuancen dunkler war. Zwei große Sessel standen sich vor einem minimalistischen Gaskaminofen gegenüber, dessen Flammen in einer niedrigen Linie hinter Rauchglas züngelten. Die Frau, die von dem gepolsterten Fenstersitz aufstand, strahlte angenehme Gelassenheit aus. Carol, die sich angewöhnt hatte, Leute zu katalogisieren, als würde man später eine polizeiliche Fahndungsbeschreibung von ihr erwarten, musste feststellen, dass es ihr schwerfiel, Einzelheiten zu bestimmen. Melissa Rintouls charakteristischstes Merkmal waren ihre schulterlangen kupferfarbenen Korkenzieherlocken, doch ihre Gesichtszüge zu definieren, war weitaus schwieriger. Der Gesamteindruck war friedfertige Ruhe. Doch sie hatte nichts Einfältiges oder Dumpfes an sich. Sie durchquerte den Raum und umschloss mit beiden Händen Carols Rechte. »Kommen Sie und setzen Sie sich«, sagte sie. Ihre Stimme war tief und warm, ihr Akzent leicht schottisch.
Die beiden Frauen nahmen einander gegenüber Platz. Melissa sah Carol fest in die Augen. »Darf ich fragen, wie Sie auf uns gestoßen sind?«
Carol kramte in ihrem Segeltuchrucksack und holte eine Broschüre voller Eselsohren hervor. »Das habe ich im Wartezimmer meiner Osteopathin entdeckt. Ich habe mir gedacht, einen Versuch wär’s wert.«
»Darf ich fragen, was Sie sich hier erhoffen?«
Carol atmete schwer durch die Nase. »Recovery. Heilung«, sagte sie. Eine lange Pause, die zu unterbrechen Melissa keine Anstalten machte. »Ich glaube, ich leide an einer PTBS.«
»Aha. Wurde bei Ihnen offiziell eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert?«
»Es ist kompliziert.« Noch eine Pause. Carol wusste, es half nichts, sie würde es erklären müssen, doch diese Unvermeidlichkeit machte es auch nicht einfacher. »Ich war früher Polizeibeamtin. Ich habe ein MIT, ein Major Incident Team, geleitet. Mein engster Kollege von damals ist klinischer Psychologe. Er war wahrscheinlich auch mein engster Freund. Er arbeitete mit uns jahrelang als Profiler für Straftäter zusammen. Wir hatten mit den schwersten Vergehen zu tun, die Sie sich vorstellen können.« Seufzend hielt sie inne.
»Sie machen das gut«, sagte Melissa. »Mir geht es nicht darum, wie Ihre Arbeit in allen Einzelheiten war. Ich möchte nur wissen, was Sie hierhergeführt hat.«
Carol wusste, dass sie Melissa mehr über den katastrophalen Tag erzählen sollte, der damit geendet hatte, dass Tony ins Gefängnis gekommen und sie in Ungnade gefallen war. Doch ihr Schamgefühl machte sie stumm. Sie war noch nicht so weit, sich derart vollständig zu entblößen. Stattdessen fuhr sie fort: »Er hat gesagt, er glaubt, dass ich an einer PTBS leide. Damals wollte ich es nicht zugeben, aber mittlerweile akzeptiere ich es. Ich hatte ein Alkoholproblem. Eine Sucht. Er hat mir geholfen, sie zu überwinden. Ich trinke nicht mehr.« Jeder Satz war, als würde sie gegen eine sich schließende Tür stoßen.
»Wie lange sind Sie trocken?«
»Demnächst sechzehn Monate.« Carol schenkte ihr ein gequältes Lächeln. »Ich könnte es Ihnen auf die Woche und den Tag genau sagen, aber das würde sich ein bisschen verzweifelt anhören.«
Melissa lächelte. »Sie sind die Einzige in diesem Zimmer, die Sie beurteilt. Ich freue mich für Sie, dass Sie solche Fortschritte bei etwas machen, das immer schwierig ist. Hat er, abgesehen von der Suchtproblematik, noch andere Gründe für seine Schlussfolgerung angeführt?«
Carol sah an Melissa vorbei zu dem Fenster hinter ihr. Eine dünne Jalousie ließ keine Einzelheiten erkennen, aber sie erahnte einen Baum und Blätter, die sanft im Wind bebten. Jedenfalls wollte sie sich das vorstellen. Einen kurzen Moment schloss sie die Augen, bevor sie sagte: »Das Eingehen von Risiken. Leichtsinn. Aggressivität. Ich habe mich und andere in Gefahr gebracht.«
»Was haben Sie unternommen, um mit diesen Verhaltensweisen umzugehen?«
Carol fuhr mit den Fingern durch ihr dichtes blondes Haar. »Nichts. Anfangs habe ich nichts unternommen. Und dann ist alles den Bach runtergegangen. Ich … ich habe etwas getan, das schreckliche Konsequenzen hatte.« Es war so nah, wie sie an ein Geständnis herankam.
»Sind Sie deshalb keine Polizistin mehr?«
»Man sagte mir, ich solle meine Kündigung einreichen, bevor sie mich feuern müssten. Also habe ich es getan. Und ich habe trotzdem nichts unternommen.« Carol war sich nicht sicher, wie Melissa es schaffte, doch sie schien eine Art unterstützendes Mitgefühl auszustrahlen. Langsam fiel ihr das Reden leichter. Die Verspanntheit in der Kieferpartie und im Nacken machte sich jetzt weniger bemerkbar.
»Aber etwas hat diese Haltung geändert?«
Carol spürte, wie sich ihre Kehle zuschnürte, als müsste sie gleich in Tränen ausbrechen. Sie war empört. Es war ihr nicht gelungen, über Tonys Abwesenheit in ihrem Leben zu weinen; sein Fehlen war eine ständige Pein, ein körperlicher Schmerz in der Brust über Monate hinweg. Doch fünf Minuten im Sprechzimmer dieser Fremden, und der Damm hinter ihren Gefühlen drohte zu bersten. Geräuschvoll räusperte sie sich. »Er weigert sich, mich zu sehen, bis ich mir Hilfe hole. Er hat mir gesagt, dass er mich liebt, und dann hat er sich geweigert, mich zu sehen.« Es war nicht ihre Absicht gewesen, das auszusprechen. Es war überhaupt nicht ihre Absicht gewesen, das auszusprechen.
Melissa nickte. »Ich verstehe, dass Sie das dazu gebracht hat, sich Hilfe zu suchen. Sind wir Ihre erste Anlaufstelle? Ich frage, weil unsere Methode nicht der konventionelle Weg zur Genesung ist, und im Allgemeinen stellen wir fest, dass Leute zu uns kommen, wenn die traditionelleren Methoden bei ihnen nicht angeschlagen haben.«
Carol schüttelte den Kopf, immer noch aus dem Gleichgewicht gebracht durch ihren Moment der Enthüllung. »Ich bin bei einem Therapeuten gewesen.« Ein Bild von Jacob Gold tat sich vor ihrem geistigen Auge auf. An ihn hatte sich auch Tony im Lauf der Jahre gewandt, wenn er professionelle Hilfe benötigte. Jacob war bestimmt gut in seiner Arbeit, aber für sie war er völlig verkehrt gewesen. Sie wollte ihn nicht in ihrem Kopf haben. »Tatsächlich mehr als einmal. Aber von Natur aus bin ich ein sehr verschlossener Mensch«, fuhr sie fort. »Und ich habe Jahre mit einer Arbeit verbracht, bei der Vertraulichkeit das A und O war. Ich hatte nie die Angewohnheit, mir Dinge von der Seele zu reden, und das mit der Redekur habe ich einfach nicht hingekriegt. Und abgesehen davon …« Sie gebot sich selbst Einhalt.
»Abgesehen davon?«
Carol schüttelte den Kopf. »Nichts.«
»Abgesehen davon waren Sie zu schlau?«
Überrascht riss sie die Augen auf. »Das habe ich nicht behauptet.«
»Nein. Ich habe eine Vermutung angestellt, und Sie haben sie bestätigt.«
Carol lachte fast. »Früher hatte ich eine Sergeant wie Sie. Die beste Kraft für Verhöre, mit der ich je zusammengearbeitet habe.«
Melissa nickte. »Danke. Carol, ich werde Sie nicht nach den genauen Umständen fragen, die Sie zu uns geführt haben. Das muss ich nicht wissen. Bei dem, was wir hier machen, geht es nicht um Worte. Wir haben eine Behandlungsmethode, bei der es um Körperarbeit geht. Soll ich es Ihnen erläutern? Und dann können Sie entscheiden, ob es das Richtige für Sie sein könnte.«
Carol fühlte sich so geborgen wie schon lange nicht mehr. Es war ein Gefühl, von dem sie befürchtet hatte, es nie wieder zu erleben. »Ja. Bitte.«
»Wissen Sie, was Faszien sind?«
Carol schüttelte den Kopf. »Abgesehen von den steinernen Leisten in der antiken Architektur habe ich keine Ahnung. Aber ich schätze mal, davon reden wir hier nicht.«
»Nein. Faszien sind das Bindegewebe des Körpers. Sie verlaufen in Bändern und Hüllen durch den ganzen Körper. Sie verbinden und schützen Muskelgruppen und innere Organe, wie ein Spinnennetz, das dafür sorgt, dass alles zusammenarbeitet. Wenn man gestresst oder traumatisiert ist, wenn die Adrenalinreaktion von Kampf oder Flucht einsetzt, sollen wir anschließend eigentlich wieder in den Ruhezustand zurückkehren, sobald die Gefahr oder Angst vorüber ist. Stellen Sie es sich wie Elektrizität vor, die aus Sicherheitsgründen geerdet ist. Aber manchmal sind wir mit der Kampf-oder-Flucht-Reaktion überlastet und rutschen dadurch die Skala weiter hoch bis zu Erstarrung und Dissoziation. Die Reaktion fällt so heftig aus, dass die Elektrizität nicht geerdet wird, und wir sinken nicht wieder in den Ruhezustand entspannten Bewusstseins zurück. Können Sie mir so weit folgen?«
»Ich verstehe, was Sie meinen, ja.«
Melissa lächelte. »Gut. Wir besitzen eigentlich zwei Gehirne. Das bewusste Gehirn, das unsere Gedanken und Handlungen kontrolliert. Es ist sich über Vergangenheit und Zukunft im Klaren, es ist immer damit beschäftigt, neurologische Signale hin- und herzusenden, derer wir uns im Großen und Ganzen gar nicht bewusst sind. Doch darunter befindet sich unser unbewusstes Gehirn. Es ist das Überbleibsel aus unserer Zeit als Reptilien, und ihm geht es einzig und allein ums Überleben. Es ist an die fünf Sinne angeschlossen, aber es begreift nur den unmittelbaren Moment. Es lebt im Präsens. Es registriert, wenn der Adrenalinzyklus vollständig ist. Aber wenn sich dieser nicht schließt, wenn wir an Stress und Trauma festhalten, dann glaubt das Überlebensgehirn, er würde weiter andauern. Daraus entwickelt sich eine Schleife, die ständig wieder abläuft. Haben Sie Flashbacks, Carol?«
Sie nickte, da sie nicht sicher war, ob sie sprechen konnte.
»Die traditionelle Gesprächstherapie kann diese Flashbacks als Anschlusspunkte zum Traumazustand nutzen, und bei manchen Menschen hilft das. Aber andere kann das Erzählen der Geschichte in einem gestörten Zustand auf der Ebene des Überlebensgehirns zurücklassen. Was wir also tun müssen, ist, die Faszien zu überreden, den Stress zu lösen, an den Sie sich klammern, damit sich die Elektrizität selbst erden kann.«
»Bei Ihnen klingt das ganz simpel. Wenn es so einfach ist, warum macht es dann nicht jeder?«
Melissas Lächeln blieb herzlich. »Ich habe Verständnis für Ihre Zweifel. Sie sind in der Schleife gefangen, und tief in Ihrem Innern haben Sie Angst, dass die Dinge nur noch schlimmer werden. Der Hauptgrund, warum es nicht jeder macht, lautet, dass es immer Widerstand gegen alternative Behandlungsmethoden gibt. Die Schulmedizin hat viel in die Art und Weise investiert, wie man die Dinge von jeher gehandhabt hat. Zu Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen nur sagen, dass sich unsere Methode auf extensive Forschung stützt und von Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation anerkannt wird. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren, und meine Erfolgsrate bei Patienten liegt zwischen fünfundsiebzig und achtzig Prozent. Allerdings funktioniert es nicht bei jedem. Ich werde nicht so tun, als wäre dem so.«
»Wie funktioniert es konkret? Ist das eine Art Massagetechnik? Werden Sie meinen Stress wegmassieren?« Carol konnte den herausfordernden Unterton in ihrer Stimme hören. Muss mein Reptilienhirn sein.
»Nein. Ich glaube, genau wie sich unser Körper von einem physischen Trauma erholen kann, kann auch unser Geist von einem psychologischen Trauma genesen. Ich werde Ihnen eine Reihe von Übungen an die Hand geben, die Sie für sich praktizieren können. Wir werden mit winzigen Augenbewegungen anfangen, die Sie bis zu hundertmal am Tag durchführen sollen. Um damit Ihrem Gehirn zu verstehen zu geben, dass das Sehen keine Gefahr darstellt. Es nennt sich EMDR – Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, die Desensibilisierung und Aufarbeitung durch Augenbewegungen. Ich werde Sie nicht mit der Theorie langweilen. Es gibt reichlich Material im Internet. Das Prinzip dahinter lautet, dass es Ihnen dabei helfen wird, Ihre Reaktionen auf die Ereignisse, die Sie traumatisiert haben, umzuprogrammieren. Sie werden eine Möglichkeit finden, das Ihnen Widerfahrene neu in Begrifflichkeiten zu fassen, die Sie nicht länger in der Feedback-Schleife des Traumas gefangen halten.«
Melissa demonstrierte, was sie meinte. Es sah einfach aus, bis Carol versuchte, es selbst mehrmals hintereinander durchzuführen. Nach einem Dutzend rascher Augenbewegungen wurde ihr mulmig zumute. »Es wird mit der Zeit angenehmer, versprochen«, sagte Melissa.
Die Therapeutin ging ein paar weitere Übungen mit ihr durch. Sie stieß langsam und kraftvoll mit den Armen nach außen, wie eine Art Brustschwimmen gegen einen imaginären Widerstand. Stampfte stoßweise so fest wie möglich auf den Boden. Saß mit den Füßen auf dem Boden da und tat so, als würde sie laufen. Carol ahmte sie nach und ließ sich korrigieren und anleiten. Nach einer knappen Viertelstunde raste ihr Herz, und ihr war leicht übel.
»Das haben Sie gut gemacht«, sagte Melissa. »Ich möchte, dass Sie diese Übungen jeden Tag machen. Kleine Gruppen von Wiederholungen, sooft Sie es hinbekommen. Es sollte einfacher werden, und Sie sollten im Lauf der Zeit mehr machen können. Ich empfehle eine Behandlung von acht Sitzungen, damit wir uns mit den Veränderungen beschäftigen können. Ich würde Sie gern in zwei Wochen wiedersehen. Können Sie das einrichten?«
Carol erhob sich. »Ich werde hier sein. Ich möchte mich nicht mehr so fühlen.«
»Und ich kann mir vorstellen, dass Sie gern wieder Kontakt zu Ihrem Freund hätten. Das ist ein lohnenswertes Ziel.«
»Darüber kann ich bisher noch nicht einmal nachdenken.«
»Machen Sie sich jetzt auf den Rückweg nach Bradfield?«
Carol nickte.
»Mit dem Auto?«
»Ja, ich habe ein paar Straßen weiter geparkt.«
»Setzen Sie sich nicht gleich hinters Steuer. Am Ende der Gasse gibt es ein reizendes kleines Café. Nehmen Sie dort Platz und genehmigen Sie sich eine Tasse Tee und einen Scone. Atmen Sie. Es ist möglich, dass Sie eine heftige emotionale Reaktion auf das, was wir getan haben, erleben werden, also seien Sie freundlich zu sich.« Melissa stand auf und legte Carol eine Hand auf den Arm. »Prima, dass Sie heute hergekommen sind. Das war kein leichter Schritt. Alles Gute.«
»Danke.«
Leicht benommen trat Carol auf die Gasse hinaus. Während sie drinnen gewesen war, hatte sich der Tag verändert. Ein breiter Streifen Sonnenschein leuchtete ihr den Weg zum Ende der Straße. Bei dem Anblick hob sich ihre Stimmung. »Ach, verdammt noch mal«, schalt sie sich auf dem Weg zum Café. »Es ist bloß das Wetter.«
Und dennoch ließ sich ein Aufflackern von Hoffnung nicht ignorieren. Vielleicht hatte sie tatsächlich den ersten Schritt auf dem Weg zurück zu sich selbst getan.
4
Extreme, sich wiederholende Gewalt als ein Symptom von Geisteskrankheit zu verstehen, fällt uns nicht schwer. Es ist kein allzu großer Sprung hin zu der Vorstellung, dass die meisten Gewaltverbrechen eine Art Krankheit darstellen. Wenn wir unser Verhalten ändern, können wir vielleicht das Ergebnis ändern.
Aus: Verbrechen lesen von DR. TONYHILL
Sich Vanessa aus dem Kopf zu schlagen, war in der Theorie leichter als in der Praxis, wie Tony feststellen musste. Ein leises Summen der Nervosität verlief unter seinen Gedanken und machte ihn ausgerechnet zu einem Zeitpunkt gereizt, an dem er sich eigentlich unter Kontrolle haben musste. Was er im Begriff stand zu versuchen, konnte über das Klima seiner restlichen Haftstrafe entscheiden. Druse’ Einfluss hatte die Angst gedrosselt; doch Tony wollte auch den Respekt ihm gegenüber verstärken. Problematisch war nur, dahinterzukommen, wie.
Die Antwort hatte sich zwei Tage nach seiner Verlegung ins HMP Doniston, dem Gefängnis der Kategorie C, wo er wahrscheinlich den Rest seiner Strafe absitzen würde, angedeutet. Die Atmosphäre war weniger toxisch als in der Untersuchungshaft, doch es bestand kein Zweifel daran, in welcher Art von Anstalt er sich befand.
Niemand, der je eine Gefängnisserie im Fernsehen gesehen hatte, wäre von den Zellenfluren im Doniston überrascht gewesen. Zwei Reihen an Zellen lagen sich gegenüber, getrennt von einem Korridor und einem freien Schacht in der Mitte, wo Treppen hinaufführten, die die Stockwerke miteinander verbanden. Im Erdgeschoss war Platz für zwei Billardtische und eine Tischtennisplatte. Die Wände waren aus Backstein, bedeckt mit etlichen Farbschichten Anstaltsgrau, die eingelassenen Türbögen gerade einmal tief genug, dass sich ein Mann hineindrücken und für jemanden, der den Gang hinabging, unsichtbar bleiben konnte. Wollte man jemandem einen Heidenschreck einjagen, war die perfekte Methode, abzuwarten, bis das Opfer auf gleicher Höhe war, und dann mit einem Knurren und einer Grimasse hervorzuspringen. Ein tätlicher Angriff erübrigte sich; der Schock und die Angst reichten aus, um die erwünschte Reaktion hervorzurufen.
Tonys Zelle glich haargenau allen anderen, in die er einen Blick geworfen hatte, als er nervös den Gang entlanggegangen war, seine Arme voller Bettzeug, Wechselkleidung, einem Karton mit Büchern und seinem kostbaren Laptop. Er war das interessanteste Ereignis an dem Morgen gewesen. Seine Mitgefangenen lehnten in Eingängen, brüllten Fragen und johlten Unverständliches, während er vorüberging.
Es war eine Erleichterung gewesen, seine eigene Zelle zu betreten. Auf den ersten Blick schien sie in anständigem Zustand zu sein, die weißgraue Wandfarbe nur ein bisschen abgenutzt und zerschrammt. Ein schmales Bett, ein Eckschrank mit drei schmalen Regalböden, ein winziger, an den Fußboden geschraubter Tisch und ein Plastikstuhl. Ein Radiolautsprecher, der über dem Bett an die Wand gedübelt war. Neben der Tür eine Toilette und ein Waschbecken aus Edelstahl, vom Rest des Raums durch eine gestrichene Backsteinwand abgetrennt. »Sie können Zeug mit Blu-Tack aufhängen. Den Raum wohnlich machen. Das gibt’s im Laden zu kaufen«, hatte der Beamte gesagt, der ihn hergebracht hatte. Tony dachte, dass es mehr als ein paar Fotos brauchen würde, um diese spartanische Zelle wohnlich zu machen. Das Fenster, das in ein Dutzend dicke Klötze aus durchsichtigem Material unterteilt war, bot Aussicht auf ein Stück Dach und ein gepflügtes Feld jenseits der umgebenden Mauer. Genug von der Außenwelt, um ihn daran zu erinnern, was er verloren hatte.
Wieder allein hatte er aus Neugierde den eingebauten Lautsprecher eingeschaltet. Schon bald begriff er, dass er einem Interview eines Gefangenen mit einem Dichter lauschte, der am Nachmittag einen Workshop in der Gefängnisbücherei leitete. Es dauerte nicht lang, um herauszufinden, dass er Razor Wireless hörte, einen von Häftlingen geführten Radiosender. Anscheinend war Mittwoch Wide Awake Day, an dem es um Kreativität und Bildung ging. Obwohl die offiziellen Ressourcen begrenzt waren, wurde doch deutlich, dass die Häftlinge ihre Fähigkeiten nutzen konnten, um ihre Aussichten zu verbessern, von Installationsarbeiten bis hin zum Kochen. Während Tony zuhörte, stiegen allmählich mit einem leichten Kribbeln Ideen in ihm auf.
Er hatte sich gehütet, ohne jemanden, der für ihn bürgen konnte, bei dem Radiosender aufzukreuzen. Es hatte ein paar Tage gedauert, während derer er sich bei den am wenigsten feindseligen Gesichtern in der Kantine und der Bücherei umgehört hatte, doch endlich war es ihm gelungen, Kieran aufzuspüren, einen Siebenundzwanzigjährigen, der drei Jahre wegen, wie er selbst sagte, »scheißvielen Einbrüchen« einsaß.
Wie war es zu seiner Mitarbeit bei dem Sender gekommen, fragte Tony ihn. »Ich habe Razor gern angehört, aber ich fand, die Sendung, die sie über Fitness gemacht haben, war viel zu spezialisiert. Ich bleibe gern in Form, aber sie haben immer nur über Training an den Geräten im Kraftsportraum geredet. Nun ist das Zeug, das sie hier drinnen haben, zum einen eh nicht so toll, aber das große Problem ist, dass es einfach nicht genug für alle gibt. Außerdem sind viele Typen kein bisschen fit und haben keinen großen Bock, neben den Fitnessfanatikern zu trainieren«, erklärte Kieran. »Und dann gibt’s da die Platzhirsche und ihre Deppen, die glauben, dass der Kraftsportraum ihnen gehört.«
Es war mehr, als Tony wissen musste, aber er verstand besser als die meisten, wie wertvoll es war, die Leute reden zu lassen. »Ich weiß, was Sie meinen. Ich würde mir neben der Hälfte der Kerle hier drinnen wie ein totaler Waschlappen vorkommen.«
»Weil Sie’s sind. Jedenfalls habe ich mir dieses Fitnessprogramm ausgedacht, das man in der eigenen Zelle machen kann. Ganz einfache Dehnübungen und Krafttraining, reichlich Wiederholungen, um ein bisschen Muskeln aufzubauen. Ein bisschen durchtrainierter zu werden.« Er streckte die Hand aus und umfasste Tonys Bizeps. »Ihnen würde das auch nicht schaden, Tony.« Er lachte glucksend und ließ die Schultern kreisen, prahlte mit seinem eigenen Körperbau.
»Ich werde mal reinhören. Sie sind also einfach hingegangen und haben darum gebeten, eine Sendung machen zu dürfen?«
Kieran nickte. »Die Kerle haben mich einen Durchlauf zur Probe machen lassen, haben ein paar Vorschläge gemacht, dann haben sie mir einmal pro Woche zehn Minuten Sendezeit gegeben. Den Leuten hat’s gefallen, also mache ich jetzt dreimal die Woche fünfzehn Minuten. Den ganzen anderen Kram musste ich auch lernen – den technischen Scheiß, den die Toningenieure bei der BBC machen, und all so was. Warum sind Sie so interessiert? Wollen Sie uns alles über die Serienmörder erzählen, die Sie ins Gefängnis gebracht haben? Uns mit Insiderwissen versorgen? Im Kopf eines Mörders, so was in der Art?«
»Das ist Schnee von gestern für mich. Ich werde nie wieder in die Nähe einer Mordermittlung gelassen werden.«
Kieran kicherte. »Nicht jetzt, wo Sie am anderen Ende gewesen sind. Aber ich wette, Sie haben ein paar tolle Geschichten zu erzählen.«
»Mir schwebt da etwas anderes vor. Sie wollen die Leute körperlich fit machen. Ich möchte ihnen helfen, ihr Leben auf andere Arten zu ändern. Könnten Sie mich dort einführen?«
»Sicher. Kommen Sie Mittwochmorgen mit mir mit, wenn ich meine Sendung mache. Das ist der beste Tag, dann sind ein paar von uns dort, um den Rest der Woche zu planen.«
Es wurde Mittwoch, und er fand sich an der Wand eines überfüllten kleinen Raums voller Gerätschaften und einem halben Dutzend Männer wieder, die wie eine willkürliche Auswahl von der Grayson-Street-Tribüne bei einem Spiel von Bradfield Victoria aussahen. Und nicht nur, weil sie alle weiß waren, in auffälligem Gegensatz zur allgemeinen Gefängnisbevölkerung. Zwei hatten glatt rasierte Köpfe und Tätowierungen, die ihre Arme zierten und an ihren Hälsen hochkrochen. Einer sah wie ein Physiklehrer aus, seine Brille rutschte ihm die Nase hinunter, und er fummelte mit einem Schraubenzieher an einer Art Anschlussbuchse herum. Ein anderer – Mitte dreißig, ordentliche Frisur, wachsame Augen, breite Schultern und der Ansatz eines Bäuchleins – hätte perfekt in die Kantine der Bradfield Metropolitan Police gepasst. Kieran stellte Tony dem Mann vor, der in dem Raum offensichtlich das Sagen hatte.
»Spoony, das ist Tony. Er ist …«
»Ja, ich weiß. Der Seelenklempner. Wir haben hier drin keine Sofas, Doc. Und Seelen zum Klempnern hat das System uns nicht übrig gelassen. Also, was woll’n Sie bei uns?« Spoony legte den Kopf schräg, sodass die Sehnen an seinem Hals hervorstanden. Er war groß und schlank, die Arme, die aus seinem T-Shirt herausragten, ähnelten einer anatomischen Zeichnung – hier ein Muskel, da eine Sehne, dort eine Ader. Sein Gesicht erinnerte Tony an einen tropischen Vogel; riesengroße Augen und Hakennase über einem kleinen Mund und fliehenden Kinn.
»Ich will eine Sendung machen.«
Spoony gackerte höhnisch. Die beiden Glatzköpfe verschränkten die Arme über den Bäuchen und lachten sich schlapp. Tweedledum und Tweedledümmer. »Einfach so? Sie halten sich wohl für was Besonderes, bloß weil Sie sich draußen ein bisschen einen Namen gemacht haben?« Spoony drehte sich weg und tat so, als wäre er mit etwas auf einem der Monitore beschäftigt. Die anderen folgten seinem Beispiel und machten sich an Klemmbrettern und Bildschirmen zu schaffen.
»Es wäre sinnlos, wenn ich vorgäbe, ich hätte keine Fähigkeiten«, sagte Tony. »Es wäre echt dumm, wenn ich versuchen würde, so zu tun, ich wäre einfach einer der Insassen. Ich habe mir Razor angehört, und mir ist ebenso klar, dass Sie auch nicht dumm sind. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich kann Ihnen eine Sendung liefern, die etwas im Leben der Menschen bewirken könnte. Ihnen dabei helfen könnte, nicht hierher zurückzukehren.«
Spoony erstarrte. »Glauben Sie wirklich? Sie sind nun schon wie lange hier drin? Was – fünf Minuten? Und Sie wissen, wie man uns geradebiegt? Halten Sie sich für Scheiß-Coldplay, oder was?«
»Ich weiß noch nicht einmal, wovon Sie sprechen«, sagte Tony. »Ich weiß nur, dass ich ein paar Ideen habe, die meiner Meinung nach einen Versuch wert sind.« Er zog ein kleines Notizbuch aus der Tasche. Noch ein Geschenk von Leuten im Justizsystem, die wussten, dass er wusste, wo ein paar der Leichen vergraben waren. »Ich habe zehn Minuten skizziert. Bloß um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben.«
Spoony drehte sich um und beugte sich an Tony vorbei, um Kieran in die Augen zu sehen. »Gute Arbeit, den da vorbeizubringen. Wir haben schrecklich wenige Komiker im Programm.«
Der Geek mit dem Schraubenzieher sah hoch. »Kann nicht schaden, dem Mann ’ne Chance zu geben.« Den überraschten Mienen der anderen nach zu urteilen, war es nicht seine Angewohnheit, Meinungen zu äußern.
Spoony blies geräuschvoll die Luft aus. »Dann mal los.« Er nickte in Richtung eines Stuhls vor einem Mikro mit Schaumstoffüberzug. »Pflanzen Sie Ihren Hintern da hin und zeigen Sie’s uns.«
Tony gehorchte, zwängte sich an den Tweedle-Zwillingen vorbei, um zu dem Stuhl zu gelangen. Er räusperte sich. »Ich bin Häftling Nummer BV8573. Außerdem bin ich klinischer Psychologe, meine Name ist Tony Hill. Die letzten fünfundzwanzig Jahre habe ich damit verbracht, mit Menschen wie Ihnen und mir zu arbeiten und zu versuchen dahinterzukommen, warum die Dinge für uns schiefgelaufen sind.« Er blickte von seinen Notizen auf. Spoony lehnte sich auf seinem Stuhl nach hinten, die Finger hinter dem Kopf verschränkt, und starrte an die Decke.
»Ich glaube nicht, dass Menschen böse auf die Welt kommen. Ich denke, wir landen aus einer Vielzahl an Gründen auf der falschen Seite des Gesetzes, und die meisten davon sind nicht unsere Schuld. Ich habe es schon einmal gesagt, und ich werde es wahrscheinlich wieder sagen: Gesellschaften bekommen die Verbrechen, die sie verdient haben. Errichtet man beispielsweise eine Gesellschaft, die auf Gier basiert, dann wird Raub das Standardverbrechen werden. Mach Sex zu einer Ware, und bingo, Sexualverbrechen vermehren sich wie Kaulquappen. Wenn das also die eigentliche Ursache von Verbrechen ist, dann muss die Abhilfe logischerweise in unseren eigenen Händen liegen. Wenn wir das Skript ändern, nach dem andere Menschen leben, dann sollten wir doch auch ändern können, wie es für uns ausgeht. Ich möchte mit Ihnen über Wege reden, wie wir unsere Skripte ändern können. Und das Erste, worüber wir reden müssen, ist Angst. Denn hier drinnen haben wir alle Angst.«
Unvermittelt sprang Spoony auf. »Alles klar, reicht schon. Sie haben Mumm, das muss ich Ihnen lassen, Doc. Hier hereinzuspazieren und so zu tun, als würden wir uns alle verdammt noch mal in die Hose scheißen.«
Seufzend erhob sich Tony. »Okay. Schon kapiert. Ich verzieh mich einfach wieder in meine Zelle und vergesse, dass ich jemals die Zoe Ball des HMP Doniston sein wollte.«
»Was reden Sie da?«, wollte Spoony wissen, den Kopf vorgereckt, unverhohlen aggressiv. Er entriss Tweedledum das Klemmbrett. Mit dem Finger fuhr er die Seite hinunter. »Ja, klar. Kürzen wir die Katholiken auf eine halbe Stunde am Freitag. Sie haben kommenden Monat fünfzehn Minuten pro Woche, Doc. Wenn Sie’s hinkriegen, gehört die Sendung Ihnen. Jetzt verpissen Sie sich, wir müssen hier Programm machen.«
Tony war schon halb aus der Tür, als er Spoonys Abschiedsworte hörte. »Enttäuschen Sie mich besser nicht, Doc. Druse zieht nicht bei den Leuten, die ich kenne.«
Unvermittelt loderte die Angst wieder auf. Sicher ist man hier drin nirgends.