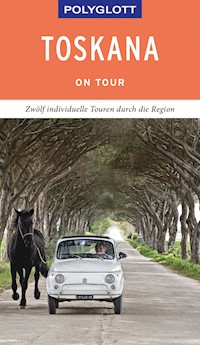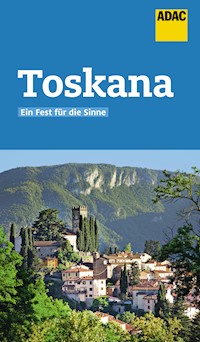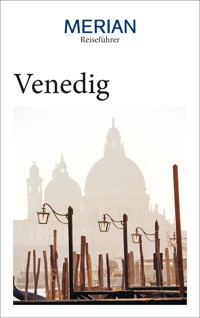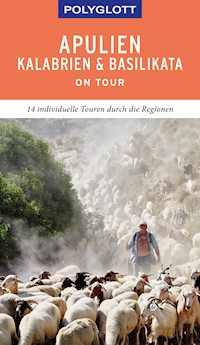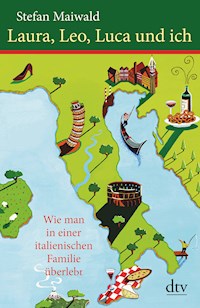8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Davide Venier
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Spion des Dogen in geheimer Mission 1570. Carnevale – ganz Venedig spielt verrückt! Die Stadt ist ein einziges rauschendes Fest, eine gewaltige Orgie. Doch Davide Venier hat keine Zeit für Vergnügungen. Diebe haben den Ausnahmezustand genutzt und die Knochen des heiligen Markus aus dem Dom entwendet – Venedigs Daseinsberechtigung! Bevor der Fall publik wird, muss Davide die Reliquie wiederbeschaffen. Schnell stellt sich heraus: Eine fremde Macht will der Serenissima schaden. Doch wer unter den vielen Feinden Venedigs ist es? Die Genueser? Die Osmanen? Etwa der Papst persönlich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Ähnliche
Stefan Maiwald
Der Knochenraub von San Marco
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Kapitel 1 Die Befreiung
Der Mond war beinahe kreisrund, nur eine Nacht noch fehlte ihm zur Perfektion. Er warf einen kräftigen Lichtkegel auf die schwarze, stille Adria, die Sterne spiegelten sich auf dem Wasser – und Davide Venier baumelte an einer Mauer dreißig Fuß in der Luft. Runterschauen sei keine gute Idee, hatte ihm Eppstein gesagt, doch er konnte nicht widerstehen. Er dachte kurz über seine Situation nach. Wenn er von hier hinabstürzte, würde er sich entweder die Knochen brechen oder vielleicht sogar sterben; in jedem Fall wäre es keine angenehme Sache. Andererseits: Was ihn an seinem Ziel erwartete, war auch nicht gerade gemütlich.
Davide Venier hing an den Außenmauern der Festung Nehaj, neunzig Seemeilen von seiner Heimatstadt Venedig entfernt. Seine Hände umfassten hölzerne Griffe, die sich mit einer Art Glocke aus Lammleder in der Burgmauer regelrecht verbissen, mit den Füßen fand er manchmal etwas Halt an groben Mauervorsprüngen, manchmal aber auch nicht. Die Griffe waren eine Erfindung von Eppstein gewesen, denn Davide musste unbedingt nach oben.
Hasan und Miguel de Cervantes, sein treuer Diener und sein Freund aus Spanien, waren mit ihm gesegelt. Sie hatten in einer Bucht in der Nähe angelegt und waren dann zu Fuß über Felsen und dorniges Gestrüpp mehr gestolpert als gegangen, bis sie zum Haupthafen der Piraten kamen. Die beiden Wachen, die eher lustlos ihrer Aufgabe nachkamen, wurden ohne große Mühen überwältigt. Hasan benutzte dazu einen seiner orientalischen Schläge auf eine dieser geheimnisvollen Körperstellen, der für sofortige Bewusstlosigkeit sorgte. Miguel wählte auf ganz traditionelle Art einen Holzknüppel. Die Wachen wären lieber in der Burg gewesen, bei einem jener legendären Gelage, die selbst nach venezianischen Maßstäben als lukullisch gelten mussten und über die man sich Wunderdinge erzählte. Auch Davide wäre lieber in der Burg, statt an der Festungsmauer zu kleben. Aber es gab keine Wahl, er musste nach oben. Von außen. Denn unten durchs Tor würde er mitten ins Gelage platzen, was als Venezianer einem Suizid gleichkam.
Die Burg war die wichtigste Piratenfestung an der Adria, von quadratischem Grundriss, mit etwa achtzig Fuß Seitenlänge, sechzig Fuß hohen Mauern und einem einzigen ebenerdigen Zugang. Das Tor aus eisenbeschlagenen Eichenbalken war für gewöhnlich nicht nur gut verriegelt, sondern auch noch mehrfach gesichert, wenn nicht gerade die gesamte Piraterie der Adria beim allwöchentlichen Besäufnis versammelt war – und lediglich zwei arme Tröpfe den Hafen bewachen mussten. Um zu den fensterähnlichen Aussparungen in etwa vierzig Fuß Höhe zu gelangen, hatte Eppstein, der Tüftler aus dem Ghetto, Davide die zwei Apparaturen mitgegeben, die mit einer halben Umdrehung am Griff fest an der Mauer haften blieben. Drehte man den Griff in die Gegenrichtung, löste sich die Glocke mühelos. Und so robbte sich Davide wie ein unbeholfenes Insekt Stück für Stück nach oben. In einem Gebüsch kauerten Hasan und Miguel und beobachteten Davides Kletterkünste.
»Gefällt mir nicht«, sagte Hasan. »Der Mensch ist nicht dafür gemacht, so etwas zu tun.«
»Piraten sind aber auch nicht dafür gemacht, dass man bei ihnen freundlich anklopft«, entgegnete der raue Spanier. Auf den Zinnen gingen zwei Wachen auf und ab, die glücklicherweise keinen Blick für die Mauern direkt unter ihnen hatten, sondern nur in die Ferne spähten.
Die Glocken funktionierten reibungslos. Eppstein hatte erklärt, es hätte etwas mit der Luft zu tun, die sich unter der Glocke befände, und je weniger Luft es wäre, desto stärker wäre die Saugwirkung. Davide hoffte inständig, dass der kluge Freund alles ausgiebig getestet hatte, vielleicht an einer der hohen Häuserwände am Ghetto. (Das hatte Eppstein natürlich nicht.) Das wirklich Schwierige waren die Klimmzüge, da er dafür oft genug nur eine Hand frei hatte. Zwar hatte Davide daheim fleißig geübt, auch mit Hasans Hilfe, aber hier in der Burgwand drohte ihm doch die Kraft auszugehen. Immerhin konnte er sich in den Fugen mit den Füßen abstützen und die schmerzenden Arme entlasten; auf Eppsteins Anraten trug er ganz dünne Kalbslederschuhe, genäht aus nur einer Lage und ohne verstärkte Sohle. Doch gerade, als er fast schon die Öffnung erreicht hatte, verlor er den Halt und geriet ins Rutschen. Hasan stöhnte leise auf. Kurzzeitig musste eine der Glocken Davides ganzes Gewicht tragen. Doch wenige Augenblicke, bevor sie nachgab und sich löste, konnte er die zweite Glocke verankern; seine Zehen fanden Halt. Ein paar Kiesel polterten zu Boden, einer der Soldaten auf der Zinne kam herangestürzt. Miguel spannte seine Armbrust. Doch der Wachtposten sah Davide nicht und entfernte sich wieder.
»Wie kann es nur angehen«, flüsterte Miguel, »dass du zwar den stärksten Uskoken ohne zu zögern zu Boden haust, aber einen Augenblick später so ängstlich bist wie ein Mestriner Waschweib?«
»Im fernen Osten, in jenem Land, das euer Marco Polo bereist hat, gibt es die Theorie des Yin und des Yang«, zischte Hasan zurück. »Davon schon mal gehört? Jeder Mensch vereint alles in sich, Angst und Mut, Wahrheit und Lüge, Liebe und Hass, ja sogar das Weibliche und das Männliche.«
»Das Weibliche und das Männliche?« Miguel de Cervantes schnaubte verächtlich. »Was für ein Unsinn.«
»Aber was wisst ihr Spanier schon? Ihr seid nun einmal die Barbaren des Südens.«
»Still jetzt. Sieh, deine Angst war überflüssig, dein Herr ist nun oben.«
Endlich hatte Davide die Aussparung erreicht, schwang sich ins Innere und stand auf der Empore, wo ihn flackerndes Kerzenlicht, dezente Musik, allerlei vorzügliche Düfte und Stimmengemurmel empfingen. Er brauchte eine Zeit, bis er wieder ganz bei Atem war. Die Glocken deponierte er dezent unter dem Sims, wobei er hoffte, einen weniger anstrengenden Rückweg zu finden. Dann riskierte er einen Blick nach unten. Dort saßen etwa drei Dutzend Menschen beieinander, doch von einem ausschweifenden Gelage, wie man sich in Venedig erzählte, konnte keine Rede sein: Mit Eleganz und Anmut saßen die Herren Piraten bei Tisch, mit geradem Rücken und äußerst distinguiert; auch die eine oder andere Dame war zugegen. Kellner, in zwar schäbigen Umhängen, aber doch um eine gewisse Haltung bemüht, servierten die einzelnen Gänge, andere Kellner waren nur dafür da, den Wein nachzuschenken. Zwei Flötenspieler ließen angenehme Melodien erklingen. Man aß mit Besteck, jedenfalls meistens, und der eine oder andere putzte sich sogar den Mund ab. Es wurde geplaudert und gescherzt statt geprügelt und gehurt; Davide hatte sogar schon Feste beim Dogen höchstpersönlich erlebt, bei denen es zügelloser zugegangen war.
Am Kopfende, unverkennbar mit stolzer Statur und leistenlangem Bartwuchs, thronte Ivan Lenkovic, der sich hier ganz neu erfunden hatte. Ja, er wollte sein eigenes Königreich erschaffen, dieser aufgeblasene Uskoke, der sich lieber Johann Freiherr von Lenkowitsch nannte, ganz eng mit den Habsburgern kuschelte und seinen Staat im Staat aufgebaut hatte, mit gut tausend Kämpfern, von denen allerdings heute nur die Anführer – also die Stärksten, Skrupellosesten und Brutalsten – in der Burg an der Tafel saßen, waren doch seine Boote stets unterwegs. Und wie sie da saßen, diese zügellosen Piraten! Das würde in Venedig kein Mensch glauben, diese Sittsamkeit. In jedem Fall hatte die gut organisierte Truppe wenig mit jenen ungestümen Haufen zu tun, die ohne jegliche Taktik und ganz vogelwild jedes Schiff angriffen, das sie anrudern konnten; Davide hatte im Jahr zuvor auf seiner erzwungenen Reise gen Istanbul einen solchen Überfall miterlebt.
Ein guter Teil der Einnahmen des vermeintlichen Freiherrn von Lenkowitsch stammte nicht vom bloßen Kapern, sondern von den viel effektiveren Entführungen. Man schnappte einen Adligen, einen renommierten Kapitän, gar eine Dame aus reichem Hause vom Wasser weg und bot sie den Venezianern, Genuesern oder Osmanen zum Rückkauf an. So füllten viele gute venezianische Dukaten die Piratenkasse und wurden geschäftstüchtig reinvestiert: in noch bessere Boote, in neueste Waffen und Munition, in die Festung selbst. Und neuerdings auch in Bestechungsgelder, die an Herzöge unbedeutenderer Reiche sowie andere kapernde Fürstentümer an der dalmatischen Küste flossen, denn Lenkowitsch wollte weg von der bloßen Piraterie und plante ein Bündnissystem, um vom dauerhaften Streit zwischen Venedig und den Osmanen zu profitieren. Das aber wussten bislang nur er und seine engsten Berater.
Dank Venedigs Informanten – zumeist gefangen genommene Uskoken, die bereitwillig plauderten, um dem Halsgericht zu entgehen, was allerdings stark von der Qualität ihrer Informationen sowie der Tageslaune der Prosekutoren abhing – wusste Davide sehr genau über die Räumlichkeiten der Festung Bescheid. Von der Empore ging ein gutes Dutzend fensterloser Räume ab, allesamt von außen zu verriegeln, bis auf das Schlafgemach des Anführers auf der gegenüberliegenden Seite. Dessen Tür ließ sich dafür von innen verschließen.
In einem der Räume nun, deren Eichentüren er linker Hand sah, musste der Anlass seiner Mission versteckt sein. Davide blickte zur Sicherheit ein letztes Mal hinunter auf die Feierlichkeiten. Es wurde gerade Wildbret aufgetragen, der Duft war köstlich. Lenkowitsch hatte sich zu seinem Nebenmann gebeugt, in dem Davide im trüben Kerzenlicht Dragomir Sosna erkannte, den Mann fürs Grobe, der selbst neben dem nicht gerade zimperlichen Lenkowitsch außerordentlich gewalttätig wirkte. Er war im Gegensatz zu den anderen Tafelnden rasiert, und mit seinem kahlen, glänzenden Schädel, der über dem mächtigen Schultergewölbe thronte, leuchtete er im Halbdunkel wie eine Höllensonne. Es hieß, er sei von seiner Mutter in Istrien ausgesetzt und von Wölfen großgezogen worden, was ganz sicher ein Ammenmärchen war. Es hieß aber auch, Dragomir könne einem Mann mit bloßen Händen den Arm aus der Schulter reißen, und manche Gefangene sollten schon vor Schreck am Schlagfluss gestorben sein, als sie seiner nur gewahr wurden. Das war angesichts seiner Statur und seiner Muskeln durchaus glaubhaft.
Davide stand vor der ersten der beiden in Frage kommenden Türen und erkannte, dass sie nicht verriegelt war. Vermutlich war er falsch, aber wenn er doch schon einmal hier war … Seine Neugier obsiegte. Lange sah er nichts, es war nahezu völlig dunkel, er hörte nur leises Gestöhne. Erst allmählich sickerte das trübe Licht der Feier in den Raum hinein. Dort stand ein großes Bett, und auf ihm erkannte er die Umrisse eines Pärchens, das offensichtlich dabei war, einander zu erkennen. Jetzt wurde das Bild klarer: Der Mann hatte seinen Kopf tief zwischen den gespreizten Schenkeln der Frau und blickte kurz auf, als er das Knarren der Tür hörte, während die Frau, den Kopf im Nacken und ihre langen blonden Locken vor Lust zitternd, nichts von dem wahrnahm, was um sie herum geschah. Davide zwinkerte dem Mann, eher noch ein Junge, zu, der zwinkerte zurück und widmete sich wieder dem Naheliegenden. Davide schloss behutsam die Tür.
Es musste also der andere Raum sein, das vorläufige Ziel der gefährlichen Reise. Und dessen Tür war auch verriegelt. Ungewöhnlich war bloß, dass aus deren Ritzen auffallend viel Licht strömte. Davide hob den Riegel an und zog die Tür so leise wie möglich auf. Der Schwall von Licht blendete ihn. Erst nach vielem Zwinkern entstand aus dem grellen Weiß ein schärfer umrissenes Bild. Hunderte von Kerzen flackerten, nach dem Duft zu urteilen sogar aus Bienenwachs. Welch ein Luxus angesichts der Umstände! Mitten im Raum stand, als hätte sie ihn erwartet, Contessa Ludovica Strozzi, mit offenen blonden Haaren, die ihr beinahe bis zur Hüfte reichten, und in ein fußlanges rotes Samtkleid gehüllt. Sie stammte aus bestem venezianischem Haus, uraltem Geldadel. Der Vater hatte in zweiter Ehe eine Adlige vom Festland geheiratet, weswegen Ludovica den Namen Contessa führen durfte. Vor einigen Wochen war sie auf dem Weg nach Ravenna entführt worden. Ihre Entourage hatte man ins Wasser geworfen, ihre Zofe an Land abgesetzt, um die Lösegeldforderung zu überbringen. Doch Giorgio Strozzi war in heftiger Sorge um seine Tochter und hatte Calaspin um Hilfe gebeten, der wiederum Davide engagiert hatte. Strozzi hatte angeboten, dafür das geforderte Lösegeld in Höhe von 500 Dukaten der Staatskasse zu schenken, wo Calaspin es auch besser aufgehoben sah als bei den Piraten. Da stand es also nun in der Piratenfestung, das hübsche Wesen mit dem kleinen Überbiss, und blickte verwirrt auf den Mann, der in ihre Zelle gekommen war und mit seinem gestutzten Bart, den halblangen Locken und dem schwarzen Tabarro so gar nicht aussah wie einer der Uskoken.
Davide legte einen Finger an die Lippen, um der Contessa zu verstehen zu geben, leise zu sein. Er näherte sich flüsternd. »Contessa? Ich bin Venezianer, ich bin aus Eurer Heimat, und ich bin gekommen, um Euch …«
Was dann kam, überraschte Davide nicht wenig: Die zarte Contessa holte aus und gab ihm eine Ohrfeige von einer Wucht, die nicht aus diesem kleinen Körper zu kommen schien. Davides Wange brannte, er wollte etwas sagen, doch angesichts der aufgebrachten Contessa kam er gar nicht dazu.
»Erst jetzt seid Ihr gekommen, um mich zu befreien?«, fauchte sie. »Das ist mir ja eine schöne Stadt, dieses Venedig! Wisst Ihr, wie viele Steuern mein Vater jedes Jahr entrichtet?«
»Contessa, ich bitte Euch …«
»Fast zwei Monate bin ich nun hier. Muss Wasser trinken und mein Kleid selbst waschen. Bin verlaust und schmutzig.« Sie war kurz davor, in Tränen auszubrechen.
»Mit Verlaub, Contessa, Ihr seht aus, wie eine wahre Venezianerin in der Gefangenschaft auszusehen hat. Eurer Schönheit konnte die schreckliche Zeit in dieser Zelle nichts anhaben.«
»Ach, tatsächlich?« Beinahe brachte Ludovica Strozzi so etwas wie ein Lächeln zustande. »Ja, wisst Ihr, ich hatte um eine Bürste gebeten und vor einigen Tagen auch bekommen, kein Elfenbein, aber immerhin, in der Not nimmt man ja, was man kriegen kann.«
Plötzlich war Davide alarmiert, er hörte Schritte näher kommen und sprang zur Tür, um sich nahe der Mauer zu verstecken. Natürlich, die Tür stand halb offen, und mit all dem Licht war das auch von Weitem erkennbar. Eine der Wachen schob die Tür noch etwas weiter auf und trat ein.
»Was ist denn hier los, Frau?«, fragte der Uskoke auf Italienisch mit starkem dalmatischem Akzent. »Ihr hattet nicht Besuch etwa?«
Die Contessa beherrschte die Situation ausgezeichnet und blickte den Uskoken kühl an. »Wer soll mich hier schon besuchen? Vielleicht der Doge?«
Der Uskoke kicherte und trat einen Schritt näher. Davide erkannte die Umrisse eines recht kleinen Mannes mit Lockenkopf. Der Säbel steckte in der Scheide am Gürtel.
Es ging ganz schnell. Der Griff von Davides doppelläufiger Pistole traf den Soldaten an der Schläfe; er stürzte stumm zu Boden. Davide zog ihn tiefer ins Zimmer und deponierte den Bewusstlosen in einer Ecke.
»Contessa, beeilt Euch. Wir müssen aufbrechen.«
»Na, da bin ich aber gespannt. Ihr wisst, dass die Burg nur ein Tor nach draußen hat?«
»Ja, das ist mir nicht entgangen.«
»Also?«
»Also nehmen wir genau jenes.«
Davide war ganz in Schwarz gekleidet, doch die Contessa in ihrem roten Prachtkleid, mit dem blonden Haar und der Haut von nobler Blässe strahlte allzu hell, um sich unauffällig davonzustehlen. Er warf ihr seinen Tabarro über, aber nur unter ihrem leisen Protest, denn sie befand, dass dieser Umhang ihrer Erscheinung erstens nicht würdig sei und zweitens möglicherweise Flecken auf ihrem Kleid hinterließe, was doch das einzige war, das sie noch hatte.
Sie schlichen hinaus auf die Empore, die wie zuvor menschenleer war. Unten ging es jetzt deutlich lauter zu, der Alkohol zeigte allmählich seine Wirkung. Eine enge, gewundene Treppe führte an einer Ecke hinunter ins ebenerdige Geschoss, in dem auch das Bankett stattfand. Glücklicherweise endete die Treppe nicht weit vom Ausgang, und für das Bankett war in jener Hälfte eingedeckt worden, die dem Ausgang gegenüberlag. Mit etwas Glück könnte man in der schummrigen Dunkelheit das Tor einen Spalt weit öffnen und von den feiernden Uskoken unbemerkt entkommen.
Sie betraten die ersten Stufen der Treppe, Davide voran, die Contessa bei der Hand haltend, was jene überraschenderweise mit sich geschehen ließ. Das Wenige, was Davide von den Gesprächen der Feiernden am Tisch verstand, unterschied sich nicht von dem, was man sich an Venedigs teuren Tafeln unter reichlicher Weinzufuhr erzählte: Geschichten von Frauen, vom Krieg und vom Gold. Es roch scharf nach Grillfleisch, das, wie Davide jetzt von der Treppe sah, auf Feuern in einem separaten, kleineren Saal zubereitet wurde. Ein kleines Fenster diente als Abzug, doch allmählich breitete sich der Rauch auch im Hauptsaal aus, was Davide nur recht sein konnte, schafften es die Kerzen doch nicht mehr, für allzu viel Helligkeit zu sorgen. Nach zwei Dutzend Stufen waren sie unbemerkt unten angelangt. Hier war der Rauch sogar noch dichter als oben, die Feiernden waren nur noch als Umrisse zu erkennen. In wenigen Schritten erreichten sie, immer an der Wand entlang, das Haupttor – welches, wie Davide sofort sah, mit einem gewaltigen Eisenriegel verschlossen war. Gut möglich, dass ein Mann allein ihn gar nicht aus den Angeln heben konnte. Was dann? Doch einen Versuch musste er wagen. Davide sah sich um; bislang war alles geradezu erschreckend glatt gelaufen, und auch der Eisenriegel ließ sich weit genug anheben, um die eine Hälfte des Doppelportals einen Spalt weit zu öffnen. Sofort strömte frischer Wind herein, der den Rauch aufwirbelte, doch niemand blickte in ihre Richtung.
»Fort nun«, flüsterte Davide und stieß die Contessa mit sanfter Gewalt ins Freie.
Auf einmal, als Davide schon so gut wie draußen war, erblickte er den lockigen Kopf eines Soldaten auf der Empore. Es war jener, den er kurz zuvor niedergeschlagen hatte. Sofort schrie er von oben los und deutete fuchtelnd aufs Tor. Nun wurden die trinkseligen Uskoken doch aufmerksam. Lenkovic rief etwas, das zweifellos wie ein Befehl klang, und schon stürzten einige Uskoken auf Davide zu, der seinerseits flink ins Freie sprang. Lenkovic dagegen blieb ruhig sitzen. In Sekundenbruchteilen fielen Davide zwei Dinge auf: Erstens schien die Hierarchie unter den Feiernden blitzschnell wiederhergestellt zu sein – bei jenen, die aufgesprungen waren, handelte es sich wohl um die niederen Handlanger, Anführer von untergeordneter Bedeutung, denn wohin sollte eine Contessa mit ihrem Erretter hier schon fliehen können? Zweitens, und deutlich beunruhigender: Es hatte sich auch Dragomir Sosna erhoben.
Davide packte Ludovicas Arm und riss sie mit sich fort. »Contessa, ich hoffe, Ihr seid gut zu Fuß.«
Das war sie. Ihre Füße huschten überraschend behände über das Gestein, und sie hatte sogar noch die Luft, Davide zu schelten. »Macht Ihr das schon länger?«, zischelte sie. Hinter ihnen wurde das Geschrei lauter.
»Wo sind die Soldaten? Wo ist die Eskorte für mich?«
»Keine Armee, Signorina. Nur Ihr und ich. Und zwei meiner Freunde. Hört nun gut zu, wenn Ihr ein Kommando hört, dann springt so hoch wie möglich.«
»Immerhin, doch so etwas wie ein Plan!«
»Springt jetzt«, rief eine Stimme aus einem Gebüsch. Es war Hasan. Davide und die Contessa machten einen Satz durch die Luft. Die Piraten waren schon dicht hinter ihnen, doch sie stolperten aus vollem Lauf über ein dünnes Hanfseil, das Hasan und Miguel gespannt hatten. Die Uskoken rappelten sich fluchend wieder auf; zwei von ihnen blieben liegen, offenbar hatten sie sich einen Fuß verstaucht oder gebrochen. Das verschaffte den vieren den nötigen Vorsprung, um bis zur Bucht zu laufen, wo sich Davide und der Contessa ein schauriges und majestätisches Schauspiel bot. Alle drei Rudergaleeren der Uskoken sowie die Beiboote, die dort verankert waren, standen in Flammen. Es knisterte und krachte, gerade kippte der Mastbaum der vordersten Galeere auf das Deck des Bootes direkt daneben. Das Feuer tauchte in der Dunkelheit die gesamte Bucht in ein tiefes Rot.
»Ihr wart nicht untätig, wie ich sehe«, zeigte sich Davide zufrieden, als alle vier am Ufer standen.
»Wie Ihr befohlen habt«, erwiderte Hasan.
»Und unsere Schiffe?«, fragte die Contessa und blickte umher.
Davide zeigte auf eine kleine Schaluppe ohne Unterdeck. »Ein kleines Boot und günstiger Wind, mit mehr kann ich nicht dienen. Und dies sind meine Gefährten Hasan und Miguel, aber für Höflichkeiten haben wir noch später Zeit. Darf ich bitten?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, bugsierte er die Contessa ins Boot. Miguel sprang hinterher und spannte die Armbrust, dann folgte Davide. Hasan löste die Taue und schob an, Davide hatte das Segel gesetzt, half aber gemeinsam mit Miguel mit dem Ruder nach. Das war auch nötig, denn die Uskoken hatten das Ufer erreicht. Die erste Welle von ihnen, direkt vom Bankett aufgesprungen, war noch unbewaffnet gewesen, doch nun, den Ernst der Lage erkennend, waren weitere Piraten nachgerückt, mit Säbeln und Pistolen ausgestattet. Als sie ihre Schiffe in Flammen sahen, war ihre Wut grenzenlos, sie fluchten, schrien durcheinander und wollten die Venezianer auf gar keinen Fall entkommen lassen. Schon flogen die ersten Kugeln über die flackernde See, Davide drückte die Contessa unter ihrem nimmermüden Protest hinter die Bordwand. Miguel legte das Ruder beiseite und schoss seine Armbrust mit bemerkenswerter Geschwindigkeit ab; immer mehr Uskoken blieben getroffen zurück. Allmählich nahm die Schaluppe Fahrt auf, aber das Wasser war flach, das offene Meer noch fern. Zwei Kugeln zischten durch das Segel, eine schlug in die Bordwand; ein Splitter traf Davide an der Wange. Auch er hörte auf zu rudern und richtete seine doppelläufige Pistole auf zwei der Uskoken, die sich, das Wasser aufschäumend, näherten. Im Gegensatz zu den venezianischen Matrosen, die zumeist nicht schwimmen konnten, bewegten sich diese beiden hier ausgezeichnet und kamen mit kräftigen Kraulzügen rasch heran. Einen der beiden traf Davide am Bein. Er schrie auf und ließ von der Verfolgung ab. Den Zweiten aber verfehlte die Kugel. Er kam näher und näher, dann tauchte er unvermittelt ab. Hatte Davide vielleicht doch getroffen?
Aber plötzlich tauchte der Schwimmer dicht neben dem Boot auf. Das schwarzrote Wasser perlte von seinem gewaltigen Schädel herab; es schien, als wäre ein Ungeheuer aus den Tiefen des Meeres aufgestiegen. Es war Dragomir Sosna, und seine Hände verhakten sich unerbittlich wie die Saugnäpfe eines Kraken an der Bordwand. Davide hieb mit der Pistole auf die Pranken ein, doch der Glatzkopf ließ nicht los, im Gegenteil: Mit einem akrobatischen Zug schwang er sich an Bord. Die Contessa schrie auf. Er war einen ganzen Kopf größer als Davide, der seinerseits schon nicht klein war. Der Venezianer prügelte mit aller Kraft auf seinen Widersacher ein, doch es war, als würde er einen Marmorblock bearbeiten. Selbst Treffer auf die empfindlichsten Stellen zeigten keinerlei Wirkung. Dragomir grinste, und während sein linker Arm Davides Kehle umfasste, griff ihn sein rechter Arm am Handgelenk und zog mit einer Wucht daran, dass der Venezianer glaubte, ohnmächtig zu werden. Seine Sinne drohten zu schwinden, doch dann stürzte Miguel mit seinem Holzknüppel herbei und hieb ihn über die Glatze des Riesen. Der schien gar nichts zu merken. Miguel hob erneut an und schlug diesmal so hart zu, dass die Keule krachend brach. Nun endlich zeigte Dragomir eine Reaktion: Ganz langsam blickte er sich um, ließ von Davide ab, sah den Spanier an und sackte in die Knie. Mit vereinten Kräften stießen Miguel und Davide den angeschlagenen Dragomir von Bord. Die Schaluppe hatte nun im Ostwind ordentlich Fahrt aufgenommen, man war außerhalb der Reichweite der Pistolen, deren Kugeln hinter ihnen ins Wasser klatschten. Hasan am Ruder steuerte die Schaluppe aus der Bucht aufs offene Meer. Der Bug durchteilte in flotter Fahrt die Adria, und neben dem Knarren des Segelwerks war das ständige Zetern der Contessa das einzig nennenswerte Geräusch.
Lenkowitsch stand oben auf einem Felsen und hatte sich die Szene reglos angesehen. Er sah im Widerschein der Flammen wie ein böser Geist aus, und Davide hatte das beunruhigende Gefühl, dass diese Begegnung nicht ihre letzte gewesen war.
Kapitel 2 Der Rapport
Im kleinen Saal des Dogenpalastes herrschte eine bedrückende Stille, während draußen auf dem Markusplatz und in den Nebengassen die Feierlichkeiten unüberhörbar waren und durch die Fenster kaum gedämpft hereinsickerten. Es wurde gebrüllt, gekreischt, gejubelt, denn schließlich befand sich die Stadt seit Wochen im Fieberschauer des carnevale! Der Lärm ließ das Mobiliar vibrieren und schüttelte die Farbpartikel der Wandfresken durch.
Doch hier im Sala delle Quattro Porte saßen zwei Menschen, die alles andere als das Karnevalstreiben im Sinn hatten. Einer davon war Calaspin, und dem war ganz sicher nicht zum Feiern zumute. Nicht während des carnevale, aber auch sonst nicht.
Der Kanzler rieb sich die Augen, als er angestrengt das Dokument studierte, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Wie immer war der Tisch übersät mit Schriftstücken. Was wäre die Republik bloß ohne ihn? Dann blickte er unendlich langsam auf. Seine Labialfalten schienen besonders tief, was, wie Davide inzwischen wusste, nie ein gutes Zeichen war.
»Fünf Uskoken verletzt, drei tot. Nennt Ihr das eine diskrete Aktion?«
Einige Augenblicke verstrichen, in denen der Lärm, der hereinschwappte, die Stille an Calaspins Schreibtisch eher noch verstärkte.
»Wäre ich Euch tot lieber gewesen?«, antwortete schließlich sein Gegenüber.
»Ich hatte Euch ausdrücklich darum gebeten, so unauffällig wie möglich vorzugehen«, seufzte der hagere Verwalter der Serenissima. »Der Doge wünscht, es sich mit Lenkowitsch nicht zu verscherzen. Es scheint, dass dieser Gauner …«
»Lenkowitsch oder der Doge?«
»Werdet nicht frech gegenüber den heiligen Institutionen Venedigs! Es scheint, dass dieser Gauner es tatsächlich schafft, die dalmatischen Seeräuber nach und nach zu vereinen. Es könnte dort unten eine machtvolle Armee entstehen, und es sind erfahrene Männer des Meeres, die einen hübschen Puffer zwischen uns und den Türken bilden könnten. Der Doge plant, einen Unterhändler für erste Gespräche zu ihm zu schicken, und ich habe ihm dazu geraten.«
»Was spricht dagegen?«
»Drei Tote. Ach ja, und die Galeeren, die den Flammen zum Opfer fielen. Hättet Ihr das nicht eleganter erledigen können?«
»In der Kürze der Zeit erschien uns das die beste Lösung, um unsere Flucht zu sichern.«
Calaspin ging auf Davides Bemerkung gar nicht erst ein. »Erste Verhandlungen wurden von Lenkowitsch abgebrochen, und wir können froh sein, dass die venezianischen Unterhändler mit allen lebenswichtigen Organen am rechten Fleck zurückkehrten.«
»Vergessen wir bei aller Politik aber nicht, dass dieser Lenkowitsch ein übler Bursche ist, der eine der reichsten Venezianerinnen entführt hatte«, mahnte Davide an.
»Richtig, die von uns allen überaus geschätzte Contessa Ludovica Strozzi.« Calaspin begann wieder zu blättern. »Außerdem hat sich der Ehemann beschwert, dass Ihr die Dame mitten im Karneval zurückgebracht habt. Hättet Ihr nicht noch ein wenig warten können?«
»Diese Beschwerde allerdings«, erklärte Davide, »kann ich voll und ganz verstehen.«
Kapitel 3 Der Raub
Der Tonkrug voll Wein schien in der Luft zu stehen, als wäre die Zeit angehalten worden. Doch im nächsten Moment näherte er sich in rasantem Tempo Davides Gesicht. Der duckte sich gerade noch rechtzeitig, und der Krug schlug mit einem gewaltigen Krachen hinter der Theke ein, nicht weit von Wirt Claudio, genannt Quattrodenti. Der sprang mit einem Satz hervor, machte den Rüpel ausfindig und hieb mit einer eigens für renitente Kunden bereitliegenden zylindrischen Keule auf ihn ein, bis das Blut floss und das Jammern groß war. Die Gäste johlten, und selbst der Verprügelte, der den Krug aus reinem Übermut in eine unbestimmte Richtung geworfen hatte, schien sich bei allem Wehklagen auf eine merkwürdige Weise zu amüsieren. Die drei Flötisten auf der hölzernen Empore in einer Ecke des Raumes hörten gar nicht erst auf mit ihrem Spiel.
Es war einer jener gemütlichen Abende in der Spelunke in Cannaregio, die in den letzten Monaten zu Davides Lieblingsort geworden war. Nein, hier traf man keinen der feinen Herren, denn Cannaregio war eine übel beleumundete Gegend, in der Messerstecher und allerhand Gesetzesbrecher ihre Heimat hatten. Doch jetzt, im Karneval, war alles anders. Alle trugen Masken, die Ärmsten wie die Reichsten, und tatsächlich gab es nicht wenige hohe Herren, die den Kitzel genossen, gut getarnt zu den dukatenfernen Schichten hinabzusteigen. Es war infernalisch eng, halb Venedig schien hier einzukehren, man brachte kaum das Glas zum Mund. »Glas« war hier ein großes Wort, Quattrodenti griff in der turbulenten Maskenzeit lieber zu robusten Holz- oder Tonbechern. Quattrodenti, eigentlich Claudio, hieß so, weil ihm aus Gründen, die niemand kannte, genau jene vier Schneidezähne – zwei oben und zwei unten – fehlten, und der Rufname galt gewissermaßen der Erinnerung an die vergangene Pracht. Sic transit gloria mundi.
Zuletzt hatte Davide den alten Geizhals sogar überredet, für ihn statt des entsetzlich sauren Weins ein paar Fässchen des guten Ribolla zu horten und bei Gelegenheit zu öffnen. Davide hatte die Kneipe schon mehrmals bei gewissen Anlässen als Ort nutzen können, um wertvolle Informationen über Venedig zu bekommen. Die Armen redeten hier ungeniert, und die Reichen fühlten sich vor dem langen Arm des Gesetzes sicher, der hier wenig bewirken konnte. Dafür sorgte schon »der Friulaner«, ein namenloser Gigant von einem Rausschmeißer, der gnadenlos auswählte. Trinker jeder Couleur waren willkommen, Spitzel der Serenissima mussten draußen bleiben. Widerworte ersparte man sich besser, denn der Friulaner konnte schnell ungemütlich werden. Überhaupt war er nah am Vulkan gebaut, hatte mehrmals Ärger mit dem Gesetz gehabt, doch weil Davide einmal ein gutes Wort für ihn einlegte – als er selbst noch ein angesehener Bürger war und kein Spion –, hatte er beim Friulaner ein großes Guthaben.
Davide trug eine dezente schwarze Maske, die nur die Augenpartie und Wangen bedeckte, sein Freund Miguel ein ähnliches Modell in Weiß. Es war keine originelle Verkleidung, aber darauf kam es auch nicht an. Im Karneval zählte einzig, seine wahre Identität zu verschleiern, und dafür waren die Masken mehr als geeignet. Die beiden hatten beschlossen, sich am heutigen Tage in die Feierlichkeiten zu stürzen, und warteten nur noch auf ihren Kumpel Tintoretto, der noch im Atelier zu tun hatte und mit der ihm eigenen Geschwindigkeit wahrscheinlich wieder drei, vier Porträts zugleich fertigstellte. Sie hatten sich mit etwas Mühe einen Platz an der Theke freigedrängelt, wobei viel Geschubse gar nicht nötig war. Miguel war ein eindrucksvoller Bursche, und über Davide, den viele Stammgäste hinter seiner Maske mühelos erkannten, kursierten längst Gerüchte, die den einen oder anderen etwas nervös machten. Manche hielten ihn gar für einen jener geheimnisvollen Meuchelmörder der Serenissima, die nachts durch die Straßen schlichen und Feinde der Republik hinterrücks niederstachen. Auf jeden Fall waren Davide und Miguel Personen, denen man lieber Platz machte. Unterdessen sorgte Quattrodenti für steten Wein-Nachschub, Davide und Miguel wurden natürlich strikt aus dem teuren Ribolla-Fass bedient. Einmal hatte der Wirt versucht, nach dem dritten Glas seiner illustren Gäste zu der für ihn kostengünstigeren Massenware zu wechseln. Miguel hatte es zuerst bemerkt, und beinahe wäre der Wirt dafür eines weiteren Zahns verlustig gegangen.
Endlich tauchte Tintoretto auf. Er hatte wie immer seine Hände voller Farbrückstände und die Augen auf schmal gestellt. Das konnte nur bedeuten, dass er, wie eigentlich jeden Tag, neben der unbestreitbar fleißigen Arbeit auch eifrig inspirierenden Getränken zugesprochen hatte. Doch weder seinem Gang noch seiner Aussprache merkte man irgendetwas an. Sofort drängte sich das hagere Genie durch die Menge, grüßte seine Freunde und bestellte bei Quattrodenti einen Wein, doch der hörte nicht gleich zu, sondern musste erst noch eine frisch ausgebrochene Schlägerei zwischen zwei Damen schlichten.
Die drei Freunde tranken noch ein gemeinsames Glas bei Quattrodenti und schoben sich dann Richtung Ausgang, was beinahe schwieriger war, als hineinzugelangen, weil nun, mit dem beginnenden Sonnenuntergang, immer mehr Menschen in die Spelunke strömten. Alles lärmte in Richtung Theke, man begrüßte die Freunde, schaute misstrauisch auf jene, die man nicht kannte, orderte seinen Becher. Aber man ließ letztlich auch gern die Ziehenden ziehen, auf dass Platz geschaffen würde.
Endlich draußen, wandten sich die drei in Richtung Rialtobrücke. Es war ein schummriger Nachmittag im November und völlig windstill, der Nebel hüllte die Stadt langsam ein. Und vielleicht war es gut, dass nicht alle alles sehen konnten. Etwa die Kartenspiele in den Nebengassen oder die Knutschereien zwischen völlig Fremden, auch zwischen Menschen gleichen Geschlechts.
Die Rialtobrücke war ein altersschwacher Holzbau, der schon mehrmals nachgegeben hatte und hastig ausgebessert worden war. Bald sollte eine neue Brücke aus Stein das hölzerne Provisorium ersetzen, was in Venedig allgemein recht skeptisch gesehen wurde. Vor allem die Gilde der Gondolieri opponierte heftig gegen den geplanten Protzbau, würden doch viele Kunden ausbleiben, die für kleines Geld auf die andere Seite des Großen Kanals gelangen wollten. Wobei die Gondolieri prinzipiell gegen jeden Brückenbau oder -ausbau wetterten. Ihnen war die Stadt bei Hochwasser und baufällig stets am liebsten.
Rund um die Rialtobrücke war an Weiterkommen nicht mehr zu denken, die Menschen standen so dicht gedrängt, dass es eher eine stete Welle war, die vor und zurück schwappte. Davide hatte manchmal das Gefühl, dass seine Füße nicht einmal mehr den Boden berührten. Masken tanzten überall um ihn herum, selbst Frauen, Babys und Bettler trugen eine. Direkt an der Brücke hatte sich ein kleiner Zirkus versammelt. Ein Feuerschlucker, natürlich ebenfalls maskiert, hatte sich mit seinen heißen Fackeln ein paar Fuß Platz geschaffen und zeigte seine Kunst, gleich daneben jonglierte ein Mann äußerst kunstvoll mit drei Säbeln. Auch ihm war es gelungen, dass die Menschen respektvoll Abstand bewahrten, johlten und klatschten.
»Seht, eine adivino«, rief Miguel und deutete auf ein schmutziges Zelt, das sehr provisorisch zwischen einer Häuserwand und einem Mauervorsprung seinen Platz gefunden hatte. »Wie sagt man bei euch?«
»Eine Wahrsagerin?«, fragte Davide.
»Genau. Lasst uns hören, wie es um uns steht. Ich gebe eine Runde Zukunft aus.«
Miguel ließ sich in seinem Enthusiasmus nur schwer bremsen, und schon drängten sich die drei in dem Zelt, das von einem rätselhaften violetten Licht beleuchtet wurde, dessen Quelle Davide nicht ausfindig machen konnte. Der Stoff hielt den Lärm von draußen verblüffend gut ab.
Auf einem Hocker saß eine Gestalt, die eine Kapuze so tief ins Gesicht gezogen hatte, dass man nur ihre blutleeren Lippen sah. Vor ihr stand ein Tisch.
»Auf nun, wer zuerst?« Miguel klatschte in die Hände, dann schob er Tintoretto vor, der auf dem Hocker gegenüber der Gestalt Platz nahm.
»Ich lese aus Händen oder lege die Karten«, flüsterte die Gestalt. Ihr Timbre war unverkennbar weiblich, ihr Dialekt schwer zu deuten.
»Was ist teurer?«, scherzte Tintoretto.
»Nein, was ist verlässlicher?«, hakte Miguel nach.
Die Wahrsagerin blickte auf, doch ihr Gesicht blieb verborgen; die Lichtquelle musste genau hinter ihr sein. Dann senkte sie wieder den Kopf und streckte beide Hände vor. »Gebt mir Eure linke Hand«, sagte sie. »Es ist die reine Hand, die dem Herzen am nächsten ist.« Könnte ihre Sprache das Sizilianische sein?
Tintoretto tat, wie ihm geheißen. Die Wahrsagerin rieb seine Hand sanft mit ihren Händen, dann blickte sie die Handinnenfläche des Malers an. Doch schaute sie wirklich? Mit ihren Fingerspitzen tastete sie auf ihr herum. Offenbar las sie auf diese Art.
»Ihr seid ein Mann von kreativem Geist«, befand die Wahrsagerin nach einiger Zeit.
»Kunststück, bei all den Farbklecksen auf seinen Fingern«, murmelte Miguel. Die Wahrsagerin blickte erneut auf und schien den jungen Spanier zu fixieren. Langsam wandte sie sich wieder Tintorettos Hand zu.
»Ihr seid von viel Geld umgeben, und besonders heute war es so.«
»Ihr habt recht«, rief Tintoretto aus. »Sie hat recht«, wandte er sich an seine Freunde, die hinter ihm standen, »gerade heute waren ein Gradenigo und eine junge Dandolo bei mir. Ganz schön gute Kunden.« Tintoretto rieb mit der freien rechten Hand Daumen und Zeigefinger aneinander.
»Macht Euch keine Sorgen um Eure Zukunft. Das Geld wird Euch lange treu bleiben«, sagte die Wahrsagerin schließlich. Mit einem breiten Grinsen stand Tintoretto auf.
»Als nächster Ihr, ungestümer Spanier«, befahl die Wahrsagerin.
»Hört man meinen Akzent so deutlich?«, scherzte Miguel, als er sich setzte. Auch bei ihm folgte dasselbe Ritual, eine Art wärmende Massage der linken Hand. Doch als die Wahrsagerin die Handfläche ihres Kunden betastete, schüttelte sie den Kopf. »In dieser Hand erkenne ich nichts, Ihr müsst mir Eure andere geben.«
»Ich werde sie doch nicht verlieren?«
Mit der rechten Hand schließlich war die Wahrsagerin zufrieden, als sie sie mit ihren Fingerkuppen erkundete. Miguel kicherte ein wenig, weil es kitzelte. »Ja, hier ist alles ganz deutlich. Ihr werdet bekannt werden. Sehr bekannt. Mit einer großen Lüge. Aber es ist nicht Eure Lüge.«
Miguel runzelte die Stirn. »Rätselhafte Worte sprecht Ihr da, Señora.«
»Hab dich doch nicht so, Hauptsache berühmt«, befand Davide, der sich nun seinerseits setzte. Nach der Erwärmung verharrten die Fingerspitzen der Wahrsagerin regungslos auf Davides Hand. Es war eine sanfte, beinahe schwebende Berührung, kein Aufstützen. Doch die eingefrorene Bewegung war äußerst merkwürdig. Das Gejohle von draußen war nun gut zu hören. Die drei blickten einander an, und Davide räusperte sich schließlich. Unendlich langsam blickte die Gestalt auf und strich sich dann die Kapuze vom Kopf. Was zum Vorschein kam, überraschte die drei: eine junge Frau, fast ein Mädchen noch, mit ganz glattem, langem weißem Haar und weißer Haut, sodass ihr Kopf beinahe leuchtete. Ihre Augen flackerten in der plötzlichen Helligkeit in einem so hellen Blau, dass sie fast vor Davides Augen verschwammen, wie ein kleines Meer. Die junge Wahrsagerin war auf eine verstörende, ätherische Art bildschön.
Und nun griff sie Davides Hand fester und blickte ihm eindringlich in die Augen, sodass sich Davide unbehaglich fühlte. Und als er und die anderen nun ganz deutlich ihre milchigen Augen sahen, wurde ihnen unvermittelt klar: Die Wahrsagerin war blind.
»Hört mir gut zu, Herr. Ihr seid in großer Gefahr, von diesem Moment an, doch ich habe einen Rat für Euch: Folgt dem Heiligen Ignatius.«
»Wem soll ich bitte folgen?«, wunderte sich Davide.
»Folgt dem Heiligen Ignatius. Er wird Euch beschützen. Und nun verlasst mein Zelt. Passt auf Euch auf, denn Ihr werdet gesucht, von bösen Menschen.«
»Der Erste reich, der Zweite berühmt, der Dritte ein Held – diese adivina hatte einen hübschen Sinn fürs Dramatische«, lachte Davide, nachdem sie aus dem Zelt getreten waren und sich im Karnevalsrummel wiederfanden.
»Ja, und der Abschluss mit dir war doch höchst wirkungsvoll«, gab Miguel zurück. »Ob sie wirklich blind ist, oder hat sie irgendwelche Tropfen oder Essenzen in ihre Augen geträufelt, um des Effektes willen? Und um uns eine volle Dukate abzuknöpfen?«
»Ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich blind ist. Blinde verfügen über ein ausgezeichnetes Gehör, und sie hat sofort erraten, dass du ein Spanier bist, obwohl du kaum einen Satz gesagt hast«, bemerkte Davide, »und ein ungestümer dazu!«
»Aber nun genug von Hokuspokus und Scharlatanerie. Mir steht der Sinn nach Handfestem«, forderte Tintoretto.
»Wohl eher nach etwas Trinkbarem.« Kaum hatte Miguel es gesagt, hatte die Menge sie schon vor ein feines casinò geschoben, das ohnehin Miguels Ziel gewesen war. Das üppige, ebenerdige Apartment gehörte einem gewissen Fabio, dem etwas verzogenen, aber insgesamt nicht unsympathischen Sohn eines reichen Ratsmitglieds, der nach dem Prinzip »leben und leben lassen« verfuhr und, solange er seine Dukaten in der Tasche hatte, zu jedem großzügig war, ganz egal, welchen Standes. Er hatte diese kleine Wohnung als Spiel- und Trinkhalle hergerichtet, in der andere junge Männer seiner Herkunft und einige geladene Gäste sich trafen, um jenen Vergnügungen nachzugehen, die von den Ratsmitgliedern äußerst ungern gesehen, in der Karnevalszeit aber zumindest nicht strafrechtlich verfolgt wurden. Ein junger Mann nahe der Pforte regelte den Einlass, denn immer wieder versuchten einige Feiernde, sich einen Zugang zu verschaffen. Er war kein großer oder furchteinflößender Bursche, doch irgendetwas an ihm wirkte auf den zweiten Blick außerordentlich gewalttätig; vielleicht waren es die eng beieinanderliegenden, schmalen Augen, die den Eindruck machten, er würde vor keiner Schlägerei zurückschrecken. Dieser Eindruck täuschte im Übrigen keineswegs.
»Miguel, du Teufelskerl!«, begrüßte der Mann mit den gefährlichen Augen den Spanier. Miguel de Cervantes hatte in der kurzen Zeit seines Aufenthalts in Venedig schon jede Menge Freunde gefunden, die höhere Gesellschaft war ganz vernarrt in ihn und sein freundliches, exotisches und etwas wildes Wesen.
Nach einer kurzen Begrüßung tauchte ein zweiter Mann aus dem Dunkel des Eingangs auf. »Haltet inne, edle Herren«, sprach er in einem überraschend bestimmten Ton. »In diesem Aufzug dürft Ihr heute nicht hinein.«
Alle blickten verwirrt, außer Miguel und dem jungen Mann direkt am Eingang. Letzterer griff hinter sich und zauberte. »Mein Kompagnon hat recht. Heute ist der Zutritt nur mit Toga gestattet.«
»Miguel, wohin entführst du uns?«, fragte Tintoretto, der etwas Mühe hatte, sich in die Toga zu wickeln, während Davide schon längst bereit war.
»Ihr werdet’s schon sehen.«
»Immer dem Lärm nach«, wies der Mann vom Eingang den Weg.
Sie folgten dem langen schmalen Gang, der in ein Cortile mit hübsch verziertem Brunnen unter freiem Himmel führte. Von der gegenüberliegenden Seite hörten sie unverkennbare Feiergeräusche, die in Wellen aus Tür und Fenstern strömten.
»KOT-TA-BOS! KOT-TA-BOS! KOT-TA-BOS«, erschollen die Rufe, die immer lauter wurden.
Der Saal maß etwa fünfzig Fuß im Quadrat; die Wände waren mit hastig gemalten, wenig künstlerischen Fresken verziert, die typische italienische Landschaften und die eine oder andere Weinrebe zeigten. Auf Ottomanen lagen rotgesichtige Männer in Togas. Die Ottomanen waren im Kreis aufgebaut, und in der Mitte befand sich ein kleines, offenes und randvolles Weinfass, auf welchem ein Stückchen Holz schwamm. Auf dem Stückchen Holz war eine kleine Schnitzfigur platziert. Es war offenbar ein Doge im Miniaturformat. Die Männer auf den Ottomanen hielten schmale Trinkgefäße, zwei Diener füllten Wein nach.
»KOT-TA-BOS! KOT-TA-BOS! KOT-TA-BOS«, riefen die Männer wieder.
»Na, was sagt Ihr? Das wird doch ein großer Spaß!« Miguel klatschte in die Hände. Da flog ein Schwall Wein durch die Luft und klatschte gegen den Rand des Weinfasses.
»Er hat’s verfehlt!«, riefen die sichtlich angeheiterten Männer nun. »Bevete, bevete, trinkt, trinkt!«
Miguels Kumpel hatte ihnen drei Ottomanen freigehalten, auf denen sie sich niederließen. Kottabos spielten schon die alten Griechen und auch die Römer, daher wohl die Idee, sich als ebensolche zu verkleiden. Es wurde in verschiedenen Varianten gespielt, und hier ging es darum, im Liegen von seinem Sitz aus die Flüssigkeit so geschickt in Richtung des Weinfasses zu schleudern, dass die Holzfigur in den Wein fiel. Wer es nicht schaffte, musste trinken. Wer immer mehr trank, dem fiel diese Geschicklichkeitsaufgabe naturgemäß immer schwerer. Der Grad der Dekadenz des Spiels hing davon ab, welchen Wein man wählte. Davide erlaubte sich einen Schluck und erkannte, dass es sich um den guten Weißwein aus dem Friaul handelte, nicht um jene Massenware aus dem Veneto, in der, glaubte man dem Volksmund, auch mal Äpfel, Ratten und Exkremente mitvergoren wurden, um für geschmackliche Tiefe zu sorgen.
Die Feierei war schon arg fortgeschritten, und das, was man Zielwasser nennt, wirkte nicht mehr sonderlich. Wein schwappte über das Ziel hinaus oder spritzte vom Fass zurück, sodass Davide, Miguel und Tintoretto schon nach wenigen Augenblicken völlig durchnässt waren. Die Reihe kam zunächst an Miguel, der es erst im dritten Versuch schaffte und demgemäß zwei volle Becher Wein zu leeren hatte. »Bevete, bevete!«,rief die Meute.
Tintoretto war noch ungeschickter und brauchte vier Versuche, was ihm augenscheinlich gut gefiel. »Bevete, bevete!«Er ließ sich nicht lange bitten und leerte die Becher in einem Zug. Nun brachten die Diener auf bunten gläsernen Tellern Sarde in savor, in Essig eingelegte Sardellen, was den Magen auspolstern und das Trinken auf unbestimmte Zeit verlängern sollte. Einer der Gäste neben Tintoretto fiel von seiner Ottomane zu Boden und blieb einfach liegen. Niemand kümmerte sich groß drum. Für ihn waren die Sardellen zu spät gekommen.
Ringsum hatten es sich die reichen Söhne Venedigs bequem gemacht, gerade mit tiefer Stimme, doch noch kaum mit Bartflaum versehen. Einige von ihnen erkannte Davide, trotz der Masken, die alle konsequent trugen. Was Kottabos anging, waren sie zwar enthusiastisch, aber völlig ungeübte Novizen.
Davide hingegen erwies sich als außerordentlich talentiert. Schon im ersten Versuch schickte er den Dogen ins Weinfass, und die Liegenden zeigten sich enttäuscht. »Doppelt oder nichts, doppelt oder nichts«, krähten sie. Auch das war ein eingeschliffenes Ritual für all jene, die das Anfängerglück für sich gepachtet hatten. Was die betrunkenen Togaträger nicht wussten: Natürlich kannte Davide das Spiel, hatte es schon oft gespielt und sich immer außergewöhnlich geschickt angestellt. Es kam darauf an, das Handgelenk ganz weich und locker zu lassen und mit einem entschlossenen Ruck, aber ohne jede Anspannung den Schwall Wein fliegen zu lassen. Davide war so begabt darin, dass die anderen ihn bald ausbuhten. Und ihn nötigten, trotzdem zu trinken. Und wer will bei einem solchen Fest schon Spielverderber sein? Also trank er wie die anderen. Dennoch erwies er sich, auch als nach vielen Runden die Reihe wieder an ihn kam, als unfehlbar und versenkte die Dogenfigur ein ums andere Mal im Weinfass.
Bald stand der Wein knöchelhoch auf dem Boden, es roch säuerlich, die Togas waren durchnässt, die Diener kamen beim Nachschenken ins Rutschen. Als einer von ihnen mit einem Krug hinfiel und sich eine tiefe Schnittwunde am Unterarm zuzog, brach ein besonders enervierender junger Bursche in Jubel aus. Miguel, schon mit deutlicher Schlagseite, erhob sich, versetzte dem unangenehmen Jüngling ein paar Schläge und brachte ihn damit zum Schweigen. Dann legte er sich wieder auf seinen Platz und wartete, bis er an der Reihe war, während der Jüngling sich die blutige Nase hielt und offenbar entschlossen war, sich von dem Vorfall die Feier nicht verderben zu lassen. Vielleicht war er aber auch schon völlig betäubt vom Alkohol.
Inzwischen wurde um Geld gewettet. Davide ließ man ausdrücklich außen vor, was bedauerlich war, hätte er hier doch gut ein paar Dukaten gewinnen können. Tintoretto als erkennbar Ältester der Gruppe wurde zu einer Art Zielscheibe der jungen Männer; alle wollten mit dem vermeintlichen Trottel wetten; viele wussten, wer er war, und was konnte so ein Kunsthandwerker wie er schon vertragen? Tintoretto verlor Dukate um Dukate, schien vom Wein immer betäubter zu werden. Miguel und Davide versuchten ihn abzuhalten, aber vergeblich. Miguel schlief bald ein, und Davide fielen auch allmählich die Augen zu. Doch er war schlagartig wach, als Tintoretto sich erhob, sich räusperte und dem Saal eine wahnwitzige Wette anbot!
»Ich werde den Dogen ins Wasser bugsieren und dabei mit dem Rücken zum Fass stehen. Für hundert Dukaten, meine Herren!« Sein Bart zitterte in höchster Erregung, er schien wahnsinnig geworden! Die hundert Dukaten als Wetteinsatz hatten die Jünglinge schnell gesammelt, der Kunsthandwerker besaß, das wussten sie, dank seiner zahlreichen Aufträge von den höchsten Herren der Stadt genug Kredit; den Wettgegnern reichte sein Wort. Einzelheiten des Wurfes wurden geklärt, würde er während des Wurfes wirklich mit dem Rücken … er würde. Das war, befand Davide, ein ganz unmögliches Unterfangen. Der Schwall Wein musste mit einer gewissen Wucht geschleudert werden; eine Parabel über die Schulter hinweg ergäbe nur einen schwachen Regenschauer, zu wenig, um den hölzernen Dogen vom Platz zu bewegen. Doch das Geld wurde unter großem Gejohle eingesammelt und auf Tintorettos Ottomane platziert, der daneben stand, das volle Glas Wein in der Hand und über die Schulter immer wieder Maß nehmend, dabei bedenklich von einem Bein aufs andere schwankend. Diese Wette, war sich Davide sicher, würde seinen Freund den Verdienst vieler Monate kosten.
»Ertränkt den Dogen! Ertränkt den Dogen!«, skandierten die Jünglinge mit rotglühenden Gesichtern.
Tintoretto hatte augenscheinlich Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Was hatte er sich nur bei dieser schwachsinnigen Wette gedacht? Schließlich hatte er seine Position gefunden. Ein letzter Blick über die Schulter, und dann erhob er das Glas.
»Ertränkt den Dogen! Ertränkt den Dogen!« Die Rufe wurden lauter, fordernder, fanatischer, füllten den gesamten Raum. Davide schaute auf Miguel, der mit den Schultern zuckte und sich an die Stirn tippte.
»Ertränkt den Dogen!«
Dann geschah etwas Überraschendes: Mit einem Ruck schleuderte Tintoretto den Wein nicht etwa über die Schulter, sondern unter seiner linken Achsel hindurch in Richtung Fass. Durch den waagerechteren Flug hatte der Schwall genügend Druck, um den Dogen vom Holz zu stoßen, und gezielt hatte Tintoretto auch gut. Es war ein perfektes Manöver, der Doge plumpste in den Wein.
Alle schauten einander fassungslos an. Doch die Venezianer waren gute Verlierer und brachen bald in Jubel aus. Wildfremde Menschen umarmten voll Rührung den Maler, das Geld wurde ihm ohne Klagen überlassen, einige Runden wurden auf die Wette gehoben. In Venedig musste jeder Abend unvergesslich sein, Karneval oder nicht, und Tintoretto hatte dieses Mal seinen Teil dazu beigetragen, dass die jungen nobili daheim und auf der nächsten Feier etwas zu erzählen hatten.
»Das hast du doch geübt«, hörte Davide noch Miguel sagen, als Tintoretto zurück auf seine Ottomane sank.
»Täglich, mein lieber Spanier, täglich. Unterschätze nie die Fähigkeiten eines alten Trottels.« Die Antwort hörte Davide schon nicht mehr, dessen Augen nun allzu schwer geworden waren.
Währenddessen machten sich zwei Gestalten am Markusdom zu schaffen. Einer trug das Gewand eines Geistlichen, der andere einen schlichten schwarzen Umhang. Niemand beachtete sie, obwohl der Markusplatz voller Trubel war, der in diesen Tagen bis tief in die Nacht anhalten würde. Maskierte Männer jagten lustig kreischenden maskierten Frauen hinterher, Küsse und Ohrfeigen wurden mit großer Lust ausgeteilt, Marketender priesen ihre Waren an, Hütchenspieler nahmen all jene aus, die auf ihr schnelles Auge vertrauten und die fingerfertigen Tricks einfach nie verstehen würden. Aber war dieses wirbelnde Leben allenthalben nicht die beste Tarnung? Keiner schaute hin, als die beiden das Hauptportal einen Fußbreit aufstemmten, hineinschlüpften und das Portal gleich wieder hinter sich schlossen. Sie gingen zwei Stufen hinab, denn der Dom war unter dem Gewicht der Ziegelsteine mit der Zeit tiefer in den schlammigen Lagunengrund gesackt als der unbebaute Markusplatz. Dann schritten sie über die prächtigen Marmormosaiken, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Kein Zweifel, sie kannten sich aus und strebten ihrem Ziel ohne Umwege zu.
Der Abend war schnell gekommen, doch reichte im Dom mit all den schimmernden Goldmosaiken schon der kleinste Lichteinfall, um den Innenraum ausreichend zu erhellen. In der Vorhalle, dem Narthex, funkelten die Mosaiken aus dem Alten Testament, und besonders prächtig machte sich die Schöpfungsgeschichte in der Kuppel, die Trennung von Licht und Finsternis, die Erschaffung des Himmelsgewölbes und von Erde und Wasser; es folgten die Gestirne, die Fische, die Vögel und die Landtiere, bevor Adam die Seele eingehaucht wurde. Der Heilige Geist schwebte in Gestalt einer Taube über dem Wasser wie Venedig selbst. Düster war es hier unten schon, aber zur groben Orientierung reichte es allemal. Etwas mehr Licht spendeten, weiter im dreischiffigen Innenraum, die Mosaike von der Geburt der Brüder Kain und Abel, vom Leben Noahs, Josephs und Abrahams, sowie das goldene Altarretabel pala d’oro, das mit mehr als zweitausend Gemmen und Juwelen geschmückt war. Es herrschte eine milchig-erhabene Helligkeit, von der die Eindringlinge sich jedoch nicht im Geringsten beeindrucken ließen.
Die beiden wussten genau, wohin sie gehen mussten. Am Sarkophag unter dem Hauptaltar streiften sie Priestergewand und Umhang ab und machten sich mit den Steinmetz-Werkzeugen, die sie darunter versteckt hatten, ans Werk.
Kapitel 4 Der Protonotario
Ein furchterregender schwarzer Vogelschnabel beugte sich auf ihn herab. »Herr Davide Venier, Herr Davide Venier!« Der Arm der Vogelnase rüttelte an seiner Schulter.
Davide schreckte auf, als er in die Maske blickte, die nur Unheil verkünden konnte. War er vom Schwarzen Tod befallen? Doch war nicht die letzte Epidemie schon ein gutes Jahrzehnt her? Dann fiel ihm ein, dass ja Karneval war. Hasans und Veronicas Gesichter tauchten nun ebenfalls über ihm auf. Hasan blickte etwas besorgt, Veronica deutlich verärgert, aber trotz seiner verschlafenen Augen glaubte Davide auch, ein wenig Amüsement wahrzunehmen. Und ja, er gab ganz sicher eine lächerliche Figur ab. Es war einfach keine gute Idee, mit zwei der erfahrensten Trinker Venedigs auf ein Fest zu gehen.
»Ich mache Euch eine kräftige Gemüsesuppe, dann kommt Ihr wieder auf die Beine«, sagte Hasan, der heute früh schon auf dem Markt gewesen war.
»Dafür wird keine Zeit sein«, erwiderte der Vogelschnabel, »der Kanzler sowie der hochwürdige Doge der Serenissima Repubblica di San Marco wünschen Herrn Veniers sofortiges Erscheinen im Palazzo Ducale.«
Davide stand auf, wusch sich hastig mit dem von Hasan jeden Morgen aus dem Stadtteilbrunnen herangeschleppten Wasser, das in einem tönernen Becken neben dem Bett stand, trank danach einen Schluck gesüßtes Wasser und zog sich schnell an. Für eine Rasur beim Barbier blieb keine Zeit mehr, der Vogelschnabelige, der jeden Schritt von Davide beobachtete, drängte zum Aufbruch.
Apropos: »Warum habt Ihr eigentlich die Maske auf, Bote?«
»Eine Order vom Großen Rat. Zu bestimmten Tagen haben im Karneval alle städtischen Angestellten die Maske zu tragen.«
»Ist das nicht schrecklich unbequem?«
»Herr, Ihr sagt es. Aber nun darf ich Euch erneut bitten, Euch zu beeilen.«
Veronica Bellini konnte ihrem immer noch etwas derangierten Geliebten rasch einen Kuss geben und schaffte es in diesem kurzen, intimen Moment, sowohl zärtlich als auch verächtlich zu wirken. Sie hielt die Feierei mit Tintoretto und Miguel für keineswegs gut, und Davide würde ihr noch ein bis zwei Wörtchen zu erklären haben. All das drückte sie mit ihrem Kuss und ihrem Blick aus.
Eine der schnelleren Gondeln der Republik wartete vor dem Kanal in Cannaregio, wo sich Davide eine Wohnung genommen hatte, nachdem er das Gefängnis verlassen hatte – als freier Mann, wenngleich für immer als Agent der Republik in die Pflicht genommen. Vier Gondolieri, zwei am Bug und zwei am Heck, sorgten für ein geschwindes Vorankommen und bogen bald auf den Canal Grande ab, während Davide mit dem Vogelmaskenmann vor dem Fahrtwind geschützt in der Felze saß. Auf eine kleine Plauderei hatten beide keine große Lust, der Bote durfte ohnehin nichts sagen, und Davide musste sich etwas sammeln, denn es schien sich um eine außergewöhnlich wichtige Angelegenheit zu handeln, wenn sogar der Doge bei den Konsultationen anwesend war. Die gleichmäßigen Ruderschläge und ein paar Befehlsrufe waren die einzigen Geräusche, die durch den Zeltstoff in der Mitte der Gondel drangen.
Heute hatte sich der Nebel verzogen, ein warmer Wind von Süden strich über die Stadt und brachte feuchte Meeresluft mit sich. Gerade als sie am Markusplatz angekommen waren, begann es heftig zu regnen. Davide blickte nach oben, die belebende Erfrischung der dicken Tropfen willkommen heißend.
Der Bote brachte ihn zu den ebenfalls maskierten Wachen, die allerdings eine schlichte, typische volte gewählt hatten. Auch die weiteren Wachen, denen Davide überreicht wurde, trugen Masken. Einem Nicht-Venezianer mussten diese Scharaden ungemein komisch vorkommen, und selbst Davide, der all dies seit seiner frühesten Kindheit kannte, fand Masken am Regierungssitz eher eigenartig. Doch für ästhetisch-politische Betrachtungen blieb ihm keine Zeit, er ging die Scala dei Giganti hinauf, vorbei an den übermenschlich großen Statuen von Mars und Neptun, die Venedigs Herrschaft über die Erde und das Meer symbolisierten und unmaskiert waren. Im ersten Stock empfing ihn ein weiterer Wachsoldat, der ihn schließlich zur Scala d’oro geleitete, jener famosen goldenen Treppe, deren anmaßenden Glanz Davide in seinem jetzigen Zustand schon gar nicht so recht vertragen konnte.
Oben wartete ein weiterer Wachsoldat, der ihn in den Sala degli Scarlatti begleitete. Der Raum mit seiner gewölbten Decke wirkte ungewöhnlich hell, weil die tanzenden Flammen des Feuers, das in dem gewaltigen Kamin loderte, in den goldüberzogenen blütenförmigen Intarsien an der Decke gespiegelt und zurückgeworfen wurden. Es wirkte, als stünde man nach einem Aufstieg durch viele Wintertage plötzlich auf einer sonnendurchfluteten Bergspitze. In dem Raum standen drei Personen, von denen Davide zwei sofort erkannte. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt und redeten leise. Sie bemerkten nicht, dass die Tür geöffnet und Davide vom Soldaten hineingeleitet wurde. Auf höfische Zeremonien wie das umständliche Ankündigen eines Gastes verzichtete man in Venedig tunlichst und bemühte sich bei aller Pracht um möglichst wenig Aufhebens. Keiner der drei trug eine Maske.
Calaspin bemerkte seinen Agenten zuerst. »Ah, Venier, gut, dass Ihr gekommen seid.«
Nun blickten auch der Doge und der dritte Mann auf, der unverkennbar ein Kirchenfürst sein musste. Doge Alvise Mocenigo, in einem schlichten bronzefarbenen Gewand, lächelte, als er Davide sah, und ging ihm in seiner typischen gebückten Haltung ein paar Schritte entgegen. »Venier, ich habe nur das Beste von Euch gehört.« Sein corno rutschte ihm dabei tief in die Stirn, er war wirklich erstaunlich klein und schwach, das Gesicht war für sein verhältnismäßig junges Alter extrem faltig, doch seine Augen versprühten noch viel Leben; sie wirkten beinahe wie eingesetzt.
Nun räusperte sich Calaspin. »Dies ist Monsignore Costantino Della Valle, Protonotario apostolico, engster Berater unseres verehrten Papstes Pius des Fünften«. Der Vorgestellte trug ein violettes Gewand mit würdevoll weiten Ärmeln, darüber einen silberfarbenen Schal.
»Engster Berater …«, wiederholte der Mann mit einer tiefen Stimme, in der doch auch ein wenig Spott mitklang, gar so, als würde er Calaspin imitieren. »Und doch bin ich nur ein kleines Licht am Himmelsgewölbe unseres Herrn.«
Alles am Protonotar wirkte quadratisch: sein Gesicht, sein Bart und auch sein gedrungener Oberkörper. Er war fast so groß wie Davide und schien insgesamt recht gesund zu sein, ganz anders als viele der Bischöfe und Kardinäle, die im Amt schnell schlaff und dick wurden. Sogar eine frische Gesichtsfarbe brachte der Römer mit in die Lagune. Nun gab er Davide die Hand und erwartete wohl ein zumindest angedeutetes Niederknien, was jener verweigerte, zum Wohlwollen seiner anwesenden Vorgesetzten. Der Papist zuckte kurz mit den Mundwinkeln, fasste sich aber schnell.
»Der Heilige Stuhl gibt unumwunden zu, dass man mit Venedig nicht immer ganz glücklich ist …«
»Das beruht auf Gegenseitigkeit«, entgegnete der Doge leise, aber bestimmt.
»… doch in dieser schweren Stunde müssen wir alle zusammenstehen«, fuhr der Monsignore ungerührt fort. Auf seiner Stirn prangte, exakt in der Mitte, ein gewaltiger Leberfleck, wie das Zeichen eines Auserwählten.
»Dem stimme ich zu«, sagte Doge Alvise und wandte sich dann an Davide. »Nun, mein lieber Venier, was wisst Ihr von unserem gepriesenen Schutzheiligen, dem Heiligen Markus, und seiner Reise nach Venedig?«
»Wollt Ihr die Geschichte hören, die man den Kindern erzählt, oder die wahre Geschichte?«
Der Doge blickte sich vergnügt um. »Kinder sind hier keine anwesend, oder?«
Also erzählte Davide die Geschichte, die den Venezianern so vertraut war wie der Anblick des Canal Grande, dem Monsignore aber, der interessiert zuhörte, noch nicht in jedem Detail. Nach allem, was man wusste, waren im Jahr 820 die beiden Kaufleute Buono und Rustico, einer aus Malamocco, der andere aus Torcello, nach Ägypten in die Hafenstadt Alexandria gereist. Dort lagen die Gebeine des Evangelisten Markus, der den Märtyrertod gestorben war; angeblich war er mit einem Strick um den Hals im Jahre 68 zu Tode geschleift worden. Der Kustode der Kirche, in welcher der Leichnam in einem alten Steinsarkophag ruhte, klagte über die Verfolgung der Christen durch die Sarazenen und äußerte Besorgnis um die vielen Schätze und Reliquien, die hier lagerten. Die Venezianer hörten sich das voller Anteilnahme an oder vermittelten diese zumindest glaubhaft und schlugen vor, den Evangelisten nach Venedig zu überführen, wo er in Sicherheit wäre. Der einbalsamierte Leichnam wurde aus dem Sarkophag gehoben, aus dem Leinentuch gewickelt und durch die Überreste eines weniger bedeutenden Heiligen ersetzt. Man brachte Markus in einer Kiste an Bord und bedeckte ihn mit Kohl und gepökeltem Schweinefleisch. Als muslimische Beamte den Inhalt inspizierten, brachen sie in den Ruf »kanzir, kanzir!« – »grauenvoll, grauenvoll!« aus und beendeten rasch die Kontrolle. Als man die offene See erreicht hatte, legte man Markus an Deck und stellte Kerzen und Weihrauchfässer um ihn herum auf. Der Heilige schien für günstige Winde zu sorgen und hielt auch die Piraten fern. Markus ließ zudem auf wundersame Art seine Wächter wissen, dass er lieber in den Dogenpalast verbracht werden wollte als in die damalige Kathedrale. Also bettete man ihn für ein paar Jahre im Bankettsaal des Palastes, bis man eine Kapelle für ihn nahe der alten Kathedrale an jener Stelle errichtete, an der heute der Markusdom steht. Die Venezianer verehrten ihren neuen Heiligen so sehr, dass der eigentliche Schutzpatron der Stadt, der Heilige Theodorus, bald vergessen war. Im Jahr 976 geschah dann die Katastrophe: Die Kathedrale fing bei einem Aufstand Feuer und brannte komplett nieder. Man musste davon ausgehen, dass auch die Reliquie zerstört worden war, doch im Jahr 1094 stürzte ein Säulenstumpf um und brachte sie zum Vorschein. Ein wirkliches Wunder und ein letzter Beweis dafür, dass Venedig die von Markus auserwählte Stadt und der Doge der von Markus auserwählte, legitime Herrscher über sie ist.
»Sehr schön, Venier«, nickte der Doge und war offensichtlich besonders dankbar, dass Davide jegliche Anspielung auf mögliche Schwindeleien unterlassen hatte.
»Nun, und mit diesen Reliquien gibt es ein Problem«, räusperte sich Calaspin und zeigte eine gewisse Verlegenheit. »Sie sind fort.«
Das allerdings war ein Schock für Davide – als hätte man ihm gesagt, der Canal Grande wäre ausgetrocknet.
»Fort? Was meint Ihr?«
»Sie sind vor zwei Nächten gestohlen worden«, seufzte der Doge.
»Wie kann das sein? Aus dem Markusdom? Vor unser aller Nase?«
»Nun, der Karneval hat wohl alle etwas in seinen Bann gezogen«, versuchte Calaspin das Unerklärliche zu erklären. Er referierte, was man bisher wusste. Ein paar Männer waren offenbar in den Abendstunden in den Markusdom eingedrungen. Sie waren niemandem aufgefallen, die Wachen vor den Toren hatten sich längst dem Karnevalstrubel hingegeben und büßten nun dafür in den pozzi, den feuchten Gefängnissen im Erdgeschoss des Dogenpalastes. Die Diebe hatten den Sarkophag unter dem Hauptaltar fachmännisch aufgestemmt und den Leichnam geraubt. Aufgefallen war es erst am Morgen danach, weil ein Küster Spuren von Staub entdeckt und die Soldaten des Palastes alarmiert hatte. Wer weiß, vielleicht hätte den Diebstahl sonst bis jetzt noch niemand bemerkt.
Davide blickte nachdenklich in das knisternde, allmählich schwächer werdende Feuer. »Habt Ihr einen Verdacht?«, fragte er.
»Nicht den geringsten. Es ist wohl naheliegend, dass ein Reliquienhändler dahintersteckt, aber das Risiko wäre enorm. Der Diebstahl eines Heiligen von dieser Bedeutung würde, ohne der Judikative vorgreifen zu wollen, mit Folter und Tod bestraft. Und natürlich mit ewiger Verdammnis unter furchtbaren Qualen.«