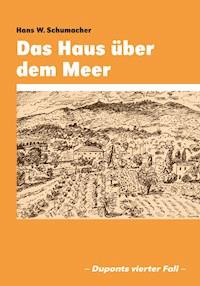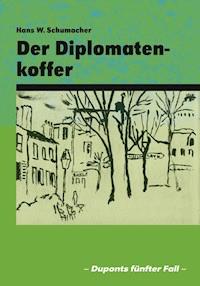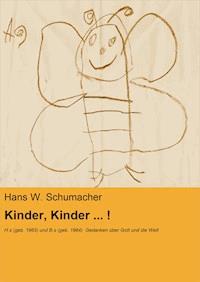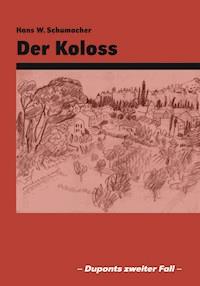
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Henri Dupont, Agent der Assurance Internationale, versichert eine Ausstellung von Gemälden Goyas gegen Diebstahl. Doch trotz aller Sicherheitsmaßnahmen wird u.a. das berühmte Bild Der Koloß, gestohlen. In derselben Stunde stirbt ein Doktorand der Germanistik während eines Studentenkrawalls. Er finanzierte sein Studium als Aushilfskraft in dem betreffenden Museum. Da sein Leichnam auf der Terrasse vor dem Büro des neuberufenen Dozenten Bernard Grandville, eines Freundes von Henri, gefunden wird, wird er von linksgerichteten Studenten als Mörder verdächtigt und entsprechend angefeindet. Dupont betätigt sich erneut als Amateurdetektiv, rettet einem Kollegen das Leben, als dieser die Gemälde von den Dieben einlösen will und Henri verliert seinen Job bei der Versicherungsgesellschaft, weil er eigenmächtig in den Austausch eingegriffen habe. Im Gegensatz zur Polizei ist er der Meinung, daß mit dem Ausschalten der Diebe der Fall nicht erledigt ist und macht sich wieder auf die Suche nach dem wirklichen Mörder des Studenten und den gestohlenen Gemälden. Dabei führt ihn sein Weg nach Deutschland, Belgien und Spanien und weit in die Vergangenheit zurück. Dann wird auf seinen Freund Bernard während eines Vortrags mit dem Titel "Sherlock Holmes und der Höllenhund - Mythologie des Kriminalromans" ein Mordanschlag verübt, dem der Dozent beinahe erliegt. Inzwischen hat aber Dupont bei einem Ausflug nach Korsika den wahren Schuldigen identifiziert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans W. Schumacher
Der Koloß
Kriminalroman Reihe Dupont 2
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Hauptpersonen
Der Koloß - Teil 1
Der Koloß - Teil 2
Der Koloß - Teil 3
Der Koloß - Teil 4
Der Koloß - Teil 5
Der Koloß - Teil 6
Nachwort
Impressum neobooks
Hauptpersonen
Die Hauptpersonen
Henri Dupont, Abteilungssleiter bei der Assurance Internationale (AI) in Cannes
Alida Celentano, seine Lebensgefährtin
Maillard, seine Sekretärin in der AI
Matin, Versicherungsdetektiv der AI
Lafont, Justitiar der AI
Alain Grandville, Industrieller
Bernard Grandville, Dozent am Germanischen Institut der Universität Cannes, Sohn Alains
Caroline, seine Frau
Ute von Studnitz, seine Studentische Hilfskraft
Nicolas Marnier, Professor fär neuere deutsche Literatur und Institutsleiter
Jean Klossowski, sein Assistent
Pierre Fournier, Professor, Leiter der älteren Abteilung
Furet, sein Assistent
Janvier, Professor für neuere deutsche Literatur
Pollet, sein Assistent
Mercier, Professorin für neuere deutsche Litratur
Vernon, ihre Assistentin
Lemaire, Leiter der Forster-Edition
Friedrich Lamprecht, deutscher Lektor
Fernet, Bibliotheksangestellter
Mathilde Lebeau, eine ältere Studentin
Denise Marquet, Studentin
Margot Cellier, Studentin
Marc Gury, Studentenvertreter
Fabier, Student
Fernand Lapin, Doktorand bei Prof. Marnier
Breton, Sekretärin am Germanischen Institut
Boulogne, Rektor der Universität
Edouard Grappin, Direktor des Grimaldi-Museums in Antibes
Fräulein Brachet, seine Sekretärin
Morvin, Sicherheitsbeauftragter des Museums
Antonio Girona, Museumswärter
Roche, Polizeipräfekt
Lagarde, Hauptkommissar der Abteilung fär Raub und Diebstahl
Mallory, Kriminalhauptkommissar
Marchand, Inspektor, sein Assistent
Pons, Hauptkommissar, Chef der Antiterroreinheit (ATE)
Mondot, Inspektor, Agent der ATE
Desailly, Inspektor, Agent der ATE
Neveux, Staatsanwalt
Roche, Polizeipräfekt
Jacquemart, Vorsitzender Richter des Zivilgerichts
Desportes, Lokalredakteur der Zeitung La Voix du Sud in Cannes
Marius Barre, Chefredakteur der Zeitung La Voix du Sud
Hausangestellte Blondeau
Bjoerklund, ein norwegischer Tourist
Herbert, Schulleiter des Lyzeums in Malmédy (Belgien)
Beschreibungen des Tatorts am Germanistischen Institut befinden sich in den Kapiteln 5 und 16.
Der Koloß - Teil 1
Bernard Grandville lehnte sich neben der Tür des Hörsaals an die Wand und während er darauf wartete, daß sich der Raum füllte, beobachtete er diejenigen, die bereits Platz genommen hatten. Im Hintergrund saßen einige etwas mitgenommene Studenten, denen er ansah, daß sie sich an dem Krawall beteiligt hatten, bei dem sich "Rechte“ und "Linke“ in die Haare über Angelegenheiten geraten waren, die er möglichst zu ignorieren versuchte. So war gestern von einem studentischen Komitee ein Vorlesungsboykott ausgerufen worden, den die Dozenten ablehnten, während die meisten Assistenten sich dafür erklärten. Bernard hütete sich allerdings, Stellung zu nehmen; er war noch neu am Département, da war Zurückhaltung angebracht. In der ersten Reihe gerade unter dem Pult, auf dem schon sein Manuskript lag, unterhielt sich der Seminardirektor Marnier mit dem Leiter der Abteilung ältere deutsche Literatur, Fournier, einem Mann, der die strengen Züge eines im harten Dienst der Wissenschaft ergrauten Gelehrten hatte. Grandville fürchtete sich vor seinen Fragen am Ende des Vortrags, den er eher als unterhaltsame Einlage in der Vortragsreihe "Literatur und Verbrechen“ für Hörer aller Fakultäten gedacht hatte.
Marnier, ein aristokratischer Typ von Mitte sechzig, der noch blonde, wenn auch etwas schüttere Haare und eine immer noch jugendlich wirkende, faltenlose Gesichtshaut besaß, hatte das Thema der Reihe in einer feuchtfröhlichen Runde zusammen mit dem eben eintretenden Janvier, einem jüngeren Dozenten für neuere deutsche Literatur, und Klossowski, seinem Assistenten, ausgebrütet. In der letzten Woche hatte er einen Beitrag über Heinrich von Kleists Der Zweikampf und Das Fräulein von Scudéri von E.T.A. Hoffmann beigesteuert.
Die hinteren Reihen hatten sich inzwischen mit Studenten gefüllt, die sorgsam Abstand von den Hochschullehrern und Assistenten hielten, welche sich allmählich um Marnier scharten. War es Korpsgeist oder Angst davor, vom Direktor, der dem Lehrkörper Anwesenheitspflicht verordnet hatte, nicht wahrgenommen zu werden, fragte sich Bernard, der sich langsam dem Komment des Seminars anpaßte, in das er erst Anfang dieses Studienjahrs aufgenommen worden war. Pollet, der Assistent Janviers hatte sich Klossowski zugesellt, sie tuschelten miteinander und sahen dabei häufig zu Grandville hinüber, Dr. Lemaire unterhielt sich mit Fräulein von Studnitz, der Hilfskraft Grandvilles, und Fräulein Vernon, der Assistentin von Frau Mercier, nur Furet saß allein und starrte mit leerem Blick und untergeschlagenen Armen vor sich hin.
Marnier hatte sich, wie Bernard später von Kollegen hörte, der Berufung Bernards erfolglos widersetzt, was alle erstaunte, die den Einfluß des Direktors kannten. Aber er hatte Bernard bei einem Empfang, den er traditionsgemäß dem Lehrkörper und den neuen Mitgliedern des Départements zu Beginn des Studienjahrs in seinem großen Haus in St.Juan-les-Pins gab, sehr freundlich begrüßt.
Das Département hatte einen nicht zu großen Hörsaal für die Veranstaltung ausgewählt, damit man nicht vor leeren Bänken lesen mußte. Das war aber eine unnötige Vorsichtsmaßnahme gewesen, denn schon bei den ersten Sitzungen stellte sich heraus, daß der Direktor mit seiner Idee ins Schwarze getroffen hatte. Alle Plätze waren besetzt und auch jetzt kurz vor Beginn mußten sich einige Zuhörer, die nicht die Mut hatten, sich neben die Dozenten in der ersten Reihe zu setzen, an die Wand lehnen. Bevor der Pedell pünktlich um 19 Uhr die Tür schloß, schlüpfte noch Henri Dupont, Abteilungsleiter der Assurance Internationale, hinein, bewegte, als er an seinem Freund Bernard vorbeiging, winkend die Hand an der Hüfte und gesellte sich den Leuten zu, die die Wand säumten. Bernard machte ihm mit dem Kopf ein Zeichen, sich zu den Respektspersonen in der ersten Reihe zu setzen, aber Henri schüttelte den seinen energisch, er fühlte sich bei der Jugend wohler.
Marnier, der stets mit der Zeit geizte, nickte Bernard autoritativ zu, er sollte pünktlich beginnen. Bernard bewegte sich mit einem Knoten im Hals auf das Pult mit seinem Vortragsmanuskript zu, da öffnete sich die Tür noch einmal, und herein trat eine schöne, elegant gekleidete Frau mittleren Alters, musterte die Sitzgelegenheiten, nahm in der ersten Reihe neben Marnier Platz und blickte lächelnd zu Grandville auf. Bernard errötete leicht, Mathilde war seit einer Woche seine Geliebte, und als er sie dort sitzen sah, neben den Professoren, die so nüchtern und trocken wirkten, packte ihn heimlicher Stolz, er verzog sein Gesicht, um ihr den Gruß zurückzugeben, wurde sich klar, daß man das bemerken könnte, legte seinen Gesichtszügen den nötigen Ernst zu und begann:
"Meine Damen und Herren, mein Thema heißt Sherlock Holmes und Cerberus oder Mythologie der Detektivgeschichte." Die ersten Worte hatte er mit belegter Stimme gesprochen; er räusperte sich und fuhr entschlossener fort: "Das fortdauernde Interesse an den Tag für Tag über die Fernsehschirme flimmernden Kriminalfilmserien Columbo, Kommissar Maigret, Hercule Poirot und Dutzenden anderen sowie die ununterbrochene Flut von Kriminalromanen scheinen die Unsterblichkeit einer Gattung zu bestätigen, die vor 150 Jahren mit E.A.Poes Die Morde in der Rue Morgue das Licht der Welt erblickt hat. Was aber so zählebig und immer aktuell ist, muß auf einem Grund von Urerlebnissen errichtet sein, die von der Realisierung in einer bestimmten literarischen Gattung unabhängig ist. Was mag das sein?" Seine studentischen Zuhörer sahen ihn betroffen an, als müßten sie die Frage beantworten.
Er fuhr mit einem Zitat aus Conan DoylesDetektivgeschichte Das gefleckte Band fort:
„Guten Morgen, Madame“, sagte Holmes. „Mein Name ist Sherlock Holmes. Das hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson, dem Sie genauso vertrauen dürfen wie mir. Großartig, Mrs.Hudson hat bereits Feuer gemacht. Setzen Sie sich doch näher zum Kamin, Madame! Ich werde sofort heißen Kaffee bestellen, Sie zittern ja.“
„Es ist nicht die Kälte“, sagte die Frau leise und zog ihren Stuhl näher ans Feuer.
„Sondern?“
„Angst, Mr. Holmes. Nackte, kalte Angst.“ Sie hob ihren Schleier und wir sahen ein verhärmtes graues Gesicht, aus dem uns zwei angstvolle Augen unruhig anblickten. „Ich kann diese Angst nicht länger ertragen. Ich werde verrückt, wenn es so weitergeht.“
Bernard erläuterte das Motiv der Angst als eines der Kennzeichen der Kriminalliteratur, die sie als ein Derivat der Tale of Terror and Horror erscheinen läßt.
"Die Erzeugung von Angst“, sagte er und blickte bedeutsam in die Runde, "verbindet die Literatur des Schreckens mit der Kriminalgeschichte, aber die letztere unterscheidet sich von ersterer dadurch, daß die Erregung der Angst nicht ihr Hauptzweck ist, das Ziel der Kriminalgeschichte ist im Gegenteil die Beseitigung der Angstursache. Die Ursache der Angst aber ist der unerkannte Mörder.“
Er sah auf die Menschen vor sich und überlegte, während er mechanisch seinen Text ablas, was sich wohl in seinem Gefühl ihnen gegenüber ändern würde, wenn er wüßte, daß ein Mörder zwischen ihnen verborgen war. Wahrscheinlich gar nichts, solange er sich selbst nicht bedroht sah. Die ganze Welt war gespickt mit unbestraften Kriminellen, wahrscheinlich hatte er schon vielen die Hand gedrückt, die imstande gewesen wären, die ihre an seine Kehle zu legen.
"Der Mörder“, las er, "ist wie eine Mikrobe, die lange unbemerkt in einem gesunden Körper existieren kann, bis sie eines Tages virulent wird. Hat man Angst, wenn sich die Symptome der Krankheit melden, geht man zu einem Arzt, so wie man sich, bedroht von einem Kriminellen, an die Spezialisten der Verbrechensbekämpfung wendet.“
Bernard verbreitete sich danach über das Faktum, daß zwischen der Wirklichkeit und ihrer literarischen Verarbeitung ein Unterschied besteht. Kaum fing er damit an, merkte er, wie das Interesse der Experten in der ersten Reihe nachzulassen begann. Das war ein alter Hut, natürlich: Realität blieb Realität und tat weh, und Fiktion war stets harmlos und vergnüglich, sogar wenn es einem der Helden an den Kragen ging.
"Die Literatur jagt immer der Wirklichkeit nach, ohne sie je zu erreichen, es geht ihr wie Achilles, der die Schildkröte nicht einholen kan“, las Bernard ab.
Hier hellten sich die Gesichter seiner Kollegen ein wenig auf. Ermutigt fuhr er fort:
"In Agatha Christies berühmtem Roman Zehn kleine Negerlein“, leises Kichern belohnte ihn für die Nennung des Titels, "werden zehn Leute von einem pensionierten Richter auf eine einsame Insel eingeladen. Schon beim ersten Abendessen sinkt einer von ihnen vergiftet vom Stuhl. Am nächsten Tag stirbt der Gastgeber, während sich die Gäste noch fragen, wer den Mord an Nummer eins begangen haben könnte. Als schon zwei Särge für die beiden ersten Opfer im Keller stehen, geht der dritte von hinnen, und ihm folgt der vierte und fünfte. Flucht ist nicht möglich, und eine Stimme, die unheimlich aus den Wänden dringt, verkündigt den Übriggebliebenen das gleiche Schicksal als Sühne für Verbrechen, die sie einst begangen haben sollen. Man stelle sich die Panik solcher Menschen vor, die trotz ständiger gegenseitiger Beobachtung und intensiven Rätselratens nicht dahinterkommen, wer unter ihnen der Henker ist. Ich verrate Ihnen seinen Namen nicht, um Sie nicht des Vergnügens an diesem in seinem Genre klassischen Roman zu berauben. Sie sollten ihn unbedingt lesen.“ Gelächter. "Aber Agatha Christie legt keinen besonderen Wert auf die Darstellung der Angst und des Schreckens dieser Leute. Die Todesangst spielt zwar eine unerläßliche Rolle im Kriminalroman, denn nur der Tod vermag die stärkste Spannung zu erzeugen, aber eine wirkliche existentielle Angst kann und will er im Leser nicht erwecken; er ist keine Erbauungsliteratur. Es geht ihm nicht um das memento mori, sondern um Unterhaltung. Der Leser ist nicht wirklich beteiligt, er fühlt sich von der Bedrohung ausgenommen und kann sie deshalb genießen: ein ziemlich perverses Faktum. Schließlich war es möglich, daß Tausende von Römern sich am Tod der Gladiatoren in der Arena vergnügten: Ave Caesar, morituri te salutant! Und auch heute gehen wohl viele nur zu Autorennen, um spektakuläre Unfälle zu sehen.“
Protestierendes Gemurmel belehrte Bernard, daß er zu weit gegangen war. Mathilde blickte fast ängstlich zu ihm auf, wahrscheinlich hatte sie nicht erwartet, daß er das Thema von dieser Seite her anging. Zuweilen sah sie geistesabwesend vor sich hin, ab und zu fuhr ihr Kopf ruckartig auf, wenn er etwas Neues berührte, dann ließ sie ihn wieder sinken und spielte mit ihren goldberingten Fingern. Das peinigte Bernard, er verhaspelte sich zweimal beim Vorlesen, während er sich fragte, was sie beunruhigte. Hoffentlich hatte es nichts mit ihrer Beziehung zu tun, die sich gerade erst so schön angelassen hatte. Ihm schwoll das Herz, wie er sie dort sitzen sah, die große Dame, die ihn mit dem Temperament einer Tigerin überfallen und im Handumdrehen verführt hatte. Ehe er einen Gedanken auf Gegenwehr verwenden konnte, ehe er sich darüber klar geworden war, was geschah, war er schon in ein Netz verstrickt, aus dem er weder heraus konnte noch wollte. Er fühlte sich seiner Frau gegenüber auch nicht schuldig. Es war wie ein Blitzschlag über ihn gekommen, und er war nur allzu gern das Opfer.
Sie saß plötzlich wie ein Paradiesvogel in seinem Seminar zwischen den eher schlicht und lässig gekleideten Studenten. Schon durch größeres Alter und Reife von ihnen abgehoben, erregte sie seine Aufmerksamkeit durch ihre nicht gerade wissenschaftlichen, aber lebensklugen Bemerkungen, auf die er lieber einging, als auf die naiveren Fragen der jüngeren Teilnehmer. Nach einer Sitzung verstrickte sie ihn, während er seinem Arbeitszimmer zusteuerte, in ein Gespräch, das er zwischen Tür und Angel nicht abbrechen konnte. Also lud er sie ein, bei ihm Kaffee zu trinken. Er fragte sie, warum sie in ihrem Alter noch studierte, und sie erklärte ihm, sie sei eben geschieden worden, wolle ein neues Leben beginnen und die Ausbildung nachholen, die sie durch eine verfrühte Heirat nicht habe vollenden können. Sie zeigte sich interessiert an seinen Forschungen, lobte sein Seminar und da es sein erstes war, schmeichelte ihm das sehr.
Marnier kritzelte zuweilen etwas auf die Rückseite eines Briefumschlags, den er aus seiner Jackentasche gezogen hatte, Bernard beobachtete es mit Mißtrauen. Lamprecht, der deutsche Lektor, schien amüsiert. Er sah mit fröhlichem Gesicht zum Vortragenden auf und schien jedem Wort Beifall zu spenden. Bernard war ihm dankbar dafür.
Nachdem er den Unterschied zwischen Verbrechensdichtung und Detektivgeschichte erläutert hatte - die eine verfolgt das Leben eines Kriminellen oder eines kriminellen Aktes chronologisch, die Detektivgeschichte dagegen ist analytisch, geht vom begangenen Verbrechen, dem rätselhaften Fall aus und erzählt in ihrem Verlauf das Unerzählte, also das, was dem Fall voranging - fuhr er fort:
"Die analytische Kriminalgeschichte, wie sie sich um 1800 allmählich herausbildete, Beispiele dafür hat Prof. Marnier in seinem Vortrag in der letzten Woche gebracht“, Bernard verneigte sich leicht gegen den Chef des Seminars, der aber völlig regungslos geradeausschaute und beim Schreiben einen Punkt auf der Wand hinter Bernard zu fixieren schien - an seiner Stelle hätte Bernard ständig auf die schöne Frau an seiner Seite gestarrt - "ist das Kind aus der Ehe von Aufklärung und Romantik.“ Er bemerkte, wie Janvier die Stirn runzelte, machte sich aber nichts daraus, denn er war sich sicher, daß man seine Argumentation akzeptieren mußte, und schob ein Paradox hinterdrein:
"Dabei ergibt sich das merkwürdige Faktum, daß die Aufklärung als etwas Mythisches erscheint und die Romantik, der man gewöhnlich eine Affinität zum Irrationalen zuschreibt, den Standpunkt der Rationalität und des Realismus vertritt. Ich will das erläutern: Dem modernen Menschen, dem Menschen der Neuzeit, ist klar geworden, daß die restlose Aufklärung, d.h. die sogenannte 'ganze Wahrheit', nie zu erreichen ist. Die ganze Wahrheit, die ewige Wahrheit, ist immer eine Illusion.“
Marnier kritzelte wild auf seinen Briefumschlag und schüttelte den Kopf. Bernard hatte das erwartet. Marnier war ein erbitterter Aufklärer und hatte des öfteren in seinen Schriften gegen den Obskurantismus der Rechten und Reaktionäre gewettert, wie er alle nannte, die nur etwas mit Romantik am Hut hatten. Bernard war nun bewußt, was ihm bei der Diskussion blühen würde, aber unbeirrt fuhr er fort:
"Es gibt bekanntlich Fälle, daß sich Leute für Verbrechen schuldig erklären, die sie gar nicht begangen haben. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde man skeptisch gegenüber Geständnissen, die durch Folterung erzwungen waren. Ein Geständnis galt nicht mehr als unumstößliche Wahrheit. Diese Skepsis ist aber nicht ein Produkt der Aufklärung, wie man immer sagt, sondern der beginnenden Romantik. Die Romantik hat gegen den mythischen Glauben an eine generelle Aufklärbarkeit der Welt die Einsicht in die Begrenztheit des menschlichen Geistes gestellt und erkannt, daß jeder Mensch seine subjektive Perspektive besitzt, d.h. durch seine Brille sieht. Er betrachtet immer nur einen bestimmten Ausschnitt der Welt, nie das Ganze. Das bedeutet: Es gibt nur Annäherungen an die objektive Wahrheit, selbst wenn man noch so viele subjektive Gesichtspunkte miteinander vereinigt. Wie Karl Popper lehrt, ist es unmöglich, etwas zu verifizieren, also man kann nicht beweisen, daß etwas richtig ist, man kann nur falsifizieren, d.h. belegen, daß etwas nicht richtig ist. Daraus folgt, daß die Wahrheit nichts Ewiggültiges mehr, sondern daß sie zeitlich begrenzt ist, wahr ist nur das, was noch nicht als falsch erkannt worden ist. Die radikale Aufklärung, d.h. der Anspruch der Vernunft, ewiggültige Wahrheit aufzustellen, erschien damit als unglaubwürdig. Zugleich wurde damit erkannt, daß die Aufklärung keineswegs erst mit dem Siècle des lumières im 18. Jahrhundert begonnen hat, sondern am Beginn des Abendlandes zu finden ist, als man noch an die von der Aufklärung denunzierten Mythen glaubte.
Sucht man nun nach dem mythischen Vertreter der Aufklärung und des Lichts, dann stößt man auf den Sonnengott Apollo. Er ist der Held, der den Drachen der Finsternis besiegt, der als Sohn des Zeus Mutter Nacht bezwingt. Er ist nicht der einzige Lichtgott der Religionsgeschichte, es gibt viele seiner Art, aber alle sind mit Tötungs- und Bestrafungsinstrumenten, Schwertern, Pfeilen und Lanzen ausgestattet, mit denen sie das Böse, Schädliche, Unkultivierte, Chaotische ausrotten. Apollinische Helden erschlagen Ungeheuer und Verbrecher, überführen Lügner, Verräter und Heuchler, sie lüften Tarnkappen, lesen Spuren und lösen Rätsel. Sie sind Helden, Könige, Richter und Henker in einem. Der schöne Apollo scheut sich nicht, seinem Konkurrenten Marsyas die Haut bei lebendigem Leibe abzuziehen."
Die studentischen Zuhörer guckten ungläubig. Bernard lächelte sardonisch und fuhr fort:
"Ödipus, der apollinische Held, der das Rätsel der Sphinx löst, ist nicht nur der erste Detektiv, er ist auch der erste, der die Tragödie des Lichtbringers erlebt: denn die Wahrheit ist tödlich. Deshalb bestraft er sich, er sticht sich seine Augen aus, jene sonnenhaften Augen, die zuviel gesehen haben. Zuviel wissen, kann den Tod bedeuten. Die nackte Wahrheit ist nicht erträglich. Wir alle können Ödipus sein, nicht nur weil wir, wie Freud meint, am Ödipuskomplex leiden“, fügte er hinzu, obwohl es nicht in seinem Manuskript stand - leises Gelächter erhob sich unter den Zuhörern - "sondern weil wir Menschen sind, also Kreaturen, die aus einer Mischung von Licht und Nacht, Vernunft und Trieb, Geist und Körper bestehen.“
Bernard kam nicht mehr dazu, seinen Vortrag fortzusetzen. Schon eine Minute vorher hatte er draußen dumpfe Geräusche gehört, erregte Stimmen, Pochen, Krachen, plötzlich wurden die Türen aufgerissen und hinein drängte sich eine aufgeregte Menge junger Leute, die krakeelten, aufs Podium stiegen, Bernard sein Manuskript zu entreißen versuchten und ihm das Mikrophon wegnahmen. Spitze Mädchenstimmen kreischten "Streikbrecher raus!“ Bernard, gegen die harten Knochen einiger vierschrötiger Studenten gedrängt, versuchte sich und sein Manuskript zu verteidigen, plötzlich griff eine Hand danach, entriß es ihm und warf es Richtung Auditorium, über dem es Blatt für Blatt hinuntersegelte. Mathilde stand auf, um es zu retten, aber schon ihre elegante Kleidung erregte den Zorn der Antikapitalisten.
Ein bärtiger Waldschrat, der sich des Mikrophons bemächtigt hatte, erklärte die Sitzung für beendet, weil sich das Komitee für die Verteidigung demokratischer Rechte dafür entschieden habe. Aus dem von Rückkopplungsquietschen begleiteten Gekreisch entnahm Bernard, daß der Vorlesungsstreik beschlossen worden war, weil sich die Rechtsradikalen allzu erfreut über den Tod einiger arabischer Freiheitskämpfer gezeigt hatten, die bei einer Flugzeugentführung von der französischen Polizei erschossen worden waren. Solange sich diese und der Fachbereichsrat nicht dafür entschuldigten, würde der Lehrbetrieb lahmgelegt. Insbesondere zeigte man sich erbost darüber, daß man versucht hatte, sich der Kontrolle der Streikposten zu entziehen, indem man eine Veranstaltung so spät auf den Abend verlegt hatte. Marnier versuchte zu intervenieren:
"Meine Herren“, rief er, "Sie wissen, daß ich Ihre politischen Ansichten teile, aber die Mittel zu ihrer Durchsetzung kann ich nicht billigen. Sie schneiden sich mit einem Vorlesungsboykott in Ihr eigenes Fleisch.“
Hohngelächter antwortete ihm. Die Mädchen, die sich durch die Anrede Marniers übergegangen vorkamen, begannen zu zischen.
Bernard sah, wie sich die Zerzausten, verstärkt von einigen Kahlköpfigen, unter lautem Protest gegen das Podium in Marsch setzten. Er konnte in dem Gedränge Mathilde und Henri Dupont nicht mehr erkennen und hoffte, daß dieser sich nicht einmischen würde, denn er sah bereits, wie Janvier, der sich allzu hitzig gegen die Angreifer wandte, niedergerungen wurde.
"Literatur und Verbrechen!?“ höhnte der Waldschrat, das Mikrophon dicht vor den Mund haltend, als wollte er es fressen, "in Zeiten wie diesen, in denen es um die Verteidigung von Sozialismus und Demokratie gegen den Faschismus Le Pens geht, ist die Beschäftigung mit Literatur ein Verbrechen.“ Und er zitierte einen bekannten Satz von Bert Brecht gegen das Reden über Bäume. (Bert Brecht: Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über soviele Untaten einschließt.)
Inzwischen hatte sich die „Reaktion“ durch die Menge der neutralen Zuhörer gedrängt und begann ein Handgemenge mit den Eindringlingen. Als sich die geschlossene Front in Einzelkämpfe auflöste, an denen auch Mädchen mit grün, rot oder violett gefärbten Haaren und Nasenringen beteiligt waren, die Schienbeine malträtierten und Gesichter zerkratzten, benutzte Bernard die Gelegenheit, um sich auf den Gang zu retten. Mathilde war es offenbar schon vorher gelungen zu entkommen. Er konnte sie nirgends finden, lief den Korridor Richtung Haupteingang, stolperte dabei über Stuhltrümmer, die noch von den Gefechten des Nachmittags stammten, und las an der Wand Nieder mit den Faschisten. Plötzlich knuffte ihm jemand von hinten in die Rippen; vor Schreck und Erregung hätte er beinahe seinem Freund Dupont, der ihm nachgelaufen war, einen Schwinger verpaßt. Der wich aber geschickt aus und lachte.
"So sieht also die Schule der Weisheit aus! Mein lieber Bernard, ihr habt wirklich schlagende Argumente!“
Bernard grinste und meinte: "Ich hätte auch nicht gedacht, daß ich meine so verteidigen müßte. Wie fandest du denn meine These?“
"Ich bin mir noch nicht klar, ob du mir schmeicheln oder mich ohrfeigen wolltest“, sagte Henri, der sich schon einmal als Amateurdetektiv betätigt hatte. „Aber bevor ich mich für eine Version entscheide, würde ich den Vortrag gern zuende hören.“
“Ich werde dir eine Kopie geben“, sagte Bernard zerstreut und blickte in einen Quergang, ob Mathilde irgendwo auf ihn wartete. Dann kam ihm der Gedanke, daß sie vielleicht zu seinem Büro gegangen war, wollte aber Henri nicht in sein Geheimnis einweihen und versuchte, ihn loszuwerden.
"Entschuldigung“, sagte er, "ich habe noch einen dringenden Termin. Können wir uns vielleicht morgen sehen?“
Henri wunderte sich. Wie konnte sein Freund jetzt eine Verabredung haben, wenn er doch theoretisch noch bis nach acht seinen Vortrag hätte halten müssen? Aber er unterdrückte seinen Wunsch nach Aufklärung und fragte, ob er morgen mit ihm in eine Goya-Ausstellung im Museum von Antibes gehen wollte. Er hatte im Namen der Assurance Internationale die Bilder gegen Diebstahl versichert.
"Na klar“, sagte Bernard nervös, er wollte schnell weg, damit ihm Mathilde nicht entschlüpfte, denn eigentlich hatte er vorgehabt, mit ihr den Abend zu verbringen, "also gut, treffen wir uns morgen Vormittag um 11 Uhr in meinem Sprechzimmer, Nummer XY 17, kannst du dir das merken?“
"Aber ich war doch schon einmal da.“
"Ach so, ja, natürlich, hatte ich ganz vergessen, also dann adieu bis morgen.“ Bernard wandte sich ab und schritt eilig von dannen. Henri sah ihm nach und fragte sich, was in ihn gefahren war. So kurz hatte Bernard ihn noch nie abgefertigt. Er musterte den breiten Gang und die vor den Hörsälen aufgetürmten Barrikaden aus Tischen und Stühlen. "Bullen weg vom Campus", war in blutroter Schrift auf eine Betonwand gesprüht, und offenbar hielt sich der Rektor an die Forderung.
Grübelnd trat er aus dem Hauptportal auf die Straße und sah noch einmal zurück, ob Bernard nicht doch noch auftauchte. Aber er konnte ihn zwischen den Gestalten, die ab und zu das Haus verließen, nicht erkennen.
Die neugebaute Universität sah nicht schön aus, war aber praktisch und geräumig. Sie ging nicht in die Höhe, sondern in die Breite. Das Haus bestand aus vorgefertigten Bauteilen, deren hervorstechendste schwarzbraune Metallplatten waren, die die Außenflächen verkleideten. Die Farbe war „Edelrost“ zu verdanken, der angeblich die Eigenschaft besaß, nach einer gewissen Zeit nicht weiter zu korrodieren, sondern eine permanente Schutzschicht zu bilden. Das Gebäude, das ein Areal von 400 m im Quadrat bedeckte, besaß nur ein Obergeschoß. Zwischen den einzelnen Teilen des durch entsetzlich lange Gänge aufgeteilten Hauses gab es auch Innenhöfe mit Rasen, Bänken und Bildwerken, die Obergeschosse hatten Dachgärten, die mit Bäumchen und Sträuchern bewachsen waren, was dem düsteren Ganzen einen heiteren Akzent verleihen sollte.
Jetzt im Dunkel der Dezembernacht war allerdings nicht viel davon zu sehen. Das schwarze Gebäude verschmolz mit der Nacht und nur einzelne Lichter funkelten hervor. Zuweilen drängten sich lärmende Grüppchen von Studenten heraus, vom Parkplatz entfernten sich Autos im Kavaliersstart. Im Dunkeln sah er ein paar lemurenhafte Gestalten auf einer Terrasse über dem Haupteingang wirken; sie schrieben mit breiten Pinseln ein Wort an die schwarzen Platten, das Henri im trüben Licht der Laternen als "Mort" entzifferte. Er wartete Zusätze nicht ab, sondern setzte sich in seinen Wagen und fuhr nach Hause.
Bernard wanderte enttäuscht in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Mathilde war nicht erschienen. Da er nicht einmal ihre Adresse wußte, mußte er sich aufs Warten verlegen. Vielleicht kam sie ja morgen wieder. Er betrachtete das Sofa, auf dem sie sich gestern geliebt hatten, fand am Kopfende eine Haarspange, drückte sie an seine Lippen und steckte sie in die Brusttasche. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und zog ein Kollegheft heran, das jemand in seinem Büro vergessen hatte. Bernard konnte sich nicht erinnern, wer das gewesen war, und suchte nach dem Namen des Besitzers, fand keinen, blätterte uninteressiert in den Aufzeichnungen, überflog Buchauszüge, unter anderem aus einem Buch von ihm selbst, Notizen aus historischen und germanistischen Veranstaltungen, Bücherlisten, sowie die kleinen gekritzelten Zeichnungen, die man bei langweiligen Vorlesungen macht, und beschloß, das Heft samt einem stehengebliebenen Regenschirm zum Hausmeister zu bringen. Der konnte die Dinge beim Fundbüro abliefern.
Er trat ans Fenster und sah in die Nacht hinaus. Vor seinem Zimmer erstreckte sich eine mit immergrünen Pflanzen in Betonkästen gesäumte Terrasse. Alle fünf Meter standen Bänke, die von Kübeln mit Fächerpalmen umgeben waren, damit man sommers im Schatten sitzen konnte. Jetzt Anfang Dezember mit den kurzen, aber immer noch lauen Tagen, konnte man es ohne sie aushalten. Im schwachen Schein, den seine Schreibtischlampe auf den Dachgarten warf, glänzten unter der nächsten Bank ein Paar Schuhsohlen, die nach rechts geneigt waren. Es ist nicht zu fassen, dachte Bernard, jetzt lassen diese Clochards auch noch ihre alten Treter rumliegen. Erst letzte Woche hatte er vom Hausmeister eine Decke, einen aufgeschnittenen Pappkanister mit Rotwein und einen zerbeulten Hut entfernen lassen. Eine Woche lang lag das Zeug neben seiner Zimmertür.
Das weitläufige Gebäude war zu einem beliebten Aufenthaltsort für Vagabunden geworden. Neben den Heizungen ließ es sich gut ruhen. Man brauchte sich, wenn das Haus um 22 Uhr geschlossen wurde, nur auf einer der Toiletten zu verstecken, um es sich nachher in einer dunklen Ecke gemütlich zu machen, nachdem die Hausmeister ihren letzten Rundgang gemacht hatten. Studentinnen waren in den nach acht fast menschenleeren Gängen bereits von Sittenstrolchen überfallen worden und forderten drakonisch in groß an die Wand gesprühten Manifesten: Schneidet den Vergewaltigern die Schwänze ab!!
Er nahm das Kollegheft und den Schirm und verließ sein Zimmer. Er vergaß es nicht mehr abzuschließen, seitdem er einmal vom Seminarleiter deswegen getadelt worden war. Es waren schon öfters Dinge aus den Büros entwendet worden, wie Diktiergeräte, Computer, Ventilatoren, Schreib- oder Kaffeemaschinen; das brachte den Junkies Geld für Drogen.
Er klopfte an der Pförtnerloge, hörte lautes "herein" und sah den Hausmeister mit zwei Männern in blauer Arbeitskleidung in einer Ecke Karten spielen und Pernod trinken. Bernard legte dem Hausmeister die Gegenstände auf den Tisch, bat ihn, sie beim Fundbüro abzugeben, wandte sich zum Gehen und fügte unter der Tür stehend noch hinzu:
"Auf der Terrasse vor meinem Zimmer liegt ein Paar Schuhe unter der Bank. Das ist kein schöner Anblick. Könnten Sie die entfernen? "
"Zu Befehl, mon Colonel!" sagte der Hausmeister und grüßte militärisch. Bernard sah ihn einen Moment lang erstaunt an und grüßte dann ebenso zurück. Draußen fand er, daß er sich etwas kindisch benommen hatte.
Nachts um zwei schreckte Bernard plötzlich aus dem Schlaf auf und wußte: In den Schuhen steckt ein Mensch. Wie konnte er nur so dumm sein! Wenn man Schuhe auszieht, dann stellt man sie entweder auf die Sohlen oder wirft sie hin und dann liegen sie, aber neigen sich nicht beide nach einer Seite. Zumindest müßte einer der beiden Schuhe liegen, wenn der andere gegen ihn gelehnt wäre. Entdeckte der Hausmeister die Leiche, denn es konnte sich nur um einen Toten handeln - wer liegt schon in einer Dezembernacht unter einer Bank? - würde er die Polizei benachrichtigen, und dann würde man ihn, Bernard, fragen, warum er nicht sofort erkannt habe, daß dort eine Leiche lag. Seine Erklärung würde man als Versuch werten, jemand anderem die Entdeckung zuzuschieben, weil er selber nicht involviert werden wollte. Man würde ihn verdächtigen, er habe mit dem Tod des Mannes, - denn es mußte ein Mann sein, bei diesem Schuhwerk - etwas zu tun, er müßte ein Alibi vorweisen können, und wenn sich dann herausstellte, daß der Todeszeitpunkt mit der Zeit, in der er mit Mathilde zusammen war, zusammenfiel, müßte er sie in die Sache hineinziehen, um sich reinzuwaschen. Wie würde Caroline reagieren? Und dann die Presse, vor seinen Augen flammten bereits Blitzlichter! Seine Karriere war bedroht. Was sollte er nur machen? Er warf sich hin und her. Caroline, deren leiser Atem über seine Wange strich, seufzte leise. Er lag still, um sie nicht zu wecken.
Das Dunkel, in das er starrte, wirkte beruhigend, und nach einiger Zeit traumlosen Dahindämmerns sagte er sich: Welchen Unsinn man in der Nacht denkt, natürlich sind das liegengelassene Schuhe! In der Wirklichkeit gibt es nicht so viele Leichen wie in der Phantasie. Außerdem, warum sollte er sich darüber Sorgen machen? Er hatte ja absolut nichts damit zu tun. Und er schlummerte erleichtert wieder ein.
Als Henri am nächsten Morgen vor seinem Schreibtisch Platz nahm, klingelte das Telefon und seine Sekretärin fragte ihn, ob sie den Direktor des Grimaldi-Museums durchstellen könnte.
"Hat er gesagt, was er will?" fragte Henri vorsorglich. Er wußte immer gern vorher, worauf er sich gefaßt machen sollte.
"Nein“, sagte Fräulein Maillard, "aber er hörte sich aufgeregt an." Henri fühlte ein Ziehen in der Magengrube, jetzt kam das, was er befürchtet und doch eigentlich nicht erwartet hatte: Der Versicherungsfall war eingetreten, fragte sich nur, in welcher Höhe! Henri hatte die Summen persönlich ausgehandelt, und er hatte das Sicherheitssystem inspiziert und für ausreichend befunden.
"Guten Morgen, Herr Direktor“, begrüßte er Grappin aufgeräumt, um es Hiobsbotschaftern nicht zu leicht zu machen, "wie geht es Ihnen? Es ist doch alles in Ordnung?" Das sagte er zur Beschwörung. Er konnte eine leichte Besorgnis in seinem Tonfall nicht unterdrücken.
Grappin seufzte düster: "Stellen sie sich vor, es ist passiert!"
"Tatsächlich“, Henris Hand krampfte sich um den Telefonhörer und wurde feucht, "und was ist verschwunden?"
"Das interessanteste Gemälde."
"Das wir so hoch versichert haben?"
"Genau das!"
"Der Koloß!" Henri sah es deutlich vor sich: Die phantastische Gestalt eines nackten Riesen erhebt sich über ein düsteres Land, auf dem Menschenmassen wie Ameisen durcheinanderwimmeln.
"Ist es nicht furchtbar?" weinte Grappin an Henris Ohr.
"Aber sagen Sie, wann haben sie es bemerkt, wann ist es geschehen?"
"Es muß heute Nacht gestohlen worden sein. Als wir die Ausstellung gestern um 18 Uhr abschlossen, war es noch da. Und heute um 7,30 Uhr, als man die Alarmanlage ausschaltete und die Räume in Augenschein nahm, war es verschwunden."
"Hat denn das Sicherheitssystem nicht funktioniert?"
"Das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall wurde kein Alarm ausgelöst, nirgendwo ist eine Einbruchsspur zu finden. Die Polizei ist übrigens seit einer Stunde im Haus."
"Das Bild ist doch unverkäuflich?"
"Natürlich, es ist eines der bekanntesten Gemälde der Spätepoche Goyas. Ein Begriff für jeden Kunstkenner. Übrigens ist noch eins aus dem Rahmen geschnitten worden, es ist allerdings weniger bedeutend: Ein armer Hund."
"Ich erinnere mich“, murmelte Henri. Der kleine Hund, der im aufgepeitschten Wasser unter einem Wasserfall um sein Leben paddelt, hatte ihm ans Herz gegriffen. War nicht jeder einmal im Leben in einer solchen Lage gewesen, wo er kaum noch den Kopf über Wasser halten kann? Jetzt fühlte er sich beinahe wie diese Kreatur. Wie würde die Zentrale über ihn herfallen, weil er der Verantwortliche für den Abschluß der Versicherung war!
"Hat man denn die Angestellten schon befragt?"
"Die Polizei ist eben dabei, die Wärter zu vernehmen, die heute Dienst haben, und die anderen, die frei haben, aufzutreiben."
"Ich nehme an, daß die Ausstellung nicht geöffnet wurde. Kein Publikumsverkehr?"
"Natürlich, der Kommissar hat es angeordnet, damit keine Spuren verwischt würden. Sie sind jetzt dabei, alles nach Spuren abzusuchen."
"Da dürften sie zu tun haben."
"Klar. Ich glaube nicht, daß etwas dabei herauskommt."
"Da die Bilder auf dem Kunstmarkt unverkäuflich sind, läuft das auf eine Erpressung unserer Versicherung hinaus“, dachte Henri laut.
Grappin gab zu bedenken: "Außer wenn es im Auftrag eines verrückten Millionärs geschah, der die Gemälde im Privatkabinett seines Wüstenschlosses in Arabien aufhängen möchte."
"Dann dürften wir wohl nichts wieder davon hören“, meinte Henri bedrückt. „Haben Sie es schon den Leihgebern mitgeteilt?"
"Oh Gott, ja, dem Prado! Ich habe es noch nicht gewagt. Ich warte lieber noch eine Stunde, bis die Polizei Genaueres sagen kann."
"Wissen Sie was?" sagte Henri nach einigem Nachdenken, "ich komme selber hinüber. Ich muß mir doch im Namen der Versicherung selbst ein Bild von der Sache machen.. Schließlich habe ich einen Bericht zu schreiben, in dem die Verantwortlichkeiten aufgeführt werden."
"Ja, tun Sie das! Kommen Sie schnell! Übrigens, ich muß auflegen. Kommissar Lagarde verlangt nach mir."
Henri warf sich in seinen R4 und raste, einige Verkehrsregeln mißachtend, nach Antibes, fand an der Kaimauer vor dem Schloß einen Parkplatz und wollte sofort hinein, aber zwei Gendarmen fingen ihn am Eingang ab. Nach einigem Hin und Her gelang es ihm, sie von der Bedeutung seiner Person und seines Amtes zu überzeugen. Ein Uniformierter begleitete ihn die drei Treppen des verwinkelten Kastells hinauf in den großen ehemaligen Rittersaal unter dem Dach, wo ihn der Kommissar für Raub und Diebstahl zusammen mit Grappin erwartete. Sie standen diskutierend den beiden leeren Goldrahmen gegenüber, während zwei Beamte der Spurensicherung nach Fingerabdrücken suchten.
„Ein Jammer“, stöhnte Grappin, nachdem sich Henri den Polizisten vorgestellt hatte, „diese Barbaren haben die Bilder aus dem Rahmen geschnitten. Sehen Sie, da liegen noch abgeplatzte Farbreste.“ Er bückte sich, tippte mit dem Finger auf den Boden und zeigte ihnen vorwurfsvoll ein braunes Pünktchen an der Fingerkuppe.
„Sie werden sie eingerollt haben, um sie leichter transportieren zu können“, meinte der Kommissar, nachdem er ein Bild, auf dem ein Hexensabbat gemalt war, ein wenig von der Wand abgehoben hatte, um die Rückseite betrachten zu können:
„Sie haben die Leinwand wohl mit einem Rasiermesser abgetrennt, säuberlich genau am Rahmen entlang. Aber Rollen von 2,30 bzw. 2, 50 m Länge sind doch ziemlich auffällig. Die kann man nicht unter einem Mantel verstecken.“
„Aber wie sind sie hineingekommen?“ fragte Henri, dem es vordringlich erschien, auf das Sicherheitssystem zu kommen, das er selbst begutachtet hatte, denn seine Firma hatte dem Vertrag nur unter der Bedingung zugestimmt, daß eine optimal funktionierende Diebstahlssicherung vorhanden war. Er mußte der Zentrale klarmachen können, daß ihn in dieser Beziehung keine Schuld traf.
„Das ist uns im Moment noch einigermaßen rätselhaft“, sagte Kommissar Lagarde, „es gibt eigentlich nur folgende Alternativen: Wenn die Gemälde in der Nacht gestohlen wurden, würde das bedeuten, daß jemand das Alarmanlage außer Kraft gesetzt hat. Das ist aber nur möglich, wenn man die beiden Schlüssel besitzt, mit denen man das System scharf macht bzw. abschaltet. Diese aber hatten Dr. Grappin und der Sicherheitsbeauftragte, Herr Morvin, über Nacht bei sich, und Sie haben heute um 7, 30 Uhr, ist das richtig?“ fragte er Grappin, der mit dem Kopf nickte, „zusammen das System abgeschaltet. Ist es denn möglich, die Sicherung lahmzulegen, indem man z.B. ein Stromkabel von außen kappt oder sonst eine Manipulation an der Elektronik außerhalb der Schalttafel vornimmt?“
„Nein“, sagten Henri und Morvin, der gerade hinzutrat gleichzeitig. Morvin fuhr fort: „Wird die Stromzufuhr unterbrochen, dann wird mit Hilfe eines Notstromaggregats automatisch akustischer Alarm ausgelöst, auch bei nächsten Polizeirevier. Die Leitungen, die von der Schalttafel ausgehen sind noch intakt, genau so wie die Tafel selbst.“
„Kann man die nicht aufschrauben und Leitungen überbrücken.“
„Nein, sie ist zugeschweißt und nur im Ganzen zu entfernen.“
„Also, Sie können ausschließen, daß eine Manipulation des Sicherheitssystems stattgefunden hat.“
Morvin nickte.
„Dann bliebe als nächste Alternative übrig, daß Sie und Ihr Vorgesetzter den Diebstahl gemeinsam ausgeführt hätten.“
Grappin blickte Lagarde mit offenem Mund an:
„Sie! Das meinen Sie doch nicht im Ernst!“
„Das ist nur eine abstrakte Möglichkeit“, sagte Lagarde, ihm kühl ins Auge blickend, „aber ich denke, daß Sie Alibis haben. Die nächste Alternative wäre, daß Sie beide durch die Räuber erpreßt worden wären, die Schlüssel herauszurücken.“
„Aber nein“, schrie Grappin, „Sie brauchen doch nur meine Frau, meine Kinder oder meine Haushälterin zu fragen. Ich lag die ganze Nacht ungestört in meinem Bett. Außerdem war ja noch der Nachtwächter da. Und der hat nichts gehört und gesehen.“
Morvin fand, daß dazu nichts weiter gesagt werden brauchte, und schüttelte bloß den Kopf.
„Ist schon gut“, beruhigte Lagarde die Museumsleute, „kommen wir zur nächsten Möglichkeit: Ein Dieb hat sich vor dem Besuchsende einschließen lassen, hat die Bilder aus dem Rahmen geschnitten und durchs Fenster einem Komplizen vor dem Haus zugeworfen und sich nach der Öffnung der Räume für die Besucher unbemerkt aus dem Gebäude geschlichen.“
„Das sind gleich vier Unmöglichkeiten“, sagte Morvin und blickte Lagarde streng an, als sei dieser von allen guten Geistern verlassen, „erstens wird der Gebäudeteil, in dem sich die Sonderausstellung befindet, nach dem Ende der Besuchszeit genau durchsucht. Es gibt keinerlei Versteckmöglichkeiten, keine Nebenräume, keine Wandschränke, außer auf den Toiletten im zweiten Stock und im Erdgeschoß. Die werden aber besonders sorgfältig in Augenschein genommen.“
„Aber die Diebe könnten sich aufs Klo stellen. Die Wärter sehen unter der Tür keine Füße und denken, die Zelle sei leer.“
„Aber das ist doch ein uralter Trick. Natürlich sieht man auch hinter die Tür, damit sich dort niemand verstecken kann."
Lagarde sah Morvin anerkennend an: „Und zweitens?“
„Zweitens kann niemand das Bild anfassen, ohne daß Alarm ausgelöst wird. Das gilt drittens auch für die Fenster, dort sind Sensoren, die jede Erschütterung registrieren, genau so wie an den Türen.“
„Aha, und viertens?“
„Niemand kann sich nachts unbemerkt im Ausstellungsteil aufhalten. Dafür sind Bewegungsmelder installiert. Also fällt auch die Möglichkeit weg, daß einer der Wärter in Komplizenschaft mit den Tätern einen Dieb auf der Toilette versteckt hat. Überdies würde er von einem der fünf Wärter gesehen werden, die vor der Öffnung die Räume und auch die Toiletten inspizieren. Und Sie glauben doch nicht, daß alle Wärter zusammen im Komplott sind?“
Lagarde wiegte den Kopf: „Man kann nie wissen. Aber konzentrieren wir uns auf das Wahrscheinlichere!“
Er starrte auf seine glänzenden Stiefelspitzen. „Ich hoffe, auch heute hat man alles vorher inspiziert.“
„Aber ja“, warf der Direktor spitz ein und versuchte, weiteren Verdächtigungen zuvorzukommen, „ich erkenne an, daß Sie sich der Sache sehr methodisch nähern, aber könnte man das Verfahren nicht abkürzen, Selbstverständlichkeiten ausschließen und aufs Wesentliche kommen?“
„Lassen Sie uns mal in Ruhe unsere Arbeit tun“, sagte Lagarde, ohne verstimmt zu sein. Er konnte den Mann verstehen, der hatte nun eine Menge Ärger, seine Nervosität war offensichtlich. Grappin trat von einem Fuß auf den anderen, ließ die Augen umherirren, doch das war unproduktiv, durch Herumzappeln kam man der Wahrheit nicht näher. Aber Kunsthistoriker sind nun mal keine Kriminalisten.
„Also weiter im Text“, fuhr der Kommissar unerbittlich fort, „wenn der Dieb nun kein Geist war, was wir im fortgeschrittenen Stadium des Rationalismus ausschließen können“, fügte er hinzu, um mit etwas Humor die Situation zu entspannen - Grappin fand aber, daß sich der Kommissar über ihn lustig machen wollte, und suchte, allerdings vergeblich, nach einem Bonmot, um ihm Paroli zu bieten - „dann können die Diebe entweder nur von außen eingedrungen sein.....“
„Unmöglich“, fuhr Morvin dazwischen, „ich habe sämtliche Gitter vor den Fenstern, die zugeschraubt sind, wie Sie sehen können, geprüft, und an Decken, Wänden und Fußböden finden sich keinerlei Einbruchsspuren. So ein Loch wäre auch schwer wieder zu flicken, ohne daß man es merkte.“
Lagarde sagte ernst: „Haben Sie denn auch hinter den Bildern selbst nachgeschaut?“
„Nein“, sagte Morvin erstaunt, „das kann man ja gleich tun.“ Er ging auf die den gestohlenen Bildern gegenüberliegende Wand zu und schaute hinter die Rahmen: „Nichts.“
Lagarde grinste, er hatte Morvin aufs Glatteis geführt. Dieser wußte das auch und kam mürrisch zurück: „Sie wollten mich nur ärgern“, sagte er säuerlich, „Sie wissen doch, nachdem Sie den Grundriß geprüft haben, daß diese Wand einen Meter dick ist und die beiden Fensterwände aufs Dach hinausgehen.“
Lagarde sah auf den prächtigen vergitterten Renaissancekamin, der die Stirnseite des Saals einnahm und mit dem Wappen der Grimaldi geschmückt war: „Wie ist es mit dem Kamin, könnte jemand durch den Schornstein eindringen?“
Morvin hob die Augenbrauen, um gelinde Verzweiflung auszudrücken: „Also der Schornstein ist vermauert und der Kamin hier unten, sehen Sie...“ er rüttelte an dem Gitter, „verschlossen. Es konnte sich also auch niemand im Schacht verstecken.“
Lagarde trat heran und prüfte die Eisenstäbe.
„Sieht zwar solide aus, aber wenn man die Eisenstäbe anbringen konnte, dann kann man sie auch wieder herauskriegen.“
„Nein“, sagte der Sicherheitschef, „als wir den Saal auf Sicherheit hin durchgecheckt haben, haben wir auch diesem Punkt Aufmerksamkeit geschenkt. Da der Kamin damals ohnehin restauriert und auseinandergenommen wurde, haben wir beim Wiedereinbau die Stäbe so im Stein verankert, daß man sie entweder nur heraussägen kann oder die Steine entfernen muß. Und hören Sie, die Stäbe sind intakt.“ Er klopfte mit einem Schlüssel wie ein Gefängniswärter daran.
Lagarde lehnte sich, das Kinn auf die Hand gestützt, an den Kamin und ssagte:
„...oder die Diebe haben die Bilder während der Besuchszeit gestohlen.“
Henri dachte das auch. Er hatte aufmerksam zugehört, sich dabei umgesehen, war umhergegangen, und ihm war ein Gedanke gekommen.
Doch der Direktor und Morvin protestierten lauthals: „Wie soll das zugegangen sein? In jedem Raum ist ein Wärter postiert, außerdem ist jedes Bild elektronisch gesichert.“
Lagarde fuhr unbeeindruckt fort: „Aber es gibt doch, nach dem, was Sie mir vorhin erzählt haben, eine Zeit, in der die Sicherung der Bilder abgeschaltet wird.“
„Selbstverständlich, das muß sein, wenn die Raumpfleger den Saal reinigen, die Rahmen abstauben und die Fenster putzen. Aber dabei werden sie von einem Wärter beaufsichtigt.“
„Und wann findet das statt?“
„Nachdem die letzten Besucher die Ausstellung verlassen haben.“
„Schildern Sie das mal im einzelnen! Wo fängt die Putzkolonne mit der Arbeit an?“
„Hier, in diesem Saal, im obersten Geschoß.“
„Ist in diesem Stockwerk noch ein weiterer Raum?“
„Nein“, sagte Morvin. Henri hatte sich unterdessen der Saalseite genähert, die zur Außenseite des Kastells ging, hatte den weißen Leinenvorhang zurückgezogen, betrachtete den Kitt am Rahmen des untersten Teils des in acht Scheiben unterteilten Mansardenfensters, sperrte aber seine Ohren auf, um zu hören, wie Morvin fortfuhr:
„Wenn die Putzkolonne eintrifft, greift der Aufsichtsbeamte zum Telefon...“ Morvin ging an eine Klappe neben der Saalpforte, öffnete sie und zeigte dem Kommissar die Anlage: „ruft bei der Sicherheitszentrale an und sagt, man solle die Bilder- und Fenstersicherung abstellen.“
„Nur für diesen Raum oder für alle?“
„Nur für diesen, und wenn die Raumpflegerinnen den Saal verlasssen, verlangt er, daß man sie wieder einschaltet.“
„Wir haben die Wärter befragt“, sagte Lagarde, „soweit sie greifbar sind. Nur Lapin war nicht zu erreichen.“
Der Direktor schaltete sich ein: „Lapin ist Student, er kommt nur zweimal die Woche zur Aushilfe. Wahrscheinlich sitzt er jetzt in einer Vorlesung. Ich werde es abends noch einmal bei ihm versuchen. Auf jeden Fall kommt er morgen wieder her.“
„Also der Wärter dieses Saales, und auf den kommt es ja an, er heißt Antonio Girona?“- der Kommissar sah in seinem Notizbuch nach - „gibt zu Protokoll, daß er wie immer nach dem Verlassen der Putzkolonne die Zentrale angerufen habe. Weiß man denn die genaue Uhrzeit?“
„Nein“, sagte Morvin erstaunt, „das registrieren wir nicht.“
„Wäre aber aufschlußreich, wenn wir es wüßten.“
„Verdächtigen Sie etwa Girona?“
Lagarde sah ihn ausdruckslos an: „Nicht mehr als jeden anderen im Haus.“
„Aber Girona ist schon seit dreißig Jahren bei uns angestellt. Er ist 64. Warum sollte er vor seiner Pensionierung so etwas tun? Er weiß doch selbst, daß diese Bilder unverkäuflich sind.“
„Und wenn er im Auftrag von jemanden handelte, wenn ihn jemand bestochen hat?“
„Er würde es uns gesagt haben, wenn man mit so einem Ansinnen an ihn herangetreten wäre. Der Mann ist die Redlichkeit selbst.“
„Na, mancher wird schwach, wenn man mit einem Millionfrancschein um seine Nase wedelt.“ Lagarde dachte nach: “Könnte es sein, daß er den Saal verlassen hat, als die Putzfrauen noch drin waren, und daß diese die Bilder herausgeschnitten und in den Putzwagen mitgenommen haben?“
„Sie haben sie doch selbst gesehen, sie sind nicht groß genug, man kann keine Rollen von 2,50 bzw. 2,30 m Länge darin verstecken. Außerdem werden sie kontrolliert. Übrigens kenne ich diese Frauen seit langer Zeit, die wären zu so etwas nicht fähig.“
Henri bückte sich am Fenster und nahm den Rahmen in Augenschein: „Kommissar“, rief er und zog sein Federmesser aus der Tasche, „können Sie einmal herkommen?“
Lagarde, Grappin, Morvin und die beiden Beamten von der Spurensicherung, die an den anderen Fenstern nach Abdrücken gesucht hatten, traten neugierig näher.
„Sehen Sie diese haarfeine Linie zwischen dem Kitt und dem Rahmen“, er zeigte auf das untere Teilfenster links, das etwa 50 x 30 cm groß war, „und vergleichen Sie mit der Scheibe daneben.“
„Tatsächlich“, sagte Lagarde, der sich hingekauert hatte, „der Kitt sitzt nicht am Rahmen wie bei den anderen.“
Henri fuhr mit dem Messer zwischen das Holz und die Kittmasse, hebelte mit dem Messer ein wenig und die Scheibe kippte ihm in die ausgestreckte Hand:
„Keine Nägel zur Befestigung der Scheibe“, sagte Lagarde, „sie sind entfernt worden, man sieht noch die Löcher. Und an den Kitt ist Papier geklebt, damit er nicht am Rahmen haftet.“
„Und der Kitt ist noch relativ weich“, meinte Henri, die Scheibe an die Wand neben sich stellend.
„Na, ich würde sagen, der ist kaum drei Wochen alt, frisch ist er nicht, aber auch nicht so knallhart wie bei den anderen Scheiben“, sagte der hinzugetretene Spurensicherer und drückte den Daumen gegen die Masse.
„Haben Sie hier Fingerabdrücke entdeckt?“ fragte Lagarde. Der Beamte verneinte.
„Wie hat denn die Scheibe halten können?“ fragte der Direktor, der sein Gesicht dem Tatort genähert hatte.
„Hier“, Henri tippte mit dem Finger auf zwei weiße Flecke am oberen und unteren Rahmen, „das scheint mir Leim zu sein. Damit hat er die Scheibe notdürftig angeklebt.“
„Darf ich mal?“ fragte Henri und schob Lagarde sanft beiseite, um den Kopf aus dem Fenster zu stecken. Er zog ihn wieder zurück und forderte den Kommissar auf, hinauszusehen: „Fällt Ihnen an der Dachrinne etwas auf?“
„Was soll da sein?“ wunderte sich Lagarde, plötzlich pfiff er durch die Zähne:
„I see the point“, rief er erstaunt, „das Abdeckgitter der Fallröhre liegt neben dem Loch in der Regenrinne.“
„Ist doch sonnenklar“, sagte Henri und hob seinen Kopf, um den versammelten Kriminalisten triumphierend ins Auge zu sehen: „Der Täter hat in der Zeit, als keine Ausstellung stattfand und das Sicherheitssystem nicht eingeschaltet war, die Scheibe präpariert, damit sie schnell herauszunehmen war. Dann entfernte er das Abdeckgitter vom Fallrohr. Er schnitt die Bilder aus dem Rahmen - wann das stattfand, überlegen wir uns später - rollte sie zusammen, zog die Scheibe mit einem entsprechenden Instrument hervor und schob die Rollen durchs Fenstergitter ins Fallrohr. Dann klebte er die Scheibe wieder fest, ging hinunter, schnitt die Regenröhre mit einer Stahlschere auf, zog die Bilder heraus und verschwand im Dunkeln.“
„Also doch Girona!“ murmelte Grappin matt und setzte sich auf einen Stuhl neben dem Fenster.
„Wir müssen ihn noch einmal ins Gebet nehmen“, sagte Lagarde zu einem seiner Beamten, „gehen Sie hinunter und schicken Sie ihn her! Danach begeben Sie sich auf den Parkplatz hier unter dem Fenster und untersuchen die Regenröhre.“
Der Beamte entfernte sich und die Dagebliebenen versammelten sich um den Direktor, der den Kopf hängen ließ und düster auf den Boden starrte.
„Es muß nicht Girona gewesen sein“, versuchte Henri ihn zu beruhigen, „es gibt eine Möglichkeit, die wir noch nicht bedacht haben. Wir müssen den Zeitfaktor berücksichtigen.“
Lagarde, der seinen Gedanken gefolgt war, nickte: „Schade, daß man nicht weiß, wann und wie lange die Putzkolonne hier war!“
Girona betrat zögernd den Raum, sah sich um, wurde von Lagarde zu der wartenden Gruppe gewinkt und sah die Männer nervös an. Henri schien der traurige alte Mann mit grauem Haar und hängendem Schnurrbart unfähig zu einer Tat dieses Kalibers. Er blickte ihn ermutigend an, um ihm in diesem Kreis von Scharfrichtern eine Stütze zu bieten, denn schon sah Grappin von unten zu dem Delinquenten auf und stieß zwischen den Zähnen die Anklage hervor: „Girona, wie konnten Sie mir das antun?“
„Ich, ich“, stotterte der alte Mann und wurde rot, so rot wie eine welke Haut noch werden kann, „ich war‘s nicht. Ich habe damit nichts zu tun.“ Er schwieg abrupt, seine Hände zitterten. Henri tat er leid. Lagarde schwieg, Schweigen, dachte er, sei die humanste Art der Folter. Die anderen schwiegen auch, entweder weil ihnen nichts einfiel oder weil das Gericht so seine Würde am besten demonstrierte.
Nur Henri störte das Verfahren: „Sagen Sie?“ begann er sanft, „kann es sein, daß Sie, nachdem die Putzfrauen den Saal verlassen haben und bevor Sie die Alarmanlage wieder anschalten ließen, den Raum einige Zeit unbeaufsichtigt gelassen haben?“
Girona sah Henri nicht an, er starrte unter sich, hielt die rechte Hand mit der linken fest und murmelte störrisch: „Nein.“
Lagarde nahm Henri das Verhör aus der Hand: „Es war also niemand im Saal außer Ihnen, nachdem die Putzfrauen gegangen waren?“
Girona blaffte plötzlich heraus: „Ja, ich habe das doch schon einmal gesagt, warum glaubt mir denn niemand?“
„Aber wie erklären Sie sich den Verlust der Bilder?“ fragte Lagarde.
„Sie waren noch da, als ich den Saal verließ, um nach Hause zu gehen.“
„Und das sollen wir Ihnen glauben?“
„Daß ich sie nicht mitgenommen habe, kann Ihnen der Pförtner bestätigen, der hat gesehen, wie ich das Haus verließ.“
„Die Bilder wurden nicht durch die Tür hinausgetragen, sondern....“ Lagarde blickte auf den eintretenden Polizisten, der ihm bestätigend zunickte: „...vom Fenster aus ins Regenrohr gesteckt.“
Girona hob den Kopf, senkte ihn aber gleich wieder und krampfte die Hände ineinander. Der Beamte trat zu ihnen und sah voller Anerkennung auf Henri: „Herr Dupont hat recht, die Regenröhre war auf 2,50 m Länge aufgeschnitten und ist nach der Entnahme der Rollen wieder notdürftig zurückgebogen worden. Der Dieb hat Puffer angebracht, damit die Bilder beim Aufprall nicht beschädigt würden.“ Er zog ein rundes Schaumgummistück vom Durchmesser des Regenrohrs aus der Jackentasche: „Das lag daneben. Der Täter hat dort, wo die Regenröhre im Erdreich verschwindet, einen langen Nagel durch das Blech getrieben, damit die Rollen nicht im Gully verschwanden. Den Puffer hat er wohl unten dran geklebt, bevor er sie in die Röhre warf.“
„Haben Sie jemand in den Saal gelassen? Zum Beispiel einen Kollegen?“ fragte Lagarde den Grauhaarigen.
„Nein.“
„Konnte jemand unbemerkt den Saal betreten?“
„Nein.“
„Könnte es sein, daß Sie nur flüchtig in den Saal gesehen haben, nachdem Sie ihn verlassen haben? Die betreffenden Bilder hingen ja an der Wand neben der Tür. Sie hätten sich also von der Tür in den Raum hineinbegeben müssen, um sie richtig zu sehen.“
„Nein. Ich habe den Saal nicht verlassen.“ Girona blickte Grappin protestierend an.
„Herr Girona“, sagte der Direktor erschöpft und sah von seinem Stuhl aus mit roten Augenlidern zu ihm auf, „Sie verschweigen uns etwas. Ich bin überzeugt, daß Sie mit der Sache nichts zu tun haben, aber Sie wissen mehr, als Sie uns sagen wollen.“
Girona sah ihn würdig und melancholisch wie ein Bluthund mit in Tränensäcken versinkenden Augen an:
„Ich bin seit dreißig Jahren Museumsdiener, ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen.“
Grappin schüttelte resigniert den Kopf, winkte dem Wärter mit der Hand zu, daß er gehen solle, erhob sich mit gebeugtem Rücken und murmelte: „Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als jetzt Madrid anzurufen.“
Henri und Lagarde nahmen ihn wie einen Schwerkranken in die Mitte. Der Versicherungsmann sprach ihm Mut zu: „Noch ist nichts verloren. Man kennt das ja. Irgendwann in den nächsten Tagen werden die Diebe anrufen und Lösegeld von uns verlangen.“
Grappin lachte verzweifelt: „Und in welchem Zustand werden sie uns die Gemälde zurückgeben?“
Seine Begleiter schwiegen bedrückt. Dazu konnten sie nichts sagen. Langsam stiegen sie die Treppen ins Erdgeschoß hinab. Als sie ins Direktionsbüro eingetreten waren und die Tür hinter sich geschlossen hatten, sagte Grappin: „Herr Kommissar, Sie müssen eine Haussuchung bei Girona durchführen.“
„Ja, klar, ich muß nur den Untersuchungsrichter von der Notwendigkeit überzeugen.“
„Ist das so schwer?“ fragte der Direktor verwundert.
„Das kommt auf die Bewertung der Verdachtsmomente an.“
Henri assistierte dem Kommissar: „Es muß nicht unbedingt Girona gewesen sein. Es könnte doch sein, daß einer der anderen Wärter ihn abgelenkt, ihn vielleicht im Treppenhaus in ein Gespräch gezogen hat, während ein anderer die Bilder aus dem Rahmen schnitt. Wie lange brauchte der Dieb nach Ihrer Schätzung dafür?“
„Zwischen vier und fünf Minuten“, meinte der Kommissar, „nachdem die Putzkolonne den Saal verlassen hatte, versteht sich.“
„Sehen Sie, und stellen Sie sich sein Entsetzen vor, als er zurückkommt und sieht, daß während seiner pflichtwidrigen Abwesenheit die Bilder verschwunden sind. Er wagt es nicht zu gestehen, weil er fürchtet, entlassen zu werden, so kurz vor seiner Pensionierung. Also behauptet er, er habe dem Saal nie den Rücken gekehrt, und die Bilder müßten in der Nacht gestohlen worden sein. Das Gegenteil kann nur derjenige beweisen, der ihn aus dem Saal gelockt hat, und der steckt mit dem Dieb unter einer Decke, wird also nicht das Gegenteil behaupten. Oder aber, was wahrscheinlicher ist, Girona hat, wie Sie schon vermuteten, den Saal nach dem Gespräch mit dem Kollegen gar nicht mehr betreten und den Verlust erst am anderen Morgen bemerkt.“
„Sie verwirren mich“, sagte Grappin, der sich in seinen Sessel hinter dem riesigen, mit Büchern und Papieren bedeckten Schreibtisch versenkt hatte, „demnach müßte man die Wohnungen aller Wärter durchsuchen lassen.“
„Ja“, seufzte Lagarde, „und das wird noch mehr Staub aufwirbeln. Einen Haussuchungsbefehl werden wir nur bekommen, wenn alle anderen Möglichkeiten des Diebstahls, also durch Manipulation der Alarmanlage, Bestechung und Erpressung der Schlüsselinhaber oder anderweitiges Eindringen in den Ausstellungssaal zwingend ausgeschlossen werden können. Dazu aber brauchen wir Zeit und die haben wir nicht, wenn wir verhindern wollen, daß man die Beute anderswohin schafft.“
„Ich glaube auch nicht, daß einer unserer Wärter die kriminelle Energie besitzt, eine solche Sache durchzuziehen“, meinte Grappin, der sich in seinem Drehsessel herumgeschwungen hatte, um durchs Fenster auf das Meer hinauszuschauen, das silberblau unter der milden Dezembersonne glänzte, „deswegen steht er, wenn überhaupt, gewiß im Bunde mit einer Gang, die etwas von Kunstdiebstahl versteht, wurde von ihr geködert und hat ihr die Bilder direkt nach dem Raub übergeben.“
„Ja, das denke ich auch“, stimmte Henri zu, „ich habe mir die Biographien der Wärter angesehen, als wir die Versicherung abschlossen, kleine Leute, alles anständige, brave Bürger, Familienväter, sogar Großväter, da ist nur einer, der vom Alter und von der Intelligenz her in Betracht kommt...“
„Der Student“, sagte der Museumsdirektor, „aber wenn Ihre Ablenkungstheorie stimmt, dann brauchte man mindestens zwei, um das Unternehmen durchzuführen. Lapin müßte also einen weiteren Angestellten geworben haben, und ich kann mir nicht denken, daß er einen der Altgedienten überreden konnte.“
„Was wissen Sie denn von diesem Studiosus?“ fragte Lagarde, „kennen Sie ihn genauer? Was für ein Mensch ist das?“
„Moment“, der Direktor stand auf, ging zum Wandschrank, zog einen Aktenordner hervor, legte ihn auf den Schreibtisch und schlug ihn auf. „Lapin, Fernand Paul, geboren 12. März 70 in Aix-en-Provence.“
„In Aix wurden 1959 ein Dutzend Cézannes aus dem Museum gestohlen“, warf Henri ein, „die fand man bei Melun in einer Scheune wieder, nachdem die Bande einen Deal mit der Versicherung gemacht hatte. Das war einer der ersten Coups dieser Art.“
„Aber Lapin war da noch nicht auf der Welt!“ gab Lagarde zu bedenken.
„Schon, schon“, grübelte Henri, „aber in so einer Kleinstadt halten sich Erinnerungen an Aufsehen erregende Kriminalfälle lange, vielleicht hat er seine Inspiration daraus geschöpft.“
„Na, na“, murmelte der Direktor tadelnd, „das ist aber ganz schön weit hergeholt. Konzentrieren wir uns lieber auf die Fakten. Also: Ecole primaire, Lycée auch in Aix, dann Studium an der Sorbonne: Germanistik, Soziologie, Kunstgeschichte, Abschlußexamen. Seit 1994 Graduiertenstudium an der hiesigen Universität. Einwandfreier Leumund. Am Museum angestellt als Aushilfskraft seit 6 Monaten. War bisher immer pünktlich und zuverlässig, habe keine Klagen gehört.“
„Betätigt er sich politisch?“ fragte Lagarde.
„Komisch, daß Sie das fragen. Ich weiß nicht, ob er einer politischen Gruppierung angehört“, wunderte sich Grappin, „aber mir fiel bei gelegentlichen Gesprächen auf, daß er ziemlich linksradikal ist, ungewöhnlich heute, wo Marx zum Auslaufmodell wird. Mir ist das egal, schließlich hat das auf seine Arbeit als Aufsichtskraft keine Auswirkung.“
„Meinen Sie wirklich?“ fragte Henri kryptisch. Grappin runzelte die Stirn: „Was wollen Sie damit andeuten?“
Lagarde folgte Henris Gedanken, die er ja selbst angeregt hatte, und antwortete: „Haben Sie denn nie von dieser ultralinken Terrorgruppe gehört, die sich La Force de Frappe du Peuple nennt, abgekürzt FFP mit der Kalaschnikow als Markenzeichen; das haben sie der deutschen RAF entlehnt?“
„Ja, schon“, meinte Grappin, „aber was hat das mit Lapin zu tun?“
„Diese Leute finanzieren sich mit Bankraub, Überfällen auf Geldtransporte, Entführungen. Warum sollten sie es nicht einmal mit Kunstdiebstahl probieren?“
„Aber Lapin - allein der Name! - das ist ein harmloser Junge, radikal schon, aber wer war in seiner Jugend nicht radikal?“ erinnerte sich der Kunstgelehrte, der in den wilden Jahren der Studentenrevolution Trotzkist gewesen war, Ernest Mandel gelesen und seine Doktorarbeit über Architektur als Herrschaftsinstrument. Der europäische Justizpalast im Früh-, Hoch- und Spätkapitalismus geschrieben hatte.
„Aber das ist es ja“, sagte Lagarde. Er wanderte im Büro herum und betrachtete die Picasso-Zeichnungen an den Wänden. „Wir vermuten, daß unsere Universität ein Terroristenhort ist. Sie bewegen sich dort wie Fische im Wasser, um mich mal wie Mao auszudrücken, von Helfern und Sympathisanten umgeben, und dort rekrutieren sie sich auch, ziehen Nachwuchs heran, dort tauchen sie sogar unter, wenn sie gesucht werden. Was meinen Sie? Wir haben nach '68 honorige Professoren als Bombenleger entlarvt.“
Grappin, der das selber nur zu gut wußte, schwieg verdattert. Sollte die Vergangenheit ihn wieder einholen? Er hatte im Lauf seiner Karriere Mühe gehabt, seine Doktorarbeit vergessen zu machen, sonst wäre er nicht in diesen Sessel gelangt. Plötzlich fiel ihm etwas ein, er schwang sich herum, und rief:
„Es kann nicht Lapin gewesen sein. Er war während der Gebäudereinigung nicht anwesend. Er hatte mich ja selbst gefragt, ob er ausnahmsweise direkt nach Ende der Besuchszeit gehen könne, er habe einen Termin beim Zahnarzt.“
„Ausnahmsweise, ausnahmsweise...“ knurrte Lagarde, „das klingt mir schon verdächtig.“
„Können Sie garantieren, daß er nicht im Haus blieb, sich zum Beispiel auf der Toilette versteckte, dann hochschlich, die Tat verübte und später fröhlich mit allen anderen das Haus verließ, ohne daß Sie es bemerkt haben?“ fragte Henri.
„Nein“, entgegnete der Kunsthistoriker enttäuscht, er hätte Lapin gern entlastet. Er hatte in ihm so etwas wie sein alter ego in jungen Jahren gesehen. Im stillen sympathisierte er mit seinen Ansichten. Der Geist steht links. Aber wenn der Student nun wirklich etwas mit dem Verschwinden der Goyas zu tun haben sollte? Er konnte ihm seine politische Gesinnung verzeihen, vielleicht sogar die Tat, wenn der Erlös wirklich dazu verwendet wurde, dem gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen, an den er nach wie vor glaubte, aber nicht die Beschädigung eines Meisterwerks. Da hörte bei ihm das Verständnis auf.
Andere Menschen hatten andere Grenzen, zum Beispiel Mord. Grappin fand '68 an Mord nichts auszusetzen, wenn er aus der richtigen Gesinnung heraus begangen wurde, die richtigen Motive hatte und die richtigen Leute traf. Er sagte das aber niemand.
Er hatte wie jedermann in seinem Gemütshaushalt ein Kämmerchen für höchst private Erinnerungen, die er strikt für sich behielt. Jetzt stimmte er eher dem Aphorismus zu: „Wer in der Jugend kein Sozialist ist, hat kein Herz, wer es im Alter noch ist, hat keinen Verstand.“ Er war ein friedlicher, wohlmeinender Bourgeois geworden, der die Kunst liebte und mit ihr sein Brot verdiente.
Henri parkte kurz vor 11 Uhr vormittags vor der entvölkerten Universität und holte Bernard ein, der gerade den Haupteingang betrat, über dem in Riesenlettern Tod den Terroristen aller Länder geschrieben stand.