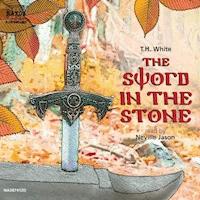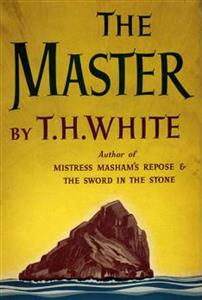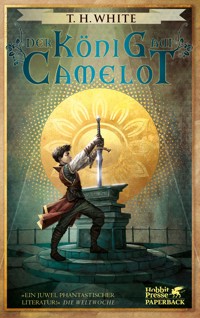
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
T. H. Whites »Der König auf Camelot« ist die umfassendste und eigenständigste Nachschöpfung der unsterblichen Artuslegende. Sie nannten ihn »die Warze«, und wie eine lästige Warze wurde der kleine Art von seinem Vetter Kay auch behandelt. Kay, der Sohn des Hauses, wurde in allen ritterlichen Fertigkeiten unterrichtet. Art hingegen hatte nur den uralten Zauberer Merlin zum Lehrer. Doch nicht Kay gelang es, das sagenumwobene Schwert aus dem Stein zu ziehen, sondern Art, dem künftigen König der Tafelrunde. Als viel später König Arthurs Frau Guinevra eine Liebschaft mit dem tapferen Ritter Lancelot eingeht und der intrigante Sir Mordred nach Arthurs Thron trachtet, nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1154
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
T.H. WHITE
Aus dem Englischenvon Rudolf Rocholl
Die Verse wurden übertragenvon H. C. Artmann
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Once and Future King« im Verlag William Collins Sons & Co Ltd., London
© Estate of T. H. White, 1958
Für die deutsche Ausgabe
© 2016 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg;
Illustration: Max Meinzold, München
Datenkonvertierung von Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN978-3-608-94970-4
E-Book: ISBN 978-3-608-10970-2
Dieses E-Book beruht auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
ERSTES BUCH:Das Schwert im Stein
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
ZWEITES BUCH:Die Königin von Luft und Dunkelheit
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
DRITTES BUCH:Der missratene Ritter
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
VIERTES BUCH:Die Kerze im Wind
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
ERSTES BUCH:
Das Schwert im Stein
INCIPIT LIBER PRIMUS
KAPITEL 1
Montags, mittwochs und freitags gab es Gotische Kanzleischrift und Summulae Logicales, an den übrigen Wochentagen waren Organon, Repetition und Astrologie dran. Die Gouvernante geriet stets mit ihrem Astrolabium durcheinander, und wenn sie besonders durcheinander war, ließ sie es an Wart aus, indem sie ihm auf die Finger schlug. Kay schlug sie nie auf die Finger, denn Kay würde, wenn er einmal älter war, Sir Kay sein, der Herr der Burg und des Besitzes. Wart wurde Wart (»die Warze«) genannt, weil sich das recht und schlecht auf Art reimte, die Kurzform seines eigentlichen Namens. Kay hatte ihm den Spitznamen gegeben. Kay wurde nie anders als Kay genannt; er war zu würdevoll für einen Spitznamen, und er wäre in Wut geraten, wenn jemand versucht hätte, ihm einen anzuhängen. Die Gouvernante hatte rote Haare und irgendeine geheimnisvolle Wunde, aus der sie beträchtliches Prestige zog, indem sie sie, hinter verschlossenen Türen, allen Frauen des Schlosses zeigte. Man nahm an, diese Wunde befinde sich an dem Körperteil, den man zum Sitzen braucht, und sei dadurch entstanden, dass die Dame sich bei einem Picknick versehentlich auf einer Rüstung niedergelassen habe. Schließlich erbot sie sich, sie Sir Ector zu zeigen, der Kays Vater war, bekam einen hysterischen Anfall und wurde fortgeschickt. Später fand man heraus, dass sie drei Jahre lang im Irrenhaus gewesen war.
An den Nachmittagen sah das Programm folgendermaßen aus: montags und freitags Lanzenstechen und Reitkunst, dienstags Falkenbeiz, mittwochs Fechten, donnerstags Bogenschießen, samstags Theorie des Rittertums nebst Anweisungen für alle Lebenslagen, Waidmannssprache und Jagd-Etikette. Wer sich zum Beispiel beim mort, dem Totsignal, oder beim Ausweiden falsch benahm, wurde über den Körper des erbeuteten Tieres gelegt und bekam eins mit dem flachen Schwertblatt verpasst. Dies hieß man: Blattgold auftragen. Ein grober Scherz, rauh und herzlich wie die Äquatortaufe. Kay bekam nie Blattgold, obwohl er oft etwas falsch machte.
Als sie die Gouvernante los waren, sagte Sir Ector: »Schließlich und endlich, verdammt noch eins, können wir die Jungens doch nicht den ganzen Tag wie Landstreicher rumlaufen lassen – schließlich und endlich, verdammt noch eins? In ihrem Alter müssten sie doch eine erstklassige Auswildung haben. Als ich so alt war wie sie, da hab ich mich jeden Morgen um fünfe mit Latein und all dem Zeugs rumgeplagt. Schönste Zeit meines Lebens. Reicht mal den Port rüber.«
Sir Grummore Grummursum, der heute hier im Hause übernachten sollte, da er auf einer besonders ausgedehnten Aventiure von der Dunkelheit überrascht worden war, sagte, dass er in ihrem Alter jeden Morgen Prügel bezogen habe, weil er auf die Beiz gegangen sei, statt was zu lernen. Auf diese Schwäche führte er auch die Tatsache zurück, dass er nie übers Erste Futurum von utor hinausgekommen war. Ungefähr ein Drittel bergab auf der linken Seite, da stand es, sagte er. Soviel er sich erinnere: Seite siebenundneunzig. Er reichte den Port hinüber.
Sir Ector sagte: »Hattet Ihr eine ordentliche Aventiure heute?«
Sir Grummore sagte: »Na ja, nicht so übel. Eigentlich sogar sehr anständig. Traf auf einen Kerl namens Sir Bruce Saunce Pité, wo in Weedon Bushes einer Maid den Kopf abhackte; folgte ihm bis Mixbury Plantation in Bicester; da hat er einen Haken geschlagen, und in Wicken Wood ist er mir dann entkommen. Muss gut und gerne fünfundzwanzig Meilen gewesen sein.«
»Ein halsstarriger Bursche«, sagte Sir Ector. »Aber von wegen der Jungens und dem Latein und all dem Kram«, fuhr der alte Herr fort. »Amo, amas, versteht Ihr, und rumlaufen wie die Landstreicher – was würdet Ihr denn vorschlagen?«
»Tja«, sagte Sir Grummore, rieb sich die Nase und warf einen verstohlenen Blick auf die Flasche, »darüber müsste man ja erst mal gehörig nachdenken, wenn Ihr’s mir nicht verübelt.«
»Nicht im Geringsten«, sagte Sir Ector. »Im Gegenteil: sehr erfreut, dass Ihr Euch äußert. Zu Dank verpflichtet, wirklich. Nehmt noch einen Port.«
»Ausgesprochen guter Port.«
»Krieg ich von einem Freund.«
»Um auf die Jungens zurückzukommen«, sagte Sir Grummore. »Wie viele sind’s denn, wisst Ihr’s?«
»Zwei«, sagte Sir Ector. »Das heißt, wenn man beide zählt.«
»Nach Eton könnt man sie wohl nicht schicken?«, erkundigte Sir Grummore sich behutsam. »Weiter Weg und so, wissen wir ja.«
Er erwähnte natürlich nicht gerade Eton, denn das College of Blessed Mary wurde erst 1440 gegründet, aber er meinte eine Schule von genau derselben Art. Auch tranken sie Metheglyn, nicht Port, doch lässt sich durch die Nennung des neumodischen Weins die Atmosphäre leichter vermitteln.
»Es ist nicht so sehr die Entfernung«, sagte Sir Ector. »Aber dieser Riese, wie heißt er doch gleich, der ist im Wege. Man muss durch sein Land, versteht Ihr.«
»Wie heißt er?«
»Ich komm im Augenblick nicht drauf; nicht ums Verrecken. Beim Burbly Water haust er.«
»Galapas«, sagte Sir Grummore.
»Genau der.«
»Dann bleibt nur noch eins übrig«, sagte Sir Grummore, »nämlich: einen Tutor zu suchen.«
»Ihr meint: einen Hauslehrer.«
»Genau«, sagte Sir Grummore. »Einen Tutor, versteht Ihr, einen Hauslehrer.«
»Trinkt noch einen Port«, sagte Sir Ector. »Nach so einer Aventiure braucht Ihr’n.«
»Hervorragender Tag«, sagte Sir Grummore. »Nur töten tun sie heutzutage anscheinend nicht mehr. Da legt man fünfundzwanzig Meilen zurück, und dann bekommt er Wind, oder man verliert ihn aus den Augen. Das Schlimmste ist, wenn man sich auf eine neue Aventiure macht.«
»Wir töten unsere Riesen, wenn sie jungen«, sagte Sir Ector. »Hernach gibt’s eine schöne Hatz, aber sie entkommen einem.«
»Man verliert die Fährte«, sagte Sir Grummore, »würde ich sagen. Ist doch immer dasselbe mit diesen großen Riesen in einem großen Land. Die Witterung geht verloren.«
»Aber wenn man sich nun einen Hauslehrer zulegen will«, sagte Sir Ector, »so seh ich noch nicht, wie man das bewerkstelligen soll.«
»Anzeige aufgeben«, sagte Sir Grummore.
»Ich hab eine Anzeige aufgegeben«, sagte Sir Ector. »Sie ist vom Humberland Newsman and Cardoile Advertiser ausgerufen worden.«
»Dann«, sagte Sir Grummore, »bleibt nur noch die Möglichkeit, zu einer Aventiure aufzubrechen.«
»Ihr meint, ich soll mich auf die Tutor-Suche machen«, erklärte Sir Ector.
»Genau.«
»Hic, haec, hoc«, sagte Sir Ector. »Trinkt noch was – einerlei, wie das Zeugs heißt.«
»Hunc«, sagte Sir Grummore.
So war’s denn also beschlossen. Als Grummore Grummursum am nächsten Tage heimwärts ritt, knüpfte Sir Ector sich einen Knoten ins Sacktuch, um nicht zu vergessen, dass er sich zwecks Tutor-Fang auf große Fahrt begeben müsse, sobald er Zeit dazu haben würde. Und da er nicht sicher war, wie er das anstellen sollte, berichtete er den Jungens, was Sir Grummore vorgeschlagen hatte, und beschwor sie, sich bis dahin nicht mehr wie Landstreicher aufzuführen. Alsdann gingen sie zum Heuen.
Es war Juli, und in diesem Monat arbeitete alles, was Arme und Beine hatte, unter Sir Ectors Anleitung auf dem Felde. Den Jungen blieb also jedwede ›Auswildung‹ vorerst mal erspart.
Sir Ectors Schloss befand sich auf einer gewaltigen Lichtung in einem noch gewaltigeren Walde. Es hatte einen Hof und einen Burggraben mit Hechten darin. Über den Graben führte eine befestigte Steinbrücke, die in der Mitte endete. Über der zweiten Hälfte lag eine hölzerne Zugbrücke, die jede Nacht gehievt wurde. Sobald man die Zugbrücke überquert hatte, befand man sich am Anfang der Dorfstraße – es gab nur eine einzige Straße –, und die erstreckte sich etwa eine halbe Meile, zu beiden Seiten von strohbedeckten Häusern aus Flechtwerk und Lehm gesäumt. Die Straße teilte die Lichtung in zwei große Felder; das linke war, in Hunderten von schmalen langen Streifen, unter dem Pflug, während das rechte zu einem Fluss abfiel und als Weide genutzt wurde. Das halbe Feld zur Rechten diente, eingezäunt, zur Heugewinnung.
Es war Juli, dazu richtiges Juliwetter, so, wie man’s in Old England hatte. Jedermann wurde brutzelbraun, wie ein Indianer, mit blitzenden Zähnen und leuchtenden Augen. Die Hunde schlichen mit hängenden Zungen einher oder lagen japsend in Schattenflecken, während die Ackergäule ihr Fell durchschwitzten und mit den Schwänzen schlugen und versuchten, mit schweren Hinterhufen sich die Bremsen vom Bauch zu treten. Auf der Weide trieben die Kühe ein übermütiges Spiel und galoppierten mit hoch aufgerichteten Schwänzen umher, was Sir Ector in schlechte Laune versetzte.
Sir Ector stand auf einem Heuschober, von wo aus er alles überblicken konnte, und schrie Befehle über das ganze Zweihundert-Morgen-Feld, wobei sein Gesicht puterrot anlief. Die besten Schnitter mähten das Gras in einer Reihe; ihre Sensen blitzten und brausten im harten Sonnenschein. Die Frauen harkten das Heu mit hölzernen Rechen in langen Streifen zusammen, und die beiden Jungen folgten beiderseits mit Gabeln, um das Heu nach innen zu werfen, sodass es leicht aufgeladen werden konnte. Dann kamen die großen Karren; ihre hölzernen Speichenräder knarrten; sie wurden von Pferden gezogen oder von gemächlichen weißen Ochsen. Ein Mann stand oben auf dem Wagen, um das Heu entgegenzunehmen und das Aufladen zu dirigieren, was von zwei Männern besorgt wurde, die rechts und links neben dem Wagen mitgingen und ihm mit Gabeln hinaufreichten, was die Jungen angehäuft hatten. Der Karren wurde zwischen zwei Reihen Heu hinuntergeführt und schön gleichmäßig von vorn bis hinten beladen, wobei der Mann, der banste, genau angab, wie er jede Gabelvoll gereicht zu haben wünschte. Die Banser schimpften auf die Jungen, dass sie das Heu nicht ordentlich zurechtgelegt hätten, und drohten ihnen Prügel an für den Fall, dass sie zurückblieben.
Wenn der Wagen beladen war, wurde er zu Sir Ectors Schober gefahren. Dort gabelte man das Heu hinauf, was ganz einfach ging, da es systematisch geladen war – nicht wie modernes Heu –, und Sir Ector trampelte obendrauf herum und kam seinen Gehilfen in die Quere, die die eigentliche Arbeit taten, und stampfte und schwitzte und fuchtelte herum und achtete ängstlich darauf, dass genau lotrecht gebanst wurde, damit der Heuschober nicht umfiel, wenn die Westwinde kamen.
Wart liebte das Heumachen und war ein guter Arbeiter. Kay, der zwei Jahre älter war, stand gewöhnlich zu weit von dem Heuhaufen entfernt, den er hinaufreichen wollte, mit dem Ergebnis, dass er doppelt so schwer schuftete wie Wart und nur die Hälfte erreichte. Er hasste es jedoch, bei irgendeiner Sache übertrumpft zu werden, und so schlug er sich mit dem vermaledeiten Heu herum – das ihm entsetzlich zuwider war –, bis ihm regelrecht übel wurde.
Der Tag nach Sir Grummores Besuch war eine reine Hetzjagd für die Leute, die zwischen dem ersten und dem zweiten Melken schuften mussten und dann wieder bis zum Sonnenuntergang mit dem schwülen Element zu kämpfen hatten. Denn das Heu war für sie ein Element wie das Meer oder die Luft, in dem sie badeten und untertauchten und das sie sogar einatmeten. Die Pollen und Fasern verfingen sich in ihren Haaren, gerieten ihnen in den Mund, in die Nase, und taten sich kitzelnd und kratzend in ihrer Kleidung kund. Sie trugen nicht viele Kleider, und zwischen den schwellenden Muskeln spielten blaue Schatten auf der nussbraunen Haut. Wer vor Gewitter Angst hatte, dem war an diesem Tag nicht wohl.
Am Nachmittag brach das Wetter los. Sir Ector hielt sie bei der Stange, bis die Blitze genau über ihren Köpfen zuckten. Dann, als der Himmel nachtdunkel war, prasselte der Regen auf sie nieder, sodass sie im Nu völlig durchnässt waren und keine hundert Schritt weit sehen konnten. Die Jungen kauerten sich unter die Karren, hüllten sich in Heu, um ihre nassen Leiber vor dem jetzt kalten Wind zu schützen, und alberten miteinander, während der Wolkenbruch herniederstürzte. Kay zitterte, allerdings nicht vor Kälte; aber er alberte wie die anderen, weil er nicht zeigen wollte, dass er Angst hatte. Beim letzten und heftigsten Donnerschlag zuckte jeder unwillkürlich zusammen, und jeder sah, wie der andere zusammenfuhr, bis sie dann mitsammen über ihre Ängstlichkeit lachten.
Dies jedoch war das Ende des Heumachens und der Beginn des Spielens. Die Jungen wurden heimgeschickt, um sich trockene Sachen anzuziehen. Die alte Frau, die einst ihr Kindermädchen gewesen war, holte frische Hosen aus der Mangel und schalt, sie würden sich noch den Tod holen, rügte auch Sir Ector, weil er so lange weitergemacht hatte. Dann schlüpften sie in frischgewaschene Hemden und liefen auf den blitzblanken Hof hinaus.
»Ich bin dafür, dass wir Cully rausholen und auf Kaninchenjagd gehen«, rief Wart.
»Bei dieser Nässe sind keine Kaninchen draußen«, sagte Kay bissig und genoss es, ihm in Naturkunde über zu sein.
»Ach, komm schon. Ist ja bald trocken.«
»Dann muss ich aber Cully tragen.«
Kay bestand darauf, den Hühnerhabicht zu tragen und fliegen zu lassen, wenn sie gemeinsam auf die Beiz gingen. Dies war sein gutes Recht – nicht nur, weil er älter war als Wart, sondern auch, weil er Sir Ectors richtiger Sohn war. Wart war kein richtiger Sohn. Er verstand es zwar nicht, doch machte es ihn unglücklich, weil Kay eine gewisse Überlegenheit daraus ableitete. Auch war es anders, keinen Vater und keine Mutter zu haben, und Kay hatte ihn gelehrt, dass jeder, der anders war, im Unrecht sei. Niemand redete mit ihm darüber, doch wenn er allein war, dachte er darüber nach und fühlte sich zurückgesetzt und elend. Er mochte es nicht, dass dieses Thema zur Sprache gebracht wurde. Da der andere Junge jedoch stets darauf zu sprechen kam, sobald sich die Frage des Vorrangs ergab, hatte er es sich angewöhnt, sofort klein beizugeben, ehe es überhaupt so weit kommen konnte. Außerdem bewunderte er Kay; er selbst war der geborene ›Zweite Mann‹: ein Heldenverehrer.
»Also los«, rief Wart, und übermütig tollten sie zu den Käfigen, wobei sie unterwegs Purzelbäume schlugen.
Die Käfige gehörten, neben den Ställen und Zwingern, zu den wichtigsten Teilen des Schlosses. Sie lagen dem Söller gegenüber und waren nach Süden gerichtet. Die Außenfenster mussten, aus Gründen der Sicherheit, klein sein, doch die Fenster, die in den Burghof blickten, waren groß und sonnig. In die Fensteröffnungen waren dicht nebeneinander vertikale Stäbe genagelt, jedoch keine horizontalen. Glasscheiben gab es nicht; um aber die Beizvögel vor Zugluft zu schützen, war Horn in den kleinen Fenstern. Am Ende der Käfigreihe befand sich eine kleine Feuerstelle, ein gemütliches Eckchen, ähnlich dem Platz im Sattelraum, wo die Stallknechte in feuchten Nächten nach der Fuchsjagd sitzen und die Geschirre reinigen. Hier waren ein paar Hocker, ein Kessel, eine Bank mit allen möglichen kleinen Messern und chirurgischen Instrumenten, sowie einige Regale mit Töpfen darauf. Die Töpfe waren mit Etiketten versehen: Cardamum, Ginger, Barley Sugar, Wrangle, for a Snurt, for the Craye, Vertigo etc. Häute hingen an den Wänden, aus denen man Stücke für Jesses (Fußriemen), Hauben und Leinen herausgeschnitten hatte. An Nägeln baumelten, ordentlich nebeneinander aufgereiht, Schellen und Drehringe und silberne varvels, alle mit eingraviertem »Ector«. Auf einem besonderen Bord, und zwar dem allerschönsten, standen die Hauben: ganz alte rissige rufter hoods, lange vor Kays Geburt gemacht, winzige Häubchen für die Merline, kleine Hauben für Terzel (männliche Falken), wunderhübsche neue Hauben, die an langen Winterabenden zum Zeitvertreib angefertigt worden waren. Alle Hauben, ausgenommen die rufters, trugen Sir Ectors Farben: weißes Leder mit rotem Fries an den Seiten und einem blaugrauen Federbusch obendrauf, der aus den Nackenfedern von Reihern bestand. Auf der Bank lag ein buntes Sammelsurium, wie man es in jeder Werkstatt findet: Schnüre, Draht, Werkzeug, Metallgegenstände, Brot und Käse, an dem die Mäuse sich gütlich getan hatten, eine Lederflasche, einige abgenutzte linke Stulphandschuhe, Nägel, Fetzen von Sackleinwand, ein paar Köder und etliche ins Holz geritzte Schriftzeichen und Kerben. Diese lauteten: Conays 11111111, Harn 111, usw. Die Rechtschreibung ließ zu wünschen übrig.
Die gesamte Länge des Raumes nahmen, von der Nachmittagssonne voll beschienen, die durch Sichtblenden getrennten Sitzstangen ein, an welche die Vögel gebunden waren. Da saßen zwei kleine Merline, Zwergfalken, die sich gerade erst vom Husten erholt hatten; ein alter Peregrin – wie man den Wanderfalken zuweilen nennt –, der in diesen bewaldeten Landstrichen von keinem großen Nutzen war, der Vollständigkeit halber jedoch weiterhin gehalten wurde; ein Turmfalke, an dem die Jungen die Anfangsgründe der Falknerei erlernt hatten; ein Sperber, den Sir Ector entgegenkommenderweise für den Priester des Kirchspiels hielt – und am äußersten Ende war, in einem eigenen Käfig, der Hühnerhabicht Cully.
Im Vogelstall herrschte peinliche Sauberkeit; auf dem Boden lag Sägemehl, um den Kot aufzunehmen, und das Gewölle wurde jeden Tag entfernt. Sir Ector besuchte die Käfige jeden Morgen um sieben Uhr, und die beiden austringers vor der Tür standen stramm. Wenn sie vergessen hatten, sich die Haare zu bürsten, bekamen sie Hausarrest. Um die Jungen kümmerten sie sich nicht.
Kay zog einen der linken Stulphandschuhe an und lockte Cully von der Stange – Cully jedoch, dessen Gefieder glatt und feindselig anlag, betrachtete ihn unverwandt mit einem bösen, blumengelben Auge und weigerte sich zu kommen. Da nahm Kay ihn auf.
»Meinst du, wir sollten ihn fliegen lassen?«, fragte Wart unschlüssig. »Mitten in der Mauser?«
»Natürlich können wir ihn fliegen lassen, du Hasenherz«, sagte Kay. »Er möcht bloß ein bisschen getragen werden, sonst nichts.«
So gingen sie denn übers Heufeld, wo das sorgfältig zusammengeharkte Gras wieder nass geworden war und an Güte verlor, ins Jagdrevier hinaus, das anfangs spärlich mit Bäumen bewachsen war, parkähnlich, allmählich jedoch in dichten Wald überging. Unter diesen Bäumen waren Hunderte von Kaninchenhöhlen, und zwar eine neben der anderen, sodass es nicht darum ging, ein Karnickel zu finden, sondern eines, das weit genug von seinem Loch entfernt war.
»Hob sagt, wir dürften Cully nicht fliegen lassen, bis er nicht mindestens zweimal aufgejagt hat«, sagte Wart.
»Hob hat keine Ahnung. Niemand kann sagen, ob ein Habicht flugfähig ist – außer dem Mann, der ihn trägt.«
»Hob ist ja sowieso bloß ein Leibeigner«, fügte Wart hinzu und löste die Leine und den Haken vom Geschirr.
Als Cully merkte, dass ihm die Fesseln abgenommen wurden, sodass er jagdbereit war, machte er einige Bewegungen, als wollte er auffliegen. Er sträubte den Schopf, die Schwungfedern und das weiche Schenkelgefieder. Im letzten Augenblick indes besann er sich eines anderen und unterließ das Rütteln. Als Wart die Bewegungen des Habichts sah, hätte er ihn nur allzu gerne abgetragen. Am liebsten hätte er ihn Kay fortgenommen und selber vorbereitet. Er war sicher, Cully in die rechte Laune versetzen zu können, indem er ihm die Fänge kraulte und das Brustgefieder spielerisch und sanft nach oben strich. Wenn er’s doch nur alleine machen könnte, statt mit diesem dämlichen Köder hinterdrein stapfen zu müssen. Aber er wusste, wie lästig es dem älteren Jungen sein musste, ständig mit Ratschlägen geplagt zu werden, und deshalb schwieg er. Wie man heutzutage beim Schießen nie den Mann kritisieren darf, der das Kommando hat, so war’s bei der Beiz sehr wichtig, dass kein Rat von außen den Falkonier irritierte.
»So–ho!«, rief Kay und reckte seinen Arm empor, um dem Habicht einen besseren Start zu geben, und vor ihnen hoppelte ein Kaninchen über den abgenagten Rasen, und Cully war in der Luft. Die Bewegung kam für alle drei überraschend: für Wart und für das Kaninchen und für den Habicht, und alle drei waren einen Augenblick lang verblüfft. Dann begann der fliegende Mörder mit den mächtigen Schwingen zu rudern, doch zögernd und unentschlossen. Das Kaninchen verschwand in einem unsichtbaren Loch. Der Habicht stieg auf, schwebte wie ein Kind auf der Schaukel hoch in der Luft, legte dann die Flügel an und stieß nieder und hockte sich in einen Baum. Cully blickte auf seine Herren herab, öffnete ob seines Versagens mürrisch den Schnabel und verharrte reglos. Die beiden Herzen standen still.
KAPITEL 2
Eine geraume Weile später, als sie den verstörten und verdrossenen Habicht genug gelockt und herbeigepfiffen hatten und ihm von Baum zu Baum gefolgt waren, verlor Kay die Geduld.
»Lass ihn sausen«, sagte er. »Der taugt sowieso nichts.«
»Aber wir können ihn doch nicht so einfach dalassen!«, sagte Wart. »Was wird denn Hob dazu sagen?«
»Es ist mein Falke, nicht Hob seiner«, rief Kay wütend. »Wen interessiert’s, was Hob sagt? Hob ist ja nur ein Bediensteter.«
»Aber Hob hat ihn abgerichtet. Wir können ihn getrost verlieren, weil wir nicht drei Nächte lang mit ihm aufbleiben mussten, ihn nicht tagelang abgetragen haben und all das. Aber Hobs Habicht dürfen wir nicht verlieren. Das wäre gemein.«
»Geschieht ihm recht. Hob ist ein armer Irrer, und Cully ist ein versauter Beizvogel. Wer will so einen versauten dämlichen Habicht? Wenn dir so viel daran liegt, dann bleib mal lieber hier. Ich geh heim.«
»Ich bleibe hier«, sagte Wart traurig, »wenn du Hob herschickst, sobald du zu Hause bist.«
Kay marschierte in die falsche Richtung los, vor Wut bebend, weil er genau wusste, dass er den Vogel zur Unzeit hatte fliegen lassen, und Wart musste ihm nachrufen und ihn auf den rechten Weg weisen. Dann setzte dieser sich unter den Baum und blickte zu Cully hinauf wie eine Katze, die einen Spatzen beobachtet, und sein Herz klopfte heftig.
Für Kay spielte es ja vielleicht keine Rolle, denn der machte sich aus der Falknerei nur insofern etwas, als es die angemessene Beschäftigung für einen Jungen seines Alters und Herkommens war; doch Wart empfand wie ein richtiger Falkonier und wusste, dass ein verlorener Beizvogel die denkbar größte Kalamität war. Er wusste, dass Hob vierzehn Stunden täglich mit Cully gearbeitet hatte, um ihm sein Handwerk beizubringen, und dass seine Arbeit dem Kampf Jakobs mit dem Engel geglichen hatte. Wenn Cully verloren war, würde auch ein Teil von Hob verloren sein. Er wagte nicht, an den vorwurfsvollen Blick zu denken, mit dem ihn der Falkner ansehen würde – nach allem, was er sie gelehrt hatte.
Was sollte er tun? Am besten blieb er still sitzen und ließ den Köder auf der Erde liegen, damit Cully sich die Sache überlegen und herunterkommen konnte. Dazu aber verspürte Cully nicht die geringste Neigung. Am Abend zuvor hatte er eine reichliche Mahlzeit bekommen, sodass er nicht hungrig war. Der heiße Tag hatte ihn in üble Laune versetzt. Das Wedeln und Pfeifen der Jungen unten und die Verfolgung von Baum zu Baum – das alles hatte ihn, der ohnehin nicht allzu intelligent war, ziemlich durcheinandergebracht. Jetzt wusste er nicht recht, was er tun sollte. Auf keinen Fall das, was die anderen wollten. Vielleicht wäre es nett, irgendetwas zu töten. Aus Trotz.
Etliche Zeit später befand Wart sich am Rande des richtigen Waldes, und Cully war drin. Jagend und fliehend waren sie ihm immer näher gekommen – so weit vom Schloss entfernt, wie der Junge noch nie gewesen war –, und nun hatten sie ihn tatsächlich erreicht.
Heutzutage würde Wart vor einem englischen Wald keine Angst haben, doch der große Dschungel von Old England war etwas anderes. Hier gab es riesige Wildschweine, die um diese Jahreszeit mit ihren Hauern den Boden aufbrachen, und hinter jedem Baum konnte einer der letzten Wölfe mit blassen Augen und geifernden Lefzen lauern. Aber die wilden und bösen Tiere waren nicht die einzigen Bewohner dieser unheimlichen Düsternis. Auch böse Menschen suchten hier Zuflucht; Geächtete, die ebenso verschlagen und blutrünstig waren wie die Aaskrähen – und ebenso verfolgt. Besonders dachte Wart an einen Mann namens Wat, mit dessen Namen die Dörfler ihre Kinder zu ängstigen pflegten. Er hatte einst in Sir Ectors Dorf gelebt, und Wart erinnerte sich seiner. Er schielte, hatte keine Nase und war nicht recht bei Trost. Die Kinder warfen mit Steinen nach ihm. Eines Tages setzte er sich zur Wehr, packte ein Kind, machte ein schnarrendes Geräusch und biss ihm tatsächlich die Nase ab. Dann lief er in den Wald. Jetzt warfen sie mit Steinen nach dem Kind ohne Nase, aber Wat sollte sich noch immer im Wald aufhalten, auf allen vieren laufen und in Felle gekleidet sein.
Auch Zauberer befanden sich in jenen legendären Tagen im Wald, dazu seltsame Tiere, von denen die modernen naturgeschichtlichen Werke nichts wissen. Es gab reguläre Banden von geächteten Saxen, die – im Gegensatz zu Wat – zusammenlebten und Grün trugen und mit Pfeilen schossen, welche niemals fehlgingen. Sogar Drachen gab es noch; es waren kleine, die unter Steinen hausten und zischen konnten wie ein Kessel.
Hinzu kam der Umstand, dass es dunkel wurde. Im Wald war weder Weg noch Steg, und niemand im Dorf wusste, was auf der anderen Seite war. Das abendliche Schweigen senkte sich hernieder, und die hohen Bäume standen lautlos da und blickten auf Wart herab.
Er hatte das Gefühl, es sei das Beste, jetzt nach Hause zu gehen, solange er noch wusste, wo er war – aber er hatte ein tapferes Herz und wollte nicht klein beigeben. Eins war ihm klar: Wenn Cully erst einmal eine ganze Nacht in Freiheit geschlafen hatte, dann war er wieder wild und unverbesserlich. Cully war kein Standvogel. Wenn der arme Wart ihn nur dazu bringen könnte, auf einem bestimmten Baum zu bleiben, und wenn Hob nur mit einer kleinen Laterne kommen wollte, dann könnten sie vielleicht noch auf den Baum klettern und ihn einfangen, solange er schläfrig und vom Licht benebelt war. Der Junge konnte ungefähr sehen, wo der Habicht sich niedergelassen hatte, etwa hundert Schritt im dichten Wald, da dort die heimkehrenden Saatkrähen tobten.
Er kennzeichnete einen der Bäume am Waldrand, in der Hoffnung, hierdurch leichter den Rückweg zu finden, und arbeitete sich dann durchs Unterholz. An den Krähen hörte er, dass Cully sich sofort entfernte.
Die Nacht brach herein, während der Junge sich durchs Gestrüpp kämpfte. Verbissen ging er weiter und horchte angespannt, und Cullys Fluchtflüge wurden müder und kürzer, bis er endlich, ehe es gänzlich dunkel war, in einem Baum über sich die gekrümmten Schultern vor dem Himmel sehen konnte. Wart setzte sich unter den Baum, um den Vogel nicht beim Einschlafen zu stören, und Cully stand auf einem Bein und ignorierte seine Gegenwart.
Vielleicht, so sagte Wart bei sich, vielleicht kann ich – auch wenn Hob nicht kommt, und ich weiß wirklich nicht, wie er mir in dieser unwegsamen Waldgegend folgen soll –, vielleicht kann ich gegen Mitternacht auf den Baum klettern und Cully herunterholen. Gegen Mitternacht müsste er schlafen. Ich werde ihn sanft mit Namen nennen, sodass er denkt, es sei nur der gewohnte Mensch, der ihn aufnimmt, während er unter der Haube steckt. Ich werd ganz leise klettern müssen. Wenn ich ihn dann habe, muss ich den Heimweg finden. Die Zugbrücke ist hoch. Aber vielleicht wartet jemand auf mich, denn Kay wird ihnen erzählt haben, dass ich noch draußen bin. Welchen Weg bin ich bloß hergekommen? Ich wollte, Kay wär nicht weggegangen.
Er kauerte sich zwischen die Baumwurzeln und versuchte, eine bequeme Stelle zu finden, wo ihm das harte Holz nicht zwischen die Schulterblätter stach.
Ich glaube, dachte er, der Weg ist hinter der Fichte mit der stachligen Spitze. Ich hätte mir merken sollen, auf welcher Seite von mir die Sonne untergegangen ist; wenn sie aufgeht, wäre ich auf derselben Seite geblieben und hätte nach Hause gefunden. Bewegt sich dort etwas, da unter der Fichte? Ach, hoffentlich begegne ich nur nicht dem alten wilden Wat, damit der mir nicht die Nase abbeißt! Zum Verrücktwerden: wie Cully da auf einem Bein steht und so tut, als wäre überhaupt nichts.
In diesem Augenblick ertönte ein Surren und ein leichtes Klatschen, und Wart entdeckte, dass zwischen den Fingern seiner rechten Hand ein Pfeil im Baumstamm steckte. Er riss seine Hand zurück, in der Meinung, etwas habe ihn gestochen, ehe er merkte, dass es ein Pfeil war. Dann ging alles langsam. Er hatte Zeit, recht genau festzustellen, was für ein Pfeil es war und dass er drei Zoll tief in dem festen Holz steckte. Es war ein schwarzer Pfeil mit gelben Ringen, einer Wespe ähnlich, und seine Hauptfeder war gelb. Die beiden anderen waren schwarz. Es waren gefärbte Gänsefedern.
Wart entdeckte, dass ihn die Gefahren des Waldes geängstigt hatten, ehe dies geschehen war, dass er jetzt aber, da er drin war, keine Angst mehr fühlte. Geschwind stand er auf – es kam ihm langsam vor – und ging hinter den Baum. Ein zweiter Pfeil kam angeschwirrt, doch der grub sich bis zu den Federn ins Gras und stand still, als hätte er sich nie bewegt.
Auf der anderen Seite des Baumes fand er ein sechs Fuß hohes Farngestrüpp. Das war eine ausgezeichnete Deckung, doch durch das Rascheln verriet er sich. Er hörte einen neuen Pfeil durch die Farnwedel zischen und eine Männerstimme fluchen, aber nicht sehr nahe. Dann hörte er den Mann, oder was es war, durchs Farnkraut stöbern. Er mochte wohl keine Pfeile mehr abschießen, weil sie kostbar waren und im Dickicht sicherlich verlorengingen. Wart bewegte sich wie eine Schlange, wie ein Kaninchen, wie eine lautlose Eule. Er war klein, und der Angreifer hatte keine Chance mehr. Fünf Minuten später war er in Sicherheit.
Der Mörder suchte nach seinen Pfeilen und trollte sich brummelnd – aber Wart stellte fest, dass er zwar dem Bogenschützen entkommen war, jedoch die Orientierung verloren hatte und seinen Habicht. Er hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Eine halbe Stunde blieb er unter dem umgestürzten Baum liegen, unter den er sich verkrochen hatte, damit der Mann endgültig verschwand und sein Herz zu hämmern aufhörte. Es hatte wie wild zu klopfen angefangen, sobald ihm bewusst wurde, dass er entkommen war.
Ach, dachte er, jetzt hab ich mich vollends verirrt, und nun bleibt mir wohl keine andere Wahl, als mir die Nase abbeißen zu lassen – oder ich werde von so einem Wespen-Pfeil durchbohrt, oder ich werde von einem zischenden Drachen gefressen oder von einem Wolf oder einem wilden Eber oder einem Zauberer – falls Zauberer kleine Jungen fressen, was sie ja wohl tun. Jetzt kann ich ruhig wünschen, ich wäre artig gewesen und hätte die Gouvernante nicht geärgert, wenn sie mit ihrem Astro-Kram durcheinanderkam, und hätte meinen guten Vormund Sir Ector mehr geliebt, wie er’s verdient.
Bei diesen trübsinnigen Gedanken, und besonders bei der Erinnerung an den freundlichen Sir Ector mit seiner Heugabel und seiner roten Nase, füllten sich die Augen des armen Wart mit Tränen, und in tiefer Trostlosigkeit lag er unter dem Baum.
Die letzten langen Abschiedsstrahlen der Sonne waren längst verschwunden, und der Mond erhob sich in ehrfurchtgebietender Majestät über die silbernen Baumwipfel. Dann erst wagte er sich aus seinem Versteck hervor, stand auf, strich sich die Ästchen vom Anzug und machte sich auf den Weg. Er ging ohne Richtung, immer dort, wo es am leichtesten war, und vertraute auf Gottes Beistand. Eine halbe Stunde vielleicht war er so durch den Wald geirrt – und bisweilen ganz fröhlich, denn es war angenehm kühl und sehr hübsch im Sommerwald bei Mondschein –, da stieß er auf das Schönste, was er in seinem kurzen Leben bisher gesehen hatte.
Eine Lichtung tauchte im Wald auf, eine ausgedehnte Blöße mit vom Mond beschienenem Gras, und die weißen Strahlen fielen voll auf die Bäume am gegenüberliegenden Waldrand. Es waren Birken, deren Stämme in perlfarbenem Licht stets am schönsten sind, und inmitten der Birken rührte sich etwas, kaum wahrnehmbar, und ein silbernes Klingen ertönte. Bis zu dem Klingen waren nur die Birken da, doch gleich darauf stand dort ein Ritter in voller Rüstung zwischen den stolzen Stämmen, still und stumm und überirdisch. Er saß auf einem gewaltigen weißen Ross, das so reglos verharrte wie sein Reiter, und in der rechten Hand hielt er eine lange glatte Turnierlanze; ihr Schaft ruhte im Steigbügel, und sie ragte steil zwischen den Baumstämmen auf, höher und höher, bis sie sich vom samtenen Himmel abhob. Alles war Mondschein, alles Silber, unbeschreiblich schön.
Wart wusste nicht, was tun. Er wusste nicht, ob es geraten war, zu diesem Ritter hinzugehen; denn es gab derart viele Schrecknisse im Wald, dass sich sogar der Ritter als Geist erweisen mochte. Geisterhaft sah er aus, in der Tat, wie er dort verharrte und über die Grenzen des Dunkels meditierte. Schließlich kam der Junge zu dem Schluss: Auch wenn es ein Geist war, war’s der Geist eines Ritters, und Ritter waren durch ihr Gelübde verpflichtet, Menschen in Bedrängnis zu helfen.
»Verzeihung«, sagte er, als er dicht unter der geheimnisvollen Gestalt stand, »könntet Ihr mir wohl sagen, wie ich wieder zu Sir Ectors Schloss komme?«
Der Geist schreckte auf, sodass er fast vom Pferd gefallen wäre, und ließ durch sein Visier ein gedämpftes Blaaah ertönen wie ein Schaf.
»Verzeihung«, fing Wart von neuem an – da verschlug’s ihm die Sprache.
Denn der Geist hob sein Visier und ließ zwei riesengroße, wie zu Eis gefrorene Augen sehen; mit ängstlicher Stimme rief er aus: »Was, was?« Dann nahm er seine Augen ab – eine Hornbrille, deren Gläser sich im Innern des Helms beschlagen hatten –, versuchte, sie an der Mähne des Pferdes abzuwischen, wodurch es nur noch schlimmer wurde, hob beide Hände über den Kopf, um sie an seinem Federbusch abzuwischen, ließ die Lanze fallen, ließ die Brille fallen, stieg vom Pferd, um sie zu suchen – im Verlaufe dieser Bemühungen klappte das Visier zu; er schob das Visier hinauf, bückte sich nach der Brille, wieder klappte das Visier zu, er richtete sich auf und äußerte mit kläglicher Stimme: »Ach, du meine Güte!«
Wart fand die Brille, wischte sie ab und überreichte sie dem Geist, der sie unverzüglich aufsetzte (das Visier klappte sogleich zu) und sich mühsam daranmachte, wieder sein Pferd zu besteigen. Als er endlich oben war, streckte er seine Hand aus, und Wart reichte ihm die Lanze hinauf. Dann, als alles seine Ordnung hatte, hob er mit der linken Hand das Visier, hielt es hoch, blickte auf den Jungen nieder – eine Hand war immer noch oben, wie bei einem verirrten Seemann, der nach Land Ausschau hält – und rief: »Ah–ha! Wen haben wir denn hier, was?«
»Bitte«, sagte Wart, »ich bin ein Junge, dessen Vormund Sir Ector ist.«
»Reizender Bursche«, sagte der Ritter. »Bin ihm nie im Leben begegnet.«
»Könnt Ihr mir sagen, wie ich zu seinem Schloss komme?«
»Blassen Schimmer. Selber fremd hier inner Gegend.«
»Ich hab mich verirrt«, sagte Wart.
»Sonderbare Geschichte. Bin seit siebzehn Jahren verirrt. – Bin König Pellinore«, fuhr der Ritter fort. »Hast vielleicht von mir gehört, was?« Mit einem Plumps ging das Visier zu, wie als Echo auf das »was?«, wurde jedoch sofort wieder geöffnet. »Siebzehn Jahre, kommenden Michaelis, und immer auf Aventiure, auf Queste, auf der Hohen Suche nach dem Biest. Äußerst langweilig. Äußerst.«
»Kann ich mir vorstellen«, sagte Wart, der nie etwas von König Pellinore oder einem Aventiuren-Biest gehört hatte, es jedoch für angeraten hielt, etwas Unverfängliches zu erwidern.
»Ist die Auflage der Pellinores«, sagte der König stolz. »Nur ein Pellinore kann es fangen – oder einer seines Geschlechts. Erziehe alle Pellinores auf dieses Ziel hin. Ziemlich begrenzte Erziehung. Losung und all das.«
»Ich weiß, was das ist«, sagte der Junge interessiert. »Es ist der Kot des Tieres, das man verfolgt. Den hebt man im Horn auf, damit man ihn seinem Herrn zeigen kann, und außerdem kann man daran erkennen, ob’s ein jagdbares Tier ist oder nicht, und in welchem Zustand es sich befindet.«
»Intelligentes Kind«, bemerkte der König. »Äußerst. Ich schleppe praktisch die ganze Zeit Losung mit mir herum. – Ungesunde Angewohnheit«, fügte er hinzu und blickte niedergeschlagen drein. »Und völlig sinnlos. Nur ein Aventiuren-Tier, weißt du, da gibt’s keine Frage, ob jagdbar oder nicht.«
Jetzt hing das Visier so traurig nieder, dass Wart sich entschied, seine eigenen Sorgen zu vergessen und stattdessen den Ritter aufzuheitern, indem er ihm Fragen zu dem Thema stellte, dem er sich gewachsen fühlte. Sich mit einem verirrten König zu unterhalten, war immer noch besser, als allein im Wald zu sein.
»Wie sieht das Aventiuren-Tier aus?«
»Ah, wir nennen es das Biest Glatisant, weißt du«, erwiderte der Monarch; er setzte eine gelehrte Miene auf und begann, sich gewandt auszudrücken. »Also: Das Biest Glatisant oder, wie wir sagen, das Aventiuren-Tier – du kannst es so oder so nennen«, fügte er huldvoll hinzu –, »dieses Tier hat den Kopf einer Schlange, ah, und den Leib eines Pardels, die Keulen eines Löwen und die Läufe eines Hirschs. Wo dies Biest auch hinkommt – immer macht’s ein Geräusch im Bauch, wie das Geräusch von dreißig Koppeln Hunden auf der Hatz. – Außer an der Tränke, natürlich«, setzte der König hinzu.
»Muss ja ein schreckliches Ungeheuer sein«, sagte Wart und sah sich ängstlich um.
»Ein schreckliches Ungeheuer«, wiederholte der König. »Es ist das Biest Glatisant.«
»Und wie folgt Ihr ihm?«
Dies schien die falsche Frage zu sein, denn Pellinore blickte noch niedergeschlagener drein.
»Ich habe einen Schweißhund«, sagte er bekümmert. »Da ist er, dort drüben.«
Wart schaute in die Richtung, die ihm ein verzagter Daumen wies, und sah eine vielfach um einen Baum geschlungene Leine. Das eine Ende der Leine war an König Pellinores Sattel befestigt.
»Ich kann ihn nicht genau sehn.«
»Hat sich auf die andere Seite gewickelt, möchte ich annehmen. Strebt ständig in die entgegengesetzte Richtung.«
Wart ging zum Baum hinüber und fand einen großen weißen Hund, der Flöhe hatte und sich kratzte. Sobald er Warts ansichtig wurde, wedelte er mit dem ganzen Körper, grinste hohlmäulig und keuchte in dem Bemühen, ihm trotz der Leine das Gesicht zu lecken. Sie war so verheddert, dass er sich nicht bewegen konnte.
»Ist ein ganz brauchbarer Schweißhund«, sagte König Pellinore, »keucht nur so und wickelt sich dauernd um irgendwas rum und strebt ständig in die entgegengesetzte Richtung. Das und dann das Visier, was, da weiß ich manchmal nicht, wohin.«
»Warum lasst Ihr ihn denn nicht los?«, fragte Wart. »Der würd dem Biest schon auf der Fährte bleiben.«
»Dann geht er ab, verstehst du, und manchmal seh ich ihn eine ganze Woche nicht. – Wird ein bisschen einsam ohne ihn«, fügte der König hinzu, »immer auf der Hohen Suche nach dem Biest, und nie weiß man, wo man ist. Leistet einem ein bisschen Gesellschaft, weißt du.«
»Er scheint recht umgänglich zu sein.«
»Viel zu umgänglich. Manchmal zweifle ich, ob er dem Biest überhaupt auf der Fährte ist.«
»Was macht er denn, wenn er’s sieht?«
»Nichts.«
»Na ja«, sagte Wart. »Ich nehme an, im Lauf der Zeit wird er schon das richtige Gespür kriegen.«
»Es ist schon acht Monate her, seit wir das Biest überhaupt gesehen haben.«
Seit Beginn der Unterhaltung war die Stimme des armen Kerls immer trauriger und trauriger geworden, und jetzt fing er tatsächlich an zu schniefeln. »Es ist der Fluch der Pellinores«, rief er aus. »Immer und ewig hinter dem biestigen Biest her. Was soll’s, um alles in der Welt? Zuerst musst du halten, um den Hund abzuwickeln, dann fällt das Visier runter, dann kannst du nicht durch die Brillengläser sehn. Nie weiß man, wo man schlafen soll; nie weiß man, wo man ist. Rheumatismus im Winter, Sonnenstich im Sommer. Es dauert Stunden, in diese grässliche Rüstung zu steigen. Wenn sie an ist, kocht sie entweder oder friert fest, und rostig wird sie auch. Die ganze Nacht musst du dasitzen und das Zeug saubermachen und schmieren. Ach, ich wünsche mir so, ich hätt ein hübsches Häuschen, in dem ich wohnen könnte, ein Haus mit Betten drin und richtigen Kissen und Laken. Wenn ich reich wär, würd ich mir eins kaufen. Ein feines Bett mit einem feinen Kissen und einem feinen Laken, in dem man liegen kann. Und dann würd ich dies Biest von einem Gaul auf die Weide schicken, und dem Biest von einem Schweißhund würd ich sagen, er soll sich davonmachen und spielen, und diese biestige Rüstung würd ich aus dem Fenster werfen, und das biestige Biest würd ich sausenlassen: soll sich selber jagen – ja, das tät ich.«
»Wenn Ihr mir den Weg nach Hause zeigen könntet«, sagte Wart listig, »würde Sir Ector Euch bestimmt ein Bett für die Nacht geben.«
»Meinst du wirklich?«, rief der König. »Ein richtiges Bett?«
»Ein Federbett.«
König Pellinores Augen wurden groß und rund wie Untertassen. »Ein Federbett!«, sprach er langsam nach. »Mit Kissen?«
»Daunenkissen.«
»Daunenkissen!«, flüsterte der König und hielt den Atem an. Dann, mit einem andächtigen Ausatmen: »Was für ein wunderbares Haus muss dein Herr haben!«
»Ich glaube nicht, dass es weiter als zwei Stunden weg ist«, sagte Wart, seinen Vorteil nutzend.
»Und dieser Herr hat dich wirklich ausgesandt, mich einzuladen?« (Ihm war entfallen, dass Wart sich verirrt hatte.) »Wie nett von ihm, wie außerordentlich nett von ihm, muss ich schon sagen, was?«
»Er wird sich freuen, uns zu sehen«, sagte Wart wahrheitsgemäß.
»Oh, wie nett von ihm«, rief der König wieder und begann mit seinen diversen Gerätschaften zu hantieren. »Und was für ein hochmögender Herr muss er sein, dass er ein Federbett hat! – Vermutlich werde ich’s mit jemandem teilen müssen?«, setzte er fragend hinzu.
»Ihr könnt eins für Euch alleine haben.«
»Ein Federbett für einen ganz allein, mit Laken und einem Kissen – vielleicht sogar zwei Kissen, oder einem Kissen und einer Kopfstütze –, und nicht zum Frühstück aufstehn müssen! Steht dein Vormund zum Frühstück auf?«
»Nie«, sagte Wart.
»Flöhe im Bett?«
»Kein einziger.«
»Nein!«, sagte König Pellinore. »Das klingt zu schön, um wahr zu sein, muss ich schon sagen. Ein Federbett, und ewig keine Losung mehr. Was hast du gesagt: Wie lang brauchen wir dahin?«
»Zwei Stunden«, sagte Wart – aber das zweite Wort musste er brüllen, denn alles ging in einem Geräusch unter, das sich dicht neben ihnen erhoben hatte.
»Was war das?«, fragte Wart laut.
»Holla!«,rief der König.
»Barmherzigkeit!«
»Das Biest!«
Und allsogleich hatte der eifrige Jägersmann alles andere vergessen und widmete sich ganz seiner Aufgabe. Er wischte die Brille an seiner Hose ab, an der Sitzfläche, dem einzig verfügbaren Stück Stoff, während um sie her Läuten und Bellen anhub. Er befestigte sie behutsam auf der Spitze seiner langen Nase, ehe das Visier automatisch herunterklappte. Er packte seine Tjost-Lanze mit der Rechten und galoppierte auf den Lärm zu. Die um den Baum geschlungene Leine brachte ihn zum Stehen – der hohlmäulige Schweißhund gab ein melancholisches Kläffen von sich –, und mit großem Getöse fiel König Pellinore vom Pferd. Im Handumdrehen hatte er sich wieder erhoben – Wart war überzeugt, dass die Brille in Scherben gegangen sein musste – und hüpfte, einen Fuß im Steigbügel, um das weiße Pferd herum. Die Gurte hielten, und irgendwie kam er in den Sattel, die Lanze zwischen den Beinen, und dann sauste er im Galopp um den Baum, immer wieder, entgegengesetzt der Richtung, in der der Hund sich aufgewickelt hatte. Er machte drei Umrundungen zu viel, gleichzeitig rannte der Köter kläffend anders herum, und dann kamen sie, nach vier oder fünf Anläufen, beide von diesem Hindernis frei. »Juchhu, was!«, rief König Pellinore, schwenkte seine Lanze in der Luft und schwankte aufgeregt im Sattel. Dann verschwand er im Dunkel des Waldes; das unglückliche Hundetier folgte ihm am Ende der Leine.
KAPITEL 3
Der Junge schlief gut in dem Waldnest, das er sich ausgesucht hatte; es war ein leichter, doch erholsamer Schlaf, wie ihn Menschen haben, die es nicht gewohnt sind, im Freien zu schlafen. Zuerst tauchte er nur knapp unter die Schlaf-Oberfläche und trieb dahin wie ein Lachs in seichtem Gewässer, so dicht unter der Oberfläche, dass er wähnte, in der Luft zu sein. Er hielt sich für wach, als er bereits schlief. Er sah die Sterne über seinem Gesicht, die stumm und schlaflos um ihre Achsen wirbelten; er sah die Blätter der Bäume, die vor ihm raschelten; und er hörte unscheinbare Veränderungen im Gras. Diese kleinen Geräusche von Tritten und sanften Flügelschlägen und unsichtbaren Bäuchen, die sich über die Halme zogen oder gegen die Farne stießen, ängstigten ihn anfangs, machten ihn neugierig, sodass er herauszufinden suchte, was es war (es gelang ihm nicht); hernach besänftigten sie ihn, sodass er nicht mehr wissen wollte, was es war, sondern sich damit zufriedengab, dass es schon seine Richtigkeit hatte; und endlich berührte ihn das alles nicht mehr: Er schwamm tiefer und tiefer, schmiegte sich in die duftende Erde, in den warmen Boden, in die endlosen Wasser tief drunten.
Es war ihm schwergefallen, beim hellen Sommer-Mondschein in die Regionen des Schlafes einzudringen, doch dann war es nicht schwierig, dort zu bleiben. Die Sonne kam früh, und er drehte sich ablehnend auf die andere Seite; indes hatte er gelernt, bei Licht einzuschlafen, sodass es ihn nun nicht mehr wecken konnte. Es war neun Uhr, fünf Stunden nach Sonnenaufgang, als er endlich die Augen aufschlug und sogleich hellwach war. Er hatte Hunger.
Wart hatte zwar erzählen hören, dass Menschen von Beeren lebten, aber das schien ihm im Augenblick nicht praktizierbar zu sein, denn es war Juli, und es gab keine. Er fand zwei Walderdbeeren und aß sie gierig. Sie schmeckten unvergleichlich köstlich, und er wünschte, es gäbe mehr davon. Dann wünschte er, es wäre April, sodass er Vogeleier suchen und essen könnte, oder dass er seinen Habicht Cully nicht verloren hätte, der ihm jetzt ein Kaninchen fangen würde, das er über einem Feuer braten wollte; ein Feuer machte man, indem man zwei Stöcke gegeneinander rieb, wie die alten Indianer. Aber Cully hatte er verloren, sonst wäre er ja nicht hier, und die Stöcke hätten sich wohl ohnehin nicht entzündet. Er kam zu der Überzeugung, dass er sich höchstens drei oder vier Meilen von zu Hause entfernt haben konnte, und das Beste würde sein, sich still zu verhalten und zu horchen. Möglicherweise hörte er dann die Leute beim Heumachen, falls der Wind günstig war, und auf diese Weise konnte er den Heimweg zum Schloss finden.
Was er hörte, war ein gedämpftes Klirren, sodass er glaubte, König Pellinore müsse dem Aventiuren-Tier wieder auf den Fersen sein, und zwar ganz in der Nähe. Nur war das Geräusch derart regelmäßig und absichtsvoll, dass er auf den Gedanken kam, König Pellinore obliege einer ganz bestimmten Tätigkeit, und zwar mit großer Ausdauer und Konzentration – vielleicht versuchte er, zum Beispiel, sich am Rücken zu kratzen, ohne die Rüstung auszuziehen. Er ging dem Geräusch nach.
Er geriet zu einer Waldblöße, und auf dieser Lichtung stand ein putziges steinernes Häuschen. Es war ein Cottage, das aus zwei Teilen bestand (was Wart nicht wissen konnte). Der Hauptteil war die Halle oder der Allzweckraum, der recht hoch war, weil er sich vom Boden bis zum Dach erstreckte; und dieser Raum hatte ein Feuer auf dem Boden, dessen Rauch sich zu guter Letzt durch ein Loch im Strohdach ins Freie schlängelte. Die andere Hälfte des Häuschens wurde durch eine eingezogene Decke in zwei Etagen geteilt: Oben befanden sich ein Schlafzimmer und ein Studierzimmer, während die untere Hälfte als Speisekammer, Vorratsraum, Stall und Scheune diente. Unten lebte ein weißer Esel, und eine Leiter führte nach oben.
Vor dem Cottage war ein Brunnen, und das metallische Geräusch, das Wart gehört hatte, rührte von einem sehr alten Herrn, der mithilfe einer Kurbel und einer Kette Wasser aus dem Brunnen holte.
Klirr, klirr, klirr machte die Kette, bis der Eimer den Brunnenrand erreichte. »Hol’s der Henker!«, sagte der alte Mann. »Man sollt doch meinen, nach all den vielen Jahren des Studierens hätt man’s weitergebracht als zu einem Heilige-Jungfrau-Brunnen mit einem Heilige-Jungfrau-Eimer, ungeachtet der Heilige-Jungfrau-Kosten.
Heilige-dies-und-heilige-das«, fügte der alte Herr hinzu und hievte seinen Eimer mit einem boshaften Blick aus dem Brunnen, »weshalb legen sie nicht endlich elektrisches Licht her und fließend Wasser?«
Er trug ein wallendes Gewand mit einem Pelzkragen, das mit den verschiedenen Tierkreiszeichen bestickt war, auch mit kabbalistischen Zeichen, Dreiecken mit Augen drin, komischen Kreuzen, Baumblättern, Vogel- und Tierknochen, und einem Planetarium, dessen Sterne leuchteten wie kleine Spiegelstückchen, die von der Sonne beschienen werden. Er trug einen spitzen Hut, ähnlich einer Narrenmütze oder gewissen weiblichen Kopfbedeckungen jener Zeit, nur dass bei den Damen noch ein Schleier daran flatterte. Darüber hinaus hatte er einen Zauberstab aus lignum vitae, der neben ihm im Grase lag, und eine Hornbrille wie König Pellinore. Es war eine ungewöhnliche Brille: Sie hatte keine Bügel, sondern war wie eine Schere geformt oder wie die Fühler der Tarantelwespe.
»Verzeihung, Sir«, sagte Wart, »könntet Ihr mir wohl bitte sagen, wie ich zu Sir Ectors Schloss komme?«
Der betagte Herr setzte seinen Eimer ab und sah ihn an.
»Du bist also Wart.«
»Ja, Sir, bitte, Sir.«
»Und ich«, sagte der alte Mann, »bin Merlin.«
»Guten Tag.«
»Tag.«
Als diese Formalitäten erledigt waren, hatte Wart Muße, ihn genauer zu betrachten. Der Zauberer starrte ihn mit einer Art vorurteilsloser und wohlwollender Neugier an, die ihm das Gefühl gab, dass es durchaus nicht aufdringlich oder ungezogen sei, ihn seinerseits anzustarren – nicht aufdringlicher, als wenn er einer der Kühe seines Vormunds ins Auge blickte, die ihren Kopf aufs Gatter gelegt hatte und sich Gedanken über seine Persönlichkeit machte.
Merlin hatte einen lang herabwallenden weißen Bart, dazu einen langen weißen Schnauzbart, der auf beiden Seiten überhing. Bei näherem Hinsehen ergab sich, dass der Alte nicht allzu sauber war. Nicht, dass er schmutzige Fingernägel gehabt hätte oder etwas dergleichen, bewahre, doch schien irgendein großer Vogel in seinen Haaren genistet zu haben. Wart kannte die Nester von Sperbern und Habichten, diese aus Stöcken und allem möglichen zusammengefügten Horste, die sie von Eichhörnchen oder Krähen übernahmen, und er wusste, wie die Zweige und der Fuß des Baumes mit weißem Kot bespritzt waren, übersät mit Knochenresten und verschmutzten Federn und Gewölle. Diesen Eindruck machte Merlin auf ihn. Den Eindruck eines Horstbaumes. Die Sterne und Dreiecke des Gewandes waren auf beiden Schultern mit Kot beschmiert, und eine große Spinne ließ sich gemächlich von der Spitze des Hutes herab, während der Alte den kleinen Jungen vor sich musterte und anblinzelte. Er hatte einen besorgten Gesichtsausdruck, so etwa, als suche er sich eines Namens zu erinnern, der mit Chol anfing, doch ganz anders ausgesprochen wurde, Menzies vielleicht, oder Dalziel? Seine sanften blauen Augen, die hinter der Tarantel-Brille sehr groß und rund wirkten, beschlugen sich nach und nach und wurden neblig, während er den Jungen betrachtete; und dann drehte er mit einem Ausdruck der Resignation den Kopf zur Seite, als sei ihm dies alles schließlich doch zu viel.
»Magst du Pfirsiche?«
»Aber ja, sehr gern«, sagte Wart, und der Mund wässerte ihm, bis er voll des süßen, sanften Saftes war.
»Ihre Zeit ist noch nicht gekommen«, sagte der Alte tadelnd und ging auf das Cottage zu.
Wart folgte ihm, da dies das Einfachste schien, und erbot sich, den Eimer zu tragen (was Merlin offenbar erfreute), und wartete, während der alte Mann die Schlüssel zählte – wobei er vor sich hin murmelte und sie verlegte und ins Gras fallen ließ. Als sie endlich im Innern des schwarzweißen Hauses waren (ein Einbruch hätte nicht umständlicher und mühevoller sein können), stieg er hinter seinem Gastgeber die Leiter hinauf und stand im oberen Zimmer.
Es war der wundersamste Raum, in dem er je gewesen war.
Von den Dachsparren hing ein richtiger Corkindrill herab, sehr lebensgetreu und erschreckend, mit Glasaugen und ausgebreitetem Schuppenschwanz. Als sein Herr und Meister den Raum betrat, blinzelte er zur Begrüßung mit einem Auge, obwohl er ausgestopft war. Es gab Tausende von Büchern in braunen Ledereinbänden; einige waren an die Bücherregale gekettet, andere stützten sich gegenseitig, als hätten sie zu viel getrunken und trauten nun ihrem Stehvermögen nicht recht. Sie strömten einen Geruch von Schimmel und deftiger Bräune aus, der höchst vertrauenerweckend war. Dann gab es allerlei ausgestopfte Vögel: Gecken und Elstern und Eisvögel und Pfauen, die nur noch zwei Federn hatten, Vögelchen, so winzig wie Käfer, und einen vermeintlichen Phönix, der nach Zimt und Weihrauch roch. Es konnte kein richtiger Phönix sein, da es jeweils immer nur einen gibt. Über dem Kamin hing eine Fuchs-Maske, unter der geschrieben stand: GRAFTON, BUCKINGHAM NACH DAVENTRY, 2 STDN 20 MIN; und da war ein vierzigpfündiger Lachs, mit AWE 43 MIN. BULLDOG deklariert; außerdem ein ganz lebensechter Basilisk mit der Beschriftung CROWHURST OTTER HOUNDS in Antiqua. Ferner waren da Wildschweinhauer und Klauen von Tigern und Pardeln, hübsch symmetrisch angeordnet, und ein großer Kopf von Ovis Poli, sechs lebende Ringelnattern in einer Art Aquarium, ein paar in einem gläsernen Zylinder hübsch hergerichtete Nester der Einsiedlerwespe, ein gewöhnlicher Bienenkorb, dessen Bewohner ungehindert durchs Fenster ein- und ausfliegen konnten, zwei junge Igel in Baumwolle, ein Dachs-Pärchen, das beim Erscheinen des Zauberers sogleich in lautes Jik-jik-jik-jik ausbrach, zwanzig Kästen, die Kleberaupen und sechs Gabelschwänze und sogar einen zwergwüchsigen Oleander enthielten – jede Spezies hatte ihre Fraßpflanze –; ein Gewehrschrank mit allen möglichen Waffen, die erst im nächsten halben Jahrtausend erfunden werden würden, ein Angelbehälter dito, eine Kommode voller Lachsfliegen, von Merlin selber gebunden, eine zweite Kommode, deren Schubladen Etiketten trugen: MANDRAGORA, MANDRAKE, OLD MAN’S BEARD usw., ein Strauß Truthahnfedern und Gänsekiele zur Herstellung von Schreibfedern, ein Astrolabium, zwölf Paar Stiefel, ein Dutzend Fangnetze, drei Dutzend Kaninchendrähte, zwölf Korkenzieher, einige Ameisennester zwischen zwei Glasscheiben, Tintenfläschchen jeder nur möglichen Farbe von Rot bis Violett, Stopfnadeln, eine Goldmedaille für den besten Scholaren in Winchester, vier oder fünf Registrierapparate, ein Nest mit lebenden Feldmäusen, zwei Schädel, reichlich Kristall, Venetianisches Glas, Bristol-Glas, ein Fläschchen Mastix-Firnis, etwas Satsuma-Porzellan, etwas Cloisonné, die vierzehnte Auflage der Encyclopædia Britannica (durch die Effekthascherei der volkstümlichen Tafeln einigermaßen beeinträchtigt), zwei Malkästen (einer für Öl, einer für Aquarell), drei Globen der bekannten geographischen Welt, ein paar Fossilien, der ausgestopfte Kopf einer Giraffe, sechs Ameisen, etliche gläserne Retorten, Kessel, Bunsenbrenner usw., dazu ein kompletter Satz Zigarettenbilder mit Wildgeflügel, gemalt von Peter Scott.
Merlin nahm seinen Spitzhut ab, als er diese Kammer betrat, da er für die Decke zu hoch war, und sogleich gab es ein Gewirbel in einer der dunklen Ecken, ein furioses Flügelgeflatter, und schon saß eine lohfarbene Eule auf dem schwarzen Käppchen, das den Schädel schützte.
»Oh, was für eine hübsche Eule!«, sagte Wart.
Doch als er zu ihr ging und die Hand ausstreckte, machte sich die Eule noch einmal so groß, hockte da, steif wie ein Feuerhaken, schloss die Augen, sodass sie nur noch durch einen ganz schmalen Schlitz sehen konnte – wie man’s beim Versteckspielen tut, wenn man die Augen zumachen soll –, und sagte mit unschlüssiger Stimme: »Ist keine Eule.«
Dann schloss sie ihre Augen vollends und drehte den Kopf zur Seite.
»Ist nur ein Junge«, sagte Merlin.
»Ist kein Junge«, sagte die Eule hoffnungsvoll, ohne sich umzudrehen.
Die Entdeckung, dass die Eule sprechen konnte, überraschte Wart derart, dass er seine guten Manieren vergaß und noch näher trat. Hierdurch wurde der Vogel so nervös, dass er einen Klecks auf Merlins Kopf machte – der ganze Raum war schon ziemlich weiß von lauter Exkrementen – und auf die äußerste Schwanzspitze des Corkindrill flog, wo er unerreichbar war.
»Wir bekommen so wenig Besuch«, erklärte der Zauberer und wischte sich den Kopf mit einer abgetragenen Pyjama-Hälfte, die er zu diesem Zweck bereithielt, »dass Archimedes sich vor Fremden ein wenig fürchtet. Komm, Archimedes, hier ist ein Freund von mir; er heißt Wart.«
Dabei streckte er seine Hand der Eule entgegen, die wie eine Gans über den Rücken des Corkindrill gewatschelt kam – sie watschelte gestelzt, um ihren Schwanz vor Schaden zu bewahren – und mit allen Anzeichen des Widerstrebens auf Merlins Finger hüpfte.
»Halt mal deinen Finger hoch und leg ihn hinter ihre Beine. Nein, unters Gefieder.«
Als Wart dies getan hatte, bewegte Merlin die Eule behutsam nach hinten, bis ihre Läufe an Warts Finger stießen, sodass sie entweder rückwärts auf den Finger steigen musste oder das Gleichgewicht verlor. Sie trat auf den Finger. Wart war entzückt und stand still, während sich die befiederten Zehen um seinen Finger schlossen und die scharfen Krallen ihn in die Haut stachen.
»Sag mal ordentlich Guten Tag«, sagte Merlin.
»Ich will nicht«, sagte Archimedes, blickte fort und hielt sich fest.
»Wirklich ein hübscher Kerl«, sagte Wart. »Habt Ihr ihn schon lange?«
»Archimedes ist bei mir, seit er klein war, ja, seit er ein winziges Köpfchen hatte wie ein Küken.«
»Ich wollt, er würd was zu mir sagen.«
»Vielleicht wird er zutraulicher, wenn du ihm diese Maus hier gibst, aber ganz zart.«
Merlin holte eine tote Maus aus seinem Käppchen – »Die verwahre ich immer hier, auch Würmer zum Angeln; ich finde es sehr bequem« – und überreichte sie Wart, der sie etwas zimperlich Archimedes hinhielt. Der gekrümmte Schnabel sah aus, als könnte er Unheil anrichten, doch Archimedes beäugte die Maus, warf Wart einen Blinzelblick zu, bewegte sich auf dem Finger näher heran, schloss die Augen und beugte sich vor. So stand er da, mit geschlossenen Augen und einem Ausdruck des Entzückens auf dem Gesicht, als spreche er das Tischgebet, und dann nahm er – mit einer absurden seitlichen Knabber-Bewegung – den Happen so sanft an, dass er nicht einmal eine Seifenblase zum Platzen gebracht hätte. Mit geschlossenen Augen blieb er vorgebeugt sitzen; die Maus hing ihm im Schnabel, als wüsste er nicht, was er mit ihr anfangen sollte. Dann hob er den rechten Fang – er war Rechtshänder, obgleich behauptet wird, dass das nur bei Menschen vorkomme – und packte die Maus. Er hielt sie hoch, wie ein Junge einen Stock oder einen Stein hält oder ein Konstabler seinen Gummiknüppel, beäugte sie, knabberte an ihrem Schwanz. Er drehte sie herum, sodass der Kopf vorne war, denn Wart hatte sie falsch herum offeriert, und machte einen Schluck. Er blickte die Zuschauer der Reihe nach an, wobei ihm der Schwanz aus dem Mundwinkel hing – als wollte er sagen: ›Ich wünschte, ihr würdet mich nicht so anstarren‹ –, drehte seinen Kopf zur Seite, schluckte höflich den Mauseschwanz, kratzte sich den Seemannsbart mit der linken Zehe und fing an, sich das Gefieder auszuschütteln.
»Lass ihn in Ruhe«, sagte Merlin. »Vielleicht will er erst Freundschaft mit dir schließen, wenn er dich genauer kennt. Bei Eulen geht das nicht so haste-was-kannste.«
»Vielleicht möcht er gern auf meiner Schulter sitzen«, sagte Wart und ließ instinktiv seine Hand sinken, sodass die Eule, die am liebsten so hoch wie möglich saß, den Hang hinaufkletterte und sich scheu an sein Ohr stellte.
»Jetzt Frühstück«, sagte Merlin.
Wart sah, dass auf einem Tisch am Fenster lukullisch gedeckt war. Da standen Pfirsiche. Da standen des Weiteren: Melonen, Erdbeeren mit Sahne, Zwieback, dampfend heiße Forelle, gegrillter Barsch (viel ansprechender), Hühnchen (so scharf gewürzt, dass es einem den Mund verbrannte), Nieren und Pilze auf Toast, Frikassee, Curry-Fleisch und zur Wahl kochend heißer Kaffee oder Schokolade mit Sahne in großen Tassen.
»Nimm ein bisschen Senf dazu«, sagte der Zauberer, als sie bei den Nieren angelangt waren.
Der Senfnapf erhob sich und kam auf dünnen Silberbeinen zu seinem Teller, watschelnd wie die Eule. Dann entkräuselte er seine Henkel, und ein Henkel hob mit übertriebener Artigkeit den Deckel, während ihm der andere einen reichlichen Löffelvoll servierte.
»Au, der Senftopf ist ja reizend!«, sagte Wart. »Wo habt Ihr denn den her?«
Bei diesen Worten strahlte der Napf über das ganze Gesicht und stolzierte ein wenig umher, doch Merlin gab ihm mit dem Teelöffel eins auf den Kopf, sodass er sich hinsetzte und sogleich zudeckelte.
»Ist kein übler Topf«, sagte er mürrisch. »Er tut nur so gern vornehm.«