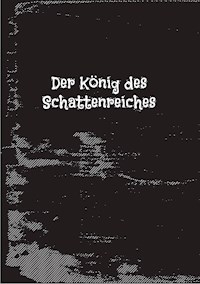
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der König des Schattenreiches ist kalt wie Eis und zu keinem Mitleid fähig. Eine Beschreibung, die zu Raven Lhiannon nur zu gut passt. Für ihn steht der Sieg über das Sonnenreich, dem erbitterten Feind, an erster Stelle. Er kennt keine Gnade mit denen, die gegen ihn sind. Die sein Land und seine Herrschaft bedrohen. In seinem Leben gibt es keine Wärme, keine Reue, kein Erbarmen. Und doch reicht ein Blick dieser Frau aus, um ihn erstarren zu lassen. Seinen Geist gefangenzunehmen. Ihn zu verzaubern, wie es bisher niemandem gelungen ist. Und das alles mit einem einzigen, flüchtigen Blick. Nach welchem sie verschwand. Für annähernd ein halbes Jahrzehnt. Als Raven sie findet, sie aus ihrem gläsernen Gefängnis befreit, steht für ihn eines fest: Er wird sie nie mehr gehen lassen. Ob diese sture Prinzessin des Sonnenreiches es nun einsehen will oder nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rubi
Der schwarze König des Schattenreiches
© 2022 Rubi
ISBN Softcover: 978-3-347-61945-6
ISBN Hardcover: 978-3-347-61946-3
ISBN E-Book: 978-3-347-61947-0
ISBN Großschrift: 978-3-347-61948-7
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Am Anfang war es ruhig.
Nur die Stille war da.
Und die vier Götter, die diese Stille füllen wollten.
So stiegen sie vom Himmel herab. Sammelten sich als Regen im See der Weisheit, aus dem der Fluss Erena entsprang und stiegen daraus empor.
Der Gott des Windes ging gen Osten. Dort fand er ein braches Land, brachte Wasser und Leben. Es war das Reich der aufgehenden Sonne, das Windreich.
Keine Erhebung spaltete den Grund. Nur gerade Flächen, über die der Wind pfiff.
Verborgen im Wald lag das Zentrum des Landes. Der Ort, an dem der Windgott sich niederließ.
Die Stadt Windtal.
Der Gott der Sonne ging gen Süden. Dort fand er Berge und Täler, Schluchten und Ebenen, brachte Fruchtbarkeit und Leben. Es war das Reich mit Sonne, das Sonnenreich.
In der Mitte lag das Zentrum des Landes. Der Ort, an dem der Sonnengott sich niederließ.
Die Stadt Engelsstadt.
Der Gott des Wassers ging gen Westen. Dort fand er Berge und Seen, brachte Reichtum und Erz. Es war das Reich der untergehenden Sonne, das Wasserreich.
Das Land war grob und rau, die Seen klar und heilend.
In der Mitte der Berge lag das Zentrum des Landes. Der Ort, an dem der Wassergott sich niederließ.
Die Stadt Felsental.
Der Gott der Dunkelheit ging gen Norden. Dort fand er weite Flächen von Wald und sieben Inseln. Er brachte ihnen Macht und Stärke. Es war das Reich ohne Sonne, das Schattenreich.
Ganz am Rande lag das Zentrum des Landes. Der Ort, an dem der Schattengott sich niederließ.
Die Stadt Wolfsstädt.
Prolog
„Was machst du hier?!“
Die laute und garstige Stimme polterte durch das Zelt. Anna verkniff sich jeden Kommentar und starrte ihren Erzeuger nur wütend an. Zorn und Hass wirbelten in ihrem Inneren umher. Da stand sie nun, vom Regen durchnässt, zitternd und bebend vor Kälte und alles, was er zu sagen hatte, war, dass sie gleich wieder verschwinden sollte. Die Wut stieg immer weiter empor, ließ ihre Augen gefährlich funkeln.
„Ich möchte helfen!“, zischte sie ihn böse an und trat einen Schritt vor. Entschlossen. Sie würde sich nicht wie ein kleines Kind verscheuchen lassen. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel stand.
„Helfen! Helfen will sie!“, keifte er und ließ sich in seinen Thron fallen. Diesen nahm er auf jeder Reise mit, immer. Damit auch ja jeder wusste, dass er der König war. Die Bediensteten, die leise in den Schatten des Zeltes standen und auf Befehle warteten, schwiegen. Aber Anna spürte ihre Blicke wie Schläge. Verachtung, Hochmut, Spott.
Als einzige Prinzessin dieses Landes sollten die Diener mehr Achtung vor ihr haben. Hatten sie aber nicht. Nur, weil sie ihm die Stirn bot. Nur deswegen wurde sie wie der niederste Sklave behandelt, wie der Dreck unter der Schuhsohle des Stallburschen. Ohne Strafe, ohne Konsequenzen. Bisher hatte sie es einfach hingenommen. Hatte hingenommen, dass ihr eigener Vater sie am liebsten tot sehen würde und ihre Mutter machtlos danebenstand. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten, die Nägel gruben sich schmerzhaft in ihre Handflächen. Ihr Hass brannte stark und wild in ihrem Herzen.
Dieses Mal hatte er es zu weit getrieben. Er hatte Finn in den Krieg geschickt. Ihren Finn, ihren Zwillingsbruder. Sie waren ein Herz und eine Seele, unzertrennbar. Zwar war er nicht so aufwieglerisch wie sie, aber er hatte das Herz am rechten Fleck und war kein Speichellecker wie alle anderen. Sie liebte ihn, wie nur eine Schwester es konnte.
Wenn ihr Vater wieder raste und tobte, wusste ihr Bruder sie zu beruhigen. Nur Finn gelang es, sie von ihrem Hass und ihrer Wut abzulenken. Nur er vermochte sie so zu beruhigen, wie es nicht einmal ihre Mutter vollbrachte.
„Ich lasse nicht zu, dass du ihn ermordest!“, donnerte sie und hob das Kinn. Die Worte waren aus Wut und Angst geboren. Angst um ihren Bruder. Der zu wenig Kampferfahrung hatte, der zu gutgläubig war, zu sanft. Kalt bohrten sich die toten und habgierigen Augen ihres Vaters in ihre. Hitze kroch, gefüllt von Wut, in Anna empor.
Ihr Vater war in den mittleren Jahren. Aber noch immer trug er das Haar voll und stark unter seiner Krone. Fältchen gruben sich über seine Gesichtszüge. Keine Krähenfüße, die von häufigem Lächeln gesprochen hätten. Sondern tiefe Furchen um seinen mürrischen Mund. Eine regelrechte Spalte vertiefte sich zwischen seinen Brauen, die er immerzu mürrisch zusammenzog. So wie auch jetzt.
„Du wagst es, so mit mir zu sprechen? Deinem König?!“, wollte er wissen und erneut zitterten die Zeltwände. Seine tiefe Stimme traf sie wie ein Peitschenhieb. Trotzig sah sie ihm dennoch entgegen, hielt seinem lodernden Blick stand.
Ihr König.
Bittere Galle stieg ihr die Kehle empor. Das war aber auch das Einzige, was er für sie war. Ihr König, ihr Laster, ihre Qual. Schon als Kind hatte er sie geschlagen und eingesperrt. Je älter und rebellischer sie wurde, desto schlimmer wurde es. Nie hatte er verstanden, dass Wut und Groll einem aufmüpfigen Kind nicht halfen, es nicht bekehren konnten, sondern die eigenen Gefühle von Wut und Hass nur noch verstärkten. Er sorgte mit seinem Verhalten dafür, dass sie sich tiefer und tiefer in ihre Seele brannten, bis sie nicht mehr zu entfernen waren.
Auch am heutigen Tage hatte er versucht, sie einzusperren, damit sie seinen Plänen nicht zuwider handeln konnte. Wie schon so oft war sie entkommen. Es gab keine Tür, kein Schloss, dass sie halten konnte. Und das wusste er. Die Erkenntnis schürte seinen Zorn, ließ es ihn immer und immer wieder versuchen.
Vergebens.
Alles hatte sie akzeptiert. Hatte sich beschimpfen, schlagen, verachten lassen. Egal, ob von ihm, oder den Dienern. Egal, ob öffentlich oder in den abgeschiedenen Räumen des Schlosses. Viel konnte sie ertragen. Aber nicht das. Nicht, wenn es um Finn ging.
Dieses Mal war er zu weit gegangen.
Anna würde es nicht akzeptieren.
Jetzt ging es nicht um sie, sondern um ihren Bruder, ihren Finn.
„Finnwick weiß, was er zu tun hat. Schafft er es nicht, ist er schwach. Ein schwacher Herrscher ist gar kein Herrscher.“
Und mit diesen harschen, kalten Worten ohne Mitgefühl oder auch nur einem Funken des Zweifels war es für ihn beendet. War man nicht stark genug, wurde man eliminiert. Konnte man nicht standhalten, überrollt. Nur der Starke überlebte, herrschte.
Anna wusste, wie stark ihr Bruder war. Er war fähig, aber noch jung. Er hatte zu wenig Erfahrung. Gegen normale Gegner würde er bestehen, daran glaubte sie fest.
Aber nicht gegen ihn. Nicht gegen den schwarzen König.
Dieser Mann war ein Monster, eine Bestie. Der stärkste Krieger würde gegen ihn verlieren, auch ihr Bruder. So sehr die bitteren Worte ihres Vaters ihn auch aufgestachelt haben mögen, er würde nicht siegen können.
„Kannst du wirklich mit dieser Last leben? Deinen eigenen, einzigen Sohn getötet zu haben?“, wollte sie mit ruhiger Stimme wissen. Zornige Worte, eine laute Stimme, hätten nichts gebracht, nichts bewirkt. Die Worte mussten weise gewählt werden, auf den kleinen Rest an Herz heranreichen, der noch in der Brust des toten Königs übrig geblieben war. Die Schatten bewegten sich bei ihren ruhigen Worten, als die Diener entrüstet zu tuscheln begannen. Ihr Vater bemerkte es, sah zur Seite. Seine Mundwinkel zuckten. Ihm gefiel es. Er genoss es, dass sie die Ausgestoßene war, die Geächtete. So bot er keine Ruhe, wie es jeder andere Herrscher getan hätte, hätten die Bediensteten es gewagt, ein Gespräch mit ihrem Getuschel zu stören. Er ließ sie einfach reden, gewährte ihnen freie Hand.
Der Zorn schlug mit spitzen Klingen um sich, doch Anna beherrschte sich. Es stand Wichtigeres auf dem Spiel, als ihr Stolz.
„Der Junge wird stehen oder sterben. Damit habe ich nichts zu schaffen. Es liegt ganz bei ihm“, meinte der König gelassen und nahm einen großen Schluck aus seinem Kelch. Entspannt wandte er sich halb ab, grinste höhnisch, als das Getuschel der Schatten lauter wurde. Für ihn war es alles nur ein Spiel. Ein Spiel, das ihn zum Sieg führen sollte. Während er selbst sicher in seinem Zelt verweilte. Und sein einziger Sohn, sein Favorit unter den Geschwistern, starb.
Die Stacheln der Wut zuckten durch ihre Brust und sie handelte unbewusst. Aber mit voller Wucht. Mit einem klatschenden Geräusch traf ihre Hand die des Königs, schlug ihm den Kelch aus den Fingern. Wein spritzte in die Luft, tropfte auf die feine Robe des Herrschers, landete auch auf ihrem eigenen Gesicht. Klirrend rollte der Kelch anschließend über den Boden. Das Geräusch ohrenbetäubend in der erstarrten Stille des Zeltes.
„Du Monster!“, schrie sie und durchschnitt diese Stille mit ihrer lauten Stimme. Die Augen des Königs funkelten. Es war die einzige Warnung.
Dann kam der Schlag, riss sie von den Füßen. Schmerz explodierte in ihrer Wange, zog bis hoch in die Schläfe und umfasste den gesamten Kiefer. Nicht mit der flachen Hand hatte er sie geschlagen, sondern mit der vor Wut geballten Faust. Anna schmeckte Blut auf der Zunge, als sie sich ihm trotzig zuwandte, ihn rasend vor Zorn anstarrte.
„Pass auf, was du sagst!“, donnerte der König, stand drohend über ihr. Vor Wut zitternd hielt sie ihm auch noch die andere Wange hin. Ihre Blicke trafen sich. Hass traf auf Hass, brannte sich tief in sie. Ihr Herz raste vor Wut, das Blut rauschte in ihren Ohren, dass sie ihren eigenen Herzschlag nicht nur fühlen, sondern auch hören konnte.
Die Stirn des Königs legte sich in Falten, seine Augenbrauen zuckten vor Wut zusammen. Er sah alt aus.
Die Luft um sie herum lud sich auf, spannte sich an. Es würde so enden, wie jedes Mal. Er würde sie vor allen erniedrigen, schlagen und beschimpfen. Sie würde mit hochgehobenem Kopf davon schreiten. Denn es war ihr egal. Die Wut erstarrte in ihrem Innern und begann sich langsam zu legen.
Ihr war alles egal. Wer den Krieg gewann, wer lebte und starb, alles. Nur ihr Bruder nicht. Neben ihrer Mutter war er das Einzige, was ihr geblieben war. Und das würde sie nicht aufs Spiel setzen, nicht seinetwegen. Anna fasste einen Entschluss. Er wollte seinem eigenen Sohn, dem Thronerben, nicht helfen? Gut, dann würde sie es tun. Als hätte er ihre Gedanken an ihren Augen abgelesen, vertiefte sich die Falte zwischen seinen Brauen, wurden die Züge um seinen Mund noch tiefer, noch mürrischer.
Gerade setzte ihr Vater zum neuerlichen Schlag an, da war Tumult vor dem Zelt zu hören. Seine Hand verweilte in der Luft, während er zum Eingang schaute. Erst Hufe, dann waren eilige Schritte zu vernehmen. Der Kundschafter war eingetroffen. Die Hand des Königs senkte sich langsam wieder, ein zufriedener Ausdruck breitete sich auf seinem Gesicht aus, konnte die Falte auf seiner Stirn aber nicht glätten.
„Bringt die Prinzessin fort“, donnerte der König und winkte sie davon. Hatte sich schon voller Desinteresse abgewandt. Bevor Anna auch nur ein Wort hätte sagen können, waren zwei Diener bei ihr, rissen sie grob auf die Füße und stießen sie aus dem Zelt. Der Kundschafter hatte nicht mal den Anstand, sich vor ihr zu verneigen oder sie gar zu beachten.
Wie tief Anna doch gesunken war. Bittere Selbsterkenntnis stieg in ihr auf.
Erbost riss sie einem der Diener ihren abgetragenen Umhang aus den Händen, schlüpfte hinein und bestieg ihr Pferd wie ein Mann. Verachtung war in den Mienen der Männer zu lesen. In ihrer eigenen nur Spott. Was ging es sie an, wie sie ritt? Was ging es sie an, was sie sagte oder tat? Nichts. Überhaupt nichts. Also war ihr die Reaktion der Diener egal, das abwertende Verhalten belustigte sie sogar.
Mit hochgehobenem Kinn und brennender Wange gab sie ihrem Pferd die Sporen und galoppierte davon. Es tat gut, den vertrauten Pferdekörper unter sich zu spüren, das gleichmäßige Auf und Ab der Muskeln zu fühlen. Langsam verebbte die Wut in ihr, ließ ihre Gedanken wieder klarer werden. Erst da spürte sie, wie die Luft ihr kalt ins Gesicht schnitt. Der Wind riss an ihrer Kapuze, schleuderte sie mit ihrem Haar nach hinten. Der Knoten hatte sich schon seit Stunden gelöst und rostrotes Haar umgab ihr blasses Gesicht. Sie hatte das Lager des Königs binnen Minuten verlassen, war auf geradem Weg direkt in die Schlacht. Ihr Plan war geschmiedet, ihr Ziel stand fest. Ohne nachzudenken, lenkte sie ihr Pferd also so dicht an den Rand des Schlachtfeldes, wie sie konnte. Ihre Augen hielten stetig nach Finn Ausschau. Die Männer bemerkten sie, sahen sogar zu ihr herüber. Aber niemand verscheuchte sie oder warnte sie. Die Wachen und Kämpfer sahen ihr nur nach, ein paar riefen ihr sogar Verwünschungen hinterher. Aber kein einziges Wort der Warnung.
Sie wären froh, wenn Anna in dem Durcheinander umkäme.
Doch so dumm war sie nicht. Ein widerwilliges Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Wäre sie dumm gewesen, wäre sie schon vor Jahren gestorben. Kopfschüttelnd lenkte sie ihre Gedanken und ihr Pferd wieder nach vorne. So schnell es konnte, ließ sie ihr Pferd laufen, mitten durch die Kämpfenden hindurch. Keiner rührte sie an, stellte sich ihr in den Weg. Dafür war auch gar keine Zeit. Zu brutal war die Schlacht. Zwar befand sie sich noch immer am Rand, doch die Kämpfe waren auch hier bestialisch. Überall Blut, überall Schmerz und Leichen. Der Geruch von Feuer, verbranntem Fleisch und Fäulnis lag in der Luft. Machte sie schwer und unmöglich zu atmen. Schreie gellten über die Ebene, das Klirren von Schwertern toste hinterher. Männer brüllten, Pferde wieherten, Pfeile schossen dahin.
Anna schlug das Herz bis zum Hals. Kalte Angst umschloss es. Sie hatte viel von Schlachten und Kämpfen gehört und auch gelesen. Hatte ihren Bruder trainieren sehen. Aber noch nie war sie selbst dabei gewesen, hatte die schwere Luft auf der Haut gefühlt, den Geruch von Tod und Schmerz eingeatmet. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als sie an einem erschlagenen Mann vorbeikam. Das Schwert des Gegners steckte ihm noch in der Brust. Seine Augen waren glasig, tot. Wie betäubt wandte Anna sich ab, blickte über den langen Pferdehals zur anderen Seite, suchte weiter.
Was, wenn er schon gefallen war? Tot irgendwo lag, wie dieser fremde Soldat? Anna schüttelte heftig den Kopf, drängte die aufsteigenden Tränen eisern zurück. Nein, solche Gedanken durfte sie nicht zulassen. Sie würden sie nur zurückhalten, sie ausbremsen.
Mit wild schlagendem Herzen galoppierte sie weiter, trieb ihr Pferd immer wieder an, kaum dass es Anstalten machte, langsamer zu werden. Sie kam der tobenden Schlacht im Zentrum des Feldes immer näher. So manch einem Schwert oder Pfeil hatte sie schon ausweichen müssen. Nur gut, dass niemand eine Gefahr in der galoppierenden Reiterin sah. Man schenkte ihr meist nicht mehr als einen verwunderten Blick. Anna ritt immer weiter, suchte unablässig. Allmählich wurde die Hoffnung immer kleiner in ihr, die Angst dafür immer und immer größer. Gerade versuchte diese sie vollends zu verschlingen, als sie ihn sah. Endlich. Ihren Bruder. Dort saß er auf seinem weißen Schimmel und erschlug einen Mann zu seinen Füßen. Das Blut spritzte aus dem übrig gebliebenen Halsstumpf.
Entsetzen durchfuhr sie wie ein Schlag, ersetzte die aufkeimende Hoffnung und Erleichterung wie ein Blitz. Fast entglitten ihr die Zügel. Nein, das konnte nicht ihr Bruder sein. Das war er nicht. So hart, fast schon kalt. Wie ihr Vater.
Doch es war sein Haar, das da hinter ihm im Wind wehte. Die gleiche Farbe wie ihres, nur kürzer.
„Finn!“, rief Anna mit allem, was ihre Lungen hergaben. Hatte angefangen, zu schreien, bevor sie es selbst begriff. Noch immer konnte sie ihn nur fassungslos anstarren. Wann war er so geworden? So kalt, so brutal? So vollkommen ohne Mitleid? Schmerz bohrte sich in ihr Herz und ließ es schneller schlagen. Taubheit breitete sich mit jedem weiteren Zucken des schmerzenden Muskels in ihr aus. Tränen rannen ihr unbemerkt über die eiskalten Wangen.
„Finn!“
Erst hörte er sie nicht, doch dann sah er auf, Entsetzen in seinen Augen, als er sie sah. Schnell schüttelte er die Überraschung ab und kam auf sie zu. Finn erschlug jeden, der ihm im Weg war. Egal, ob Freund oder Feind. Seine Augen blitzten. Sie erkannte Wut und Zorn. Fassungslos schüttelte Anna den Kopf. Nein, das konnte nicht sein. Das war nicht möglich! Er war … er war genau wie ihr Vater. Die gleichen groben, unerbittlichen Züge, die gleichen hasserfüllten Augen. Das Spiegelbild des Königs legte sich für den Bruchteil einer Sekunde über die Züge ihres Bruders. Ein Blinzeln später war es verschwunden. Würde aber immer in ihrem Herzen brennen wie eine Fackel im Sturm.
Kälte umgab sie, ließ sie zittern. Finn war genau wie er … sie war … zu spät. Es gab niemanden mehr zu retten, ihr Bruder war … fort.
Hörner dröhnten, ließen den Boden unter ihr erbeben. Ihr Pferd stieg, warf sie fast ab. Aus ihrer Starre gerissen, griff Anna hektisch nach den Zügeln. Ihr Herz schlug schmerzhaft in der Brust. Panik erfüllte sie. Krampfhaft versuchte sie, ihr Pferd wieder unter Kontrolle zu bringen, krampfte die Beine um den sich in wilder Panik aufbäumenden Leib zusammen.
Sie fiel nicht, konnte sich gerade so auf dem wilden Tier halten. Aber etwas anderes fiel. Direkt vom Himmel schien er zu stürzen.
Der schwarze König.
Wie sein Name es verlangte, ganz in Schwarz, mit wehendem Umhang schien er einfach auf das Schlachtfeld gestürzt zu sein. Kaum berührten seine Füße den Boden, spritzte Blut, rollten Köpfe und fielen Männer in Massen. Mit nur einer Hand erschlug er gleich drei Mann. Sein Schwert fuhr durch die Luft, schleuderte das Blut von der glänzenden Klinge.
Schwärze legte sich über das Schlachtfeld. Die Geräusche verstummten, alles wurde still.
Von ihrem Pferd aus hatte Anna einen guten Blick auf sein Gesicht. Kalt, emotionslos, herzlos. Er schlachtete alle ab, ohne die Miene zu verziehen. Wie ein Todesengel.
Eiskalt lief es ihr den Rücken hinunter, stockte ihr der Atem. Vollkommen verstört, sah sie wieder zu ihrem Bruder und erstarrte.
Auch Finn beobachtete den schwarzen König. Mit einer perversen Faszination verfolgte er jede seiner Bewegungen genau. Aber das war es nicht, was sie so schockierte und ihr die Luft aus den Lungen trieb.
Sondern der bewaffnete Krieger zu seiner Linken, der auf ihn losging. Finn sah ihn nicht, keiner sah ihn. Alle starrten nur den Todesengel mitten auf dem Schlachtfeld an.
„Finn! Pass auf!“, schrie Anna so laut sie konnte, riss sich aus ihrer Starre und rief erneut den Namen ihres geliebten Bruders. Panik und Angst machten es ihr fast unmöglich zu atmen, ließen das Blut laut in ihren Ohren rauschen.
Ihr Bruder schien durch ihren Ruf aus seiner Trance zu erwachen, wirbelte herum und wehrte den verhängnisvollen Schlag ab. Klirrend schlugen die Klingen zusammen und Anna konnte wieder frei atmen. Er war gerettet. Vorerst. Der einfache Krieger war keine Gefahr für ihn. Dafür aber jemand anderes umso mehr.
Erneut huschte ihr Blick zu dem schwarzen König.
Und erneut erstarrte sie. Genau in diesem Moment ging ihr Pferd durch. Hielt es die angespannte Atmosphäre von Angst, Blut und Tod nicht mehr aus. Hart wurde Anna nach hinten geschleudert, als das Pferd mit aller Macht nach vorne stürzte. Ihre Finger verloren den Halt an den Zügeln, sie rutschte ein Stück nach hinten. Nur das beherzte Zugreifen ihrer Hände und die lange Mähne bewahrten sie vor einem Sturz. Ihr Herz schlug viel zu schnell, Angst raste durch jede Faser ihres Körpers. Das Haar flog ihr ins Gesicht, trübte ihren Blick, ließ die Welt in einem rostroten Feuer verschwimmen. Und doch konnte sie den Blick nicht abwenden, den Kopf nicht drehen.
Ihre Augen waren gefesselt.
Vom anderen Ende des Schlachtfeldes aus nahm der Blick aus farblosen, eiskalten Augen sie gefangen. Es war nicht schwer zu erraten, wem diese Augen gehörten.
Der schwarze König sah sie direkt an, sah tief in sie hinein, bis in die tiefsten Winkel ihrer Seele.
Auch er wandte den Blick nicht ab, starrte sie an. Keine Gefühle, keine Regung auf seinen Zügen. Der Wind wehte ihr die Haare abermals ins Gesicht und der Moment war vorbei, der Kontakt abgerissen.
Keuchend richtete Anna sich nach vorne, ließ sich vornüber über ihr Pferd fallen. Sie zitterte am ganzen Leib, starrte starr auf das dunkle Fell ihres Reittieres. Die Luft wollte nur unter enormer Gewalt in ihre Lungen strömen, alles drehte sich um sie herum.
Diese Augen. Diese farblosen, kalten Augen …
Kapitel 1
Dunkelheit umgab sie. Schon seit Jahren. Und Stille. Vor allem die Stille. Erst dann kam die Dunkelheit. Die tiefe, tiefe Dunkelheit.
Dann die Stille.
Stille.
Schatten bewegten sich vor ihr. Dunkel, trüb. Müde sah sie auf, ohne wirkliches Interesse. Schon lange hatte sie es aufgegeben, alle Mühe vergebens. Sie konnte ein leises Gespräch hören, achtete aber nicht weiter darauf, machte einfach wieder die Augen zu und trieb, trieb …
Ihre Gefühle waren ebenso wie ihre Gedanken leer, taub. Schon so lange. Sie wusste nicht mehr, wie lange. Die Zeit kam und ging, verging gleichzeitig langsam und rasend schnell. Nicht enden wollend.
Helles Licht blendete sie, riss sie aus ihrem Delirium. Ein leuchtender Fleck erlaubte es, einem Sonnenstrahl in ihr Gefängnis zu gelangen. Sie musste blinzeln, bevor ihre geblendeten Augen wieder etwas sehen konnten. Die Helligkeit war sie nicht mehr gewohnt, das Licht. Wo es an diesem Ort doch nur so wenig davon gab. So wenig Licht … so wenig Hoffnung, fast gar kein Leben.
Neugierig richtete sie sich auf. Ihr Körper bewegte sich schwerfällig, langsam. Sie hatte sich schon lange nicht mehr bewegt. Lag einfach hier. Im Dunkel, in der Stille. Der Bedeutungslosigkeit. Es kostete sie enorme Anstrengungen, sich zu bewegen, das eigene Gewicht nach all der Zeit wieder auf den Beinen, den Füßen zu spüren. Ein gleichsam ungewohntes, wie vergessenes Gefühl. Es dauerte schier Jahrzehnte, bis sie endlich schwankend stand, sich nur gerade so auf den eigenen Beinen halten konnte. Bis es ihr gelang, noch immer von Neugier getrieben, näher an dieses helle Fleckchen Licht zu treten, das so viel Geheimnis wie Hoffnung in sich trug.
Blinzelnd trat sie näher, hielt sich mit schwerem Arm die Hand vors Gesicht. Jede Bewegung war schwerfällig, langsam. Ungeübt und rostig. Ihr eigener Körper fühlte sich fremd an, beklemmend. Als sie die Hand sinken ließ, musste sie mehrfach blinzeln, bevor ihre die Dunkelheit gewöhnten Augen etwas erkennen konnten. Gespannt spähte sie durch das faustgroße Fenster ihres Gefängnisses.
Zu Anfang hatte sie geschrien, getobt. Alles umsonst, immer umsonst.
Irgendwann hatte sie geschwiegen, war komplett verstummt. Wie ihre Stimme klang, wusste sie nicht mehr, interessierte sie auch nicht mehr. Wozu sprechen, wenn sie sowieso niemand hören konnte?
Die Zeit verging langsam, kriechend. Aber ihr Haar wuchs, schnell, rasant. Binnen kürzester Zeit war es ihr weit über den Rücken bis zu den Schenkeln gekrochen. Was ihr erst jetzt richtig bewusst wurde, da sie stand, die langen Flechten lose hinabhängen konnten.
Gestanden hatte sie lange nicht mehr, immer nur dagelegen. Dagelegen und gewartet.
Worauf wusste sie nicht.
Vielleicht auf den Tod? Auf Rettung?
Sie konnte sich nicht erinnern, es war ja auch egal.
Denn es gab weder Tod noch Rettung. Nur das Nichts.
Ihre Beine schmerzten als sie nun mit zitternden Gelenken vor dem kleinen Fenster stand und hinaussah.
Es war erstaunlich.
Zwei Männer unterhielten sich vor ihr, gestikulierten in ihre Richtung. Aber sie sahen sie nicht. Niemand sah sie. Niemals.
„Der dürfte in Ordnung sein“, sagte der eine Mann. Der Klang seiner Stimme war wie eine Offenbarung für sie. So lange hatte sie niemanden mehr sprechen gehört, keine Worte mehr vernommen. Es war fast wie ein kleines Wunder jetzt wieder in der Lage zu sein etwas zu hören. Der Mann hatte einen traurigen Blick. Seine Haare waren schon zurückgegangen, sein Gesicht alt. Genauso alt wie seine Kleidung. Lachfalten umrahmten seine Augen, müde Augen.
Sie selbst war auch müde, so müde.
„Oder doch den kleineren der zwei?“
„Nein, der hier ist schon in Ordnung. Komm, wir müssen uns beeilen.“
Der zweite Mann hatte freundliche Augen, war jünger. Seine Stimme, ein sanfter Bariton. Das Haar noch dicht und kräftig. Wie eine Ertrinkende saugte sie den Anblick, die Stimmen dieser zwei Fremden in sich auf. Hielt daran fest, als wäre es ihr Rettungsanker.
Kaum waren die Männer da, verschwanden sie auch schon wieder, ließen sie allein in ihrem Gefängnis zurück. Nur der einsame Lichtstrahl verblieb, tauchte das einsame Nichts in ein dreckiges Grau, eine verwaschene Erinnerung an das Leben.
Ihre Beine trugen ihr Gewicht nun relativ gut, hielten sie aufrecht. Also blieb sie stehen, sah sich weiter um. Kämpfte gegen das Gefühl der Verlassenheit an und wollte sich ein wenig mehr von diesem faustgroßen Wunder behalten.
Sie sah viele alte Möbel. Einige vergilbte Lampenschirme. Und ein Schild. Doch es blieb keine Zeit, um es zu lesen. Die fremd gewordenen Buchstaben zu entziffern. Schritte näherten sich. Sie sah auf, erkannte die beiden Männer wieder. Ein dritter folgte. Langsam, gebrechlich. Der Klang ihrer Schritte war ebenso ungewohnt, wie ihre Stimmen es gewesen waren.
Ein alter Mann, gebeugt von Gicht und der Last des Lebens, folgte den Fremden. Doch seine Augen waren klug, nicht vom Alter verhangen oder trüb.
„Ein Prachtexemplar. Sie haben ein gutes Auge“, meinte er mit einer Stimme, die genauso alt und zerknittert klang, wie sein Gesicht aussah. Diese vor Leben sprühenden Augen sahen genau durch ihr kleines Fenster. Direkt zu ihr. Ihr Herz machte einen schmerzhaften Satz in ihrer Brust. Hoffnung keimte auf, erfüllte sie wie warmes Sonnenlicht. Ihre Hand legte sich auf die Scheibe, berührte das kalte Glas. Das Gefühl war bekannt und gleichsam ungewohnt. Erinnerungen huschten durch ihren Geist. Wie oft hatte sie an dem Glas gestanden? Wie oft es berührt, darauf eingeschlagen. Schmerz schwemmte ihre Gedanken.
Die Augen des Mannes wanderten weg, schweiften in die Ferne.
Ihre Hand sank hinab, hing leblos an ihrer Seite.
Tränen rollten ihre Wangen hinunter.
Er sah sie nicht.
„Der Rahmen gefällt mir besonders gut“, meinte der jüngere der beiden fremden Männer und strich darüber. Der Rand des Gefängnisses wurde heller, Licht brach hindurch, als er dabei auch das Glas sacht berührte und den Schmutz davon wischte.
Langsam zog sie sich zurück, kroch wieder in das Dunkel. Weg von dem Licht. Sie zitterte. Angst beherrschte ihren Geist. Tränen rannen ihre Wangen in einem stummen Schrei hinab.
Müde. Sie war so müde.
Zusammengerollt legte sie sich mit dem Rücken zum Glas hin, schloss die Augen, zählte.
Eins, zwei, drei …
„Er ist etwas ganz Besonderes“, erklang die Stimme des alten Mannes hinter ihr.
… vier, fünf, sechs …
Die Sonne ging gerade unter und malte den Himmel in den Farben des Feuers. Blutrot kroch sie über die Wiesen, küsste die Baumwipfel, ergoss sich in goldenes Licht über den sterbenden Himmel. Er stand am Fenster und sah hinaus. Langsam versank die rote Feuerkugel und verschwand hinter dem Horizont. Dann war es dunkel, kalt.
Seine Augen fixierten sein Spiegelbild in den Scheiben. Farblose Augen sahen ihm entgegen, erwiderten seinen Blick.
Kalt wie Stein, farblos wie Eis.
Die Augen eines Monsters.
Vor seinem inneren Auge tauchte jedoch das Bild von flammenden, brennenden Augen auf. Ein strahlendes Grün, das zum Rand hin immer dunkler wurde und in einem wunderschönen Braun endete.
Ihre Augen.
Ihm war nach seufzen zumute, aber kein Laut entwich seinen Lippen, kein Geräusch durchschnitt die Nacht. Die Lampe hinter ihm duellierte sich mit dem Licht des Mondes. Er war nur halb voll, würde erst in einigen Wochen wieder rund am Himmel stehen.
Einsam und silbern.
Es klopfte an der Tür. Vom Anblick der Nacht losgerissen, drehte er sich geräuschlos um.
„Eintreten“, sagte er leise und dennoch durchschnitt seine Stimme die Nacht. Sofort wurde die Tür geöffnet und ein junger Mann trat ein, die Kappe nervös in den Händen knetend.
„Eure Majestät“, verneigte er sich unsicher.
Schnell winkte er ihm, sich wieder aufzurichten. Es war eher lästig als schmeichelhaft.
„Wir haben, was Sie wollten, Herr“, sagte der Mann, sah ihm dabei nicht in die Augen. Das tat niemand. Ein trockenes Gefühl breitete sich in seiner Magengegend aus. Wie es dies immer tat, wenn ihm dieser Umstand gewahr wurde.
„Stellt ihn dort hin“, wies er die beiden Männer knapp an und setzte sich an seinen Schreibtisch. Scheinbar desinteressiert unterschrieb er erst noch einige Dokumente, bevor er aufsah. Dabei war die Neugier drängend und stark in ihm. Hörte er doch das Schaben von Holz auf Holz, das geschäftige Rücken eines großen Gegenstandes. Er war endlich hier.
Sein Gesichtsausdruck änderte sich nicht, aber innerlich war er überrascht, als er es sich gestattete aufzusehen.
Das Stück war von einer erlesenen Schönheit.
Silbrig schimmerte der Rahmen im Licht der Lampen. Feine Ornamente waren eingraviert worden, Muster umspielten sie fast schon neckisch. Und doch war die Erscheinung kühl und elegant.
Es erinnerte ihn an den Mond.
Kaum waren die Männer fertig, den mannshohen Spiegel aufzustellen, verschwanden sie auch schon nach einer raschen Verbeugung und schlossen leise die Tür. Mehr ängstlich, als respektvoll. Das taube Gefühl in ihm verstärkte sich, bekam aber keine Beachtung geschenkt. Zu bekannt war es, zu oft trat es in ihm auf, als noch von Interesse zu sein.
Neugierig trat er näher, besah sich den Rahmen genauer. Der Spiegel war mannshoch und rechteckig, mit spitzen Ecken und abgerundeten Kanten.
Frisch poliert strahlte ihm sein eigenes Spiegelbild entgegen.
Ein großer Mann, komplett in Schwarz gekleidet, mit Haaren so dunkel wie die schwärzesten Schatten. Nachdenklich musterte er sich selbst, wie er mit hinter dem Rücken verschränkten Armen vor dem Spiegel stand. Seine Gesichtszüge waren anders, zu elegant, zu glatt. Genauso wie seine Bewegungen. Geschmeidig und fließend. Manche sagten, er trüge Elfenblut in sich, andere, es wäre das Blut des Teufels.
Sie hatten alle nicht unrecht. Ein bitteres Lächeln stahl sich auf sein Gesicht, ließ seine Augen leuchten.
Kalt wie Eis.
Mehrere Dienstmägde trugen frische Laken durch den Flur, hielten sofort in ihrem Gespräch inne, wichen zurück und verneigten sich tief, als er an ihnen vorbei schritt.
Er würdigte sie keines Blickes.
Zu heiß brodelte die Wut in ihm, betäubte sie jeden weiteren Gedanken, jedes andere Gefühl. Kaum, dass er sie passiert hatte, liefen die Frauen eilig weiter, sagten aber kein Wort mehr. Zu groß war die Furcht vor seinem Zorn.
Berechtigt.
Heute war der schlechteste Tag seit Langem, in welchem man ihn am besten nicht einmal ansah. Die Diener beeilten sich, die Türen des Thronsaales zu öffnen, doch da war er schon an ihnen vorbei und stieß die Türen selbst auf, dass sie gegen die Wände schlugen. Laut krachten sie gegen die dicken Mauern.
„Was willst du hier?!“, hielt er sich nicht lange auf und marschierte an dem jungen Mann vorbei, zu seinem Thron. Hoch ragte die Rückenlehne auf, fing den Blick sofort ein, mit ihren eingravierten Mustern und besetzten Edelsteinen. Ein Zeichen der Macht, ein Zeichen der Herrschaft.
Seiner Herrschaft.
An dem Zentrum seiner Macht angekommen, ließ er sich geschmeidig nieder, schlug die Beine scheinbar nachlässig übereinander. Sein Gehrock fiel locker zu den Seiten seiner Beine über die Sitzfläche. Die Geste konnte Ruhe, Gelassenheit ausdrücken, doch bei ihm war es anders. Bei ihm war alles anders. Seine Geste drückte kontrollierte Stärke, beherrschte Macht aus. Sie weckte Furcht und vermittelte keine Ruhe. Ganz im Gegenteil.
„Meinen Lieblingscousin besuchen“, antwortete der stehen gelassene Mann grinsend. Ihn konnte nichts aufwühlen, jedes Gefühl der Angst war ihm vollkommen fremd.
Aurelio Caillean. Ein weit, weit entfernter Verwandter, der sich der einfachheitshalber selbst als seinen Cousin bezeichnete.
„Es heißt, der große Raven Lhiannon hätte das Königreich der Sonne besiegt. Ich wollte mich nur vergewissern, dass dies auch der Wahrheit entspricht“, zwinkerte Aurelio ihm zu.
Das Königreich der Sonne lag tatsächlich in seiner Hand. Der Krieg, der fünf Jahre währte, war geschlagen. Seine Truppen hatten die Hauptstadt und den Palast besetzt. Der König saß noch auf seinem Thron. Aber nur, weil Raven es so wollte.
Er zeigte sich gnädig, nahm seinem Feind nicht alles, was er hatte, sondern ließ ihn auf seinem hohen Ross. Nur um ihn so bald wie möglich wieder hinunterzustoßen.
Der Plan dafür lag schon auf seinem Schreibtisch. Bald war es so weit.
„Natürlich wollte ich mich auch nach deinem Wohlergehen erkunden“, meinte Aurelio da vollkommen ernst. Seine Augen glitzerten kurz und ließen das helle Grün lebendig wirken. Aurelio war das genaue Gegenteil von Ravens eigener, dunkler Erscheinung. Er war blond, von stattlicher Natur. Sein Haar trug er zu einem kurzen Zopf im Nacken gebunden. Sein Gesicht war das eines Engels. Hohe Wangenknochen, volle Lippen und ein markantes Kinn.
Raven war auch hochgewachsen. Doch seine Schultern waren breit, sein ganzer Körper von Muskeln bedeckt. Sein Gesicht war allenfalls schön. Seine Augen waren zu schmal, zu kalt. Die Pupillen schon fast transparent.
Wo Aurelio elegant und leidenschaftlich war, war Raven geschmeidig und eiskalt.
Jedermann zuckte zusammen, kaum dass er einen Blick auf ihn warf. Spätestens wenn man in seine Augen blickte, ergriff man die Flucht.
Der schwarze König mit dem farblosen Blick.
Das war er.
„Hast du sie gefunden?“, drangen Aurelios Worte zu ihm durch und holten ihn wieder in den Thronsaal zurück. Sein Cousin stand vor einer Vase voller Blumen und fuhr spielerisch mit den Fingern über die Blütenblätter. Raven hatte nicht bemerkt, wie der Mann seinen Standort gewechselt hatte.
„Woher weißt du davon?“, wollte er nach einer Weile des Schweigens schließlich wissen. Er wusste, dass seine Augen nun in einem farblosen Feuer brannten. Niemand wusste von seiner geheimen Mission. Von dem Drang, der ihn die letzten fünf Jahre verfolgt hatte, wie ein gejagtes Tier.
„Ein Vögelchen hat es mir geflüstert“, begann Aurelio und wandte sich von den Blumen ab, ihm zu. „Es heißt, der schwarze König sei noch ungehaltener, seit er eine gewisse Frau auf dem Schlachtfeld gesehen habe.“
Das grüne Leuchten der Augen seines Cousins bohrte sich in seine, wollte seine Seele ergründen, seine Gefühle lesen. Raven ließ es nicht zu und kapselte alles ab, verschloss sich innerlich. Es ging niemanden etwas an, was er fühlte. Besonders er sollte es nicht wissen. Aurelio war zwar ein guter Mann, zuverlässig und tüchtig, aber er war auch ein Frauenheld.
„Dein Vögelchen wird wohl eine unwahre Vermutung aufgeschnappt haben“, tat Raven sein Geschwätz ab und erhob sich. Ihm war das Gespräch zuwider. Sein Cousin respektierte seinen Stand nicht, sah ihn nicht als König, nicht als Herrscher. Er ging ganz entspannt mit ihm um. Als wäre Raven nicht das Monster, das alle in ihm sahen. Ein Umstand, der ihn selbst verunsicherte. Ein Gefühl, welches der schwarze König über alle Maßen verabscheute. Mit langen und bestimmten Schritten machte er sich auf den Weg zur Tür. Für ihn war das sinnlose Gespräch beendet. Es gab nichts mehr zu sagen. Sein nutzloser Cousin hatte ihn nur erneut für sein eigenes Amüsement benutzt, um seine Reaktion zu sehen. Mehr nicht.
Auf dem Weg aus dem Thronsaal wandte er sich an einen Diener, der an der Wand stand, bereit, seine Befehle entgegenzunehmen.
„Bereitet dem Prinzen ein Zimmer.“ Loswerden würde er seinen Cousin ja ohnehin nicht. Der Mann war sturer, als es selbst Raven vollbrachte.
Die Anweisung war knapp und kalt. Der Diener nickte, verneigte sich tief und huschte davon. Dieses Mal waren die Diener an der Tür schneller, öffneten zügig und er rauschte hinaus.
Er würde schon noch die wahren Absichten hinter dem plötzlichen Auftauchen seines Cousins erfahren. Es mochte eine Weile dauern, doch irgendwann verplapperte sich der Prinz immer. Raven musste nur abwarten.
„Es ist schön, dich wiederzusehen, Cousin“, rief Aurelio ihm mit einem Lachen in der Stimme nach. Raven blickte nicht zurück, ging einfach weiter.
Verwandtschaft war eine unabänderliche Widrigkeit.
Kapitel 2
Sie sah alles, was im Zimmer geschah. Hockte ganz dicht vor der Scheibe, die Arme um die Beine geschlungen und beobachtete das Geschehen. Anna hätte es nicht gedacht, aber es war tröstlich nach all der Zeit wieder sehen zu können, was dort draußen vor sich ging. Zu sehen, wie das Leben aussah, wie es klang, wie es sein könnte.
Augen so kalt wie Eis hatten durch das Glas geschaut. Direkt in ihre gesehen und eine Erinnerung hatte sie getroffen wie ein Schlag. Irgendwo hatte sie diese Augen schon einmal gesehen, ihren Blick auf sich gespürt. Kalt und farblos. Ihr Herz hatte angefangen, ganz sonderbar zu rasen, als sie ihn erblickt hatte.
Den Mann, dem diese Augen gehörten. Gerade saß er an seinem Schreibtisch, ging einige Dokumente durch. Ein Diener stand an seiner Seite. Er schien sein Sekretär oder Berater zu sein. Er war im mittleren Alter, hatte ein gepflegtes Äußeres. Dunkle Haare, tadellos sitzende Kleidung. Ein freundliches Gesicht, das eine Brille mit dünnem Rand zierte. Sein Name war Xeron. Und etwas war besonders an ihm. Denn er behandelte seinen Herrn nicht wie die anderen Diener. Er sah ihn direkt an, sprach offen und hatte keine Angst. Wahrscheinlich schien der König sich deshalb etwas zu entspannen, wenn er in seiner Gesellschaft war. Zwar änderte sich nichts an seiner Miene oder an seiner Haltung, aber Anna hatte beobachtet, wie sich die Schultern des Königs leicht nach unten gesenkt hatten, als der Mann vor einigen Minuten eingetreten war.
„Eine Bauernfamilie am Rande der Stadt klagt über gehäufte Vorfälle mit Dieben.“ Trug Xeron gerade vor und legte seinem König ein Dokument auf den Tisch. Dieser nahm es auf und überflog es. Wie bei allen anderen Dokumenten auch, ob Politik oder geschäftlich, änderte sein Gesichtsausdruck sich kein einziges Mal. Unbeweglich wie Stein.
„Sie sollen vorsprechen und das Problem genau schildern“, sprach der König und legte das Dokument zur Seite. Anna wusste seinen Namen nicht. Er war immer nur der König oder seine Majestät. Nie sprach ihn jemand mit seinem Namen an, nicht mal Xeron. Anna fragte sich, warum sie alle solche Angst vor ihm hatten. Nachdenklich legte sie den Kopf zur Seite. Ihr langes Haar fiel ihr ins Gesicht, schob sich vor ihre Augen. Geübt warf sie ihr Haar in den Nacken, drehte es mit fahrigen Fingern zu einem Knoten. Es war so lang, dass es ganz ohne Haarnadeln oder Kämme oben blieb. Ihre Augen sahen wieder, doch ihr Herz raste noch immer vor Angst. Ihr Körper begann zu zittern. Sie wollte nicht mehr zurück, sie wollte nicht mehr in die Dunkelheit …
Dieser kurze Moment reichte aus, um ihre Gefühle vollends durcheinanderzubringen, ihre Gedanken rasen zu lassen und das Geschehen vor dem Glas aus den Augen zu verlieren. Als Anna sich aus der Dunkelheit ihres Geistes befreite und wieder aufsah, stand der König vor dem Glas. Sah hinein, als würde er sie sehen. Anna sprang so plötzlich auf, dass sich ihr Haar nun doch löste und ihr wieder schwer und lang über den Rücken fiel. Ihre Knie zitterten, ihre Beine schwankten. Alles übertönt von ihrem rasenden Herzen. Mit angehaltenem Atem legte sie eine Hand an die Scheibe und hoffte. Diese Augen konnten sie sehen, das wusste sie. Diese farblosen Tiefen konnten sie sehen, wenn sie wollten. Es war eine tiefe, innere Überzeugung. Der Hoffnungsschimmer in ihrer Dunkelheit. Verzweifelt sah sie in diese Augen, schrie mit ihrem ganzen Herzen, ihrer Seele nach ihm.
„Rette mich“, wisperte Anna. Nur ein Krächzen kam heraus. Ihre Stimme rau und unbenutzt, ein ungewohnter Laut in der ewigen Finsternis ihres Gefängnisses. Der Mann vor dem Spiegel blinzelte überrascht. Hatte er sie gehört? Vor Schreck hielt sie erneut den Atem an, hätte fast einen Schritt zurück gemacht. „Könnt Ihr mich hören?“, krächzte Anna erneut. Noch immer war ihre Stimme brüchig, ungeübt. Die Töne hüpften unkoordiniert in ihrer Kehle umher.
So schnell wie der Anflug der Verwirrung auf das Gesicht des Königs gekommen war, verschwand er auch wieder und er wandte sich langsam ab, kehrte zu seinem Schreibtisch zurück. „Wie sieht es im Süden aus?“, fragte er und wandte sich Xeron zu. Blickte nicht noch einmal zum Spiegel. Die Hoffnung zerplatzte wie eine Seifenblase und Anna blieb alleine in den Schatten zurück.
Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit machten sich in ihr breit, bohrten sich tief in sie und wurden zu einem schmerzhaften, festen Klumpen in ihrer Kehle. Geweint hatte sie lange nicht mehr, seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt drängten die Tränen nach außen, drückte der Kloß in ihrem Hals. „Bitte“, wisperte Anna und ihre Hand rutschte von der Scheibe, fiel leblos an ihrer Seite hinab.
„Bitte“, wiederholte sie erneut und Tränen flossen ihre Wangen lautlos hinab. Warum konnte sie niemand sehen? Warum war sie alleine? Die Schatten krochen näher, zogen sie in die Tiefe, in die Leere.
Schwärze umgab sie.
Es gab keine Hoffnung.
Er saß auf seinem Thron, die Beine lässig übereinandergeschlagen und hörte dem ärmlich aussehenden Bauer zu. Es hatte einige Tage gedauert, bis sich der Mann dazu hatte durchringen können, sich seinem König gegenüberzustellen. Der Bauer sah ziemlich mager und müde aus. Seine Wangen waren eingesunken, seine Arme dünn und seine Hände zitterten. Ob aus Angst vor ihm oder aus Schwäche, das vermochte Raven nicht zu sagen. Die Tochter des Bauern kniete neben ihrem Vater, hielt den Kopf gesenkt. Aber ihre Hände waren zu Fäusten geballt. Raven fing ihre Empfindungen auf und spürte Zorn und Hilflosigkeit. Verzweiflung.
„Bitte, Herr. Diese Banditen kommen jede Woche aufs Neue, rauben uns unser Geld und unser Vieh.“ Trug der Bauer stotternd vor. Sein Blick war fest auf den Boden gerichtet. Zwei Wachen standen hinter den beiden. Raven winkte sie mit einer schnellen Handbewegung zur Seite. Ohne Zögern gehorchten sie und traten zurück, positionierten sich an der Tür. Dennoch wich keine Unze der Anspannung von dem gebeutelten Mann. „Sie verwüsten unser Haus, schlagen alles kaputt und … und …“ Der Mann brach ab und Tränen sammelten sich in seinen Augen. Sein Blick huschte zu dem Mädchen an seiner Seite. „Und sie vergreifen sich an uns“, stellte die Tochter klar. Ihre Stimme war fest und ihre Augen sprühten vor Wut und Hass. Diese Gefühle machten sie mutig. Aber auch übermütig. Es fehlte ihren Worten an Respekt, an Unterwürfigkeit. Ravens Augenbraue schnellte nach oben, ansonsten regte sich nichts in seinem Gesicht. „Sie versuchen es. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ihnen gelingt“, führte die Tochter weiter aus.
Xeron stand an des Königs Seite und räusperte sich nun leise. Raven neigte den Kopf leicht in seine Richtung. „Es könnten Räuber aus dem Süden sein“, meinte sein Berater flüsternd, den Blick auf den Bauern und seine Tochter gerichtet. Raven schwieg. Der Süden war geschlagen, hörte aber nicht auf, Probleme zu bereiten.
„Wir erbitten Hilfe von unserem König. Nur Ihr habt die Macht etwas zu unternehmen“, sprach da die Tochter erneut und sah ihm direkt in die Augen. Ihre waren von einem hellen braun. Doch sie loderten wie der Morgen. Überrascht öffnete sich sein Mund einen Spaltbreit. Keinerlei Furcht. Nur Wut und Zorn.
Eine Erinnerung überkam ihn. Wie er am gestrigen Abend sein Spiegelbild betrachtet und sich an diese ungewöhnlichen Augen erinnert hatte. Erschreckt hatte er geglaubt, sie wirklich im Spiegel gesehen zu haben. Einen Moment hatte ihr Gesicht zwischen ihm und dem Glas aufgeblitzt, dann war es wieder verschwunden. Das Mädchen vor ihm hatte einen ganz ähnlichen Ausdruck auf dem jungen Gesicht.
„Nun gut“, sprach Raven zum ersten Mal seit dem Erscheinen der beiden und erhob sich, schüttelte die unliebsame Erinnerung ab. „Ich werde ein paar Männer zu eurem Dorf schicken. Sie werden sich der Sache annehmen.“
Der Bauer verbeugte sich tief und Erleichterung überzog sein Gesicht. „Ich danke Euch, ich danke Euch vielmals“, haspelte er und drückte die Hand seiner Tochter fest. „Nun geht“, wies Raven die beiden an. Sich noch mehrfach bedankend und tief verbeugend wurden die beiden von den Wachen nach draußen geleitet und die Türen schlossen sich leise hinter ihnen. Gerade wollte Raven sich wieder seinem Thron zuwenden, als eine Stimme in seinem Rücken erklang. „Wie überraschend.“ Sofort schoss seine Hand zu dem Schwert an seiner Seite. All seine Sinne waren binnen eines Wimpernschlages geschärft, jeder Muskel angespannt. Bereit zum Kampf.
Aurelio sah kurz auf, grinste dann breit, bevor er hinter einer großen Vase hervorkam.
„Wie ich sehe immer kampfbereit. Aber lieber Cousin, ich muss dir sagen, der Krieg ist vorbei. Also lege das Schwert zur Seite.“ Xeron, der sich etwas im Hintergrund befand, seufzte leise und schob sich die Brille zurecht. Auch der Berater hatte sich bei dem plötzlichen Klang der Stimme angespannt. „Wie seid Ihr hier hineingelangt?“, wollte er von Aurelio wissen. Dieser lächelte träge, ging zu dem Thron hinauf und lehnte sich lässig dagegen. Die Dreistigkeit sich zu setzen hatte er nicht. Noch nicht.
„Durch die Tür. Einen guten Ausblick hast du von hier oben“, meinte er an Raven gewandt und sah in den Saal hinein. In dem König brodelte es, aber er hielt sich zurück. Je mehr Aufmerksamkeit man diesem Mann bot, desto nervtötender wurde er. „Was willst du hier?“, wollte er wissen und scheuchte Aurelio von seinem Thron weg. „Mich mit dir unterhalten. Es ist schrecklich langweilig. Keine Bälle, keine Damen, mit denen man plaudern kann. Nur Generäle und Soldaten. Nicht mal die Dienstmägde wollen sich unterhalten. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ermüdende Sache.“ Klagte der Prinz mit leidendem Ton. Raven verdrehte innerlich die Augen. „Niemand hat dich gezwungen zu kommen, noch zu bleiben. Xeron zeigt dir gerne den Ausgang.“ Aurelio lachte und es klang, als würde die Sonne aufgehen. Ein überaus unangenehmer Laut in den weiten Hallen seines Thronsaals.
„Aber nicht doch. Ich beabsichtigte nicht so schnell wieder abzureisen.“ Raven verkrampfte sich. Welch unliebsame Offenbarung. Es musste mehr dahinterstecken, wenn sich Aurelio dazu entschloss irgendwo länger als ein paar Tage zu verweilen. Xeron schien die Reaktion seines Königs und dessen Gemütsumschwung zu bemerken, denn er trat vor. „Wie wäre es mit einem Ausritt Prinz Aurelio? Die Wälder sind in dieser Jahreszeit besonders schön. Nicht wahr, mein König?“
Gewagt. Aber Raven verstand den Wink. Auf diese Weise könnte er vielleicht herausfinden, was sein Cousin wirklich im Schilde führte.
„Sicher“, sagte Raven daher nur langsam, bevor er sich umdrehte und den Saal verließ. „Ausgezeichnet. Sie sind ein wahrer Ausbund an Brillianz“, meinte Aurelio in seinem Rücken und es erklang ein Geräusch, als würde er Xeron anerkennend auf die Schulter klopfen. Wenn er nur wüsste. Zielsicher trugen Ravens Füße ihn zu den Stallungen. Er brauchte erst gar nicht den Befehl zu geben, die Pferde satteln zu lassen. Die Diener taten es von selbst. In dem Bemühen, jedem Wunsch ihres Herrn sofort und ohne viel Federlesen folge zu leisten. So war es nur eine Sache von Minuten, bis zwei Pferde gesattelt und bereit bei den Stallungen warteten. Gerade strich Raven über das dunkle Fell seines eigenen Hengstes, als sein Cousin zu ihm stieß. Hatte der werte Prinz sich doch erst umkleiden müssen.
„Eine wahre Schönheit“, sprach Aurelio neben ihm. Raven hob den Kopf und sah, dass sein Cousin das Pferd meinte, welches für ihn gedacht war. Ein weißer Hengst mit kräftigen Beinen und einer edlen Kopfform. „Dagegen sieht mein Hengst zu Hause wie ein alter Klappergaul aus“, meinte Aurelio amüsiert und strich dem Tier über die rosa Pferdenase.
„Dein Reich ist nicht für seine schönen Tiere bekannt“, meinte Raven ausdruckslos und saß auf. Der Stallknecht reichte ihm die Zügel und trat zur Seite, den Kopf gesenkt. Kaum, dass Raven im Sattel saß, spürte er den kräftigen Körper des Tieres, fühlte seine Stärke, seine Kraft. Ruhe kehrte in seinen Geist ein. Auch Aurelio saß auf, dankte dem Burschen und trieb sein Pferd an.
„Wunderbarer Gang“, lobte er, als er das Tier neben Ravens lenkte. In einem lockeren Trab verließen sie die Stallungen, ritten über den Weg zu der hohen Schlossmauer und verließen die Burg. Wachen und Ritter folgten in angemessenem Abstand.
„Bist du nur hier, um über das Tier zu schwärmen oder willst du reiten?“, erkundigte Raven sich gelangweilt. Ihm war nicht nach reden. Er suchte keine nutzlose Konversation, keine Unterhaltung. Wenn er alleine ritt, suchte Raven die Ruhe, den wilden Galopp des Tieres. Das Rauschen des Windes in seinen Ohren, die dahinfliegende Landschaft. Nun ritt er nicht alleine, dennoch stand ihm nicht der Sinn danach, die Belustigung für den Prinzen zu spielen. Am ehesten kam man bei diesem an Informationen, wenn man schwieg und den Mann in Selbstgesprächen zergehen ließ. Welche meist überaus informativ waren.
„Selbstverständlich letzteres, lieber Cousin“, antwortete Aurelio schließlich mit einem verschlagenem Grinsen. Wobei Aurelio zu ahnen schien, dass sich der König nicht leichtfertig auf diesen Ritt einließ.
Ein feines Lächeln breitete sich als Antwort auf Ravens Gesicht aus. Er würde schon noch erfahren, was seinen Cousin hierher getrieben hatte. „Dann gib deinem Gaul die Sporen“, wies er ihn an und galoppierte ohne Vorwarnung los.
„Ein Wettrennen? Wie unfair. Du spielst nicht gerecht“, beschwerte sich Aurelio hinter ihm. Raven konnte ihn näher kommen hören. Der Wind pfiff ihm um das Gesicht, riss an seiner Kleidung und zog an seinem langen Haar. Flatternd wehte es hinter ihm her. So fühlte sich Freiheit an.
„Im Krieg gibt es keine Fairness“, murmelte Raven und stieß seinem Hengst die Fersen in die Flanken. Sie ritten eine Weile im zügigen Galopp durch den Wald. Als sich das Blätterdach lichtete, erreichten sie ein Dorf. Dort zügelten sie ihre Pferde etwas. Die Leute kamen aus ihren Häusern, als sie ihren König sahen und verneigten sich tief. Hocherhobenen Hauptes ritt Raven an ihnen vorbei. Niemand sah ihm in die Augen, wagte es auch nur den Kopf zu heben. Er trieb sein Tier erneut an. Der Wind wehte ihm das Haar auf den Rücken und ließ seinen Umhang flattern. Aurelio war etwas hinter ihm, unterbrach seine Bemühungen, mit einigen jungen Damen zu flirten und schloss wieder zu ihm auf. Raven schwieg.
Die Wachen befanden sich in ihrem Schatten.
„Hast du schon an Heirat gedacht?“, wollte sein Cousin da auf einmal wissen und zog Ravens Aufmerksamkeit wieder auf sich. Gerade ritten sie durch die engen Gassen am Dorfrand. Auch hier hatten sich einige Bauern versammelt, um ihrem König die Ehre zu erweisen. Dabei stach ein Paar deutlich heraus, kam es Raven doch bekannt vor. Es war der Bauer mit seiner Tochter. Die Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm stand neben ihnen. „Wie kommst du darauf?“, wollte Raven wissen. Kein Gefühl schlich sich in seinen Ton. Dabei war er äußerst aufmerksam. Dieses Thema konnte der Prinz nicht ohne Grund angeschnitten haben. „Na ja, du jagst nun schon fünf Jahre hinter dieser Frau her“, fing Aurelio an, schwieg aber sofort, als er Ravens eisigen Blick sah. „Ich meine, du hast alles. Die Krone, den Thron, sogar das Sonnenreich hast du unter deiner Macht. Was dir jetzt noch fehlt, ist eine Frau und ein Kind. Einen Erben, der das alles mal erhalten wird.“
Raven sah stur gerade aus. Sein Herz hatte bei diesen Worten einen schmerzhaften Satz gemacht. Um die Wahrheit zu sagen, er hatte auch schon daran gedacht. Das erste Mal vor fünf Jahren. Der Gedanke war ihm wie ein Pfeil durch den Kopf geschossen und stecken geblieben. Doch wen sollte er zur Frau nehmen? Alle anderen Könige im nahen Umfeld hielten ihre Töchter unter Verschluss. Aus Angst, er könnte ihnen begegnen und sie ihnen rauben. Welche Frau würde den Platz an seiner Seite ausfüllen können? Viel Macht und Verantwortung lagen darin begründet. Es musste eine tapfere, willensstarke Frau sein.
„Hörst du dich manchmal selbst reden? Lass gefälligst den Unsinn!“, herrschte Raven Aurelio an und beschleunigte sein Pferd erneut. Auf einmal war der Wunsch, die Beweggründe des Prinzen zu erfahren, erloschen. Dafür waren seine Gedanken im Moment zu unruhig, zu unkonzentriert und wild. Er hörte Aurelio etwas murmeln, schwieg aber.
Es würde keine Frau und keinen Erben geben, niemals. Dazu hatte Raven sich schon vor langer Zeit entschlossen. Wahrscheinlich war der Prinz tatsächlich nur deswegen hierhergekommen. Wegen der Thronfolge. Immerhin war er der einzig bekannte Mensch, den man als seinen Verwandten bezeichnen könnte. Wenn, würde die Krone wohl an ihn fallen. Daran, dass Aurelio an dem Glück seines Cousins interessiert war, dachte der König nicht einmal. Für ihn gab es keine Bindung, keine Nächstenliebe. Für ihn gab es nur den Kampf, die Schlacht. Das Verteidigen, das Beschützen seiner Selbst. Vor dem Krieg, vor den Feinden und vor allem sich selbst. Es würde keinen Erben geben. Niemals. Auch keine Frau. Aurelio würde wohl eines Tages wirklich König werden. Vorausgesetzt Raven gedachte sich jemals umbringen zu lassen.
Das auf diesen Ausritt folgende Abendessen verlief schweigend. In einer mehr als unangenehmen Stille. Raven hatte seinem Cousin nichts mehr zu sagen. Hing eher eigenen, düsteren Überlegungen nach. Und auch Aurelio schien es vorzuziehen zu schweigen. Also war nur das Geklapper von Besteck auf Tellern zu hören. Es reizte Ravens Nerven und machte ihn wütend. So schnell er konnte, beendete der König das Essen deswegen und kehrte in sein Arbeitszimmer zurück. Dort fiel sein Blick als Erstes auf den Spiegel. Wie das Licht die Motte anzog, wurde er zu diesem mannshohen Glasgebilde gezogen. Erneut traf sein Blick auf sich selbst. Lange stand er vor dem Spiegel, sah in seine eigenen Augen.
Farblos und kalt.
Welche Frau konnte solche Augen lieben? Wut stieg in ihm auf, wirbelte durch ihn hindurch, als er an die Antwort zu dieser Frage dachte: keine. Er nahm sich Aurelios unbedachte Worte viel zu sehr an. Raven war ein Schwachkopf, auch nur darüber nachzudenken. Und doch konnte er einfach nicht aufhören. Seine Gedanken kreisten um die Worte, aber auch um seine eigenen vorangegangenen Überlegungen. Diese Augen, die er einfach nicht aus dem Kopf zu bekommen vermochte.
Es klopfte. Ein lauter Ton in dem ansonsten stillen Arbeitszimmer, der Ravens Gedanken unterbrach. Der König antwortete zuerst nicht. Sortierte seine Gedanken, schob das Unliebsame zur Seite. Starrte blind in seine eigenen Augen im Spiegel. Sah das Feuer, das darin brannte. Es klopfte erneut, etwas lauter dieses Mal. Wütend über seine eigene Dummheit, riss Raven sich los und drehte sich weg.
„Herein!“, rief er währenddessen verstimmt. Kehrte an seinen Schreibtisch zurück. Ließ sich gerade auf seinen Stuhl sinken, als er es aus den Augenwinkeln sah. Erneut. Grün-braune Augen. Sie sahen ihn durch den Spiegel an. Raven blinzelte.
Die Augen waren verschwunden.
„Entschuldigt die Störung, mein König. Die Truppen, die Ihr in Engelsstadt aufgestellt habt, melden Probleme“, sprach Xeron da und trat ein. Verbeugte sich tief und wartete. Raven blinzelte, betrachtete den Spiegel, als könne er das Geheimnis dieser Augen, ihre Faszination dafür, durch reine Willenskraft brechen oder erkennen. Was natürlich nicht möglich war. Irrational, das war sein Verhalten. Und nichts, was der König im Moment gebrauchen konnte. Xeron, der noch immer in einer leichten Verneigung stand, kam da gerade recht, um Ravens Gedanken wieder auf die richtige Spur zu bringen. Leicht genervt wedelte er mit der Hand, damit Xeron sich wieder aufrichtete und nahm schlussendlich hinter seinem Schreibtisch Platz.
„Welche Art der Probleme?“, wollte er wissen. Sein Blick flog noch einmal zum Spiegel. Aber die Augen blieben verschwunden. Seine Brauen zogen sich nachdenklich zusammen, bevor er sich eines Besseren besann und sich auf Xeron konzentrierte. „Die Männer im Reich der Sonne begehren auf. Ihr König hält sie nicht zurück. Wir haben die Situation noch unter Kontrolle, aber Prinz Finnwick ist ihr Anführer. Unsere Truppen erbitten Unterstützung.“ Raven war durchaus klar gewesen, dass es irgendwann zu solchen Tumulten kommen würde. Nur nicht so bald. Stellten sie im Moment doch ein größeres Problem dar als erwartet. Der Krieg war noch nicht lange vorbei, der Sieg ganz frisch. Noch nicht in allen Köpfen angekommen. Was Tumulte und Aufstände viel zu schnell aufzüngeln und eskalieren ließ.
„Wir schicken drei weitere Truppen, je hundert Mann. Dazu noch Verpflegung und Waffen. Wir werden uns nicht vertreiben lassen. Das Prinzlein will ich lebend. In welcher Verfassung ist mir gleich“, stellte Raven fest und verschränkte die Hände vor dem Mund, die Ellbogen auf der Tischplatte. Er musste hart durchgreifen. Ansonsten würde es niemals zu einem wahren Frieden kommen. Oder zu Ruhe, Sicherheit. Die Schlacht war geschlagen, aber sicher war es dadurch noch lange nicht.
„Sehr wohl, Eure Majestät.“ Xeron verneigte sich abermals. „Ich gebe die Nachricht gleich weiter.“ Mit diesen Worten war er auch schon verschwunden. Xeron war weniger ein Sekretär, als vielmehr ein enger Berater. Er fügte sich in beide Rollen und füllte sie perfekt aus. Ohne ihn würde Raven wohl noch den Verstand verlieren. Wenn es nicht schon längst so weit war.
Nachdenklich erhob er sich wieder und wanderte in seinem Arbeitszimmer umher. Er konnte sich dem Gefühl, genau beobachtet zu werden, nicht erwehren. Auch seine Gedanken wanderten unablässig auf und ab, als wollten sie seinem Körper folgen. Und schon wieder tauchten Aurelios dumme Worte auf. Eine Frau, ein Kind … lächerlich. Und doch hatte Raven angefangen, nachdenklich zu werden. Es stimmte wohl: Er hatte alles, was er wollte. Den Sieg, die Krone zweier Reiche. Macht und Wohlstand.
Aber was er nicht hatte, war etwas, um die Leere zu füllen. Eine Leere, die ihn immer nur dann überkam, wenn er alleine war. Zu lange arbeitete, die Nacht ihre Schatten über seinen Schreibtisch warf und er ins Grübeln kam. Sein Leben war kein leichtes gewesen. Sein Vater ein König, seine Mutter eine Königin. Beide mehr kalt, denn alles andere. Auf Macht aus, auf Ruhm und Reichtum. Schlachten und Kriege. Weswegen Raven jung zum Thronfolger wurde. In Fußstapfen treten musste, die viel zu groß für ihn waren. Es hatte seine Zeit gedauert, bis der junge Prinz es schaffte, aus den Fußstapfen auszubrechen und seinen eigenen Weg zu gehen. Er war jung gewesen. Aber nicht dumm. Unerfahren, aber ambitioniert. Erfolgreich aber auch alleine.
Es hatte nicht lange gedauert, bis ihm klar geworden war, dass er den Beratern, die schon seine Eltern in den Tod schickten, nicht trauten konnte. Und dann war die Einsamkeit sein Freund geworden. Ein Gefährte, den er nicht mehr loswurde. Den er an manchen Tagen stärker spürte als an anderen. Ein Gefährte, der in den Hintergrund rückte, wenn er an diese Augen dachte. An diese Frau. Sie war wie aus dem Nichts auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Hatte ihn von Anfang an fasziniert. In ihrem Gesicht hatte Angst gelegen. Aber auch wilde Entschlossenheit. Mut. Tapferkeit. Ein starker Wille. Dinge, die Raven anzogen, die ihn faszinierten. Sie hatte den Prinzen retten wollen. Ihren Bruder. Im Nachhinein hatte Raven alles über sie in Erfahrung gebracht. Sie war die einzige Prinzessin des Sonnenreiches. Und verschwunden. Seit fünf langen Jahren, in denen er sie suchte. Mehr über sie erfahren wollte. Zuerst, da er sie als Mittel zum Zweck nutzen wollte. Sie schien nicht sehr angetan von dem Kampf, dem Krieg. Wollte ihren Bruder eher retten, als eine Schlacht zu schlagen. War mutig genug, direkt in die Kämpfenden hineinzureiten. Wenn er sie auf seine Seite bringen könnte, wäre die Schlacht schnell geschlagen. Da war er sich sicher gewesen. Doch Raven fand sie nicht. Seit dem Tag, an dem er das erste Mal in ihre grün-braunen Augen sah, war sie verschwunden. Nicht mehr aufzufinden. Selbst, als er das Sonnenreich einnahm. Was seine Neugierde nur noch stärkte. Seine Faszination. Wo war sie? Wie konnte sie entkommen? Warum war sie nicht im Palast gewesen? In ihrem Land? Oder einem anderen? Schien ganz und gar unauffindbar.
Ein Rätsel, das Raven lockte, ihn fesselte. Es war wie verhext. Und hatte sich herumgesprochen, wie es schien. War Aurelio doch tatsächlich nur deswegen hier. Raven hatte einiges erfahren. Prinz Aurelio hatte sich über ihn informiert, seine Schritte anscheinend eisern verfolgt. So wie es schien, nicht aus hinterhältigen Absichten. Sondern, weil er ehrlich in Sorge war. Das Gerücht um eine Frau war da lediglich der Tropen, der das Fass der Neugier zum Überlaufen brachte und den Prinzen veranlasste hierherzukommen. Solch kühne Vermutungen wie bei dem Ausritt anzustellen.
Eine Frau, ein Kind … lächerlich.
Raven würde sehen, wie er Aurelios Neugier schnellstmöglich stillen konnte, damit der Prinz wieder verschwand. Ohne Hofdamen und Feste würde dies hoffentlich früher, denn später der Fall sein.
Spätestens, wenn die Truppen das Prinzlein des Sonnenreiches zu ihm brachten, wäre Raven mehr als beschäftigt. Und würde Aurelio gehen müssen. Damit er nicht erfuhr, warum Raven den Prinzen wirklich lebend wollte.
Einzig deswegen, da der Bruder, für den die Prinzessin ihr Leben zu opfern bereit gewesen war, wohl am besten wissen würde, wo sie sich verbarg. Wohin sie verschwunden war. Damit hätte Raven ein perfektes Druckmittel in der Hand, um sie hervorzulocken. Seine Neugierde endlich zu befriedigen.
Kapitel 3





























