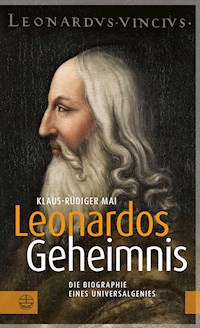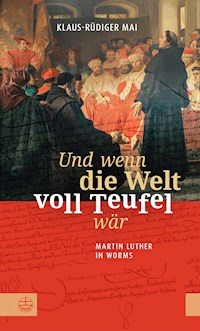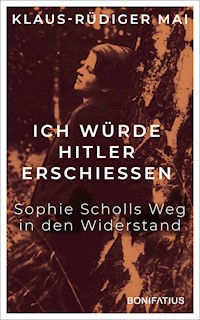Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zu recht bekannt und Teil unserer Erinnerungskultur ist die mutige Tat und das erschütternde Schicksal der Gruppe um die Geschwister Scholl. Doch wer kennt Herbert Belter? Wer kennt Wolfgang Ihmels, Jutta Erbstößer oder Wolfgang Natonek? Auch Herbert Belter wurde von den Henkern eines totalitären Staates ermordet, nachdem er Flugblätter verteilt hatte, auch er war erst 21 Jahre alt am Tag seines gewaltsamen Todes. Klaus-Rüdiger Mai erzählt auf der Grundlage intensiver Quellenrecherchen erstmals die ganze Geschichte des mutigen Widerstands Leipziger Studenten gegen die Stalinisierung Ostdeutschlands und bettet ihre Geschichte ein in die Unterdrückung demokratischer Anfänge in der DDR von ihrer Gründung 1949 bis zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Ein Lehrstück über das Werden einer Diktatur und über Mut und Widerstand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus-Rüdiger Mai
Der kurze Sommer der Freiheit
Wie aus der DDR eine Diktatur wurde
Gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: Spielende Kinder an der Ostsee, Anfang der 50er-Jahre, © IMAGO/United Archives
Die drei Bilder in diesem Buch wurden mit freundlicher Genehmigung des Universitätsarchivs Leipzig zur Verfügung gestellt
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timişoara
ISBN (Print): 978-3-451-39463-8
ISBN (EPUB): 978-3-451-83002-0
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Zweierlei Arten des Erinnerns: Sophie Scholl und Herbert Belter
I. Die Hoffnung auf Freiheit: Jugend zwischen den Diktaturen
Der verführerische Charme der Utopie
Aufbruch an den Universitäten?
II. Das Gefühl der Freiheit: Der Klassenkampf gegen die Demokratie
Luise Langendorf: Der Terror beginnt
Die „Gruppe Gallus“: Wie sowjetische Militärgerichte Spione produzieren
Werner Ihmels: Das Ende christlicher Jugendarbeit
Wolfgang Natonek: Die Befreiung von den Schatten des Nationalsozialismus
Die bürgerlichen Parteien im Visier der Kommunisten
Die Manipulation der freien Wahlen
Der „Sturm auf die Wissenschaft“ beginnt
Auf dem Weg in die Teilung
Die Gleichschaltung der Universitäten
Die Entscheidung der Machtfrage
Das Zusammenspiel von SED und sowjetischer Staatssicherheit
III. Nach der Freiheit: Das Beispiel der „Belter-Gruppe“
Die Vollendung der Diktatur
Der verschwundene Sohn
Die Mitglieder der „Belter-Gruppe“
Ankunft an der Universität
Wie die „Gruppe“ sich findet
Die Verhaftungen
Die Verhöre
Der Prozess
Das Verschwinden
Tod
Sowjetische Panzer garantieren die Diktatur
Epilog: Nur die Spitze des Eisberges: Widerstand und Tod in der frühen DDR
Anhang
Danksagung
Quellen und Siglen
Verzeichnis der benutzten Literatur
Anmerkungen
Über den Autor
Prolog: Zweierlei Arten des Erinnerns: Sophie Scholl und Herbert Belter
Zu Recht bekannt und Teil unserer Erinnerungskultur ist die mutige Tat und das Schicksal der Studentin Sophie Scholl. Doch wer kennt Herbert Belter?
Herbert Belter aus Rostock war 20 Jahre alt, als er 1949 das Studium der Volkswirtschaft an der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät (Gewifa) in Leipzig aufnahm. Sophie Scholl aus Ulm hatte gerade ihren 21. Geburtstag gefeiert, als sie in München 1942 begann, Biologie und Philosophie zu studieren. 21 Jahre zählte Sophie Scholl, als die Nationalsozialisten sie am 22. Februar 1943 in München durch das Fallbeil ermordeten. So alt war auch Herbert Belter, als die Kommunisten ihn am 28. April 1951 in Moskau durch Genickschuss hinrichteten. Wir wissen von Sophie Scholls Mut und Unerschrockenheit, wie sie unbeirrt in den Tod ging. Am Morgen vor dem Prozess im Münchener Justizpalast in der Prielmayerstraße unter dem Vorsitz des berüchtigten Präsidenten des Volksgerichtshofes Roland Freisler, der eigens aus Berlin nach München angereist kam – im Grunde ein Psychopath –, um selbst das Todesurteil über Sophie Scholl, Hans Scholl und Christoph Probst zu fällen, erzählte sie ihrer Zellenmitbewohnerin Else Gebel den Traum, den sie in der Nacht zuvor gehabt hatte. Im Traum brachte Sophie an einem schönen Sommertag ein Kind im weißen Kleid zur Taufe. Zur Kirche musste sie einen steilen Berg hinaufgehen, doch trug sie das Kind sicher in ihrem Arm. Plötzlich jedoch öffnete sich eine Gletscherspalte. Das Kind vermochte sie noch auf die sichere Seite zu legen, bevor sie in die Tiefe stürzte. Für Else Gebel legte Sophie den Traum so aus: Das Kind sei ihre Idee, die sich am Ende durchsetzen werde, auch wenn sie, die Wegbereiter, es nicht mehr erleben, sondern vorher sterben würden. Diese Idee bestand in der Freiheit der Bürger und der Ablehnung von Diktatur und Gesinnungszwang.
Das Vorletzte, was wir von Herbert Belter wissen, ist die Beschreibung eines Bildes, das sich seinen Mitverurteilten eingeprägt hat. Die Mitglieder der sogenannten Belter-Gruppe waren zu 25 bzw. zehn Jahren Arbeitslager verurteilt worden und befanden sich auf dem Weg nach Workuta. Herbert Belter hatten die Schergen des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes von seinen Kommilitonen getrennt. Im weißrussischen Brest sahen die Gefährten Herbert Belter, den seine Bewacher über die Gleise führten, die Augen verbunden, als ginge es schon zur Erschießung und nicht zum Zug nach Moskau, zum letzten Mal. Ein erbarmungswürdiges Bild, ein Bild voller Einsamkeit, ein Bild der Verlorenheit. Das Letzte, was man von Herbert Belter weiß, ist, dass er am 28. April 1951 im Keller des Butyrka-Gefängnisses wahrscheinlich von einem der blutrünstigsten Henker Stalins, dem berüchtigten Wassili Blochin, auch ein Psychopath, per Genickschuss ermordet wurde.
Die Eltern kamen zu Sophie Scholls Beerdigung, noch heute kann man ihr Grab, das ihres Bruders sowie Christoph Probsts letzte Ruhestätte auf dem neben der Justizvollzugsanstalt Stadelheim gelegenen Friedhof am Perlacher Forst aufsuchen. Jahrelang schrieben die Eltern von Herbert Belter Briefe an die Behörden der DDR, den Ministerpräsidenten und den Präsidenten der DDR, um etwas über den Verbleib ihres Sohnes, der plötzlich verschwand, zu erfahren. Nichts hörten sie von der Hinrichtung ihres Sohnes, nie standen sie an seinem Grab. Es existiert auch kein Grab. Nach der Hinrichtung wurde sein Leichnam im Krematorium des angrenzenden Friedhofes Donskoje verbrannt und dann in einem Massengrab verscharrt, das die Asche von über 800 Deutschen birgt, die seit Kriegsende nach Moskau verschleppt und dort ermordet worden waren. Herbert Belters Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Keller am Hauptsitz der sowjetischen Staatssicherheit in Dresden in der Bautzener Straße statt. Ausdrücklich heißt es im Protokoll des Prozesses, dass die Verhandlung als „geschlossene Gerichtssitzung […] ohne Teilnahme der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung“1 stattfindet.
Im Februar kam Herbert Belter in Moskau an, wurde in eine Todeszelle gesperrt, bis er zwei Monate später tief in der Nacht in den Keller geführt und erschossen wurde.
Niemand weiß von der Einsamkeit der letzten beiden Monate, von der Erschütterung, der Hoffnung vielleicht, niemand weiß, was Herbert Belter, ein junger Mann von 21 Jahren, in seinen letzten beiden Monaten durchgemacht hat. Keine Quelle wird je darüber Auskunft geben, kein Augenzeuge berichten. Vielleicht werden in einer Zeit nach Putin, in einer Zeit, in der Russland, wie zu hoffen steht, die Freiheit erlebt, die Archive sich wieder öffnen. Vielleicht wird doch noch ein Schriftstück auftauchen, das Auskunft über die letzten Tage dieses allzu kurzen Lebens gibt.
Es scheint so zu sein, dass diejenigen, die gegen das nationalsozialistische Regime Widerstand geleistet haben, ganz anders in unserer Erinnerungskultur beheimatet sind als diejenigen, die sich gegen den Kommunismus stellten und dafür ebenfalls mit dem Leben oder langen Haftstrafen bezahlten. Messen wir die beiden deutschen Diktaturen in unserer Erinnerungskultur mit unterschiedlichem Maß? Konkreter gefragt, gewichten wir die Opfer der beiden Diktaturen unterschiedlich? Ist es bestimmten politischen Kräften gelungen, die kommunistische Diktatur, den linken Totalitarismus im Zuge der Bereinigung ihres politischen Erbes zu verharmlosen? Doch wie kann man diese Frage beantworten, wenn sie sich aus dem einfachen Grund nicht stellt, weil man nichts von Herbert Belter weiß? Bevor also gefragt werden kann, ob und wie man an Herbert Belter erinnern kann, müssen wir uns vergegenwärtigen, wer er, wer Werner Ihmels, wer Wolfgang Natonek war.
Das einzige Bild von Herbert Belter
In „1984“, dem Roman, den die Studenten der sogenannten Belter-Gruppe als Tarndruck verteilt hatten, schrieb George Orwell: „Die Menschen verschwanden einfach, immer mitten in der Nacht. Der Name wurde aus den Listen gestrichen, jede Aufzeichnung von allem, was einer je getan hatte, wurde vernichtet; dass man jemals gelebt hatte, wurde geleugnet und dann vergessen. Man war ausgelöscht, zu Nichts geworden; man wurde vaporisiert, wie das gebräuchlichste Wort dafür lautete.“2
George Orwell schildert in dem Roman, wie wichtig es für totalitäre Machthaber ist, die Geschichte auszulöschen und die Vergangenheit umzuschreiben. In ihren Geschichtskonstruktionen stören wirkliche Menschen, weil die Wirklichkeit stört. Um ihre neuen Utopien unters Volk zu bringen, eine große Transformation ins Werk zu setzen, müssen die Verbrechen, die bei der Umsetzung dieser Utopien begangen wurden, in Vergessenheit gebracht werden. Als man in der DDR die Verbrechen Stalins und seiner Partei nicht mehr totschweigen konnte, trennte man Stalin von dieser Partei, lud bei ihm alle Schuld ab und fand für die Opfer des Kommunismus den Begriff der Gestehungskosten des Fortschritts. Weil Diktaturen und totalitäre Machthaber mit dem Mittel der damnatio memoriae, mit der Auslöschung der Erinnerung an Menschen zum Zwecke der Auslöschung und des Umschreibens von Geschichte arbeiten, ist es so wichtig, ihren Opfern ihre Geschichte und damit auch ihre Würde zurückzugeben. Doch es geht nicht nur um sie. Es geht auch um uns. Friedrich Hans Eberle, der Vater einer der zehn jungen Männer, die im Januar 1951 in jenem Keller im sächsischen Hauptsitz des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes verurteilt wurden, schrieb über die Zeit, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen: „Was hätte ich denn tun können? Das hätte man am Anfang vielleicht verhindern können und da hat niemand gewusst, wo das alles hinführt.“ Seinem Sohn wurden diese Worte zur Mahnung, als in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der jungen DDR wieder eine Diktatur etabliert wurde.
Darin besteht die große Aufgabe und der Sinn von Erinnerungskultur: den Opfern ihre Würde und ihre Geschichte zurückgeben, damit die Späteren dafür sensibilisiert werden können, „wo das alles hinführt“ oder hinführen kann. Was wir erinnern wollen, ist, wo sich Menschen als Menschen verhalten haben und wo nicht, und was Freiheit und Demokratie kosten. Damit ist zugleich gesagt, dass eine abstrakte Erinnerungskultur eine contradictio in adjecto ist, sie darf kein Alibi oder eine akademische Eitelkeit sein, sondern muss konkret, muss biografisch präzise vorgehen, wenn sie eine Kultur des Erinnerns sein will und nicht nur Fundus für wohlfeile Sonntagsreden. Ihr Gegenstand sind Menschen, deren Lebensgeschichte sie zu erzählen hat, Menschen wie Sophie Scholl und Herbert Belter. Aber erst dann, wenn Herbert Belter so bekannt ist wie Sophie Scholl, können wir wirklich in Deutschland von einer vollständigen Erinnerungskultur reden.
Herbert Belter war kein „Rechter“. Er gehörte sogar der SED an – und dennoch empörte ihn, dass die angekündigten Wahlen von 1949, die gleich nach der Gründung der DDR stattfinden sollten, auf das Jahr 1950 verschoben wurden, um sie dann als sogenannte Blockwahl abzuhalten, die als reine Farce stattfand.
Sophie Scholl war keine „Linke“. Gegen die Diktatur der Nationalsozialisten leistete sie Widerstand, weil sie es als ihre Pflicht als Mensch und als Christin ansah. Weil sie nicht links war, stufte sie ein linker Autor aus kommunistischem DDR-Adel als „ideologisch fragwürdig“ ein.3 So beginnen linke Diktaturen, indem Menschen als ideologisch zuverlässig oder „fragwürdig“ markiert werden.
Das Buch wird Geschichten von Menschen erzählen und ihr Leben in den Mittelpunkt stellen, um jene Geschichtskonstruktionen zu vermeiden, die vorschnell versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu verleihen, der nicht selten von einem ideologischen Interesse getrieben wird. Dem gelebten Leben werde ich nachgehen – auch und vor allem mithilfe persönlicher Zeugnisse und bisher wenig, kaum oder gar nicht ausgewerteter Quellen aus deutschen und russischen Archiven.
Die Frage, wie die DDR eine Diktatur wurde, lässt sich durch den Verweis auf die Konferenzen von Jalta und Potsdam erklären, und durch die Eroberung aller Institutionen in der Sowjetischen Besatzungszone durch die KPD – ab 1946 SED –, gestützt auf die Militärmacht der Panzer und die Terrormacht des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes – beides wurde oft genug unternommen. So notierte der Leipziger Theologiestudent Werner Ihmels (Jahrgang 1926) ein halbes Jahr vor Churchills Rede in Fulton, in der dieser den „Eisernen Vorhang“ in Europa konstatierte, am 22. September 1945 in sein Tagebuch: „Wir erleben heute in sechs Monaten die gleiche Entwicklung wie in den letzten zwölf Jahren. Stehen wir dann vor dem gleichen Ergebnis? – Die ersten Verhaftungen sind auch schon da.“4 Er fühlt sich ohnmächtig – und verfolgt dennoch weiter sein Ziel, das, wie er seinem Bruder am 30. März 1945 aus der amerikanischen Gefangenschaft in Meißen schrieb, in einer christlichen Jugend besteht: „Wir wollen eine deutsche Jugend unter Christus sein.“5
Warum leisteten Menschen Widerstand in einem ungleichen Kampf, den sie nicht gewinnen konnten? Dieser Frage geht das Buch nach. Und warum wissen wir so wenig darüber, obwohl doch der Anschein besteht, dass wir darüber gut informiert seien? Denn man kann nicht behaupten, dass die Geschichte der SBZ und der DDR wenig erforscht sei, eher im Gegenteil. Trotzdem besitzen diese Geschichten als Teil der jüngsten Geschichte in der breiten Öffentlichkeit nicht die Bekanntheit, die ihnen eigentlich zukommen müsste.
I. Die Hoffnung auf Freiheit: Jugend zwischen den Diktaturen
„Wir leben alle ohne Ziel und wissen kaum noch, was zu hoffen. Die fortschreitende Ausplünderung wird kaum viel Möglichkeiten des Aufbaus lassen. Die Kommune wird uns den Rest nehmen – Elend! Und dabei herrscht ein grauenvoller Egoismus überall. Unvorstellbares Flüchtlingselend. Alles, was der 30jährige Krieg mit sich brachte, ist gar nichts mehr. Werden spätere Generationen noch erschauern, wenn sie davon lesen? 6 Kriegsjahre haben uns demoralisiert, sonst müsste mehr Kraft und Würde des Ertragens erkennbar sein. Wir hoffen zu viel von den andern! Freilich ist die kommunistische Führung ja völlig unfähig.“
Prof. Dr. Ludwig Lendle, Tagebucheintrag vom 31. August 1945
Der verführerische Charme der Utopie
Im Sommer 1945 gestattet die sowjetische Verwaltung der sowjetischen Besatzungszone, die den Namen Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) trägt, die Bildung von Antifaschistischen Jugendausschüssen, aus denen sich eine freiheitliche, überparteiliche Jugendorganisation bilden soll. Konfessionelle oder parteiliche Jugendverbände werden nicht erlaubt. Im zentralen Antifaschistischen Jugendausschusses („Antifa-Jugend“) einigen sich die Kommunisten mit den Sozialdemokraten auf eine paritätische Besetzung des Zentral-Ausschusses. Am 30. August 1945 hält Werner Ihmels, der sich in der christlichen Jugendarbeit engagiert, fest, dass die Arbeit in den Antifaschistischen Jugendausschüssen begonnen habe. Da die SMAD den Parteien eigene Jugendorganisationen verboten hat, dafür aber die Bildung einer überparteilichen Organisation als Vertreterin der Belange der Jugend fördert, bleibt Werner Ihmels nur übrig, in den Jugendausschüssen mitzuarbeiten, wenn er Jugendarbeit leisten will. Er macht sich keine Illusionen darüber, dass die „Überparteilichkeit“ von den Kommunisten nicht ernst gemeint ist, und es nur um die blanke Macht geht, darum, zu verhindern, dass starke bürgerliche Jugendorganisationen und Bünde entstehen, die tief in die Tradition kirchlicher Jugendarbeit zurückreichen. Gerade die Bekennende Kirche in Sachsen hatte während der nationalsozialistischen Diktatur gute Erfahrungen damit gemacht, die Jugendarbeit weit in das Innere der Kirche zu verlegen, in Bibellesekreise, in denen christliche und antifaschistische Bildungsarbeit erfolgen konnte, und wo sie vor dem Zugriff der Nationalsozialisten gesichert wurde. Werner Ihmels, Enkel des früheren Bischofs der sächsischen lutherischen Kirche, der in Leipzig im Bibelkreis gegen die nationalsozialistische Weltanschauung opponiert hatte, unterschätzt die kommunistische Strategie nicht, unter dem Deckmantel der Überparteilichkeit Parteiarbeit zu betreiben. Doch will er den Kommunisten die Jugendausschüsse nicht kampflos überlassen, zumal sie die einzige legale Möglichkeit für die Jugend bieten, politisch tätig zu werden.
Sowohl die Sowjets als auch die deutschen Kommunisten legen auf „die Jugend“ großen Wert. Sie steht für das zu errichtende Neue. Natürlich ist die „Jugend“, wie immer, wenn sie propagandistisch oder medial in den Mittelpunkt gestellt wird, eine Projektion. Der kleine Teil der Heranwachsenden, der für die eigenen ideologischen Belange instrumentalisierbar ist, wird zur Jugend schlechthin erklärt. Die Argumentation der Kommunisten zielt darauf, dass die Eltern die Katastrophe des Nationalsozialismus zu verantworten hätten, sie folglich die Schuld am Zusammenbruch Deutschlands trügen, und es deshalb nun auf die Jugend ankäme, die es besser, die es anders machen werde. Dass für das Neue zu sein, nach ihrer Auffassung nur bedeuten kann, für den Kommunismus zu kämpfen, verschweigen sie – noch. Allgemeine sozialistische Gedanken sind in diesen Jahren bis in die CDU hinein en vogue.
So entschließt sich Werner Ihmels, die einzige Chance, die sich ihm und anderen engagierten jungen Menschen bietet, zu nutzen: „Antifaschist bin ich in des Wortes eigentlicher Prägung. Mehr nicht. Die Demokratie halte ich, bei richtiger Durchführung, für die vernünftigste Regierungsform. Doch mit all dem Gefasel vom Kommunismus und Weltverbrüderung möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin im Ausschuss als Christ mit politischer Verantwortung, weil ich mein Volk und mein Vaterland, an dem man oft verzweifeln könnte, trotz allem liebe! Ich bin überzeugt, dass nur noch Umkehr, innere Umkehr unser Volk retten kann. Nichts sonst. Da nützen keine Beschlüsse, Parteien, Programme, Erziehungsmaßnahmen: Ein Volk ohne Gott ist tot […] Den Alten ist es oft genug gesagt, die wollen nicht mehr. Die Jugend ist aufgewachsen, ohne von Christus zu hören. Sie muss sich jetzt entscheiden. Gott gebe, dass sie sich recht entscheide.“1
Am 6. März 1946 genehmigt die SMAD die Gründung der FDJ, am 7. März wird die Einheitsjugendorganisation gegründet.
Anfangs hatte Werner Ihmels wie viele andere auch in den Antifaschistischen Jugendausschüssen und etwas später in der FDJ mitgearbeitet, um für eine Pluralität in der Einheitsorganisation der Jugend zu kämpfen. Am Ende sah er ein, dass der Kampf verloren war, und riet den jungen Christen, mit denen er Umgang pflegte, aus der FDJ auszutreten. Das Argument der KPD und der Sowjetischen Militäradministration für die Einheitsjugend bestand darin, dass man die Jugend nicht spalten wollte, indem die Parteien eigene Jugendorganisationen aufbauten, sondern in einer überparteilichen Organisation Jugendliche mit unterschiedlichen Anschauungen und Überzeugungen in Achtung voreinander vereint sein würden. Deshalb ging die KPD sogar mit gutem Beispiel voran und verzichtete auf die Wiederbegründung des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschland (KJVD), aber sie wusste, wie sich herausstellte, sehr wohl, dass die FDJ im Grunde nichts anderes als der KJVD sein sollte und schließlich sein würde.
Die Vorgehensweise war im Grunde schon von den Nationalsozialisten erfolgreich angewandt worden. Hatte sich die HJ 1933 zuerst der bündischen Jugend geöffnet, so wurde sie 1936 gleichgeschaltet und bündische Umtriebe durch die Gestapo verfolgt. Die Gestapo schätzte im Oktober 1935 die Situation folgendermaßen ein:
„Als Endziel schwebt den Bündischen die Gründung eines ,Jungenstaates‘ vor, der frei von jeder gesetzlichen Ordnung geschaffen werden soll. Ein Verbot der dj.1.11 und aller ähnlichen Bünde wird in kürzester Zeit erfolgen, damit dadurch eine Handhabe zum Einschreiten gegen die Betätigung einzelner früher bündischer Gruppen gegeben ist.“2 Aus der überparteilichen Jugendorganisation HJ wurde die Parteijugend der NSDAP.
Warum hofften junge Menschen auf eine demokratische Gesellschaft im Osten, obwohl ihre täglichen Erfahrungen dazu im krassen Gegensatz standen? Und warum ließen sich andere von einer neuen Verheißung einfangen, wo sie doch die Katastrophe der letzten Verheißung erlebt hatten? In ihrem besten Roman, den 1976 veröffentlichten „Kindheitsmustern“, erzählt Christa Wolf (Jahrgang 1929) die verzweifelte Orientierungslosigkeit der Heranwachsenden, die in ihrem jungen Leben nichts anderes als die nationalsozialistische Diktatur erlebt hatten, so: „Inzwischen überlegte Nelly bei sich, wie sie sich einer Werwolfgruppe anschließen könne, von denen man jetzt munkelte: Ein Zeichen dafür, dass sie sich der wirklichen Lage durch Verzweiflungstaten zu entziehen wünschte.“3 Im September 1944 hatte Heinrich Himmler für den sich abzeichnenden Fall der militärischen Niederlage versucht, eine Untergrundorganisation zu gründen, die den Krieg durch Terrorakte weiterführte. Obwohl Himmlers Aufrufe nur auf wenig Bereitschaft trafen, überschätzten die Alliierten die Gefahr, die vom Werwolf ausging, und machten Jagd auf vermeintliche Angehörige der Organisation, zumeist auf Kinder und Jugendliche. Unter den 28 000 Häftlingen im Speziallager Nummer zwei des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes, im vormaligen KZ Buchenwald, befanden sich – unter Bedingungen, die sich nicht von denen der nationalsozialistischen Führung des Lagers unterschieden – auch 1300 Kinder und Jugendliche. Als Haftgrund genügte der bloße Verdacht oder ein unter Folter erpresstes Geständnis. Viele der von einem auf den anderen Tag verschwundenen Jugendlichen wurden erst 1950 entlassen.
Der später erfolgreiche DDR-Schriftsteller, Autor des legendären Aufbau-Romans „Spur der Steine“, Erich Neutsch (Jahrgang 1931), der sich nach der Haft Erik nennen wird, wurde mit 13 Jahren zum Opfer des Terrors: „Im Jahr 1945, kurz vor Weihnachten, wurde ich von der sowjetischen Militärpolizei verhaftet, weil ich unter Verdacht stand, an einer Werwolfgruppe beteiligt gewesen zu sein, und in das Militärgefängnis Magdeburg eingeliefert.“ Neutsch wurde nach neun langen Monaten aus der Hölle entlassen. Der junge Erik Neutsch durfte in seinem Lebenslauf, der seiner Bewerbung zum Studium beilag, natürlich den Aufenthalt im sowjetischen Militärgefängnis nicht verheimlichen, denn der war aktenkundig, doch er nutzte ihn dramaturgisch geschickt, um ihn als großen Wendepunkt in seinem Leben zu inszenieren. In wenigen Sätzen skizzierte der Abiturient, wie er vom Nationalsozialismus verführt, kindliches Opfer der nationalsozialistischen Propaganda wurde und wie ihn schließlich der Gefängnisaufenthalt rettete und gleichzeitig erleuchtete.
Auch in einem biografischen Gesprächsbuch, das mehr als 20 Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR und drei Jahre vor Neutschs Tod erschien, redete er das Gefängnis als die „Universität seines Lebens“ schön und stellte damit einen Bezug zum Titel des dritten Bandes der autobiografischen Romantrilogie Maxim Gorkis her: „Ich kam aus dem Gefängnis als ein anderer Mensch heraus, als ich hineingegangen war.“4 Als der 15-jährige Neutsch aus der Haft entlassen wurde, stand er menschlich, geistig und intellektuell vor dem Nichts. „Jemand, der das nicht miterlebte, wird sich nicht denken können, dass man die Freiheit verlernen kann“, resümierte der Abiturient in seinem Lebenslauf.5 Das klingt nicht nach einer Universität des Lebens. „Ich musste erst wieder lernen in das Leben hineinzuwachsen. Das dauerte lange.“6 Diese Leere füllte nicht nur die Schule, sondern vor allem die FDJ. Der junge Neutsch beschönigte nichts, sondern gab in seinem Lebenslauf sogar unumwunden zu, dass er nicht aus Überzeugung der Jugendorganisation 1946 beigetreten war, sondern weil „ich diesen Schritt aufgrund meiner Inhaftierung (für) besser hielt.“7 Nach nichts suchte der Jugendliche intensiver als nach einem neuen Lebenssinn, nach einer Orientierung, nach etwas, woran er glauben konnte.
Viele Jugendliche, viele junge Menschen, die in ihrem Leben bisher nichts anderes oder nicht viel anderes als den Nationalsozialismus erlebt hatten, suchten nach dem vollständigen Zusammenbruch nach einer Perspektive. Erik Neutsch fand sie wie viele andere auch im Marxismus, in sozialistischen Ideen: „Erst allmählich warf ich sämtliche Vorurteile über Bord und befasste mich eingehend mit dem Wissen um den Leninismus-Marxismus.“8 Man wird weder den Biografien, dem gelebten Leben, noch der Geschichte gerecht, wenn man in ein Schwarz-Weiß-Denken verfällt und zwischen den Widerständigen auf der einen Seite und den vom Sozialismus Überzeugten auf der anderen Seite unterscheidet und womöglich dazwischen noch eine Kategorie der Mitläufer aufmacht.
Die DDR war ein Staat mit Utopieüberschuss: Sie unterbreitete mit der Vorstellung eines Paradieses ein metaphysisches Angebot, das auch deshalb so unwiderstehlich war und für manche immer noch ist, weil es innerweltlich verwirklicht werden könne. Dabei konnte man sich auf die deutsche Literatur und Dichtung stützen. Während die Nationalsozialisten Heinrich Heine mit einem Bann belegten, weil er Jude war, nutzten die Kommunisten ihn, weil Heine mit Marx eine Freundschaft verband. Besser konnte man den kommunistischen Traum einer innerweltlichen Erlösung kaum ausdrücken, als es Heinrich Heine in den Versen aus „Deutschland. Ein Wintermärchen“ vermag:
„Ein neues Lied, ein bessres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.“9
Nicht wenige junge Leute sahen die Entwicklung in der SBZ und in der DDR als etwas grundlegend Neues an, als eine Chance, eine bessere, eine menschliche Gesellschaft zu errichten und in der eigentlichen Geschichte der Menschheit anzukommen und die blutige und elende Vorgeschichte hinter sich zu lassen. Ihnen wurde beigebracht, dass der Nationalsozialismus, den die Kommunisten konsequent Faschismus nannten, Resultat des Kapitalismus sei. In der Schule, im Studium, in Schulungen, Lehrgängen und Vorträgen wurde gebetsmühlenartig Georgi Dimitroffs Faschismusdefinition, die von der Komintern übernommen und kanonisiert worden war, wiederholt, wonach der „Faschismus an der Macht […] die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ wäre. Diese einflussreiche und wirksame Definition erlaubte es den Kommunisten, den Bogen in die aktuellen Auseinandersetzungen zu schlagen, indem sie propagierten, dass im Westen der Kapitalismus restauriert werde, das Alte, Reaktionäre, das Antidemokratische an die Macht käme, während im Osten eine menschliche, helle, einer gerechten Zukunft zugewandte Gesellschaft entstünde. Das berühmte FDJ-Lied von Reinhold Limbach aus dem Jahr 1951 brachte genau diese Vorstellung populär auf den Punkt:
„Allüberall der Hammer ertönt, die werkende Hand zu uns
spricht: Deutsche Jugend, pack an, brich dir selber die Bahn,
für Frieden, Freiheit und Recht. Kein Zwang und kein Drill,
der eigene Will’ bestimme dein Leben fortan. Blicke frei in das
Licht, das dir niemals mehr gebricht. Deutsche Jugend steh deinen
Mann.
Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, Freie Deutsche Jugend,
bau auf! Für eine bess’re Zukunft richten wir die Heimat auf!“
Karl Marx hatte es mit dem verführerischen Charme der Utopie im Vorwort „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ so formuliert: „Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab.“10 Der Dichter Heiner Müller lässt in seinem Stück „Der Bau“, das auf Neutschs Roman „Spur der Steine“ zurückgeht, den Brigadier Barka sagen: „Mein Lebenslauf ist Brückenbau. Ich bin / Der Ponton zwischen Eiszeit und Kommune.“11 Ursprünglich stand für „Ponton“ „Fähre“, doch schien das Müller zu romantisch, Pontons werden auch für Panzer gebaut.
Man versteht die Geschichte der DDR, die Geschichte, wie aus Ostdeutschland eine Diktatur wurde, nicht, wenn man nicht auch sieht, dass sehr viele junge Leute eine Chance in dem neuen Staat, die Möglichkeit einer neuen, einer gerechten Gesellschaft sahen; ihre Begeisterung war so echt wie ihre Hoffnung. Im November 1950 beschloss auf einer Funktionärskonferenz der Zentralrat der FDJ den „Feldzug der Jugend für Wissenschaft und Kultur“, was auf eine von vielen jungen Menschen enthusiastisch vorangetriebene Kulturrevolution hinauslief, d. h. in Wahrheit auf den Versuch der Gleichschaltung von Wissenschaft und Kultur. Doch in der Vorstellung von einer Revolution, die angeblich ein besseres Leben für alle Menschen schuf, verdrängte die Illusion des großen Aufbruchs die triste Wirklichkeit des Zwangs, der Einschüchterung, der Gleichschaltung.
Andere erkannten, dass die schönen Versprechungen der Kommunisten sich nicht erfüllen würden. Der 21-jährige Gerhard Schulz (Jahrgang 1924) vertraute schon am 18. November 1945 seinem Tagebuch an: „Je öfter ich in unsere heutigen Zeitungen schaue, desto verlogener und falscher erscheinen mir die kommunistischen Parolen und Phrasen vom Nationalbewusstsein, Zusammengehörigkeitsgefühl des deutschen Volkes, von der Betonung des Eigentumsprinzips und der Ablehnung des bolschewistischen Kollektivgedankens. Die Kommunisten tarnen sich.“12 Schulz fügte bitter hinzu, dass man die wahre Absicht der Kommunisten nur aus „gelegentlichen Entgleisungen“ erführe. Obwohl Schulz recht hatte mit seiner Einschätzung, gestaltete sich die Realität auf kommunistischer Seite doch komplizierter. Zum einen gab es innerhalb der Führung der KPD und dann der SED einen Kampf zwischen Funktionären, die zuvor Exil im Westen, in Frankreich, in Mexiko oder Lateinamerika gefunden hatten, und den Moskauer Emigranten, die als Gruppe Ulbricht von den Sowjets eingeflogen wurden und dann von ihnen protegiert die Führung übernahmen. Funktionäre wie Anton Ackermann setzten auf einen nichtsowjetischen, spezifisch deutschen Weg zum Sozialismus. Doch nachdem Tito sich mit Stalin überworfen hatte und Jugoslawien einen eigenen, von Moskau unabhängigen Weg ging, wurde ein deutscher Weg zum Sozialismus als „titoistische“ oder „rechte“ Abweichung bekämpft, wurde stärker auf Lenin und Stalin statt auf Marx gesetzt und die SED durch Ulbricht und seine Anhänger stalinisiert. Im theoretischen Parteiorgan der SED „Einheit“ jubelte Ulbricht im November 1947, dass die SED auf dem besten Wege sei, eine „Partei neuen Typus“ zu werden, eine „Kampfpartei“, „geleitet von der wissenschaftlichen Theorie von Marx, Engels, Lenin und Stalin.“13 Am 29. Juni 1948 beschloss der Parteivorstand der SED die „Säuberung der Partei von feindlichen und entarteten Elementen.“ Ulbrichts Weg zum Sozialismus lässt sich in dessen Satz zusammenfassen, den Wolfgang Leonhard überliefert hat: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“14
Andere kämpften dafür, dass auch in ihrer Heimat, die sie nicht zu verlassen gedachten, ein demokratischer Weg eingeschlagen wird. Jedenfalls wollte man in den ersten Jahren die Hoffnung darauf noch nicht aufgeben – schließlich blieb trotz seiner frühen realistischen Einschätzung auch Gerhard Schulz bis 1950 in der SBZ und der DDR. Sogar ein kommunistischer Funktionär wie Fritz Selbmann, der während des Nationalsozialismus in Zuchthäusern und KZs inhaftiert war und später Industrieminister wurde, äußerte dem Philosophen Hans-Georg Gadamer gegenüber: „Wir haben doch nicht die braune Zwangsjacke ausgezogen, um eine rote Zwangsjacke anzuziehen.“15 Selbmann dürfte das sogar ehrlich gemeint haben. Er war der einzige hohe Funktionär, der am 17. Juni 1953 den Mut aufbrachte, auf die Straße zu gehen und mit den streikenden Arbeitern zu reden, die anderen, Pieck, Grotewohl, Ulbricht und Co., flohen lieber vor ihrem Volk unter den Schutz der Besatzungsmacht nach Karlshorst.
Die Tatsache, dass selbst in der KPD und SED unterschiedliche Konzepte vertreten wurden, sowie die Erwartung, dass auch in der SBZ und in der DDR freie Wahlen stattfinden würden, ließ viele hoffen. Demokratische Parteien, bürgerliche Parteien wie die Christdemokratische Union (CDU) und die Liberaldemokratische Partei (LDP), die sich 1951 in Liberaldemokratische Partei Deutschlands (LDPD) umbenannte, wurden 1945 gegründet und erstarkten sehr schnell. Doch es gelang der SED in einem, gestützt auf die Anwesenheit der sowjetischen Panzer und den Terror des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes, perfid durchgeplanten und mit großer Scheinheiligkeit durchgesetzten Prozess, die Parteien in den sogenannten demokratischen Block, in die Nationale Front des demokratischen Deutschlands, einzubinden und ihnen politische Ziele und die Anzahl der Mandate im gemeinsamen Vorschlag vorzugeben. Es folgte die brutale Enttäuschung 1950, als die SED und die Blockparteien ihren gemeinsamen Wahlvorschlag für die Volkskammerwahlen hervorzauberten. Was in einem Flugblatt der Weißen Rose als Hoffnung geäußert worden war, war nun auch für Ostdeutschland enttäuscht worden: „[J]eder einzelne Mensch hat einen Anspruch auf einen brauchbaren und gerechten Staat, der die Freiheit des einzelnen als auch das Wohl der Gesamtheit sichert. Denn der Mensch soll nach Gottes Willen frei und unabhängig im Zusammenleben und Zusammenwirken der staatlichen Gemeinschaft sein natürliches Ziel, sein irdisches Glück in Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit zu erreichen suchen.“16
Als die Hochschulgruppe der FDJ an der Universität München sich 1950 den Namen „Geschwister Scholl“ gab, versuchte Inge Scholl, die Schwester von Hans und Sophie, das rückgängig zu machen. So schrieb sie an die Hochschulgruppe Briefe. Einer dieser Briefe wurde 1951 in der RIAS-Sendung „Studenten kommen zu Wort“ verlesen: „Sie können mich nicht glauben machen, dass Ihre Gruppe nicht mit dem Regime in der Ostzone in Einklang steht. Ihre propagandistischen Schlagworte beweisen es zu Genüge […] Selbst, wenn ich all das abstreichen würde, was über die politische Linie der FDJ in der westlichen Presse steht, würden mir die persönlichen Berichte von Freunden aus der Ostzone genügen, um festzustellen, dass der Name meiner Geschwister mit diesen Gruppen unvereinbar ist. Meine Geschwister waren Christen von einer tiefen, unerschütterlichen Überzeugung, dies wäre jedoch kein Grund, dass sich Andersdenkende ihnen verbunden fühlen könnten. Denn meine Geschwister waren sich bewusst, dass eine große Zahl von Überzeugungen und Meinungen in der heutigen Welt existieren und dass es uns auferlegt ist, in dieser Verschiedenheit zu leben, sie zu ertragen und zu achten. Sie waren Andersdenkenden gegenüber aufgeschlossen, suchten leidenschaftlich nach gemeinsamen Ansatzpunkten und achteten jede ehrliche und echte Überzeugung. Sie hatten in der tödlichen Gleichschaltung des Dritten Reiches eines begreifen gelernt, nämlich dass eine tiefe, wirkliche Toleranz allein das Leben in dieser Vielfalt von Meinungen möglich macht […] Nur gegen etwas kannten sie keine Toleranz, gegen jede Art von totalitärem Regime, welcher Farbe, welcher Nation und welchen Programms es sich immer bediente. Sie sahen in der Diktatur einen Feind des Lebens und die Bedrohung jeder lebendigen Entwicklung, sie misstrauten tief jeder Weltanschauung und jedem Staat, der um scheinbar höherer, gemeinschaftlicher Ziele willen auch nur ein Menschenleben bewusst zerstört.“17
Herbert Belter äußerte als Angeklagter vor dem sowjetischen Militärtribunal in Dresden im Januar 1951, dass er sich „illegal“ betätigt habe, weil er „unzufrieden war mit der Situation an der Leipziger Universität, wir hatten keine Gewissensfreiheit, keine Redefreiheit und keine Pressefreiheit. Die Leipziger Universität ist eine Volksuniversität, ist Teil der DDR, und wenn die Studenten keine Freiheiten hatten, waren wir unzufrieden mit der Situation in der DDR. Wir kämpften für die Verfassungsrechte an der Universität, da die Universität eine Festung der Wissenschaft in der DDR ist.“18
Aufbruch an den Universitäten?
In dem kleinen sächsischen Örtchen Mahlis lastet die ganze Traurigkeit seines Daseins an diesem Morgen auf Gerhard Schulz. Nicht wenig hat der 21-Jährige bereits durchgemacht. Im Oktober 1942 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Im März erhielt er das Reifezeugnis, da befand er sich schon an der Front in Italien. Im Januar 1944 erlitt er eine schwere Verletzung, einen Bauchschuss, den er knapp überlebte. Anfang 1945 wurde er schließlich entlassen und folgte seinen Eltern nach Mahlis, wo sie nach ihrer Flucht aus Sommerfeld in Schlesien, das an Polen fällt und heute Lubsko heißt, gestrandet waren. Im November 1945 schreibt er in sein Tagebuch: „In der letzten Nacht ist der erste Schnee gefallen; draußen ist alles weiß […] Der Gedanke an Weihnachten aber ist zum ersten Mal voller Traurigkeit. Das Heimweh macht sich mit Heftigkeit bemerkbar. Der Gedanke an unser gutes Haus, den Garten, die warmen Stuben und die Geborgenheit daheim stimmt uns wehmütig und lässt manches Mal Tränen in die Augen treten.“19 Der Vater findet nur eine Anstellung als Waldarbeiter, weil er vorher der NSDAP angehört hat. Gerhard Schulz möchte vor allem nur eins, studieren, am liebsten in Leipzig, seiner „alten Liebe“20, hat er doch dort die Wirtschaftsoberschule besucht. Aber die Universität Leipzig ist zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen. Über die Wiedereröffnung entscheiden die Russen.
In der sowjetischen Besatzungszone wird 1945 als oberstes Verwaltungsorgan die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) gebildet, an deren Spitze zunächst Marschall Georgi Schukow steht, und deren Hauptquartier sich in Berlin-Karlshorst befindet. Schukows Stellvertreter, Armeegeneral Wassili Sokolowski, leitet die konkrete Verwaltungsarbeit. Für den Bereich der Zivilverwaltung wird Generaloberst Iwan Serow eingesetzt, ein skrupelloser Geheimdienstoffizier, der auch den sowjetischen Geheimdienst in der SBZ führt. Damit ist sichergestellt, dass der sowjetische Staatssicherheitsdienst eine mächtige Rolle innerhalb der Zivilverwaltung einnimmt. Von Anfang an gehört das Terror- und Spitzelsystem des NKWD (sowjetisches Innenministerium) zum Bestandteil der Zivilverwaltung in der SBZ. Die Broschüre „Der NKWD-Staat“, die später im Zuge von Hausdurchsuchungen bei Studenten gefunden wird, stellt eine frühe Studie über das Terrorsystem dar, das von Serow nach dem Vorbild der Sowjetunion in Ostdeutschland installiert wird. Serow selbst kam aus dem Innenministerium, war am stalinistischen Terror, der Großen Säuberung in den 1930er Jahren, führend beteiligt und organisierte die brutalen Deportationen innerhalb der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs, beispielsweise der Wolgadeutschen, der Tschetschenen, der Inguschen und der Krimtataren. Laut Schätzungen starben über 40 Prozent der Deportierten an Unterernährung und Seuchen. Wer sich weigerte, sich „umsiedeln“ zu lassen, wurde erschossen oder, wie es auch vorkam, lebendig in einer Scheune verbrannt.
Als Fachmann für Deportationen organisiert Serow auch die Verschleppung von ungefähr 2500 deutschen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern aus der SBZ in die Sowjetunion. Da die Familien ebenfalls „umgesiedelt“ wurden, werden in einer Geheimoperation in den frühen Morgenstunden des 22. Oktober 1946 ungefähr 6500 Personen deportiert. Nicht nur Menschen bringen die Züge an diesem Tag in die Tiefen der Sowjetunion, sondern auch Industrieanlagen, ganze Werke. Während im Westen bald schon der Marshallplan zu wirken beginnt, wird im Osten Deutschlands das, was der Krieg an Anlagen übriggelassen hat, demontiert und in die Sowjetunion gebracht.
In einem sind sich Werner Ihmels und seine kommunistischen Kontrahenten einig: dass dem, der die Jugend besitzt, die Zukunft gehört. Dieser Kampf wird deshalb mit aller Härte auf bildungspolitischem und vor allem auf akademischem Feld ausgetragen, schließlich geht es um nichts Geringeres als um die künftige Elite des künftigen Staates. Die Universitäten fallen in die Zuständigkeit der Sektion Wissenschaft und Hochschulwesen innerhalb der Verwaltung Volksbildung der SMAD. Im Zuge des Aufbaus deutscher Selbstverwaltungsorgane, in denen die Kommunisten die Schlüsselpositionen einnehmen, wird auf Befehl Nr. 17 der SMAD vom 27. Juli 1945 die Deutsche Zentralverwaltung für Volksbildung (DVV) gebildet, die der deutsche Kommunist Paul Wandel leitet. Die DVV stellt damit das Pendant der Abteilung Volksbildung der SMAD unter Pjotr Solotuchin dar, in der für den Bereich Universitäten der Physiker Pjotr Nikitin tätig ist.
Nationalsozialismus und Krieg haben die Alma Mater Lipsiensis hart getroffen. Dozenten sind im Krieg gefallen oder befinden sich in der Gefangenschaft. Auch Leipziger Wissenschaftler und Hochschullehrer ließen sich mit den Nationalsozialisten ein, einige von ihnen wurden zu strammen Nazis und Verbrechern. Über die Hälfte der Mitglieder der Universität gehörten der NSDAP an. Der Professor für Kinderheilkunde Werner Catel etwa trieb in Leipzig die „Kindereuthanasie“ voran, die Ermordung von Kindern, deren Leben er oder seine Mitarbeiter als „lebensunwert“ einschätzten. Catel geht 1946 nach Westdeutschland und setzt dort seine Karriere fort.
An der Leipziger Universität erfolgt die Entnazifizierung in mehreren Wellen. Nachdem die Amerikaner abgezogen sind und die Russen Leipzig übernommen haben, forcieren sie den Prozess. Der Mediziner und Pharmakologe Ludwig Lendle schüttelt über die Art und Weise, wie die Entnazifizierung durchgeführt wird, nur den Kopf, weil sie „vielfach die Falschen trifft“.21 Unter dem Datum vom 25. Dezember 1945 hält er fest, dass „ein ehemaliges NS-Weib ohne PG-Mitgliedschaft“ jetzt kommunistische Stadtbaumeisterin sei. Einige seiner Kollegen ziehen mit den Amerikanern in den Westen, doch Lendle beschließt, in Leipzig zu bleiben, wie auch der Philosoph und Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer. Lendle, für den das Tagebuch sich zu seinem Selbstverständigungsmedium entwickelt, vergleicht im November 1945 die Nachkriegszeit mit der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Damals: „Aufbauwille […] Hoffnungen […] Keine Bedrohung der Gesamtexistenz.“ Heute: „Gefühl der Leere und Verlorenheit. – Alles unwiderruflich verloren. – Niemand weiß, was kommen wird. Leere.“22
Ganz anders die Stimmung bei Werner Gumpel (Jahrgang 1930) zu diesem Zeitpunkt. Gumpels Vater, Chefarzt im Krankenhaus in Buchholz im Erzgebirge, bewahrte eine sehr gute Flasche Rotwein Jahrgang 1933 im Keller für den Tag auf, an dem Hitler stirbt. Als die Nachricht vom Tod Hitlers die Familie Gumpel am 9. Mai 1945 erreicht, wird die Flasche feierlich geöffnet und auf die Nachricht angestoßen. Zwölf Jahre haben die Gumpels auf diesen Tag gewartet. Der 15-jährige Werner Gumpel beginnt sofort, im Antifaschistischen Jugendausschuss mitzuarbeiten.
Während für Werner Gumpel in Buchholz eine neue Zeit anbricht, gesteht sich der Kriegsheimkehrer Gerhard Schulz in Mahlis ein, dass man sich „abgewöhnen muss, in der Kommunistischen Partei eine politische Willensrichtung der Demokratie zu sehen“23, und der Leipziger Professor Ludwig Lendle versucht sich irgendwie Mut zu machen: „Geduld, die wertvollste Eigenschaft. Nicht in Klagen und Verbitterung versinken! Das Leben bleibt immer noch Aufgabe – auch im Elend.“24
Von den 108 Gebäuden der Alma Mater Lipsiensis können nach Kriegsende nur noch 16 uneingeschränkt genutzt werden. Einige der Professoren engagieren sich für die Wiedereröffnung der Universität und nehmen den Lehrbetrieb in kleinem Maßstab wieder auf, indem sie in ihren Wohnungen Seminare geben, Vorlesungen mit eingeschränktem Zuhörerkreis halten und sogar Prüfungen abnehmen. Zunächst soll die Universität am 1. Oktober 1945 neu starten, doch will die SMAD aus politischen Gründen die Leipziger Alma Mater nicht vor der Berliner Universität, die 1949 den Namen Humboldt-Universität erhalten wird, eröffnen, die am 29. Januar 1946 den Hochschulbetrieb für 2600 Studenten wieder aufnimmt. Hinzu kommen die Personalprobleme durch die strenge Entnazifizierung, die nicht nur von der SMAD, sondern vor allem von den deutschen Kommunisten betrieben wird. Es kommt zu dem Paradoxon, dass die russischen Offiziere, die in der SMAD für die Hochschulen zuständig sind, auf die Tradition der deutschen Universitäten setzen, während die deutschen Kommunisten die Universitäten nach sowjetischem Vorbild umgestalten wollen. Der Grund für diese Paradoxie liegt darin, dass im Gegensatz zu vielen deutschen Funktionären die zuständigen russischen Offiziere vor dem Krieg oft selbst Akademiker waren und Kenntnisse über die deutsche Universität besitzen, entweder, weil sie selbst in Deutschland studiert oder ihre Hochschullehrer deutsche Universitäten besucht haben.
Die rigide Entnazifizierung treibt Lendles Medizinische Fakultät in eine Situation, in der sie nicht mehr arbeitsfähig ist. Zur Fakultät gehören auch die Universitätskliniken, die für die medizinische Versorgung der Bevölkerung eine Rolle spielen. Der Rektor der Universität und der Dekan der Medizinischen Fakultät führen einen zähen Kampf gegen die Leipziger Behörden und die Funktionäre der KPD und SPD; gegen Doktrinäre wie Helmut Holtzhauer etwa, den späteren sächsischen Volksbildungsminister. Von den 259 Lehrkräften des Wintersemesters 1944/45 stehen Ende November 1945 nur noch 49 zur Verfügung. Die anderen sind in den Westen gegangen, umgekommen oder als Nazis nicht mehr zugelassen. Die richtige politische Einstellung ist auch bei der Studienzulassung nicht selten wichtiger als die Befähigung. Lendle notiert am 15. Januar 1946: „In Sprechstunde des Prüfungsvorsitzenden kommt kommunistischer Student mit Bescheinigung der Landesverwaltung – alles wie früher bei den Nazis! Entlarve seinen Schwindel.“ Und 14 Tage später resümiert er: „Nur 120 Mediziner (zum Studium) zugelassen […] Partei empfiehlt vorweg ihre Leute (Studentenführer und Frau).“25
Am 5. Februar 1946 öffnet die Leipziger Universität endlich ihre Pforten für zunächst 767 Studenten. Als Rektor tritt der Archäologe Bernhard Schweitzer an, Dekan der Philosophischen Fakultät wird Hans-Georg Gadamer. Die Zahl derjenigen, die zu studieren wünschen, übertrifft allerdings die Anzahl der Studienplätze, die von der Universität aus Kapazitätsgründen vergeben werden können, um das Doppelte. Für Lendle ist der Tag der Wiedereröffnung der Universität zwiespältig, auf der einen Seite lobt er die Ansprache des „russischen Ministers“ und schwelgt für Gadamers Schlussrede, die „ein Meisterwerk“, auch „rhetorisch“, gewesen sei.26 Wenn man so will, das Gegenstück zu Heideggers Rektoratsrede 1934 in Freiburg. Einerseits gesteht Gadamer zu, dass eine neue Zeit anbricht, in der auch Arbeitern der Zugang zur Universität ermöglicht werden muss, andererseits stehe die Universität nicht im Dienst einer Ideologie. Lendle stellt resigniert fest: „Das neue Collegium erschreckend im Niveau. 3. Garnitur unter sich.“27
In Mahlis wartet indessen Gerhard Schulz auf seine Studienzulassung in Halle. Doch was ihm den Zugang zum Studium erschwert, ist die stalinistische Doktrin, die Stalin selbst in seiner Ansprache an die Jugend so zusammengefasst hat: „Vor uns steht eine Festung. Der Name dieser Festung ist die Wissenschaft mit ihren unzähligen Wissenszweigen. Diese Festung müssen wir um jeden Preis nehmen. Diese Festung muss die Jugend nehmen, wenn sie den Wunsch hat, der Erbauer des neuen Lebens zu sein, wenn sie den Wunsch hat, in der Tat die Ablösung der alten Garde zu sein.“28 Gerhard Schulz macht die Erfahrung, dass die „Türen der Alma Mater“ für ihn verschlossen bleiben. Der Grund dafür ist alles andere als ermutigend und liegt ganz auf der politischen Linie, eine kommunistische Intelligenz zu schaffen: „Ich werde wohl immatrikuliert, für dieses Semester aber nicht zum Studium zugelassen, da ich keiner der beiden Arbeiterparteien angehöre. – So sieht die Demokratie in Wirklichkeit aus.“29
Vor allem die Studenten der kommunistischen Hochschulgruppen verstehen es von Anfang an als ihren Klassenauftrag, Proteste gegen Entscheidungen des Rektors zu organisieren. Klassenkampf nehmen sie ernster als das Studium. Im Streit um die Entnazifizierung verschleißt sich Bernhard Schweitzer und tritt zurück. Gadamer folgt ihm als Rektor. Er bemüht sich, die Universität durch die Kämpfe der Zeit zu führen und vertritt die Belange der Universität höchst geschickt. Doch gegen den Machtanspruch der Kommunisten, der von der Sowjetischen Militäradministration vollkommen unterstützt wird, scheitert jeder Versuch der Schaffung einer weltanschaulich unabhängigen, nur der Wissenschaft verpflichteten Forschungs- und Bildungseinrichtung. Für die Kommunisten ist laut ihrer Doktrin alles Weltanschauung, alles politisch, deshalb kann es in ihrer Vorstellungswelt kein Neutralitätsgebot für die Schulen, Hochschulen und Universitäten geben. Am 18. Oktober 1945 erlassen die Parteivorstände der KPD und der SPD einen Aufruf zur demokratischen Schulreform, in deren Zentrum „die Verwirklichung antifaschistisch-demokratischer Ziele“ steht, die „mit dem Kampf um die Brechung des bürgerlichen Bildungsprivilegs, mit Maßnahmen zur besonderen Förderung von Arbeiter- und Bauernkindern und zur Heranbildung einer neuen, aus dem Volke stammenden Intelligenz“ durchzusetzen sind, wie das offizielle Lehrbuch der DDR eines Autorenkollektivs unter Leitung von Rolf Badstübner 1984 rückblickend schreibt.30 Dem entsprechen auch die Vorstellungen im gemeinsamen Aufruf zur Hochschulreform: „Der neue Geist eines wahrhaft fortschrittlichen Humanismus und kämpferischer Demokratie muss in den Hochschulen Einzug halten.“31 Was die Kommunisten unter „kämpferischer Demokratie“ verstehen, wird sich bald schon zeigen.
Von Anfang an gehörte zum Plan der kommunistischen Machtergreifung die Schaffung einer sozialistischen Staatsintelligenz, einer kommunistischen Elite. Der von Stalin verkündete „Sturm auf die Wissenschaft“ fand in der Sowjetischen Besatzungszone und in der frühen DDR mit aller Brutalität statt. Das Kernanliegen erst der KPD, dann der SED besteht daher in Bezug auf die Universitäten darin, nach sowjetischem Vorbild eine Kaderschmiede für eine der SED ergebene, sozialistische Intelligenz zu schaffen. Um die Anzahl der bürgerlichen Studenten zurückzudrängen, werden die Vorstudienanstalten geschaffen, in denen in einer Art Notabitur junge Leute vor allem aus der Arbeiterklasse, aus den „werktätigen Schichten“, mehr schlecht als recht zum Studium befähigt werden. Unter der Losung: „Arbeiterstudenten an die Universität“ starten im Februar 1946 die KPD und die SPD einen Aufruf, der letztlich vorsieht, dass Absolventen der Vorstudienanstalten bevorzugt zum Studium zugelassen werden. Man setzt durch, dass die Vorstudienanstalten an den Universitäten angesiedelt werden, damit diese „Kader“ auch in den Studentenvertretungen Sitz und Stimme erlangen können.
Es fällt zwar anfangs der KPD und SPD, später der SED schwer, genügend geeignete Bewerber für das Studium oder für die Vorstudienanstalt unter den Arbeitern zu gewinnen, und zuweilen finden sich auch nicht die geeignetsten Personen bereit, dennoch wird die Diskussion um die Arbeiterstudenten zum Feld grundsätzlicher Auseinandersetzung. Dabei lehnen die bürgerlichen Studenten den Gedanken nicht ab, Arbeitern den Zugang zur Universität zu ermöglichen, sie erheben lediglich Einspruch dagegen, dass Absolventen der Vorstudienanstalten in der Konkurrenz um die knappen Studienplätze extrem bevorzugt und die soziale Herkunft höher als die Leistungen bewertet wird. Für die Bevorzugung wird das Argument ins Feld geführt, dass die bürgerlichen Studenten aufgrund ihrer Herkunft einen Bildungsvorsprung besäßen.
In der sächsischen Provinz schlägt sich Gerhard Schulz derweil als Neulehrer durch. Im Schuljahr 1945/46 beginnen etwa 15 000 Neulehrer, die in kurzen Lehrgängen von einigen Wochen bis wenigen Monaten für diese Aufgabe ausgebildet werden, zuweilen parallel zum Unterricht, den sie bereits erteilen. Manch ehemaliger Neulehrer erinnert sich, dass er anfangs oft nur eine Stunde weiter war als seine Schüler.
So recht zum Lehrer fühlt sich Gerhard Schulz jedoch nicht berufen, zumal er ohne größere pädagogische Ausbildung eine Klasse mit Kindern unterschiedlichen Alters zu unterrichten hat, die Krieg und Zusammenbruch erlebt haben und in deren Familien nicht die Bildung im Mittelpunkt steht, sondern das Überleben. Zwar meint er, dass dem Lehrer eine verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut sei, denn schließlich liege es an ihm, „ob unsere Jugend einmal eine Blüte unserer Volkes wird hervorrufen können oder ob sie von Anfang an verdirbt und unser Volk von unten her abstirbt.“32 Aber auch ihm fällt auf: „Das Wort Demokratie ist eine Lüge. Wer es gebraucht, sucht etwas zu überdecken, was das Licht des Tages scheut. Noch niemals ist von der Demokratie so oft geredet worden wie heute. Diese Tatsache wirft ein bezeichnendes Licht auf unser Zeitalter.“33
Schulz beneidet Luise Langendorf, die er von der Wirtschaftsschule in Leipzig her kennt, wo sie wie er das Abitur machte. Nach kurzer Zeit als Neulehrerin kann sie mit dem Studium der Geschichte an der Leipziger Universität beginnen. Sogar die Partei, die LDP, in die er eintrat, ist womöglich die falsche, denn: „Luise und ihre Mutter sind sehr aktive Personen in der Parteiarbeit der CDU, die ich als das tätigste Zentrum gegen den Bolschewismus ansehen muss. Sie scheint tatsächlich die repräsentativsten Köpfe in dieser Zeit zu vereinen und beachtlicher zu sein als die Liberalen, deren Name etwas Unangenehmes, etwas veraltet Klingendes an sich hat. Die CDU sammelt alle Elemente – ganz gleich, welcher Konfession –, die die alten abendländischen kulturellen Welten, die sittlichen und moralischen Werte, die das Christentum in die Menschheit gebracht hat, bejahen“, notiert er am 3. April 1946 in sein Tagebuch. Da ist Luise bereits auf dem Weg ins Studium, das ihm weiterhin versagt bleibt.
II. Das Gefühl der Freiheit: Der Klassenkampf gegen die Demokratie
„Nach der Erkenntnis, dass man einem furchtbaren Irrtum erlegen war, eröffneten sich für einen kurzen Zeitraum ganz neue Horizonte. Wir fanden Zugang zu dem reichen humanistischen Erbe unserer deutschen Kultur und lernten den unschätzbaren Wert der Freiheit der Persönlichkeit kennen […] So waren wir dann besonders sensibilisiert, als Lüge und Gewalt wieder Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wurden. Dagegen versuchten wir anzukämpfen jeder auf seine Weise […] Doch die Gewalt wurde immer stärker und unsere Ohnmacht immer größer. So ergab sich häufig eine Gratwanderung zwischen scheinbarer äußerer Anpassung und innerem Widerstand.“
Hans Günter Aurich1
Luise Langendorf: Der Terror beginnt
Luise Langendorf ist eine bemerkenswerte junge Frau. Am 12. April 1925 in Schleswig geboren, zieht sie nach der Scheidung der Eltern mit ihrer Mutter, einer Konzertpianistin, nach Leipzig und legt dort 1943 das Abitur ab. In einem ihrer Lebensläufe schreibt sie: „Ich gehöre jener Generation an, die ihre Kindheit und einen Teil der Jugend unter dem Faschismus verlebte. Ich wurde zu Hause antifaschistisch erzogen […]“2. Das dürfte stimmen, denn der Vater, Peter Langendorf, arbeitet bis 1933 als Redakteur einer Regionalzeitung, schlägt sich zwischen 1933 und 1945 als kaufmännischer Angestellter durch und kehrt erst 1945 als Redakteur in die Zeitung zurück. Ostern 1938 tritt sie in die Wirtschaftsoberschule in Leipzig ein, um das Abitur zu machen. Dort lernt sie auch Gerhard Schulz kennen. Nach dem Abitur 1943 tritt sie beruflich in die Fußstapfen des Vaters und übernimmt die Schriftleitung des Greizer Boten in Thüringen. Die Stelle dient nicht nur dem notwendigen Gelderwerb, sondern auch ihrer Ausbildung. Mit dem nahenden Zusammenbruch kehrt Luise Langenfeld im April 1945 nach Leipzig zurück. Zunächst arbeitet sie aushilfsweise in einer Gärtnerei und gibt nebenbei Nachhilfestunden. Sie ist politisch interessiert und engagiert sich. Ab Dezember 1945 unterrichtet sie als Neulehrerin an ihrer alten Grundschule in Leipzig Lindenthal. Im August gelingt es ihr, freie Mitarbeiterin beim mdr zu werden.
Im Austausch mit ihrem Vater, der von der Ausbildung her promovierter Historiker ist, entscheidet sie sich für Geschichte als Studienfach und bewirbt sich nach ihrer Rückkehr nach Leipzig an der Philosophischen Fakultät. Sie beginnt im Wintersemester 1946/47 mit dem Studium. Sie ist voller Elan und voller Hoffnung auf den demokratischen Neuanfang, für den sie ihre ganze Kraft einsetzt. Zwar lebt man in Ruinen und auf Lebensmittelkarten, doch viele Wege stehen offen und die Zukunft scheint gestaltbar. Im Frühjahr 1946 tritt sie der CDU bei und wird Pressesprecherin der Leipziger CDU. Neben Geschichte studiert sie Geografie und Publizistik. Gerhard Schulz schwärmt in seinem Tagebuch in den höchsten Tönen über diese aktive und attraktive junge Frau, die er seit seiner Schulzeit kennt, die für ihn, der sich auf dem platten Lande abgeschnitten vom großen Aufbruch fühlt, immer mehr zu einer wichtigen Bezugsperson, zu einer Verbindung zur neuen Zeit wird, und die ihm ermöglicht, zumindest als Zaungast die Entwicklung in Leipzig mitzuverfolgen. Für ihn stellt die CDU „den Konservativismus im besten Sinne des Wortes dar, das einzige Element, das als positive Weltanschauung dem Kommunismus gegenübersteht […] Die CDU stellt in dieser Übergangszeit das positive Moment in unserem Volk dar. Vielleicht lässt sich noch viel aus ihr machen.“3
Der Befehl Nr. 2 der SMAD erlaubt die Gründung von Parteien. Nachdem sich KPD und SPD wieder konstituiert haben, wird am 26. Juni 1945 in Berlin die CDU von Andreas Hermes, Walther Schreiber, Ernst Lemmer und Jakob Kaiser gegründet. Andreas Hermes, der gegen die nationalsozialistische Diktatur gekämpft hatte, dem Kölner Kreis angehörte und Kontakte zu Carl Friedrich Goerdeler, dem ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister, und zum Kreisauer Kreis unterhielt, wurde am 11. Januar 1945 zum Tode verurteilt. Noch am 3. April wurden von den neun zum Tode verurteilten Gegnern des Naziregimes sieben aus den Luftschutzkellern geholt und ermordet. Nur Andreas Hermes und Theodor Hans Friedrich Steltzer überlebten. Hermes wurde zum ersten Vorsitzenden der CDU gewählt. Die offizielle „Geschichte der DDR“ von 1984 gibt dem jungen Gerhard Schulz in seiner Einschätzung nur aus anderer Perspektive durchaus recht, wenn sie resümiert: „Zu den Gründern der CDU in Berlin gehörten Interessenvertreter der deutschen Monopolbourgeoisie wie Andreas Hermes als erster Parteivorsitzender und Jakob Kaiser, aber auch bürgerliche Demokraten wie Otto Nuschke, die bereit waren, gemeinsam mit den Arbeiterparteien an der Errichtung antifaschistisch-demokratischer Verhältnisse mitzuwirken.“4 Otto Nuschke erwirbt später seine Lorbeeren, indem er die CDU im Osten gleichschaltet und zur willigen Blockpartei macht.