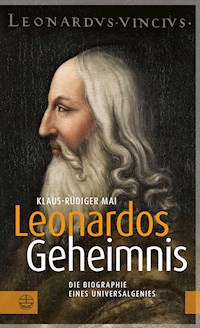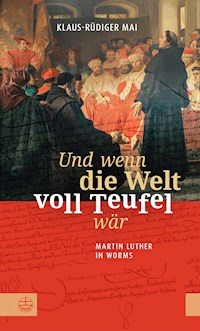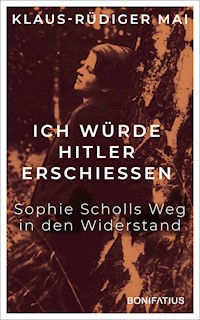14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der abenteuerlichen Flucht des Lutheraners Veit Bach in den religiösen Wirren des 16. Jahrhunderts aus Ungarn nach Thüringen tritt eine der bemerkenswertesten Musikerdynastien Deutschlands auf den Plan. Über mehrere Generationen hinweg sollten die Bachs das Musikgeschehen Deutschlands und Europas maßgeblich prägen. Klaus-Rüdiger Mai schreibt ein einzigartiges Kapitel deutscher Kulturgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Klaus-Rüdiger Mai
Die Bachs
Eine deutsche Familie
Propyläen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt
ISBN: 978-3-8437-0615-5
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013Lektorat: Karin SchneiderEinbandgestaltung: Morian & Bayer-Eynck, CoesfeldTitelgemälde: © B. Denner/Sotheby’s/akg-imagesStammbaum: Thomas Hammer
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Patron, das macht der Wind.Dass man prahlt und hat kein Geld,Dass man das für Wahrheit hält,Was nur in die Augen fällt,Dass die Toren weise sind,Dass das Glücke selber blind,Patron, das macht der Wind.
Johann Sebastian Bach, Geschwinde ihr wirbelnden Winde, BWV 201
Inhalt
Sechs Generationen
I.
Halbdunkel des Ursprungs
Die Flucht
Die Brüder
Eine »sonderliche Zuneigung zur Music«
II.
Eine Familientradition wird begründet
In den Wirren des Krieges
Erstes Glück und frühes Leid
Schwieriger Anfang einer Dynastie
Der Patriarch
Familienbande
Der Organist von »munterm Geiste«
»Der profonde Componist«
Geglückte Überlieferung
Der brave Bruder
Johann Sebastians Großvater
Leben und Leiden eines Hofmusikers – des Vaters Zwillingsbruder
Der Vater
III.
Unscheinbare Geburt eines Genies
Der frühe Tod der Eltern
Beim Bruder
Musikalisches Glück in der Fremde
Hamburger Erfahrungen
Student oder Musiker
Die Bachs erobern Thüringen
Auf dem Weg zum Organisten
Erstaunlicher Anfang einer großen Karriere
Arnstädter Querelen
Johann Sebastian verliebt
Mühlhäuser Zwischenspiel
Himmelsorganist und Hofkomponist
Ein sehr gemischtes Jahr
Erschallet, ihr Lieder
Vom Glück eines Hofkapellmeisters
Ein Stück vom Himmel
Ein fast vergessener Bach
Eine folgenreiche Bewerbung
Die Passion der Familie
Die große Krise
Eine Ära endet
IV.
Deutschlands erster Romantiker
Vom Glück der gelungenen Existenz
Vom Glück des Verkanntseins
Untreu sind die Götter ihren Lieblingen
Epilog
Bildteil
Anmerkungen
Literatur
Stammbaum
Bildnachweis
Sechs Generationen
Die nasse Kälte drang durch alle Ritzen. Vom Klassenzimmer aus, in dem Johann Sebastian Bach gerade den Unterricht in der Sekunda beendet hatte, betrat er die Musikbibliothek, in der zwei Kopisten für ihn arbeiteten. In den Regalen lagerten Schätze, über 4500 Stimmbücher, 500 Bände vor allem theologischer, musikalischer und philosophischer Literatur und Noten unbestimmter Zahl. Der Anblick, der ihn sonst mit Stolz und Freude erfüllte, konnte ihn an diesem grauen Februartag nicht aus seinen düsteren Gedanken reißen. Das Jahr 1735 hatte ihn ganz und gar unerwartet in eine Krise gestürzt. Zum ersten Mal in seinem Leben empfand er das Gefühl einer Unsicherheit, einer Ahnung, kommenden Ereignissen wehrlos ausgeliefert zu sein. Besonders beunruhigte ihn, dass er sich, obwohl nicht zur Melancholie neigend, aus dieser Stimmung nicht befreien konnte.
Vorbei an einem viertürigen Bücherschrank führte der Weg in seine Komponierstube. Sein Blick fiel auf den Schreibtisch, dann durch das Fenster auf das schneebedeckte Dach der Thomasmühle. Der kleine Seitenarm der Pleiße trug eine dünne Eisdecke, aber die sah er nur, wenn er die Augen ein wenig zukniff. Ein leichter Wind hatte Schnee wie Spinnweb über den Weg geweht, der an der Mühle vorbei ans andere Ufer des Flüsschens führte. Vor vierzig Jahren, auch an einem kalten Februartag, war sein Vater gestorben und hatte ihn noch nicht zehnjährig als Waise zurückgelassen. In nicht ganz einem Monat würde er fünfzig Jahre alt sein, so alt wie sein Vater bei seinem Tod.
In seinem Leben hatte es immer wieder schwierige Situationen und heftige Auseinandersetzungen gegeben, eine hatte sogar im Kerker des Herzogs von Sachsen-Weimar geendet. Nur zu gut wusste er, dass man die Bachs achtete, aber ihren Eigensinn nicht schätzte. Schon zwei Generationen zuvor hatte der damalige Direktor der Arnstädter Ratsmusik, Heinrich Gräser, geklagt, dass die Bachs »stolz« seien und obendrein »untüchtige Gauner«. Vor allem hatte ihn ihr Trotz erzürnt, der berühmte bachsche Eigensinn. Mit dieser Einschätzung stand Gräser nicht allein. Johann Sebastian musste sich eingestehen, dass sich nichts geändert hatte. Aus Arnstadt war auch er im Streit gegangen. Und in Leipzig zogen sich gerade die Gewitterwolken über ihm zusammen.
Nicht nur eskalierte die Auseinandersetzung mit dem bornierten Rektor der Thomasschule Johann August Ernesti (1707–1781), der Leipzigs Stadtpolitiker gegen ihn aufwiegelte, auch stellte sich immer drängender die Frage, wie der Gefahr zu begegnen sei, immer nur Altes zu wiederholen, ohne Neues zu schaffen. Er war noch nicht einmal fünfzig Jahre alt, und trotzdem sprach man von ihm schon als dem alten Bach. Eine junge Generation Musiker, zu der seine beiden älteren Söhne gehörten, schickte sich an, mit ihren Kompositionen Kirchen, Konzertsäle und den Musikmarkt zu erobern. Johann Sebastian entging nicht, dass ihm drohte, zu Lebzeiten vergessen zu werden. Seine Erfahrung sagte ihm, dass nur der in der Musikwelt bestand, der sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhte, sondern ihr beständig neue Impulse verlieh. Das Publikum war nicht nur unersättlich, sondern auch wählerisch, und vor allem besaß es einen Heißhunger auf Neues. Doch das Neue durfte, auch das wusste er, allzu neu nicht sein, sondern sollte lieber nur den Anschein erwecken. Die Bachs hatten immer ein Gespür für das Mögliche besessen. Das Alte zu bewahren und das Neue zu tun genügte nicht. Altes und Neues, Vertrautes und Überraschendes mussten eins sein, nahtlos ineinandergewoben. Dabei durfte man sich selbst nicht untreu werden, denn dann verlor man sein Publikum, ohne ein anderes zu gewinnen. Mit einem Wort: seine aktuelle Lage erwies sich künstlerisch wie beruflich als ausgesprochen heikel. Johann Sebastian machte sich keine Illusionen darüber, wie schnell Sicherheiten schwinden und er und seine Familie im Elend enden konnten. Seine Existenz hing einzig und allein an der Achtung, die er in der Musikwelt genoss.
Er ging zu seinem Schreibtisch und schaute auf die darauf ausgebreiteten Noten Johann Christoph Bachs, der ein Cousin seines Vaters und ein tüchtiger Komponist gewesen war. Die Hochzeitskantate, die Johann Sebastian einst abgeschrieben hatte, erinnerte ihn an seinen Bruder, der auch Johann Christoph hieß, und an dessen Hochzeit, auf der sie das Werk aufgeführt hatten – sein Vater, der berühmte Johann Pachelbel, sein Bruder Johann Jacob und er. Ein Lächeln umspielte seine Lippen und ließ seine Augen leuchten. Dann stand sein Entschluss fest. Er nahm ein Blatt vom Stapel, tauchte die Feder ins Tintenfass und begann zu schreiben: »Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie«.
So widerstand er der Versuchung, die Flucht nach vorn anzutreten und mit gefälligen Kompositionen dem Zeitgeist hinterherzulaufen. Stattdessen tat er etwas, das, ungewöhnlich genug, weder für das Publikum noch für Verleger, Musiker und Sänger, sondern nur für ihn selbst bestimmt war. War es nicht Zeit für eine Positionsbestimmung, wo sich doch gerade die Stellung des Musikers grundlegend änderte? War ihm nicht manchmal so, als stünde er auf auseinandertreibenden Eisschollen? Etwas war in Bewegung geraten. Hatte sich der Musiker bisher vor allem als Handwerker und Dienstleister verstanden, so empfand er sich zunehmend als autonomer Künstler. Er selbst hatte diese Entwicklung maßgeblich vorangetrieben – mit der vielgescholtenen bachschen Unbotmäßigkeit. Aber war diese nicht viel eher Eigensinn und Selbstvertrauen? Vertrauen in das eigene Können und ein ausgeprägter Sinn für das Eigene? Jetzt kam es darauf an, nicht zum Opfer dieser Entwicklung zu werden.
Wer also war er? Was war er? Was durfte er fordern, er, der berühmte Thomaskantor, der doch nicht einmal ein theoretisierender, sondern nur ein praktischer, also ausübender Musiker war? Kein Gelehrter, kein Philosoph, kein Dichter und schon gar kein Aristokrat, stand er in der gesellschaftlichen Achtung unter dem Musiktheoretiker und dem Musikschriftsteller. Johann Mattheson, der soeben den Beruf des Musikkritikers erfunden hatte, gab die Schuld an der beklagenswerten Musikpraxis seiner Zeit der mangelnden Bildung der Musiker und dem alles erdrückenden Gewicht der Kirchenmusik – dabei solle Musik nicht Gott, sondern die Menschen erfreuen. Matthesons Feldzug gegen die Kirchenmusik war ein Angriff auf ihn, denn die Kirchenmusik war seine Domäne, seine musikalische Heimat. Der Publizist, der auch Komponist, Opernsänger und höfischer Beamter war, wollte unter allen Umständen galant sein, der Thomaskantor nicht. Der Vorwurf der Unbildung traf ihn nicht, aber die modische Wendung gegen die Kirchenmusik rief seinen Widerspruch auf den Plan.
In der Auseinandersetzung mit derlei drängenden Fragen formte sich aus dem, was sich im Familiengedächtnis an Anekdoten und Erinnerungen erhalten hatte, die Chronik einer Musikerdynastie, die seit sechs Generationen Musikgeschichte schrieb. Fünf Bach-Generationen waren ihm im Musizieren vorausgegangen.
Die Bachs standen auch dank Johann Sebastians Schaffen auf dem Höhepunkt der Anerkennung und des Ruhms; gleichwohl ahnte er als Vater begabter Söhne, dass sich die aufwärtsstrebende Linie noch fortsetzen ließ. Beim Abfassen der Familienchronik wurde ihm bewusst, dass es nicht nur um seine, sondern auch um die Stellung seiner Söhne in der Musikwelt ging. Mit Akribie legte er ein Archiv1 an, das alle Kompositionen und biographischen Informationen seiner Vorfahren enthielt, derer er habhaft werden konnte. Dieses Werk ist umso bemerkenswerter, als zu jener Zeit noch viele Kompositionen als Original oder höchstens als Abschrift kursierten, für den einmaligen Gebrauch geschrieben und nie gedruckt. Alle Mitglieder der Familie, die halbwegs eine Note schreiben konnten, waren ebenso wie die Lehrburschen fortwährend damit beschäftigt, seine Kompositionen für die Aufführungen zu kopieren, denn das gehörte zu den Dienstpflichten eines Kantors. Gelegentlich stellte man auch Kopisten an.
Bei der Zusammenstellung der Familienchronik und der Sammlung der bachschen Musikwerke ging es Johann Sebastian nicht um die Veröffentlichung, sondern um die Begründung eines Archivs, das nur für die Familie, vor allem für ihn selbst bestimmt war. Dennoch war sein privatestes Werk am allerwenigsten privat. Es wurde zum Instrument der Selbstvergewisserung und zur zukunftsweisenden Urkunde des Ruhmes dieser Dynastie. Von hier aus konnte es nur aufwärts oder abwärts gehen – ein Verharren kam nicht in Frage. Mit der Genealogie stellte sich Johann Sebastian in die Tradition seiner Familie, die so viele Musiker hervorgebracht hatte. Jeder Vorfahr bekräftigte seinen eigenen Anspruch, im Dienste der Musik zu stehen, wie sie alle seit fast zweihundert Jahren, in Thüringen, in Stockholm, in London, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg oder Braunschweig, in Franken, Sachsen und Anhalt, in Polen, ja selbst im Osmanischen Reich. In der Tradition, die er bewusst aufleben ließ, fand er die Verpflichtung, der Lebenskrise zu wehren, Neuland zu betreten und dennoch musikalischen Moden nicht hinterherzulaufen, weiter an seiner regulierten Kirchenmusik zu arbeiten, der für die wechselnden Anlässe im Kirchenjahr komponierten Werke, und das Verstehen der Welt durch die Musik zu befördern.
Auf den ersten Blick verwundert es, dass der vielbeschäftigte und stets unter Zeitdruck stehende Komponist sich dieser Mühe unterzog, die, sosehr sie ein Segen für die Bach-Forschung ist, für ihn vor allem Kraft- und Zeitverschwendung bedeuten musste, da sie ihm keinen offenkundigen Nutzen erbrachte. Etwas muss ihn angetrieben haben, etwas, das mehr war als Laune oder Eitelkeit. Das Projekt blieb schließlich unvollendet. Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel setzte die Arbeit fort, brachte sie aber auch nicht zum Abschluss.
Will man eine Antwort auf die Frage finden, was Johann Sebastian Bach zur Arbeit an der Genealogie bewegte, muss man sich in den Aufbau der Chronik mit dem schnörkellos selbstbewussten Titel »Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie« vertiefen, ihn trotz der nüchternen Form der Auflistung als Komposition begreifen.
Aus der Überschrift der siebzehn Seiten spricht zuallererst der Stolz eines Mannes auf seine Herkunft und auf seine Familie, die ihren Adel nicht Blut, Geld oder Amt verdankt, sondern der Erhabenheit der Musik, die sie schuf. In Thüringen wurden die Begriffe Musiker und Bach über lange Zeit synonym gebraucht. In Erfurt sprach, wer Musiker meinte, allgemein von den Bachen.
In der Genealogie seiner Familie findet Johann Sebastian Bach trotz aller Missachtung durch die Leipziger Pfeffersäcke und durch professorale Kunstwächter wie Johann Christoph Gottsched (1700–1766) und seinen Schüler Ernesti, trotz des ewig stänkernden Matthesons in Hamburg zu einem autonomen Ich. Niemandem musste er zu Willen sein, keinem Fürsten, keinem Pfeffersack, keinem Gottsched und keinem Ernesti. Schon ein flüchtiger Blick auf die Abstammung beantwortete die Frage, wer sich eines größeren Adels rühmen durfte. Nicht ohne Grund begann Johann Sebastian die Chronik mit einer präzise komponierten Ouvertüre, in der er die beiden Themen anschlug, aus denen das große Oratorium der Bach-Dynastie sich erhob: die Musik und das Luthertum.
Trotz der unermüdlichen Suche zahlreicher akribischer Bach-Forscher bleiben die Anfänge der Familie allzu vage, um darüber berichten zu können. Weiter als Johann Sebastian im Jahr 1735 ist kein anderer in die Vorgeschichte eingedrungen. Er hätte seine Chronik nicht mit dem halbmythischen Veit Bach beginnen müssen; gleichwohl hätte er in der ganzen bachschen Familiengeschichte keinen besseren Stammvater finden können.
Vieles mag strittig sein, nur eines nicht: Die Geschichte der Bach-Dynastie beginnt in einem thüringischen Flecken namens Wechmar, zweieinhalb Wegstunden von Gotha, gute vier von Arnstadt, eine Tagesreise von Erfurt, Weimar und Eisenach entfernt.
I.
… dieses ist gleichsam der Anfang zur Music
Halbdunkel des Ursprungs
»Veit Bach, ein Weißbecker in Ungern, hat im 16ten Seculo der lutherischen Religion halben aus Ungern entweichen müssen.«2 Sparsame und dennoch präzise Worte für ein dramatisches Geschehen: Ein unbeugsamer Christ entkam bei Nacht und Nebel in letzter Minute seinen Häschern, gab seine Existenz auf, um seinem Glauben treu zu bleiben. Mit diesem Beispiel aufrechten Luthertums begann Johann Sebastian Bach die Chronik seiner Familie. Vielleicht war es kein Zufall, dass der Thomaskantor zur gleichen Zeit an der Kantate »Ein feste Burg ist unser Gott« (BWV 80) arbeitete, deren Text von Martin Luther stammt.
Johann Sebastian beschrieb den Stammvater der Dynastie als einen Flüchtling aus religiösen Gründen, als einen Mann, der im Angesicht einer Gefahr für Leib und Seele eine mutige und richtige Entscheidung traf. Der sich, wie von Martin Luther dringend empfohlen, an sein Gewissen hielt. Der sichere, gutbürgerliche Verhältnisse, deren Bewahrung einer Konversion bedurft hätte, aufgab und eine Wanderschaft ins Ungewisse antrat. Die Religion zu wechseln schien dem Müller oder Weißbäcker Veit Bach viel unzumutbarer zu sein, als in die Heimat zurückzukehren und sich dort eine neue Existenz aufzubauen.
In auffälliger Weise spricht auch die Kantate von der Gefahr an Leib und Seele, verkündet Gott als Rettung, als feste (Flucht-)Burg und warnt eindringlich davor, von dieser Burg zu lassen. Versichert die Aria Nr. 2, dass alles, was von Gott geboren, zum Sieg erkoren ist, so warnt das Rezitativo Nr. 3 – »Erwäge doch, du Kind Gottes« –, abtrünnig und sündig zu werden, während die Aria Nr. 4 einlädt, im Glauben Wohnung zu nehmen: »Komm in mein Herzenshaus«. Veit Bachs Entschluss, um der lutherischen Religion willen Ungarn zu verlassen, kostete Überwindung, denn er musste seinen Besitz, alles, was er geschaffen und sich erarbeitet hatte, zu Geld machen. Mit Verlust, worauf Johann Sebastian ausdrücklich hinwies, also unter Opfern. Doch die Opfer würden sich auszahlen, denn »alles, was von Gott geboren, ist zum Sieg erkoren«.
Und tatsächlich, Veit fand in »Thüringen genugsam Sicherheit vor [für] die lutherische Religion« und auch ein Auskommen, denn er konnte seine »Profession« von neuem ausüben. Er musste letztlich keine Einbußen hinnehmen, und was er verloren hatte, gewann er zurück. Im thüringischen Wechmar, in lutherischen Landen, war Veit nun in Sicherheit. Auch »… wenn die Welt voll Teufel wär / und wollt uns gar verschlingen, / so fürchten wir uns nicht so sehr, / es soll uns doch gelingen«,3 heißt es im Choral Nr. 5 der Kantate. Die Mühle, in der Veit das Korn zu Mehl mahlte, zeichnete Johann Sebastian als Idylle, als »Herzenshaus«, denn dort ging der Stammvater seinem eigentlichen »Verlangen«, der Musik, nach. »Er hat sein meistes Vergnügen an einem Cythringen gehabt«, einem Saiteninstrument, das Mandoline und Laute ähnelt, »welches er auch mit in die Mühle genommen, und unter währendem Mahle daraufgespielet. (Es muss doch hübsch zusammen geklungen haben! Wiewohl er dabey den Tact sich hat imprimiren lernen)« – die Mühle als Metronom und Lehrmeister. Dieses Bild erinnert an die kleine Szene, die der Astronom Johannes Kepler, ein Zeitgenosse Veit Bachs, in seiner »Weltharmonik« als den Beginn der bewussten Beschäftigung mit der Musik bezeichnete: Als der griechische Philosoph Pythagoras, auch als Mathematiker bekannt, an einer Schmiede vorbeikam, fielen ihm »die harmonisch abgestimmten Töne der Hämmer« auf. So wie Veit Bach von den Mahlsteinen den Takt erlernte, entdeckte Pythagoras in der Schmiede die Harmonie, genauer: die Proportionen, die harmonische von dissonanten Tonintervallen unterscheiden.4
Wir wissen kaum etwas über das Leben von Veit Bach, ob er ein zweites Mal geheiratet hat, wie viele seiner Kinder er sterben sah, aber seinem berühmten Nachkommen lag daran festzuhalten, dass er mit Gottes Hilfe eine große Lebensentscheidung getroffen hatte, die für ihn zum Guten ausschlug und die Dynastie der Thüringer Musikerfamilie begründete. Umso mehr existieren Legenden und Theorien über Veit und seine Brüder. Mancher zerlegte den Stammvater in den älteren Veit I. und den jüngeren Veit II., doch es gibt keinen Grund, sich nicht an die Familienüberlieferung zu halten, sofern sie nicht zu anderen Quellen in Widerspruch steht.
Das Leben der Musikerfamilie Bach war von Anfang an eng mit dem deutschen Protestantismus verwoben. Der Stammvater der »musicalisch-Bachischen Familie« wurde in eine Welt geboren, die gerade dabei war, sich grundlegend zu verändern. Auf dem Reichstag zu Augsburg war am 25. September 1555 der »Augsburger Religionsfrieden« beschlossen worden, der die freie Ausübung der lutherischen Religion verfassungsrechtlich zusicherte. Durch die Regelung cujus regio, eius religio – »wessen Land, dessen Religion« – wurden die mitteldeutschen Territorien evangelisch. Ohne Luthers Reformation hätte es die bachsche Musikerdynastie wohl kaum gegeben.
Im Herzen Thüringens, an der Route zum Wallfahrtsort Vierzehnheiligen im heutigen Oberfranken, liegt Wechmar und in Wechmars Mitte die Kirche Sankt Viti. Nach dem Schutzpatron der Kirche, dem heiligen Veit oder Sankt Vitus, erhielt der Stammvater der Bachs seinen Namen, denn geboren wurde er an einem 15. Juni, dem Sankt Veitstag, wahrscheinlich in dem so bedeutungsvollen Jahr 1555. Eine Reliquie des Nothelfers war in der Wechmarer Kirche verehrt worden, bis sie im Sturm der Reformation mit dem Sühnkreuz vor der Kirche verbrannt worden war. Das Feuer, in dem die alte Welt in Flammen aufging, wird auch der drei- oder vierjährige Hans Bach, Veits Vater, miterlebt haben.
Seinen eigenen Namen hatte Hans Bach, wie es üblich war, bereits dem Erstgeborenen gegeben. Der jüngste der drei Brüder würde den Namen Caspar bekommen. Über Töchter und andere Söhne schweigen die Quellen, doch darf man davon ausgehen, dass die Familie größer war. Über Veit Bachs Kindheit in Wechmar ist nichts bekannt. Sicher ist nur, dass er sich auf die Wanderschaft begab, auf die Walz, wie es für Gesellen üblich war. In Ungarn ließ er sich nieder. Den Grund kennen wir nicht, aber er wird bei einem Meister untergekommen sein, der ihn schätzte, und vielleicht hätte er schließlich eine der Töchter des Meisters geheiratet, um eines Tages dessen Gewerbe zu übernehmen. Wenn man im Zusammenhang mit Veit Bach von Ungarn spricht, dann ist eher das Gebiet der heutigen Slowakei und Nordungarns gemeint, vielleicht auch noch Siebenbürgen. In den südmährischen Städten Pressburg, Kaschau, Thuróc und Eger lebten viele deutsche Handwerks- und Kaufmannsfamilien, wie auch im siebenbürgischen Kronstadt, in Hermannstadt, Mühlbach, Weißenburg und Klausenburg.
Was hatte Veit im heimischen Wechmar erlebt, was prägte sein Weltbild, sein Selbstverständnis, seinen Glauben? Worüber sprachen die lutherischen Prediger in der neuen Heimat? Im Wesentlichen von vier Dingen: von der Gerechtigkeit, vom Glauben, von der Tugend und von der Freiheit. Am wichtigsten war Veit Bach diese neue Freiheit im Glauben, für sie würde er alles aufgeben, was er sich in Ungarn erarbeitet hatte, um nach Wechmar zurückzukehren, wo ein Lutheraner dank des Augsburger Religionsfriedens Sicherheit genoss.
Zu den bedeutendsten Schriften der Reformation zählt Martin Luthers »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. Zum ersten Mal hörten die Menschen, dass Gott die Freiheit des Christen nicht nur garantiere, sondern dass sie die Grundlage des Glaubens bilde. Um die Balance zwischen Freiheit und Verantwortung zu finden, deutete Luther die sogenannte Zweinaturenlehre neu. Das trinitarische Glaubensbekenntnis, dem zufolge Jesus Christus ganzer Gott und ganzer Mensch sei, »wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater … der für uns Menschen und wegen unseres Heils vom Himmel herabgestiegen und Fleisch geworden ist durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria, Mensch geworden ist«, übertrug der Reformator auf den Christenmenschen, der für ihn »ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan« war, zugleich aber »ein dienstbarer Knecht aller Ding und jedermann untertan«5. Denn der Mensch habe eine Seele, die von Gott komme, weshalb der Christenmensch wie Jesus Christus auch zwei Naturen besitze, eine geistliche und eine leibliche. Der geistliche, seelische, innere Mensch sei frei, der äußerliche, leibliche Mensch aber allem dienstbar.
Luther ging von der Definition des Apostels Paulus im Korintherbrief aus, die besagt, dass der Mensch frei in allen Dinge sei, sich aber freiwillig zu jedermanns Knecht gemacht habe (1 Kor 9), weil er dem Gebot der Liebe gefolgt sei (Röm 13). In Luthers Übersetzung heißt das: Der Mensch als Gottes Ebenbild ist frei und niemandes Untertan, denn wer den Menschen ausbeutet und unterjocht, unterjocht und beutet Gott aus. Aber der Mensch entscheide sich aus freien Stücken und vor allem vermöge seiner von Gott verliehenen Freiheit, Verantwortung für die Welt, für die Schöpfung zu übernehmen. Damit wurde ein radikal neues Verhältnis des Menschen zu Gott, zum Mitmenschen und zur Welt definiert.
Hatte der Mensch bisher nur als der ewige Sünder gegolten, schwach und verführbar, deshalb der Leitung der Priester bedürftig, so trete er nun als freier Mensch in seine Verantwortung ein, gerecht durch den Glauben allein, der eine Gnade sei. Forderte mehr als zwei Jahrhunderte später Johann Sebastian Bachs Zeitgenosse Immanuel Kant den Mut, »sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen«,6 so forderte Martin Luther in Wittenberg, sich seines Glaubens aus dem Wissen heraus zu bedienen, dass durch Christus alle zum Priester berufen sind.
Luthers Reformation war zunächst die Reaktion darauf, dass mehr als zweihundert Jahre lang jede Erneuerung der Kirche unterblieben war. Keineswegs wollte er die Grundfesten der Institution ins Wanken bringen, schon gar nicht hatte er die Gründung einer neuen Konfession im Sinn. Mit seiner Theologie der Rechtfertigung durch Gnade bezog er sich auf Augustinus und sein einflussreiches Werk »Über den Gottesstaat«, in dem der Kirchenlehrer zu Beginn des 5. Jahrhunderts den Gegensatz zwischen der civitas terrena und der civitas dei erörtert und abwägt zwischen dem Nutzen des irdischen Staates, der die Einhaltung von Gesetzen überwache, und dem Ideal des Gottesstaates, dessen leider unvollkommene irdische Erscheinung die Kirche darstelle.
Nicht zufällig war es die Zeit der großen apokalyptischen Bilder. Wie Martin Luther bezog sich auch Michelangelo auf Augustinus und auf Joachim von Fiore (1130/35– 1202), dessen Endzeitvision angesichts des Taumels, der die mittelalterliche Welt erfasst hatte, nur umso realistischer erschien. Der kalabrische Abt hatte das letzte von drei Zeitaltern in der Ära des Heiligen Geistes und der Mönche gesehen – und nun war der Augustinermönch Martin Luther auf die Bühne der Welt getreten.
Die Visionen der Apokalyptik wurden als genauso real und unausweichlich verstanden wie die drohenden Strafen der Hölle und der ersehnte Lohn des Paradieses. Der Italiener Dante Alighieri hatte zwei Jahrhunderte zuvor die Höllenqualen im Inferno plastisch beschrieben, und die Wanderprediger, die durch die Städte und Dörfer zogen, legten ihre ganze Wortgewalt darein, die Höllenstrafen wirkungsvoll auszumalen und in den Köpfen ihrer Zuhörer Gestalt annehmen zu lassen. Auf diesen Gewissheiten beruhte die Welt. Deshalb gingen Menschen lieber in den Tod, als ihrem Glauben abzuschwören. Auch Veit Bach flüchtete aus Ungarn, um der Konversion zu entgehen.
Im Übrigen hielt die Hölle auch sehr real ihre Tore offen. Verwesende Leichen an Galgen und ans Stadttor genagelte Köpfe waren oft das Erste, was ein Reisender sah, wenn er sich einer Stadt näherte. Jedermann sollte sehen, dass ein starkes Regiment herrschte. Zur Abschreckung wurden Hinrichtungen als öffentliche Darbietungen inszeniert. Genützt hat es wenig, die Gewalt dieser Zeit hatten schon zwei Generationen vor Veit Bach die Bilder Matthias Grünwalds, Jörg Ratgebs, Albrecht Dürers oder Lucas Cranachs festgehalten. Christus, der Leidensmann, wurde zum Symbol für den Menschen schlechthin, Maria zur gütigen Mutter, die Schutz versprach in Bedrängnis und Gefahr. Von Fürbitten erhofften sich die Menschen ihre Hilfe.
Dabei hatte lange vor Luther, bereits im 14. Jahrhundert, Meister Eckhart auf die Bedeutung des eigenen Glaubens hingewiesen, die Menschen zu ermutigen versucht, selbstbewusst ihr Verhältnis zu Gott zu klären und auf Fürbitten zu verzichten: »Die Leute sagen oft zu mir: ›Bittet für mich!‹ Dann denke ich: ›Warum geht ihr aus? Warum bleibt ihr nicht in euch selbst und greift in euer eigenes Gut? Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch.‹«7 Jeder Mensch sei zum Denken, zur Erkenntnis der Wahrheit befähigt, denn die Wahrheit sei Teil seines Wesens.
Martin Luther griff Meister Eckharts Überlegungen auf und formulierte, was als Lebensmaxime der Bachs gelten könnte: »Nun nehmen wir uns den inwendigen, geistlichen Menschen vor, um zu sehen, was dazu gehört, dass er ein rechter, freier Christenmensch sei und heiße. Hier ist’s offenbar, dass kein äußerlich Ding ihn frei und gerecht machen kann … Ebenso hilft es der Seele nicht, wenn der Leib heilige Kleider anlegt, wie es die Priester und Geistliche tun; auch nichts wenn er in Kirchen und heiligen Stätten weilt … auch nichts, wenn er leiblich betet, fastet, Wallfahrten macht und alle guten Werke tut … Es muss alles noch etwas anderes sein, wenn es der Seele Rechtschaffenheit und Freiheit bringen und geben soll.«8
Besonders der Ablasshandel hatte Luther erzürnt, die Möglichkeit, Befreiung von kirchlichen und göttlichen Strafen zu erwerben. Die Ablässe erteilte Christi Stellvertreter auf Erden, der Papst, der den dank des Wirkens der Heiligen angesammelten Gnadenschatz verwaltete: Der heilige Sebastian beispielsweise hatte durch sein Martyrium mit jedem Pfeil, der seinen Körper durchbohrte, ein Quantum der Gnade Gottes für die Kirche erworben, die nun diese Gnade in klingende Münze umwandelte, indem sie sie den Sündern als Ablass von ihren Strafen verkaufte.
Die Erde galt den meisten Menschen nur als Durchgangsstation auf der Reise in eine Ewigkeit, für die sie auf Gottes Gnade hofften. Erreichen konnten sie diese nicht nur durch den Erwerb von Ablassbriefen, sondern auch durch Pilgerreisen an geweihte Stätten wie Jerusalem, die sieben Kirchen Roms, die Kathedrale in Santiago de Compostela oder eben die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen in Oberfranken. Der Reliquienschatz des Kardinals Albrecht in Halle beispielsweise, auch Hallesches Heiltum genannt, versprach einen Ablass von 39 Millionen Jahren – in der Ewigkeit zwar nicht einmal ein Wimpernschlag, aber aus der Sicht eines Menschenlebens unendlich lange.
Der dubiose Hintergrund des Ablasshandels blieb nicht verborgen. Der Dominikaner Johann Tetzel predigte: »Wenn das Geld im Kasten klingt, / die Seele in den Himmel springt«. Die Deutschen fühlten sich von der Kurie in Rom und dem eigenen Klerus ausgeplündert. Mit den »Gravamina der deutschen Nation« richteten sie ihre Beschwerden gegen diesen Raubzug an den Vatikan – vergebens.
Dann erschien Martin Luther auf der Kanzel, nannte den Papst einen Teufel und lehrte, dass Christus keinen irdischen Stellvertreter benötige, denn alle »sind wir Priester; das ist noch viel mehr als Königsein, deshalb, weil das Priestertum uns würdig macht, vor Gott zu treten …«. Jeder Mensch könne und solle sich zu Gott direkt ins Verhältnis setzen. Christus benötige weder Mittler noch Stellvertreter, weil er in der Welt sei; er brauche keinen Hof voller Kardinäle und Bischöfe, sondern sei unmittelbar für jeden erreichbar. Aus der Kirche, der Kurie und dem Klerus sei »eine solch weltliche, äußerliche, hochfahrende, furchterregende Herrschaft und Gewalt geworden, dass die rechte weltliche Macht es ihr keineswegs gleichzutun vermag, gerade als wären die Laien auch etwas anderes als auch Christenleute«.9 Wirkungsvoll konterte Luther den vatikanischen Herrschaftsanspruch mit dem menschlichen Gewissen als der letzten Instanz. Als ihn der Offizial des Kurfürsten von Trier, Johann von der Ecken, am 17. April 1521 auf dem Reichstag zu Worms mit den Worten: »Martin lass dein Gewissen fahren …« beschwor, einzulenken, antwortete Luther laut und vernehmlich vor den Vertretern der Reichsstädte und vor Kaiser Karl V.: »Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen.«10
Gott und das Gewissen wurden zu den Leitbildern der neuen Zeit, der feste Grund, die feste Burg einer neuen, individuellen Weltanschauung. Gott und das Gewissen wurden zum Quell des lutherischen Weltbildes der Bachfamilie – Gott, das Gewissen und die Musik. Insofern trug die Wahl Veit Bachs als Stammvater durch Johann Sebastian symbolische Bedeutung. Der Thomaskantor hätte seine Familiengeschichte auch mit Hans, dem Vater Veits, oder mit dessen Sohn Johannes, der bereits ein professioneller Musiker war, beginnen können, aber mit Veit Bach, dem Glaubensflüchtling aus Ungarn, begann die für die Familie so prägende Verbindung von Luthertum und Musik. Weil er in Wechmar eine sichere Existenz fand, konnte die »musicalisch-Bachische Familie« wachsen und gedeihen. In diese Tradition stellte sich Johann Sebastian. Von hier nahm alles seinen Anfang.
Die Flucht
Wohl zu Beginn der 1570er Jahre, als in der Seeschlacht von Lepanto die osmanische Vorherrschaft zur See für immer gebrochen wurde, als Johannes Kepler und der Komponist Michael Praetorius das Licht der Welt erblickten, als Tycho Brahe im Sternbild Kassiopeia eine Supernova entdeckte, als in der Pariser Bartholomäusnacht Tausende von Hugenotten ermordet wurden und mit der Erfurter Teilung Thüringen in das Herzogtum Sachsen-Weimar und das Fürstentum Sachsen-Coburg-Eisenach zerfiel, irgendwann in dieser Zeit begab sich der siebzehnjährige Geselle Veit Bach aus dem thüringischen Flecken Wechmar auf die Wanderschaft. Sein wichtigstes Gepäckstück war seine geliebte Cythringen. Er durchstreifte auf seinem Weg ausschließlich protestantische Lande. Thüringen war lutherisch, in Böhmen pflegten die Böhmischen Brüder das Erbe von Jan Hus und den Hussiten.
Seit Martin Luthers spektakulärem Auftritt vor dem Reichstag zu Worms hatte die Reformation an Boden gewonnen. Sie strahlte weit bis Ungarn und Italien und setzte der katholischen Kirche so zu, dass sie zeitweise um ihre Existenz, der Klerus um sein Leben kämpfen musste. Giulio Antonio Santorio (1532–1602), der spätere Großinquisitor, hatte sich als junger Priester in Neapel immer wieder vor den Lutheranern verstecken müssen.11 Erst mit dem Konzil zu Trient (1545–1563) fand sich die römisch-katholische Kirche wieder und nahm den Kampf auf, um verlorenes Terrain und Abtrünnige zurückzugewinnen.
Aber nicht nur die römisch-katholische Kirche kämpfte gegen das Luthertum, sondern auch die Anhänger des Genfer Reformators Jean Calvin, der seine Gegner nicht nur demütigte und mundtot machte, sondern auch dem Scheiterhaufen übergab. Wie scharf und unerbittlich der Kampf tobte, zeigt das Schicksal Miguel Serveto y Reves’, das die protestantische Welt in Aufregung versetzte. Calvin hatte ihn kurzerhand festnehmen und in den Genfer Kerker werfen lassen. Der spanische Theologe und Arzt hatte die Trinität bestritten und sich damit bei den Theologen aller Konfessionen verhasst gemacht. Aber nicht die römische Inquisition verurteilte ihn zum Tod auf dem Scheiterhaufen, sondern Calvin, nachdem sein Versuch, den missliebigen Denker bei den Katholiken zu denunzieren, fehlgeschlagen war. Am 17. Oktober 1553 brachte man Miguel Serveto y Reves zur Hinrichtungsstätte Champel vor den Toren Genfs, band ihn an einen Pfahl und ließ ihn langsam bei lebendigem Leib verbrennen. Diese grausamste Form des Autodafés wurde nur selten angewandt. In der Regel wurde der Delinquent zuvor erwürgt. Nicht jedoch Serveto.
In Ungarn zeichnete sich in den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts eine Teilung ab.12 Während die Magyaren, der altungarische Adel und die Bauern, den Calvinismus annahmen, bekannten sich die Städter, unter ihnen viele Deutsche, mehrheitlich zum Luthertum. Dass Veit Bach Ungarn, wohin ihn seine Wanderschaft geführt hatte, wieder verließ, weil er als Lutheraner von den Katholiken verfolgt wurde, ist aufgrund der geschichtlichen Ereignisse kaum haltbar. Der katholische Gegenschlag begann erst mit den Jesuiten Anfang des 17. Jahrhunderts, als Veit sich längst in Wechmar niedergelassen und eine Familie gegründet hatte. Als er noch in Ungarn lebte, hatten Calvinisten und Lutheraner die gegnerischen Fronten gebildet. Gründe, das Land zu verlassen, hätten aber auch die Pest, die Missernte 1584 mit der Folge steigender Lebensmittelpreise sowie die osmanischen Heere geboten, denen es 1596 schließlich nach mehreren Anläufen gelang, die nordungarische Stadt Eger einzunehmen.
Manche sahen in den osmanischen Eroberungen Vorzeichen der baldigen Ankunft des Antichrist, der zur Strafe für ihren sündhaften Lebenswandel auf die Menschen herabkommen würde. Ein Traum des Sehers Daniel im Alten Testament verkündete, dass sich ein Viertes Reich erheben und alle anderen Reiche und die Kirche vernichten würde. Die lutherische Auslegung des Traums prophezeite, dass Christus den Seinen zu Hilfe kommen würde: Mit der Vernichtung des Antichrist und seines Vierten Reiches durch die Reformation entstehe das wahrhaft christliche Reich. Der Antichrist konnte nur der Sultan sein, glaubten die Lutheraner, das Vierte Reich die Herrschaft der Osmanen, die schon 1523 das erste Mal Wien belagert hatten. Diese Endzeitstimmung, befeuert durch die reale muslimische Bedrohung und die sich überstürzenden Vorhersagen des baldigen Weltuntergangs, radikalisierte das Denken. Mag sein, dass Veit Bach vor dem Vierten Reich geflohen ist und vielleicht auch vor den Calvinisten, deren niederländische Glaubensbrüder Allianzen mit den Osmanen eingingen. Später würde der siebenbürgische Calvinistenführer Gábor Bethlen (1580–1629) die größten Ängste wahr werden lassen und den Osmanen helfen, tief nach Mitteleuropa vorzudringen.
Trotz alledem lässt sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts für Ungarn keine Ausreisewelle feststellen. Als Lutheraner hätte Veit Bach in einer Stadt zudem keinerlei Schwierigkeiten erfahren. Vermutlich ist er einfach nach einiger Zeit in der Fremde in die Heimat zurückgekehrt. Dass es seinem Nachkommen anderthalb Jahrhunderte später – nachdem Ungarn, Mähren und Böhmen rekatholisiert waren – so scheinen konnte, dass sein Vorfahr als religiöser Flüchtling nach Wechmar kam, ist vorstellbar. Johann Sebastian Bach war vor allem die Verfolgung der Lutheraner im 17. Jahrhundert durch die Inquisition, in Böhmen und Mähren durch die Jesuiten, noch präsent. Das Haupt der Böhmischen Brüder, Johann Amos Comenius (1592–1670), wurde aus Böhmen vertrieben und fand schließlich nach abenteuerlichen Wegen Asyl in den Niederlanden. Nach dem Lehrbuch des Pädagogen Comenius war Johann Sebastian in der Eisenacher Lateinschule unterrichtet worden. Von den unerbittlichen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen protestantischen Strömungen wusste er, der als Lutheraner eine Zeitlang einem reformierten Fürsten diente, nichts mehr.
Johann Sebastian Bach begann im Jahr 1735 seine Genealogie mit dem, was er wusste oder in Erfahrung bringen konnte, nämlich mit dem »Weißbecker« Vitus oder Veit, der am Ende des 16. Jahrhunderts aus Ungarn zurückgekehrt war, heiratete und die Mühle des Vaters übernahm. Wahrheit und Mythos fließen in seiner Chronik sinnfällig zusammen. Auch wenn es heißt, dass der Stammvater in Wechmar »seine Beckers Profession fortgetrieben« habe, erzählt Johann Sebastian nur von dessen Tätigkeit als Müller – und von der Mühle als Bühne für die musikalische Weihe der Bachfamilie: der Müller, der die Cythringen spielt, während die Mühlsteine das Korn mahlen und ihm den Takt vorgeben. Diese Szene »ist gleichsam der Anfang zur Music bey seinen Nachkommen gewesen«.13
Die Brüder
Eine große Liebe zur Musik zeigte auch Veit Bachs älterer Bruder Hans. Obwohl er das Schreinerhandwerk erlernt hatte, war er der Erste in der Familie, der aus seiner Leidenschaft einen Beruf machte. Auf einem Holzschnitt, der ihn mit Halskrause, Fiedel und Bogen zeigt, vermittelt ein Knittelvers eine Ahnung von seiner Wirkung:
»Hie siehst du geigen
Hannsen Bachen,
Wenn du es hörst,
so mustu lachen.
Er geigt gleichwol
nach seiner Art,
Unnd tregt ein hipschen
Hanns Bachen Bart.«
Als reisender Schalksnarr war er in bester Gesellschaft. In jenem Jahrhundert machten die Geschichten von Till Eulenspiegel und die Possen des märkischen Hans Clauert die Runde. In Jost Ammans »Ständebuch«, einer Beschreibung weltlicher und geistlicher Stände, der Künste, des Handwerks und des Handels aus dem Jahr 1568, widmet Hans Sachs auch dieser Profession ein paar Zeilen:
»Ich brauch mancherley Narren weiß
Damit ich verdien Tranck und Speis
Doch weiß ich durch ein zaun [Hinterlist] mein Man
Mit meinem Fatzwerk [Narretei] zu greifen an.
Da ich mit mein närrischen Sachn
Die Herrschaft kann fein fröhlich machen
Mit heuchlerey die Leut ich blendt
Drum man mich ein Schalksnarren nent.«14
Musikalisches Können, gepaart mit robustem Witz und darstellerischer Begabung, vielleicht auch bachschem Eigensinn und ebensolcher Zielstrebigkeit, hob Hans Bach aus der Gemeinschaft der nicht selten zwielichtigen Possenreißer heraus und erlaubte ihm den Sprung ins Ehrbare – immerhin wurde er gleich zweimal porträtiert. Beide Holzschnitte gelangten in den Besitz Carl Philipp Emanuel Bachs, der Hans, anders als sein Vater, als Vorfahr würdigte.
Der zweite Holzschnitt zeigt Hans Bach mit Becher und Fiedel. Das Oval, das ihn umgibt, trägt die honorige Inschrift: »Morio celebris et facetus: fidicen ridiculus: homo laboriosus simplex et pius [Berühmter und witziger Narr: scherzender Fiedler, arbeitsamer Mann, bescheiden und fromm]«. Deutlicher konnte einem Narren Achtung nicht gezollt werden, als ihn »bescheiden und fromm« zu nennen. Galt doch der Narr als eitel, unbescheiden, großsprecherisch, dreist, vorwitzig und in Fragen des Glaubens eher als zweifelhaft. Das brachte der Beruf mit sich. Um das Konterfei herum ist dekorativ Schreinerwerkzeug angeordnet, aber auch Narrenpeitsche und Narrenschelle fehlen nicht. Die Werkzeuge könnten darauf hinweisen, dass Hans Bach Instrumente anfertigte.15 Das Signum »M. W. S. fecit Nirtingae Anno 1617« verrät, dass kein Geringerer als der spätere Tübinger Universitätsprofessor und Erfinder der Rechenmaschine, Wilhelm Schickard – M. W. S. steht für Magister Wilhelm Schickard –, zwei Jahre nach Hans Bachs Tod vermutlich nach einer Skizze den Holzstich in Nürtingen angefertigt hat. Über den Instrumentenbau könnten sie zusammengekommen sein, der Narr und Musiker und der spätere Professor und Erfinder.
Irgendwann am Ende des 16. Jahrhunderts begab sich auch Hans auf die Wanderschaft, anfangs womöglich als Schreinergeselle, mit der Fiedel im Gepäck. Unterwegs scheint er häufiger Gebrauch vom Musikinstrument als vom Schreinerwerkzeug gemacht zu haben. Vom Erfolg verführt, mag er sich auf das Spielmanns- und Narrenhandwerk verlegt haben; er sammelte Erfahrungen und schärfte seinen Witz.
In Stuttgart angekommen, wusste Hans Bach die Gunst Ludwigs des Frommen (1554–1593), des strenglutherischen Herzogs von Württemberg, zu gewinnen, der ihn als Schalksnarren und Spielmann einstellte. Obwohl Herzog Ludwig III. die Ausbreitung des Luthertums förderte und Abstand zu den reformierten Fürsten von Kassel und der Pfalz hielt, weil er deren Calvinismus ablehnte, genoss er die Jagd und das Feiern. Trinkfest soll er gewesen sein und die Gelage geliebt haben. Da bei diesen Gelegenheiten ein Narr zur Unterhaltung nicht fehlen durfte, nutzte Hans Bach die Auftritte, um bei Hofe zu reüssieren. Und er schien gewusst zu haben, wie man Eindruck machte. Er legte Wert auf Kleidung und Manieren, das hatte er sich auf seinen Reisen und am Hof von den Bürgern und Adligen abgeschaut. Trugen die Narren meist bunte, abgewetzte Hosen und Wämse, so ging Hans vornehm schwarz gekleidet, achtete auf Sauberkeit und versuchte seinen Scherzen einen gewissen Charme zu geben; schließlich kam er nicht vom Zotenerzählen und Possenreißen, sondern vom Singen und Musizieren zum Spielmannsstand. Immerhin ließen es sich die Notablen der Reichsstadt Weil nicht nehmen, ihn würdevoll zu empfangen, als er dort Station machte. So schilderte es der Pastor zu Ostelheim, Albert Aubelin, in seiner »Historie von dem an dem Hof der Herzogl. Ludwigschen Wittib befindl. Hanns Bach, der, wegen seiner Tracht vor einen Geistlichen gehalten und von den Vorstehern der Reichsstadt Weil, bei seiner Durchreise, freigehalten und tractiret wurde«.16 Hinzu kam, dass seine musikalischen Fähigkeiten diejenigen gewöhnlicher Spielleute übertrafen. Wahrscheinlich wirkte er in der Hofkapelle Herzog Ludwigs mit, so dass man ihn nicht für einen Spielmann und Schalksnarren, sondern für einen Musicus gehalten hat.
Die Kapelle leitete der Komponist Leonhard Lechner. Der Südtiroler war bei Orlando di Lasso (1532–1594) in München in die Lehre gegangen, in Italien und Süddeutschland auf Wanderschaft gewesen und schließlich zum Protestantismus konvertiert. 1570 hatte er in Nürnberg eine Anstellung als Lehrer gefunden. Hier erlangte er mit seinen Kompositionen – Messen, geistigen und weltlichen Liedern – bald einen hervorragenden Ruf. Der katholische Hohenzoller Eitel Friedrich IV. (1545–1605) holte ihn 1583 nach Hechingen. Aber dieses Engagement stand unter keinem guten Stern, es kam zu einem schlimmen Zerwürfnis. Der Graf beleumdete ihn fortan schlecht und erklärte ihn für vogelfrei, so dass Lechner trotz der Fürsprachen Orlando di Lassos und des Herzogs Wilhelm von Bayern von Glück reden konnte, 1584 als Hofmusikus und Kapellmeister am Hof Ludwigs des Frommen unterzukommen. Die Württemberger Kapelle wurde sehr stark von den Münchener Hofmusikern beeinflusst. Es bestanden enge Beziehungen und eine freundliche Konkurrenz.
Nach dem frühen Tod des Herzogs blieb Hans Bach bis an sein Lebensende 1615 in den Diensten der Witwe, Ursula von Württemberg (1572–1635), die sich nach Nürtingen zurückzog und nicht wieder heiratete. Ihrem Musiker und Narren Hans Bach ließ sie ein ehrbares Begräbnis ausrichten. Es findet sich nicht der geringste Hinweis, dass er Nachkommen hinterlassen hätte. Auch deshalb wird ihm Johann Sebastian Bach in seiner Genealogie keine größere Aufmerksamkeit gewidmet haben.
Veits jüngerer Bruder Caspar machte seine Begabung sofort zum Beruf, er trat eine Lehre als Stadtpfeifer an. Im nur anderthalb Wegstunden von Wechmar entfernten Gotha fand er eine Anstellung und zog mit seiner Familie in den Turm des Rathauses. Das Leben in luftigen Höhen, hoch über dem geschäftigen Treiben der Kaufleute, war allerdings weniger romantisch als beschwerlich. Alles, was zum Leben benötigt wurde, musste nach oben geschleppt werden, und das war viel bei gut zehn Personen. Neben den fünf bis sechs eigenen Kindern werden, wie damals üblich, ein oder zwei Lehrburschen im Haushalt des Meisters und seiner Frau Katharina gelebt haben. Die Wohnung war klein, und der Wind pfiff durch die Räume.
Seit einiger Zeit schon machte sich in ganz Europa eine Klimaveränderung bemerkbar, es herrschte die sogenannte Kleine Eiszeit. In den langen Wintern froren die Flüsse zu, im Sommer schadeten Regen und Kälte den Ernten. Unruhe und Ängste rief auch die Kalenderreform hervor, die Papst Gregor XIII. 1582 durchführen ließ. Die Protestanten lehnten die Reform entweder ab, weil sie darin den von Satan inspirierten Versuch sahen, Gottes Zeit zu verändern, oder sie war ihnen gleichgültig, da ohnehin das Weltende nahte. So unterschied Katholiken und Protestanten nicht nur die Konfession, sondern auch das Datum. Eine Differenz von zehn Tagen stand zwischen ihnen.
Den Weltuntergang befürchteten die Thüringer, als sich aus dem Neckarraum kommend am 8. Juni 1613 die Regenfluten über das Land ergossen. Binnen kurzer Zeit trat die Unstrut über die Ufer. Neun Stunden lang wetteiferten Hagel- und Regengüsse miteinander, angefeuert von satanischem Donnergrollen und heftigen Gewittern. Der Weimarer Superintendent Abraham Lange konnte nur verzweifelt feststellen: »So hat doch die reissende grosse Wasserflut hier und in etlichen Dörffern ubel haußgehalten. Denn nicht allein Wiesen und Gärten verschlemmet und verderbet / die köstlichsten Obstbäume zerbrochen / geschelet / aus der erde gerissen / vnd alles mit Must / Schlamm / Sand und Steinen vberführet … / sondern es ist auch an Gebäwden / Menschen vnd Vihe ein trefflicher Schade geschehen.«17 Die Gothaer kamen letztlich mit dem Schrecken davon, denn die Stadt hat kein Gewässer, das über die Ufer treten kann. Das Ereignis aber brannte sich als Thüringer Sintflut in das kollektive Gedächtnis ein.
Die verregneten Sommer und schneereichen Winter führten immer wieder zu Überschwemmungen, die neben schlechten Ernten auch Viehseuchen verursachten. Wegen des fehlenden Mists wurden die Äcker nur mangelhaft gedüngt, so dass der Boden, von Regen und Hochwasser ausgewaschen, immer schlechtere Erträge brachte. Steigende Lebensmittelpreise, Mangelernährung und Hungersnöte waren die Folge. Die Katholiken gaben den Protestanten die Schuld an der Misere. Für sie stand fest, dass deren Glaubenskälte zu der Klimaverschlechterung geführt hatte. Doch auch in lutherischen Büchern und Kirchenliedern nahm die Erfahrung von Krankheit und Tod eine beherrschende Stellung ein. 1584 vertonte Orlando di Lasso die Bußpsalmen, 1619 Heinrich Schütz die Psalmen Davids.
Johann Sebastian Bach irrte, als er in seiner Chronik schrieb, dass Caspar und Katharina Bach in den Turm der Festung Grimmenstein zogen, denn die Feste war 1576 infolge der Grumbachschen Händel geschleift worden. In dieser Auseinandersetzung hatte der Ernestiner Zweig des Hauses Wettin der Albertiner Verwandtschaft die sächsische Kurwürde abspenstig zu machen versucht. Nachdem Kurfürst August von Sachsen die Zwistigkeiten für die Albertiner hatte entscheiden können, ließ er den Ritter Wilhelm von Grumbach, der schon zuvor mit einer Reichsacht belegt worden war, und einige seiner Mitstreiter auf Seiten der Ernestiner vierteilen. Zuvor hatte der Henker dem Delinquenten bei lebendigem Leib die Brust geöffnet, das Herz herausgerissen und es ihm mit den Worten »Sieh Grumbach! Dein falsches Herz!« ins Gesicht geschlagen.
Also nicht an der Stätte der Niederlage, sondern in der Turmwohnung des Gothaer Rathauses gebar Katharina Bach vermutlich um 1600 den ältesten Sohn, der den Namen des Vaters erhielt, 1602 Johann, 1603 Melchior, am 20. Februar 1617 die Tochter Maria und am 6. Dezember 1619 Nikolaus, auch Nikol gerufen. Wann der im Jahr 1635 verstorbene Heinrich geboren wurde, lässt sich nicht ermitteln, wahrscheinlich zwischen 1605 und 1610.
Von 1619 auf 1620 wütete in dem eine halbe Tagesreise entfernten Arnstadt die Pest, der ein Drittel der Einwohner zum Opfer fiel. Es lässt sich heute nicht immer entscheiden, ob mit der Seuche stets die Pest oder nicht auch mal die Pocken oder der Typhus gemeint war, denn der Begriff Pest war zum Synonym für eine verheerende Epidemie geworden. Unter den Toten war auch einer der drei Arnstädter Stadtpfeifer, und so erging an Caspar Bach das Angebot, die vakante Stelle zu besetzen. Was immer ihn zur Annahme des Angebots bewogen haben mag – finanzielle Gründe, Ärger in Gotha oder bessere Ausbildungsmöglichkeiten für seine Söhne – , im Jahr 1620 kündigte Caspar und zog mit seiner mindestens achtköpfigen Familie in den Neideckturm der Residenzstadt der Grafen von Schwarzburg-Sondershausen, der vier Brüder Johann Günther II., Günther XLII., Anton Heinrich und Christian Günther I., die seit 1593 gemeinsam regierten. Zu Caspar Bachs neuen Verpflichtungen gehörte es, in der gräflichen Kapelle zu spielen.
Auch wenn Hans Bach womöglich schon mit Leonhard Lechner musiziert hatte, waren die Bachs noch nicht in die Musikgeschichte eingetreten, spielten die Berufsmusiker Hans und Caspar noch das, was von ihnen verlangt wurde. Aber der gleiche Ehrgeiz, der den Müller Veit im Spiel auf seiner Cythringen angespornt hatte, war auch seinen Brüdern Hans und Caspar zu eigen. Die größte Schwierigkeit bestand darin, an Noten zu kommen, denn die gedruckten Notenbüchlein waren teuer. Es kursierten Einblattdrucke und Handschriften, so dass es zum Alltag Caspars und seiner Söhne gehörte, Kompositionen zu kopieren, zu denen Caspar als Mitglied der gräflichen Kapelle von Arnstadt Zugang hatte. Noch war Musik vor allem Vokalmusik: Lieder und Choräle, die von den Instrumentalisten begleitet, zunehmend aber auch schon akzentuiert wurden. Die reine Instrumentalmusik begann sich als Nachahmung der Vokalmusik herauszubilden, indem Musikinstrumente in einer Komposition Stimmen übernahmen, die bis dahin Sängern vorbehalten waren.
In der künstlerischen Vokalmusik, wie sie in den Motetten und Madrigalen gepflegt und entwickelt wurde, experimentierten Meister wie Orlando di Lasso, der als Hofmusiker der Kapelle des musikliebenden Herzogs Albrecht V. von Bayern vorstand, mit der Polyphonie der Motetten und Psalmenchoräle. Mit gleicher Leichtigkeit glückten Orlando zudem recht frivole Chansons – die musikalischen Genres waren nicht allzu scharf getrennt. Valentin Haussmann (1565/70 bis vor 1614) veröffentlichte 1604 »Neue Intraden zu 6 und 5 Stimmen«, in denen er Tanzlieder präsentierte und Instrumentaltänze, denen er einen Text unterlegte. Adam Gumpelzhaimer (1559–1625), Kantor und Lehrer am Annen-Gymnasium in Augsburg, veröffentlichte 1591 unter dem Titel »Compendium musicae« eine Sammlung von über 250 Stücken, die von niederländischen, deutschen und italienischen Komponisten stammten. Darin finden sich auch »kurtzweilige« Lieder »nach Art der welschen Villanellen«. Daneben publizierte er unter dem Titel »Sacrum concentuum« Kirchenmusik.
Gallus Dreßler (1533–1580/89), zunächst Kantor in Magdeburg, dann lutherischer Diakon in Zerbst, veröffentlichte mit der »Musica poetica« ein Lehrbuch der Komposition, das besonders viele Kompositionsbeispiele Orlando di Lassos enthält. In ihm sah Dreßler über Konfessionsgrenzen hinweg – die auf dem Gebiet der Musik nicht streng gehandhabt wurden – den Meister, der es wie kein Zweiter verstand, für den Text die adäquate musikalische Gestaltung, den unübertroffenen musikalischen Ausdruck zu finden. Über Gallus Dreßler erhielt Caspar Bach Kenntnis vom Schaffen des Münchner Hofkapellmeisters.
Aus Italien drangen Madrigale, Motetten und große Messen in den Norden. Besonders der römische Komponist Giovanni Pierluigi da Palestrina wurde zum musikalischen Wegbereiter der Gegenreformation und der katholischen Reformen. Seine Messen überzeugten die Teilnehmer des Konzils in Trient von der Bedeutung der Musik für den Gottesdienst. In der Alpenstadt versammelten sich zwischen 1545 und 1563 die Repräsentanten der katholischen Kirche aus ganz Europa, um in teils mehrjährigen Sitzungsperioden die lange geforderte innerkirchliche Erneuerung einzuleiten und sich gegen die Reformation zu positionieren. Die heutige Gestalt der katholischen Kirche beruht zu einem Gutteil auf den Beschlüssen des Tridentinums.
In lutherischen Landen bestand verständlicherweise kein Bedarf an der lateinischen Messe und auch nicht an Musik mit lateinischen Texten. Andererseits überwand Musik konfessionelle Grenzen, interessierten sich Musiker vor allem für den Fortschritt in der Musik, für neue Kompositionstechniken, neue Stimmführungen, die Balance zwischen Vokal- und Instrumentalmusik, für neue Instrumente und Instrumentierungen. Protestantische Komponisten wie Lukas Osiander, Leonhard Lechner, Hans Leo Haßler und Heinrich Schütz verfolgten aufmerksam die Entwicklung der musikalischen Sprache, die vor allem in Venedig, Rom, Florenz und Mantua von ihren katholischen Komponistenkollegen Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, Claudio Merulo oder Andrea und Giovanni Gabrieli vorangetrieben wurde.
Italien war das Land der Musik, italienische Musiker galten als Meister dieser Kunst schlechthin. Sie besaßen nördlich der Alpen einen fast mythischen Ruf. Weder der Wiener noch der Dresdner Hof, kein Regent, der ein bestimmtes Renommee beanspruchte, durfte auf Italiener als Kapellmeister, Komponisten, Sänger oder Instrumentalisten verzichten. Genauso war es geradezu die Pflicht begabter Musiker und Komponisten, zur Vervollkommnung ihrer Fertigkeiten nach Italien zu gehen. Häufig finanzierten die Fürsten diese Ausbildungsaufenthalte; sie investierten in ihre Musiker. Aber auch die Städte sandten hoffnungsvolle Talente auf Kosten der Kommune in den Süden, wie Nürnbergs Magistrat, der dem zwanzigjährigen Lechner-Schüler Hans Leo Haßler (1564–1612) den Aufenthalt in Venedig finanzierte, wo er Unterricht bei Andrea Gabrieli (1510–1586) erhielt. Hier freundete er sich mit Gabrielis Neffen Giovanni an, der bald schon das Erbe seines Onkels antreten und schließlich der Lehrmeister von Heinrich Schütz werden sollte. Auf die Qualität der deutschen Hofkapellen wirkte sich diese Entwicklung vorteilhaft aus.
Auch die Volks- und Gesellschaftslieder der Italiener, vor allem die Frottola und die Villanella, fanden in den deutschen Ländern Verbreitung, teils durch wandernde Spielleute, vor allem aber durch Komponisten, die versuchten, diese Lieder für die deutsche Sprache zu adaptieren. So gab Jacob Regnart (1540–1599) in den 1570er Jahren in Nürnberg »Kurtzweilige teutsche Lieder zu 3 Stimmen, nach Art der Neapolitanen oder welschen Villanellen« heraus. Er arbeitete mit Leonhard Lechner zusammen, dessen Ruf den seinen bald schon überstrahlen sollte.
Die Frottola ist ein vierstimmiges Gesangsstück, das sich an den Höfen in Italien großer Beliebtheit erfreute. Isabella d’Este (1474–1539) hatte diese Musik gefördert. Die Gattin des Markgrafen von Mantua und zeitweilige Regentin spielte virtuos Laute und Flöte und sang sehr gut. Bartolomeo Tromboncino (1470–1535), der viel für die Blüte der Frottola leistete, lebte an ihrem Hof, bevor er nach Venedig ging und dort Komponisten wie Andrea Gabrieli beeinflusste. Auch Luthers Gegenspieler, der fröhlich-verschwenderische Papst Leo X., Sohn von Lorenzo Il Magnifico Medici, war ein Freund dieser Kunstform. Eines der schönsten Lieder Orlando di Lassos ist die Frottola »Madonna mia pietá.«
Der Name des dreistimmigen Strophenliedes Villanella – Bauernmädchen – oder Villanella alla Neapolitana erklärt seine Herkunft: Ursprünglich wurden diese einfachen Weisen von (neapolitanischen) Bauernmädchen gesungen. Auch dieser Kunstform widmete sich Orlando di Lasso. So durchlässig die Grenzen zwischen weltlicher und geistlicher Musik waren, so offen zeigten sich die Komponisten der Renaissance und des Barock für Volksmusik, auch wenn schon zwischen U- und E-Musik unterschieden wurde, wie Jacob Regnart in der Widmung an den Leser mit einer gewissen Selbstironie dichtete:
»Wiß dass es sich durchauß nit schick
Mit Villanellen hoch zu prangen
Und dadurch wöllen preiß erlangen
Würd sein vergebens und umb sunst
An andre ort gehört die kunst.«18
Villanellen galten nicht als Kunst, erfreuten sich aber großer Beliebtheit. In Deutschland leitete sich zudem die Tradition des Volksliedes von den Tanz- und Scherzliedern des Mittelalters her, wie sie etwa in der »Carmina Burana« erhalten sind, während die Kunstmusik aus dem Schaffen der Minnesänger entstanden war. Die Übergänge jedoch waren auch hier fließend. Die Minnelieder standen genauso Pate für die geistlichen Lieder, die Motetten, die im 14. Jahrhundert aufkamen, während sich die Messen aus den gregorianischen Gesängen entwickelten. Gleichwohl bestand im 16. Jahrhundert ein großer Unterschied zwischen den kirchlichen und höfischen Musikern, den Kantoren und Stadtpfeifern, die wie Handwerker ihrer Zunft angehörten, und den fahrenden Sängern und Bierfiedlern, die auf Jahrmärkten und Volksfesten aufspielten.
Caspar Bach war als Stadtpfeifer Angestellter des Magistrats von Arnstadt. Feste Arbeitsverhältnisse boten sonst nur noch die Kirche oder die Höfe. Im Dienst eines Landesherrn war der Musiker aber ein Lakai und konnte jederzeit auch für andere Arbeiten in die Pflicht genommen werden. Um die Kapelle eines kleineren Hofes zu einem klangvollen Orchester zu verstärken, spielten zu entsprechenden Anlässen auch die örtlichen Organisten, Kantoren und Stadtpfeifer mit.
Caspars Tag war durch seine Aufgaben gegliedert, die zuallererst darin bestanden, im Wechsel mit den anderen Stadtpfeifern bei Sonnenaufgang, zu Mittag und zum Abend einen Choral zu blasen, um den Bürgern die Zeit anzugeben und sie zur Andacht zu gemahnen. Oder wie es hundert Jahre später Johann Sebastian Bachs Vorgänger im Amt des Thomaskantors zu Leipzig, Johann Kuhnau (1666–1722), beschreiben würde: »Wenn unsere Stadtpfeifer etwa zur Festzeit ein geistliches Lied mit lauter Trombonen vom Turme blasen, so werden wir über alle Maßen darüber beweget und bilden uns ein, als hören wir die Englein singen.«19
In der Kapelle der Grafen von Schwarzburg-Sondershausen blies Caspar Bach eine frühe Form des Fagotts, den Dulzian. Als Mitglied der Musikerzunft hatte er zu festlichen Anlässen der Stadt und des Hofes zu spielen. Das konnte eine Ratswahl, die Inthronisierung eines neuen Fürsten, hoher Besuch in der Stadt, eine Hochzeit, eine Taufe oder eine Beerdigung sein. Von den Musikern wurde erwartet, dass sie mehrere Instrumente beherrschten.