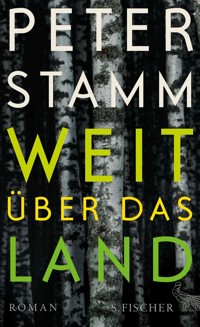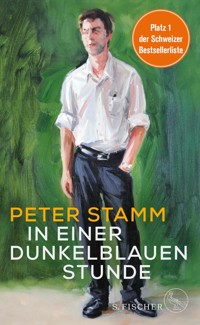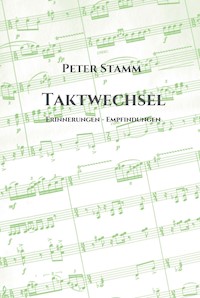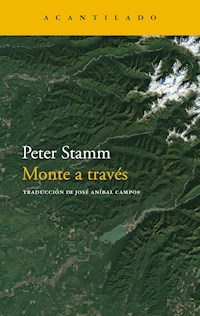12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bewegender Deuter heutiger Befindlichkeiten: Peter Stamms Momentaufnahmen des Lebens »Hohe literarische Qualität. Sprachlich souverän, modern und zeitlos zugleich.« - Charles Linsmayer, NZZ am Sonntag In Der Lauf der Dinge erzählt Peter Stamm mit großer Präzision und wenigen Worten Geschichten, die Welten entfalten. Seine Figuren erleben Momente des Glücks und der Sehnsucht nach Veränderung, sie durchleben Enttäuschungen und Wunder. Stamm fängt Augenblicke größter Intensität ein und erschafft bewegende Bilder. Von Heidi Rainer in der Schweiz über New York und Italien bis hin zu Blitzeis, Videocity und dem Eismond am Valentinstag - Peter Stamms Kurzgeschichten berühren und fesseln. »So wird der Dichter der Dunkelheiten und Unwägbarkeiten, der Schilderer schiefer Liebesbeziehungen zu einem bewegenden Deuter heutiger Befindlichkeiten.« - Beatrice von Matt, Neue Züricher Zeitung Ein Meisterwerk der modernen Literatur, das die Leser in seinen Bann zieht und noch lange nachklingt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Stamm
Der Lauf der Dinge
Gesammelte Erzählungen
FISCHER E-Books
Inhalt
Feuer
Unter dem Kuhfall, wo einst eine Kuh über die Nagelfluhfelsen gestürzt war und wo im Winter die schönsten Eiszapfen wuchsen, war die Höhle, bei der Sven und ich uns trafen. Es hieß, von dort habe früher ein Geheimgang bis zum Schloss geführt. Jetzt aber war die Höhle schon nach wenigen Metern verschüttet, und dort trafen wir uns. Wir zündeten Kerzen an und schnitzten Pfeifen und trockneten Buchenlaub, das wir nie zu rauchen wagten. Dort in der Nähe wohnte Herbert.
Die Mutter von Herbert gab uns selbstgemachtes Wassereis, weil wir mit ihrem Sohn spielten, obwohl die Familie katholisch war. Wir hatten kein Geld. Erst später, beim kantonalen Schützenfest, verdienten wir etwas als Zeiger. Da stellte die Gemeinde ein großes Festzelt auf neben dem Schützenhaus.
Beim Schützenhaus rauchte ich eines Nachts meine erste Zigarette, und nicht weit davon vergruben wir die Knochen und Tierkadaver, die wir im Wald manchmal fanden. Einmal brachte Sven den Kopf eines Hechts mit, der schon stank, und warf ihn ins Feuer. Beim Schützenhaus war Buchenwald, der viel heller war als der Wald beim Kuhfall, bei unserer Höhle. Buchenlicht, sagte mein Vater.
Damals waren wir frei im Wald und lachten über die Pfadfinder in ihren Uniformen, mit ihren Liedern. Wir sangen nicht. Wir kauten Sauerampfer und Harz und sammelten Bucheckern und Eicheln. Sven behauptete, er habe einmal eine Krähe getötet und gegessen, und ich glaubte ihm, weil er auch das Loch für seinen Ohrring selbst gemacht hatte, mit einem glühenden Nagel. Sein Vater war Deutscher, das schien damals alles zu erklären. Mein Vater war Buchhalter, der von Herbert Architekt.
Herbert ging jeden Samstag in die Jungschar, und am Mittwochnachmittag musste er in den Religionsunterricht. Am Abend baute er mit seinem Vater Modellflugzeuge mit winzigen Benzinmotoren. Manchmal, wenn Sven und ich spielten, trieb er sich in der Nähe herum, wartete stundenlang, bis er plötzlich auftauchte und sagte, kommt mit zu mir und ihr kriegt ein Eis.
Dann standen wir vor dem Haus seiner Eltern und aßen das Eis, und seine Mutter fragte uns, wie es in der Schule gehe, und Herbert schnitt hinter ihrem Rücken Grimassen, bis wir lachen mussten. Herbert hatte drei Schwestern.
Er zeigte mit uns beim Schützenfest. Sein Vater, sagte er, habe gewollt, dass er zeige, und auch, dass er in die Jungschar gehe. Der Vater war nicht beliebt im Dorf. Er war aus der Stadt gekommen und hatte die hässliche Kirche mitten im Dorf gebaut. Er trug beim Schießen eine Schießbrille und eine teure Lederjacke mit Polstern an den Ellbogen. Herbert sagte, sein Vater sei Scharfschütze im Militär, aber wir glaubten ihm nicht.
Ich hatte schon zweimal den Arm gebrochen, Sven sogar ein Bein beim Skifahren. Herbert hatte nur eine Narbe am Arm, und Sven sagte, die sei von einer Impfung.
Beim großen Schützenfest zeigte Herbert neben mir. Auf seiner Scheibe gab es nur Einer und Zweier, während mein Schütze einen Fünfer nach dem anderen schoss. Herbert hatte eine Feldflasche mit warmem Tee dabei, und ich sagte: »Traust du dich rauszuschauen, wer so schlecht auf deine Scheibe schießt.«
Es war natürlich ein Witz, das hätte er wissen müssen, wir waren viel zu weit weg. Aber wir waren ganz hinten im Stand, und Herbert kletterte an der Seitenwand hoch und rief lachend herunter: »Ich sehe den Rauch der Gewehre.«
Dann fiel er herunter mit einem Loch im Kopf. Es gab eine große Aufregung, obwohl man nichts mehr machen konnte. Ich stand neben Herbert, und der Zeigerchef gab mir eine Ohrfeige und stieß mich weg. Er weinte. Später entschuldigte er sich dafür, was mir peinlich war.
Der Zeigerchef kam vor Gericht, weil er die Verantwortung trug, aber er musste nicht ins Gefängnis, und niemand im Dorf gab ihm die Schuld. Auch mir nicht. Ich hatte nichts gesagt. Ich wurde sogar besonders nett behandelt, weil ich dabei gewesen war und Herbert tot gesehen hatte.
Am Abend des nächsten Tages war die Preisverleihung und danach das Fest. Da rauchte ich meine erste Zigarette, und der Präsident des Schützenvereins gab mir Feuer und sagte: »Wenn der Architekt ein besserer Schütze wäre, hätte er die Scheibe in der Mitte getroffen und nicht seinem Sohn in den Kopf geschossen.«
Grace
Als der Mann fiel, schien sein ganzer Körper sich zu entspannen. Seine Arme und Beine streckten sich langsam wie die Blätter einer sich öffnenden Blüte. Er schrie nicht. Dann hörte ich einen dumpfen Schlag, und er lag ausgestreckt im engen und schmutzigen Hinterhof des Empire Hotels.
Ich hatte am Fenster eine Zigarette geraucht, als ich den Mann zwei Stockwerke tiefer auf der Feuerleiter entdeckte. Er versuchte in ein Zimmer einzusteigen. Erst stellte er einen Fuß auf den schmalen Sims und griff mit einer Hand in den engen Spalt des Schiebefensters. Er versuchte es aufzuziehen, nahm die zweite Hand nach und trat schließlich auch mit dem anderen Fuß auf den Sims. Er fluchte leise und zerrte am morschen Fenster. Sein ganzer Körper ragte weit von der Fassade ab. Dann ließ er los und fiel.
Ich rannte hinunter zum Empfang und versuchte Bob, dem algerischen Portier, zu erklären, was geschehen war. Er sprach kaum Englisch, und es dauerte einige Zeit, bis er mich verstand und mit mir in den Hof kam, um nach dem Gestürzten zu sehen.
»Das ist Roberto«, sagte er, »er wohnt im zweiten Stock. Mit seiner Freundin Grace.«
Der Mann rührte sich nicht. Wir schoben einen Pullover unter seinen Kopf und riefen einen Krankenwagen. Einige Minuten später traten zwei Sanitäter mit einer Tragbahre in den Hinterhof. Sie zerschnitten Robertos Kleider und schälten sie von seinem schwammigen, bleichen Körper. Am Abend fragte ich Bob, was geschehen sei.
»Junkies«, sagte er, »sie wohnen schon seit Jahren hier.«
Er erzählte mir die ganze Geschichte, und ich verstand, dass Roberto Grace in der Nacht verprügelt hatte. Er war betrunken gewesen, und Bob hatte die Polizei gerufen. Die Polizisten hatten Roberto mitgenommen und über Nacht auf dem Revier behalten. Als Roberto am Morgen ins Empire kam, war er schon wieder betrunken. Grace war nicht da, aber Roberto ging nach oben, ohne den Schlüssel zu verlangen. Bob sagte, er habe ihn gerufen. Roberto habe nicht reagiert, er müsse gemeint haben, Grace sei im Zimmer, sie lasse ihn nicht rein. Und dann hatte er versucht, durchs Fenster zu steigen.
Bald nach Robertos Sturz zog ich in eine Gegend weiter im Norden Manhattans. Die Schaben in meinem Zimmer hatten mich vertrieben. Einige Wochen später kam ich an einem regnerischen Abend zufällig am Empire vorbei. Bob saß in seiner Loge und schaute sich im Fernsehen den Bericht über eine Gasexplosion in Harlem an. Er erkannte mich erst, als ich nach Roberto fragte. Dann schaltete er den Ton des Fernsehers aus und erzählte, Roberto sei mit einer Gehirnerschütterung und einigen Brüchen davongekommen. Auf dem Bildschirm erschien das verzerrte Gesicht einer schwarzen Frau.
»Schrecklich«, sagte Bob, »sieben Tote … bumm!«
Eine Frau in einem schmutzigen T-Shirt und bunten Leggins trat neben mich. Sie war sehr dünn. Ihre schlecht geschminkten Augen waren wie dunkle Flecken auf dem bleichen Gesicht.
»Hi, Grace«, sagte Bob und reichte ihr einen Schlüssel. »Das ist der Mann, der Roberto gefunden hat.«
Zu mir sagte er: »Das ist Grace, Robertos Freundin.«
»Hi«, sagte Grace und lächelte. Ihre wenigen Zähne waren braun und sahen brüchig aus. »Danke für Ihre Hilfe.«
»Das war selbstverständlich«, sagte ich. »Wie geht es ihm?«
»In einer Woche kommt er aus dem Spital. Die Ärztin sagt, er hat Glück gehabt. Weil er betrunken war. Er war entspannt, als er gefallen ist. Hätte tot sein können.«
»Ist er versichert?«, fragte ich.
Sie zuckte mit den Achseln.
»Schrecklich«, sagte Bob und zeigte auf den Bildschirm. »Sieben Tote … bumm!«
»Wo?«, fragte Grace.
»In Harlem«, sagte Bob, »Gas.«
Er schaltete den Ton des Fernsehers ein, und als ich ging, hörten die zwei gebannt dem Reporter zu, der mit bebender Stimme die schreckliche Verwüstung beschrieb.
Esperanza
Seit die Langstreckenflugzeuge den Atlantik ohne Zwischenhalt überquerten, war die Inselgruppe mehr und mehr in Vergessenheit geraten, bis man ihren Namen nur noch in Verbindung mit einem subtropischen Hochdruckgebiet kannte, von dem das Wettergeschehen Westeuropas abhing.
In der Touristenunterkunft, einigen heruntergekommenen Bungalows in einem verwilderten Park, lebten außer mir nur ein paar magere Katzen. Meine Tage verliefen immer gleich. Ich las, machte wegen des ständig drohenden Regens nur kurze Spaziergänge und aß mittags und abends im einzigen Restaurant des Ortes. Der Kellner tat noch nach einer Woche so, als kennte er mich nicht. Niemand schien sich für mich zu interessieren außer Esperanza, das Zimmermädchen.
Esperanza war klein und zierlich, aber sie hatte einen entschlossenen Gesichtsausdruck und arbeitete so schnell, als habe sie ihr Leben lang nichts anderes getan. »Ich will dir dein Bett bereiten«, hatte sie gesagt, als sie am ersten Tag in meinem Bungalow erschienen war. Zehn Minuten später stand sie schon wieder an der Tür, räusperte sich und sagte: »Dieses Land ist ein Land mit Bergen und Tälern, das Wasser trinkt vom Regen des Himmels.« Bevor ich antworten konnte, war sie verschwunden.
Am nächsten Tag kam sie um dieselbe Zeit, machte mein Zimmer und sagte, als sie fertig war: »Auch ich möchte hinüber, möchte das schöne Land schauen.«
Jeden Morgen sagte Esperanza nur einen Satz und verschwand gleich darauf. Was sie von mir wollte, merkte ich erst, als sie sagte: »Und du erblickst nun unter den Gefangenen eine schöne Frau, wirst von Liebe zu ihr ergriffen und willst sie zum Weibe nehmen.«
Wieder verschwand sie, aber diesmal folgte ich ihr. Ich sah, wie sie draußen eine der verwilderten Katzen streichelte und dann in einem kleinen Anbau des Wirtschaftsgebäudes verschwand. Ohne anzuklopfen, trat ich ein. Esperanza stand im schummrigen Raum, in dem sie zu wohnen schien, und sagte: »Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes.«
Erst viel später, als Esperanza längst Deutsch sprach wie ihre Muttersprache, erzählte sie mir, was es mit jenen Sätzen auf sich gehabt hatte. Vor vielen Jahren hatte sie sich in einen deutschen Missionar verliebt, der in einem der Bungalows gewohnt hatte. Eines Tages war der junge Mann von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. In seinem Koffer fand Esperanza zwei Bücher, ein Wörterbuch und eine Bibel. Und weil sie die Hoffnung nie aufgab, dass er eines Tages wiederkehren würde, brachte sie sich an langen Abenden ein wenig Deutsch bei. Sie war in ihrer Lektüre kaum über das Buch Mose hinausgekommen, aber darin fand sie alles, was sie ihrem Geliebten sagen wollte. Oder einem anderen. Sie zeigte mir das Blatt mit den Sätzen, das sie aufbewahrt hatte als Beweis für unsere seltsame Liebe. Den letzten Satz hatte sie mir am Ende jenes langen Tages gesagt, an dem ich ihr Zimmer zum ersten Mal betrat: »Gewiss will ich mit dir gehen.«
Eine Geschichte ohne Bedeutung
Das Schiff fuhr an einem der Piers an der West-Side. Als es ablegte, war es noch hell. Wir saßen zu fünft oder sechst an einem Blechtisch auf dem Oberdeck. Ein Freund hatte mich eingeladen, ich kannte niemanden außer ihm. Wir waren fast die einzigen Weißen auf dem Schiff. Der alte Dampfer fuhr langsam den Hudson River hinauf. Unten spielte schon die Musik, aber wir blieben sitzen, solange Manhattan noch zu sehen war.
»Yonkers«, sagte mein Freund, als es schon fast dunkel war. Dann ging ich mit einer der Frauen nach unten. Sie sagte, sie heiße Angela, sie stamme aus Trinidad, lebe seit einigen Jahren in New York, sie arbeite in einem Coffee Shop. Wir tanzten auf dem Mitteldeck des Schiffes zur viel zu lauten Musik einer Steel Band. Die Tänzer und Tänzerinnen standen so dicht, dass wir uns mit ihnen bewegen mussten. Der Rhythmus ging in Wellen durch die schwitzende Menge. Angela drängte sich nach vorn, wo es noch enger war und die Musik betäubend laut. Ich legte meine Hände auf ihre Schultern, um sie nicht zu verlieren. Sie stand vor mir und presste sich eng an mich oder wurde an mich gepresst.
Als wir zum Tisch zurückkamen, waren die anderen verschwunden. Drei ältere Paare saßen jetzt da und tranken mitgebrachten Rum und stritten sich über irgendetwas. Ich folgte Angela zum Bug des Schiffes. Es war Juli, und obwohl es jetzt ganz dunkel war, war die Luft noch immer warm. Angela lehnte sich an die Reling, und ich stand hinter ihr. Unsere Körper berührten sich ohne Druck diesmal. Vor uns tauchte eine hell erleuchtete Brücke auf, doch bevor wir sie erreichten, verlangsamte das Schiff, begann für einen Augenblick stärker zu vibrieren und wendete in einem weiten Kreis.
Wir waren noch verschwitzt vom Tanzen, und nachdem das Schiff gewendet hatte, spürten wir den Wind, der den Fluss heraufwehte. Angela trug ein schulterfreies Kleid, das von ihren kleinen Brüsten kaum gehalten wurde. Immer wieder zog sie es hoch und strich mit den Händen den Stoff über den Hüften glatt.
»Es ist lange her«, sagte sie und richtete sich auf, »sehr lange …«
Es war nach Mitternacht, als das Schiff anlegte. Am Pier warteten Taxis, und in wenigen Minuten waren die Tänzerinnen und Tänzer in alle Richtungen verschwunden. Das Licht auf dem Schiff ging aus, während wir noch diskutierten, wohin wir gehen sollten. Mein Freund wollte nach Hause. Angela und die anderen beschlossen weiterzutanzen in einer Diskothek in Jamaica, dem Stadtteil, in dem sie alle wohnten. Sie nahmen ein Taxi, und ich schloss mich ihnen an.
In der Diskothek schienen alle einander zu kennen, und unsere Gruppe fiel auseinander. Ich stand abseits und trank mein Bier, bis Angela mich aus meiner Ecke holte, mit mir tanzte und mir Leute vorstellte, deren Namen ich sofort vergaß. Endlich zog sie mich am Ärmel und sagte, sie gehe jetzt nach Hause. Ich bot ihr an, sie zu begleiten. Obwohl es nach zwei Uhr war, hatte der Verkehr noch kaum nachgelassen. Angela zeigte mir, wo ich später die U-Bahn nehmen könne.
»Ein schlechtes Viertel«, sagte sie, als wir durch dunklere Straßen kamen.
Sie wohnte im Erdgeschoss eines zweistöckigen, schäbigen Holzhauses. Das Haus war einmal weiß gewesen, aber die Farbe blätterte überall ab, und der kleine Rasen davor war voller Unkraut und mit Abfällen übersät.
»Komm herein«, sagte Angela leise.
Die Wohnung war unordentlich, aber Angela entschuldigte sich nicht dafür. Sie schien an etwas anderes zu denken. Der Boden war mit dicken, hellen Spannteppichen belegt, und überall auf den wenigen Möbeln lagen Kleider, Zeitungen und Bücher. Angela zog die Rollläden herunter und setzte sich neben mich aufs Bett.
»Möchtest du Fotos von Trinidad anschauen?«, fragte sie.
»Nein«, sagte ich. Sie lachte und holte Bier aus dem Kühlschrank.
»Ich schaue mir die Fotos oft an«, sagte sie, »ich darf Amerika fünf Jahre lang nicht verlassen. Sonst kriege ich die Green Card nicht.«
Wir wussten in jener Nacht bald nicht mehr, worüber wir reden sollten. Angela zeigte mir schließlich doch die Fotos von ihrer Familie, und dann empfahl sie mir ein Buch, das sie kürzlich gelesen hatte. Sie zog es aus einem Stapel zerlesener Taschenbücher.
»Es ist mein Lieblingsbuch«, sagte sie, »du kannst es mitnehmen. Gib es mir irgendwann zurück.«
Dann sagte sie, es sei zu spät für mich, um nach Hause zu gehen. Die Nachbarschaft sei gefährlich um diese Zeit. Ich könne bei ihr übernachten. Sie holte eine dünne Matratze aus dem Wandschrank im Flur und machte mein Bett auf dem Boden neben ihrem. Sie ging ins Badezimmer, um sich auszuziehen.
Am nächsten Morgen frühstückten wir in einem Coffee Shop gleich neben der U-Bahn-Station. Ich wollte Angela einladen.
»Ich habe bei dir geschlafen«, sagte ich, »dann bezahle ich wenigstens das Frühstück.«
»Nicht so laut«, sagte sie und schüttelte lachend den Kopf. Sie schaute sich um, aber niemand schien mich gehört zu haben. Jetzt, am Sonntagmorgen, war Jamaica ein friedliches Viertel. Die Gehsteige waren voller Menschen. Es war Mittag, und die Sonne blendete uns, als wir aus dem Restaurant traten.
»Was hast du vor?«, fragte ich.
Sie gehe einkaufen, sagte Angela, dann vielleicht spazieren und am Abend nicht zu spät schlafen. Sie sei immer noch müde.
»Und du?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Ich habe nichts Bestimmtes vor.«
Wir verabschiedeten uns, und ich fuhr zurück nach Manhattan. Einige Tage später rief ich Angela an und fragte, ob sie am Wochenende zu einem Konzert im Central Park mitkommen wolle. Sie sagte ja.
Als wir in den Park kamen, hatte das Konzert schon angefangen. Ein kleiner, hagerer Mann, der als König des TexMex angekündigt worden war, spielte Harmonika. Das Publikum war nicht sehr interessiert, aber nach jedem zaghaften Applaus gab er neue Zugaben, bis der Veranstalter mitten in einem Stück auf die Bühne kam und sagte, das Konzert sei jetzt zu Ende. Ich fragte Angela, ob sie noch ein Bier mit mir trinken wolle. Sie sagte, sie müsse heim, es sei ein weiter Weg nach Jamaica. Ich könne sie ja wieder einmal besuchen dort. Wir waren beide etwas ratlos. Schließlich trennten wir uns.
Ein paarmal telefonierte ich mit Angela, aber wenn ich mich mit ihr verabreden wollte, hatte sie immer schon etwas vor oder sagte, sie sei müde und müsse früh ins Bett. Sie hatte noch einen zweiten Job angenommen und sparte Geld. Jedes Mal sagte sie, sie würde mich gern wiedersehen, ich solle sie anrufen. Schließlich gab ich auf.
Einmal trafen wir uns dann noch, an einem Mittag, kurz bevor ich in die Schweiz heimreiste. Ich gab ihr das Buch zurück. Sie fragte, wie es mir gefallen habe. Ich hatte es nicht gelesen, aber ich behauptete, ich hätte es gemocht. Sie sagte, es sei ihr Lieblingsbuch. Wir aßen in einem kleinen chinesischen Restaurant. Wir hatten beide wenig Zeit und trennten uns schon nach einer Stunde.
»Schreib mir«, sagte Angela, und ich versprach es.
»Ich komme bestimmt bald wieder nach New York«, sagte ich.
In der Schweiz nahm ich eine neue Stelle an. Ich hatte viel zu tun und dachte kaum noch an New York. An Weihnachten schickte ich Angela eine Karte, aber sie antwortete nicht. Danach schrieb ich ihr noch zwei- oder dreimal, aber ich bekam wieder keine Antwort. Ich werde ihr zu Weihnachten schreiben, aber ich glaube nicht, dass sie noch in Jamaica wohnt, in Queens. Schon als wir uns kennenlernten, suchte sie eine bessere Wohnung.
Ich weiß nicht, weshalb ich Angela suche. Wenn wir uns träfen, wüssten wir wohl kaum, worüber wir sprechen sollten. Wir haben nie viel gesprochen. Ich glaube, ich möchte nur wissen, wo sie ist, ob es ihr gutgeht. Und vielleicht hoffe ich noch immer herauszufinden, was uns vom ersten Augenblick an verband. Obwohl es im Grunde ohne Bedeutung ist.
BLITZEIS
Am Eisweiher
Ich war mit dem Abendzug aus dem Welschland nach Hause gekommen. Damals arbeitete ich in Neuchâtel, aber zu Hause fühlte ich mich noch immer in meinem Dorf im Thurgau. Ich war zwanzig Jahre alt.
Irgendwo war ein Unglück geschehen, ein Brand ausgebrochen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam mit einer halben Stunde Verspätung nicht der Schnellzug aus Genf, sondern ein kurzer Zug mit alten Wagen. Unterwegs blieb er immer wieder auf offener Strecke stehen, und wir Passagiere begannen bald, miteinander zu sprechen und die Fenster zu öffnen. Es war die Zeit der Sommerferien. Draußen roch es nach Heu, und einmal, als der Zug eine Weile gestanden hatte und das Land um uns ganz still war, hörten wir das Zirpen der Grillen.
Es war fast Mitternacht, als ich mein Dorf erreichte. Die Luft war noch warm, und ich hatte die Jacke nur übergehängt. Meine Eltern waren schon zu Bett gegangen. Das Haus war dunkel, und ich stellte nur schnell meine Sporttasche mit der schmutzigen Wäsche in den Flur. Es war keine Nacht zum Schlafen.
Vor unserem Stammlokal standen meine Freunde und berieten, was sie noch unternehmen sollten. Der Wirt hatte sie nach Hause geschickt, die Polizeistunde war vorüber. Wir redeten eine Weile draußen auf der Straße, bis jemand aus einem Fenster rief, wir sollten endlich ruhig sein und verschwinden. Da sagte Stefanie, die Freundin von Urs: »Warum gehen wir nicht im Eisweiher baden? Das Wasser ist ganz warm.«
Die anderen fuhren schon los, und ich sagte, ich würde nur schnell mein Fahrrad holen und dann nachkommen. Zu Hause packte ich meine Badehose und ein Badetuch ein, dann fuhr ich hinter den anderen her. Der Eisweiher lag in einer Mulde zwischen zwei Dörfern. Auf halbem Weg kam mir Urs entgegen.
»Stefanie hat einen Platten«, rief er mir zu. »Ich hole Flickzeug.«
Kurz darauf sah ich dann Stefanie, die an der Böschung saß. Ich stieg ab.
»Das kann eine Weile dauern, bis Urs zurückkommt«, sagte ich. »Ich gehe mit dir, wenn du magst.«
Wir schoben unsere Fahrräder langsam den Hügel empor, hinter dem der Weiher lag. Ich hatte Stefanie nie besonders gemocht, vielleicht weil es hieß, sie treibe es mit jedem, vielleicht aus Eifersucht, weil Urs sich nie mehr ohne sie zeigte, seit die beiden zusammen waren. Aber jetzt, als ich zum ersten Mal mit ihr allein war, verstanden wir uns ganz gut und redeten über dies und jenes.
Stefanie hatte im Frühjahr die Matura gemacht und arbeitete bis zum Beginn ihres Studiums im Herbst als Kassiererin in einem Warenhaus. Sie erzählte von Ladendieben und wer im Dorf immer nur die Aktionen und wer Kondome kaufe. Wir lachten den ganzen Weg. Als wir beim Weiher ankamen, waren die anderen schon hinausgeschwommen. Wir zogen uns aus, und als ich sah, dass Stefanie keinen Badeanzug dabeihatte, zog auch ich meine Badehose nicht an und tat, als sei das selbstverständlich. Der Mond war nicht zu sehen, aber unzählige Sterne und nur schwach die Hügel und der Weiher.
Stefanie war ins Wasser gesprungen und schwamm in eine andere Richtung als unsere Freunde. Ich folgte ihr. Die Luft war schon kühl gewesen und die Wiese feucht vom Tau, aber das Wasser war warm wie am Tag. Nur manchmal, wenn ich kräftig mit den Beinen schlug, wirbelte kaltes Wasser hoch. Als ich Stefanie eingeholt hatte, schwammen wir eine Weile nebeneinanderher, und sie fragte mich, ob ich in Neuchâtel eine Freundin hätte, und ich sagte nein.
»Komm, wir schwimmen zum Bootshaus«, sagte sie.
Wir kamen zum Bootshaus und schauten zurück. Da sahen wir, dass die anderen wieder am Ufer waren und ein Feuer angezündet hatten. Ob Urs schon bei ihnen war, konnten wir aus der Entfernung nicht erkennen. Stefanie kletterte auf den Steg und stieg von dort auf den Balkon, von dem wir als Kinder oft ins Wasser gesprungen waren. Sie legte sich auf den Rücken und sagte, ich solle zu ihr kommen, ihr sei kalt. Ich legte mich neben sie, aber sie sagte: »Komm näher, das hilft ja so nichts.«
Wir blieben eine Zeitlang auf dem Balkon. Inzwischen war der Mond aufgegangen und schien so hell, dass unsere Körper Schatten warfen auf dem grauen, verwitterten Holz. Aus dem nahen Wald hörten wir Geräusche, von denen wir nicht wussten, was sie bedeuteten, dann, wie jemand auf das Bootshaus zuschwamm, und kurz darauf rief Urs: »Stefanie, seid ihr da?«
Stefanie legte den Finger auf den Mund und zog mich in den Schatten des hohen Geländers. Wir hörten, wie Urs schwer atmend aus dem Wasser stieg und wie er sich am Geländer hochzog. Er musste nun direkt über uns sein. Ich wagte nicht, nach oben zu schauen, mich zu bewegen.
»Was machst du da?« Urs kauerte auf dem Geländer des Balkons und blickte auf uns herab. Er sagte es leise, erstaunt, nicht wütend, und er sagte es zu mir.
»Wir haben gehört, dass du kommst«, sagte ich. »Wir haben geredet, und dann haben wir uns versteckt, um dich zu überraschen.«
Jetzt schaute Urs zur Mitte des Balkons, und auch ich schaute hin und sah dort ganz deutlich, als lägen wir noch da, den Fleck, den Stefanies und mein nasser Körper hinterlassen hatten.
»Warum hast du das gemacht?«, fragte Urs. Wieder fragte er nur mich und schien seine Freundin gar nicht zu bemerken, die noch immer regungslos im Schatten kauerte. Dann stand er auf und machte hoch über uns auf dem Geländer zwei Schritte und sprang mit einer Art Schrei, mit einem Jauchzer, in das dunkle Wasser. Noch vor dem Klatschen des Wassers hörte ich einen dumpfen Schlag, und ich sprang auf und schaute hinunter.
Es war gefährlich, vom Balkon zu springen. Es gab im Wasser Pfähle, die bis an die Oberfläche reichten, als Kinder hatten wir gewusst, wo sie waren. Urs trieb unten im Wasser. Sein Körper leuchtete seltsam weiß im Mondlicht, und Stefanie, die nun neben mir stand, sagte: »Der ist tot.«
Vorsichtig stieg ich vom Balkon hinunter auf den Steg und zog Urs an einem Fuß zu mir. Stefanie war vom Balkon gesprungen und schwamm, so schnell sie konnte, zurück zu unseren Freunden. Ich zog Urs aus dem Wasser und hievte ihn auf den kleinen Steg neben dem Bootshaus. Er hatte am Kopf eine schreckliche Wunde.
Ich glaube, ich saß die meiste Zeit einfach nur da neben ihm. Irgendwann, viel später, kam ein Polizist und gab mir eine Decke, und erst jetzt merkte ich, wie kalt mir war. Die Polizisten nahmen Stefanie und mich mit auf die Wache, und wir erzählten, wie alles gewesen war, nur nicht, was wir auf dem Balkon getan hatten. Die Beamten waren sehr freundlich und brachten uns, als es schon Morgen wurde, sogar nach Hause. Meine Eltern hatten sich Sorgen gemacht.
Stefanie sah ich noch bei der Beerdigung von Urs. Auch meine anderen Freunde waren da, aber wir sprachen nicht miteinander, erst später, in unserem Stammlokal, nur nicht über das, was in jener Nacht geschehen war. Wir tranken Bier, und einer sagte, ich weiß nicht mehr, wer es war, es reue ihn nicht, dass Stefanie nicht mehr komme. Seit sie dabei gewesen sei, habe man nicht mehr vernünftig reden können.
Einige Monate später erfuhr ich, dass Stefanie schwanger war. Von da an blieb ich an den Wochenenden oft in Neuchâtel und fing sogar an, meine Wäsche selber zu waschen.
Treibgut
May God forgive the hands that fed
The false lights over the rocky head!
John Greenleaf Whittier
Ich wusste nicht, ob ich die richtige Nummer gewählt hatte. Auf dem Anrufbeantworter war nur klassische Musik zu hören, dann ein Pfeifton und dann die erwartungsvolle Stille der Aufnahme. Ich rief noch einmal an. Wieder kam nur die Musik, und ich hinterließ eine Nachricht. Eine halbe Stunde später rief Lotta zurück. Als wir uns besser kannten, erzählte sie mir von Joseph. Er sei der Grund, weshalb sie den Beantworter nicht bespreche. Er dürfe nicht wissen, dass sie zurück sei in der Stadt.
Lotta war Finnin und wohnte im West Village auf Manhattan. Ich brauchte für einige Zeit eine Wohnung. Eine Agentur hatte mir Lottas Nummer gegeben.
»Ich muss die Wohnung manchmal vermieten«, sagte Lotta, »wenn ich keine Arbeit habe.«
»Und wo wohnst du in der Zwischenzeit?«, fragte ich.
»Meistens bei Freunden«, sagte sie, »aber diesmal habe ich noch niemanden gefunden. Weißt du einen Platz für mich?«
Die Wohnung war groß genug, und so bot ich ihr an zu bleiben. Sie willigte sofort ein.
»Du darfst das Telefon nie direkt abnehmen«, sagte sie. »Warte immer, bis du weißt, wer dran ist. Wenn du mich anrufen willst, ruf mich. Dann stelle ich den Beantworter ab.«
»Warst du da, als ich zum ersten Mal anrief?«, fragte ich.
»Ja«, sagte sie.
Lotta wohnte im vierten Stock eines alten Hauses in der 11th Street. Alles war schwarz in der Wohnung, die Möbel, das Bettzeug, die Teppiche. Einige vertrocknete Kakteen standen auf dem kleinen eisernen Balkon, der auf einen Hinterhof hinausging. Auf der Kommode neben Lottas Bett und auf dem Glastisch mit dem Anrufbeantworter lagen verstaubte Muscheln und Korallenästchen. In den wenigen Lampen steckten rote und grüne Glühbirnen, die die Räume abends in ein seltsames Licht tauchten, als stünden sie unter Wasser.
Als ich die Wohnung besichtigt hatte, war Lotta im Pyjama an die Tür gekommen, obwohl es schon Mittag war. Nachdem sie mir alles gezeigt hatte, ging sie sofort zurück ins Bett. Ich hatte sie gefragt, ob sie krank sei, aber sie hatte den Kopf geschüttelt und gesagt, sie schlafe einfach gern.
Als wir dann zusammen wohnten, stand sie nie vor Mittag auf und ging meistens vor mir wieder zu Bett. Sie las viel und trank Kaffee, aber ich sah sie kaum je essen. Sie schien von Kaffee und Schokolade zu leben. »Du musst gesünder essen«, sagte ich, »dann bist du nicht immer so müde.«
»Aber ich schlafe gern«, sagte sie und lachte.
Mit uns lebte eine ganz junge schwarze Katze. Lotta hatte sie geschenkt bekommen und Romeo getauft. Später hatte sie erfahren, dass Romeo ein Weibchen war, aber der Name war geblieben.
Es war Oktober. Ich traf alte Freunde, Werner und Graham, die bei einer Bank arbeiteten. Ich schlug ihnen vor, für ein langes Wochenende ans Meer zu fahren. Graham sagte, wir könnten sein Auto nehmen, und ich lud Lotta ein, mit uns zu kommen. An einem Freitagmorgen fuhren wir los. Wir wollten nach Block Island, einer kleinen Insel, hundert Meilen östlich von New York.
Noch in Queens machten wir zum ersten Mal halt. Unsere Abfahrt hatte sich verzögert, und wir waren hungrig. An einem kleinen Imbissstand direkt an der Hauptstraße aßen wir Hotdogs. Lotta trank nur Kaffee. An einer Kreuzung, nicht weit von uns entfernt, stand ein Schwarzer. Er hatte eine Pappschachtel mit vakuumverpacktem Fleisch neben sich. Wenn die Ampel rot wurde, ging er von Auto zu Auto und versuchte, das Fleisch zu verkaufen. Als er uns sah, kam er mit einem der Pakete in der Hand auf uns zugerannt. Wir unterhielten uns eine Weile mit ihm. Sein Französisch war besser als sein Englisch, und wir fragten ihn, wie es ihn ausgerechnet nach Queens verschlagen habe. Er ging auf all unsere Scherze ein, hoffte wohl bis zuletzt, dass wir ihm etwas abkaufen würden. Als wir schon losfuhren, lächelte er noch, hob sein Fleisch in die Höhe und rief uns etwas nach, das wir nicht mehr verstanden.
Wir waren mit der letzten Fähre an diesem Tag auf die Insel gekommen. Das Auto hatten wir auf einem fast leeren Parkplatz auf dem Festland zurückgelassen. Die Überfahrt dauerte zwei Stunden, und obwohl es kalt war, blieb Werner die ganze Zeit über draußen an der Reling stehen. Wir anderen saßen in der Cafeteria. Das Schiff war fast leer.
Direkt am Hafen der Insel stand ein großes, heruntergekommenes Jugendstilhotel. Nicht weit davon entfernt fanden wir eine einfache Pension in einem leuchtend weiß gestrichenen Holzhaus. Es war selbstverständlich, dass Lotta mit mir das Zimmer teilte.
Vom Meer her wehte ein heftiger Wind. Trotzdem beschlossen wir, noch vor dem Abendessen einen Spaziergang zu machen. Am Strand entlang führte eine Promenade aus grauverwittertem Holz. Außerhalb des Dorfes hörte sie plötzlich auf, und wir mussten durch den Sand weitergehen.
Werner und ich gingen nebeneinander. Er war sehr schweigsam. Graham und Lotta hatten die Schuhe ausgezogen und suchten näher am Wasser nach Muscheln. Sie blieben bald zurück. Nur manchmal hörten wir noch einen Schrei oder Lottas hohes Lachen durch das Lärmen der Brandung.
Als wir eine Weile gegangen waren, setzten Werner und ich uns in den Sand, um auf die beiden zu warten. Im Gegenlicht sahen wir ihre Silhouetten schwarz vor dem glitzernden Wasser.
»Was machen die so lange da unten?«, fragte ich.
»Muscheln suchen«, sagte Werner ruhig. »Wir sind weit gegangen.«
Ich kletterte auf eine Düne, um zurückzuschauen. Sand kam in meine Schuhe, und ich zog sie aus. Das Dorf war weit entfernt. In einigen Häusern brannte schon Licht. Als ich zurückkam, war Werner zum Ufer hinuntergegangen. Lotta und Graham saßen im Windschatten der Düne. Sie hatten ihre Schuhe wieder angezogen. Ich setzte mich neben sie, und wir schauten schweigend zum Meer, wo Werner Muscheln oder Steine ins Wasser warf. Der Wind trieb den Sand in Wirbeln über den Strand.
»Ich friere«, sagte Lotta.
Auf dem Rückweg ging ich neben Lotta und half ihr, die gesammelten Muscheln zu tragen. Meine Schuhe hatte ich an den Schnürsenkeln zusammengeknotet und über die Schultern gehängt. Der Sand war kalt geworden. Graham lief voraus, Werner folgte uns in einiger Entfernung.
»Graham ist nett«, sagte Lotta.
»Sie arbeiten bei einer Bank«, sagte ich, »er und Werner. Aber sie sind o.k.«
»Wie alt ist er?«
»Wir sind alle gleich alt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen.«
Lotta erzählte von Finnland. Sie war auf einem Bauernhof aufgewachsen, nördlich von Helsinki. Ihr Vater hatte Stiere gezüchtet. Lotta war schon früh von zu Hause weggegangen, erst nach Berlin, dann nach London, nach Florenz. Schließlich, vor vier oder fünf Jahren, war sie nach New York gekommen.
»Letzte Weihnachten habe ich meine Eltern besucht. Zum ersten Mal seit Jahren. Meinem Vater geht es nicht gut. Ich wollte erst dableiben, aber im Mai bin ich dann doch zurückgekommen.« Sie zögerte. »Eigentlich bin ich nur wegen Joseph gegangen.«
»Was war denn mit Joseph? Wart ihr ein Paar?«
Lotta zuckte mit den Achseln. »Das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich dir ein andermal.«
Kurz vor dem Dorf schauten wir uns nach Werner um. Er war weit zurückgeblieben und ging langsam, nahe am Wasser entlang. Als er sah, dass wir auf ihn warteten, winkte er und kam schneller auf uns zu.
Wir aßen in einem kleinen Fischrestaurant. Lotta sagte, sie sei Vegetarierin, aber Graham meinte, Fisch dürfe sie trotzdem essen. Wir luden sie ein, und sie aß von allem, aber trank keinen Wein.
Wenn Lotta eine Weile geschwiegen hatte, fielen Graham und ich manchmal in unsere Muttersprache. Werner sagte nichts, und Lotta schien es nicht zu stören. Sie aß langsam und konzentriert, als müsse sie sich jede Bewegung in Erinnerung rufen. Sie merkte, dass ich sie beobachtete, lächelte mir zu und aß erst weiter, als ich meinen Blick abgewandt hatte.
Nachts trug Lotta einen rosaroten Pyjama mit einem aufgestickten Teddybären. Ihr blondes Haar war kurz geschnitten. Sie musste über dreißig sein, aber sie wirkte wie ein Kind. Sie lag auf dem Rücken und hatte die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen. Ich hielt den Kopf aufgestützt und schaute sie an.
»Willst du immer in New York bleiben?«, fragte ich.
»Nein«, sagte Lotta, »ich mag das Klima nicht.«
»Finnland ist auch nicht besser«, sagte ich.
»Zu Hause war mir immer kalt. Ich möchte nach Trinidad. Ich habe Freunde dort.«
»Du hast viele Freunde.«
»Ja«, sagte Lotta.
»Jetzt hast du auch Freunde in der Schweiz.«
»Ich möchte einen kleinen Laden haben auf Trinidad«, sagte sie. »Kosmetik, Filme, Aspirin und so … von hier direkt importiert. Das gibt es dort nicht. Oder es ist sehr teuer.«
»Spricht man Englisch auf Trinidad?«, fragte ich.
»Ich glaube. Meine Freunde sprechen Englisch … und es ist immer warm.«
Unten fuhr ein Auto vorüber. Das Scheinwerferlicht, das durch die Jalousien fiel, wanderte durchs Zimmer, über die Decke und erlosch plötzlich, dicht über unserem Bett.
»Du bist sehr frei«, sagte ich. Aber da war Lotta schon eingeschlafen.
Wir trafen Werner und Graham beim Frühstück.
»Habt ihr gut geschlafen?«, fragte Graham grinsend.
»Ich mag es, wenn man das Meer vom Bett aus hört«, sagte ich.
»Ich war müde«, sagte Lotta.
Werner aß schweigend.
Vor dem Mittag begann es zu regnen, und wir gingen ins Lokalmuseum. Es war in einem kleinen weißen Schuppen untergebracht. Über die Geschichte von Block Island gibt es nicht viel zu sagen. Die Insel wurde irgendwann von einem Holländer namens Block entdeckt. Später kamen Siedler vom Festland herüber. Danach geschah nicht mehr viel.
Der alte Mann, der das Museum führte, erzählte uns von den unzähligen Schiffen, die an den Klippen vor der Insel gestrandet waren. Die Leute hier hätten mehr vom Strandgut als von der Fischerei gelebt.
»Es heißt, sie hätten die Schiffe mit falschen Feuern an die Klippen gelockt«, sagte der Mann und lachte. Heute lebe die Insel vom Tourismus. Im Sommer sei jede Fähre voll von Badegästen, und viele reiche New Yorker hätten ein Sommerhaus auf der Insel. Eine Zeitlang habe es zum guten Ton gehört, ein Haus auf Block Island zu haben. Aber heute flögen die Reichen in die Karibik.
»Es ist ruhiger geworden hier«, sagte der Mann, »aber wir können uns nicht beklagen. Schiffe stranden nicht mehr, aber es wird noch allerhand angetrieben.«
Lotta fragte ihn, ob er Fischer sei.
»Ich war Immobilienmakler«, sagte er. »Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier alles angetrieben wird.«
Er lachte, ich wusste nicht, weshalb.
Dann gingen wir wieder an den Strand. Lotta machte sich auf die Suche nach Muscheln, wir anderen setzten uns und rauchten. Graham schaufelte mit einem zerbrochenen Krebspanzer ein Loch in den feinen Sand, der schon dicht unter der Oberfläche feucht zusammenklebte.
»Und«, sagte ich, »was habe ich gesagt? Sie ist doch ganz nett.«
Werner schwieg. Graham lachte. »Wir haben nicht mit ihr im selben Bett geschlafen.«
»Wie das klingt: im selben Bett geschlafen. Sag doch, was du denkst.«
»Heute Nacht bin ich an der Reihe«, sagte Graham grinsend, »und morgen Werner. Aber der macht so was nicht.«
Ich sagte, er sei ein Idiot, und Werner sagte: »Hört auf.« Er stand auf und ging davon, zum Meer hinunter. Lotta kam zurück, die Hände voller Muscheln. Sie setzte sich neben uns in den Sand, breitete ihre Beute vor sich aus und begann, sie sorgfältig mit den Fingern abzuwischen. Graham hatte sich eine Röhrenmuschel vom Lager zwischen Lottas Beinen genommen und betrachtete sie lange.
»Seltsam, was die Natur alles hervorbringt«, sagte er und lachte. »Wie war das? Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier alles angetrieben wird.«
Mit der Mittagsfähre waren noch einmal einige Touristen angekommen, aber sie verloren sich rasch in alle Richtungen, und schon bald war das Dorf wieder leer. Wir aßen auf der Terrasse eines Coffee Shops.
»Was nun?«, fragte ich.
»Ich bin müde«, sagte Lotta. »Ich lege mich eine Stunde hin.«
Graham machte sich auf die Suche nach einer Zeitung, und Werner sagte, er gehe ans Meer. Ich schlenderte mit Lotta zurück zum Hotel.
Die Betten in unserem Zimmer waren schon gemacht, und das Fenster stand weit offen. Lotta schloss es und ließ die Jalousien herunter. Sie legte sich hin. Ich setzte mich auf den Boden und lehnte mich an das Bett.
»Was wohl der arme kleine Romeo macht«, sagte Lotta. »Er fehlt mir schrecklich.«
»Es wird ihm schon gutgehen.«
»Willst du dich nicht hinlegen?«
»Ich bin nicht müde.«
»Ich kann immer schlafen«, sagte Lotta.
Am Nachmittag liehen wir uns Fahrräder, um die Palatine-Gräber im Süden der Insel zu besuchen. Sechzehn Holländer, die den berühmten Schiffbruch der Palatine an der Insel überlebt hatten, sollen dort begraben sein.
»Warum sind sie denn begraben, wenn sie doch überlebt haben?«, fragte Lotta.
»Lebendig begraben«, sagte Graham.
Werner lachte.
»Das war im achtzehnten Jahrhundert«, sagte ich.
»Aber warum wurden sie zusammen begraben?«, fragte Lotta. »Nur weil sie auf demselben Schiff waren?«
»Vielleicht weil sie zusammen gerettet wurden«, sagte ich, »das verbindet.«
Wir fanden irgendwo einen verrotteten Wegweiser, aber die Gräber fanden wir nicht. Auf einer Wiese trafen wir einen Mann. Auch er wusste nicht, wo die Gräber waren. Er hatte noch nie etwas von ihnen gehört. Enttäuscht kehrten wir um.
»Ich mag sowieso keine Friedhöfe«, sagte Lotta.
Wir fuhren jetzt gegen den Wind und kamen erst, als es schon dunkel wurde, zurück zu unserem Hotel. Wir tranken ein Bier. Lotta rief ihre Nachbarin an, um sich nach der Katze zu erkundigen.
»Alles in Ordnung«, sagte sie, als sie wieder da war.
»Werner wird in einer Woche dreißig«, sagte ich zu Lotta. »Wir sollten eine Party für ihn geben.«
»Dann bist du eine Waage«, sagte sie. »Joseph ist auch eine Waage.«
Werner nickte. Er wolle keine Party, sagte er.
»Wer ist Joseph?«, fragte Graham. »Joseph und Maria?«
»Joseph und Lotta«, sagte ich.
»Ein Freund«, sagte Lotta.
»Waage«, murmelte Graham und blätterte in seiner Zeitung. Dann las er vor: »Sie müssen eine Entscheidung treffen und sollten von realistischen Überlegungen ausgehen. Das Knüpfen neuer Kontakte dürfte Ihnen nicht schwerfallen. Glückliche Stunden stehen bevor.«
»Das ist ein gutes Horoskop«, sagte Lotta.
Werner lachte. Es war ein seltsames, spöttisches Lachen. Graham und ich lachten mit, aber Lotta lächelte nur und legte eine Hand auf Werners Arm.
»Es ist in Ordnung«, sagte sie. »Komm, wir gehen spazieren.«
Sie standen auf, und wir verabredeten uns in einer Stunde in dem Fischrestaurant vom Abend vorher. Werner ging aufrecht und langsam wie ein kranker Mensch. Es sah aus, als bewege er sich nicht. Lotta hängte sich bei ihm ein. Sie schien ihn vorwärts zu ziehen hinunter zum Strand.
»Und«, fragte Graham, nachdem wir lange geschwiegen hatten, »wie ist sie?«
»Was meinst du?«
»Spiel nicht den Unschuldigen. Wozu hast du sie denn sonst mitgenommen?«
»Sie ist eine seltsame Frau«, sagte ich. »Findest du nicht?«
Graham grinste. »Eine Frau ist eine Frau.«
»Nein«, sagte ich, »ich mag sie. Ich bin gern mit ihr zusammen.«
»Was meinst du, wer von uns dreien gefällt ihr am besten?«, fragte Graham.
»Ich glaube, du bist der Einzige hier, der so versessen darauf ist, ihr zu gefallen.«
»Ach was. Mir gefällt ihre müde Art. Die sind gut im Bett. Ich kenne den Typ.«
»Mein lieber Freund, denk an deine Frau.«
»Ich bin in den Ferien. Meinst du, ich bin hierhergekommen, um Muscheln zu suchen?«
»Und was sagt Werner?«, fragte ich.
»Nichts. Er sagt überhaupt nichts. Ich habe ihn noch nie so schweigsam erlebt. Stumm wie ein Fisch.«
Wir hatten unser Bier ausgetrunken. Graham sagte, er müsse telefonieren, und ich setzte mich in einen Sessel im Foyer der Pension und blätterte im Fishermen’s Quarterly.
Lotta kam nicht zum Abendessen. Sie sei müde, sagte Werner, als er allein an unseren Tisch trat. Während des Essens war er noch immer schweigsam, aber der Ernst der vergangenen Tage war verschwunden, und manchmal ließ er sein Besteck sinken und lächelte still vor sich hin.
»Haben wir uns verliebt?«, fragte Graham spöttisch.
»Nein«, sagte Werner kurz, aber nicht unfreundlich. Dann aß er ruhig weiter. Beim Kaffee meinte er, er wolle morgen die Kreideklippen im Süden der Insel sehen.
»Die müssen in der Nähe der Palatine-Gräber sein«, sagte ich. »Noch mal den ganzen Weg da raus …«
Auch Graham hatte keine Lust, ein zweites Mal über die Insel zu fahren.
»Nur wegen ein paar Kreidefelsen. In Europa hast du überall Kreidefelsen. In England, in der Bretagne, in Irland, überall.«
Aber Werner ließ sich nicht beirren und meinte nur: »Ihr müsst ja nicht mitkommen.«
Um Mitternacht ging Werner zu Bett. Graham und ich blieben noch lange sitzen. Wir hatten ziemlich viel getrunken. Graham erzählte, seine Frau sei ausgezogen. Sie wohne jetzt bei ihrem Englischlehrer.
»Sie hat keine Arbeitsbewilligung bekommen«, sagte er. »Nachher wollte sie ein Kind, aber das hat nicht geklappt. Sie hat sich gelangweilt.«
Graham tat mir leid. Da merkte ich plötzlich, wie wenig ich ihn mochte. Ich sagte, ich sei müde und wolle ins Bett. Er bestellte noch zwei Bier, aber ich stand auf und ging.
Lotta schien tief zu schlafen, als ich ins Zimmer trat. Sie atmete laut und unregelmäßig. Ich zog mich aus, öffnete das Fenster einen Spaltbreit und legte mich neben sie. Ich horchte auf ihren Atem und auf das Rauschen des Meeres, doch schlief ich bald ein und erwachte erst, als jemand heftig an die Tür klopfte. Sofort sah ich, dass Lotta nicht da war, aber ich dachte mir nichts dabei. Es war schon später Vormittag. Draußen stand Graham.
»Werner ist weg«, sagte er.
»Lotta auch«, sagte ich. »Vielleicht sind sie beim Frühstück.«
»Nein«, sagte Graham, »ich war schon unten.«
Wir frühstückten in der Pension.
»Vielleicht sind sie ans Meer gegangen«, sagte ich, »oder zu den Klippen.«
»Die Fahrräder haben sie jedenfalls nicht genommen«, sagte Graham, »und zu Fuß sind es mindestens zwei Stunden zu den Klippen.«
Wir waren beide verärgert. Als Werner und Lotta gegen Mittag noch immer nicht da waren, nahmen wir die Räder und fuhren in Richtung Süden. Aber es gab zwei Straßen, und wenn Lotta und Werner zu Fuß unterwegs waren, kamen sie überall durch. Zwei Stunden später waren wir wieder in der Pension.
»Die können etwas erleben, wenn sie zurückkommen«, sagte Graham.
Die Frau am Empfang winkte uns zu sich. Sie sagte, wir müssten unsere Zimmer räumen. Unsere Freunde seien abgereist, während wir weg gewesen seien. Sie hätten eine Nachricht hinterlassen. Sie reichte mir ein Blatt Papier, auf das Lotta geschrieben hatte, wir sollten uns keine Sorgen machen und allein nach Hause fahren. Sie und Werner nähmen einen anderen Weg.
»Dass deine Finnin nicht wählerisch ist, wundert mich nicht«, sagte Graham, »aber dass sie mit Werner geht …«
»Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb sie gegangen sind«, sagte ich. »Wir hatten doch schöne Tage zusammen.«
»Werner hat gewonnen«, sagte Graham. »So einfach ist das.«
Er grinste, aber er konnte seine Wut nicht verbergen.
»Sie ist ein freier Mensch«, sagte ich. »Sie kann gehen, mit wem sie will.«
Die Zeit reichte gerade noch, um zu packen, bevor die nächste Fähre zum Festland ging.
Die Überfahrt war kalt und windig. Als wir zum Auto kamen, war schon der ganze Himmel bewölkt, und kurz nachdem wir losgefahren waren, begann es zu regnen. Wir sprachen nicht viel. Graham war wütend und fuhr viel zu schnell. Er gehe bald zurück in die Schweiz, sagte er, er habe endgültig genug von Amerika. Seine Frau werde dann wohl oder übel auch mitkommen müssen. Sie lebe immer noch von seinem Geld.
In der Nähe von Bridgeport hielten wir an einer Tankstelle, und ich versuchte, Werner und dann Lotta anzurufen. Aber Werner war nicht da, und Lottas Maschine spielte nur ihre Musik, als sei nichts geschehen. Nach dem Pfeifton rief ich: »Lotta, bist du da? Lotta!«
Ich stellte mir vor, wie meine Stimme durch die leere Wohnung hallte, und kam mir lächerlich vor. Ich hängte ein.
Wir fuhren durch die Bronx direkt nach Queens, wo Graham wohnte. Ich ging mit ihm hinauf. Die Wohnung war unaufgeräumt, in der Küche stand schmutziges Geschirr. Während Graham den Anrufbeantworter abhörte, kochte ich Kaffee. Auf dem Band war eine aufgeregte Stimme zu hören, aber ich verstand nichts bei dem Sirren des kochenden Wassers. Als ich ins Wohnzimmer kam, saß Graham zusammengesunken auf dem Sofa und hielt den Telefonhörer ans Ohr gepresst. Ich goss Kaffee ein. Graham sagte ein paarmal ja, dann bedankte er sich und legte auf.
»Werner hat sich umgebracht«, sagte er. »Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, bevor wir am Freitag losgefahren sind. Das war seine Vermieterin. Sie hat einen Schlüssel zur Wohnung und hat gestern da herumgeschnüffelt. Als es regnete, hat sie gesagt, wollte sie nachsehen, ob alle Fenster geschlossen seien.«
Er erzählte mir die ganze, völlig nebensächliche Geschichte, als fürchte er sich vor der Stille.
»Der Brief lag auf dem Esstisch. Die Frau spricht etwas Deutsch, sie stammt aus Ungarn und hat das Wichtigste verstanden. Aber sie wusste nicht, wo wir waren. Meine Nummer hat sie neben dem Telefon gefunden. Sie hat noch ein paar andere Leute angerufen.«
»Aber Lotta«, sagte ich, »sie hat sich doch bestimmt nicht … Sie hat doch geschrieben, wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie nähmen einen anderen Weg …«
Graham zuckte mit den Achseln.
»Meinst du, er wollte sich … er hat sich von den Klippen gestürzt?«, fragte ich. »Das traue ich ihm nicht zu. Er ist kein Romantiker.«
»Eine Pistole hat er bestimmt nicht«, sagte Graham.
»Was sollen wir machen?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht«, sagte er. »Für eine Vermisstenmeldung ist es zu früh.«
Er wollte mich in die Stadt bringen, aber ich sagte, er solle beim Telefon bleiben. Ich hatte keine Lust zu reden, ich wollte allein sein. Auf dem Tisch standen unberührt die beiden Tassen mit Kaffee.
Die Subway-Station war fast leer. Ich musste eine Viertelstunde warten, bis endlich ein Zug kam. Als wir uns Manhattan näherten, füllte sich der Wagen langsam. Ich stieg eine Station früher aus als sonst und ging das letzte Stück zu Fuß. Es regnete nicht mehr, aber die Straßen waren noch immer nass. Im Supermarkt in meinem Viertel kaufte ich Bier und ein Sandwich.
Als ich die Wohnungstür öffnete, hörte ich Lottas Stimme. Der Anrufbeantworter lief und nahm sie auf. Ich wollte den Hörer abheben, um mit ihr zu sprechen, aber dann ließ ich es bleiben und hörte nur zu.
»Die Möbel gehören Joseph. Und Romeo … Robert, schau bitte nach Romeo. Er ist noch so klein. Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Du kannst auch in der Wohnung bleiben. Das musst du mit Joseph ausmachen. Sag ihm, dass du die Agentur bezahlt hast.«
Es war einen Moment still.
»Ich glaube, das ist alles. Macht’s gut, und seid uns nicht böse. Bye Graham, bye Robert.«
Sie flüsterte: »Möchtest du noch etwas sagen?«
Ich hörte, wie Werner kurz und deutlich nein sagte. Dann knackte es, und die Verbindung war unterbrochen. Ich stellte mir vor, wie Lotta sich zu Werner umwandte, irgendwo an einer Bushaltestelle oder in einem Restaurant, wie er sie anlächelte und wie sie gemeinsam weggingen und verschwanden. Ich dachte, dass ich die letzte Gelegenheit verpasst hatte, sie zu sprechen, mich wenigstens von ihnen zu verabschieden.
Ich spulte das Band ganz zurück und hörte es ab.
»Sie haben zwei Nachrichten«, sagte eine künstliche Stimme. Dann kam meine Stimme: »Lotta, bist du da? Lotta!« Ich klang nervös und ärgerlich, ängstlich. Es knackte zweimal, dann sprach Lotta: »Hallo? Ist jemand da? Hallo, Robert, hallo!« Sie seufzte, dann sagte sie: »Na gut, dann seid ihr also noch unterwegs. Auch gut. Ich rufe von einem Restaurant aus an. Wir sind in … wo sind wir?« Ich hörte sie flüstern.
»Wir sind in der Nähe von Philadelphia. Ich bin mit Werner zusammen. Wir gehen weg. Werner wollte … er hat einen Brief in der Wohnung zurückgelassen. Aber was er schreibt, gilt nicht mehr. Wir gehen weg. Er hat alles geregelt. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr den Brief findet. Bei mir gibt es nicht viel zu erledigen. Robert? Wenn du das hörst, ruf doch bitte Joseph an. Er weiß über alles Bescheid. Seine Nummer findest du im Verzeichnis neben dem Telefon. Ich war noch schnell in der Wohnung, um ein paar Sachen zu holen. Den Rest brauche ich nicht mehr. Die Möbel gehören Joseph …«
Ich stellte das Band ab und rief Graham an. Wir sprachen nur kurz. Als ich mir ein Bier holte, kam Romeo in die Küche. Im Kühlschrank fand ich Milch. »Do you know where your children are?« stand auf der Verpackung, darunter waren das Bild und der kurze Steckbrief eines vermissten Kindes gedruckt.
Die Milch war sauer, und ich goss sie weg. In einem der Schränke fand ich eine Büchse Katzenfutter. Ich schaltete den Fernseher ein, legte mich aufs Sofa und trank mein Bier.
Einige Tage später rief ich Joseph an und bat ihn um ein Treffen. Ich sagte, ich sei ein Freund von Lotta. Er räusperte sich und sagte, ich könne ihn in seinem Restaurant an der Ecke Vandam und Hudson Street treffen.
Am nächsten Vormittag ging ich hin. Das Lokal war dunkel und leer. Nur an einem der hinteren Tische saß ein kleiner, untersetzter Mann und las Zeitung. Er hatte eine Stirnglatze und war vielleicht fünfzig Jahre alt. Er erhob sich, als ich an seinen Tisch trat, und reichte mir die Hand.
»Sie müssen Robert sein. Freut mich. Ich bin Joseph. Was bringen Sie mir von Lotta?«
Er bat mich, Platz zu nehmen, und ging hinter die Theke, um mir einen Kaffee zu holen.
»Ich bin Lottas Untermieter«, sagte ich.
»Also ist sie zurück aus Finnland. Ich habe es eigentlich vermutet.«
»Sie ist verschwunden«, sagte ich.
Er lachte. »Milch und Zucker? Das ist nicht ungewöhnlich bei ihr.«
»Schwarz«, sagte ich. »Sie ist mit einem Freund von mir auf und davon. Niemand weiß wohin.«
Joseph setzte sich mir gegenüber. »Das Haus gehört mir«, sagte er. »Lotta hat keine Miete bezahlt. Schauen Sie mich nicht so an. Ich bin nicht verheiratet.«
»Es war nichts zwischen uns«, sagte ich. »Wir haben nur zusammen gewohnt.«
»Das wundert mich nicht«, sagte Joseph. »Lotta ist eine von diesen vagabundierenden Schmarotzerinnen. In New York wimmelt es von der Sorte. Sie nehmen, was sie kriegen können, aber sie geben nie etwas zurück.«
»Ich wollte immer leben wie sie«, sagte ich. »Ich mag sie. Sie ist nett.«
»Natürlich. Was glauben Sie, warum habe ich sie gratis wohnen lassen?«
Ich lächelte, und er lächelte auch.
»Wie lange wollten Sie in der Wohnung bleiben?«
»Noch drei Wochen. Ich habe die Miete bezahlt. Ich habe eine Quittung …«
»Keine Angst. Bleiben Sie, solange Sie wollen.«
»Was ist mit Lottas Sachen?«, fragte ich. »Sie hat gesagt, sie braucht sie nicht mehr.«
»Lassen Sie nur alles, wie es ist«, sagte er. »Irgendwann kommt sie ja doch zurück.«
In den Außenbezirken
Heiligabend hatte ich bei Freunden verbracht. Schon am Nachmittag hatten sie eine Flasche Champagner geöffnet, und ich war früh nach Hause gegangen, weil ich betrunken war und mein Kopf schmerzte. Ich wohnte in einem kleinen Studio im Westen von Queens. Am Morgen weckte mich das Klingeln des Telefons. Meine Eltern riefen aus der Schweiz an, wünschten mir frohe Weihnachten. Das Gespräch dauerte nicht lange, wir wussten nicht, was wir noch sagen sollten. Draußen regnete es. Ich machte mir Kaffee und las.
Am Nachmittag ging ich spazieren. Zum ersten Mal seitdem ich hier wohnte, ging ich stadtauswärts, in die Außenbezirke. Ich kam auf den Queens Boulevard und folgte ihm in Richtung Osten. Die Straße zog sich breit und gerade durch immer gleiche Viertel. Manchmal folgte Geschäft auf Geschäft, und ich hatte den Eindruck, in einer Art Zentrum zu sein, dann kam ich in Wohngegenden mit Mietshäusern oder kleinen, schäbigen Reihenhäusern. Ich ging über eine Brücke, unter der ein altes, überwuchertes Gleis lag. Ein umzäuntes Grundstück voller Schutt und Abfälle folgte, eine riesige Kreuzung ohne Ampeln und ohne Verkehr. Dann kam ich wieder zu einigen Geschäften und einer Querstraße, über die, wie ein Dach, eine Subway-Linie gebaut war. Die Weihnachtsdekorationen in den Schaufenstern und das von Wind und Regen zerzauste Lametta, das in den Straßen hing, wirkten schon jetzt wie Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit.
Der Regen hatte nachgelassen, und ich blieb an der Straßenecke stehen, um mir eine Zigarette anzuzünden. Ich wusste nicht, ob ich weitergehen sollte. Da sprach mich eine junge Frau an und bat mich um Feuer. Sie sagte, es sei ihr Geburtstag. Wenn ich zwanzig Dollar hätte, könnten wir ein paar Sachen kaufen und ein kleines Fest machen.
»Es tut mir leid«, sagte ich. »Ich habe nicht so viel bei mir.«
Sie sagte, das sei egal, ich solle hier auf sie warten. Sie gehe einkaufen und komme dann zurück.
»Seltsam, dass du Weihnachten Geburtstag hast.«
»Ja«, sagte sie, als habe sie daran nicht gedacht, »das ist wahr.«
Sie ging die Straße hinunter, und ich wusste, dass sie nicht zurückkommen würde. Ich wusste, dass heute nicht ihr Geburtstag war, aber ich wäre trotzdem mit ihr gegangen, wenn ich genug Geld dabeigehabt hätte. Ich rauchte die Zigarette zu Ende und zündete mir eine zweite an. Dann machte ich mich auf den Weg zurück.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße sah ich ein Pub. Ich ging hinein und bestellte ein Bier.
»Bist du Franzose?«, fragte der Mann neben mir. »Ich heiße Dylan.« Wie der große Dylan Thomas, sagte er, light breaks where no sun shines …
»Hast du«, fragte Dylan, »in deinem ganzen Leben jemals ein Liebesgedicht von einer Frau an einen Mann gelesen?«
»Nein«, sagte ich. »Ich lese keine Gedichte.«
»Ich sage dir, das ist ein Fehler. Da findest du alles, in den Gedichten. Da steht alles drin.«
Er stand auf und stieg die kleine Treppe hinunter zur Toilette. Als er zurückkam, stellte er sich neben mich, legte einen Arm um meine Schultern und sagte: »Kein einziges! Die Frauen lieben die Männer nicht, glaub mir.«
Der Barmann machte mir ein Zeichen, das ich nicht verstand. Dylan zog ein abgegriffenes Buch aus der Tasche und hob es über unsere Köpfe.
»Immortal Poems of the English Language«, sagte er. »Das ist meine Bibel.«
Überall im Buch steckten kleine, schmutzige Zettel. Dylan schlug eine der Stellen auf.
»Hör, wie die Frauen die Männer lieben«, sagte er und las: »Mrs Elizabeth Barrett Browning: How do I love thee? Let me count the ways … Kein einziges Wort über ihn. Mrs Browning erzählt nur, wie sehr sie ihn liebt, wie grandios ihre Liebe ist. Ein anderes …«
Ein alter Mann neben mir flüsterte: »Das tut er dauernd.« Dann machte er dasselbe Zeichen wie vorher der Wirt. Ich begann zu verstehen, aber ich war schon etwas betrunken und wollte noch nicht gehen. Ich lächelte nur und wandte mich wieder Dylan zu, der eine andere Stelle aufgeschlagen hatte.
»Miss Brontë«, sagte er, »auch sie! Cold in the earth, and the deep snow piled above thee! Far, far removed … So fängt es an, und dann beschreibt sie ihren Schmerz. Der Mann spielt überhaupt keine Rolle. Oder hier … Mrs Rossetti: My heart is like a singing bird … My heart is like an apple-tree … Das geht so weiter bis zur letzten Zeile, wo es heißt: Because my love is come to me. Nennst du das Liebe? Schreibt so ein Mensch, der verliebt ist? Ja, einer, der in sich selbst verliebt ist.«
Er steckte das Buch weg und legte mir wieder seinen kurzen Arm um die Schultern.
»Die Liebe der Frauen, mein Freund … es gibt sie nicht. Sie lieben uns wie Kinder, wie ein Schöpfer seine Schöpfung liebt. Aber so wenig wie wir den Frieden mit Gott finden, finden wir den Frieden mit den Frauen.«
»Dann ist Gott eine Frau?«, fragte ich.
»Natürlich«, sagte Dylan, »und Jesus ist ihre Tochter.«
»Und du bist seine Schwester«, sagte der Barmann.
»Ich mag keine Frauen mit Bart«, murmelte der alte Mann neben mir.
Wir schwiegen.
»Die Schwulen gehen alle in die Hölle«, sagte der Alte.
»Auf diesem Niveau diskutiere ich nicht«, sagte Dylan böse und rückte näher zu mir, als suche er Schutz. »Wir zwei, wir sprechen von Poesie. Dieser junge Mann hat nicht solche Vorurteile wie ihr Schwachköpfe.«
»Die nächste Runde geht aufs Haus«, sagte der Barmann und schob eine Kassette mit Weihnachtsmusik in die Stereoanlage hinter sich.
»God rest ye merry, gentlemen«, sang Harry Belafonte.
»Eoh«, grölte ein junger Mann von einem der Tische, »he misadeh misadeeeho …«
Der Barmann stellte das Bier vor uns auf die Theke. Ich war inzwischen ziemlich betrunken. Ich hob mein Glas: »Es lebe die Poesie!«
»Na, sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt«, sagte der Alte.
»Lies die Gedichte, die Männer für Frauen geschrieben haben«, sagte Dylan und zitierte auswendig. »She is as in a field a silken tent, at midday when a sunny summer breeze has dried the dew …«
Bewegt schwieg er, blickte auf den schmutzigen Boden und schüttelte nachdenklich den Kopf.
»Frauen sagen, ich bin romantisch, wie wenn sie sagen würden, ich bin Amerikanerin«, fuhr er fort. »Sie lieben es, wenn du sagst, du bist so schön, deine Augen leuchten wie die Sonne, deine Lippen sind rot wie Korallen, deine Brüste weiß wie Schnee. Sie glauben, sie sind romantisch, weil sie es lieben, wenn die Männer sie anbeten.«
Ich wollte widersprechen, aber er sagte: »Ich möchte dir nur die Augen öffnen. Lass dich nicht von den Frauen reinlegen. Sie ködern dich mit all ihrem überflüssigen Fleisch. Und wenn du angebissen hast, schlagen sie dir den Schädel ein und fressen dich auf.«
Ich lachte.
»Du erinnerst mich an jemanden«, sagte Dylan.
»Einen Freund?«, fragte ich.
»Einen sehr guten Freund. Er ist gestorben.«
Ich ging zur Toilette.
»Ich habe kein Geld mehr für den Bus«, sagte ich.
»Ich bringe dich nach Hause«, sagte Dylan.