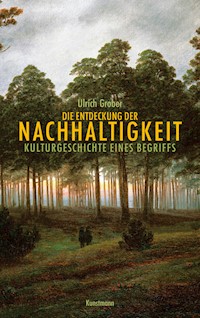Ulrich Grober
Der leise Atem der Zukunft
Vom Aufstieg nachhaltiger Wertein Zeiten der Krise
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 oekom, Münchenoekom verlag, Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagabbildung: © AKG Images (C. D. Friedrich),© MACIEJ NOSKOWSKI/iStockphoto (Bäume),© artjazz /Shutterstock (Windräder)
Satz und Layout: Tobias Wantzen, BremenLektorat: Manuel Schneider, oekom verlag
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96006-125-0
Inhalt
PrologVom Durchbruch
Kapitel 1Das Kalte-Herz-Syndrom
Zwischenruf: In Resonanz gehen
Kapitel 2Wanderer in der Autostadt
Zwischenruf: In Kontakt bleiben
Kapitel 3Energiequelle Gelassenheit
Zwischenruf: Leichtfüßig werden
Kapitel 4Halden-Saga
Zwischenruf: Ein europäisches Wir schaffen
Kapitel 5Passwort: teilen
Zwischenruf: Wachstum überdenken
Kapitel 6Mut zum Weniger
Statt eines EpilogsFragmente eines gelassenen Zukunftsdenkens
Zitierte und weiterführende Literatur
Danksagung
Zum Autor
PrologVom Durchbruch
~
Ein historischer Durchbruch« – mit diesem Wort feierten im Dezember 2015 beinahe einhellig Experten, Politiker und Medien im globalen Dorf das Pariser Klimaabkommen. An die 200 souveräne Staaten hatten sich am Ende eines dramatischen Verhandlungsmarathons auf einen Vertrag geeinigt, der die globale Klimaerwärmung auf »deutlich unter zwei Grad Celsius« begrenzen soll. Das Abkommen erklärten sie für »bindend«. Schon im April 2016 hatten es etliche Staaten ratifiziert. Die anderen wollen bis zum April 2017 folgen. Das Schicksal der Erde, so der weitgehende Konsens, hänge davon ab, wie schnell und wie umfassend die Maßnahmen umgesetzt würden.
»Durchbruch« – diese Metapher beherrschte das semantische Umfeld des Abkommens. Die im Vorfeld des Klimagipfels publizierte päpstliche Enzyklika Laudato si hatte bereits diesen Ton angeschlagen. »Wir brauchen eine Politik«, heißt es da, »deren Denken einen weiten Horizont umfasst und die einem neuen, ganzheitlichen Ansatz zum Durchbruch verhilft.« Auf der Konferenz selbst präsentierte sich eine Breakthrough Energy Coalition. Es handelte sich um zwei Dutzend der reichsten Leute der Welt, darunter alle großen Namen aus dem kalifornischen Silicon Valley. Sie kündigten Maßnahmen zu einer weltweiten Energiewende an, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden. Die Entwicklung von breakthrough technologies und die Schaffung einer sauberen Technosphäre seien der Weg in eine digitale, klimafreundliche Zukunft.
Moonshot thinking. Noch eine Metapher, die in der letzten Zeit Karriere machte. Auch sie hat im Silicon Valley ihren Ursprung. Sie besagt: Wir brauchen ein Denken, so groß und so kühn wie das Denken, das im 20. Jahrhundert Menschen auf den Mond – und zurück – gebracht hat. »Durchbruch«, »groß denken«, »Herausforderungen annehmen«: Diese Sprache hat eine Gravität. Die Rhetorik ist stark. Sie ist verlockend, spricht auch junge Wilde an. Mir kam, je länger ich hinhörte, das Hintergrundrauschen bekannt vor. Es weckte eine Fülle von Assoziationen und Erinnerungen. Sie versetzten mich zurück in die späten Sechzigerjahre ...
~
Der Gitarrenriff am Anfang klang nach Blues, der Trommelwirbel eher nach Salsa. Dann setzte die Stimme ein: maskulin, von latenter Wildheit, tranceartig – mystisch. You know the day destroys the night/Night divides the day. Gleich im ersten Vers scheint die uralte Polarität von Licht und Dunkelheit auf. Gefolgt von der archetypischen Albtraumszene: Tried to run/Tried to hide ... Du versuchst zu fliehen. Du versuchst dich zu verstecken. Doch du bist wie gelähmt. Es gibt kein Entrinnen. Was bleibt dir? Break on through to the other side. Gitarre, Orgel und Schlagzeug haben jetzt voll aufgedreht. Wag doch den Durchbruch, hämmert die Stimme. Wohin? Auf die andere Seite, Yeah. Der Song feiert die Vorwärtsbewegung in ihrer radikalsten Form. Durchbruch ist disruptiv, ist kreative Zerstörung. Doch was findest du dort? Eine andere Welt?
Ich saß in der Dunkelheit der Halle, einen Steinwurf weit vom Lichtspot entfernt, den der Scheinwerfer auf die Bühne warf. Kongresshalle, Frankfurt am Main, 12. September 1968. Ich war achtzehn. Am Vormittag war ich per Anhalter angekommen, um mich an der Universität für die Fächer Germanistik und Anglistik einzuschreiben. Erstsemester, Abi-Jahrgang ’68. Auf dem Campus an der Bockenheimer Warte war mir das Plakat ins Auge gefallen. The Doors spielten an diesem Abend nach London das zweite Konzert ihrer European Tour. Ihr Debütalbum von 1967 hatte ich rauf- und runtergespielt, bis ich so gut wie jeden Song auswendig kannte. Nun saß ich in einer Menge von zwei- oder dreitausend Fans. Überwiegend Soldaten. Die kalifornische Band war Kult, bei Abiturienten aus der westdeutschen Provinz, vor allem aber unter den GIs der U.S. Army, auf der Rhein-Main-Airbase genauso wie im Dschungel von Vietnam. So sah ich die Doors schräg rechts vor mir live auf der Bühne: Jim Morrison, ihr Dichter und Sänger, gekleidet in hautenger schwarzer Lederhose und weitem weißen Hemd, umklammerte das Mikrofon und schüttelte seine Löwenmähne. Die anderen, langhaarig, intellektuell, virtuos, blieben eher im Schatten.
We chased our pleasures here/Dug our treasures there ... Hedonismus ist nicht die Lösung, die Gier nach materiellen Dingen erst recht nicht. Das macht am Ende nur traurig: can you still recall / The time we cried? / Break on through to the other side. Durchbruch ist die Vorwärtsbewegung, die ein Hindernis zerstört. Everybody loves my baby ... She get HIGH. Jetzt ist die Stimme wie entfesselt. Geht es hier um Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll? Oder um mehr? Den Höhenflug, das bewusstseinserweiternde, mystische Erlebnis des flow, des Einsseins von Körper und Geist, Seele und Außenwelt. I found an island in your arms / Country in your eyes ... Die Umarmung, der Blickkontakt, die zwischenmenschliche Beziehung als tiefste, unergründliche Quelle von Glückserfahrung? Große Frage! Arme können doch klammern, Augen lügen. Egal, nicht stehen bleiben. Nicht nachgeben. Break on through. Es gibt kein richtiges Leben im falschen, lehrte der Frankfurter Philosoph Adorno, dessen Vorlesung ich vor ein paar Stunden belegt hatte. The gate is straight / Deep and wide / Break on through to the other side. So gipfelt der Song in einer Anspielung auf das biblische »Denn die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden« (Matthäus 7:14). – Was meinst du eigentlich genau mit »die andere Seite«?, hatte John Densmore, der Drummer der Doors, Morrison einmal gefragt. Die Antwort: »Na ja, die Leere, den Abgrund.« Der »kalifornische Traum«, den die Doors in Szene setzten, hatte definitiv seine dunklen Schatten – Übergänge zum Albtraum.
~
»Durchbruch« ist ein großes Wort. Eine semantische Tiefenbohrung, eine von vielen in diesem Buch. Sie alle dienen dazu, aus der Herkunft der Wörter ihre Bedeutung auszuloten und ihren Wert für die Zukunft zu skizzieren. Ein Schlüsseltext für den kalifornischen Traum war Aldous Huxleys langer Essay von 1954 über The Doors of Perception, zu Deutsch: Die Pforten der Wahrnehmung. Der aus England stammende, damals schon lange in Los Angeles lebende Schriftsteller beschreibt darin das Erleben einer »anderen Welt«. Im Titel, der die Doors zu ihrem Namen inspirierte, spielt Huxley auf einen Satz des englischen Romantikers William Blake an. »Würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, erschiene einem alles so, wie es wirklich ist: in seiner Unermesslichkeit.«
Unter diesem Motto protokolliert Huxley einen persönlich erlebten Drogentrip und einen »Durchbruch« zu einer anderen Wahrnehmung von Wirklichkeit. Zunächst breite sich »stoische Gelassenheit« (stoical serenity) aus. Es öffneten sich die »Türen in der Mauer«, und »verschiedene andere Welten« (various other worlds) träten hervor. Und zwar in ihrer nackten Existenz. An dieser Stelle seines Textes zitiert Huxley auf Deutsch ein Wort des mittelalterlichen Theologen, Mystikers und Ketzers Meister Eckhart: Istigkeit – Seinsgrund. Folgt man diesem roten Faden, kommt man ins Staunen: »Durchbruch« war eine zentrale Kategorie im Denken Meister Eckharts.
Was meinte der thüringische Mönch damit? Aus der Arbeitswelt der mittelalterlichen Bauhütten und Bergwerksstollen überträgt er die Vorstellung vom Durchbruch in die spirituelle Sphäre. Da geht es um nichts Geringeres als um die Öffnung zur Gegenwärtigkeit des Göttlichen, also zu dessen dauerhafter Präsenz im eigenen Leben. Es geht ihm um einen Vereinigungsvorgang: die unio mystica. Nicht vliehenne, fliehen, sich nicht in die Einsiedlerklause zurückziehen, predigt Meister Eckhart um 1300 seinen Novizen im Dominikanerkloster zu Erfurt. »Der mensche [...] muoz lernen diu dinc durchbrechen und sinen got dar inne nehmen.« Lernen, die Dinge zu durchbrechen und Gott darin zu ergreifen. Denn: »Diu schal muoz entzwei sin, sol der kerne heruz komen.« Eckhart hat noch ein weiteres Wort für den Durchbruch zur »Gottesgeburt in der Seele«: transformatio. Kaum anzunehmen, dass sich die heutigen Klimaforscher und Nachhaltigkeitsexperten, die sich für eine »große Transformation« starkmachen, dieser begrifflichen Wurzeln in der mittelalterlichen Mystik bewusst sind.
~
Noch eine Rückblende auf das turbulente Jahr 1968: An Heiligabend war ich wieder zu Hause. An diesem Tag flimmerten NASA-Bilder aus dem Raumschiff Apollo 8 zur Erde. Es umkreiste den Mond, etwa 100 Kilometer über der Oberfläche, auf der Suche nach einem geeigneten Platz für die erste Mondlandung, geplant für den Sommer 1969. Zum eigentlichen Faszinosum aber wird der Anblick der Erde. Über dem Horizont einer grauen, steinernen, öden Mondlandschaft hebt sich der 400 000 Kilometer entfernte Blaue Planet betörend schön aus der Schwärze des Weltalls. Die Fernsehbilder aus dem All unterlegen die Astronauten Anders und Lovell mit einer Lesung aus der Genesis, der biblischen Schöpfungsgeschichte. »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ...« Die Lesung endet an der Stelle: »Und Gott sah, dass es gut war.« Sekunden später verschwindet das Raumschiff hinter der erdabgewandten Seite des Mondes.
Ich erinnere mich vage. Sicher weiß ich nur eines: An diesem Tag wurde ich neunzehn. Die Aufnahmen vom earthrise, vom Aufgang der Erde, haben die Menschen damals weltweit euphorisiert und inspiriert. Ein neues Weltbild, Bild des Planeten, Bild der Menschheit von sich selbst, nahm Konturen an. Das Narrativ der Mondflüge enthielt eine Kosmologie für das 21. Jahrhundert. Es handelte von der Einzigartigkeit des Blauen Planeten (only one earth), von seiner Schönheit (der schönste Stern am Firmament) und – das war neu – von der Zerbrechlichkeit seiner Ökosysteme. Damit rückten zum ersten Mal die Grenzen des Wachstums ins Blickfeld. Global denken, lokal handeln.
Inmitten einer chaotischen, vom Kalten Krieg und von heißen regionalen Konflikten zerrissenen und vom nuklearen Winter bedrohten Welt entstand eine große Erzählung aus wenigen Worten. Sie setzte enorme positive Energien frei. Kreative Suchbewegungen begannen überall auf der Welt, an Lösungen nach menschlichem Maß zu arbeiten. Das Narrativ bildete die Matrix eines neuen, vitalen Begriffs, der in den folgenden Jahrzehnten zu einem neuen Paradigma, einer Achse des Denkens, aufstieg: sustainable development, Nachhaltigkeit. Die Essenz des moonshot thinking der Jahre um 1970 hat der Astronaut Eugene Cernan auf den Punkt gebracht: »Wir flogen los, um den Mond zu erkunden, tatsächlich aber entdeckten wir die Erde.«
~
Was bringt es, heute an die Bilder und Denkbilder von damals zu erinnern? Sie kehren, so scheint mir, momentan gerade mit neuer Strahlkraft zurück. Die Metapher vom »Durchbruch« ist hilfreich, um das Wesen einer Krise besser zu verstehen. Sie bringt uns zurück in den Modus der Vorwärtsbewegung. Kaum etwas ist jetzt so dringlich. Denn die Kette der Krisen reißt nicht ab: Erderwärmung, Artensterben, Finanzkollaps, Schuldenberge, scheiternde Staaten, Flüchtlingsdramen, fundamentalistischer Terror. Wir haben es mit multiplen Krisen zu tun. Die Krise, eigentlich ein Ausnahmezustand, ist zum Dauerzustand geworden. Hat der »Kollaps in Zeitlupe« begonnen, der 1972 vom Club of Rome für die Mitte des 21. Jahrhunderts vorhersagt wurde? Falls, ja falls wir den Kurs nicht radikal ändern würden.
Doch genau in dieser kritischen Situation hat die Gesellschaft – mehr oder weniger – eine Art Schockstarre befallen. Die Kette von Hiobsbotschaften, Horrormeldungen und Katastrophenbildern, die uns gegenwärtig rund um die Uhr multimedial kommuniziert werden, tut uns nicht gut. Die Schockwellen lassen sich kaum noch abfangen. Die Anspannung nimmt zu. Die Vigilanz, die permanente Wachsamkeit und das Scannen der Wirklichkeit nach allen möglichen Bedrohungen, verengt sich zum Tunnelblick. Die Wahrnehmung fokussiert sich auf die Probleme, ja oft sogar auf ein einziges Problem, das völlig unverhältnismäßig zu seiner tatsächlichen Bedeutung ins Rampenlicht gerückt wird. Es türmt sich auf. Die Hütte brennt. Die Nerven liegen blank. Es gibt scheinbar kein Entrinnen. Es gibt keine Alternative. Erstarrung und Lähmung führen zu Resignation und Rückzug oder zu Hass und Gewaltbereitschaft. Man fühlt sich machtlos und hilflos. Angst essen Seele auf. No future.
In dieser Lage suchen wir gleichsam nach einer Reset-Taste. Wir wollen es wieder so haben wie vorher. Wir wollen den Zustand wiederherstellen, wie er vor Beginn der Krise war. Das Pendel soll zurückschwingen. Doch das Lauern auf die Rückkehr des Bisherigen ist vergeblich. Die Reset-Taste funktioniert nicht. Wir verkennen nämlich das Wesen einer Krise. Das griechische Wort krísis bedeutet so viel wie »Entscheidung«. In der antiken Medizin bezeichnete es den Moment, in dem es sich entscheidet, ob der Patient stirbt – oder gesundet.
So gesehen, stellt die Krise die Phase der Zuspitzung einer gefährlichen Entwicklung dar, in der diese einen entscheidenden Wendepunkt erreicht. Entweder führt sie zum Kollaps des alten Zustands und ins Chaos oder zum Durchbruch eines neuen Paradigmas. Fest steht: Man kann nicht mit denselben Strategien aus der Krise herauskommen, welche die Krise verursacht haben. Es geht hier gerade nicht um eine Pendelbewegung zurück. Die Krise zwingt dazu, hinter den Symptomen die Ursachen der Krankheit zu erkennen und diese zu überwinden.
Im Chinesischen setzt sich der Begriff für Krise (weiji) aus zwei Wörtern und Schriftzeichen zusammen: Gefahr (wei) und Gelegenheit (ji). In jüngster Zeit wird das häufig umschrieben mit: aus der Krise gestärkt hervorgehen. Ja, aber was bedeutet das genau? Legen wir den Ausdruck auf die Goldwaage. Es kann nicht um ein »Weiter so« mit den alten, durch einzelne Maßnahmen irgendwie robuster, »resilienter« gemachten Mustern gehen. Die Pendelbewegung, das Nebeneinander, ein Sowohl-als-auch zwischen altem und neuem Paradigma führt nicht aus der Krise heraus. Das gilt auch für den Versuch, ein altes mit einem neuen Paradigma zu verschmelzen. Etwa mit einer Formel wie »nachhaltiges Wachstum«. Die Stärkung besteht genau in dem Bruch mit den alten Mustern, der Adaption, Durchsetzung und Dominanz anderer, »nachhaltiger« Denk- und Verhaltensmuster. In diesem Transformationsprozess vollzieht sich ein Wechsel des herrschenden Paradigmas. Ohne Krise, ohne Schockwellen ist er gar nicht möglich. Ein »Weiter so wie bisher« endet im Kollaps.
~
Im 21. Jahrhundert ist aus dem »kalifornischen Traum« ein schillerndes Amalgam geworden – ein Mix aus Just-do-it-Pragmatismus, Forever-young-Utopismus und Techno-Futurismus. Die daraus abgeleiteten Geschäftsideen: die Google-Brille, eine Brille, mit der man beispielsweise seinen Cholesterinspiegel überwachen und sein Gegenüber per Augenzwinkern unbemerkt fotografieren kann. Oder das selbst fahrende Auto, das den Fahrer zum Beifahrer eines Autopiloten macht, sodass er während der Fahrt twittern oder dösen kann. Das Internet der Dinge, das einem ermöglicht, vom Supermarkt aus die Vorräte im Kühlschrank zu checken. Das ultimative Anti-Aging-Mittel. Solche Dinge werden als Meilensteine auf dem Weg in eine »digitale Zukunft« angepriesen, als tools für eine bessere Welt, als Glücksverheißung. Durchbruch?
Kein Zweifel, die Innovationen aus dem Silicon Valley haben momentan Konjunktur. Doch sind sie mehr als nur tools, die einer kleinen Elite das »Weiter so« in eine beschleunigte Zukunft ermöglichen? Eine Zukunft, die immer weniger lebbar und lebenswert erscheint? Und stets lauert im Hintergrund die alte NASA-Vision von »Erdflucht« und terraforming. Da geht es um die Besiedlung des Mars, des Roten Planeten. Für den Fall, dass die Erde unbewohnbar geworden sein wird. Ein Megaprojekt aus dem Silicon Valley nennt sich Breakthrough Listen. Geplant wird der Bau eines neuartigen Superteleskops. Es soll in der Lage sein, auch schwache Signale von Leben aus den Tiefen des Weltraums zu empfangen. Es gibt keine Alternative? Doch, es gibt immer Alternativen.
Eine Momentaufnahme aus dem Herbst 2015. Zwei Bildwelten beherrschten die Medien: Auf der Frankfurter Automobilausstellung präsentieren Unternehmen aus dem Silicon Valley und in deren Gefolge die deutschen Branchenführer die ersten Prototypen des »selbst fahrenden Autos«. Scheinwerferlicht. Trommelwirbel. Vorhang auf. Harter Schnitt: Auf den endlosen, staubigen Landstraßen der Balkanroute bewegen sich Hunderttausende von Flüchtlingen auf die Außengrenzen der Europäischen Union zu. Viele sind lange Strecken zu Fuß unterwegs. Eine kleine österreichische Schuhmanufaktur spendet einen Teil ihrer Produktion. Die Erfahrung, die dahintersteht: »Schuhe sind das Wichtigste für einen Menschen auf der Flucht. Schuhe sichern das Überleben. Man muss auf sie aufpassen wie auf einen Augapfel. Am besten schläft man auf ihnen.« Was zählt, schrieb mir ein Freund aus Bayern in jenen Tagen, ist: die positive Energie.
An die aus ihrer Sicht besten Köpfe und kreativsten Forschungsinstitute verleihen die Strategen des Silicon Valley einen hoch dotierten Breakthrough Prize. Ausgezeichnet werden »fundamentale Entdeckungen über das Universum, das Leben und den Geist«.
Deutlich geringer dotiert, dafür aber bedeutsamer als der Breakthrough Prize aus dem Silicon Valley scheint mir der Right Livelihood Award aus Stockholm. Ausgezeichnet mit diesem »Alternativen Nobelpreis« wird »eine herausragende Vision und ein Werk im Dienste unseres Planeten und seiner Menschen«. Doch was ist right livelihood? Das richtige Leben im falschen? »Es bedeutet, ein Leben zu führen, das andere Menschen und unsere Umwelt respektiert. Es bedeutet, verantwortlich zu handeln und nur einen fairen Anteil an den begrenzten Ressourcen unseres Planeten zu verbrauchen.« Der Weg dahin, so die Stiftung, die den Preis alljährlich vergibt: »Der Right Livelihood Award will dem Norden helfen, eine Weisheit zu finden, die zu seiner Wissenschaft passt, und dem Süden, eine Wissenschaft zu finden, die seine alte Weisheit ergänzt.« Wissenschaft und Weisheit, breakthrough technologies, neue Produkte und neue Werte – ich vermute, wir brauchen beides. Doch wo liegen die Prioritäten? Und wo die Schnittmengen? Diesen Fragen möchte ich nachgehen.
~
»Eine andere Welt ist nicht nur möglich. Sie ist im Entstehen. An einem stillen Tag höre ich sie atmen.« Hier ertönt nun eine weibliche Stimme. Sie spricht in unsere Gegenwart hinein, zu unserer Generation. Es ist die Stimme der indischen Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy. Ihr Satz bildete den Schlussakkord zu ihrer Rede auf dem Weltsozialforum. Das war 2003 in der brasilianischen Metropole Puerto Alegre. Das Forum stand unter dem Motto »Leben nach dem Kapitalismus«. Ihr schöner Satz behauptet sanft und entschieden, dass im Schoß der alten Gesellschaft eine neue heranwachse und zu atmen beginne. Hier hat sich die Metaphorik verändert. Die Vorstellung des »Durchbruchs« wandelt sich zum Bild der »Entbindung«.
Eine sanfte Metapher? Ja, aber nicht nur. Den Moment der Entbindung, so erzählte mir eine junge Hebamme, erleben die meisten Frauen als eine ungeheure Erleichterung. Die Wehen sind vorüber. Schlagartig lässt der Schmerz nach. Eine Welle von Freude und Glücksgefühl durchflutet Leib und Seele. Doch das Kind nimmt diesen Moment ganz anders wahr, nämlich durchaus als einen Durchbruch. Sein winziger Körper muss erst mal die Fruchtblase sprengen. Er zwängt sich mit dem eigentlich zu großen Kopf, den Schultern, dem ganzen Leib durch den Geburtskanal. Das erfordert alle Kraft. Das Herz schlägt schnell. Der Muskeltonus ist angespannt. In diesem Moment bricht das Licht der Welt herein – und die Kälte. Im Vergleich zum Mutterleib jedenfalls muss die Außenwelt kalt wirken, die Entbindung als Schockwelle. Der erste Atemzug. Ein Moment der Stille. Dann erst der Urschrei. Bedenkt man diese Erfahrung, dann erscheint die Metapher der »Entbindung« auf einmal in einem härteren Licht. Sie ist sehr verwandt mit der Rede vom »Durchbruch«. Beide sind komplementär. Sie ergänzen sich.
»Die Gegenwart ist aufgeladen mit Vergangenheit – und geht schwanger mit der Zukunft.« So formulierte 300 Jahre vor Arundhati Roy der deutsche Philosoph Leibniz. Einen achtsamen Blick auf das richten, was geschieht, und dann das, was davon wünschenswerte Zukunft enthält, begleiten, fördern, zum Durchbruch verhelfen. Eine solche Haltung und Handlungsweise wäre zukunftsfähig. Eine schöne alte Metapher, in vielen Kulturen der Welt bekannt, bringt zum Ausdruck, wie im Schoß des Alten das Neue entsteht: Die schimmernde Perle wächst in der harten und rauen Schale der Muschel heran. Wir wären gut beraten, unsere Aufmerksamkeit auf das Wachstum der Perle zu richten.
Für die Wiedergewinnung von Denk- und Handlungsoptionen scheinen mir diese Spiele mit der Sprache erhellend. Sie tragen dazu bei, wesentliche Voraussetzungen für den Mut zur Transformation zu erkennen: erstens ein Grundvertrauen in die eigenen Potenziale und Ressourcen; zweitens die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und drittens die Arbeit am weiteren Aufbau einer tragfähigen, also »nachhaltigen« Wertewelt. Der scheint mir wichtiger als die Arbeiten an den technischen Lösungen und Produkten, den breakthrough technologies. Er ist im Gange, und zwar erfolgreicher, als wir manchmal meinen. Vom aktuellen Aufstieg nachhaltiger Werte im Schoß unserer Gesellschaft erzählt dieses Buch.
~
Dies ist ein Reisebericht. Er erzählt von Streifzügen durch das Land, die ich in den letzten zwei, drei Jahren unternommen habe. Er handelt von Orten, an denen ich das Gefühl hatte, dem in der Gesellschaft vor sich gehenden Wertewandel besonders nahe zu kommen. Den leisen, unterschwelligen Veränderungen ebenso wie den disruptiven Umbrüchen. Es waren jeweils langsame Annäherungen, die letzte Etappe meist zu Fuß. Denn zu Fuß siehst du besser. Und: Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich.
Um möglichst viele und vielsagende Realitätspartikel ging es mir bei meinen Erkundungen. Um Mosaiksteinchen für ein größeres Bild. »Vor Ort«, wie man so schön sagt, hatte ich das Glück, mit einigen Akteuren aus der großen Suchbewegung ins Gespräch zu kommen. Diese Gespräche sind eine Keimzelle dieses Buches.
Werte sind schwer zu fassen und kaum messbar. Sie sind etwas Immaterielles. Sie entstehen nicht in der Retorte, sondern in der Atmosphäre des Zeitgeistes. Sie lassen sich nicht verordnen, sondern »emergieren«, treten hervor, steigen auf. Die Sprache ist ein feiner Seismograph. Mich interessieren die »Modewörter«, Begriffe, die gerade Karriere machen. Sie auf die Goldwaage zu legen ist ein weiterer Strang, der sich durch dieses Buch zieht. Die besonders zeitgeistigen Wörter haben meist tiefe Wurzeln in der Kultur. Zukunft braucht Herkunft. Das gilt besonders für unseren Wortschatz. Diesen Prozessen von Recycling und Upcycling nachzuspüren finde ich besonders spannend. Es hilft uns, Tiefendimensionen und Facetten unserer Begriffe zu verstehen, um im Hier und Jetzt souverän damit umgehen zu können. So entstand Schritt für Schritt die mentale Landkarte, der ich auf meinen Wegen durch das Land gefolgt bin.
Das wachsende Unbehagen an der die Gesellschaft zerreißenden Gier halte ich für einen wichtigen Trend. Dieses Unbehagen entwickelt gegenwärtig eine enorme Dynamik. Aber es ist diffus. Als Wegweiser zu einer kühlen »Anatomie der Gier« diente mir Hauffs Märchen über Das kalte Herz. Mit dem Büchlein im Rucksack entdeckte ich im Nordschwarzwald die Schauplätze der Parabel und deren Aktualität: Gier und Narzissmus sind dysfunktional. Angesagt sind Varianten der Warmherzigkeit – die Empathie. Davon handeln Kapitel 1 und der ihm folgende erste von insgesamt fünf gedanklichen »Zwischenrufen«.
Kapitel 2 spielt in der Autostadt, der Traumfabrik des VW-Konzerns. Wir kamen »aus der Tiefe des Raumes«, aus der umgebenden Natur-Kultur-Landschaft. Auch hier schärfte die langsame Annäherung die Wahrnehmung. Der Kult der Beschleunigung ist passé. Die Wiederentdeckung von Geschwindigkeiten nach menschlichem Maß hat begonnen. Die Zeit ist reif für einen Abgesang auf die Autostadt.
Alle reden von »Gelassenheit«. Kein Zweifel, auf der Skala unserer Werte rückt diese Verhaltensweise nach oben. Gelassenheit, aber was ist das? Eine Form von Wellness? Eine Variante von »cool«? In Kapitel 3 mache ich mich auf eine verschlungene Zeitreise zu den Quellen, die über die Mystik des Mittelalter bis in die Antike zurückreichen.
Kapitel 4 erzählt von einer neuen Landmarke des Ruhrgebiets. Auf einer Berghalde, Altlast des fossilen Zeitalters, erhebt sich seit Kurzem ein Horizontobservatorium, Wahrzeichen für ein kommendes solares Zeitalter. Ein Ort härtester Maloche transformiert sich zu einer Bühne, die jeder frei nutzen kann, um sich neu in die Rhythmen und Zyklen von Natur und Kosmos einzuklinken. Für mich auch ein Ort der persönlichen Erinnerung an die Arbeit »unter Tage«, die die Mentalität dieser Region bis heute prägt.
Vom Wert der Gemeingüter handelt auch Kapitel 5. Auf dem Höhepunkt der Welle von Privatisierungen rollt plötzlich eine neue Welle heran. Die Wiederentdeckung der commons hat begonnen. Wem gehört die Welt? Die Antwort: allen und keinem. Ich besuche alte, noch intakte Allmendewälder im Weserbergland und spreche mit einem Wikipedia-Autor, einem Aktivisten der Wissensallmende.
In Kapitel 6 schließlich geht es – wie auch zuvor schon – um das Mantra des »Wachstums«. Ich mache mich auf den Weg zu Pionieren des Wandels in Richtung einer »Postwachstumsgesellschaft«. Meine Gespräche führen in die Gedankenwelt von Leuten ein, die zwischen Münsterland, Thüringer Wald und dem Breisgau an gesellschaftlichen Strukturen und neuen Lebensformen arbeiten, welche auch nach dem Ende einer wachstumsfixierten Wirtschaft halten und tragen könnten. Mutmachende Laboratorien einer »anderen Welt« – im Hier und Heute.
Kapitel 1Das Kalte-Herz-Syndrom
Anatomie der Gier
~
Als Kind liebte ich Luftballons. Damals waren sie noch etwas Besonderes. Doch in der Woche der Herbstkirmes in unserer kleinen Stadt bekamen wir Kinder in den Geschäften, in denen unsere Mutter einkaufte, ein oder zwei bunte Ballons geschenkt. Das Laub fiel. Der Geruch von Kartoffelfeuern lag in der Luft an den Rändern der Schrebergärten, wo wir spielten. Es dunkelte früh. Im schlauchartigen Flur unserer Vier-Zimmer-Mietswohnung begannen unsere wilden Spiele: Kopfballstafetten, volleyball- oder handballartige Spielzüge von Wand zu Wand. Ich staunte über die zeitlupenhaften Bewegungen der Ballons durch den Raum, über die Elastizität und Zartheit des Materials. Sie verkörperten etwas von der Leichtigkeit des Seins.
Spannend war jedes Mal neu das Aufblasen. Um die besten Flugeigenschaften zu entfalten, muss ein Luftballon möglichst prall mit Atemluft gefüllt sein. Aber gleichzeitig musst du sehr darauf achten, die Hülle nicht zu überdehnen. Jedes Mal, wenn mir ein Ballon platzte, erlebte ich eine Schrecksekunde und war todunglücklich. Zumal ich wusste, dass unser kleiner Bestand rasch aufgebraucht und damit die ohnehin kurze Luftballonsaison zu Ende sein würde. Ersatz war nämlich nicht in Sicht. »Teilt’s euch ein – mehr gibt’s nicht.« Noch heute klingt mir diese Mahnung unserer Mutter im Ohr. Beim Austeilen von Obst, Süßigkeiten oder Spielzeug regulierte das Prinzip »Teilen und einteilen« die kindliche Gier, vor der niemand von uns gefeit war. Es war eine genuin nachhaltige Faustregel. Ein Denken und Fühlen in den Bahnen »immer mehr!« und »ich und nicht du!« war von Anfang an keine Option. So verlockend und »natürlich« es uns oft auch vorkam.
Mir fielen diese Glücks- und Unglücksmomente der Kindheit wieder ein, als ich von einer Versuchsreihe am Psychologischen Institut der Universität Würzburg hörte. Dort wurde 2014 über das Phänomen der Gier geforscht. Die Probanden, Durchschnittsalter 24 Jahre, wurden zunächst in einer Befragung auf ihre Nähe zu Verhaltensmustern von »Gier« getestet. Danach bekamen sie die Aufgabe, am Computerbildschirm durch einzelne Mausklicks einen Luftballon so prall wie möglich aufzublasen. Der virtuelle Ballon stellte einen Wert von 1 000 Euro dar. Durch das Aufblasen auf die maximale Größe würde er seinen Wert verdoppeln und dem erfolgreichsten Versuchsteilnehmer ganz real einen Bonus von maximal 100 Euro bescheren. So weit wie möglich aufblasen, aber nicht platzen lassen – so war die Vorgabe. Natürlich wusste niemand, beim wievielten Mausklick der Ballon platzen und damit wertlos würde. Wie würden die Probanden agieren und reagieren?
Das Versuchsergebnis kurz zusammengefasst: Es hat sich gezeigt, dass das Verhaltensmerkmal »Gier« zum einen mit einer hohen Risikobereitschaft korreliert, zum anderen mit einer geringen Lernfähigkeit. Gierige Individuen lernen nicht aus ihren Fehlern. Stimuliert von Erfolgsgeschichten aus ihrer Umgebung, die erzählen, wie Gier sich auszahlt, »sich rechnet«, machen sie einfach weiter. Und – besonders beunruhigend – es berührt ihren Gefühlshaushalt gar nicht, wenn ihr Ballon platzt. Im Moment des Erfolgs oder des Scheiterns zeigen sie nahezu die gleichen Hirnaktivitäten.
~
»Die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.«Mahatma Gandhi
»Die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.« Seit dem Aufstieg des Turbokapitalismus, erst recht seit dem Bankenkollaps von 2008 flimmert dieser Satz Mahatma Gandhis über unzählige Webseiten. »Gier«, genauer gesagt: Habgier, ist ein scheinbar einfaches Phänomen. Seine Essenz: immer mehr haben wollen, unbedingt und maßlos: materielle Güter, Geld, Macht, Sex und Ansehen. All das gilt es exklusiv für sich selbst, also ohne Rücksicht auf andere – ja bewusst auf Kosten anderer –, zu haben und zu nutzen. Auf dem Weg dahin das volle Risiko in Kauf nehmen: alles oder nichts. Das ist der Kern. Als eine unter vielen seelischen Grundkräften war und ist die Gier in allen Kulturen der Welt verbreitet. Doch stets war sie gesellschaftlich eingehegt. Sie wurde dosiert und gemäßigt, geächtet, verspottet, bekämpft und nach Möglichkeit unter Kontrolle gehalten. Gierig sein, das gehörte sich nicht. Es galt als eine Abweichung vom normalen Verhalten. Erst der Kapitalismus machte die Gier schrittweise gesellschaftsfähig. Im 21. Jahrhundert hat sich diese Dynamik beschleunigt und ausgeweitet. Geiz ist geil. Selbstsucht ist geil. Gier wird epidemisch, und das hat weitreichende Folgen. Sie führen uns, wenn es nicht gelingt, sie wieder einzudämmen, in den Kollaps. Denn wir haben in vielen Bereichen die planetarischen Grenzen des Verbrauchs an Ressourcen erreicht, teilweise bereits überschritten. Das »Immer mehr!« führt zum Absturz ins Nichts. Wir alle wissen oder ahnen es. Warum gelingt es trotzdem noch immer nicht, die Gier zu bändigen? Welche starken seelischen Triebkräfte sind mit im Spiel?
Um die Anatomie – und Pathologie – der Gier zu verstehen, scheint mir eine Zeitreise angebracht. Sie führt von den Tälern des Schwarzwalds zur Zeit der Romantik bis in die Straßenschluchten des heutigen Manhattan. Als Reiseführer für die erste Etappe dient ein Märchen: Wilhelm Hauffs Das kalte Herz.
Das »Immer mehr!« führt zum Absturz ins Nichts.
»Gut, Michel; gebt mir den Stein und das Geld, und die Unruh könnet Ihr aus dem Gehäuse nehmen!« In der Erzählung besiegeln Peters Worte einen Tausch, ein Geschäft. Die »Transaktion«, wie man im Jargon der modernen Finanzmärkte sagen würde, hat es in sich. Der bitterarme, junge und naive Schwarzwälder Köhlerbursche Peter Munk will sich ein für alle Mal aus dem Elend erlösen. Also verkauft er das unruhig pochende Herz in seiner Brust und tauscht es gegen einen Klumpen kühlen Marmelstein. Der Investor heißt Holländer-Michel, ist ein Waldgeist und agiert in Gestalt eines vierschrötigen Flößers und unter der Maske eines »Entrepreneurs«, wie man schon damals in den Gegenden längs der französischen Grenze sagte. Er packt Peter an seiner empfindlichsten Stelle, den erlittenen Kränkungen der Ehre, also bei seinem Narzissmus, dem Geltungsdrang, dem unstillbaren Bedürfnis, etwas zu gelten und immer mehr zu gelten. Für den Deal bezahlt er viel Geld. Den Rat, es zinsbringend zu investieren, also als Kapital anzulegen, gibt er seinem Kunden – und Opfer – gratis dazu. So nimmt das Grauen seinen Lauf. Eine unheimliche Abwärtsspirale setzt sich in Gang und gerät außer Kontrolle.
Doch Gott sei Dank hat der Holländer-Michel einen ebenbürtigen Gegenspieler. Das Glasmännlein, der Schatzhauser im grünen Tannenbühl, verkörpert den guten Geist des Waldes. Er steht sowohl für die überkommene Wertschöpfungskette von Holz, Quarz und Glas als auch für die tradierten Maßstäbe von Sitte und Anstand in dem Leben und der Arbeit der Waldbewohner. Sie waren seit jeher gewohnt, sich mit ihrer Hände Arbeit maßvoll von den Gaben der Natur zu ernähren.
Nur ein harmloses Märchen aus uralten Zeiten? 1826 ist es erschienen, also in der Übergangszeit zwischen Romantik und Biedermeier. Es war zugleich die Epoche, als die Dynamik der frühkapitalistischen Entwicklung mit ziemlicher Verspätung auch die deutschen Territorien erreichte.
Um an dieser Stelle noch eine Kindheitserinnerung einzublenden: Für mich war Das kalte Herz eine Art Initiation in die Welt der Dichtung, die bis heute nachhält. Wenn ich wieder darin blättere, sehe ich mich auf den Knien meines Vaters sitzen und atemlos zuhören, als er es mir und meinem Bruder vorlas. Zusammen mit den anderen schaurigen Geschichten aus Hauffs Wirtshaus im Spessart. Wir hockten eng aneinandergekuschelt auf der Couch im Wohnzimmer, im zweiten Stock eines 1950er-Jahre-Neubaus in einer westfälischen Kleinstadt. Im Hintergrund glühte und knisterte es im Kohleofen, und wir fieberten mit dem Kohlenmunk-Peter, als er den Einbruch des Fantastischen in seine armselige Existenz herbeisehnte und herausforderte. Die Vorstellung, drei Wünsche frei zu haben, beflügelte kindliche Fantasien, auch Allmachtsfantasien, weckte das Begehren. Die Idee, ein »Sonntagskind« zu sein, also etwas Besonderes, von einem geheimnisvollen Schicksal auserwählt, war ebenfalls ein Faszinosum.
Die Angst vor der Erkaltung und Erstarrung der eigenen Gefühlswelt
Doch die Angst vor der Erkaltung und Erstarrung der eigenen Gefühlswelt entfaltete beim Fortgang der Handlung ein machtvolles Abschreckungspotenzial. Damals spürte ich zum ersten Mal etwas vom Wesen jeder großen Dichtung: Sobald du dich in sie versenkst, betrittst du einen Schonraum, in dem nur eine Regel gilt: Nichts ist unmöglich.
Die häuslichen Vorleseabende muss ich erlebt haben, kurz bevor ich lesen lernte. Das war Mitte der 1950er-Jahre, in den Anfängen der Wirtschaftswunderzeit. Heute, im längst angebrochenen 21. Jahrhundert, ist Das kalte Herz noch immer sehr präsent. In Baden-Württemberg gehört es quer durch die Generationen zum Kanon. Es hat seinen Platz in Schulen, auf Heimatbühnen, in einem ihm eigens gewidmeten Museum. Fest verankert im kulturellen Gedächtnis des »Ländle«, stiftet es regionale Identität. Aber nicht nur dort. Wer in der DDR sozialisiert wurde, kennt die Geschichte genauso gut. Wenn nicht aus dem Lesebuch, dann aus dem DEFA-Farbfilm von 1950, der das Märchen als sozialistischen Heimatfilm inszenierte. Diese Fassung steht in einer langen Kette von Verfilmungen. Die jüngste kommt im Herbst 2016 in die Kinos. Es scheint, die Erzählung führt wiederum mitten ins Zentrum einer brandaktuellen Problematik: Was macht das Geld aus den Menschen? Kann uns die kleine Parabel einen Schlüssel zur Pathologie der Moderne liefern?
~
»Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen.« Mit dieser Empfehlung beginnt der junge Dichter – Hauff war gerade 25 Jahre alt – seine Geschichte. Folgen wir seinem Rat. Eine Wanderung in das Quellgebiet von Enz, Nagold und Murg führt, wenn man bei einem Märchen so sagen darf, zu den Originalschauplätzen.
Ein Tag Anfang Juni, elf Uhr, 22 Grad Celsius, sonnig, leichte Brise. Ein steiler Anstieg aus dem Tal der Enz bringt uns aus dem Kurortmilieu von Bad Wildbad auf den Sommerberg. Gut 300 Meter Höhenunterschied. Der Schwarzwald-Mittelweg, der von Pforzheim nach Waldshut den Schwarzwald in Nord-Süd-Richtung durchquert, macht auf seiner zweiten Etappe an dieser Stelle einen leichten Bogen nach Südwesten. Ein erster Blick über die Landschaft: Die Höhen sind dicht bewaldet. Hier stockt Nadelwald, mit wenigen Laubwaldbeständen gemischt, bis hinüber zum Nagoldtal. Schattierungen von Grün, darüber Himmelsbläue und das Weiß ziehender Wolken – Sommerseligkeit. Der Nordschwarzwald, sagt Herbert, mein Wanderkumpan, der im nahen Calw zu Hause ist und hier jeden Weg und Steg kennt, ist eigentlich kein Bergland, sondern eine Hochfläche, die von mehreren Flusstälern eingekerbt ist. Wir kreuzen einen Weg, der auf der Wanderkarte als »Kohlweg« eingezeichnet ist. Ein erster Hinweis auf die Zeit, als in den Wäldern ringsum Meiler qualmten und hoch beladene Gespanne die Holzkohle zu den Glashütten und Schmieden in den Tälern transportierten. Hinter Kaltenbronn, einer kleinen Ansiedlung, die aus einer Försterei entstanden ist, erreicht unser Weg die 1 000-Meter-Zone. Auf dem Plateau des Hohloh erstreckt sich eine einsame Hochmoorlandschaft. Mittendrin ein See. In Ufernähe treibt Schwingrasen, bedeckt mit Wollgras und Torfmoos. Baumleichname liegen im Wasser oder stehen aufrecht am Ufer. Eiszeitliche Relikte treffen auf eine sich verjüngende Natur. Rosmarinheide und junge Birken wachsen nach und bilden die Vorhut für den Wald von morgen. Die Orkane der 1990er-Jahre hatten hier oben ausgedehnte Fichtenbestände umgeworfen. Die Vorherrschaft der menschengemachten Monokultur geht nach 200 Jahren im Klimawandel unwiderruflich zu Ende. Jenseits des Moores ragt der Hohloh-Turm empor. Mit dem 360-Grad-Rundumblick ist er der perfekte Ausguck, um in den inneren Nordschwarzwald hineinzuschauen.
Abendlicht beleuchtet das Waldmeer ringsum, als wir die Aussichtsplattform des Turmes erklimmen. In einer tiefen Staffelung von Farbtönen tritt die räumliche Anordnung von Höhenzügen, Kuppen und Abhängen hervor. Das zarte Grün des Jungwuchses am Fuß des Turmes verwandelt sich in die Schwärze der umgebenden Nadelwälder, fließt über in die bläulichen Schleier der Ferne und weicht über dem Horizont den Abstufungen der Himmelsbläue, die sich mit den Pastelltönen der Abendröte verbinden. Nach Nordwesten öffnet sich das Murgtal mit seinen Dörfern und »Städtle« zur Rheinebene. Das Gebiet von Hornisgrinde und Mummelsee, dem höchsten Berg und dem mystischen Gewässer des Nordschwarzwalds, kommt ins Blickfeld. Nach Südwesten schweift der Blick über eine geschlossene Waldfläche ins obere Murgtal. Östlich davon schließen sich die Enzhöhen an, dicht dahinter das Quellgebiet der Nagold. »O Täler weit, o Höhen!« Vor uns liegt das Reich von Holländer-Michel und Glasmännlein.
Die Tanne: eine Aura von Vornehmheit und Adel
Mein Blickfang ist eine solitäre Tanne. Am Steilhang des Plateaus überragt sie die gezackte Silhouette der Fichtenbestände. Da ist sie, die ursprüngliche Königin des Schwarzwaldes. Unterwegs hatten wir immer wieder stattliche Exemplare stehen sehen, vereinzelt oder in Grüppchen, manchmal ziemlich zerzaust. Der ehemals flächendeckende Weißtannenwald ist unter dem Druck der Kahlschlagswirtschaft und des Wildverbisses schon lange von der schneller hiebreifen »Rottanne«, der Fichte, in kleine Nischen abgedrängt worden. Und trotzdem wirkt ihr Anblick jedes Mal erhebend. Ist es ihre Körpersprache? Die hohe Gestalt? Der kerzengerade Wuchs des Schaftes mit den Ästen, die sich weit ausladend nach oben öffnen? Ist es die Art, wie sie ihre »Tännle«, ihren Nachwuchs, beschirmt? Oder die Krone, die sich wie ein Vogelnest wölbt, statt wie bei der Fichte schlank und spitz in die Luft zu stechen? Liegt es am Stamm, der sich silbrig grau von der rötlich braunen Rinde benachbarter Fichten abhebt? Sind es die Tannennadeln, die an der Unterseite hell schimmern? Oder die Tannenzapfen, die aufrecht stehend ihren Samen ausstreuen, während die Fichte die Zapfen herabhängen lässt und schließlich abwirft? Die Tanne, so kommt es mir während dieser Wandertage im Nordschwarzwald vor, hat eine Aura von Vornehmheit – von Adel. Alte Forstleute sind überzeugt, die Zeit des Buchen-Weißtannen-Waldes komme wieder. Er könne sich besser als die künstliche Fichtenmonokultur dem Klimawandel anpassen. Die Tanne sei halt »resilienter«.
In der Abenddämmerung laufen wir noch ein Stück weiter nach Süden. Der Weitwanderweg folgt hier der Wasserscheide zwischen Murg und Enz. Zeitweilig verengt er sich zu einem schmalen Pfad, schlängelt sich steinig und durchwurzelt an Fichtenjungwuchs und Heidelbeergestrüpp entlang. Am »Toten Mann«, einer Schutzhütte für Wanderer, benannt nach einem aufgelassenen Bergwerksstollen im Gelände, mündet der Pfad wieder auf eine Forststraße. Im Wipfel einer bestimmt 30 Meter hohen Tanne hängt der Silbermond. Zeit zum Biwak.
~
Am Abend vorher hatte ich mit Herbert im Schauspielhaus Stuttgart Das kalte Herz auf der Bühne gesehen. Großes Drama, von Regiestar Armin Petras als eine Art Schocktherapie inszeniert. Auf der Bühne rollt ein wüstes Spiel mit Versatzstücken der Erzählung ab: Peter ist ein tumber Narr, Lisbeth käuflich, das Glasmännlein eine Tänzerin im grünen Trikot. Mal entzündet es Wunderkerzen. Mal toben in seinem Gefolge zottelige Waldmenschen in Kostümen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht über die Bühne. Holländer-Michel gibt im schwarzen Mantel, mit Melone und Sonnenbrille eine Kreuzung aus Börsenhai, Drogenboss und Zuhälter. Auf der Mundharmonika intoniert er Spiel mir das Lied vom Tod. Mobiliar wird zerdeppert, Geld verbrannt. Eine Kuckucksuhr entpuppt sich als Sarg. Auf dem Bühnenvideo rennt das Ensemble wie auf der Flucht durch einen finsteren Tann, karrt ein Truck Langholz über einen Forstweg. Eine 30-köpfige Original-Volkstanzgruppe des Schwäbischen Albvereins verkörpert in schwarz-weiß-roter Tracht die Dorfgemeinschaft. Um nicht zu sagen: die Volksgemeinschaft. Die Tänzer kommen aus Balingen und Umgebung.
Klingt nach tiefster Provinz, ist es aber nicht. Größter Arbeitgeber der Gegend ist Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar. Die »Königlich Württembergische Gewehrfabrik« aus Hauffs Zeiten mutierte zum global player auf dem boomenden Markt für High-Tech-Schnellfeuerwaffen. Zu den Rundtänzen holt man sich Leute aus dem Publikum auf die Bühne. Am Schluss feiert ein Männerschwerttanz, eher Kampfkunst als Volkstanz, Peters Rückkehr zu den Wurzeln und seine endgültige Inklusion in die – wehrhafte – Gemeinschaft. Geschäftsmäßig hatte zuvor Holländer-Michel seinen Deal mit Peter abgewickelt. »Du entgehst mir nicht.« Gierig tastet und schleckt er an dem bluttriefenden Herzen, als er es vorübergehend in seinen Besitz gebracht hat. Doch im krassen Gegensatz zu dem alten Märchen ist er es, der am Schluss triumphiert. Es ist eine kaputte Welt. Zombies, Untote, überall. Auf der Bühne und vor der Bühne, im Zuschauerraum. Keine Hoffnung, nirgendwo. Eine andere Welt ist unmöglich.
Lang anhaltender Beifall. Schauspieler und Regisseur verneigen sich. Wir treten hinaus in die laue Frühsommernacht, durchqueren den Park. Unser Weg führt durch das alte Herz von Stuttgart. Ausgewählte Gebäude sind angestrahlt: der barocke Flügelbau der Residenz, jenseits das alte Schloss, die Burg, gegenüber das Ensemble des Schillerplatzes, der Renaissancebau der Alten Kanzlei, Sitz der großherzoglichen Kammer, der Fruchtkasten, die früheren Kornspeicher, die spätgotische Stiftskirche und das Schiller-Denkmal. Die Illuminierung verfremdet das Stadtbild. Das alte Stuttgart beginnt zu leuchten. Die Bauten, Bauformen und Fassaden der Zeit um 1800 treten hervor und erwachen zum Leben. Unser nächtlicher Gang versetzt uns in die Epoche der Großherzöge, der bürgerlichen Oligarchie, der allmächtigen Holländer-Holz-Compagnien. Dem Geld aus den Kahlschlägen im Schwarzwald verdankt Stuttgart viel von seinem Glanz. Unweit von hier liegt Hauff begraben.
~
Insekten summen aus der Blumenwiese am Wegrain. Ein Mohrenfalter flattert vorbei, später ein Kleiner Fuchs. Aus der Ferne ruft ein Kuckuck. Im Frühtau sind wir vom Toten Mann aufgebrochen. Die Wanderkarte verzeichnet für diesen Abschnitt des Mittelwegs den historischen Namen »Alte Weinstraße«. Um 1800 war das noch ein Karrenweg für den Transport von Weinfässern aus der Oberrheinebene, von Holzkohle aus den Wäldern und Glaswaren aus den kleinen Glashütten. Ein Weg der Hinterwäldler, Hausierer und Vagabunden, gewiss auch der Wegelagerer und Banden, die bis in die Wirren der napoleonischen Zeit um 1800 hinein in den abgelegenen Mittelgebirgen die wenigen Transitrouten auf den Höhen unsicher machten.
Der Wald zu unserer Rechten, an den lang gezogenen, nach Westen ins Murgtal abfallenden Hängen, trägt auf der Wanderkarte den historischen Namen »Murgschifferschaftswald«. »Schiffer« bedeutete in den Mundarten des Schwarzwalds so viel wie Flößer. 5 000 Hektar sind noch heute im Besitz einer Genossenschaft, die im nahen Gernsbach ihren Sitz hat. Zu Hauffs Zeiten betrieben eine Handvoll solcher konkurrierenden »Compagnien« das Geschäft mit dem Holz. Im 18. Jahrhundert hatten sie ihre Boomzeit. »In Holland gibt’s Gold, / Könnt’s haben, wenn Ihr wollt / Um geringen Sold / Gold, Gold.« So träumt es Kohlenmunk-Peter im Märchen. Die Verse beschwören beinahe magisch die Macht des Goldes und das Habenwollen. Sie signalisieren einen epochalen Bewusstseinswandel: Das Zeitalter der Entfesselung der Gier hatte begonnen. Sie wurde gesellschaftsfähig. Wie hat sich dieser Prozess im 18. Jahrhundert bei den Hinterwäldlern im Schwarzwald abgespielt?
Epochaler Bewusstseinswandel: Gier wird gesellschaftsfähig.
Kapitalkräftige Bürger aus den Städtchen der Schwarzwaldtäler schlossen sich zusammen. Mit ihren Geldeinlagen gründeten die »Entrepreneurs« eine Handvoll Holländer-Holz-Compagnien. Nur wenige waren beteiligt, denn, so Hauff: »Es gab nicht viele reiche Leute im Wald.« Dafür war ihr Geschäftsmodell genial einfach. Von den notorisch hoch verschuldeten Landesherren kauften die straff organisierten und hart konkurrierenden Unternehmen Konzessionen für den Holzeinschlag im Staatswald. Der absolutistische Staat machte sich also vom Geldadel abhängig, um aus einer von der eigenen Gier und Prunksucht verschuldeten Schuldenkrise herauszukommen. Damit hatten die Compagnien freie Bahn für großflächige Kahlschläge. Besonders begehrt waren die »Holländer-Tannen« mit ihren 30 Meter langen, einen halben Meter dicken Stämmen. Sie waren bestens für den Schiffbau geeignet. Unter unsäglichen Mühen transportierten Holzknechte das Langholz an den nächstgelegenen flößbaren Flussabschnitt. Dort übernahmen die Flößer. Für jedes Floß wurden Mannschaften neu angeheuert. An den Verladestellen banden sie Hunderte von Stämmen zusammen und flößten das Holz etappenweise zum Rhein. Von Mannheim aus gelangten sie in großen Einheiten – manche Flöße waren an die 500 Meter lang und 50 Meter breit – bis nach Köln. »Die stärksten und längsten Balken aber«, so heißt es bei Hauff, »verhandeln sie um schweres Geld an die Mynheers, welche daraus Schiffe bauen.« Endstation der Flößerei war das niederländische Dordrecht. In der Stadt im Delta von Rhein und Maas wurden die Flöße zerlegt, das Holz von Murg, Enz und Nagold an »Commissionäre« versteigert.
Binnen weniger Jahrzehnten hat diese Raubbauökonomie den Charakter des Schwarzwaldes radikal verändert: das Landschaftsbild und die Mentalität der Leute. Um 1800 war ein Drittel des württembergischen Schwarzwaldes abgeholzt. Zeitgenössische Quellen sprechen vom »Mord« am Wald – im Dienst am »Mammon«, dem »Gott unserer Zeit«. Von diesem Bruch erzählt Hauffs Märchen.
Was es nicht mehr erzählt: Die Schiffe, die zwischen 1700 und 1800 auf den holländischen Werften gebaut wurden, setzte man vor allem im transatlantischen Handel ein. Die »Ware«, die sie hauptsächlich transportierten, waren Sklaven. Menschenhandel und der Handel mit »Colonialwaren«, also mit von Sklaven erzeugten Gütern wie Gummi, Zucker, Kaffee und Tabak, waren die Grundlage für den Aufstieg des Kapitalismus im alten Europa.
Die Fortsetzung von Das kalte Herz hat Heinrich Heine geschrieben. Sein Gedicht Das Sklavenschiff erzählt diese Geschichte aus der Perspektive eines holländischen Sklavenhändlers. Es beginnt mit den Versen: »Der Superkargo Mynher van Koek / Sitzt rechnend in seiner Kajüte; / Er kalkuliert der Ladung Betrag / Und die probabeln Profite«. Die Ladung besteht aus Schwarzen. »Gewinne daran: achthundert Prozent / Bleibt mir die Hälfte am Leben.« Heines Gedicht führt mit ätzender Ironie mitten in das Herz der Finsternis.
»Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe.«Walter Benjamin
Das Geschäftsmodell hat einigen wenigen Schwarzwälder Familiendynastien tatsächlich »unmenschlich viel Geld« (Hauff) beschert. Es hat immer nur kurzfristig die Kammer des Herzogs wieder aufgefüllt, also den fürstlichen Haushalt konsolidiert. Im 21. Jahrhundert wirkt es ungebremst weiter. In den armen und den Schwellenländern wird es heute mit einer damals unvorstellbaren Dynamik und mit modernster Technologie praktiziert. Wieder ist die Spirale aus Verschuldung von Staaten und Schuldenabbau mittels Verkaufs von Konzessionen an Investoren ein entscheidender Hebel. Heutzutage treiben die globalisierten Märkte die Entwaldung voran. Nicht mehr mit Axt und Floß, sondern mit Motorsägen, Harvesterkolossen, Trucks und Containerschiffen. Das schwäbische Familienunternehmen Stihl ist Weltmarktführer für Kettensägen. Die Plünderung des Planeten »rechnet sich« mehr denn je. Die »Assetklasse Holz« ist eine Topgeldanlage. »Waldfonds bringen langfristige stattliche Gewinne.« Der Index ermittele seit Jahren eine Durchschnittsrendite von über zwölf Prozent für Holzinvestments. Die Anzeige im Netz ist illustriert mit dem Foto zweier asiatischer Mädchen, die hinter einem Teakholzstamm hervorlugen und den potenziellen Investor anlächeln.
Kein Zweifel: Die Einladung zur Gier ist seit den Zeiten des Holländer-Michel subtiler geworden. Und dennoch: Der Holzpreis regelt alles. Die Holzstapel verwandeln sich in Geldstapel. Es herrscht der Mammon. »Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe«, sagte Walter Benjamin, der Philosoph, der vor dem Ersten Weltkrieg in Freiburg studierte und damals viel im Schwarzwald wandern ging. Viel später, 1932, kurz vor seiner Emigration, hat er für das Radio eine Hörspielfassung von Hauffs Märchen verfasst.
~
Ein Rotmilan kreist über der Lichtung, als wir die Kuppe des Schrambergs erreichen. Das Blockhaus an der Weggabelung ist verriegelt. Offenbar dient es als Unterkunft für die Waldarbeiter und als Magazin des Forstbetriebs. Daneben, im Adlerfarn und Ginster versteckt, ein Gedenkstein für einen 1853 verstorbenen Waldinspektor der Murgschifferschaft. Der Querweg nach Westen geht hinunter ins Murgtal. Wir biegen in östlicher Richtung ab und gelangen nach ein paar Kilometern kurz vor Gompelscheuer an den Kaltenbach, einen Quellbach der Enz. Auf »Jockeles Flößerweg« wandern wir ein lichtdurchflutetes, atemstilles Bachtal aufwärts. Das Wildwasser strömt durch den schmalen Wiesengrund. Das Gelb von Sumpf-Hahnenfuß, die hellen Dolden der Wilden Möhre, das blasse Rot der Lichtnelke leuchten in der Sonne.
»Was für eine zauberhafte, in sich ruhende Welt«, schwärmt Herbert, mein Wegbegleiter. Der Weg steigt sanft an. Weiter oben staut ein steinerner Damm den Kaltenbach zu einem künstlichen Teich. Am Ufer blüht Ginster. Im Wasser spiegeln sich dunkel die Wipfel der Nadelbäume. Wieder ein Wahrzeichen aus Hauffs Zeit. Diese »Wasserstube« wurde 1780 gebaut. Wenn man Scheitholz die Enz hinabflößen wollte, öffnete man das Wehr. In dem Moment, als der Sog der »Schwallung« seine größte Energie entfaltete, ließ man das Holz schwimmen und brachte es so auf den Weg.
Jenseits steigt unser Pfad steil an. Dort, wo er im dichten Tann der Lägehalde verschwindet, zeichnet sich auf dem Waldboden eine kreisrunde, ebene Fläche mit einem Radius von etwa zehn Schritten ab. Die schüttere Grasnarbe ist mit frischen Farnwedeln bewachsen. Kratzt man ein wenig an der Oberfläche, treten pechschwarze Bröckchen zutage: Holzkohle. Wir stehen auf einer alten Kohlplatte, dem Standort eines Holzkohlenmeilers. Wir sind in der Arbeitswelt von Kohlenmunk-Peter angekommen.
Idyllisch war sie mitnichten. Die Köhlerei gehört zu den ältesten Handwerken. Schon die Kelten waren Meister darin. Tatsächlich ist der Köhler ein Virtuose in der Beherrschung der Elemente Feuer und Luft. Schließlich muss er die Luftzufuhr in das Innere des zuvor kunstvoll aufgeschichteten Holzstapels über zwei, drei Wochen so präzise regulieren, dass die Scheite vollständig durchglühen, ohne zu verbrennen, und am Ende fast reiner Kohlenstoff übrig bleibt. Doch es waren raue Gesellen, die dieses Handwerk ausübten. Ihre Arbeit war dreckig und gefährlich. Ruß und Schweiß verbanden sich, drangen porentief in die Haut. Der Schwelbrand mit dem Qualm und den Gasen schädigte die Lungen. Der Brandgeruch hing lange in der Arbeitskluft und in den Haaren. Ein Köhler arbeitete einsam. Wochenlang war er von zu Hause fort. Dann hauste er, ständig bereit einzugreifen, in einer primitiven, aus Holz und Grassoden gebauten Hütte in unmittelbarer Nähe seines Meilers. Das Ansehen dieser Zunft war erbärmlich. Und genau hier liegt Kohlenmunk-Peters seelisches Trauma: sein sozialer Status, in Hauffs Sprache »sein Stand«. Er beginnt, sich und sein »ärmlich Leben« zu vergleichen mit dem verschwenderischen Lebensstil und dem scheinbar hohen Ansehen der wenigen Reichen.
Doch im kollektiven Bewusstsein des Dorfes haben die Reichen einen »Hauptfehler«, der sie »bei den Leuten verhasst machte, nämlich ihr unmenschlicher Geiz und ihre Gefühllosigkeit gegen Schuldner und Arme«. Die Kritik der einfachen Leute an der Gier zielt im Kern auf die ungleiche Verteilung des Reichtums. Der Gierige nimmt sich mehr, als ihm zusteht. Folglich nimmt er anderen etwas weg. Er entzieht ihnen etwas, das ihnen eigentlich zusteht, und stürzt sie ins Elend. Die Dorfgemeinschaft verurteilt die Gier im Namen von Gleichheit und Gerechtigkeit.
Gier und das narzisstische Gefühl, auserwählt zu sein
In Peters Wahrnehmung jedoch tritt die Ungerechtigkeit und die als »unmenschlich« empfundene soziale Kälte der Holzherren zurück. In seinem Gefühlshaushalt mischen sich Unsicherheit und Scham, Angst vor sozialer Ausgrenzung und Zorn auf die narzisstische Kränkung mit dem unbedingten Willen, selbst aufzusteigen. Der reich gewordene Flößer Ezechiel zum Beispiel – eine Art Donald Trump des Nordschwarzwalds – erscheint ihm immer stärker »als das vollendetste Bild eines glücklichen Menschen«. Peters Gefühle schlagen um in eine neidvolle und gleichzeitig unterwürfige Bewunderung für den Hedonismus und die arrogante Selbstsicherheit der Reichen und Mächtigen.