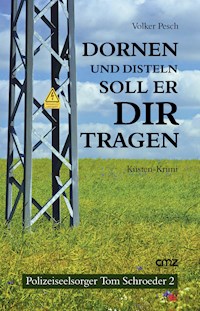Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein versenktes Schiff, ein verschwundenes Gemälde und Spuren in die Vergangenheit. Das gesunkene Traditionsschiff Sansibar ist eigentlich kein Fall für die Mordkommission, doch unter Deck liegt eine Leiche. Handelt es sich dabei um den vermissten Bootsmann? Während die Leiche noch geborgen wird, beginnt Hauptkommissarin Doro Weskamp die Ermittlungen. Zunächst scheint die geplante Teilnahme des Seglers an der Hanse Sail ein Motiv zu sein. Wollte das jemand verhindern? Doch dann stößt die Kommissarin auf Spuren aus der Vergangenheit, die mit dem Großvater des Bootsmanns, dem Zweiten Weltkrieg und einem verschollenen Kunstwerk zu tun haben. Und mit ihrer eigenen Generation, der Generation der Kriegsenkel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Pesch • Der letzte Grund
Volker Pesch wurde 1966 am Niederrhein geboren und studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie in Köln. Mitte der 1990er-Jahre ging er als Mitarbeiter an die Universität Greifswald, wo er promovierte. Nach verschiedenen beruflichen Stationen arbeitet er heute freiberuflich als Texter, Journalist und Schriftsteller. Volker Pesch lebt gemeinsam mit seiner Frau im ländlichen Vorpommern.
Volker Pesch
Der
letzte
Grund
PENDRAGON
1
Die frische Brise aus Südost schob das Schiff in schneller Fahrt vor sich her. Es trug Vollzeug, sogar die Toppsegel waren gesetzt, die Segel für leichten Wind. Sommersegel. So dicht unter Land war die See nur mäßig bewegt, der Bug tauchte sanft ein und zerteilte das Wasser. Zu jeder Seite warf sich eine schäumende Welle auf. Knochen im Maul, dachte er, das sieht aus wie ein Knochen im Maul eines Hundes. Am Horizont zeichneten sich die Speicher und Kräne des Hafens ab, auch ein Kraftwerk mit seinem weißen Schweif aus Wasserdampf war in Sicht. Nicht mehr lang hin, dann mussten sie die Segel bergen oder unter vollen Segeln in die Hafeneinfahrt kreuzen. Das konnte an diesem Nachmittag vielleicht sogar gelingen.
Er roch den Muschelkalk vom Strand und das Harz der Kiefern hinter den Dünen. Eine neugierige Möwe drehte ihre Runden um die Flagge am Besanmast. Sein Blick folgte ihr kurz und kehrte mit einer anderen Möwe zurück an Bord. Für eine stille Sekunde schloss er die Augen und nahm das rauschende Kielwasser wahr, das Ächzen und Knarren des alten Holzes, die Spannung im ganzen Schiff. Irgendeine der zahllosen Leinen schlug im Takt der Bewegung an den Mast. Es war dieses Geräusch der entspannten Minuten, der Minuten am Ende eines langen Törns, dieses Geräusch, das er so liebte. Wenn alle Gäste zufrieden waren und nicht mehr viel schiefgehen konnte. Er genoss es. Zugleich atmete er tief den Duft von Leinöl und Pech ein, der von den ergrauten Planken aufstieg. Das war jetzt sein Leben. Und er stand mit beiden Beinen fest an Deck. Seine rissigen Hände fassten das Steuerrad, er fühlte sich gut, stark, voller Energie, unbändig, wie verwachsen mit dem Schiff und den Elementen, und er hielt sicher den Kurs. Nur sein linker Fuß war kalt.
Dann waren da plötzlich Menschen an Bord, viele Menschen. Überall waren diese Menschen. Frauen in Jack-Wolfskin-Allwetterjacken und Männer in orthopädischen Sandalen saßen auf der Reling und dem Kajütaufbau. Am Bug stand eine Gruppe Senioren ohne Zähne, Kinder lärmten, kreischten mit ihren schrillen Stimmen, vor lauter Lärm und Gekreische hörte er weder die Möwen noch das Kielwasser. Vor ihm, neben ihm, hinter ihm, über und unter Deck waren Menschen. Und alle starrten ihn an. Was wollten die von ihm? Machte er etwas falsch? Was warfen sie ihm vor? Er zog den Kopf ein, spannte die Muskeln an, von den Schultern über Rumpf und Gesäß bis tief in die Beine, sein Puls wurde schneller, der Atem flacher, die Blase drückte. Aus der Kombüse stieg der Geruch von Erbsensuppe und Bockwurst auf. Wieso kochen die schon wieder?, fragte er sich, als hätten die keine anderen Probleme als immer nur essen. Es hat doch eben erst Suppe gegeben! Sein Mund wurde trocken. Plötzlich griff jemand nach dem Steuer, er wollte ihn abweisen, wollte um das Steuer kämpfen, aber der Mann war kräftig und entschlossen. Dann war auch der Schipper da, ganz kurz fühlte er so etwas wie Erleichterung, aber statt ihm zur Seite zu stehen, forderte der ihn in hartem Befehlston auf: „Lass den Mann ran! Der kann das besser als du!“
Erschrocken trat er zur Seite, verletzt wegen dieser Ungerechtigkeit, wieso traute der ihm auf einmal das Steuern nicht mehr zu? Das Schiff schlingerte, er taumelte, stieß an irgendetwas an, etwas Festes, etwas, das dort nicht hingehörte. Das waren Dosen, blecherne Dosen, Dutzende, eine ganze Pyramide aus leeren Erbsensuppendosen. Jetzt nur nicht auffallen, sagte er sich. Seine Hände zitterten. Wenn er diese Dosen umstieß, dann gab es kein Entkommen, das war ihm glasklar. Er versuchte, sich irgendwo abzustützen, griff aber ins Leere, nirgends war ein fester Halt. Der Mann stand immer noch am Steuer, lachte, drehte beherzt am Rad. „Pass doch auf !“, rief er ihm zu. „Wir müssen wenden!“ Er wollte eingreifen, rannte, kam nicht von der Stelle, strauchelte, die ersten Dosen fielen scheppernd um, er versuchte, das zu verhindern und die Dosen festzuhalten, aber er griff nur ins Leere, eine nach der anderen schepperten die Dosen über das Deck, er konnte es nicht abwenden und nicht stoppen, er stieß einen verzweifelten Schrei aus, schrie laut: „Nein!“
Davon schreckte er hoch und riss schwer atmend die Augen auf. Sein Herz pochte mit schnellen Schlägen. Um ihn herum war es stockdunkel. Er brauchte ein paar Sekunden. Meine Koje, dachte er dann, das ist meine Koje! Nur ein Traum. Er sackte erleichtert zurück auf die Matratze. Aber sein Fuß blieb kalt, er zog ihn unter die Decke und wollte ihn mit der Hand anfassen und wärmen. Dann holte ihn der Traum wieder ein.
Der Wind frischte auf. Eine heftige Welle spritzte über die Reling und spülte das Deck. Das Wasser umspielte die Aufbauten und lief gurgelnd ab. Der Mann drehte am Steuerrad, drehte und drehte und drehte. Immer noch wortlos und lachend. Er fragte den Kerl: „Wer bist du?“ Der antwortete nicht. „Gleich sind wir vor dem Wind!“, warnte er noch, er kannte die Gefahr schließlich genau. Wenn das Schiff nicht Kurs hielt und der Wind plötzlich von der anderen Seite ins Segel greifen würde, geriete alles außer Kontrolle. Das hatten sie ihm vom ersten Tag an eingetrichtert: Wer vor dem Wind segelt, muss höllisch aufpassen! Immer nach oben auf die Flagge schauen und rechtzeitig Gegenruder legen! Aber dieser Idiot drehte einfach nur, der hatte doch keine Ahnung! Er wollte wieder schreien, warnen, aber er brachte keinen Ton mehr heraus. Der Schipper stand neben ihm und lachte, der Mann lachte, all diese Menschen an Bord lachten plötzlich, sie lachten über ihn, lachten ihn aus. Das war so ungerecht! Er sah die Katastrophe kommen, wollte nicht tatenlos sein, wollte irgendwas tun. Aber er musste wie gelähmt zusehen, wie das Großsegel mit dem schweren hölzernen Baum von einer Seite zur anderen rauschte. Er hörte den lauten Schlag und das Geräusch von berstendem Holz, ein Teil des Mastes stürzte an Deck, Menschen kreischten und schrien, stürzten, eine Frau ging über Bord, der Mann am Ruder lachte noch lauter, sein Gelächter übertönte das brachiale Krachen, als das Schiff die steinerne Mole rammte und sich der Klüverbaum in das historische Leuchtfeuer bohrte. Wir sind verloren, dachte er nur, das Schiff ist verloren! Er hatte es kommen sehen. Der Schipper schaute ihn von oben herab an, ganz ruhig, überheblich grinsend, schüttelte langsam den Kopf und sagte: „Dir darf man auch wirklich keine Aufgabe anvertrauen!“
Er wollte laufen, irgendwie von Bord kommen, egal wie und egal wohin, Hauptsache laufen. Es ging nicht. Er bewegte die Beine, rannte, aber kam nicht von der Stelle. Irgendwer rief: „Clemens!“ Dann viele im Chor: „Cleeeee-mens! Hosen-scheißer!“ Er war plötzlich im Pausenhof seiner Grundschule. Die Jungs bauten sich vor ihm auf, breit grinsend. Er versuchte nach rechts auszuweichen, aber da standen noch mehr von ihnen, auch nach links war kein Entkommen. „Ho-sen-schei-ßer, Ho-sen-schei-ßer!“ Da hinten war die Lehrerin, die Aufsicht, er sah sie auf den Eingangsstufen vor dem Hauptgebäude stehen, mit verschränkten Armen. Die musste doch sehen, was hier passierte! Wieso sah die das nicht?
Er zog den Kopf tief zwischen die Schultern, hielt schützend beide Arme darüber und erwartete einen Schlag. Oliver würde als Erster schlagen. Das war der Stärkste von allen, der machte immer den Anfang. Dann Stefan und Markus und Axel, die immer mit Oliver liefen. Seine Adjutanten. Er wusste, was kommt, kannte das aus leidvoller Erfahrung, spürte die Schläge schon im Voraus, die Schmerzen. „Hosen-schei-ßer!“ Die Lehrerin schaute zu ihm herüber, ihre Blicke trafen sich, seiner flehend und voller Tränen, ihrer kalt und gleichgültig. Wieso hilft die mir nicht?, dachte er verzweifelt.
Er schämte sich für seine Schwäche, für die Tränen, sah Oliver sich vor ihm aufbauen, bekam kaum noch Luft, ging tief in Deckung, sein ganzer Rücken verkrampfte sich. Ein Schlag traf seinen Kopf, er hob schützend die Arme darüber, ein zweiter Schlag ging in den Magen. Dann stand sein Vater neben ihm und sagte kopfschüttelnd: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“ Er hatte ihn enttäuscht. Mal wieder enttäuscht. Er spürte, wie es in seinem Schritt warm und feucht wurde. „Ho-sen-schei-ßer!“, höhnten alle im Chor. „Pisser!“ Auch sein Vater und die Lehrerin stimmten ein. „Ho-sen-schei-ßer-Pis-ser-Pis-ser!“ Von irgendwoher hörte er eine vertraute Frauenstimme: „Du hast überhaupt keine Vorstellung davon, was wir auf der Flucht alles durchmachen mussten!“ Wer war das? Er kannte diese Stimme. Mutter? Bist du das? Stefan riss ihn zu Boden, Markus trat zu, Oliver lachte.
Nass von Schweiß wachte er auf, keuchend und mit Herzrasen. Seine gesamte Muskulatur war bretthart verspannt und schmerzte. Mit dem Handrücken wischte er sich über die Stirn. Das Bettzeug, sein Kissen, das Laken, alles war nass. Aber auch kalt, eiskalt. Erst nach einigen Sekunden wurde ihm klar, dass es wieder nur ein Traum gewesen war. Einer dieser Träume. Er atmete erleichtert aus und langsam wieder ein, sein Puls wurde etwas ruhiger. Er richtete sich in der Koje auf, um nicht wieder einzuschlafen. Nur nicht wieder einschlafen!, dachte er und versuchte, sich auf das Wachbleiben zu konzentrieren. So hatte er es gelernt für diese Fälle. Einatmen, ausatmen, ein, aus. Nicht wieder einschlafen und nicht in Panik verfallen.
Eine Beruhigungstechnik fiel ihm ein, die hatte eine Schwester ihm gezeigt, in einer der schlimmeren Nächte in der Klinik. Seitdem übte er die gelegentlich, das half ihm zurechtzukommen. Nenne fünf Dinge, die du sehen kannst!, forderte er sich selbst auf. Aber in der dunklen Kammer fiel ihm die Technik schwer, sein Herz klopfte nur noch schneller, weil er nichts sehen konnte und es ihm nicht auf Anhieb gelang, sich fünf Dinge vorzustellen. Dann nenne erst einmal fünf Dinge, die du hören kannst! Auch das war schwierig. Konnte er fünf Dinge riechen? Er roch nichts. Oder fühlen? Er bekam keine Luft. Das war Nummer eins, immerhin. Nummer zwei: Die nasse Decke. Drei: Schweiß im Gesicht. Und der Fuß fühlte sich kalt an. Okay, sagte er sich, bleib ruhig, es geht doch, also noch mal von vorn. Nenne Dinge, die du sehen kannst, oder sehen könntest, wenn Licht wäre. Konzentrier dich! Er stellte sich vor: die Bettdecke, das Bullauge, sein Ölzeug, die Leuchtziffern seiner Armbanduhr. Die konnte er tatsächlich sehen, es war kurz nach drei.
Die Zeit war auf seiner Seite. Auch diese Attacke würde nicht ewig dauern, das wusste er. Irgendwann würde er aufstehen, an Deck gehen, durchatmen, vielleicht bis zum Morgen durch die Straßen laufen. Jedenfalls nicht wieder einschlafen. Der neue Tag macht die Nacht vergessen, so viel hatte er in all den Monaten gelernt, er musste nur bis zum Hellwerden durchhalten. Bis zu den Straßenreinigern und Zeitungsausträgern. Er atmete aus. Erschöpft streckte er die Arme von sich, seine linke Hand glitt neben die Matratze.
Da war Wasser.
Er brauchte eine Sekunde, um das zu begreifen: Wasser. Da war Wasser im Schiff ! Das war wirklich, kein Traum, und das Wasser stand schon fast bis zur Höhe seiner Matratze. Schlagartig wurde er hellwach, drehte sich aus der Koje und stand auf, dabei tauchte er fast bis zur Hüfte ein. Daher der kalte Fuß, dachte er und wunderte sich für den Bruchteil einer Sekunde selbst darüber, dass er in dieser Situation so sachlich denken konnte. Aber dann drängte ein anderer Gedanke vor: Das Schiff sinkt, du musst hier raus!
Er watete zur Tür, öffnete sie und machte einen vorsichtigen ersten Schritt in den Gang. Mein Koffer!, schoss es ihm durch den Kopf. Er hastete zurück zu seiner Koje und ertastete seinen Koffer, zog ihn an sich. Sein Koffer war bei ihm, das war gut, das beruhigte ihn, da war alles drin. Jetzt musste er nur noch raus aus dem Schiff.
Der nächste Niedergang mit dem Ausstiegsluk war mittschiffs, im Salon, da musste er hin. Er tastete sich an der Wand entlang durch den Gang, der seine Kammer im Heck des Schiffes mit dem Salon verband. Um nicht mit dem Kopf irgendwo anzustoßen, hielt er die linke Hand nach vorn. Eine offene Tür ließ ihn ins Leere fassen und verunsicherte ihn kurz. War das eine der Gästekammern oder schon das Klo? Er ging vorsichtig tastend einen Schritt hinein, das Klo war es nicht, also musste es eine der Kammern sein. Wahrscheinlich die erste, die Störtebeker-Kammer, dann kam Lord Nelson, dann das Klo, zuletzt die Sindbad-Kammer. Wie lächerlich diese Namen sind, dachte er zu seiner eigenen Überraschung, als sei das momentan sein Problem. Alles nur Kitsch für Touristen! Dass dieses Schiff jetzt gerade im Begriff war, fest vertäut am Liegeplatz auf Grund zu gehen, machte es noch lächerlicher.
Er gelangte ans Ende des Gangs, dort führten zwei Stufen hinunter in den Salon, den größten Raum, zugleich Kombüse und Aufenthaltsraum. Mit dem Fuß fühlte er vor, vorsichtig, eins, zwei. Unten angekommen fehlte ihm eine Wand als Geländer. Er watete in die Richtung, die er für die Mitte hielt, geriet zu weit nach rechts und stieß sich am Tisch schmerzhaft den Oberschenkel. Also korrigierte er die Richtung, tastete sich an der großen Tischplatte entlang, hielt zum Schutz den Koffer vor sich, obwohl ihm der Arm schnell lahm wurde. Das Wasser reichte ihm jetzt bis zur Hüfte. Steigt das so schnell, fragte er sich, oder macht das nur der niedrigere Fußboden? Der Mast war mittig durch die Kajüte geführt, den wollte er ertasten, von dort würde er den Niedergang finden. Tatsächlich gelang ihm das, erleichtert drückte er mit der Linken den Koffer vor die Brust, stieg die steile Treppe hinauf und griff mit der Rechten nach dem Schiebeluk. Es bewegte sich keinen Millimeter. Er zog, riss, ruckelte, soweit das einhändig möglich war. Er wollte beide Hände nehmen, wollte den Koffer irgendwo abstellen, aber überall war Wasser. Also presste er den Koffer mit seinem Bauch an die Stufen und versuchte, beidhändig das Luk zu öffnen. Es rührte sich nicht. Er spürte seinen Herzschlag, hängte sich mit dem gesamten Gewicht hinein und rüttelte, dabei rutschte der Koffer ab und fiel ins Wasser. Er schrie: „Geh auf ! Geh endlich auf, du Scheißding!“ Es nutzte nichts. Hat das etwa einer abgeschlossen? Das wurde doch niemals abgeschlossen!
Er begann zu zittern. Von innen heraus zu beben. Jeder Herzschlag erschütterte seinen ganzen Körper. Ganz ruhig, ermahnte er sich, bleib ruhig! Tatsächlich schaffte er es noch, einen klaren Gedanken zu fassen: Das Luk klemmt, du musst zum Notausstieg im Vorschiff ! Aber erst den Koffer finden. Er drehte sich auf der Treppe, rutschte dabei ab, konnte sich nirgends halten und stürzte ins Wasser. Mit einem gequälten Schrei tauchte er wieder auf. Halb kniend griff er blind nach rechts und links, ohne den Koffer zu finden. Voller Verzweiflung ertastete er den Mast, richtete sich daran auf und hielt ihn umfangen wie einen geliebten Menschen. Dann gab er sich einen Ruck, wischte sich mit dem Arm das Wasser aus dem Gesicht. Zum Notausstieg, dachte er und ließ den Sicherheit gebenden Mast los. Kurz wusste er nicht mehr, in welcher Richtung das Vorschiff lag, aber irgendwie fand er die richtige Tür und dahinter wieder eine Wand zum Entlanghangeln.
In diesem Moment fiel ihm Sami ein. Der Syrer musste noch an Bord sein! In der Sindbad-Kammer. Konnte der schon raus sein? Aber wie sollte er rausgefunden haben? Er kannte das Schiff nicht, hätte sich im Dunkeln nicht orientieren können. Nein, sagte er sich, der ist bestimmt noch in der Kammer! Eine Sekunde dachte er daran, ihn zu suchen. Aber sein Hals schnürte sich zu, er atmete flach und keuchend. Du musst endlich hier raus, sagte er sich, gleich sackt der Kahn ab, dann hast du keine Chance mehr. Er kämpfte sich weiter durch den Gang, stieß sich heftig den Kopf an einem Deckbalken, das warf ihn zurück, sein Schädel dröhnte, er bekam keine Luft, fasste dann aber endlich eine der Leitersprossen und stieg hoch zum rettenden Ausgang. Die Tür klemmte, er rappelte an der Klinke. Das kann nicht wahr sein, dachte er noch und warf sich verzweifelt mit der Schulter und seinem ganzen Körpergewicht dagegen, soweit das aus seiner Position möglich war. Die Tür brach aus den Angeln und stürzte mit ihm auf das Deck.
Dort blieb er liegen. Sein Atem war schnell und flach. Er zitterte am ganzen Körper. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ins Leere. Er begriff nicht, dass er es geschafft hatte, dass er aus dem sinkenden Schiff entkommen war, lebend und soweit unversehrt. Stattdessen spürte er einen Adrenalinschauer nach dem anderen durch seinen Körper jagen und sein Herz stolpern und aussetzen. Eine Panikattacke, dachte er, das wird zur Panikattacke. Nur das nicht! Mit diesem Gedanken begann sein Herz erst recht zu rasen, wurde schneller und schneller, klopfte und hämmerte in seinem Brustkorb. Wie innere Detonationen fühlte sich das an. Die Angst vor der Attacke erfasste ihn vollständig. Er konnte nicht mehr klar denken und war außerstande, aufzustehen und wegzulaufen.
Plötzlich gab es einen lauten Knall, zugleich ging ein Stoß durch das Schiff. Eine der vier Festmacherleinen war unter Hochspannung gerissen und wie eine Peitsche über das Deck geschnellt. Er wusste, was das bedeutete: Das Schiff hing in den Leinen. Es sank oder kippte zur Seite. Auch die anderen Festmacher mussten längst wie Bogensehnen gedehnt sein und würden nicht mehr lange halten. Da lasteten Tonnen an Zug drauf. Wenn die rissen, konnte alles passieren. Er musste weg hier, sofort raus aus der Gefahr, das war ihm klar. Aber er war nicht in der Lage zu handeln. Die gespannten Leinen erzeugten Töne wie Saiten eines Kontrabasses beim Stimmen. Zitternd und schweißgebadet lag er auf der ausgebrochenen Tür und horchte wie paralysiert auf das Geräusch.
Dann griff endlich der nackte Überlebensinstinkt. Du musst hier weg, sagte eine innere Stimme, laut und glasklar. Er überwand die Lähmung, sprang auf, machte drei übergroße Schritte über das Deck und einen gewaltigen Satz über die Reling auf die Kaikante. Dort strauchelte er und schlug heftig mit dem Knie auf, fing sich ab, spürte dabei nicht, wie sich ein scharfer Stein in seine Handfläche bohrte, rannte los, ohne sich umzuschauen, erst ein Stück am Wasser entlang, dann quer über den Platz, vorbei an einigen Schaustellerwagen, auf die noch leere Straße, er kreuzte den Grünstreifen, folgte ein Stück der Fahrspur und brachte auf dem Gehweg beinahe eine frühe Radfahrerin zum Sturz. Er nahm das alles nicht wahr. Er rannte nur. Er hörte nicht den Aufschrei der Frau und auch nicht das Jaulen des Hundes, als sie die Leine an sich riss, erschrocken über den halbnackten Mann mit Blut an Knie und Hand.
Vom Wasser dröhnten in kurzer Folge drei laute Donnerschläge herüber. Die restlichen Festmacher waren gerissen. Er hörte das nicht. Während die Sansibar auf den Grund des Hafenbeckens sank, rannte er nur noch um sein Leben.
2
Das Orange war unter einer Schicht aus schmierigem Staub kaum zu erahnen. Von dem unförmigen Fahrzeug ging ein infernalischer Lärm aus, der in krassem Missverhältnis zu seiner Größe stand. Doro Weskamp hatte das schon aus der Ferne wahrgenommen, bevor sie die Straße überquert und das Hafenareal betreten hatte, allerdings ohne es einer konkreten Quelle zuschreiben zu können. Ein Stadtgeräusch eben, wie es diese und wahrscheinlich jede andere Großstadt bei Anbruch des Tages prägte. Sie empfand solche Geräusche eigentlich als Zeichen des Lebens, des Lebens dieser Stadt und ihres eigenen. Aber jetzt kreuzte das Ding direkt ihren Weg.
Sie blieb stehen, und für den Bruchteil einer Sekunde traf sich ihr Blick mit dem des Fahrers. Er trug Gehörschützer, sein Ausdruck erschien ihr traurig und teilnahmslos. Sie nickte ihm leicht zu, er reagierte nicht. Während er vorüberfuhr, hielt sie sich die Ohren zu und vergrub den Kopf tief zwischen die Schultern. Der Lärm bereitete ihr Schmerzen. Aus fast zusammengekniffenen Augen sah sie, wie die schwarzen Bürsten Pappbecher und anderen Müll unter das Fahrzeug fegten, wo der Lärmerzeuger alles aufsaugte. Gequält schaute sie dem Ding noch einen Moment nach, bevor sie ihren Weg über den weiten Platz fortsetzte. Vom Coffee to go blieben nur wässrige Spuren auf dem Asphalt.
Sie war zu Fuß von ihrer Wohnung in der Altstadt gekommen. Als die Häuserflucht den Blick über die Fläche freigegeben hatte, war sie zuerst verwundert, keine parkenden Autos darauf zu sehen. An den meisten Tagen des Jahres war das schließlich nichts als ein großer Parkplatz, ein Parkplatz mit weitem Blick über Hafen und Fluss. Aber wo sich sonst Blech an Blech reihte, standen an diesem Montagmorgen nur vereinzelt Fahrzeuge. Dann war ihr eingefallen, dass die Hanse Sail bevorstand, die große Seglerparade, vier Tage Ausnahmezustand für die ganze Stadt. Zweimal im Jahr, zum Weihnachtsmarkt und eben zu diesem Volksfest, wurde der Parkplatz geräumt. Als Dauerparkerin hatte sie sogar eine Benachrichtigung bekommen, verbunden mit der Aufforderung, ihren Wagen rechtzeitig zu entfernen. Unter Androhung von Bußgeld und mit korrekter Rechtsmittelbelehrung, offensichtlich hatten die Kollegen keinen Anfänger daran gesetzt.
Während sie das noch dachte, war ihr Blick auf einen Abschleppwagen gefallen, und sofort war ihr der Schreck in die Glieder gefahren: Hatte ihr Golf nicht genau dort gestanden? Manchmal stand er wochenlang unbewegt an einer Stelle, weil sie die Wege in der Stadt lieber zu Fuß oder mit einem Dienstwagen zurücklegte. War er bereits abgeschleppt? Das wäre ärgerlich und teuer, hatte sie gedacht, denn die Zeiten, in denen sie als Kommissarin mit einem Augenzwinkern statt Strafzahlung davonkam, waren lange vorbei. Aber dann war ihr eingefallen, dass sie gestern an der Kriminalpolizeiinspektion geparkt hatte. Der Wagen stand noch auf dem Parkplatz der KPI, unversehrt, wenn ihn in der Nacht nicht einer dieser Schwachköpfe von rechts oder links in Brand gesetzt hatte.
Sie ging zwischen den Schaustellerfahrzeugen hindurch. Ein Mann wies einen gewaltigen Sattelschlepper ein, wie ein Lotse auf dem Flughafen. Sie erkannte Teile eines Fahrgeschäftes, vielleicht war es das Riesenrad. Andere rangierten Anhänger mit bunten Aufschriften auf deren künftige Stellplätze. Sie fühlte sich an die Wanderzirkusse ihrer Kindheit erinnert. Die ersten Schausteller mussten in aller Frühe hier gewesen sein, vielleicht schon über Nacht. Offensichtlich durften die ab heute aufbauen. Die könnten also was gehört oder gesehen haben, dachte sie. Das war doch schon eine Aufgabe für den neuen Kollegen, diesen Hauptmeister Kowalek.
Sie lief erst ein gutes Stück auf zwei große Hafenkräne zu, wandte sich dann nach rechts und folgte dem Weg in Richtung der alten Backsteinspeicher, die noch an die wirtschaftliche Blütezeit des Hafens erinnerten. Einmal atmete sie tief ein und nahm dabei die Morgenstimmung über der Warnow bewusst wahr. Aber nicht lange genug, sie auch wirklich innerlich zu spüren. Aus dem kleinen mecklenburgischen Rinnsal war hier schon ein mächtiger Strom geworden, stellenweise an die 500 Meter breit und tief genug für große Frachtschiffe. Auch wenn die schon lange nicht mehr so weit flussaufwärts fuhren, sondern im Überseehafen an der Mündung festmachten. Der Himmel war verhangen, in den Wolken zeichnete sich eine leichte Röte ab und die Luft roch nach brackigem Wasser. Doro nahm sich vor, bald wieder einmal am Ufer entlang zu joggen. Das hatte sie schon länger nicht mehr getan.
„Es ist bei dem historischen Kran“, hatte der Kollege vom Kriminaldauerdienst am Telefon gesagt, „den kennen Sie doch, oder? Das ist dieses Holzding.“ Jedenfalls glaubte sie, sich erinnern zu können, dass er das gesagt hatte, es war mitten in einer späten REM-Phase, und sie war sich nach Ende des Telefonats nicht hundertprozentig sicher gewesen, das nicht geträumt zu haben. Sie hatte noch kurz wach gelegen und sich über die Frage am Schluss geärgert. Immerhin tat sie seit Jahren Dienst in Rostock und kannte die Stadt wahrscheinlich besser als die meisten Kollegen. Ob sie für alle Zeiten eine „Zugereiste“ bleiben würde? Noch dazu „die aus dem Westen“? Der Idiot soll mal im Atlas nachschauen, wo Kiel liegt, hatte sie gedacht, von wegen Westen!
Schließlich hatte sie beherzt die Decke zur Seite geschlagen und noch auf der Bettkante ihre schulterlangen Haare zu einem kurzen Zopf gebunden. Zum Duschen war keine Zeit gewesen. Während des Zähneputzens war ihr Blick ungewollt auf ihr Spiegelbild gefallen. Auf eine blasse Haut und leichte Ränder unter den Augen. Ich möchte einmal abends so müde sein wie morgens!, hatte sie dabei gedacht. Das fiel ihr jetzt wieder ein, und kurz musste sie über sich selbst lachen, in einer Mischung aus Ironie und Fatalismus. Wenn sie morgens erst einmal in Gang gekommen war, ging es immer, dann stand sie den Tag durch. Solange der nicht zu ruhig verlief. Ruhe war nichts für sie, die hielt sie schwer aus. Sie hatte sich ein T-Shirt herausgesucht, war in eine Jeans gestiegen, hatte ihr Schulterholster angelegt und eine Kapuzenjacke übergezogen. Das war gewissermaßen ihre Dienstkleidung, die hätte sie gestern Nacht gar nicht ausziehen müssen. Gefühlt hatten die Klamotten noch Körpertemperatur. Zuletzt hatte sie ihre Dienstwaffe aus dem kleinen Safe neben ihrer Wohnungstür genommen und in das Holster gesteckt. Und jetzt war sie mitten im Hafen.
Schon von Weitem sah sie die Spiegelung eines Blaulichts an der hölzernen Wand des Krans. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren bis dorthin vorgefahren. Beim Näherkommen erkannte sie ihren Lieblingskollegen, von dem niemand mehr zu sagen wusste, ob Fabio sein Vorname oder Nachname war. Nur wenige Männer trugen heute einen derart beeindruckenden Backenbart, der beidseitig einige Zentimeter lang und auch von hinten gut zu sehen war. Ein Caspar David Friedrich wäre darauf neidisch gewesen. Wie immer trug Fabio seine graue Wolljacke. Doro konnte sich nicht erinnern, ihn jemals anders gekleidet gesehen zu haben. Er stand in einer Gruppe von Uniformierten an der Kaikante und schaute hinab aufs Wasser wie ein Angler auf seinen dicken Hecht am Haken.
Sie gesellte sich von hinten kommend still dazu und schaute ebenfalls hinab.
„Na, was gefangen?“, fragte sie anstelle einer Begrüßung.
Fabio schreckte kurz auf und lachte sie dann an, die anderen blickten ziemlich verständnislos.
„Morgen, Doro!“, grüßte er, und ehe er das verhindern konnte, nahm sie ihm geschickt den Becher einer Thermosflasche aus der Hand. Er ließ es zu.
„Schwarz mit Zucker, wie du ihn magst“, sagte er noch.
Jetzt lächelte sie zum ersten Mal an diesem Tag.
„Bist ein Schatz!“
Der Kaffee tat ihr gut. Er war sogar noch fast heiß, und sie spürte, wie er langsam die Speiseröhre hinunter bis in den Magen rann. Diese Sekunde gehörte ihr.
Dann scannte sie die Situation. Zwei Masten ragten leicht schräg aus dem Wasser, außerdem die Oberkante einer Kajüte und vorn die Spitze eines Klüverbaums. Ihr Blick ging von vorn nach hinten und von unten nach oben. Die Nationalflagge flatterte an einem der Masten im Schein des Blaulichts. Sie schaute an einer der unzähligen Leinen entlang, bis die unter der Oberfläche des Wassers verschwand. Ihr war sofort klar, dass es eines der vielen alten Schiffe sein musste, die hier oft festmachten. Für dich fällt die Hanse Sail dieses Jahr aus, dachte sie. Von einem Schlauchboot aus zogen zwei Feuerwehrmänner eine Kette aus gelben, länglichen Schwimmkörpern um das gesunkene Schiff.
„Ölsperre“, sagte Fabio.
„Schon klar.“
„Prophylaktisch, noch tritt kein Öl aus.“
„Und“, fragte sie nach ein paar Sekunden, ohne den Blick vom Schiff abzuwenden, „was ist das hier?“
„Traditionsschiff Sansibar“, erklärte Fabio, „ist heute früh auf Grund gegangen. Der Hafen ist ziemlich verschlammt, hat in diesem Bereich nur noch ungefähr vier Meter. Deswegen guckt noch so viel von dem Kahn raus. Die Ursache ist bis jetzt unklar.“
„Okay, ein Schiffsuntergang. Und was machen wir dann hier? Das ist doch eher was für die Entenpolizei, oder?“
Das war ihr unbedacht rausgerutscht. Fabio zuckte zusammen und knuffte sie warnend in die Seite. Bevor sie den Wink verstanden hatte, trat ein uniformierter Polizist an sie heran. „Wenn Sie uns damit meinen, dann gebe ich Ihnen recht.“
Der Mann war klein, etwas untersetzt und sorgfältig rasiert. Doro erinnerte er an ihren Physiklehrer. Aber die vier goldenen Streifen auf der Schulterklappe wiesen ihn als Hauptkommissar aus.
„Eichbaum“, stellte er sich vor, „Wasserschutzpolizei Rostock.“
„Weskamp“, sagte Doro, „äh … Hauptkommissarin Weskamp, Mordkommission. Tschuldigung, tut mir leid mit der Entenpolizei, ich wollte Sie nicht beleidigen.“
„Schon gut. Für Ihre Truppe gibt es ja ebenfalls ganz nette Bezeichnungen. Aber ich hatte mich auch schon gefragt, was die Mordkommission hier macht.“
Jetzt schauten beide fragend Fabio an.
„Wahrscheinlich ist da noch einer drin“, erklärte er, „der Bootsmann. Das vermutet jedenfalls der Skipper. Oder ‚Schipper‘, so nennen die sich auf den alten Schiffen selbst.“ Er deutete mit einer Kopfbewegung auf einen Mann, der mit dem Rücken am Kran lehnend auf dem Boden kauerte. Sein Gesicht wurde im Takt des Blaulichts angestrahlt. Er sah verzweifelt aus.
„Kann mal einer dieses Blaulicht abschalten?“, rief Doro den Polizisten zu, die am nächsten beim Streifenwagen standen. „Das macht einen ja verrückt.“ Dann wandte sie sich wieder an Fabio. „Es tut mir ja wirklich leid für den Bootsmann, armer Kerl, aber noch mal: Was soll ich hier?“
„Das wissen wir noch nicht. Es sieht so aus, als sei der Ausgang von außen verkeilt worden“, sagte Fabio und deutete auf ein Schiebeluk knapp über der Wasseroberfläche, „siehst du das? Da wollte wohl jemand verhindern, dass der da noch lebend rauskommt.“
Doro schaute hinunter, konnte es aber nicht genau erkennen. Ein Bootshaken schien zwischen dem Luk und irgendetwas unter Wasser zu klemmen.
„Von allein kann das nicht passiert sein?“, fragte sie Fabio.
„Kann schon. Ist aber unwahrscheinlich.“
In diesem Moment stiegen neben dem Schiff blubbernd Luftblasen auf. Doro schaute verwundert erst Fabio, dann Eichbaum an.
„Da ist einer von unseren Tauchern unten“, erklärte er, „der Rumpf muss erst einmal von außen begutachtet werden. Das ist Vorschrift, zur Sicherheit, bevor ins Innere getaucht wird, um die Leiche zu suchen.“
Doro stellte sich vor, wie das sein würde, in so ein enges und dunkles Wrack zu tauchen. Schon der Gedanke daran nahm ihr die Luft.
„Wo ist eigentlich der Kowalek?“, fragte sie Fabio.
Er zuckte mit den Schultern. „Schläft wahrscheinlich noch.“
„Wenn er irgendwann aufgewacht sein sollte, soll er hier alle Schausteller befragen. Das Übliche halt. Haben die was gesehen oder gehört und so weiter? Egal was, alles kann wichtig sein.“
Sie ging zu dem am Boden kauernden Schipper und hockte sich vor ihn hin. Das war zwar unbequem, aber auf Augenhöhe. Fabio folgte ihr und blieb hinter ihr stehen.
„Ich bin Dorothea Weskamp, ich leite die Ermittlungen. Meinen Kollegen Fabio kennen Sie ja bereits.“ Der Mann schaute nicht auf.
„Und Sie sind?“
Er rührte sich nicht.
„Herr …“, sagte sie und blickte sich fragend zu Fabio um.
„… Christopher Darr“, ergänzte der.
„Herr Darr …“, hob Doro an, aber plötzlich fing der Mann von sich aus an zu reden. Er klang traurig und erschüttert. „Das kann alles nicht sein“, sagte er leise, „das geht doch nicht einfach so unter.“
Doro wiegte zweifelnd den Kopf, sparte sich aber eine entsprechende Bemerkung.
„Das ist massive Eiche! Und wir waren gerade noch auf der Werft, die Sansibar ist top in Schuss!“
Wirklich überzeugend fand sie das nicht. Immerhin war das Schiff keine zwanzig Meter entfernt auf den Grund des Hafens gesackt. Aus ihrer Sicht war das nicht gerade ein Indiz für „top in Schuss“. Aber sie wollte den Mann nicht kränken, und genau genommen konnte sie es auch nicht beurteilen. Also fragte sie lieber, wann sie hier eingelaufen waren.
„Vorgestern am Nachmittag“, antwortete er, „wir haben noch aufgeklart und kurz zusammengesessen, ein Anlegerbier getrunken. Also ich hab eins getrunken, Klemme trinkt ja nichts.“
„Klemme, ist das der Name des Bootsmannes?“
„Ja. Eigentlich Clemens, aber wir nennen ihn meist Klemme. Ich bin dann zu meiner Freundin, die wohnt hier in Rostock. Klemme ist an Bord geblieben, da gab’s genug zu tun, nach der Fahrt ist vor der Fahrt. Außerdem hat der ja nichts anderes.“
„Wie meinen Sie das?“
„Er hat nur uns und die Sansibar.“
„Das heißt, er wohnt auch an Bord?“
„Ja. Während der Saison. Ich weiß gar nicht, wo der sonst gelebt hat. Also vorher. Er ist erst seit diesem Jahr an Bord. Mir ist das sehr recht, dass immer einer da ist, es gibt so viele Arschlöcher, die einem die Leinen zerschneiden oder einbrechen. Aber so was …“
„Hatten Sie schon häufiger solchen Ärger?“
„Hin und wieder. Früher bin ich selbst oft an Bord geblieben. Und im Winter räumen wir alles raus, was nicht niet- und nagelfest ist. Aber jetzt war ja Klemme da. Der wollte auch im Winter an Bord bleiben.“
Von hinten näherte sich das Reinigungsfahrzeug. Doro hörte den ansteigenden Lärm schon seit einigen Sekunden.
„Nun warten Sie erst mal ab“, versuchte sie ihn zu beruhigen, „wir wissen noch gar nicht, ob Ihr Bootsmann überhaupt an Bord war. Und ob er tatsächlich da unten drin ist.“
Der Mann schaute sie an und versuchte ein Lächeln, ganz kurz sah er dankbar aus. Aber dann fielen seine Züge wieder zusammen. „Wo sollte der sonst sein?“
Armer Teufel, dachte Doro und wusste selbst nicht genau, ob sie den Schipper oder seinen vermeintlich toten Bootsmann meinte. Das Fahrzeug war jetzt auf ihrer Höhe, sie hielt sich die Ohren zu und wandte den Kopf ab.
„Wie hieß Clemens denn mit Nachnamen?“, fragte sie, als der Lärm vorüber war.
„Muss ich nachsehen“, sagte er. Doro schaute ihn verwundert an. „Nachnamen sind auf so ’nem Schiff nicht üblich“, erklärte er entschuldigend, „das war einfach der Klemme.“
„Okay. Wo und wann können Sie das nachsehen?“, fragte sie.
„Im Bordbuch.“
„Das ist da unten drin, stimmt’s?“
Er nickte. Sie schaute ihn mit hochgezogenen Brauen an. Im Moment wusste sie nicht mehr, was sie den Mann noch fragen sollte. Sie richtete sich auf und spürte einen Schmerz im unteren Rücken. Ischias. Während sie zurück an die Kaikante ging, dehnte und streckte sie sich nachdenklich. Sie hatte also erst einmal nichts als einen Vornamen. Allerdings hatte sie auch noch keine Leiche, insofern war ein Vorname schon viel.
Sie schaute nachdenklich auf das Schiff hinab und überlegte gerade abzubrechen und sich in die KPI fahren zu lassen, als ihr jemand von schräg hinten zuraunte: „War doch nur eine Frage der Zeit.“
Doro wandte sich um. Der Mann war klein und ziemlich korpulent, vielleicht Mitte oder Ende sechzig, sein hochrotes Gesicht zeugte von beachtlichem Bluthochdruck und ließ den beeindruckenden weißen Bart noch weißer wirken. Das Wort Seebär schoss Doro in den Kopf. Er trug eine blaue Hose und ein weißes Hemd mit reich verzierten Schulterstücken, außerdem eine blauweiße Kapitänsmütze. Sie musste nur zwei Sekunden auf das Arrangement von goldenen Ankern und Sternen auf seinen Schultern schauen, um zu erkennen, dass es keine amtlichen Insignien waren. Das war eine Fantasieuniform.
„Was war eine Frage der Zeit?“
„Das mit dem Schiff “, sagte er.
„Aha. Und wer sind Sie?“, fragte sie verhältnismäßig grob. Sie mochte den Mann auf Anhieb nicht.
„Ich bin Kapitän Jürgen Auerich.“