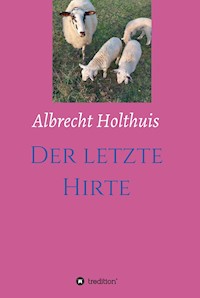
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2017: Bert Winter gehört zu der immer seltener werdenden Spezies der evangelischen Pfarrer in Deutschland, 47 Jahre, geschieden, zwei Kinder. Er ist als Pastor an der Erlöserkirche in Rheinstadt-Benninghausen am Niederrhein, tätig. Er selbst betrachtet sich mit seinem Berufsbild schon als eine Art Dinosaurier, was ihn aber nicht daran hindert, sich ständig mit den aktuellen Medien und Arbeitsmitteln auf dem Laufenden zu halten. Kollegen, die noch ihren Papierkalender nutzen, ihr Fax noch nicht abgemeldet haben, Angst vor dem Datenklau auf sozialen Medien haben und niemals eine Weiterschaltung auf ihr Smartphone wegen der Gefahr permanenter Ruhestörung in Erwägung ziehen, sind ihm suspekt. Er durchlebt beruflich wie privat turbulente Monate, da sich in seiner Gemeinde große Verwerfungen aufgrund der kirchlichen Finanz- und Relevanzkrise ankündigen. Zudem hadert er mit den fragilen Strukturen seines komplizierten Familienlebens. In dieser Situation wird er zufällig mit dem Leben eines Vorgängers im Pfarramt, Wilhelm Ortmann, konfrontiert, da er auf dem Dachspeicher seines Pfarrhauses dessen alten Koffer mit Aufzeichnungen und Briefwechseln aus den 30er Jahren in einem Versteck entdeckt. Eine Geschichte von Verrat und Kirchenkampf unter dem Hakenkreuz tut sich auf. Bert Winter beginnt daraufhin, sich für diesen Kirchenmann, der einst die Erlöserkirche in Benninghausen mit aufbaute, zu interessieren. Dessen ungeklärtes Schicksal - seit April 1945 gilt Ortmann als vermisst - versucht er zu ergründen. Die Spuren führen ihn zunächst in kirchliche Archive, aber dann auch bald in die USA. Schließlich bricht er zu einem kurzen Pilgertrip spontan ins Heilige Land auf. Gleichzeitig kämpft er um den Erhalt der eigenen Kirche, die von Schließung bzw. Entwidmung bedroht ist und um den Zusammenhalt seiner eigenen Familie. Konfrontiert mit verschiedenen Krisenherden muss er die Bewährungsprobe seines Lebens bestehen - als womöglich letzter Hirte seiner Gemeinde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der letzte Hirte
© 2021 Albrecht Holthuis
Autor: Albrecht Holthuis
Umschlaggestaltung, Illustration: Albrecht Holthuis
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359
Hamburg
ISBN: 978-3-347-28015-1 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-28016-8 (Hardcover)
ISBN: 978-3-347-28017-5 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog – Millerstown, USA
Abschnitt 1 – Rheinstadt
Abschnitt 2 – Millerstown, USA
Abschnitt 3 – Heiliges Land
Abschnitt 4 – Rheinstadt
Epilog – Washington, USA
Nachwort
Personen im Roman
Historische Hintergründe
Dank
Prolog
Millerstown, Maryland
Mittwoch, 7. Januar 1972
Als die Orgel zum großen Finale anhob, öffnete sich das Kirchenportal der Zion Reformed Church of Millerstown in Maryland und polyphone Pfeifenklänge aus dem Nachspiel von „Holy God, we praise thy Name“ schallten in die Umgebung des nahe gelegenen Stadtzentrums, als wollten sie jedem Haus einen zärtlichen Himmelsgruß zuflüstern. Durch das gerade sich intensivierende Schneegestöber war der Verkehr fast zum Erliegen gekommen und die sonst üblichen Geräusche der Geschäftigkeit in der Kleinstadt waren verklungen. Selbst Passanten hielten einen Moment inne, um den weiteren Verlauf des sich anbahnenden Schauspiels abzuwarten. Es dauerte eine Weile, bis die sechs schwarzen Gestalten in aller Würde und Vorsicht den schlichten Holzsarg aus der Kirche herausgetragen hatten, immer in Sorge, dass der Schnee eine allzu rutschige Grundlage darstellen könnte. Der Weg zum Leichenwagen, der vor der Kirche stand, war allerdings nicht weit. Fast schwebend und ohne Hast bewegten die Sargträger ihre Last zielsicher zu der mit frostresistenten Pflanzen ausgeschmückten Laderampe. Dort erwartete sie schon der Bestatter, der ihnen mit einem kurzen Fingerzeig andeutete, wo genau der Sarg aufzusetzen sei, damit er dann in das Innere des Fahrzeugs sanft hinein bugsiert werden könnte. Währenddessen strömten immer mehr pechschwarz gekleidete hauptsächlich ältere Menschen aus dem Portal hervor. Sie versammelten sich schweigend auf dem Vorplatz der neogotischen protestantischen Kirche in einem Halbkreis in respektvollem Abstand um den Leichenwagen herum. Auch ein Pastor war an seinem Talar zu erkennen. Der Bestatter wies ihn zeichenhaft an, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen, so dass der Leichenzug zum eine halbe Meile entfernt liegenden Friedhof am Ortsrand seinen Anfang nehmen könne. Als sich der Tross mit dem majestätischen Leichenwagen an der Spitze in gemäßigtem Schritttempo in Bewegung setzte, hörte man - nur leise wahrnehmbar - ein vielstimmiges Flüstern. Es schien, als seien alle noch sehr mit ihren Gedanken bei dem Verstorbenen und der gerade beendeten eineinhalbstündigen Trauerfeier, in dessen Mittelpunkt das Bibelwort gestanden hatte:
„Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.“
Ein Pastor war gestorben. Ein ihnen besonders verbundener Mann, den sie über 25 Jahre in seinem Gemeindedienst erlebt und meistens bewundert hatten. Nach den Worten des Predigers „ein großer Seelsorger, Trostspender, Zuhörer, Lehrer und Bibelausleger, ein Mann Gottes und ein Hirte, wie man ihn sich nicht hätte besser wünschen können“. Aber ein Satz, der auf Bitte des Verstorbenen in den Ablauf des Trauergottesdienstes eingebettet worden war, blieb fast allen Teilnehmern dieser Trauerfeier im Gedächtnis und beschäftigte sie. Dagegen konnten auch alle wohlüberlegten würdigenden und mitfühlenden Worte des Nachfolgers im Amt nicht konkurrieren.
Es war ein persönlicher Gebetswunsch des Verstorbenen gewesen. Vor dem gemeinsamen Vaterunser hatte der Trauerredner bei den Fürbitten gesagt:
„Wir beten auf Wunsch des Verstorbenen insbesondere für Margret und Fenna. Mögen sie nun gemeinsam mit dem Verstorbenen in Gottes Hand geborgen sein und ein fröhliches Wiedersehen miteinander feiern“.
Sie meinten, ihren alten gerade verstorbenen Pastor gut gekannt zu haben, da sie sich hauptsächlich den fleißigen Kirchgängern zurechneten. Aber diese beiden Namen hatten sie heute alle zum ersten Mal gehört.
Abschnitt 1
Rheinstadt
Mittwoch, 4. September 2017
1.
Bert Winter reckte sich am frühen Morgen in seinem Doppelbett, das er nun seit langer Zeit (wie viele Monate waren es eigentlich schon?) allein belegte. Ein Stich durchfuhr sein linkes Schultergelenk und er rollte sich wieder tief eingehüllt in seine warme Bettdecke in die schmerzfreie Zone. Es war 5.43 Uhr laut Anzeige der grellweißen Zahlen seines Smartphones gewesen, bevor er die Weckfunktion ausgewischt hatte. Langsam kamen die Gedanken und Bilder wieder bei ihm hoch, mit denen er sechs Stunden zuvor eingeschlafen war.
Die Szene mit dem heimlich aus dem Fenster des Klassenraums geworfenen Blumentopf war ihm wieder präsent genauso wie der Papp-Penis im Schuhkarton als besondere Essenz des Konfirmandenunterrichts zum Thema „Was möchte ich auf meiner letzten Reise nach meinem Tod zu einem neuen Leben unbedingt dabei haben?“ Er musste dabei grinsen.
Dann kam ihm der indiskutable Gottesdienstbesuch am letzten Sonntag nochmals in den Sinn: Zehn Personen waren sie gewesen inklusive Küster und seiner selbst. Da könne er ja bald Selbstgespräche im Sonntagsgottesdienst führen, dachte er. Ja, in der letzten Woche war vieles zusammengekommen, was noch in seinen Gehirnwindungen rumorte und seinen morgendlichen Schädel brummen ließ. In letzter Zeit begann er jeden Morgen neu um seine Motivation für seinen Pfarr- und Schuldienst zu ringen.
Andererseits: War es nicht schlicht normal, dass die häufig Testosteron gesteuerten „Zehner-Jungs“ immer ‚mal wieder besonders durch solche Aktionen auffallen wollten, ja mussten? Und ebenso auch die pubertierenden männlichen Exemplare der Gattung homo sapiens bei den Konfirmanden? Sie sollten doch mit viel Phantasie überlegen, was ihnen gerade bei den letzten Fragen in den Sinn kam. Träumten nicht auch die gläubigen männlichen Muslime von den Jungfrauen im Paradies?
Gott sei Dank hatten wenigstens die meisten anderen – und natürlich vor allem die in diesem Alter eher braveren und reiferen Mädchen - in ihren Karton für die letzte Reise auch viele gute Gedanken und Ideen eingepackt: die engsten Freunde, die Familie, die liebsten Haustiere. Dazu hatten sie noch beeindruckende Mitbringsel wie Schminksachen und elegante Kleidung selbst kreiert. Wichtig war es doch, der heutigen Jugend mit einem „großen Herz“ zu begegnen.
Und außerdem gab es immer wieder auch genug Erfolgserlebnisse im Gemeinde- und Schuldienst und ihm fiel ein, dass er erst gestern wieder eine Danksagungskarte für die liebevoll gewählten Worte bei der Trauerfeier von Anni Schneiders erhalten hatte. Und war nicht auch manche Veranstaltung im Zuge des sich im nächsten Monat anbahnenden Reformationsjubiläums recht erfolgreich gewesen, wenn man bedachte, wie viele Menschen letztens allein zum Kirchenkabarett gekommen waren?
Er legte die Bettdecke etwas beiseite, gähnte und reckte sich abermals.
Und dann dachte er an seine komplizierte familiäre Situation. Immer war er darauf bedacht trotz seiner nicht zu leugnenden Stimmungsschwankungen dafür zu sorgen, die Familie zusammenzuhalten und den beiden Kindern, Nils und Franziska, weiterhin ein guter Vater zu sein. Aber er selbst hatte ja mit sich, seiner manchmal chaotischen und dann wieder phlegmatischen Art zu kämpfen. Wie oft wollte er sympathisch wirken und es kamen nur grantige Wörter aus ihm heraus? Er trug eben nicht unbedingt immer ein Lächeln in seinem Gesicht. Vor allem das schwierige Verhältnis zu seiner Ex-Ehefrau Elena machte ihm zu schaffen. Und die Tatsache, dass er sich nicht mehr regelmäßig mit seinen beiden morgens gern verschlafenen und häufig nörgelnden Kindern, dem schwer pubertierenden Teenager Nils und der gerade erwachsen werdenden charmanten jungen Dame Franziska, am Küchentisch treffen konnte. Wie sehr er gerade das vermisste! Viel zu selten sah er die beiden seit der Trennung von seiner Frau Elena. Wie viele Monate waren inzwischen vergangen, seitdem sie das letzte Mal zusammen an einem Sonntagmorgen gefrühstückt hatten? Auch das versetzte ihm einen Stich.
Warum all diese frustrierenden Erfahrungen und Enttäuschungen, warum die vielen gescheiterten Rettungsversuche und die elenden vertrauten dunklen Stimmen am Morgen? Also doch keine Lust aufzustehen um 05.47 Uhr?
Dann aber hörte er aus dem schmalen Spalt des leicht geöffneten Fensters aufgeregtes Vogelgezwitscher, eine Autotür schlug zu und ein Motor wurde angelassen. Untrügliches Zeichen für ein allmähliches Erwachen der biologischen Diversität in der unmittelbaren Nachbarschaft des alten Pfarrhauses, das er immer noch bewohnen durfte. Erste Sonnenstrahlen an einem dunstigen Herbsttag tasteten sich auch in sein Schlafzimmer vor und hinterließen eine leuchtende Fläche am Schlafzimmerschrank. Bert Winter betrachtete dieses als Fingerzeig, den neuen Tag nun doch bitteschön freundlich anzulächeln. War nicht jeder Tag letztlich doch immer wieder ein Stück weit eine Spur der sich immer wieder zum Leben hin aufbäumenden Schöpfung? „Morning has broken like the first morning …“
Darin war er Experte, ein Gleichnis-Deuter par excellence. Alles musste doch irgendwie einen lebensbejahenden Sinn ergeben! Bert Winter mal wieder ganz der Prediger der Hoffnung, wie seine handverlesenen Kanzelschwalben vielleicht urteilen würden. Heute ‚mal mit dem guten alten Cat Stevens im Geist der 70er. Auch wenn der zum Islam konvertiert war. Egal, es war doch an der Zeit, seine müden Glieder von der Matratze zu erheben. Raus aus der Todesgruft hinein ins pralle Leben! Und als er aufstand, fiel sein Blick auf ein Wand-Tattoo im Flur seines Hauses, das sie vor der Trennung dort angebracht hatten – er und Elena: „Gib dem Leben die Hand und lass dich überraschen, welche Wege es mit dir geht.“
Und so kam es, dass er sich am Frühstückstisch schon wieder ganz anderen Gedanken hingab. Kaffeeduft erfüllte die kleine Küche, die nur jedem Minimalisten als optimal erscheinen konnte. Bert Winter schmierte sich sein Brötchen und klickte sein Smartphone wieder an, um die News für den Tag zu scannen. Parallel hörte er mit einem Ohr auf die Nachrichten im Radio, die zwischen den Musikbeiträgen zu seinem normalen Morgenprogramm gehörten.
Seitdem die Tageszeitung infolge der Trennungskosten dem Spardiktat zum Opfer gefallen war und nicht mehr zur allmorgendlichen Lektüre gehörte, hatte er inzwischen ein neues Ritual eingeführt, nämlich regelmäßig wortlastige Radiosender einzuschalten, da man von ihnen, wie er meinte, wenigstens nicht mit Werbekaskaden und Glücksspielen aller Art zugedröhnt werden könnte. Stattdessen Fakten, Analysen, Meinungen. Ja er war in gewisser Hinsicht über die Jahre ein Nachrichten-Junkie geworden. Wenn er wollte, konnte er stundenlang zwischen CNN, BBC, NTV und Tagesschau hin und her zappen, ohne sich zu langweilen. Hatte nicht der alte Karl Barth, sein längst verblichener Groß-Heilige der evangelischen Kirche und Vorbild aus vergangenen Studientagen, zu denen gehört, die jedem Pastor die Bibel und die Tageszeitung als tägliche Lektüre empfahlen? Er sah sich als Barth 2.0 in dieser Hinsicht.
Andererseits fehlte das „Lokale“ ein wenig. Deshalb musste er immer wieder auch die Lokal-Nachrichten auf dem Radio abpassen oder im Smartphone herunterscrollen.
Als er gerade die erste Tasse Milchkaffee in kleinen Schlucken zu genießen begann und ihm der erste Biss ins Käsebrötchen sichtlich Freude bereitete, erklang das bekannte Jingle des Lokalsenders, das die Lokalnachrichten einleitete: „Radio RNR – mit den Lokaaaal-Nachrichten!“ Und ergänzend hierzu schmetterte eine Fanfare im Crescendo einen dramatischen Schlussakkord, ohne den wohl kein Nachrichtensender im privaten Rundfunk auskommen konnte.
„Rheinstadt: Superintendent Friedhelm Bettermann kündigt wegen der demographischen Entwicklung und zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen weitere Sparmaßnahmen des Evangelischen Kirchenkreises an. Sie würden deutliche Konsequenzen für die einzelnen Gemeinden vor Ort nach sich ziehen. Man müsse dort jeweils in Kürze entscheiden, ob allevorhandenen Kirchengebäude mittel- oder kurzfristig weiterhin genutzt werden könnten, meinte der Kirchenmann. Die Gemeinden müssten sich wegen zurückgehender Finanzmittel auf ein richtiges Maß an Bauwerken und personellen Ressourcen verständigen. Zurzeit hätten einige Gemeinden nicht die angemessene „Garderobe“, die in der jetzigen Zeit gefragt sei. Bei einigen – so Bettermann wörtlich –,ist das Hemd noch zu groß ausgefallen‘. Es gebe hier und da Kirchengebäude, die seien im Unterhalt einfach zu kostspielig. Auch sei das Personal-Tableau nicht vernünftig an die Zahl der Gemeindeglieder angepasst. Das gelte insbesondere für die Kirchengemeinde Rheinstadt, meinte Bettermann.“
Bert Winter fiel bald das Brötchen aus dem Mund. Hatte er richtig vernommen? Der Superintendent tadelt seine Gemeinde öffentlich und will, dass wir eine Kirche schließen? Wieso äußert er sich plötzlich so offen gegenüber der Presse, wo er doch sonst so gerne „im Stillen“ wirken möchte, wie er behauptet? Was ist da im Busch?
Gleich nach dem Schulunterricht würde er seinen Kollegen von der Rheinstädter Gemeinde, Dieter Menge, anrufen und die neueste Entwicklung mit ihm besprechen. Denn eins und eins konnte er zusammenzählen: Von allen Kirchengebäuden in der Gemeinde war seine Kirche, Bert Winters Erlöserkirche, womöglich diejenige, die im Notfall am ehesten mit einer Schließung oder Umwidmung zu rechnen hätte. Ein Gedanke verbiss sich in seinen Gehirnwindungen: Die Erlöserkirche endgültig schließen oder in ein Restaurant oder Museum verwandeln – nicht mit mir!
Bert Winters Frühstücks-Ritual fand ein jähes Ende, denn nun hatte er schnell einige Dinge in seine „To-Do-Liste“ einzugeben und eine E-Mail auf den Weg zu bringen. Dieser Morgen würde nicht gut für seinen Blutdruck werden, und dabei hatte er noch gar nicht richtig begonnen.
2.
„Moin Andreas! Heute mal wieder besonders pünktlich auf der Matte?“ Jovial begrüßte Bert Winter seinen Kollegen Andreas Hilkenbach von der Gesamtschule am Holzweg. Der hatte sich gerade mit Mühe aus seinem Kleinwagen herausgezwängt, während parallel auf dem angrenzenden Radweg eine Horde von Schülern mit ihren Fahrrädern an ihm vorbei sauste. „Ich muss noch einiges kopieren! Alles klar bei dir?“
„Könnte besser sein“, murmelte Winter.
Andreas Hilkenbach, der 45 Jahre alte sportlich ambitionierte Lehrer für Sport und Deutsch, war für Winter in den vergangenen Jahren ein angenehmer Kollege geworden, auch wenn der Kontakt noch nicht so richtig tief in den privaten Bereich hineingedrungen war. Nicht ganz unangenehm war Winter zudem die Tatsache, dass er des Öfteren schon von den Schülern mit ihm, dem sympathischen und sehr gut durchstrukturierten Pädagogen, verwechselt worden war. Offenbar ähnelten sie sich vom Typ her. Man hatte über all die Jahre auch gemeinsame Themen gefunden und das waren – eher unüblich unter Lehrerkollegen – auch religiöse Fragen. Hilkenbach hatte sich vor einiger Zeit sogar entschlossen zu konvertieren, um evangelisches Kirchenmitglied zu werden. Das hatte er erst vor einigen Wochen mit Winters Unterstützung in die Tat umgesetzt.
Winter ging näher auf Hilkenbach zu und ergänzte seine erste Auskunft: „Na ja, um offen zu sein: Momentan gibt es extrem viel Aufregung in meiner Gemeinde. Die große „Finanz- und Relevanzkrise“ der Kirche hat auch uns ganz konkret erreicht. Wir sprachen letztens drüber. Gerade war in den Lokalnachrichten sogar davon die Rede, dass wir uns nach Meinung des Superintendenten damit befassen müssen, eine Kirche dichtzumachen.“
„Das hört sich ja dramatisch an“, kommentierte Hilkenbach ein wenig erschrocken. „Steht eventuell auch deine Pastorenstelle auf dem Spiel?“
Winter zuckte die Schultern. „Kann man so ohne Weiteres noch nicht sagen – und das ist ja auch nur ein Nebenaspekt für die meisten. Im Falle eines Falles werden wir Pfarrer eben anderswo zum Dienst verpflichtet. Es ist auf jeden Fall die Zeit gekommen, um für den Erhalt der Kirche zu kämpfen. Aber jetzt geht es ja erst einmal an die andere wahre Front des Lebens: Du an den Kopierer und ich ans Lehrerpult! Bis nachher im Lehrerzimmer!“
Winter nahm den Abzweig zum Nebengebäude und marschierte nun schnurstracks zu seinem Unterrichtsraum in den 2. Stock. Er musste gleich in der ersten Stunde noch einen Medienwagen organisieren und prüfen, ob die alten Fernseher mit den vorsintflutlich angedockten DVD-Playern überhaupt noch funktionstüchtig waren. Denn heute gönnte er sich und seiner 9b den Film „Dead Man Walking“ – ein fabelhafter Streifen, um über das Thema Todesstrafe ins Gespräch zu kommen. Fragte sich nur, ob der Medienwagen dieses tatsächlich zuließ und ob die Schüler wirklich die Konzentration aufbrächten, sich auf die ethische Diskussion im Anschluss daran einzulassen. Denn es war ihm schon häufig passiert, dass gerade unter den Schülern die Zustimmungsrate vor dem Betrachten des Films relativ hoch gewesen war. Aber nachher erforderte es schon großes pädagogisches Geschick, die Mannschaft zu fundierten eigenen ethischen Urteilen zu führen. Winter freute sich auch ein wenig auf das Wiedersehen mit Sean Penn und Susan Sarandon, die dafür einen Oscar bekommen hatte. Auch wenn der Film längst in die Jahre gekommen war – das Minen- und Schauspiel der beiden Filmstars zog ihn immer wieder neu in den Bann. Und er wusste, dass Susan Sarandon für diesen Film sogar einen Ehren-Doktor der Theologie von der Universität Chicago erhalten hatte. Ein theologischer Doktorhut für eine Hollywood-Diva - so etwas war wohl nur in Amerika möglich!
3.
„Hallo Dieter, hier Bert. Hast du das heute Morgen in den Lokalnachrichten von RNR gehört, was Bettermann angeblich gesagt hat?“
Am anderen Ende der Leitung war Erstaunen in der Stimme zu hören.
„Wie unser SUP bei RNR in den Nachrichten? In der Radio-Morning-Show? Was soll er denn gesagt haben?“
„Wir Rheinstädter sollen uns ‚mal endlich dran machen unsere überflüssige Garderobe loszuwerden. Sprich - mindestens eine Kirche schließen.“
„Was? Ich fass es nicht! Der spricht in der Öffentlichkeit von Kirchenschließung in Rheinstadt! Er, der oberste Kirchenfunktionär, unser großer Oberseelsorger!“ Dieter Menge, inzwischen ergrauter, mit leichtem Schmerbauchansatz ausgestatteter Vollblut-Theologe und Pastor am Bonhoeffer-Gemeindezentrum in Rheinstadt-Niederberg, redete sich in Rage. „Der will eindeutig Stimmung machen und uns Stadtprotestanten gegen die armen Landpfarrer und -pfarrerinnen ausspielen. Das alte Spiel geht wieder los. Wir sollen abgeben, da wir ja noch mehrere Kirchen haben und auf dem Lande soll die Kirche im Dorf bleiben! Was denkt der sich bloß!“
„Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, aber wir müssen unbedingt zu einer gemeinsamen Linie unter uns Rheinstädtern kommen!“, forderte Winter.
„Ansonsten sehe ich`s schon kommen, dass meine Erlöserkirche auf der Abschussliste steht. Liegt doch auf der Hand, wenn es nur noch um die Kosten-Nutzen-Rechnung geht. Die Stadtkirche ist ja unantastbar, das Bonhoeffer-Gemeindezentrum gerade modernisiert, aber die Erlöserkirche, die ja bald eine Generalüberholung bräuchte, die mit dem morbiden Charme der 30er Jahre … die ist ja angeblich einfach nicht mehr … so relevant!“
„Komm Bert, lass uns mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Da wird ja auf jeden Fall zunächst im Presbyterium besprochen, was zu tun ist. Und da kann er noch so viel reden, der Bettermann. Wir halten doch erst ‚mal zusammen und lassen da nichts anbrennen.“
„Dein Wort in Gottes Ohr, Dieter, aber du weißt ja, wie schnell die Stimmung auch im Presbyterium kippen kann, wenn der SUP sein Lied singt! Wir müssen uns einfach eine neue Strategie überlegen. Jetzt, da in aller Öffentlichkeit darüber gesprochen wird.“
„Klar, wir reden erst mal intern – und gehen die Sache in Ruhe an. Wir setzen kurzfristig ‚ne Kollegenrunde an. Wird schon Bert!“
„Ich werde die Angelegenheit auf jeden Fall im Presbyterium zur Sprache bringen und möchte, dass wir hier an einem Strang ziehen, Dieter!“
„Bert, ich bin voll bei dir. Wir werden schon eine Lösung finden!“
„Okay, Dieter, ich muss hier weiter die Jugend bilden – bis dann!“
Bert Winter ließ sein Handy in der Jackentasche verschwinden und packte seine Unterrichtsmaterialien zusammen. Jetzt folgte noch „Amos und seine Sozialkritik“ in der 7a und anschließend „Das Regierungsprogramm Jesu – die Bergpredigt“ in der 9d.
Noch ein Schluck aus der Kaffeetasse und dann hinein ins Vergnügen!
4.
„Hi Dad! Ich bin’s, deine Liebste von allen!“
Franziska Winter, die 17-jährige Pastorentochter und Wirbelwind in Person, kam von hinten um die Ecke angeschossen, als Winter gerade dabei war, den Haustürschlüssel aus der Geldbörse herauszukramen. Winter ließ sich von ihrem Lächeln sofort anstecken und umarmte sie. Sein Blick streifte über ihr geschmackvolles Schuloutfit an diesem sonnigen September-Tag. Enganliegende Jeans, eine flotte Bluse mit nett drapiertem Halstuch, dezent geschminkt. Sie war wirklich auf dem Weg, sehr guten Geschmack zu entwickeln.
„Hey Große, toll dich zu sehen! Bist du direkt von der Schule zu mir?“
„Ja, Dad, ich würde ganz gern mit dir reden!“
„Schön! Hast Du Lust, mit mir zusammen ein Essen zu zaubern.“
„Gerne, hast du denn was Vernünftiges da?“
„Ich denke, es wird sich finden.“ Und mit diesen Worten schloss er die Tür mit einem Grinsen im Gesicht auf, denn er wusste, dass der Kühlschrank nicht besonders üppig ausgestattet war. Aber egal wie spartanisch das Essen auch immer ausfallen sollte, dieser Besuch war ihm sehr willkommen.
Eine halbe Stunde später brutzelte eine Gemüsepfanne mit Bratkartoffeln auf dem Herd und während des Essens erwischte sich Winter bei dem Gedanken, dass die Welt es heute doch noch gut mit ihm meinte.
Schließlich rückte Franziska Winter mit ihrem eigentlichen Anliegen heraus: „Dad, ich brauch deine Hilfe für ein Projekt, das wir uns in Geschichte vorgenommen haben. Es geht um die Zeit vor und nach der Wende. Wir sollen hierzu unter anderem biographische Statements und Fotos sammeln. Hast Du vielleicht noch authentische Fotos aus dieser Zeit, die besonders typisch sind? Ich dachte mir, weil du doch damals auch bei der einen oder anderen Friedensdemo dabei warst oder bei verschiedenen Kirchentagen…“
„Hmh …,“ Bert Winter überlegte.
„Wenn ich mich recht erinnere, könnte es noch eine Kiste auf dem Speicher geben, wo ich etwas finden könnte. Allerdings – ich brauche ein wenig, um mir Orientierung zu verschaffen. Es ist einfach noch vieles nicht aufgeräumt. Seit dem Um- und Auszug vor zwei Jahren. Na ja, du kennst mich ja. Es gibt eben doch so einiges, was im Laufe der Zeit liegengeblieben ist.“
„Kannst du mir das vielleicht möglichst bald raussuchen, liebster Papa?“
„Ja, mache ich, sobald ich Zeit finde. Das hat natürlich Top-Priorität, Franzi!“ Und in diesem Moment begann sein Smartphone zu vibrieren. Winter ignorierte es zunächst, bis er merkte, dass jemand wohl seinen Sermon auf dem AB hinterlassen hatte. Er konnte nicht umhin, ihn sich sofort anzuhören. Eine wohlbekannte sonore Stimme sagte: „Hier Bettermann, lieber Kollege, darf ich Sie bitten, mich möglichst bald zurückzurufen? Ich bin jetzt unter folgender Nummer erreichbar …“ Und damit war die nette Unterhaltung von Vater und Tochter schneller beendet als gedacht.
5.
„Du glaubst es nicht! Es ist nicht zu fassen! Bettermann …“
„Komm, Bert, das ist alles noch in der Schwebe …“
„Nein, der meint es wirklich ernst. Wir sollen hier in Rheinstadt möglichst zügig zu einer Entscheidung …“
„Ja, Bert, ich habe verstanden, wir setzen uns in Ruhe mit allen zusammen und dann kommt alles auf den Tisch und dann …“
„Dieter, es ist wirklich an der Zeit, dass wir miteinander, wir alle miteinander …“
„Ja, Bert, ich muss jetzt aber zum nächsten Taufgespräch.“
Und damit war Bert Winter allein mit der neuesten Sorge, die ihn jetzt voll erwischt hatte. Der Superintendent hatte ihm in einem längeren Telefonat die neuesten finanziellen Kennzahlen aus der Landeskirche herunter gebetet. Und die wären wie nach den immer wieder heraufbeschworenen demographischen Effekten tatsächlich deutlich schlechter ausgefallen. Warum gab es gerade unter den Christenmenschen eine so geringe Geburtenrate und eine so hohe Überalterung!
Auf die Gemeinden kämen demnächst weitere Kosten zu. Die Pensionen für die künftigen Ruheständler seien in Gefahr. Ja auch seine Pension wäre davon betroffen. Eine neue Rücklage müsse dringend aufgefüllt werden, sonst könne die Kirche ihren Verpflichtungen als Dienstgeber nicht mehr nachkommen. Und das wäre doch sicher auch nicht in seinem Sinne, wenn er bei seinem Eintritt in den Ruhestand nicht mehr eine angemessene Pension bekäme. (Oder hatte er das noch bürokratischere Wort „Alimentation“ gewählt?) Nun müsse insbesondere die Gemeindeleitung in Rheinstadt eine Entscheidung treffen, ob und wie die drei Kirchen noch zu halten seien bzw. auf welche man am ehesten verzichten könne. Er könne sich alternativ zu einem sicher schwer vermittelbaren Abriss einer Kirche auch sehr wohl eine „verträgliche Umwidmung“ vorstellen. Es gäbe doch zum Beispiel immer mehr Kolumbarien, also so eine Art Friedhofskirche mit Urnenbelegung. Da gäbe es doch in anderen Städten schon ganz gute Beispiele.
Und in diesem Moment musste Bert Winter gewaltig schlucken: „Meine Kirche ein überdachter Friedhof?“ Fast hätte er „nur über meine Leiche!“ gesagt, mühte sich aber dann das Gespräch künstlich abzukürzen mit dem Hinweis, dass er einen dringenden Termin habe.
„Kolumbarium, Panoptikum, Brimborium!“ – Das alles kommt für meine Kirche nicht in Frage! Ich glaube, ich spinne!“ kam ihm in den Sinn.
Winter musste sich angesichts solcher Bilder innerlich schütteln. Sie standen in völligem Gegensatz zu den vielen guten Erinnerungen, die er bislang mit seiner Erlöserkirche verband. Wie sollte das gehen: keine Trauungen und Taufen mehr, keine Konfirmationen, kein Weihnachten und Ostern in der Kirche, die ihm wie ein „gemütliches Wohnzimmer Gottes auf Erden“ ans Herz gewachsen war?
Beim Blick auf das Handy fiel ihm ein, dass er noch rasch an seiner Beerdigungsansprache arbeiten musste. Werner Schlottermann hatte im Alter von 84 Jahren für immer die Augen zu gemacht. Inzwischen war die Urne mit seiner Asche nach nur wenigen Tagen im Beerdigungsinstitut angekommen. Die Trauerfeier sollte in eineinhalb Stunden beginnen. Winter ging noch einmal die Ansprache durch, die er schlussendlich nach dem Bibelwort: „Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir,“ gestaltet hatte. Das schöne tröstliche Wort aus dem Prophetenbuch Jesaja. Ob es Werner Schlottermann auch gefallen würde? Auf jeden Fall wollte Winter der Witwe und den Kindern Mut und Hoffnung zusprechen und sie bitten, diesen Abschied anzunehmen. Denn im Trauergespräch zuvor war ihm mal wieder deutlich geworden, wie unterschiedlich Menschen mit dem Tod eines Angehörigen umgehen. Während der Sohn („es war doch eine Erlösung für ihn!“) fast mit Erleichterung den letzten Atemzug des leidenden krebskranken Vaters für sich erlebt hatte, bekam die greise, von Gewichtsverlust gezeichnete Witwe, zunächst kaum ein Wort heraus. Nur zum Ende wurde sie gesprächiger und sagte schluchzend: „Wir haben uns immer bis zuletzt gut verstanden und niemals schlimm gestritten.“
Winter musste an seine Frau denken, mit der er eine intensive Streitkultur gepflegt hatte. Leider am Ende deutlich zu intensiv, wie er sich inzwischen selbst eingestehen musste.
Diese Beerdigungen waren für Winter von jeher schon eine Sache mit gemischten Gefühlen gewesen. Er erinnerte sich noch daran, dass er als junger Theologiestudent den größten Bammel vor seiner allerersten Trauerfeier hatte. Wie sollte er die rechte Haltung bewahren angesichts des todtraurigen Umstands, von einem Verstorbenen Abschied nehmen zu müssen? Ihm war regelrecht mulmig zumute bei dem Gedanken, ein falsches Wort zu sagen oder eine falsche Geste zu wählen. Wie leicht konnte man in einer solchen Situation jemanden verletzen und irritieren oder wie schnell war ein falsches Wort gesagt, falls es im Trauergespräch zu Missverständnissen gekommen war?
„Achte immer besonders darauf, dass du auf jeden Fall den Namen des Verstorbenen und die der Angehörigen richtig nennst und aussprichst“, hatte ihn noch sein Mentor in den 90er Jahren ermahnt. Nichts sei schlimmer, als gerade hier einen Fehler zu machen. Dabei war es nur allzu menschlich, dass ihm im Gemeindealltag viele der zweieinhalbtausend Gemeindeglieder gänzlich unbekannt geblieben waren bis zu dem Tag, wo es um die Trauerfeier ging. Auch die meisten älteren Seelen seiner Gemeinde hatten zwar „ihre“ Erlöserkirche als einen wichtigen Ort in ihrem Leben begriffen und waren auch immer wieder gern bereit zu besonderen Anlässen dort einzukehren. Aber ein regelmäßiger Kirchgänger war mittlerweile eine genauso vom Aussterben bedrohte Spezies wie die der Theologen und Theologinnen, die inzwischen auch so ihre Nachwuchsprobleme hatten.
Eine halbe Stunde vor der Trauerfeier stieg die Hektik bei Winter spürbar an. Bis endlich der Talar, das Beffchen, der Autoschlüssel, die Schuhe (hoffentlich gut gewienert), die Notizen und die Bibel gefunden und an Ort und Stelle waren, wurde es langsam Zeit, denn die Organistin musste vorher auch noch wegen der Lieder verständigt werden. Winter ermahnte sich selbst zur Eile: „Werner Schlottermann, ich komme!“
6.
In der Mittagspause nach einem seiner üblichen Nickerchen auf dem Sofa begab sich Winter auf den Weg über die knarzige Treppe des alten Pfarrhauses aus den 30er Jahren in den zweiten Stock. Er öffnete die alte Tür zum Dachboden, die nur mit einem heftigen Ruck den Blick auf den alten Speicher freigab. So voll Staub und auch marode war er, weil er immer noch im Ursprungszustand der frühen 30er Jahre war. Es war kalt und zugig dort oben. Man blickte direkt auf die Holzbalken und Dachpfannen über sich. Nirgendwo gab es das heute im Neubau omnipräsente Dämmmaterial irgendwelcher Art. Ein Grund, warum die Heizkosten bei ihm immer noch überdurchschnittlich hoch waren, fiel ihm ein, obwohl er selbst doch viel klimafreundlicher sein wollte.
Allein unter Dachziegeln und Dachsparren konnten sich Spinnweben und Staubflocken auf bestem Wege ausbreiten und das hatten sie inzwischen auch hinlänglich getan. Winter seufzte innerlich: „Wieder ein Ort, der nach Veränderung schreit!“
Langsam arbeitete er sich in dem staubigen Durcheinander von Möbeln, Kisten und Koffern vor, um zu einem Regal zu gelangen, wo er die alten Fotoalben vermutete.
Tatsächlich, da schienen sie auch unter einer beachtlichen Staubschicht begraben zu sein (hier musste er seiner Ex-Frau einmal recht geben – alles hätte luftdicht in Kartons verpackt sein sollen). Als er gerade einen Blick hineinwerfen wollte, sah er im Halbdunkeln hinter dem Regal ganz im äußersten Winkel des Speichers etwas Größeres, Kompaktes unter den Dachsparren liegen. Das war ihm bei seinen seltenen Gängen auf den Dachboden bislang nie aufgefallen. Wie denn auch, da er ja erst vor kurzem eine leuchtstärkere Birne in die alte Lampenfassung eingesetzt hatte. Und besonders genau hatte er den Speicher seit dem Einzug damals auch noch nicht inspiziert bei all dem Tohuwabohu zwischendurch. Winters Neugierde ließ ihn das Album beiseite legen und er krabbelte sich langsam in die versteckte Randzone zum vermeintlichen Gegenstand voran, bis er schließlich durch Tasten herausfand, dass es sich dabei offenbar um einen kleinen Koffer handeln könnte. Und - wie er langsam erkannte - um einen von älterer Machart.
Dann erwischte er den Griff und zog ihn zu sich. Winter wusste sofort: Es konnte nur ein wirklich alter Koffer sein – womöglich Kriegs- oder sogar Vorkriegszeit. Kleines Format, bräunliche Schale, offenbar mit viel Handarbeit mit Leder und ohne Kunststoff hergestellt. Er hob ihn hoch, schüttelte ihn leicht, putzte ihn grob ab und stellte ihn ins Licht. Wie gesagt: Schwer und groß war er nicht, eher handlich. Man hatte ihn ganz verkeilt unter den Dachsparren im dunklen Winkel versteckt. Offensichtlich befand sich etwas in ihm, was sich nicht nach Kleidung anfühlte, wie Winter beim Anheben registrierte. Ihm kam es so vor, dass es sich eher um Schriften, Dokumente oder Bücher handeln musste.
Wem konnte er ursprünglich gehört haben? Winter dachte nach. Möglicherweise einem Vorgänger im Amt, der in diesem Pfarrhaus gewohnt hatte oder einem anderen ehemaligen Bewohner?
Winter überlegte nicht lange und versuchte den Koffer zu öffnen.
Die Verschlüsse gingen nicht ohne weiteres auf, das war bald klar. Winter entschied sich Werkzeug aus dem Keller zu organisieren, um damit der Sache endgültig auf den Grund gehen zu können.
Nach zehnminütigem Traktieren mit Hammer und Schraubenzieher machte es Klack. Das Schloss gab nach und Winter blickte zum ersten Mal in einen Schatz, der wohl schon seit etlichen Jahrzehnten unberührt geblieben war. Einige alte Bücher lagen obenauf. Winter hob sie vorsichtig heraus und erkannte theologische Literatur sowie einige alte Fachzeitschriften aus den 20er und 30er Jahren. Ein Antiquariat würde sich sicher über das ein oder andere freuen, aber kostbar war es nicht. Aber da war noch etwas anderes ganz unten … ein Bündel Papier mit fast verblichener Handschrift beschrieben, aber doch noch gut lesbar. Es kamen schließlich auch noch ein paar Briefe in Sütterlin-Schrift zum Vorschein. Winter stutzte einen Moment. War das nicht zu privat, diese zu lesen? Aber über 70, 80 Jahre sind es her, dass diese Briefe zur Privatsphäre eines Menschen gehörten … Und dann entdeckte er eine Art Buch, dessen Einband besonders fest gebunden war, aber keinen Titel trug. Er nahm es vorsichtig in die Hand und blies den Staub fort, der sich in einer mächtigen Wolke in alle Winkel des Dachbodens verzog.
Schon beim ersten Aufklappen stach ihm eine immer wiederkehrende, gleiche akkurate Sütterlin-Handschrift entgegen sowie Datumsanzeigen am Rand, die offenbar einer chronologischen Ordnung folgten. Feuchtigkeitsschäden zeigten sich auch im hinteren Teil. Kein Zweifel: Bert Winter hielt das Tagebuch eines Menschen in der Hand, der vor vielen Jahrzehnten diese Eintragungen gemacht hatte. Aber von wem konnte es stammen? Ihm gingen die Namen seiner Vorgänger durch den Kopf.
War es vielleicht das Tagebuch von Wilhelm Ortmann, dem ersten Pfarrer der Gemeinde, der noch den Kirchenbau der Erlöserkirche mit initiiert hatte oder von einem seiner Nachfolger – Werner Meierkord – ein Pfarrer, den noch viele als traditionell und volksverbunden in Erinnerung hatten und von dem er sich das ein oder andere Döneken immer mal wieder bei den Seniorenbesuchen anhören durfte.
Langsam blätterte er in dem Tagebuch, bis er schließlich an einer Eintragung vom 21. November 33 hängen blieb. Mühsam entzifferte er die Worte:





























