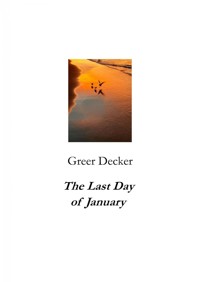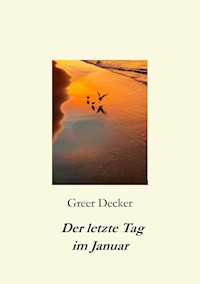
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist Ende August 2019. Als die Demenz ihrer Mutter, Joan, weiter fortschreitet, beschließt Sarah eine Stelle als Lehrerin in ihrer Heimat Suffolk anzunehmen, um sich besser um sie kümmern zu können. Doch dort angekommen vermisst sie schnell das kosmopolitische London, wo sie dreißig Jahre lang gelebt hat. Außerdem hadert sie noch über den Brexit und ist etwas besorgt, dass sie als Remainerin in einer überwiegend Leave-wählenden, konservativen Provinz schwer Anschluss finden wird. Außerdem ist das Zusammenleben mit ihrer Mutter und der Umgang mit deren Mutters Krankheit deutlich herausfordernder als erwartet. Sarahs Schwester Rachel und ihre Familie leben in Berlin. Es kommt zu Spannungen zwischen den Schwestern, als sie sich über die Pflegebedürftigkeit ihrer Mutter verständigen müssen. Die Arbeit an der neuen Schule gefällt Sarah und sie freundet sich rasch mit einem ihrer Kollegen an. Nach einigen Wochen verschwindet eine ehemalige Schülerin der Schule und Sarah beschließt, die Sache nachzugehen. Auch mit der Nachbarin von Joan bahnt sich schnell Ärger an. In dem kleinen Dorf auf dem Land gibt es also auch durchaus größere Herausforderungen. Sarahs Leben in den fünf Monaten bis zum Brexit-Tag entwickelt sich zunehmend komplexer statt ruhiger. Wird sie diese Herausforderungen meisten und ihr Glück auf dem Land finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Texte: © Copyright by Greer DeckerUmschlaggestaltung: © Copyright by Greer DeckerTitel des Originals: »The Last Day of January«
Verlag:Greer Decker Altenburger Straße 12
1
Wäre es nach mir gegangen, wäre ich größer, in einer glücklichen Beziehung und hätte Kinder. Und der Planet wäre noch zu retten. Ich wäre dennoch bei der ersten sich bietenden Gelegenheit vom ländlichen Suffolk nach London gezogen, wie der Rest meiner Schulkameraden. Ich hatte diese Entscheidung nie bereut, genauso wenig wie Lehrerin geworden zu sein. Meine Zuneigung für London war in der Tat so groß, dass ich keine Sekunde mehr daran dachte, von dort jemals wieder wegzuziehen.
Bereits als Zehnjährige hatte London bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. An einem kühlenFrühsommertag 1979 hatte ich mit meiner Familie in einer zweistündigen Zugfahrt die erste Reise in diese so bunte und lebendige Welt angetreten. Meine Nase fest an das Zugfenster gepresst, starrte ich auf die ziegelroten Reihenhäuser, welche die Bahngleise auf den letzten Kilometern nach Liverpool Street Station säumten, manche schienen zum Greifen nah. Ich erinnere mich an den Schmutz in den Hinterhöfen, aber auch an viele bunte Eindrücke. In einer Häuserlücke sah ich einen kleinen Spielplatz voller Leben. Einige kleine Kinder kreisten in schwindelerregendem Tempo auf einem regenbogenfarbigen Drehkarussell. Wenig später in Covent Garden war ich fasziniert von den Straßenkünstlern und den vielen Punks. Einer grüßte mich freundlich mit einem Peace Zeichen. Nach einem kleinen Rundgang zu einigen Sehenswürdigkeiten besuchten wir ein beliebtes italienisches Restaurant im West End. London zog mich an diesem Tag für immer in seinen Bann; ich beschloss, ein Teil davon zu werden.
Zwölf Jahre später wurde London dann tatsächlich mein Zuhause. Als ich zwei Jahre als junge Lehrerin in dieser Stadt überstanden hatte, stand für mich fest, dass ich für immer hierbleiben würde. Über diesen festen Entschluss habe ich sogar meinen Friseur offiziell beim nächsten Haarschnitt in Kenntnis gesetzt. Dann - im Alter von fünfzig Jahren - habe ich diese Stadt verlassen.
Sonntag, den fünfundzwanzigsten August 2019, London lag jetzt schon hinter mir. Als ich auf der A12 Richtung Suffolk fuhr, bemerkte ich die ersten Anzeichen des Spätsommers. Der Himmel sah weniger sommerlich blass aus, sondern strahlte tiefblau. Die liebliche Landschaft passte perfekt zu meiner Stimmung, bis ich in eine gewisse Nachdenklichkeit verfiel. Ich wechselte die Radiostation von Klassisch auf Soft Rock, um mich vor der aufkommenden Melancholie zu bewahren. Ich fragte mich, was ließ ich nun zurück, was würde kommen?
Ich fuhr an einer Werbetafel des Tierparks in Colchester vorbei und musste an eine Werbetafel auf der stark befahrenen M40 denken, die mich vor über drei Jahren, im Frühjahr 2016, ziemlich erschüttert hatte. Diese Fremdenfeindlichkeit auf dem Werbeträger hätte mich damals schon erahnen lassen sollen, wohin wir uns einen Monat später mit dem Brexit-Referendum bewegen würden. Nach einer Welle von öffentlicher Empörung in den Medien wurde die Tafel kurz darauf wieder abgehängt. Damals hatte ich nach dem Namen der nächsten Ausfahrt Ausschau gehalten, um zu wissen, wo ich meinen Unmut verorten konnte.
Ende Mai war ich wieder auf der M40 auf dem Weg zu Dorothys Geburtstagsfeier, als ich mich entschied, doch das Angebot für eine befristete Stelle an einer Schule in Suffolk anzunehmen. Eigentlich fühlte ich mich dieser Region nur noch wenig verbunden, aber es ermöglichte mir, bei meiner dreiundachtzigjährigen Mutter sein zu können. Ach, da fällt mir noch was ein: Wäre es nach mir gegangen, hätte meine Mutter keine Demenz bekommen.
Ich freute mich zudem auf die Chance eines Tapetenwechsels, auch wenn das Muster vermutlich etwas eintönig ausfallen könnte. Wahrscheinlich zog mich eine gewisse Neugierde zurück zu meinen Wurzeln. Dieser Umzug ließ mir auch die Gelegenheit zu reflektieren, welche Gründe mich damals zu einer Art Flucht nach London bewegt hatten und ob ich mich heute auch noch einmal so entscheiden würde. Dann gab es das Thema Brexit, das in London stärker präsent schien. Dort hatte ich nur zwei Menschen getroffen, von denen ich definitiv wusste, dass sie für Brexit gestimmt hatten. In Suffolk würde ich vermutlich mehr Befürwortern begegnen.
Vor ziemlich genau drei Jahren traf ich einen Typen vom Militär, woran mich das jetzt auf der M12 vor mir fahrende Militärfahrzeug schlagartig erinnerte. Es war bei der Tauffeier von Nigel und hinterließ mich zornig, ratlos und auch traurig.
»Was haben wir denn jemals von dieser Scheiß-EU gehabt? Das war unser Untergang und es ist höchste Zeit, dass wir es denen auch ein für alle Mal klar zeigen«, sagte er lautstark zu mir, als wir am Buffet unsere Teller mit mediterranen Vorspeisen beluden.
»Wie bitte? Wie kannst du denn so was sagen? Unser Untergang?« Ich verzog mein Gesicht. »Die EU ist eine Gemeinschaft, die Frieden und Wohlstand anstrebt.«
»Gemeinschaft?! Du verarschst mich jetzt aber, oder? Die stecken sich unser Geld ein und ärgern uns dann mit all ihren beschissenen sinnlosen Regeln und Vorschriften.«
»Dass die UK aktiv an all diesen Regelungen genauso mitgearbeitet hat und auch vom Binnenmarkt stark profitiert, ist dir wohl nicht bewusst?«
Innerlich verdrehte ich die Augen. Schon wieder einer, der sich von der Pro-Brexit-Presse und den verlogenen Plakaten der UKIP hatte manipulieren lassen.
Ich ärgere mich jetzt noch, weil mir seine Argumente so völlig unüberlegt vorkamen und er dann auch noch so persönlich wurde, so dass die neben uns stehenden Gäste verlegen wegblickten. Auch seiner Frau schien diese Szene sichtlich unangenehm zu sein, sie hatte allerdings auch nicht den Mut, ihm zu widersprechen. Wahrscheinlich war sie des Themas inzwischen auch überdrüssig. Mein Unverständnis über seine Argumentation beunruhigte mich aber weniger als meine schlechte Reaktion. Diese Konfrontation hatte nicht nur damals die Stimmung an unserem Tisch komplett verdorben, sie beschäftigtmich heute noch, drei Jahre später. Sie ließ in mir ein Stereotyp des Brexiteers erwachsen, welche in dieser Vereinfachung sicherlich zu kurz gegriffen war.
Vor der Abzweigung der A120 zum Stansted Airport musste ich an meine Schwester Rachel und ihren Mann Peter denken. Von dort flog ich Ende Juli für zweieinhalb Wochen nach Berlin, um sie und ihre Familie zu besuchen. Ich hatte einen Mieter für meine Londoner Wohnung in Wandsworth gefunden, alle Reparaturen erledigt und die Räume komplett gestrichen. Alles war in Kisten verpackt oder geregelt. Ich konnte beginnen, mich zu entspannen.
Der Urlaub mit Rachel, Peter und den Kindern, Anna und Tim, war – wie die Male davor – für mich sehr erholsam. Die Zeit, die wir gemeinsam verbringen konnten, war leider so selten geworden und deshalb so kostbar. Ich fand das Berliner Lebenstempo deutlich entspannter als in London. Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs, meistens ging es zum Wannsee oder an den Schlachtensee, wo es keine »Baden verboten« Schilder gab und die Temperaturen auch zum Baden einluden, also stürzten wir uns ins Wasser und genossen die Sommertage. Auf dem Heimweg pflegten wir im Café Venezia auf ein Eis einzukehren. Wir saßen oft bis spät in der Nacht auf der Terrasse zu Hause, um bei einer Flasche Wein zu plaudern. Manchmal sprach ich mit Anna und Tim auf Deutsch. Ich liebte es, meine eingerosteten Deutschkennt-nisse an Anna auszuprobieren, und sie liebte es, mir coole neue Wörter beizubringen und meine schreckliche Grammatik zu korrigieren.
Diesmal reisten wir zusätzlich für ein paar Tage nach Prag und Wien. Unterwegs genossen wir die felsige Landschaft der Sächsischen Schweiz südöstlich von Dresden, dann führte uns die Route über die offene Grenze nach Tschechien und durch die einsamen Landschaften Böhmens nach Prag. Die hübsche Altstadt war durchaus touristisch geprägt, aber nicht so überlaufen, wie einige gemeint hatten. An die Menschenmassen, die sich durch enge Gassen wälzten, war ich von London ohnehin gewöhnt. Auf Wunsch von Anna und Tim fuhren wir danach weiter nach Österreich. Sie hatten kürzlich eine Netflix-Serie gesehen, die in Wien spielte. Zwischen den Besuchen der Kaffeehäuser besichtigten wir das Schloss Schönbrunn und machten einen Spaziergang durch den Sankt Marxer Friedhof, wo wir einige Gräber von berühmten Personen entdeckten.
Zurück in Berlin verbrachte ich mit Rachel und Peter die meisten Abende gemeinsam mit ihren Freunden. Sie diskutierten gerne. Meiner Erfahrung nach war die deutsche Diskussionskultur vergleichsweise offen und dafür manchmal etwas schwermütig, während die britische Diskussionskultur sich eines humorvollen Stils bediente und kontroverse Themen eher vermied. Dabei kam auch das Thema Referendum immer wieder zur Sprache.
»Glaubst du Sarah, dass es wirklich zu einem EU-Austritt kommt? Ich kann mir das nicht vorstellen.«
»Ich denke, ja, leider.«
»Aber die Briten sind doch sonst so pragmatisch, oder? Das ist doch völlig verrückt. Warum tun sie das?«
»Ich denke, da gibt viele Gründe. Politische, historische, geografische, wirtschaftliche. Und eine clevere Kampagne der Brexit-Unterstützer. Die Leute wurden von denen bewusst in die Irre geführt, mit falschen Fakten. Es wurde einfach mit irgendwelchen Summen argumentiert, welche das Königreich in die EU einzahlen muss.«
»Ja. Das habe ich auch gehört.«
»Wer hat denn überhaupt für den Brexit gestimmt? Ist es so wie hier bei den AfD-Wählern? Hast du schon von der AfD gehört? Das ist eine sehr rechte Partei. Sie ist schrecklich. Waren es eher die Leute aus Nordengland?«
»Nein, es gab so viele Faktoren: soziale Schicht, Bildung, Alter.«
Auf der anderen Seite des Tisches lenkte uns jemand mit einer humorvollen Zwischenbemerkung ab und zog die Aufmerksamkeit auf sich – worüber ich erleichtert war. Wären wir bei dieser Diskussion weiter in die Tiefe gegangen, hätte er vielleicht irgendwann bedauert, mich gefragt zu haben.
Rachel war erstaunt, dass ich freiwillig mein Leben in London gegen ein Leben in der Provinz eintauschen würde. Natürlich war sie auch froh, damit Mutter in meiner Nähe zu wissen.
»Wie du eine Weltstadt für dieses kleine Kaff verlassen kannst, verstehe ich nicht, vor allem, wenn der Brexit kommt.«
»Ich weiß, aber was ist mit Mum?«
»Das stimmt natürlich. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du dich um Mum kümmern willst. Und wenn dir in Suffolk die Decke auf den Kopf fallen sollte, bist du bei uns natürlich stets willkommen. Berlin ist zwar auch nicht der Nabel der Welt, aber es kann dir definitiv mehr bieten als das Post-Brexit-England.«
Ich lachte. Das stimmte. Suffolk würde eine Umstellung sein. Aber die Stelle war ohnehin auf ein Jahr befristet. Das war mir ganz recht. In dieser Zeit konnte ich eine geeignete Versorgung für meine Mutter finden und nebenbei meine Vorurteile über die ländliche Bevölkerung überprüfen. Naja, und vielleicht würde ich sogar wieder einen Partner finden. Ich lebte jetzt seit fast zwölf Jahren allein, nachdem zwei Beziehungen gescheitert waren. Ich konzentrierte mich in London eine Weile mit großer Energie darauf, doch noch den richtigen Menschen für mich zu finden, bis ich dann schließlich beschloss, mich einfach auf das Schicksal zu verlassen. Für Kinder war es nun zu spät, aber die Vorstellung von einem Seelenverwandten, mit dem ich gemeinsam alt werden konnte, hatte durchaus ihren Reiz.
Nach zwei Stunden Autofahrt von London erreichte ich Mutters Haus. Mum zeigte sich von meiner Ankunft völlig überrascht, obwohl wir am Tag zuvor darüber telefoniert hatten. Ich hatte sechs Umzugskisten, zwei Koffer und fünf Einkaufstüten im Auto. Bei der Ankunft umarmte ich sie - sie war in den Wochen, in denen ich sie nicht gesehen hatte, offenbar wieder kleiner und dünner geworden, und ihre Kleidung hing etwas lose an ihrem Körper.
Umgehend erzählte sie mir, dass neue Leute ins Nachbarhaus eingezogen seien, was sie mir bereits gestern ausführlich am Telefon berichtet hatte. Die neuen Bewohner waren ein Ehepaar mittleren Alters mit drei Kindern und zwei Hunden, die zumindest bisher wenig Lärm zu machen schienen. Gwyneth und Alfred, das ältere Ehepaar, das zuvor in dem Haus gewohnt hatte, hatte sie eigentlich recht gern gemocht - obwohl der Kontakt über Jahre nur aus entfernten Grüßen und den obligatorischen Weihnachtskarten bestanden hatte. Meine Mutter hatte mir letztes Jahr eher beiläufig erzählt, dass Alfred bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen sei. Er saß am Steuer, Gwyneth überlebte mit schweren Verletzungen. Kurz danach war sie in ein Pflegeheim gezogen und ich hatte schon länger vor, sie mit meiner Mutter zu besuchen.
Die neu eingezogene Familie hatte die Fassade des Hauses renoviert und schien ganz nett zu sein. Ich hatte sie einmal bei einem Besuch im Frühjahr gesehen, aber es ergab sich nie der richtige Moment sich vorzustellen. Mutter war neugierig, aber zu schüchtern, um selbst auf sie zuzugehen. Dann hatten sie Mutter jedoch etwas verärgert, weil sie die bisherige Hecke durch einen höheren, aber in ihren Augen weit weniger attraktiven Zaun ersetzt hatten, vermutlich wegen der Hunde. Das verdarb den Charakter der Straße, fand meine Mutter. Es gab Zeiten, in denen sie mit allen unkompliziert umging, aber in letzter Zeit wurde sie konsequent härter in ihren Urteilen.
Die Reaktion meiner Mutter auf meinenEinzug empfand ich als eher verhalten. Es herrschte Verwirrung bei ihr darüber, was um sie herum passierte, und die Aussicht auf Gesellschaft schien bei ihr erstmal keine richtige Freude auszulösen. Und was war mit all diesen Umzugskisten? Sie zog sich ins Wohnzimmer zurück, als ich die Kisten hereintrug und merkte, wie sie mich durch den dünnen Spalt der angelehnten Tür aufmerksam beobachtete. Sie war beunruhigt darüber, dass ich ihr hier alles durcheinanderbringen und ihre Routine stören könnte. Das war nicht meine Absicht. Ich stapelte die Kisten schnell an der Rückwand im großen Gästezimmer.
In den ersten Tagen war ich dann so intensiv mit dem Auspacken und den Vorbereitungen für meinen Neuanfang an der neuen Schule beschäftigt, dass ich Mutters Routine nicht groß störte. Bald wurde mir allerdings klar, dass es gar keine Routinen für sie gab. Abgesehen von den Essenszeiten waren ihre Tage praktisch leer. Den meisten Aktivitäten, die ihr früher Spaß gemacht hatten, zum Beispiel, Nähen, Zeichnen und Lesen, konnte sie nicht mehr nachgehen. Diese Erkenntnis war für mich niederschmetternd. Kurz nach meinem Einzug wurde mir klar, dass es gar nicht so ideal war, sie mehr als ein paar Stunden am Tag allein zu lassen.
Mutters Reaktion, als ich das Thema zaghaft ansprach, war große Irritation über meine Impertinenz.
»Natürlich schaffe ich das. Wie meinst du das? Ich habe immer allein gelebt. Was denkst du, wie ich all die Jahre zurechtgekommen bin? Ich bin doch nicht blöd!«
Ich hatte sie nie für blöd gehalten, ganz im Gegenteil. Trotzdem war es eine gute Frage, wie sie die letzten Jahre überhaupt allein gemeistert hatte. Wer stellt jetzt sicher, dass der Herd nach dem Kochen ausgeschaltet war oder dass sie in einem Notfall ungehindert aus dem Haus gelangen konnte? Es gab eine Zeit - nachdem bei ihr eingebrochen worden war - in der sie fast manisch sogar tagsüber alle Fenster und Türen verriegelt gehalten hatte. Gleichzeitig war sie ständig auf der Suche nach den passenden Schlüsseln derselben. Eine Alarmanlage kam nicht in Frage. Bereits die bloße Erwähnung einer solchen versetzte sie in Panik. Sie hatte Angst vor allem, was laut und elektrisch war. Dazu gehörte inzwischen auch ihr Telefon, durch das sie vor Jahren einen leichten Stromschlag bekommen hatte, als sie während eines Gewitters noch zu Zeiten kabelgebundener Telekommunikation am Fenster saß. Sie hatte dieses Ereignis eine Zeit lang erfolgreich verdrängt, aber jetzt war die Erinnerung wohl wieder da, und die Angst war umso intensiver.
Bereits nach drei Tagen bekam ich das erste Mal schon ernsthafte Zweifel, ob ich mit meinem Umzug das Richtige getan hatte. In London hatte ich mich nie allein gefühlt, immer war jemand für einen Drink und ein Lachen zu haben. Hier dagegen war die Nachricht des Tages höchstens die Entdeckung eines jungen Igels unter der Hecke in unserem Vorgarten.
Ich ging davon aus, dass es mir nach dem Schulanfang besser mit der Entscheidung gehen würde. Und ich freute mich auf gewisse Dinge in Suffolk: die liebliche Landschaft mit dem oft eindrucksvollen Himmel, der Weite, der leichte Küstenwind, lange Spaziergänge sowie das viel gemächlichere Lebenstempo. Und – so sagte ich mir – wenn der Schulalltag wieder anfing, würde eine gewisse Normalität für mich zurückkehren.
Am Donnerstag gingen wir zum Mittagessen zu Heartys, einem Hofladen mit einem Café. Das war derzeit Mutters Lieblingsausflugsziel, weil man dort immer einen Tisch bekam und – ganz wichtig - es ausreichend Toiletten gab. Das Essen war ganz nach ihrem Geschmack. Mir gefiel es dort auch, man saß gemütlich, und es gab eine schöne Auswahl an Käse und eine kleine Ecke mit Geschenken und Grußkarten. Ich erkannte die Geschäftsführerin und auch das junge Mädchen, das als Bedienung im Café arbeitete. Bei einer früheren Begegnung im Juni waren wir schon einmal kurz ins Gespräch gekommen. Mutter liebte es, auf ihren Ausflügen mit Leuten zu plaudern. Das Mädchen, Izabela, offenbar so um die neunzehn, war auffallend hübsch. Aufgrund ihres Akzentes und ihres Aussehens vermutete ich gleich, dass sie aus Polen stammte, was sich in unserem ersten Gespräch dann auch bestätigt hatte. Sie stammte aus Terespol, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Belarus, nur ein paar Kilometer von Brest entfernt. Meine Mutter und ich hatten noch am selben Tag zu Hause die Lage der Stadt im Altas nachgeschaut. Dies führte mir vor Augen, wie klein im Vergleich mein bevorstehender Umzug sein würde.
Izabela war mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester vor etwa drei Jahren nach England gezogen. Als meine Mutter sich erkundigte, ob es ihr in England gefalle, nickte sie, aber vermutlich mehr aus Höflichkeit als aus Überzeugung. Ihr Vater arbeitete auf dem Bau, war ein passionierter Fan des Fußballclubs von Norwich geworden und liebte die englischen Pubs. Ihre Mutter arbeitete im Krankenhaus und war begeistert von den Einkaufsmöglichkeiten der Stadt. Das Mädchen war sehr charmant und aufgeweckt, aber wirkte zugleich ein wenig unsicher. Sie fuhr sich mit der Hand immer wieder durchs Haar und hielt gelegentlich inne, um über ihre eigenen Worte nachzudenken. Sie hörte auch geduldig meiner Mutter zu, als sie von ihrem eigenen jüngsten Aufenthalt im Krankenhaus von Norwich erzählte. Meine Mutter konnte sich aber nicht mehr erinnern, warum sie eigentlich dort gewesen war.
Diesmal brachte uns ein junger, breitschultriger Mann das Essen. Mutter hatte sich für die Schweinekoteletts entschieden, ich für Fish und Chips. Auf dem Weg zurück in die Küche sprach er mit Izabela, die gerade die Tische auf der anderen Seite des Raums abwischte. Die Blicke der beiden ließen darauf schließen, dass die Stimmung zwischen ihnen nicht besonders gut war. Die hausgemachten Pommes schmeckten köstlich. Ich fragte meine Mutter, ob sie sich noch daran erinnern könne, dass wir mit Izabela im Juni schon gesprochen hatten. Ja, sie erinnere sich, die hat ihr oft die Haare gemacht. Sie verwechselte sie offenbar mit Dorota, die vor Jahren Mutters Haare in dem kleinen Friseursalon am Marktplatz geschnitten hatte und ebenfalls aus Polen stammte.
Mutter hatte Mühe, ihre Koteletts aufzuessen und wollte auch keinen Nachtisch. Früher hätte sie eine riesige Portion Dessert mit größtem Genuss verputzt. Als sie Messer und Gabel ablegte, ging ein Mann an unserem Tisch vorbei, gefolgt von einer großen, glamourös aussehenden Dame in einem für Heartys etwas zu ausgefallenen Outfit. Während ich den Mann zunächst nicht wahrgenommen hatte, erregte die Frau sofort meine Aufmerksamkeit. Auch Mutter schien die beiden zu beobachten. Ich saß mit dem Rücken zu ihnen, somit hatte Mutter den besseren Blick.
Izabela kam, um unsere Teller abzuräumen und blickte dann in Richtung des Tisches und man konnte ihr ansehen, dass sie sich über irgendetwas erschrocken haben musste. Rasch drehte sie sich wieder weg und eilte mit unseren Tellern zurück in die Küche. Sie stellte hastig die Teller auf einen Ablagetisch und verschwand eilig über eine Seitentür in den Garten. Eine andere Bedienung folgte ihr nach außen und man konnte durch das Fenster sehen, wie die beide sich aufgeregt unterhielten.
Mutter hatte es plötzlich sehr eilig zu gehen. »Wo sind denn hier die Toiletten?«
Als wir aufstanden, versuchte ich wieder einen Blick auf das Paar zu erhaschen, das offenbar in einen Streit miteinander geraten war. Die Frau wurde immer lauter. Mutter forderte mich ruppig auf, mich zu beeilen, drückte mir ihre Tasche in die Hand und stürmte aus dem Café. Ich folgte ihr hastig und musste verwundert feststellen, dass sie an den Toiletten vorbei direkt auf den Ausgang zusteuerte.
Ich holte sie ein und begleitete sie zu den Toiletten. Danach kehrte ich ins Café zurück, um Kuchen für später zu kaufen. Ich war neugierig, noch einmal das seltsame Paar zu sehen, das aber offensichtlich das Café durch den Nebeneingang verlassen hatte.
Als ich an der Theke des Cafés bezahlen wollte, kam Izabela mit weiteren Kuchenstücken an. Sie lächelte etwas verlegen, ihre schönen Augen waren noch leicht gerötet. Es tat mir leid, sie traurig zu sehen, auch wenn sie sich sichtlich bemühte, gefasst zu wirken.
An der Hauptkasse, als wir unsere Einkäufe aus dem Laden bezahlen wollten, bediente uns erneut der breitschultrige Mann. Er war schätzungsweise um die dreißig. Ein Blick auf das Teamfoto, das an die Wand hinter ihm geheftet war, verriet, dass er offenbar der Sohn der Bauernfamilie war, der dieser Laden hier gehörte. Als er mir meine Quittung überreichte, bemerkte ich einen Stapel Brexit-Party-Flugblätter, die neben der Kasse lagen.
Im Auto fing meine Mutter an, über das streitende Paar im Café zu sprechen.
»Hast du mitbekommen, wie sich die Frau aufgeregt hat? Schrecklich. So eine Szene.«
»Ja. Und sie war auch etwas stark aufgedonnert für einen Hofladen, meinst du nicht?«
»Ja, das stimmt. Aber der Mann hatte schönes rötliches Haar, genau wie mein Vater. Und sie war streitsüchtig wie meine Mutter. Armer Kerl.«
Ich konnte mir ein Lächeln über Mums schnelles Urteil nicht verkneifen. Ich hatte meine Großeltern nie kennengelernt.
2
Wenn ich mit Freunden und Freundinnen in London über meine Mutter sprach, sagte ich immer, sie hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit der Queen. Mit ihrer Statur, ihrem Verhalten und auch in ihrer Kleidungsweise, auch wenn ihr Budget vermutlich ein anderes Niveau hatte.
Sie ging nie ohne Hut aus dem Haus und hatte elegante Autofahrerhandschuhe aus feinem Leder, die allerdings fast immer unbenutzt im Handschuhfach lagen. Mutter hatte auch sehr feste Vorstellungen von Rocklängen und eine starke Abneigung gegen lässige Sprache und schlechte Tischmanieren und lehnte das Trinken direkt aus der Flasche kategorisch ab.
Sie war ein Teenager der 1950er Jahre, hatte eine strenge Erziehung über sich ergehen lassen müssen, und war modisch vor allem von ihrer wohlhabenden Tante inspiriert worden. Von ihr hatte sie die lebenslange Liebe zu klassischen Schuhen und Handtaschen, die sie geschickt mit entsprechenden Kleidern und Bleistiftröcken kombinierte. Eine Hose oder ein T-Shirt hatte sie nie besessen. Ihre Kleidung kannte zwei Kategorien – einmal die für die besonderen, die besten Tage und einmal die für den Alltag. Ihre Alltagskleidung trug sie auf dem Weg zur Post oder zum Supermarkt, die besseren Kleider zu Hochzeiten, Tanzbällen und Taufen. Leider gab es seit vielen Jahren immer weniger feierliche Anlässe für sie, abgesehen von Beerdigungen.
Meine Mutter wurde in Blackpool geboren, einer Stadt, der sie stets mit gemischten Gefühlen gegenüberstand. Für sie war die Stadt mittlerweile komplett heruntergekommen – eine verfallende Betonwüste ohne einen einzigen Baum. Aber sie kannte noch die Blütezeit Blackpools in den 1950er Jahren. In ihren eigenen Zwanzigern hatte meine Mutter auf Schwarz-Weiß-Fotos eine auffallende Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Deborah Kerr, die übrigens die letzten Jahre ihres Lebens in einem nahegelegenen Dorf in Suffolk verbrachte. Und Mutter hatte bei einem Liveauftritt 1953 Frank Sinatra im Blackpool Opera House gesehen, ebenso wie Vera Lynn und die Beverley Sisters.
Völlig beiläufig hatte sie kurz nach dem Tod von John Lennon erwähnt, dass sie auch die Beatles in der allerersten Zeit ihrer Karriere dort live gesehen hatte. Und sie war auch bei Freddie Frintons allererstem Dinner for One-Auftritt in Blackpools Winter Gardens im Jahr 1954 dabei gewesen. Rachel erzählte mir, dass Millionen von Deutschen genau diesem Sketch seit 1972 jeden Silvesterabend mit beinahe religiöser Begeisterung folgten, während die allermeisten Briten diesen Sketch überhaupt nicht kannten.
Ich lernte in den langen Gesprächen mit meiner Mutter in dieser letzten Augustwoche 2019 mehr über die Familien meiner Eltern als in den fünfzig Jahren zuvor. Die Heraus-forderung bestand darin, zuzuhören und sich nicht von den Wiederholungen irritieren zu lassen.
Das Zusammenleben mit ihr erwies sich anstrengender, als ich es erwartet hatte. Zwischen den Zeiten, in denen wir entspannt am Esstisch oder auf dem Sofa saßen und über vergangene Zeiten plauderten, merkte ich zunehmend besorgt, wie sehr sie mit den alltäglichen Aktivitäten überfordert war. Es war für sie zu einer sehr großen Aufgabe geworden, den bloßen Überblick über die Zeit und ihre persönlichen Dinge zu behalten. Sie fragte gern, ob wir schon gefrühstückt hätten und ließ dabei jede Tasse Tee kalt werden. Ihr Appetit war ohnehin sehr gering.
Das Langzeitgedächtnis meiner Mutter war noch in Ordnung, aber ihre Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen, war nahezu weg. Sie verbrachte die Hälfte des Tages damit, sich zu vergewissern, dass die ihre alltäglichen Gegenstände tatsächlich dort waren, wo sie von ihr vermutet wurden. Wenn wir unsere Tagesplanung abgeschlossen hatten, dann war diese innerhalb von zwei Minuten wieder komplett vergessen. Für Leute mit Erfahrung im Umgang mit Demenzkranken war dies völlig normal - für mich war es schwer zu ertragen.
Ständig fragte mich meine Mutter, ob es denn Rachel gut gehe. Sie hätte seit Monaten nichts mehr von ihr gehört. Und sie fragte, wie lange ich dann blieben wolle und wo ihre Sachen waren. Wo seien denn ihre Hausschuhe, ihr Lieblingsstift und ihre Bücher? Am Tisch sitzend leerte sie mehrmals am Tag ihre Handtasche, nahm ihre drei Brillenetuis heraus, kramte die jeweiligen Brillen heraus und betrachtete das alles mit einem Befremden, als ob sie diese noch nie gesehen hätte. Dann seufzte sie resigniert, packte die Brillen wieder in die Etuis, dann die Etuis in die Handtasche und fing nach wenigen Minuten das ganze wieder von vorne an.
Überall lagen kleine handbeschriftete gelbe Notizzettel - in jeder Schublade, in der Kiste neben dem Telefon, gebündelt mit Gummibändern in verschiedenen Dosen in der Küche und versteckt zwischen den zwei kleinen Vasen auf der Kommode. Am häufigsten fand ich ihre Bank-PIN – die hatte sie vermutlich zwanzigfach an verschiedenen Stellen im Haus schriftlich hinterlegt.
Nachdem sich meine Erschütterung über ihren mentalen Zustand gelegt hatte, konnte ich mit den Verdächtigungen und den neuen Versionen altbekannter Geschichten besser umgehen. Mir wurde nun klar, warum Mutter häufig mir gegenüber vorwurfsvolle Bemerkungen machte. Sie meinte es nicht böse.
Hätte ich das früher begriffen, hätte ich mir einigen Unmut über ihre für mich grundlosen Anschuldigungen ersparen können. Nein, ich hatte nicht die Wände vollgeschrieben, als ich drei war (es war ein einziger Bleistiftstrich). Nein, ich hatte nicht ihre Uhr ausgeliehen und dann verloren. Und nein, ich hatte nicht ihr Adressbuch verlegt und sie somit davon abgehalten, Geburtstagskarte und Weihnachtskarten zu schreiben. Offenbar lösten sich Teile von Mutters Gehirn auf, und es gab nichts, was wir hätten tun können. Oder doch?
Irgendwie fühlte ich mich schuldig. Ich war so selten dort gewesen. Ich hätte sie öfter besuchen sollen, mehr den Dialog mit ihr suchen können, mehr über Demenz herausfinden können, darauf bestehen können, mit den Ärzten zu sprechen. Jetzt war es zu spät.
Immerhin gab es auch ein paar positive Aspekte der Erkrankung. So glaubte meine Mutter, dass sie an viel mehr Orten der Welt gewesen sei, als dies tatsächlich der Fall war und erzählte von einigen wunderbaren Reisen mit meinem Vater und gemeinsamen Urlauben, die niemals stattgefunden haben konnten. So vermittelte sie mir eine große innere Zufriedenheit über ein erfülltes Leben.
Mit ihrem Humor und ihrer fast immer sehr fröhlichen Art hatten wir auch viele schöne gemeinsame Stunden. Auch meine Laune war tagsüber meist optimistisch, vor allem wenn wir im Garten arbeiteten und meine Mutter die Namen aller Pflanzen und Blumen korrekt benennen konnte. Später am Abend wandelte sich die Stimmung aber oft in Momente der Verzweiflung, wenn ich sah, wie verwirrt sie dann wurde.
Meine Gedanken wurden nachts oft noch schwerer, wenn mir Zweifel an meinem Umzug nach Suffolk kamen und ich mich auch dafür noch schuldig fühlte.
Rachel und ich hatten im Sommer vage über die Option eines Umzuges in ein Altenheim für meine Mutter nachgedacht. Da ich jetzt ein besseres Bild über ihren tatsächlichen Gesundheitszustand hatte, mussten wir uns mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen. Mutter hatte ein wunderschönes Haus mit Garten, das für sie immer perfekt schien. In den letzten Monaten hatte sie sich aber am Telefon darüber beklagt, dass ihr der Garten zur Last werde. Aber allein der Gedanke, dass sie in absehbarer Zeit vermutlich ihr Haus verlassen würde, stimmte mich traurig. Ich empfang große Achtung, wie es manche schafften, ihre alten und kranken Angehörigen jahrelang zu Hause zu pflegen.
Ich nahm mir vor, einen sehr schönen Heimplatz für meine Mutter zu suchen, auch wenn das nicht ganz einfach sein würde. Mum hatte sich vor ein paar Jahren selbst einige Seniorenheime angesehen und zeigte uns einige Prospekte. Damals hatten wir sie nicht wirklich ernst genommen. Um ehrlich zu sein, hatten Rachel und ich sie in den letzten Jahren insgesamt zu wenig ernst genommen - was mir jetzt leidtat. Ich hatte mich damals lediglich gewundert, warum sie sich Altenheime ansah, obwohl sie noch so fit war.
Am Donnerstagabend klingelte das Telefon.
»Sarah Wills.«
»Hallo, hier ist Alison, ich wollte fragen, ob es in Ordnung wäre, morgen zu kommen und Joans Haare zu machen?«
»Ja, prima, danke! Um wie viel Uhr kommst du normalerweise?«
»Um zwei. Passt euch das?«
»Ja, perfekt.«
Ich informierte meine Mutter, dass Alison morgen kommen wolle. Mir fiel auf, dass meine Mutter sie stets Alice nannte.
»Sie heißt Alison, oder?«
»Ja, ich glaube schon. Oder Alice. Vielleicht kann sie dir auch mal die Haare machen. Sie sehen richtig schlimm aus.«
In unserer Familie gab es immer nur schwarz und weiß. Da gab es den kleinen, beliebten Labour-Premierminister, der in den Augen meiner Eltern an allem scheiterte, schon weil er aus Yorkshire und nicht aus Lancashire kam, außerdem war er noch in der falschen Partei. Dem folgte ein PM ausgerechnet aus Portsmouth, ebenfalls Labour und schon deshalb ebenso zum Scheitern verurteilt. Als dann schließlich die Eiserne Lady an die Macht kam, war mein Vater zufrieden. Er bewunderte sie und es grämt mich heute noch, dass ich mich für die politische Ansichten meines Vaters schämte, der sonst so ein toller Mensch gewesen war.
Samstagfrüh läutete es an der Tür. Es war die Avon-Vertriebsdame. War das immer noch dieselbe Dame, die bereits in meiner Jugend Kosmetik an der Haustür verkaufte? Es sah so aus – das spräche ja dann tatsächlich für eine hohe Qualität ihrer Pflegeprodukte. Nein, es war eine andere Dame. Mutter sprach sehr lange mit ihr und war davon überzeugt, dass sie noch nicht für Käufe der letzten Male gezahlt hatte. Die Dame versicherte ihr jedoch mehrmals, das Geld bereits bekommen zu haben.
Danach wollten wir zum Supermarkt fahren. Mutter sagte, sie hätte noch Bargeld im Haus. Ich schlug vor, ich könnte die Einkäufe mit meiner Karte zahlen. Trotzdem begann sie hektisch in einem der unteren Schränke in der Küche zu wühlen. Sie wollte mir unbedingt zeigen, wie klug sie ihr Bargeld versteckt hatte – nur war das Geld nicht auffindbar. Daraufhin ärgerte sie sich massiv über all diese Tupperdosen, die im Weg standen, und schleuderte diese sogar genervt an die Rückwand des Schranks. Dann wankte sie in ihrem Zorn rückwärts, um aufzustehen, stürmte anschließend ins Esszimmer und begann nun hektisch in der Anrichte zu wühlen.
»Ich hatte hier tausend Pfund drin.«
Ich schaute sie regungslos an.
»Nur kann ich es jetzt nicht mehr finden. Hast du es genommen?«
»Nein.«
Die Tür des kleinen Schranks zu meiner Rechten flog auf. Zwei Landkarten fielen auf den Boden.
»Hier ist es. In diesem Umschlag, ganz unten. Zähl mal nach.«
Ich nahm die Scheine und zählte sie auf dem Tisch. Zehn Fünfziger.
»Hier sind fünfhundert, Mum.«
»Das kann nicht sein. Es waren tausend Pfund. Jemand muss es genommen haben.«
Ich seufzte.
»Bist du sicher? Vielleicht waren es fünfhundert.«
»Nein. Ich bin mir ganz sicher. Das war mein Notgroschen für die Flucht. Deshalb habe ich es mit den Landkarten aufbewahrt.«
»Okay, dann nehmen wir es erst einmal mit. Mir gefällt es nicht, dass das ganze Bargeld hier herumliegt. Wir werden es auf der Bank einzahlen, sobald wir dazu Gelegenheit haben.«
»Aber ich habe gerne etwas Bargeld zu Hause.«
»Ja, aber fünfhundert sind wirklich zu viel.«
»Es sind tausend Pfund. Zähl nochmal nach.«
Ich zählte noch einmal.
»Nein, es sind definitiv fünfhundert, Mum.«
»Nein, es sind eintausend Pfund.« Meine Mutter runzelte die Stirn.
Ich zwang mich, das Geld zu vergessen. Ich würde später noch einmal in der Anrichte nachsehen.
Das nächste Problem für sie war, was sie anziehen sollte. Mutter wollte ihr bestes Kostüm anziehen, was auch in Ordnung war, obwohl der Rock mir viel zu lang erschien. Hauptsache, sie war glücklich, und wir kamen endlich los. Dann holte sie ihren marineblauen Wollmantel heraus.
»Mum, heute ist es ziemlich warm draußen. Du brauchst keinen Mantel.«
»Okay. Ich lege ihn ins Auto.«
Ich verstand zwar den Sinn dieser Aktion nicht, widersprach ihr aber nicht. Sie machte jetzt schon einen genervten und überforderten Eindruck.
Auch der Supermarkteinkauf erwies sich alles andere als einfach, obwohl die schlechte Laune wieder verflogen war, als wir den Laden betraten. Mutter legte ein paar Artikel in den Einkaufswagen, von denen ich wusste, dass wir sie noch in großen Mengen zu Hause hatten, oder sie diese gar nicht mochte. Sie schien froh zu sein, wenn ich Vorschläge machte und stimmte allem zu, sichtlich erleichtert, dass jemand die Initiative ergriff. Ich legte zwei Artikel diskret ins Regal zurück, als sie nicht hinsah.
Zu Hause aßen wir gleich ein Stück von dem Fruit Cake, der eigentlich für Gäste gedacht war. Meine Mutter erzählte mir noch einmal von damals, als Patsy und Michael sie besucht hatten und drei Stücke von ihrem Fruit Cake gegessen hatten, außerdem hatte Patsy aus Versehen ihr kleines Picknickmesser eingesteckt.
»Dann ist es doch gut, dass wir ihn heute allein essen.«
»Ja. Ich habe jedes Jahr Fruit Cake als Spende für das Dorffest gebacken, aber eine dieser Damen im Komitee hat ihn immer weggeschnappt, bevor das Fest überhaupt richtig los ging!«
»Wirklich? Das war ja dreist!«
»Ja, und ich glaube nicht, dass sie jemals dafür bezahlt hat. Wahrscheinlich sah sie es als ihr Vorrecht an, nach all ihrer harten Arbeit. Sie war ein richtiger Snob, um ehrlich zu sein.«
Abends legte ich einen Film in den DVD-Spieler ein, der nach Mutters Geschmack sein sollte: The Ladies in Black aus dem Jahr 2018. Ich fand den Film großartig. Mutter schien konzentriert dem Film zu folgen.
Am Ende fragte ich, »Hat dir der Film gefallen, Mum?«
»Ja, er hat mir gefallen. Ich habe ihn aber schon öfters gesehen. Du übrigens auch. Es ist ein sehr alter Film.«
Ich hatte angenommen, dass meine Mutter viel fernsehen würde, so wie früher. Allerdings schaltete sie niemals den Fernseher tagsüber ein, denn das war nicht mit ihren Werten vereinbar. Mit Sorge sah ich, dass meine Mutter – wenn sie nicht gerade nach irgendwelchen persönlichen Gegenständen suchte, oder mir etwas aus der Vergangenheit erzählte – einfach oft ins Leere starrte.
Am Nachmittag überredete ich sie zu einem kurzen Spaziergang zum Dorfteich.
»Du bist so unruhig. Ich bin müde und will mich aus-ruhen.«
»Lass uns einfach die Beine vertreten und die Enten füttern.«
Sie seufzte, verließ das Zimmer und kam in ihren Hausschuhen zurück. Ich wagte kaum ihre Sandalen vorzuschlagen, aber es führte kein Weg daran vorbei. Ich holte sie aus dem Schuhschrank und half ihr beim Anziehen. Dann füllte ich eine kleine Papiertüte mit Haferflocken und reichte sie ihr.
Bis Sonntagabend hatte ich ein paar Dinge im Haushalt geändert. Um alle Risiken zu minimieren, zog ich den Stecker des Backofens und versteckte das Bügeleisen. Vor dem Einschlafen begann ich im Internet über die Krankheit nachzulesen. Nach den dortigen Beschreibungen schien meine Mutter gegenwärtig leichte bis mittlere Demenzsymptome zu haben. Sie war oft verwirrt oder desorientiert, aber man konnte sich immer noch gut mit ihr unterhalten und sie war häufig sogar scharfsinnig und sehr wortgewandt.
In einem anderen Artikel las ich, warum viele Menschen mit Demenz nicht mehr gerne fernsehen. Sie können der Handlung nicht mehr folgen und finden die bewegten Bilder irritierend. Meine Mutter behauptete, sie habe sämtliche Filme und Serien bereits gesehen und nutzte dies als Rechtfertigung, warum sie gerade nicht fernsehen wolle. Sie war sehr geschickt in ihrer Argumentation. Dass das Lesen unmöglich für sie geworden war, empfand ich als großen Verlust. Mutter hatte immer gerne gelesen. Um diesen Zustand bestmöglich zu verbergen, sprach sie deshalb nicht selten über Bücher, die sie angeblich gerade las.
Ich hatte das Gefühl, die Krankheit auf einmal zu verstehen, und diese Erkenntnis nahm mir eine große Last von den Schultern. Es war Zeit, meiner Mutter Geduld und Liebe zu schenken.
3
Montag war der erste Tag an der Middleton High, meiner neuen Schule. Da die Ferien für die Schüler noch bis Mittwoch gingen, hatten wir Lehrkräfte noch zwei Vorbereitungstage.
Als ich viel zu früh am Schulparkplatz ankam, wartete ich noch etwas im Auto, um nicht die erste im Gebäude zu sein. Ich fühlte, wie sich mein Magen zusammenzog und versuchte so gut es ging, dies zu ignorieren. Ich war nicht gut darin, neue Leute kennenzulernen. Zumindest war mir das Schulgelände vertraut. Ich war in meiner Jugend schon einige Male hier gewesen, um mit meiner damaligen Schulmannschaft Hockey zu spielen. Die Mädchen dieser Schule waren unsere härtesten Konkurrentinnen gewesen. Ich erinnerte mich an die geräumigen Umkleidekabinen, das makellose Spielfeld und die köstlichen Verpflegungen. Am meisten erinnerte ich mich an das selbstbewusste Auftreten der Spielerinnen und insbesondere an die aggressive rechte Flügelstürmerin, die so viele Tore gegen uns schoss, was mich als linke Verteidigerin heftig ärgerte. Deshalb hatte ich diese Schule nicht gemocht, jetzt hatte ich sie gewählt. Ich war also dabei, wenn auch etwas spät, die Seiten zu wechseln.
Mir wurde das Gefühl vermittelt, hier willkommen zu sein. Die Mitarbeiter, die ich traf, waren freundlich. Natürlich würde es auch hier Probleme und Spannungen geben, das ist ja normal. Die Schuldirektorin machte einen offenen Eindruck, und ich mochte ihre Begrüßungsrede. Bei ihrem Stellvertreter war ich mir nicht so sicher. Im Anschluss erhielten wir eine Auffrischungseinweisung zum Thema Präventiver Kinderschutz. Die Fachabteilungen kamen dann am Nachmittag zusammen, um den Lehrplan zu besprechen.
Am zweiten Tag hatte sich die Schuldirektorin bereits bei einigen etwas unbeliebt gemacht, weil sie für den Beginn des Schuljahres sofort einen zusätzlichen Elternabend in einem neuen Format ankündigte, bei dem den Eltern die Gelegenheit geboten werden sollte, die Klassenlehrer und -lehrerinnen sowie andere Eltern aus der Klasse kennenzulernen. Bereits am kommenden Dienstag sollte dieser stattfinden. Nicht alle meiner neuen Lehrerkolleginnen und -kollegen zeigten sich von dieser Initiative begeistert, viele bezweifelten die Notwendigkeit. Sie betrachteten die Einzelgesprächeim Verlaufe des Schuljahres als viel wichtiger.
Als dann die Kinder am Mittwoch eintrafen, war es mit der Ruhe vorbei. Ich war froh, dass ich Klassen aus der Mittelstufe zu unterrichten hatte. Somit hatte ich weniger Stress im Beruf und mehr Zeit für Mutter.
Bis Freitag hatte ich mich an der Schule schon etwas eingelebt und wurde zuversichtlich, dass mir mein neuer Arbeitsplatz gefallen würde.
Am Freitagabend nach dem Abendessen hatte ich es mir gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht, als mein Handy klingelte.
»Sarah Wills.«
»Hi Sarah, hier ist Malcolm, von der Schule. Ich habe gerade mit Jill, meiner Frau, gesprochen und wir wollten wissen, ob du vielleicht Lust hättest, mit uns morgen Abend auf ein paar Drinks ins Pub zu kommen. Wir treffen uns im Kollegenkreis etwa einmal im Monat im Three Horseshoes, meistens am Samstag. Mary hat mir deine Handynummer gegeben. Sie kommt auch.«
Malcolm war Fachleiter für Naturwissenschaften. Ich fand es sehr nett von ihm, mich einzuladen. Ich sagte, ich käme gerne.
Am Samstagabend war ich dann irgendwie nicht mehr sicher, ob ich wirklich hingehen sollte. Ich fühlte mich schuldig, meine Mutter alleine zu lassen.
Das Three Horseshoes war ein nettes Country-Pub mit einem riesigen Parkplatz. Dies war ein großer Vorteil gegenüber London, parken war kein Problem. Innen war das Pub ziemlich leer, die Wände mit Hufeisen und verblichenen Fotos geschmückt. Der verschlissene Teppich und die Möbel wirkten auf mich fast schäbig, und es mangelte an dem Ambiente, das ich aus dem Londoner West End gewohnt war. Positiv war, dass wir uns unterhalten konnten, ohne uns direkt in die Ohren brüllen zu müssen. Zwei ältere Männer saßen etwas abseits voneinander an der Bar, beide schweigend und in ihre Biere starrend.
»Hi Sarah! Schön, dass du gekommen bist!«
Malcolm stand auf, um mich zu begrüßen. An dem großen Tisch saßen acht Personen. Die Unterhaltung war bereits lebhaft. Ich fühlte mich noch nervöser als vor dreißig Teenagern. Hätte ich die Chance gehabt, wäre ich sofort umgekehrt, aber es war zu spät, und so zwang ich mich zur Geselligkeit. Eigentlich hätte kein Grund zur Nervosität bestanden, denn es war wirklich eine freundliche Truppe, und alle wollten offensichtlich nach der ersten Woche Schule gemeinsam bei einem Drink entspannen.
Mary, die Leiterin des Fachbereichs Geschichte, hatte ich bereits in der Schule kennengelernt. James stellte sich mir vor, schätzungsweise Anfang fünfzig, ein eher ruhigerer Typ – so mein erster Eindruck. Dann gab es noch Aidan, jung, gutaussehend und sportlich, vermutlich ein Referendar, und Alex, ein durchtrainierter Typ Ende dreißig, den ich ein paar Mal im Verlauf der Woche in Sportklamotten gesehen hatte. Die anderen zwei am Ende des Tisches kannte ich noch nicht. Wir stellten uns kurz vor; sie hießen Barbara und Daniel, beide waren von der Englischabteilung.