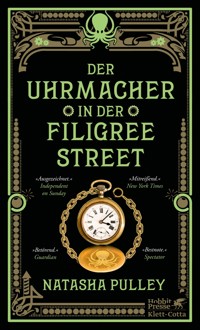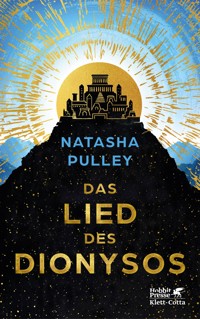Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Komm nach Hause, wenn du dich erinnerst.« 1898 erwacht Joe Tournier ohne jegliche Erinnerungen am Bahnhof Gare du Roi in Londres. Die Welt steht Kopf: England ist französisch, und Joe wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Nur wenig später, als er wieder in Freiheit ist, trifft eine rätselhafte Postkarte bei ihm ein, die 90 Jahre zu ihm unterwegs war. Auf der Postkarte ist ein Leuchtturm auf einer Insel in den Äußeren Hebriden mit dem Namen Eilean Mor abgebildet, auf der Rückseite steht ein kurzer Text: "Liebster Joe, komm nach Hause, wenn du dich erinnerst. M." Was hat es mit dem Leuchtturm auf sich und wie kann ein Mann mittleren Alters aus einer 90jährigen Vergangenheit heraus vermisst werden? Und wer ist M.? Joe macht sich schließlich auf die nicht ungefährliche Reise nach Schottland, um den Leuchtturm zu suchen und findet stattdessen einen Weg in die Vergangenheit. Unversehens gerät er in die Turbulenzen der großen Schlachten zwischen England und Frankreich, die lange vor seiner Geburt entschieden wurden. Schnell wird klar, dass jeder Schritt in die Vergangenheit auch seine Zukunft beeinflusst. "Halten Sie sich das Wochenende frei und lassen Sie sich entführen." - New York Times
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Natasha Pulley
Der Leuchtturm an der Schwelle der Zeit
Roman
Aus dem Englischen von Jochen Schwarzer
Klett-Cotta
Impressum
Die Arbeit des Übersetzers an diesem Werk wurde durch ein Stipendium der VG WORT im Rahmen des Bundesprogramms NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Kingdoms« im Verlag Bloomsbury Publishing Plc, London, New York
© 2021 by Natasha Pulley
Für die deutsche Ausgabe
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung mehrerer Abbildungen von © Shutterstock
(Antares Light, Vasy Kobelev, Jackie Niam)
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98763-8
E-Book ISBN 978-3-608-11928-2
Inhalt
Teil I
Londres
1
Londres, 1898 (93 Jahre nach Trafalgar)
2
3
4
Londres, 1900 (zwei Jahre später)
5
6
Pont du Cam, 1900
7
Schottland, 1900
Teil II
Der Leuchtturm
8
Äußere Hebriden, 1900
9
10
Eilean Mòr, 1900
11
12
13
14
Eilean Mòr, 1807
Teil III
Agamemnon
15
HMS Agamemnon, 1807
16
17
Auf dem Ärmelkanal, 1797
18
HMS Agamemnon, 1807
19
20
Southampton, 1797
London, 1797
21
HMS Agamemnon, 1807
22
23
24
Cádiz, 1777
25
HMS Agamemnon, 1807
26
London, 1805
27
Edinburgh, 1807
Teil IV
Edinburgh
28
Edinburgh, 1807
29
30
31
London, 1797
32
Edinburgh, 1807
33
Edinburgh, 1807
34
Vor der Küste von Cádiz, 1805
35
Edinburgh, 1807
36
37
38
Southampton, 1798
39
Edinburgh, 1807
London, 1798
Edinburgh, 1807
Teil V
Newgate
40
Straße nach Glasgow, 1807
41
Edinburgh, 1807
42
Santíssima Trinidad, Irische See, 1807
43
HMS Agamemnon, 1807
44
Gefängnis Newgate, 1807
45
London, 1807
Edinburgh, 1805 (25 Tage nach Trafalgar)
Gefängnis Newgate, 1807
46
Gefängnis Newgate, 1807
47
Eilean Mòr, 1807
Teil VI
Zu Hause
48
London, 1903
49
Edinburgh, 1805
50
London, 1903
51
52
King’s Cross, 1903
Dank
Der Crew der Pelican of London
Teil I
Londres
1
Londres, 1898 (93 Jahre nach Trafalgar)
Den meisten Menschen fällt es schwer, sich ihrer frühesten Erinnerung zu entsinnen. Es kostet sie Mühe, so als streckten sie sich nach ihren Zehen. Joe aber ging es nicht so – was daran lag, dass diese Erinnerung eine Woche nach seinem dreiundvierzigsten Geburtstag entstand.
Er stieg aus dem Zug. Das war es: das Allererste, woran er sich erinnerte. Das Zweite war schon nicht mehr so klar fassbar. Es war das ihn beschleichende unheimliche Gefühl, dass alles um ihn herum zwar seinen gewohnten Gang ging, zugleich aber ganz grundsätzlich etwas nicht stimmte.
Es war früher Morgen und garstig kalt. Dampf zischte direkt über ihm aus der schwarzen Lokomotive. Da sich der Bahnsteig nur eine Handbreit über den Gleisen erhob, befanden sich die Doppelzylinder der Räder auf Höhe seiner Taille. Er war dem so nah, dass er das Wasser im Kessel sieden hörte. Schnell trat er ein paar Schritte beiseite, sich ängstlich bewusst, dass sich die Lok jeden Moment ruckartig vorwärtsbewegen konnte.
Der Zug war gerade erst eingefahren. Der Bahnsteig war voller Leute, die sich, müde und steifbeinig von der Reise, in Richtung Bahnhofshalle bewegten. Der süßliche Geruch von Kohlenrauch hing in der Luft. Da es draußen gerade erst hell wurde, tauchten die kugelförmigen Lampen alles in ein fahles Licht, in dem selbst der Dampf einen langen, vagen Schatten warf und wie ein scheuer Teufel wirkte, der noch nicht recht wusste, ob er feste Gestalt annehmen sollte oder nicht.
Joe hatte nicht die leiseste Ahnung, was er dort tat.
Er wartete ab, denn Bahnhöfe waren ja schließlich überall auf der Welt Orte, an denen man schon mal verwirrt sein konnte. Es geschah aber nichts. Er konnte sich nicht erinnern, dort angekommen oder von irgendwo fortgegangen zu sein.
Er sah an sich hinab. Mit einem Anflug des Entsetzens stellte er fest, dass er sich nicht einmal erinnern konnte, sich angezogen zu haben.
Seine Kleidung war ihm fremd. Ein sehr schwerer Mantel mit Schottenkarofutter. Eine schlichte Weste mit interessanten Knöpfen, auf denen Lorbeermuster eingeprägt waren.
An einem Schild sah er, dass er sich auf Bahnsteig drei befand. Weiter hinten am Zug ging ein Schaffner an den Coupés entlang und sagte immer wieder das Gleiche, leise und respektvoll, da er Fahrgäste der ersten Klasse zu wecken hatte.
»Londres, Gare du Roi, alle aussteigen bitte! Londres, Gare du Roi …«
Joe fragte sich, warum zum Teufel die Bahngesellschaft Londoner Bahnhofsnamen auf Französisch angab, und fragte sich dann verwirrt, warum er sich das überhaupt fragte. Alle Bahnhöfe in London trugen französische Namen. Das wusste doch jeder.
Dann berührte ihn jemand am Arm und fragte auf Englisch, ob mit ihm alles in Ordnung sei. Er zuckte so heftig zusammen, dass er sich einen Nerv im Nacken zerrte. Ein greller Schmerz schoss ihm den Hals hinab.
»Verzeihung … könnten Sie mir bitte sagen, wo wir hier sind?«, fragte er und merkte sogleich, wie lächerlich das klang.
Der Mann schien jedoch nichts Ungewöhnliches dabei zu finden, auf einem Bahnhof jemandem mit Gedächtnisverlust zu begegnen. »In London«, sagte er. »Gare du Roi.«
Joe wusste nicht, warum er auf etwas anderes gehofft hatte als darauf, was er den Schaffner hatte sagen hören. Er schluckte und wandte den Blick ab. Der Dampf begann sich nun zu lichten, und überall tauchten Schilder auf – zur Kolonialbibliothek, zum Musée Britannique, zur Métro. Ein Stückchen weiter stand auf einer Tafel, dass der Verkehr auf der Desmoulins-Linie wegen Schachtarbeiten unterbrochen sei, und dahinter führten schmiedeeiserne Tore in den Nebel hinaus. »Ganz sicher … London in England?«, fragte er schließlich.
»Ja«, sagte der Mann.
»Oh«, sagte Joe.
Nun schnaufte der Zug wieder Dampf und verwandelte den Mann damit in ein Gespenst. Inmitten der leichten Panik, die Joe nun befiel, dachte er, dass er Arzt sein müsse, denn er wirkte immer noch nicht erstaunt. »Wie heißen Sie?«, fragte der Mann. Er hatte entweder eine junge Stimme oder sah älter aus, als er war.
»Joe.« Nach einigem Grübeln fiel es ihm wieder ein, und das war eine immense Erleichterung. »Joe Tournier.«
»Wissen Sie, wo Sie wohnen?«
»Nein«, antwortete Joe und fühlte sich, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggerissen.
»Dann bringen wir Sie am besten in ein Krankenhaus«, sagte der Mann.
Er bezahlte eine Droschke, und Joe dachte, er würde es dabei bewenden lassen, doch dann fuhr der Mann tatsächlich mit und sagte, es mache ihm nichts aus, er habe nichts Dringendes zu tun. Unzählige Male versuchte Joe in den darauffolgenden Monaten, sich zu erinnern, wie der Mann ausgesehen hatte. Doch obwohl er ihm die ganze Droschkenfahrt gegenübergesessen hatte, gelang es ihm nicht. Er wusste nur noch, dass der Mann aufrecht gesessen hatte, ohne sich anzulehnen, und dass er etwas Fremdländisches an sich gehabt hatte – trotz der Tatsache, dass er auf jene strenge Art und Weise Englisch sprach, wie streitbare ältere Herren es taten, die sich all die Jahre standhaft geweigert hatten, Französisch zu lernen, und die einem nur einen finsteren Blick zuwarfen, wenn man sie mit Monsieur ansprach.
Sie war zum Verrücktwerden, diese kleine Lücke in seiner Wahrnehmung, denn alles andere hatte er später noch bestens parat. Die Droschke war noch ganz neu, das Leder frisch und nach Politur duftend, die sich noch wächsern anfühlte. Er konnte sich später sogar noch daran erinnern, dass Dampf von den Rücken der Pferde aufgestiegen war und dass die Federung geknarrt hatte, als sie vom Kopfsteinpflaster vor dem Bahnhof auf den glatteren Straßenbelag der Rue Euston eingebogen waren.
Bloß das Aussehen des Mannes war wie wegradiert. Und es war, als hinge dieses Vergessen weniger mit einer Gedächtnislücke zusammen, als vielmehr mit einer Art Schleier, der ihn verhüllte.
Die Straße kam ihm einerseits bekannt vor und andererseits überhaupt nicht. An jeder Ecke, die Joe zu kennen meinte, gab es entweder einen anderen Laden als den, den er erwartet hatte, oder es stand dort gar kein Gebäude. Droschken ratterten vorbei. Bräunliche Nebelschwaden drifteten über die Fenster der Geschäfte. Der Himmel war verhangen. Joe begann sich zu fragen, ob ihm der Mann womöglich gar nicht helfen wollte, sondern sich die Sache irgendwie zunutze machte; er konnte sich allerdings nicht vorstellen wofür.
Nicht weit entfernt bliesen monströse Türme dunklen Rauch in den metallisch grauen Himmel. Sie waren von einem Gespinst aus Gerüsten und Schrägaufzügen umgeben, und aus den Schornsteinen loderten kleine Flammen. An einem riesigen Silo stand in weißen Lettern auf Französisch: HOCHOFEN 5. Joe schluckte. Er wusste genau, was das war – ein Stahlwerk –, und doch erfüllte es ihn mit dem gleichen unheimlichen Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wie die Métro-Schilder auf dem Bahnhof. Er schloss die Augen und versuchte sich zu klar zu werden, was er wusste. Stahlwerke: Ja, dafür war London berühmt, dafür war London da. Sieben Hochöfen in Farringdon und Clerkenwell, die Stahl für die ganze Republik produzierten. Auf Ansichtskarten von London sah es immer beeindruckend aus, dieses hoch aufragende Gewirr aus Rohrleitungen, Kohleschütten und Schloten mitten in der Stadt. Es war eine Quadratmeile, die komplett eingerußt war: die Ruine der St.-Pauls-Kathedrale, die schiefen alten Häuser rund um die Chancery Lane, alles. Deshalb nannte man London »Die Schwarze Stadt«.
Doch all diese Kenntnisse hätten genauso gut aus einem Lexikon stammen können. Er wusste nicht, woher er das alles wusste. Und er erinnerte sich nicht, je durch diese schwarzen Straßen oder durch die Gegend der Stahlwerke gegangen zu sein.
»Sind Sie aus demselben Zug ausgestiegen wie ich?«, fragte er den Mann, in der Hoffnung, dass es sein Unbehagen lindern würde, wenn er sich auf eine ganz bestimmte Sache konzentrierte.
»Ja. Der Zug kam aus Glasgow. Wir saßen im selben Waggon.« Der Mann hatte eine knappe, schneidige Sprechweise, aber seine ganze Körperhaltung brachte Mitgefühl zum Ausdruck. Er sah aus, als koste es ihn große Beherrschung, sich nicht vorzubeugen und Joes Hände zu ergreifen. Joe war froh, dass er das nicht tat. Er wäre sofort in Tränen ausgebrochen.
Er konnte sich nicht erinnern, in dem Zug gewesen zu sein. Der Mann versuchte, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, indem er ihm von der Fahrt erzählte: von der komischen Hochnäsigkeit des Schaffners und davon, wie die Klappbetten einen zu schlucken versuchten, wenn man sie nicht richtig herunterdrückte; doch Joe erinnerte sich an nichts von alledem. Der Mann bestätigte Joe, dass er weder gestürzt war noch sich den Kopf gestoßen hatte; er habe lediglich seit dem frühen Morgen einen verwirrten Eindruck gemacht. Inzwischen war es neun Uhr.
Joe ließ den Kopf hängen. Nie zuvor hatte er solche Angst gehabt. Er machte das Fenster auf, um besser atmen zu können. Alles roch nach Ruß. Zumindest das wirkte vertraut. Auf den Gehsteigen strömten Scharen von Männern in schwarzen Mänteln und schwarzen Hüten aus den eisernen Toren der Métro-Stationen. Sie sahen alle gleich aus. Dann hielt die Droschke vor einem Bahnübergang. Ein Kohlenzug zockelte in Richtung Stahlwerk. Der Lokführer ließ seine Pfeife gellen, um ein paar Kinder beiseitezuscheuchen; sie waren zu zehnt oder zwölft und haschten nach den Kohlebrocken, die von den Waggons fielen.
»Das wird schon wieder«, sagte der Mann leise. Es war das Letzte, was er zu ihm sagte. Während Joe dann bei dem Arzt war, verschwand er. Keine der Schwestern hatte ihn gehen sehen, ja, keine hatte ihn überhaupt bemerkt, und Joe kam allmählich zu der Überzeugung, dass er sich allein auf den Weg zum Krankenhaus gemacht habe und der Mann einer harmlosen Halluzination entsprungen sei.
Das erste der beiden Krankenhäuser, in die er kam, war das Kolonieklinikum, ein dunkler, eiskalter Ort, an dem alle Fenster offen standen, um die Stationen zu lüften. Dort überwies ein erschöpfter Arzt ihn sogleich an eine Anstalt auf der anderen Seite des Flusses. Es folgte eine weitere Droschkenfahrt, diesmal allein und auf Kosten der Klinik. Unterwegs schlang Joe, der inzwischen bis auf die Knochen durchgefroren war, seinen Mantel um sich. Weitere verrußte Straßen glitten vorbei, mit Häuserreihen wie schwarze Trauerspitze. Und dann war da die Tamise: ebenfalls schwarz und so voller Frachtschiffe, dass ein gelenkiger Mann mit Sprüngen von Deck zu Deck den ganzen Fluss hätte überqueren können. Alles ganz normal, alles wie eh und je. Bloß dass Joe sich vorkam, als hätte man ihn auf der Oberfläche des Mars abgesetzt.
Das zweite Krankenhaus hieß La Nouvelle Salpêtrière. Es war ein viel angenehmerer Ort, als Joe erwartet hatte. In Southwark, auf der Südseite des Flusses gelegen, war es ein beeindruckendes Gebäude, das eher nach einem Museum oder einer Bank aussah. Er hatte sich das Innere streng und weiß vorgestellt, doch tatsächlich war kaum zu erkennen, dass man sich in einer Anstalt befand. In der Eingangshalle gab es Marmor und Säulen, schöne Sofas und Kronleuchter mit elektrischem Licht. Irgendwo spielte sogar jemand Klavier.
Auf dem Weg hinauf zum Sprechzimmer des zuständigen Facharztes führte ihn die Schwester an zwei mit Kork ausgekleideten Zellen vorbei, doch dort standen die Türen offen, und niemand war darin. Es gebe, sagte sie, auch einen Trakt für Verbrecher, wo die schweren Fälle untergebracht seien, aber der sei separat. Das einzige andere Anzeichen dafür, dass an diesem Ort vielleicht nicht jedem zu trauen war, stellten die Gitter vor den Kaminen dar.
Während er vor dem Sprechzimmer wartete, lieh ihm ein Mann eine Le Monde und behauptete dann, über das Wetter herrschen zu können. Joe saß mit der Zeitung in den Händen da, betrachtete die Worte und das Schriftbild und versuchte zu ergründen, warum ihm alles falsch vorkam. Es stand gar nichts Ungewöhnliches in der Zeitung. In einer Spalte ging es um das Wetter der nächsten Tage – das nicht der Vorhersage des Mannes entsprach –, dann folgte eine Anzeige für Seidenhemden und eine für die brandneue Erfindung eines gewissen Monsieur d’Leuve: ein elektrisches Korsett, das angeblich sehr förderlich bei Damenbeschwerden wirkte. Joe erschien das fragwürdig, denn zumindest Madeline schien nie so unwohl gewesen zu sein, dass sie Stromschläge benötigt hätte. Er stutzte, als ihm klar wurde, dass er sich an einen Namen erinnert hatte – und an ihr Gesicht; eine kleine Frau mit dunklem Haar, der Dunkelgrün gut stand. Ihr Nachname fiel ihm jedoch nicht ein und auch nicht, ob sie seine Schwester, seine Ehefrau oder keins von beidem war.
Das Sprechzimmer des Arztes war luftig und bot einen trist-schönen Ausblick über die mit Raureif bedeckten Rasenflächen der Klinik. An der Wand hing ein Diplom von einer Pariser Akademie. Der Schreibtisch wies oben an einem Bein Bissspuren auf. Joe sah sich nach dem Hund um, der das getan haben musste, konnte aber keinen entdecken, was deutlich beunruhigender war, als es hätte sein sollen. All diese Einzelheiten prasselten wie leuchtende Stecknadeln auf seinen Geist ein, was sehr unangenehm war.
Der Arzt erklärte, er werde eine Woche lang dortbleiben, und so lange würden ihm die Unterbringungskosten erlassen. »Wie ich sehe, wurden Sie vom Kolonieklinikum hierher überwiesen. Ich kann Ihnen genau sagen, woran Sie leiden. Es ist ein Anfall, eine Form der Epilepsie. Mit ein wenig Glück ist es bald wieder vorbei.«
»Ein Anfall?«
Der Arzt legte seine Schriftstücke nieder und lächelte. Er war jung und schick gekleidet, ein Pariser; wahrscheinlich war er im Kolonialdienst, um Erfahrungen zu sammeln und anschließend nach Frankreich zurückzukehren. Joe war verzweifelt, denn je mehr er darüber nachdachte, desto klarer wurde ihm, dass er zwar allgemeine Dinge wusste, aber nichts Konkretes.
»Ja«, sagte der Arzt. »Ich interessiere mich persönlich sehr für diesen speziellen Typ von Epilepsie und habe mich nach Fällen umgehört, und deshalb wurden Sie hierher überwiesen. Es handelt sich dabei um etwas, das wir als stille Epilepsie bezeichnen. Es geht nicht mit Krämpfen einher, sondern nur mit Symptomen, die man normalerweise mit einer epileptischen Aura verbindet: Amnesie, Paramnesie, Visionen. Haben Sie die letzteren beiden schon einmal gehabt?«
»Was bedeutet denn Paramnesie?«, fragte Joe. Die Stimme des Arztes wirkte so vornehm, dass er spürte, wie er sich unwillkürlich innerlich zusammenrollte, erfüllt von dem Drang, seine Antworten möglichst kurz zu halten und keine Fragen zu stellen oder Zeit zu vergeuden.
»Das Verschwimmen von etwas Imaginärem mit etwas Realem. Meist handelt es sich um ein Déjà-vu: das Gefühl, etwas Neues schon einmal gesehen zu haben. Und das Gegenteil dessen, ein Jamais-vu: wenn einem etwas, das einem bekannt sein sollte, vollkommen fremd vorkommt.«
»Ja!«, sagte Joe sogleich und spürte, wie ihm vor verzweifelter Dankbarkeit, dass jemand dieses Gefühl benannte, die Augen brannten. »Ja, das Zweite, und zwar, seit dieser Mann mich auf dem Bahnhof gefunden hat! Ich habe nicht geglaubt, dass der Gare du Roi in London ist, alle Straßen sahen falsch aus, die … Zeitungen sehen falsch aus …«
»Absolut lehrbuchmäßig«, sagte der Arzt in sanftem Ton. »Also, ich kann Ihnen versichern, dass Sie Londres kennen, denn Sie sprechen mit einem ausgeprägten Clerkenwell-Akzent.« Er lächelte wieder. »Wollen doch mal sehen, was passiert, wenn wir Sie hier ein paar Tage lang zur Ruhe kommen lassen. Ich vermerke Sie als heilbar«, fügte er hinzu und deutete auf das vor ihm liegende Formular.
»Und was ist, wenn das nicht wieder weggeht?«, fragte Joe. Er musste vorsichtig sprechen. Es kam ihm vor, als hätte er sehr lange nicht mehr gesprochen, was absurd war, denn er hatte ja auch in dem anderen Krankenhaus und auf dem Bahnhof etwas gesagt. Aber die Reihenfolge der Worte fühlte sich falsch an. Sie sprachen natürlich Französisch miteinander, und der Mann am Bahnhof hatte Englisch mit ihm gesprochen; vielleicht war es also nur die Umstellung.
»Nun, darüber können wir ein andermal sprechen …«
»Nein, ich will jetzt darüber sprechen. Bitte.«
»Es gibt keinen Grund, aggressiv zu werden«, sagte der Arzt in scharfem Ton und wich auf seinem Stuhl ein wenig zurück, als glaubte er, Joe würde nach ihm schlagen.
Joe stutzte. »Ich bin nicht aggressiv, ich habe bloß fürchterliche Angst.«
Seine Aufrichtigkeit schien den Arzt zu überraschen. Er besaß den Anstand, leicht betreten dreinzuschauen. »Sie müssen meine Vorsicht verstehen. In Ihren Unterlagen steht, dass Sie Englisch sprachen, als Sie im Kolonieklinikum ankamen, und der Mantel, den Sie da tragen, hat ein Futter mit Schottenmuster. Der Zug, in dem Sie saßen, kam aus Glasgow.« Zum Ende hin klang er eher anklagend als fragend.
»Ich kann Ihnen nicht folgen …«, sagte Joe.
»Wenn ich The Saints sage, fällt Ihnen dazu etwas ein?«
Joe überlegte, aber da war nichts. »Ist das eine Kirche?«
»Nein, das ist eine Terrororganisation, die regelmäßig Bombenanschläge auf Eisenbahnzüge und alle möglichen Regionen der Republik verübt.«
»Oh. Und die …?«
»Sprechen Englisch und tragen Schottenkaro und halten Edinburgh besetzt, das aus naheliegenden Gründen keine Bahnverbindung nach Londres hat. Stattdessen nutzen sie den Bahnhof in Glasgow.«
Joe starrte auf das Futter seines Mantelärmels hinab. »Ich … sehe mich nicht irgendwelche Bombenanschläge verüben. Ich glaube, die nervliche Belastung wäre zu viel für mich. Ich bin ja jetzt schon … mit den Nerven am Ende.«
Der Arzt sah das offenbar auch so, denn er lenkte ein. »Falls es nicht weggeht, könnte das darauf hindeuten, dass Sie eventuell eine Läsion oder einen Tumor im Hirn haben, der auf ein bestimmtes Areal drückt, und in diesem Fall könnten wir leider nicht viel für Sie tun, und er würde wahrscheinlich über kurz oder lang zum Tode führen.« Er sagte das ganz unverblümt, als kleine Strafe dafür, dass Joe ihn zuvor erschreckt hatte. »Fürs Erste aber geben wir Ihre Daten und eine Beschreibung von Ihnen an die Presse weiter. Wollen doch mal sehen, ob wir nicht irgendwelche Angehörigen von Ihnen auftreiben können.«
Joe war klar, dass er sich nun hätte bedanken sollen, doch in diesem Moment fiel es ihm schwer, überhaupt etwas zu sagen. »Und wenn sich niemand meldet?«
»Das Grafschaftsasyl ist kostenlos, Sie könnten also dorthin gehen.« Der Arzt zuckte bei dem Gedanken zusammen, und Joe mochte sich gar nicht erst ausmalen, wie es dort wohl zuging. »Aber wie gesagt: Eine Woche behalten wir Sie hier, und daher bleibt uns bis nächsten Dienstag Zeit.«
»Verstehe.«
Ein riesiger Hund kam hereingetrottet, legte Joe seinen Kopf auf den Schoß und sah ihn erwartungsvoll an, bis Joe ihm die Ohren kraulte. Er war erleichtert zu sehen, dass es dort tatsächlich einen Hund gab und nicht etwa ein Patient das Tischbein angenagt hatte.
»Lassen Sie sich von Napoleon bitte nicht stören, er ist ganz harmlos. Ich habe allerdings«, fuhr der Arzt fort, als hätte er den Hund gar nicht erwähnt, »noch nie einen Fall erlebt, der sich nicht binnen weniger Tage aufgeklärt hätte – manchmal sogar schon nach wenigen Stunden. Es ist eine sehr weit verbreitete Erkrankung. Vor einigen Monaten hatten wir geradezu einen Ansturm von Leuten, die davon befallen waren, und die sind alle wieder vollkommen genesen. Es war nicht so gravierend wie bei Ihnen, aber genau das gleiche Phänomen.«
Joe blickte von dem Hund auf. »Eine ganze Gruppe von Menschen, die alle zur gleichen Zeit an der gleichen Sache leiden, deutet doch auf eine äußere Ursache hin, die sie alle betrifft. Oder etwa nicht?«
Der Arzt machte große Augen und lachte dann, als wäre er überrascht, dass Joe sich so gewählt ausdrücken konnte. »Ja, ganz recht. Eine solche Häufung deutet auf eine äußere Ursache hin. Diese Häufung ist allerdings nicht geografischer Art. Patienten aus der ganzen Republik wurden davon befallen, von Rom bis Dublin. Wir untersuchen alles Mögliche: das Wetter, das Grundwasser, Feldfrüchte, giftige Dämpfe. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden schon rausfinden, woran es liegt.«
Joe nickte.
»Kommen Sie erst mal zur Ruhe und spielen Sie vielleicht ein wenig Tennis mit jemandem. Wir haben hier viele Veteranen, fabelhafte Kerle. Die kommen bloß nicht so gut mit plötzlichem Lärm zurecht. Und dann sehen wir uns in einigen Tagen wieder.«
Joe wollte noch etwas fragen, aber das Gespräch war beendet, denn eine Frau kam hereingetrippelt, die eine Puppe umklammert hielt und auf den Hund zeigte, und der Arzt erhob sich eilig und führte sie wieder hinaus. Der Hund trottete hinterher.
2
Die Schwester, eine dünne weiße Dame, hatte einen schroffen Ton am Leib. Die meisten anderen Patienten seien gebildete Leute, und daher solle er sich gefälligst benehmen. Ein Clerkenwell-Akzent, hatte der Arzt gesagt – das musste wohl eine Umschreibung für Unterschicht gewesen sein. Sie steckte ihn in ein enges Zimmer mit einem Bett, einem Tisch und mit Blick über die Gärten und zeterte die ganze Zeit auf ihn ein.
Er hielt sie zunächst einfach nur für unhöflich, dann aber wurde ihm klar, dass er sie nervös machte, und daher stellte er sich in eine Ecke und versuchte, einen harmlosen Eindruck zu verbreiten, während sie ihm erklärte, wo sich alles befand und wann die Essenszeiten waren. Ihr Verhalten verwirrte ihn, war er doch nicht mal groß genug, um sie damit einschüchtern zu können. Dann fiel ihm jedoch wieder ein, was der Arzt über das Schottenkarofutter seines Mantels gesagt hatte. Ganz vorsichtig und mit einem Gefühl, als wäre sie mit einem Zünder versehen, ließ er sich die Vorstellung durch den Kopf gehen, dass er eventuell irgendetwas mit Terroristen zu tun haben könnte. Das kam ihm aber immer noch ganz falsch vor. Er war sich ziemlich sicher, dass richtige Terroristen wütende Leute sein mussten, und so unklar ihm vieles auch war, wusste er doch, dass er selbst ungefähr so dazu neigte, vor Wut zu explodieren, wie ein nach seinem Ebenbild geformter Haufen Kochsalz. Will sagen, er war vielleicht nicht in beliebigem Maße genießbar, aber im Grunde doch neutral.
Das, bemerkte ein Teil seines Verstands, war ein Chemiescherz. Woher verstand englischer Abschaum aus Clerkenwell etwas von Chemie?
Vorläufig zwecklos, darüber nachzugrübeln.
»Äh«, wagte er sich vor, »gibt es hier irgendwelche Bücher?« Wenn er all dem schon nicht entfliehen konnte, schien eine Flucht an einen imaginären Ort die nächstbeste Option zu sein.
»Wir haben eine Bücherei. Zu Zwecken der Besserung und Fortbildung.« Mit ihrer ganzen Körperhaltung brachte sie zum Ausdruck, dass er das ihrer Meinung nach gut gebrauchen könnte. »Französische Klassiker natürlich.«
Klassiker klang sehr danach, als ginge es darin um die Schrecknisse des Daseins in Elendsvierteln und um »gefallene Frauen« – die aber nie ein so spannendes Leben geführt hätten, dass sie tatsächlich mal von irgendwo heruntergefallen wären. »Auch irgendwas Englisches?«, fragte er, ohne allzu große Hoffnungen zu hegen.
Die Schwester starrte ihn an. »Was glauben Sie eigentlich, wo Sie hier sind?«
Sie ließ ihm keine Gelegenheit, Vermutungen darüber anzustellen, sondern schritt zur offenen Tür und verschwand mit empörtem Schnauben auf dem Korridor.
Er fuhr sich mit den Händen in alle Taschen und leerte sie dann auf dem Tisch aus.
Er hatte ein paar Franc dabei, noch ganz neu, mit Napoleon IV. drauf, der ungefähr so alt aussah, wie er gegenwärtig war. Dann war da ein Zigarettenetui. Die Zigaretten sahen selbstgedreht aus, aber der Tabak roch gut. Aus derselben Tasche holte er ein kleines Döschen hervor, mit einem emaillierten Deckel und dem winzigen Bildnis eines Schiffs darauf. Er hielt es erst für eine Schnupftabakdose, doch als er es aufmachte, fand er Streichhölzer darin. Zuletzt zog er zwei Bahnfahrkarten aus seiner Innentasche. Zweimal einfache Fahrt nach Gare du Roi von Glasgow aus. Der Schaffner hatte mit seiner Zange das »Glas« weggeknipst.
Joes Herz setzte für einen Moment aus. Zwei Fahrkarten.
Er wandte sich zur Tür und wollte der Schwester nachlaufen, wurde sich dann aber klar, dass er ja gar nicht wusste, wen sie für ihn suchen sollte. Beklommen legte er die Fahrkarten beiseite und versuchte, wie der Arzt es ihm geraten hatte, nicht mehr daran zu denken, und ging nach unten, um sich umzuschauen. Doch sooft er sich auch sagte, dass der Mann, der ihm geholfen hatte, es bemerkt hätte, wenn da noch jemand anderer gewesen wäre, oder dass er selbst einfach nur zufällig einen herumliegenden Fahrschein eingesteckt hatte, konnte er doch die Gewissheit nicht abschütteln, dass er, ohne sich dessen bewusst zu sein, von jemandem fortgegangen war, der nach ihm Ausschau gehalten hatte. Und je länger er darüber nachdachte, desto sicherer wurde er.
Erneut versuchte er mit aller Kraft, sich an den Zug zu erinnern, an den Waggon, ob es dort eine Frau mit dunklem Haar gegeben hatte, der Grün gut stand, aber er konnte sich an keinen einzigen Menschen erinnern.
»Madeline … Mach schon, sie heißt Madeline«, sagte er sich laut und versuchte seinem Hirn nur einen kurzen Blick hinter jenen Schleier des Vergessens zu entlocken.
Vergebens.
Er konnte nur hoffen, dass sie weiterhin nach ihm suchte.
Mit dem Gefühl, nur halb anwesend zu sein, geisterte er den Rest des Tages durch die offenen Räume im Erdgeschoss und durch die Gärten, die voller Kirschbäume waren. Dass Letztere ihm so gut gefielen, brachte ihn auf die Idee, dass er Gärten nicht gewohnt war, aber das war nur eine Vermutung. Später versuchte er, ein Buch zu lesen, was ihm aber nicht gelang, denn das Gefühl der Enge in seiner Brust wollte nicht lange genug weichen, um sich hinreichend zu konzentrieren. So hielt er sich stattdessen an die Zeitungen. Die meldeten lauter ganz gewöhnliche Dinge. Der Kaiser residierte für die Saison im Buckingham-Palast, nachdem er jüngst aus Paris eingetroffen war; im St. Jacques’ Park fanden die ganze Woche Volksfeste mit Feuerwerk statt. Nach umfangreichen Tiefbauarbeiten, die dazu dienten, die Weingärten korrekt zu beheizen, schossen die Preise für Plantagen in Cornwall in die Höhe, und auch die Preise für Leibeigene stiegen, da die Besitzer so viele von ihnen beim Ausheben der Schächte und der Aufrechterhaltung des warmen Luftstroms verschlissen. Der sonst so blühende Leibeigenenmarkt in Truro war fast wie leergefegt. Auch er selbst tauchte in einer Kleinanzeige der Abendausgabe auf. Joseph Tournier, Patient mit Gedächtnisverlust in La Salpêtrière, bittet Angehörige, sich zu melden.
Es änderte sich nichts. Die ganze Nacht saß er wach und versuchte seinem Gedächtnis etwas abzulauschen. Doch je länger er lauschte, desto leerer klang es. Die winzige Erinnerung an Madeline aber war echt. Er sah sie vor sich, wenn er an sie dachte, und so dachte er mit aller Kraft an sie. Er nannte dem Arzt ihren Namen. Der versprach, das an die Polizei weiterzuleiten, setzte aber einen düsteren Blick auf, als Joe sagte, er wisse immer noch nicht, wo er wohne. Dienstag, der letztmögliche Tag seines Aufenthalts, rückte näher.
Am Samstagmorgen kam dann doch jemand, und es war ein unerwarteter Jemand: ein ausgesprochen akkurat gekleideter weißer Herr, der eine purpurrote Krawatte trug. Als der Arzt ihn ins Besuchszimmer geleitete, erstarrte Joe und fragte sich unwillkürlich, wen er verärgert haben könnte, doch der Herr atmete auf und lächelte.
»Du bist es! Ach, Joe. Erkennst du mich?« Er sprach Französisch, Pariser Französisch.
»Nein«, sagte Joe leise. Sein Magen krampfte sich zusammen. Es war undenkbar, dass er mit so jemandem normalen Umgang pflegte. O Gott, was, wenn der Arzt recht gehabt und er tatsächlich etwas mit den Saints zu tun hatte? Dieser Mann war so gut gekleidet, er konnte durchaus ein Polizeikommissar sein oder einer jener Staatsdiener, die sich einem höflich vorstellten, ihre rote Dienstmarke zeigten und einen dann in eine sogenannte Verhöreinrichtung mitnahmen.
Urplötzlich ärgerte er sich über sich selbst. Wie konnte es angehen, dass er etwas über rote Dienstmarken und Verhöreinrichtungen wusste, aber nichts darüber, wer Madeline war und wo verdammt noch mal er hingehörte?
»Ich bin Monsieur Saint-Marie. Ich bin dein Herr. Du gehörst meinem Haushalt an, seit du ein kleiner Junge warst.« Er sagte das ganz freundlich. »Ich habe gehört, es fällt dir schwer, dich an bestimmte Dinge zu erinnern.«
Joe stockte der Atem, denn er hatte instinktiv »Sehr erfreut, Sie kennenzulernen« sagen wollen, was natürlich vollkommen unpassend war. »Tut mir leid, aber …«, murmelte er stattdessen und verstummte. Dieser Herr wirkte viel zu stattlich für das Besuchszimmer.
»Das ist jetzt nicht vordringlich«, beeilte sich der Arzt zu sagen. »Vielleicht Madame Tournier?«
Joe hob flugs den Blick. Vielleicht war es Madeline.
Jedes Atom in ihm wollte, dass sie es war. Er konnte sich zwar immer noch nicht richtig an sie erinnern, aber es wäre immerhin mal etwas, und sie zu sehen, würde ihm helfen, das wusste er – und auch sie selbst würde ihm helfen, denn wenn es eines gab, was er über sie wusste, dann, dass sie bei allem helfen konnte. Sie war einer jener Menschen, die durch Wände gehen konnten und es dabei kaum bemerkten.
Die Beobachterstimme in seinem Hinterkopf wies ihn darauf hin, dass er sich, ihrer bescheidenen Meinung nach, ziemlich so anhörte, als würde er sich da eine Märchenfrau zusammenspinnen.
Sei still, sei still.
Es gab sie wirklich. Vielleicht stand sie sogar draußen vor der Zimmertür.
»Madame Tournier?«, fragte er. Seine Stimme klang angespannt.
»Ja«, bestätigte der Herr. Er wirkte ein wenig besorgt, sagte aber nichts dazu. »Ich gehe sie holen.«
Joe wartete und fühlte sich, als würde er gleich platzen. Weder der Arzt noch er sprachen auch nur ein Wort. Die Einzelheiten des Zimmers strapazierten seine Nerven. Das einzige Geräusch kam von schabendem Glas in der Nähe des Fensters, denn der Gärtner war hereingekommen, um die Farne zu befeuchten, die einige Patienten unter Glashauben kultivierten. Nacheinander hob er die Hauben an und setzte sie, nachdem er die Farne mit einem Zerstäuber besprüht hatte, wieder ab. Im Garten sprach der Mann, der behauptete, über das Wetter herrschen zu können, zu einem Kirschbaum.
Der Arzt spielte mit seinem Füllfederhalter, zog die Kappe ab und schob sie klickend wieder drauf. Eine wutglühende Sekunde lang fand Joe, er habe eine Handgranate in die Schnauze verdient.
Na, na, na, sagte die Stimme, vielleicht wärst du ja doch ein guter Anführer für die Saints.
Draußen vor der Tür waren Schritte zu hören.
»Hallo noch einmal«, sagte der Herr, als er wieder hereinkam. Dann hielt er jemandem die Tür auf. »Hier ist Madame Tournier.«
Joes Herz schwoll an – und fiel gleich darauf wieder in sich zusammen.
Sie war es nicht. Nichts an der Frau, die ihm als Madame Tournier vorgestellt wurde, kam ihm bekannt vor. Ihre Kleider waren schlicht, aber gut gebügelt, und als sie leise »guten Morgen« sagte, sprach sie mit jamaikanischem Akzent. Ihre Bewegungen waren so flink und präzise, dass Joe sich unwillkürlich fragte, ob sie wohl Gouvernante oder Krankenschwester war.
»Ich bin Alice. Erkennst du mich?«, fragte sie. Sie war sehr jung. Joe sah von ihr zu dem Herrn hinüber und hätte am liebsten empört gefragt, wie um alles in der Welt sie auf die Idee kämen, dass er mit ihr verheiratet sein könnte – er war doch mindestens doppelt so alt wie sie. Doch keiner der beiden schien das irgendwie ungewöhnlich zu finden. Sie sahen ihn nur erwartungsvoll an, der Herr nervös und Madame Tournier, als sei sie dieses ganzen Theaters überdrüssig. Joe sah ihr an, dass es ihr egal war, ob er sie erkannte oder nicht.
»Nein«, sagte er, und es klang empört.
Da wirkte der Herr sogar noch nervöser, und Alice Tournier riss der Geduldsfaden.
»Natürlich kennst du mich«, sagte sie zu ihm.
Joe wollte widersprechen, wollte gar aus dem Zimmer fliehen. Sie war im Grunde noch ein Kind. Doch der Arzt war schon bei ihm und hielt seine Schultern fest.
Alice hatte sogar eine Fotografie mitgebracht. Als der Arzt sie dann zurück ins Wartezimmer geleitete, starrte Joe das Bild an. Es war am Tag ihrer Hochzeit aufgenommen, und es musste mit einer guten Kamera gemacht worden sein, denn sie beide hatten nicht den steifen Blick, den Leute hatten, die drei oder vier Minuten lang still halten mussten. Glücklich sahen sie aber auch nicht aus. Seinen eigenen Gesichtsausdruck vermochte er nicht recht zu deuten. Verschlossen, neutral. Es war aber nicht sein Ruhegesicht, aus dem eher eine Art bohrende Aufmerksamkeit sprach, die ihn selbst beim Rasieren wirken ließ, als würde er ein Physiklehrbuch studieren.
»Joe«, sagte der Arzt, als er wiederkam, in ernstem Ton. »Monsieur Saint-Marie hat uns mitgeteilt, dass du ein Leibeigener bist. Du bist vor zwei Monaten verschwunden. Die Gendarmerie hat nach dir gesucht. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit.« Er klopfte bei jedem Wort mit dem Ende seines Füllfederhalters gegen eine der goldfarbenen Nieten an der Armlehne seines Stuhls. Die Stühle waren alle sehr prächtig, aber auch sehr alt. Jemand hatte erzählt, sie seien von einem Gentleman’s Club gestiftet worden, was gut sein konnte, denn wenn man sich mit viel Schwung darauf niederließ, drang ein wenig Zigarrenqualm aus den Polstern hervor. »Du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Erinnerst du dich wirklich nicht – oder bist du vielleicht weggelaufen und hast es dir dann anders überlegt? Falls Letzteres zutrifft, kannst du es mir ruhig sagen. Monsieur Saint-Marie will keine Anzeige erstatten. Er will einzig und allein, dass du wieder nach Hause kommst.«
»Nein!«, sagte Joe und musste sich dann zwingen, sich wieder zu beruhigen, denn die Miene des Arztes versteinerte sich, und er sah aus, als würde er gleich den kräftigen Pfleger mit den Beruhigungsmitteln rufen. »Nein. Mir ist klar, wie das aussieht, aber …«
»Ich tendiere dazu«, sagte der Arzt langsam, »dir zu glauben. Und das werde ich auch in deiner Krankenakte vermerken – von der die Gendarmerie eine Abschrift erhält. Das wird dich selbst dann vor strafrechtlicher Verfolgung bewahren, wenn dein Herr seine Meinung ändern sollte.« Dabei sah er keine Sekunde so aus, als ob er ihm glaubte. Es lag eine gewisse Gekränktheit in seinem Blick.
Joe nickte und hatte das Gefühl, erneut die Kontrolle über alles verloren zu haben. Ein Leibeigener. Vielleicht sogar ein entflohener. Er schluckte. »Hören Sie: Ich habe diese Frau noch nie gesehen. Meine Frau heißt Madeline. Ich bin mir da ganz sicher.«
»Fehlerinnerungen sind in solchen Fällen ganz normal. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Madeline tatsächlich existiert. Das Gefühl, sich an sie zu erinnern: Das ist eine Halluzination.«
»Aber ich hatte zwei Zugfahrkarten –«
»Joe, wir haben deinen Fall in der überregionalen Presse und auch in allen Lokalblättern annonciert. Glaubst du nicht, dass sie dich inzwischen gefunden hätte, wenn sie wirklich nach dir suchen würde?«
Joe konnte nur auf den Teppich hinabstarren.
Der Arzt musterte ihn eine Weile. »Madame Tournier besitzt eine Fotografie; das scheint mir Beweis genug. Und du musst auch bedenken: Wenn du diese Leute von dir weist, sieht es noch viel mehr nach einem Fluchtversuch aus. Kein ärztliches Attest könnte die Gendarmerie dann davon abhalten, Ermittlungen anzustellen.«
»Aber –«
»Ich werde dir jetzt mal ganz genau sagen«, blaffte der Arzt ihn an, »was die Gendarmerie behaupten wird. Die werden behaupten, dass du einer der vielen englischen Leibeigenen bist, die beschlossen haben, sich den Saints in Edinburgh anzuschließen. Du hast dich hier aus dem Staub gemacht, aber als du dann dort ankamst, musstest du leider feststellen, dass es gar nicht das wundersame Gelobte Land ist, sondern ein abscheulicher Saustall, voller Fanatiker, aber ohne was zu futtern, und daraufhin hast du halt beschlossen, in die Heimat zurückzukehren, und hast dir eine Amnesiegeschichte zurechtgelegt, in dem Wissen, dass es sich dabei um ein sehr weit verbreitetes Krankheitsbild handelt, was dir so ziemlich jeder erzählt haben könnte oder was du vielleicht auch in der Zeitung gelesen hast. Im besten Falle wird die Gendarmerie glauben, dass du dich einfach nur äußerst dumm verhalten hast; im schlimmsten Falle aber werden sie davon ausgehen, dass du keineswegs die Nase voll hattest und deshalb zurückgekehrt bist, sondern vielmehr in den Süden geschickt wurdest, mit dem schrecklichen Auftrag, einen Zug in die Luft zu sprengen. Und ehrlich gesagt, könnte ich es niemandem verdenken, der glauben würde, dass du genau das getan hättest.«
Joe fühlte sich in die Enge getrieben. Monsieur Saint-Marie und Alice hätten irgendwer sein können – das Ganze könnte ein einziger Schwindel sein, der damit enden würde, dass er an eine Plantage in Cornwall verkauft wurde.
Wenn er sich aber weigerte, mit ihnen zu gehen, und stattdessen in einem Gebäude der Gendarmerie verschwand, würde er nie wieder das Tageslicht erblicken. Er hatte keine klare Vorstellung davon, was mit entflohenen Leibeigenen geschah, wusste aber, dass er auf einem sehr schmalen Steg über einem sehr dunklen Abgrund balancierte, und unten in der Tiefe hörte er, wie sich etwas regte. Er ertappte sich dabei, dass er den Kopf abwandte, um von dieser Vorstellung wegzukommen. Er wollte auf keinen Fall sehen, was dort unten auf ihn lauerte.
Als er den Blick wieder hob und den Arzt ansah, ging ihm allerdings auf, dass er, wenn er kein Leibeigener wäre, sich gar nicht so fühlen würde. Menschen, die in Sicherheit lebten, hatten keine solchen Abgründe in den Grundfesten ihres Geistes. Die hatten eher einen netten Weinkeller.
»Also gut, ich gehe mit ihnen«, sagte er.
Der Arzt hob die Augenbrauen. »Kluge Entscheidung.«
Und so ging Joe mit Alice Tournier und Monsieur Saint-Marie zu einem Haus, das er nicht kannte. Es befand sich in einem heruntergekommenen Teil von Clerkenwell, und die Zimmer hatten hohe Decken und waren mit Möbeln eingerichtet, die sechzig Jahre zuvor recht kostspielig gewesen sein mussten. Monsieur Saint-Marie schloss Joe in die Arme und hieß ihn, ein wenig tränenreich, zu Hause willkommen. Er kam Joe vor wie eine Glucke, die ein verloren geglaubtes Küken wiedergefunden hatte.
»Ich bin nicht weggelaufen«, sagte Joe. Sein ganzer Brustkorb fühlte sich wie eingezwängt an. »Glaube ich zumindest.«
Monsieur Saint-Marie schüttelte den Kopf, noch bevor Joe zu Ende gesprochen hatte. »Natürlich hast du das nicht getan. Du bist so ein hübscher Junge; jemand wird dich geraubt haben, und der hat dir dann an der falschen Stelle einen Schlag auf den Kopf verpasst.«
Das brachte Joe ein wenig aus dem Gleichgewicht. Er hatte wohl tatsächlich ein einnehmendes Lächeln, das hatte er im Krankenhaus festgestellt – nachdem er erst einmal zu lächeln begonnen hatte, waren die Schwestern plötzlich überaus freundlich zu ihm gewesen –, aber auf den Gedanken, dass er eventuell entführt worden war, war er überhaupt noch nicht gekommen. Er war ja, das hatte er die ganze Woche schon gedacht, ein seltsam aussehender Mensch: Er hatte glattes braunes Haar, aber seine Gesichtszüge wirkten nicht europäisch, und seine Haut war zwei Nuancen zu dunkel, als dass er ausschließlich aus diesen nördlichen Breiten stammen konnte. Einer seiner Mitpatienten hatte ihn für einen Südfranzosen gehalten, einer der Ärzte für einen Perser, und eine Frau hatte behauptet, er sehe ein wenig slawisch aus, und ihn gefragt, ob er ihren Vetter Ivan kenne.
»Du wärst sehr wertvoll auf dem Schwarzmarkt, auch ohne Abstammungsnachweis«, sagte Monsieur Saint-Marie. »Es wimmelt dort nur so von Walisern, und du glaubst nicht, wie hässlich die sind. Nein, du hast es wieder nach Hause geschafft. Gott sei Dank! Falls die Gendarmerie doch Schwierigkeiten macht, sollen sie sich an mich wenden. Ich bin verantwortlich für dich, und daher trifft mich die Schuld.«
»Äh … habe ich denn überhaupt einen Abstammungsnachweis?«, fragte Joe, der gern gewusst hätte, woher er kam, und sei es auch nur, weil es vielleicht erklärt hätte, wo er vor dem Bahnhof gewesen war.
»Nein, tut mir leid. Du stammst aus … äh, inoffizieller Zucht. Ein braves Mädchen aus Whitechapel.«
Whitechapel war nicht in der Nähe von Glasgow, so viel wusste er. Er hätte sich dafür interessieren sollen, hätte sich wie ein Bluthund in das Thema seiner Eltern verbeißen sollen, aber es war nur ein weiterer Winkel in dem großen Gebäude seiner Unwissenheit.
»Deinen Bruder haben wir natürlich auch von ihr. Ihren Ehemann habe ich leider nie kennengelernt«, sagte Monsieur Saint-Marie leicht verlegen. »Ich glaube aber eher, sie hat Kinder auf Bestellung bekommen. Alles Mischlinge und alle sehr hübsch – sie hat uns Fotografien gezeigt. Toby hat ziemlich orientalisch ausgesehen, aber vielleicht hattet ihr auch keinen gemeinsamen Vater, und daher kann ich das nicht genau sagen … Aber das ist ja nun auch egal. Wie fühlst du dich, wie geht es dir?«
Er schaute Joe mit hoffnungsvoller Miene an. Alice wirkte eher niedergeschlagen. Joe ließ den Blick durch das Wohnzimmer schweifen. Auf dem Boden lagen ausgeblichene Seidenteppiche, und dann stand da ein Regency-Sofa, das jedoch angesichts der Löcher im Polster wohl mehr zum Abstauben als zum Sitzen diente. Rohre röchelten in den Wänden. Joe erkannte nichts von alldem wieder.
Laut beteuerte er jedoch, dass ihm nun, da er wieder da war, das alles sehr vertraut vorkam.
3
Die Erinnerungen kamen nicht wieder.
Joe versuchte noch einmal in La Salpêtrière vorzusprechen, doch man sagte ihm, dass Leibeigene ohne den für sie verantwortlichen Bürger keine Termine vereinbaren könnten und er Monsieur Saint-Marie fragen müsse. Der ging zum Glück sogleich mit ihm dorthin. Der Arzt vermutete einen Tumor, was sich aber ohne Operation nicht feststellen ließe, und bei so etwas sei die Sterberate so hoch, dass es eher einer sehr kostspieligen Hinrichtung gleichkomme. Die gute Neuigkeit sei, dass es zu keinen weiteren Amnesieanfällen gekommen war und sich die Sache daher wahrscheinlich nicht als tödlich erweisen würde. Der Arzt trug all das in der schalkhaften Manier eines Mannes vor, der keinen Moment daran glaubte, dass Joe überhaupt ein Problem hatte. Monsieur Saint-Marie beschwerte sich anschließend schriftlich über seine Impertinenz.
Dass Joe sich an nichts erinnern konnte, erwies sich jedoch als gar nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Monsieur Saint-Marie war ganz reizend zu ihm und entpuppte sich als sogar noch größerer Hasenfuß, als Joe anfangs gedacht hatte. Bei Alice war er sich nicht so ganz sicher, aber Monsieur Saint-Marie meinte, das sei nicht anders zu erwarten gewesen. Alice hätte eigentlich Joes Bruder heiraten sollen, doch dann war Toby ein halbes Jahr zuvor in der Nähe von Glasgow gefallen; und stattdessen Joe zum Mann zu nehmen, war anscheinend die einzige Möglichkeit gewesen, wie sie ihrer schrecklichen Herrin entkommen und im Hause des behäbig-gutmütigen Monsieur Saint-Marie verbleiben konnte, der nur auf der Grundlage einer Heiratslizenz, die Joe nicht durchschaute, eingewilligt hatte, sie zu kaufen, und diese Lizenz wäre verfallen, wenn sie niemanden geehelicht hätte.
Joe drehte all das lange in Gedanken hin und her, konnte sich aber dennoch weder an einen Bruder noch an seine eigene Hochzeit erinnern.
Er war jedoch froh, Alice und Monsieur Saint-Marie zu haben. Die Außenwelt machte ihm Angst. Joe kannte Londres – und kannte es doch nicht. Er fand sich dort einigermaßen zurecht, wusste, wo all die Métro-Stationen waren und wie man den Fahrkartenkauf und andere alltägliche Kleinigkeiten erledigte – aber er kannte weder die Straßennamen noch die Namen der Stationen, und als Monsieur Saint-Marie ihn das erste Mal aufforderte, zum Markt zu gehen, um Lebensmittel einzukaufen, bekam er es mit der Angst zu tun. Saint-Marie bemerkte das.
»Ach, Joe«, sagte er. »Du gehst doch nicht allein; das darfst du doch gar nicht; das wäre ja illegal. Du gehst mit Henrique von gegenüber; den kennst du doch: Der in der Küche von Madame Finault tätig ist? Und ihr passt schön aufeinander auf.«
»Ach ja«, brachte Joe erleichtert hervor. Henrique war ein leicht zu beunruhigender Deutscher, und wenn sie gemeinsam die Wäsche aufhängten, schwatzten sie manchmal miteinander, hauptsächlich über einen fortwährenden Zwist, den Henriques Herrin mit der Herrin von jemand anderem austrug und bei dem es um die Gemeinderatswahlen ging. Henrique fürchtete, das würde noch so weit eskalieren, dass er eines Tages herausfinden müsste, wie man Rotwein aus Seide herausbekam.
Monsieur Saint-Marie zeigte ihm eine offiziell aussehende Karte mit Stempelfeldern darauf. Oben war Joes Name und eine lange Leibeigenen-Registriernummer aufgedruckt. »Das ist eine Verantwortungskarte. Die zeigst du bei der Zeitungshändlerin vor – ihr Stand ist an einer Ecke des Markts, Henrique weiß, wo das ist –, und sie gibt dir dann einen Stempel, zum Zeichen, dass du wohlbehalten dort angekommen bist. Wenn einem Leibeigenen etwas geschieht, verstehst du, und er dann aufgefunden wird, schauen die Gendarmen auf der Verantwortungskarte nach, wo er zuvor gewesen ist. Da stehen mein Name und meine Adresse drauf, und daher wissen sie dann, wo du hingehörst.«
Joe nickte. »Wie ein Reisepass.«
»Genau.« Monsieur Saint-Marie tätschelte Joe den Rücken. »Wir werden dich nicht noch mal verlieren. Und mach dir keine Sorgen, dass du das mit der Karte mal vergessen könntest. Du kannst erst etwas einkaufen, nachdem du den Händlern den Stempel vorgezeigt hast. Und hier hinten drauf, das ist die offizielle Liste der Dinge, die du nicht kaufen darfst. Alkohol und scharfe Gegenstände. Ich meine, nicht dass so etwas auf deinem Einkaufszettel stehen würde, aber, na, du weißt schon.« Joe sah, wie er krampfhaft nach einem Grund suchte, der nichts mit einem Fluchtversuch zu tun hätte. Saint-Marie hatte sich große Mühe gegeben, Joe wissen zu lassen, dass er ihm das nicht unterstellte. »Falls irgendwelche Kinder dich bitten sollten, etwas für sie zu kaufen, oder so …«
»Verstehe.«
»Braver Junge.« Mit feuchten Augen ergriff er Joes Arm. »Du schaffst das doch gemeinsam mit Henrique, nicht wahr?«
Joe lächelte. Er konnte nachvollziehen, warum Alice all das hasste, doch in der Geistesverfassung, in der er sich in letzter Zeit befand, war es gut zu wissen, dass es viele Leute gab, die darauf achteten, dass er am richtigen Ort war und nicht verloren ging. »Ja.«
»Na bestens. Hier ist der Einkaufszettel. Wenn du in einer Stunde nicht zurück bist, lass ich die Gendarmen nach dir suchen. Und nun gib mir einen Kuss, mein Hübscher.«
Joe tat wie geheißen, auch wenn er sich am liebsten weggeduckt hätte. Aus der Nähe hatte Saint-Marie etwas von Krepppapier, das erst zusammengeknüllt, dann wieder glatt gebügelt und schließlich zu lange in der Sonne liegen gelassen worden war. Er roch nach einem altmodischen Parfüm, das die unangenehme Eigenschaft hatte, noch lange, nachdem man ihn berührt hatte, an einem zu haften. Es wäre jedoch überaus dumm gewesen, ihn gegen sich aufzubringen. Die Gendarmen waren nie weit entfernt.
Henrique kannte da keinerlei Mitgefühl. Seine Herrin verlangte ständig absurde Dinge von ihm, und er wäre sehr froh, sagte er, wenn es weiter nichts als ein Küsschen auf die Wange wäre. Wenn Joe wollte, könnten sie ja tauschen, sagte er, um dann gleich darauf zu unken, dass Joe Saint-Marie ums Verrecken wiederhaben wollen würde, nachdem er eine Woche lang herauszufinden versucht hatte, wo in Gottes Namen es Kolibridaunen für ein Puppenhauskissen zu kaufen gab.
»Stockentenfedern sehen ganz ähnlich aus«, erwiderte Joe und überraschte sich selbst damit. Er war immer noch dabei, sich selbst kennenzulernen, und ihm war gar nicht klar gewesen, was er alles wusste.
Henrique schärfte ihm ein, sich das lieber nicht anmerken zu lassen, weil es ihm nur schaden würde, dann aber ertappte Joe ihn dabei, wie er mit nachdenklicher Miene ins Fenster der Metzgerei spähte.
An der Fassade des Geschäfts hatte jemand einen krakeligen Schriftzug hinterlassen. Auf Englisch stand da:
WOSINDDENNALLE??
Joe hatte mit einem Mal ein ungutes Gefühl in der Magengegend, von dem er nicht wusste, woher es kam. Es fühlte sich an, als wäre in seinem Innern ein Fahrstuhl defekt. »Was bedeutet das?«
Henrique würdigte den Schriftzug nur eines kurzen Blickes. »Ach, diese Spinner …«, sagte er verärgert. »Es ist gerade Wahlkampf. Das, was mit dir passiert ist, die Epilepsie und dann die falschen Erinnerungen …? Das passiert vielen Leuten. Bloß dass manche von denen zu blöd sind, um zu kapieren, was Epilepsie ist. Die glauben tatsächlich, ihre Verwandten wären verschwunden und die Regierung hätte sie unter Drogen gesetzt und alle Aufzeichnungen vernichtet.«
»Aber könnte das nicht sein? Dass sie unter Drogen gesetzt wurden oder …«
Henrique schnaubte. »Also, zu meiner Herrin kommt oft ein Herr zu Besuch, der im Senat sitzt, und wenn die alle so sind wie der, dann kann die Regierung nicht mal einen einzigen Süchtigen zum Opiumrauchen bringen, geschweige denn, ganz England unter Drogen setzen.« Er drückte Joe die Schulter und sagte weiter nichts dazu.
Joe musste zugeben, dass er sich nicht vorstellen konnte, wie oder warum jemand das zustande gebracht haben sollte. Doch nachdem er den Schriftzug einmal gesehen hatte, entdeckte er ihn auch andernorts: auf den Seiten alter Karren, in öffentlichen Toiletten (selbst dort musste er die Verantwortungskarte abstempeln lassen) und eines Tages auch außerhalb der St.-Pauls-Kathedrale. Und jedes Mal wenn er den Schriftzug sah, musste er an Madeline denken.
Drei Monate später hatte Joe die Mansarde des Hauses durch seine Zwangsarbeit schließlich abbezahlt und war nach fünfunddreißig Dienstjahren offiziell ein freier Mann. Monsieur Saint-Marie gab ihm zu Ehren ein kleines Fest und schluchzte dabei ein wenig in seinen Wein. Joe schloss ihn in die Arme und hatte ein schlechtes Gewissen. Saint-Marie wurde älter und ärmer; inzwischen reiste er in der Saison nicht mehr nach Paris. Die meisten seiner Freunde hatten sich längst von ihm abgewandt, und nun musste es ihm vorkommen, als geschehe ihm das auch in seinem eigenen Haushalt.
»Ich weiß, du bist jetzt ein erwachsener Mann, ich weiß … aber du bist nun einmal bei mir, seit du ein kleiner Junge warst. Ich kann die Vorstellung gar nicht ertragen, dich jetzt in die Welt hinauszuschicken, wo du ganz allein für dich verantwortlich bist …«
»Sie Dummerchen«, sagte Joe gerührt. »Sie schicken mich nirgendshin. Ich wohne doch auch weiter hier in der Mansarde. Ich habe schließlich lange genug dafür gearbeitet.«
»Du gehst nicht weg?«
»Nein«, sagte Joe und lächelte, als Saint-Marie erleichtert auflachte. Es war das erste Mal seit dem Gare du Roi, dass er ein Gefühl von Zugehörigkeit empfand.
Alice war überglücklich über ihre Freiheit – sie verbrannte alle ihre alten Verantwortungskarten in einem Topf auf der Fensterbank und färbte anschließend ihr graues Alltagskleid mit Wein dunkelrot –, Joe aber gefiel es gar nicht. Er fühlte sich ungeschützt, wenn er ohne Stempelkarte oder ohne Henrique auf die Straße ging. In der Woche, in der er sich auf Arbeitssuche machte, während das Wetter in bittere Kälte umschlug, wurde er zweimal ohne ersichtlichen Anlass von Gendarmen angehalten und durchsucht. Beim zweiten Mal fragte er nach dem Grund und bekam dafür einen Schlagstock in die Rippen gestoßen. Als er Saint-Marie davon erzählte, schnitt der das Schottenkarofutter aus seinem Mantel heraus. Es zu verlieren, ging Joe weit mehr gegen den Strich, als er zu sagen wagte – dieser Schottenstoff zählte zu den wenigen Dingen, die ihn in jener verlorenen Zeit überallhin begleitet hatten –, aber danach ließen die Gendarmen ihn in Ruhe.
Die nächsten Tage mochte er nicht aus dem Haus gehen, doch am Montag darauf blieb ihm nichts anderes mehr übrig, als sich zusammenzureißen. Es war Mitte Dezember und selbst um neun Uhr morgens noch schummrig draußen. Die aus den Schloten der Stahlwerke lodernden Flammen wirkten wie ein orangenes Sternbild über den funzeligen Straßenlaternen, die zu allem Übel auch noch flackerten: Immer war irgendwas mit den Gasleitungen nicht in Ordnung.
Vor der Hintertür prallte er mit dem Postboten zusammen, der daraufhin kreischte. Sichtlich verärgert, dass er ein so unmännliches Geräusch von sich gegeben hatte, hielt er Joe ein Stück Papier und einen Stift vor die Brust.
»Monsieur Tournier? Hier unterschreiben.«
»Wofür?«, fragte Joe, der nichts bestellt hatte und niemanden kannte. Er sah auf das Formular hinab. Da war eine Linie für die Unterschrift, und darunter stand in kleinen, durchscheinenden Lettern: Empfänger / verantwortlicher Bürger des Empfängers. Er zögerte, denn er hatte noch gar keine eigene Unterschrift, und schrieb dann einfach in seiner normalen Schrift: J. Tournier.
»Ein Brief«, sagte der Postbote nicht sehr entgegenkommend. Er guckte allerdings neugierig. »Den haben sie jetzt eine Ewigkeit auf dem Hauptpostamt zurückgehalten. Dreiundneunzig Jahre.«
»Was? Warum das denn?«
»Weil er am angegebenen Tag zugestellt werden sollte, und heute ist es der angegebene Tag«, erwiderte er kurz angebunden und stapfte, nachdem Joe den Empfang quittiert hatte, von dannen, so als wäre es etwas noch Schlimmeres als das unmännliche Kreischen, wenn er seiner Neugierde nachgegeben hätte.
Verblüfft sah Joe auf den Brief hinab. Das Kuvert war so alt, dass es tatsächlich vergilbt war. Er öffnete es, so vorsichtig er nur konnte. Darin befand sich die erste Seite einer alten Zeitung. Sie war auf das Jahr 1805 datiert und stammte damit aus der Zeit kurz nach der Invasion, als die Zeitungen auf Französisch umgestellt wurden und sich noch ganz einfach ausdrücken mussten, weil die Engländer es sonst nicht verstanden hätten.
Und dann steckte da auch noch eine Postkarte in dem Kuvert. Auf der Vorderseite war eine Radierung, die einen Leuchtturm zeigte. Darunter stand in gestochener Handschrift:
LEUCHTTURMEILEANMÒR
ÄUSSEREHEBRIDEN
Die Nachricht auf der Postkarte war kurz und in einer altmodischen verschnörkelten Handschrift verfasst, die Joe nur mit Mühe entziffern konnte. Er starrte das Ganze eine Zeit lang an, denn schriftliches Englisch sah er sonst nur als Schmiererei an Hauswänden.
Liebster Joe,
komm nach Hause, wenn du dich erinnerst.
M
Unwillkürlich sah er nach links und rechts die Straße hinab und zuckte zusammen, als er nicht weit entfernt einen Gendarm auf Streife erblickte. Er huschte ins Haus zurück, schloss die Tür hinter sich und musste sich dann eine ganze Weile in der Küche an der Tischkante festhalten. Wenn der Postbote noch auf ein Schwätzchen geblieben wäre und die Aussichtskarte mit der englischen Aufschrift und dem Ort in Schottland darauf gesehen hätte, dann käme wohl jener Gendarm nun angerannt.
M … stand vielleicht für Madeline. Bloß dass er Madeline in der Gegenwart kannte und nicht aus einem hundert Jahre alten Buch oder Gemälde.
Der abgebildete Leuchtturm war ihm so vertraut, dass er ihn auch ohne die Beschriftung hätte benennen können. Eilean Mòr: Das wusste er. Er kannte die Gestalt des Turms. Ja, mehr noch: Etwas in ihm hatte seit langer Zeit nach dieser Gestalt gesucht.
Er drehte die Postkarte noch einmal um und berührte die Handschrift auf der Rückseite. Ein Instinkt sagte ihm, dass sie unmöglich vor über neunzig Jahren abgeschickt worden sein konnte und dass es sich um einen seltsamen Fehler handeln musste. Er war keine neunzig Jahre alt, und der Joe Tournier, an den der Brief adressiert war, konnte nicht er sein. Halb London hieß Joe Tournier. Die ganze alte Gentry, der niedere Adel, hatte sich während des Terrors in Tournier umbenannt. Das war in der ganzen Republik nun der verbreitetste Nachname bei Leibeigenen.
Aber er kannte diesen Leuchtturm.
Er nahm das Branchenadressbuch vom Regal. Dann suchte er eine halbe Stunde lang nach sämtlichen Personen oder Firmen, die sich eventuell mit Leuchttürmen auskannten: Architekten, Reedereien, irgendetwas. Er hatte sich bereits ein paar Namen und Adressen notiert, als er auf einen Monsieur de Méritens stieß, der Maschinen und Generatoren für den Betrieb von Leuchttürmen herstellte. Nicht wissend, was genau er fragen wollte, nur dass er sich einfach erkundigen musste, machte er sich auf den Weg. Die Postkarte behielt er in der Tasche. Er hätte sich zwar selbst mit einer Bombe als Gepäck sicherer gefühlt, brachte es aber nicht fertig, sie zurückzulassen.
Monsieur de Méritens, ursprünglich in der Rue Boursault in Paris und inzwischen auch in Clerkenwell ansässig, war Inhaber eines Staatsauftrags für alle Leuchttürme der Republik. So stand es auf dem vergoldeten Schild über dem Eingang zu seiner Werkstatt – auf Geheiß Seiner Majestät Napoleon IV. –, und an der Wand darunter hieß es auf einem Plakat, dass die dort gefertigten Generatoren elektrischen Strom für Bogenlampen mit einer Lichtstärke von bis zu achthunderttausend Kerzenstärken lieferten und über eine garantierte Laufzeit von einhundert Jahren verfügten.
Als Joe auf den großen Hof der Werkstatt zuschritt, wallten ihm Dampfschwaden entgegen, und von Schweißarbeiten regnete es Funken herab. Die Maschinen dort wirkten monströs, und in dem ganzen Dampf sahen manche der Rohrbögen wie Ellenbogen aus. Eine der Maschinen fauchte, als ein Junge versuchsweise einen Dampfstrahl durch ihre Kolben jagte, die heftig herniederfuhren. Knapp über Joes Kopf schwebte eine Ladung Stahl vorbei; der Kran war in dem Rauch nicht zu sehen. Als er sich der Werkstatt näherte, roch es immer eindringlicher nach heißem Metall und Kohle, und von den Schmelzöfen her drang Lichtschein heraus. Joe fragte jemanden nach dem Büro des Chefs und wurde auf eine Glastür verwiesen.
Monsieur de Méritens saß hinter einem breiten Schreibtisch und fuhrwerkte in einem Wirrwarr aus Papieren und Maschinenteilen herum, mit der entschlossenen Miene eines Mannes, der darauf bestand, dass bei ihm alles einem bestimmten System gehorche. Er war recht beleibt und musste in letzter Zeit noch zugenommen haben, denn er trug eine Weste, die ihm zu klein geworden war. Er murmelte mit rauer Stimme vor sich hin, was er aber nicht zu bemerken schien.
»Hallo«, sagte er, als Joe eintrat. »Kommen Sie wegen der Schweißerstelle? Ich sag’s Ihnen gleich: Wenn Sie nüchtern sind und in ganzen Sätzen sprechen, können Sie sie haben.«
»Nein«, erwiderte Joe und zögerte dann. »Ich habe eine etwas seltsame Frage. Kennen Sie zufällig … diesen Ort?« Er zeigte de Méritens die Postkarte – wobei er sie so hielt, dass er die auf Englisch verfasste Nachricht auf der Rückseite mit dem Daumen verdeckte.
De Méritens setzte eine Brille auf. »Ja, das ist der Leuchtturm von Eilean Mòr. Was soll an der Frage denn seltsam sein?«
»Wissen Sie, ob dort … in letzter Zeit etwas passiert ist? Vor drei Monaten ungefähr?«
»Etwas passiert? Nein. Der ist ja gerade erst erbaut worden. Wie meinen Sie das? Haben Sie etwa eine Beschwerde? Mein Gott, wenn Sie von der Leuchtturmdirektion sind …«
»Nein, nein, bin ich nicht«, sagte Joe verlegen. Es war bizarr, mit jemandem zu reden, der mit ihm sprach, als wüsste er irgendetwas Bestimmtes. Er kam sich dabei wie ein Betrüger vor. »Ich habe mit alldem nichts zu tun. Mein Name ist Joe Tournier. Ich wurde vor drei Monaten am Gare du Roi aufgefunden – ohne jede Erinnerung an die Zeit davor. Aber heute Morgen hat mir jemand das hier geschickt, und es kommt mir bekannt vor.«
De Méritens guckte fasziniert. »Sie sind einer dieser Amnesiefälle? Erstaunlich, erstaunlich … Aber ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann … Es ist ja, wie gesagt, ein nagelneuer Turm. Er wurde erst vor einem halben Jahr fertiggestellt.«
Joe runzelte die Stirn. »Nagelneu? Gab es dort früher schon einmal einen Leuchtturm?«
»Nein. Warum?«
»Weil …« Er musste lachen. »Diese Postkarte ist aus dem Jahre 1805.«
De Méritens hatte eine herrliche Art zu lachen: Er machte tatsächlich ho ho ho. »Ich fürchte, da will Sie jemand auf den Arm nehmen«, sagte er.
Joe steckte die Postkarte wieder ein, immer noch ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Ihm war klar gewesen, dass es nicht damit getan sein würde, eine Adresse herauszusuchen und jemanden zu fragen, und da er nicht viel erwartet hatte, war er nun auch nicht allzu enttäuscht. »Tja. Trotzdem vielen Dank, Monsieur, ich … äh, Moment. Sprachen Sie gerade von einer Stelle als Schweißer?«