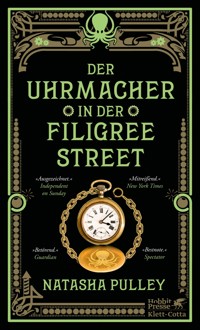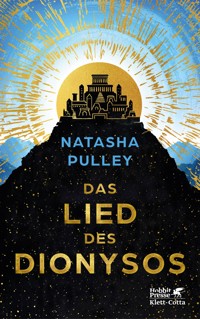12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Raffiniert, elegant und insgesamt überraschend.« New York Times »Hellseher haben eine besondere Begabung im Umgang mit der Zeit — daher war es mehr als plausibel, dass Keita Mori ausgerechnet als Uhrmacher tätig war.« Leserinnen und Leser werden in »Die verlorene Zukunft von Pepperharrow« ins Japan der 1880er Jahre entführt, wo der Nationalismus auf dem Vormarsch ist und Geister durch die Straßen streifen. Fünf Jahre, nachdem sich Thaniel Steepleton und Keita Mori in London kennengelernt haben, reisen sie, ein unscheinbarer Übersetzer, und ein Uhrmacher, der sich an die Zukunft erinnert, nach Japan, denn in Tokio gehen seltsame Dinge vor sich. Während Krieg mit Russland droht, tritt das Personal der britischen Gesandtschaft in den Streik, weil in ihrem Gebäude Geister ihr Unwesen treiben. Thaniel soll herausfinden, was hinter dem Spuk steckt. Doch dann beginnt er selbst, Geister zu sehen. Mori fürchtet sich, will – oder kann – die Gründe dafür aber nicht nennen. Und dann verschwindet er spurlos. Thaniel ist überzeugt, dass die magischen Dinge, die im ganzen Land vorgehen, etwas mit Moris Verschwinden zu tun haben - und dass Mori in großer Gefahr ist. So wird er mit der erschreckenden Offenbarung konfrontiert, dass die Zeit des Uhrmachers abgelaufen sein könnte. »Eine romantische, einfallsreiche und wunderbar fesselnde Lektüre.« Sunday Express »So filigran wie eine Origami-Skulptur.« Spectator »Entzückend, unerbittlich charmant und tief bewegend. Ein erstaunliches Buch.« Los Angeles Times »Pulleys komplizierter Plot, die lebendige Kulisse, die faszinierende Magie und das dynamische Ensemble von Charakteren sorgen für eine historische Fantasy, die man nicht aus der Hand legen kann. Neue Leser werden in den Bann gezogen, und Fans der Serie werden von dieser Tour de Force begeistert sein.» Publisher's Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Natasha Pulley
Die verlorene Zukunft von Pepperharrow
Roman
Aus dem Englischen von Jochen Schwarzer
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Lost Future of Pepperharrow« im Verlag Bloomsburry, London
© 2020 by Natasha Pulley
Für die deutsche Ausgabe
© 2023, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung der Daten des Originalverlags
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
ISBN 978-3-608-98817-8
E-Book ISBN 978-3-608-12191-9
Für Jacob
PROLOG
Der Gedanke liegt nahe, dass niemand in der Lage wäre, den Lauf der Welt so zu arrangieren, dass die einzelnen Ereignisse dem eigenen Wunsch gemäß wie in einem Uhrwerk ineinandergreifen. Alles Mögliche käme da doch in die Quere, denkt man. Und tatsächlich waren all die Königinnen und Generäle, die so etwas im Laufe der Geschichte mit aller Macht versucht hatten, meist schon an etwas so Banalem wie dem Wetter gescheitert. Nun haben Hellseher jedoch eine besondere Begabung im Umgang mit der Zeit – weshalb es einer gewissen Ironie nicht entbehrte, dass Keita Mori ausgerechnet als Uhrmacher tätig war.
Was er in seiner Werkstatt erschuf, erkannte man meist erst, wenn es fertig war. Ein wohlgeordnetes Chaos kennzeichnete seine Arbeitsweise, was so weit ging, dass er ewig an etwas bauen konnte, das nur wie ein befremdliches Gewirr aussah – bis es sich eines Tages erhob, in Bewegung setzte und sich als Oktopus entpuppte. Noch undurchschaubarer war sein Tun, wenn er nicht mit Stahl, sondern mit der Zeit hantierte. Nur wer ihn sehr gut kannte, entdeckte eventuell, dass er etwas arrangierte, und erspähte die Umrisse der Tentakel. Einem derart geschulten Blick wäre womöglich nicht entgangen, dass am letzten Oktobertag des Jahres 1888 in Sankt Petersburg ein solcher Tentakel Gestalt anzunehmen begann.
• • •
Pjotr Kusnezow war überrascht, als ihm Mori, den er fünf Jahre nicht gesehen hatte, eine Einladung zum Kaffee im Hotel Angleterre zukommen ließ.
»Ausgerechnet das Scheiß-Angleterre«, knurrte Pjotr, als er die Straße überquerte, und erschreckte damit einen dort Schnee schippenden Jungen.
Auf der offiziellen Ebene hasste Japan alle anderen. Es war eines jener verlockend reichen und zugleich unterentwickelten Länder, in die sie alle – Großbritannien, Russland, Amerika – unbedingt einmarschieren wollten; doch da Russland am nächsten dran war, rangierte es auf der Tokyoter Feindesliste auf Platz eins. Pjotr und Mori hätten niemals miteinander befreundet sein dürfen – davon ging man bei Geheimdienstoffizieren verfeindeter Staaten einfach aus. Sie waren allerdings ihre ganze Laufbahn hindurch gewissermaßen Amtskollegen gewesen. Mit einem Bein hatten sie stets in oft unangenehmen oder öden Dienstpflichten gesteckt, während sie mit dem jeweils anderen auf schicken Botschaftsempfängen herumstanden. Beide hegten sie eine Abneigung gegen das Fahnenschwenken und gegen Amerikaner. Mori konnte einiges an Alkohol vertragen, und Pjotr kannte sich mit den Sumo-Regeln aus. Sie hatten viel mehr miteinander gemein als die mit den Fahnen schwenkenden Minister, für die sie arbeiteten.
Ein kleines Hemmnis in ihrem ansonsten harmonischen Verhältnis war, dass es sich bei Mori – und daran kam man nicht vorbei – um einen reichen Mann handelte. Er tat so scheußliche Dinge wie, Pjotr in Nobelhotels einzuladen – ein normaler Mensch wäre gar nicht so ohne Weiteres auch nur am Portier des Angleterre vorbeigekommen. Tolstoi logierte dort gegenwärtig. Pjotr hatte seine instinktive Scheu vor Etablissements mit vergoldeten Fresken und Schriftstellern als Dauergästen nie gänzlich abgelegt.
Mori war einige Jahre zuvor auf eigenen Wunsch aus dem japanischen Staatsdienst ausgeschieden – behauptete er zumindest. Seit einem halben Jahr bewohnte er nun eine Suite im Angleterre und fertigte dort Uhren und ähnliche Gegenstände für die Zarin. Das war die erstaunlichste Tarngeschichte, die Pjotr je gehört hatte, denn Mori fertigte dort tatsächlich Uhren und ähnliche Gegenstände für die Zarin. Sie hatte dem Innenminister einige Monate zuvor eine Taschenuhr geschenkt, und der hatte sie allen gezeigt, auch Pjotr. Es war ein Prachtstück.
Pjotr hätte sich herzlich gern ein ganzes Jahr lang Katharina nennen lassen, wenn Mori wirklich nur der Uhrenfertigung wegen in Sankt Petersburg war.
Vor dem Hotel angelangt, blieb er stehen. Es war erst zehn vor elf; er war extra früh losgegangen für den Fall, dass es am Eingang zu Scherereien kam. Anständigerweise hätte er nun warten müssen, doch es war so kalt, dass er es nicht ertrug, draußen herumzustehen. Seit vier Tagen schon schneite es fast ununterbrochen, und an den Gehsteigrändern war der Schnee schon übermannshoch aufgeschippt. Er war pulvrig und fein wie Puderzucker, und die vorbeifahrenden Kutschen zogen glitzernde Fahnen davon hinter sich her. In der Nähe des Hotels waren einige Männer damit beschäftigt, eine Telegrafenleitung zu reparieren, die in der Kälte gerissen sein musste. Und dabei war es erst Oktober; es stand ein harter Winter bevor.
Der Portier ließ Pjotr dann jedoch ganz ohne Umstände herein. Er musste nicht einmal seinen Ochrana-Ausweis zücken.
Im Hotelcafé herrschte reger Betrieb, der Saal war erfüllt vom verheißungsvollen Klirren der aufgetragenen Gebäck-Etageren und dem Geplauder der Damen – man wusste, man war in gut betuchter Gesellschaft, wenn die Männer leiser sprachen als die Frauen –, doch Pjotr erspähte Mori fast augenblicklich am Fenster, da das Gewirr der mechanischen Teile auf seinem Tisch das Licht einfing. Er baute einen Spielzeugkraken. Gerade justierte er etwas in dessen Innern. Der kleine Krake versuchte indessen, sich den Silberlöffel aus der Zuckerschale zu schnappen.
»Ist der etwa lebendig?«, fragte Pjotr, vor allem, um sich den Ausruf zu verkneifen, dass Mori keinen Tag älter aussehe als bei ihrer letzten Begegnung. Er selbst war in der Zwischenzeit ergraut.
»Nein«, sagte Mori in seinem vornehmen Russisch. Er hatte die eigenartigste Stimme, die Pjotr je untergekommen war. Obwohl er ein geradezu nymphenhaft zierlicher Mann war, klang er so dunkel, wie sprechende Petroleumdämpfe geklungen hätten. »Er tut nur so.«
Der Krake hatte einen fast vollkommen runden, schimmernden Leib mit kleinen silbernen und gläsernen Einsätzen darin. Pjotr reichte ihm den Löffel. Daraufhin gab das kleine Ding einen freudigen mechanischen Laut von sich, der wie Wob-Wob-Wob-Wob klang, glitt dann unter den Tisch und schmiegte sich an Pjotrs Knöchel. Der beugte sich hinab und streichelte es, wobei er sich sehr zusammenreißen musste, um keine peinlichen Koselaute von sich zu geben. Der Krake besaß nur sieben Beine. An der Stelle des achten ragte lediglich ein bronzefarbenes Rädchen hervor.
Ihm gegenüber krempelte sich Mori nun die Ärmel herunter. Pjotr erhaschte einen Blick auf eine Tätowierung an seinem Unterarm, die aus japanischen Schriftzeichen bestand. Sie musste frisch sein, denn sie sah noch nicht verheilt aus. Widerstrebend beschloss er, nicht danach zu fragen.
»Also«, sagte Pjotr, »was machen Sie hier? Muss ich nun damit rechnen, dass im Schlafgemach des Zaren eine Bombe mit Zeitzünder auftaucht?«
Mori lächelte. Es ging ihm sichtlich so gut, dass er förmlich von innen heraus strahlte. Er hätte mindestens eine Besenkammer damit erhellen können. Pjotr verspürte kurz Lust, ihn in eine zu schubsen. »Sie wissen doch, dass ich den Dienst quittiert habe. Ich habe in den letzten Jahren in London gelebt. Tokyo wäre gar nicht in der Lage, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Hatten Sie mal mit der Royal Mail zu tun?«
»London könnte sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Sind Sie übergelaufen?« Es klang deutlich gekränkter, als es sollte. Pjotr hatte insgeheim immer gehofft, dass Mori zu den Russen überlaufen würde.
»Nein, natürlich nicht. Ich habe eine Uhrmacherwerkstatt eröffnet. Wenn ich überlaufen würde, dann natürlich nur zu Ihnen, nicht wahr? Wie geht es Ihnen?« Er wirkte aufrichtig erfreut, ihn wiederzusehen.
Pjotr schmolz dahin. Sonst wirkte niemand je erfreut, ihn zu sehen. »Man tickt so vor sich hin …«, sagte er, und Mori war so höflich, darüber zu lachen. »Wie wär’s jetzt mit einem Kaffee?«, fragte Pjotr.
»Ja, gern«, sagte Mori, und wie gerufen kam eine Kellnerin mit zwei Tassen.
»Wie machen Sie das?«, fragte Pjotr. »Ich bin zehn Minuten zu früh.«
Wenn es eine Antwort gab, bekam er sie nicht mit. Drei Eulen hockten hinter Mori draußen auf dem Fenstersims und schmiegten sich aneinander. Sie schauten herein, als wären sie in einem Theater. Pjotr ertappte sich dabei, dass er den Kopf neigte, nur um zu sehen, ob eine von ihnen es ihm nachmachen würde.
»Hören Sie, ich habe aus Tokyo etwas erfahren, das Sie interessieren dürfte«, sagte Mori und verpasste Pjotr, als der seine Brieftasche zückte, um bei der Kellnerin zu zahlen, unterm Tisch einen leichten Tritt.
»Worum geht’s?«, fragte Pjotr, nun ganz Ohr.
»Ein Freund von mir wird dort demnächst zum Premierminister ernannt«, sagte Mori und stellte flink die Zuckerschale und die Kaffeekanne von der Tischkante fort. »Kiyotaka Kuroda. Sie wissen schon …«
»Dieser Verrückte, der besessen davon ist, in Korea einzumarschieren?«, platzte Pjotr hervor und stellte geräuschvoll seine bereits geleerte Tasse hin. Der Tisch wackelte. Mindestens vier Kellner runzelten die Stirn. »Den haben sie in den Palast gelassen? Gibt’s denn gar keine Regeln mehr? Schauen Sie mich nicht so an, als wäre ich ein Naivling – vor einer Viertelstunde habe ich noch einen Gewerkschafter gefoltert.«
Mori gab ihm das Pistazien-Macaron, das zum Kaffee gereicht worden war. »Kurodas erste Priorität wird es sein, sich Achtung zu verschaffen. Wenn er kann, wird er Ihnen die Kurilen und Wladiwostok abnehmen.«
Pjotr schnaubte. »Wladiwostok? Was reden Sie da für einen …?«
»Er steht kurz davor, eine Order über vierzig Panzerschiffe aus Liverpool abzuschließen«, konterte Mori, ohne die Stimme zu erheben. »Die Briten werden sie im Februar nach Nagasaki liefern. Und jedes dieser Schiffe bietet Platz für zweihundert Mann Besatzung.«
Eine ganze Zeit lang herrschte Schweigen. Informationen dieses Kalibers hatten sie einander nie zuvor anvertraut. Wenn ihre jeweiligen verrückten Nationalisten etwas besonders Brisantes planten, hatten sie das am Rande erwähnt, doch verglichen hiermit waren das Kleinigkeiten gewesen.
»Mori«, sagte Pjotr schließlich, »warum erzählen Sie mir das?«
»Weil man sich um Kuroda kümmern muss. Wenn er erst mal damit anfängt, irgendwo einzumarschieren und vom Reich der Sonne zu schwadronieren, wird er erst Korea und anschließend China angreifen, und ehe man sich’s versieht, befinden wir uns im Krieg mit Amerika.« Mori starrte einen Moment lang seltsam abwesend in seinen Kaffee. Nun, da Pjotr ihn aufmerksamer ansah, wirkte er nicht mehr wie er selbst. Seine Schlüsselbeine waren angespannt, das war selbst durch Hemd und Weste zu sehen. Und als er die Tasse ergriff, traten die Sehnen in seinen Handrücken so deutlich hervor wie bei einer Ballerina, und Pjotr verspürte das Bedürfnis, ihn zu beschützen. »Einen Krieg gegen Amerika würde ich gerne vermeiden«, sagte Mori schließlich und hob wieder den Blick. »Sie würden siegen, und dann gäbe es keine Pufferzone mehr zwischen Russland und den Vereinigten Staaten.«
»Ich werde der Sache nachgehen«, versprach Pjotr vage. Dann zögerte er. »Aber Sie wissen ja, was der Minister dazu sagen wird, nicht wahr? Wenn Kuroda neue Schiffe in Auftrag gibt, müssen seine alten vollkommen marode sein. Er wird sagen, dass dies der ideale Zeitpunkt wäre, um Nagasaki zu erobern.«
Mori neigte den Kopf. Er war zu wohlerzogen, um mit den Achseln zu zucken. »Wenn Kuroda um Nagasaki kämpft, kann er währenddessen kein Imperium aufbauen.«
»Mein Gott«, sagte Pjotr und blickte sich unwillkürlich um. Die Japaner mussten außer sich sein vor Wut, dass Mori überhaupt hier war. Kein Geheimdienst der Welt ließ es einfach so geschehen, dass sich einer seiner pensionierten Agenten in einem Feindstaat niederließ und sich mit seinem ehemaligen Konterpart zum Kaffee traf, ohne ihn zumindest beschatten zu lassen. »Mori, ist Ihnen nicht klar, wie töricht das hier ist? Wenn die auch nur vermuten, dass Sie so etwas äußern, enden Sie mit Backsteinen beschwert im Winterkanal.« Damit sprach er zwar lediglich eine offensichtliche Tatsache aus, aber Mori konnte das unmöglich zu Ende gedacht haben. Reiche Leute dachten nie an die Konsequenzen.
»Ich vertraue Ihnen«, erwiderte Mori leise.
Pjotr rang mit sich. Die Form des Ganzen kam ihm falsch vor. »Sie sagen, man müsste sich um ihn kümmern, aber dahinter steckt ja wohl kaum Ihre großherzige moralische Sorge um das Wohl der Nationen. Was treiben Sie hier wirklich?«
Mori stellte seine Tasse allzu präzise ab. Vollkommen lautlos setzte sie auf der Untertasse auf. Ihm wich die Farbe aus dem Gesicht.
Pjotr stutzte. »Geht es Ihnen gut?«
Mori nickte, wirkte aber angespannt. »Mit mir wird gleich etwas geschehen, und das wird schlimm aussehen, aber es geht mir gut, und Sie brauchen also keinen Arzt zu rufen oder so etwas. Aber … wenn Sie mich vielleicht zu meiner Droschke geleiten könnten?«
»Wie bitte?«, fragte Pjotr verständnislos. Hinter dem Fenster, vor dem Mori saß, glitt eine Droschke herbei und hielt dann am Straßenrand. Jetzt erst bemerkte Pjotr, dass Mori eine Reisetasche bei sich hatte. Er pflegte stets mit leichtem Gepäck zu reisen, und daher war Pjotr klar, dass das alles war, was er mitnehmen würde. Er war im Begriff, Sankt Petersburg zu verlassen. »Schlimm? Was soll das heißen?«
»Ich bin kurz davor, meine gesamten Russischkenntnisse zu vergessen.« Seine Fingernägel gruben sich in das Tischtuch. Hinter ihm hatten sich die Eulen aufgerichtet.
»Wie bitte? Was reden Sie denn da?«
»Es schwindet dahin, tut mir leid«, sagte Mori, und Pjotr starrte ihn an, denn es stimmte: Er vergaß tatsächlich sein Russisch. Er hatte nun plötzlich einen Akzent und musste langsam sprechen, als müsste er sich an die einzelnen Worte erst aus einem Lehrbuch erinnern. Es war überhaupt nicht mehr die selbstverständliche Art, mit der er noch eine halbe Minute zuvor parliert hatte. »Könnten Sie … dem Kutscher sagen … dass ich zum Bahnhof muss?«
»Mori …«, setzte Pjotr erschrocken an. Er ging um den Tisch, ergriff seine Ellenbogen und stellte mit Entsetzen fest, dass Mori Tränen in den Augen hatte. Er musste vergiftet worden sein, mit irgendeiner Substanz, die das Hirn angriff. Hatten sie ihn also doch attackiert. »Wir müssen Sie in ein Krankenhaus bringen …«
»Droschke für Baron Mori?«, unterbrach sie ein prächtig uniformierter Portier.
»Ich muss nicht ins Krankenhaus«, sagte Mori auf Englisch zu Pjotr. Der konnte ihm gerade so folgen. »Ich muss nur zurück nach London. Das ist einfach nur ein … chronisches Gebrechen, an dem ich von Kindesbeinen an leide. Kein Grund zur Sorge.«
»Sind Sie sicher?«
»Ja, bin ich. Danke.«
»Zum Bahnhof Zarskoselski, bitte«, sagte Pjotr machtlos zu dem Portier und reichte ihm Moris Tasche. Der Uhrwerkkrake, der in der Zwischenzeit sämtliche Löffel von den freien Tischen gemopst hatte, eilte herbei und kletterte auf Moris Arm.
»Schicken Sie mir ein Telegramm!«, rief Pjotr Mori hinterher. Es war an diesem Tag so kalt, dass man die Speisekarten fürs Frühstück von Hand hatte ändern müssen, weil die Eier auf dem kurzen Weg vom Markt in die Hotelküche in der Schale gefroren waren. Es war also wahrlich kein angenehmes Reisewetter, nicht einmal für jemanden in bester Verfassung. »Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie wohlbehalten in Paris eingetroffen sind, ja?«
Mori nickte und ließ sich dann vom Portier hinausgeleiten.
Pjotr trat ans Fenster, um die Droschke abfahren zu sehen. Im selben Moment, da sich der Kutschgaul auf der weißen Straße in Bewegung setzte, flogen auch die Eulen auf und davon. Pjotr schaute noch eine ganze Weile hinaus und versuchte zu verstehen, was in Gottes Namen gerade geschehen war.
• • •
Zwei Tage später begann die russische Flotte vor der Südküste Koreas sogenannte Manöverübungen abzuhalten. Für jemanden, der Ausschau hielt nach arrangierten Ereignissen, war daran vor allem bemerkenswert, dass diese Übungen gerade rechtzeitig anliefen, damit Kiyotaka Kuroda, der neue japanische Premierminister, sie mit eigenen Augen zu sehen bekam.
Er war noch nicht lange im Amt. In seinen Knochen steckte noch der Marineoffizier, ein kräftiger, normaler Mann, und ganz gewiss nicht jemand, der einen großen Mitarbeiterstab besaß, der überdies der Meinung war, er solle eine Nelke am Revers tragen. Es war schön, wieder auf einem Schiffsdeck zu stehen und Hafenbefestigungen zu inspizieren – davon verstand er immerhin etwas. Die ausgedehnten Hafenanlagen von Nagasaki boten einen imposanten Anblick: ein industrielles Labyrinth aus Kränen und Trockendocks, aus Stahlwerken und den monumentalen Kais der Marinezerstörer. Ganze Galaxien von Schweißbrennern funkelten und flackerten, und auf einem der Schiffe, die zur Instandsetzung hier lagen, wimmelte es geradezu von Männern.
Dieser Anblick war allerdings nur imposant, wenn man nie Liverpool gesehen hatte. Kuroda hatte Liverpool gesehen.
Der Mensch, den Kuroda am allerwenigsten ausstehen konnte, äußerte die Bemerkung, das sehe doch alles ganz vortrefflich aus. Arinori war der Bildungsminister. Er trug eine rosa Nelke am Revers. Kurodas Ansicht nach hätte ihn allein das für Regierungsämter disqualifizieren sollen.
»Ich weiß gar nicht, warum Sie ständig eine neue Flotte fordern. If it ain’t broke, don’t fix it.«
Kuroda starrte ihn an. Arinori zählte zu den Leuten, die keinerlei Sinn für Ironie besaßen. Er wollte doch tatsächlich – und hatte das auch schon verschiedentlich öffentlich bekundet – das Englische zur Landessprache machen oder, falls das nicht klappte, die japanischen Schriftzeichen durch lateinische Buchstaben ersetzen, damit Kinder und Ausländer das Japanische leichter erlernen konnten. Kuroda bewahrte den diesbezüglichen Zeitungsartikel in seiner obersten Schreibtischschublade auf. Er lag dort zwar schon seit dem Jahre 1871, aber eines Tages würde er Arinori damit zu einem öffentlichen Widerruf zwingen. »In England«, sagte Kuroda und musste sich sehr beherrschen, um den Mann nicht über Bord zu stoßen, »landen Leute wie Sie am Galgen.«
Arinori lachte nur.
Kuroda ging schnurstracks in die Kabine des Admirals, um ihm mitzuteilen, dass man noch am heutigen Tage vierzig neue Zerstörer in Liverpool ordern werde – und scheißegal, was das Kabinett dazu sagen würde. Wenn er noch länger zauderte, würden die Briten die verdammten Dinger womöglich an die Amerikaner verkaufen – oder schlimmer noch: an den Zaren.
Anschließend saß er mit dem Admiral bei einer Flasche Wein beisammen. Plötzlich kam ein Offizier hereingeplatzt und meldete, man habe Feindbewegungen gesichtet.
»Feindbewegungen?«, schnaubte der Admiral. »Was soll das heißen: Feindbewegungen? Wir sind doch nur zwanzig Meilen vor der Küste.«
Der Offizier wirkte sehr besorgt und meinte, der Admiral solle sich das vielleicht mit eigenen Augen ansehen.
Kuroda ging mit den beiden auf die Brücke. Der Admiral schaute lange durch das große Fernrohr. Als er sich wieder aufrichtete, war sein Lächeln verschwunden. Nun sah Kuroda ebenfalls hindurch.
Am Horizont, etwa dreißig Meilen entfernt, waren Schiffe zu erkennen. Viele Schiffe. Und sie fuhren nicht vorüber. Vielmehr verharrten sie dort, in verschiedene Richtungen gewandt, und noch während er hinsah, schossen plötzlich Rauchbahnen aus den schweren Kanonen des größten Zerstörers. Sie machten Gefechtsübungen.
»Was sehen wir da, Herr Admiral?«, flüsterte der Offizier.
»Wir sehen«, fauchte der Admiral, »wie die gesamte russische Pazifikflotte vor der Küste von Busan in unsere Richtung wichst.«
• • •
Kuroda sandte die Schiffsorder vom Amtssitz der Admiralität in Nagasaki aus nach Liverpool. Er ging mit seiner Sekretärin gerade noch einmal den Wortlaut durch, als eine andere Sekretärin in besorgtem Ton seinen Lieblingsberater und Mann fürs Grobe ankündigte, Herrn Tanaka. So einen Tanaka hätte jeder gut gebrauchen können. Während die übrigen Herren der Regierung einen Cutaway und eine lächerliche Nelke am Revers trugen, stolzierte Tanaka in einem knallroten Mantel mit unterschiedlichen Knöpfen einher. Bei einem davon, der in hellem Licht stets glitzerte, handelte es sich um ein Miniatur-Fabergé-Ei. Tanaka hatte offenbar entschieden, dass die Korridore der Macht einen geschmacklosen Farbklecks gut vertragen könnten – Tanaka war überhaupt ein entscheidungsfreudiger Kerl –, und Kuroda schätzte das sehr an ihm.
»Tanaka«, sagte Kuroda. »Schafft die Wissenschaftler nach Aokigahara. Es geht los.«
Tanaka hob die Augenbrauen, stellte aber keine Fragen. Er verneigte sich nur und verschwand.
• • •
Die Universität Tokyo war die beste des Landes. Dr. Grace Carrow hätte gerne geglaubt, dass ihr Hörsaal voll besetzt war, weil einige der klügsten Studenten der Welt wissen wollten, was sie zu sagen hatte. Sie war sich jedoch fast sicher, dass es eher daran lag, dass es draußen in Strömen regnete und sich das Physikalische Institut direkt über dem Heizungskeller befand. Der Reiz des Neuen angesichts einer weiblichen Lehrkraft war schon Wochen zuvor verblasst.
Bei ihrem Kurs handelte es sich um eine zehnwöchige allgemeine Einführung in verschiedene Zweige der Physik für Studenten im zweiten Studienjahr, doch der gegenwärtige vierzehntägige Block behandelte ihr Fachgebiet: die Äthertheorie. Darauf freute sie sich immer ganz besonders.
Dennoch war ihr an den Tagen davor immer ein wenig beklommen zumute. Die Äthertheorie war die einzige plausible wissenschaftliche Erklärung für das Hellsehen, und deshalb musste sie dabei immer an den einzigen echten Hellseher denken, der ihr je begegnet war. Sie kannte Keita Mori nicht gut – gerade nur gut genug, um zu wissen, dass sie ihn niemals wiedersehen wollte. Er war ein ruhiger, schweigsamer Mann, aber sie wusste, wie es war, auf engstem Raum äußerst klug zu sein. Man langweilte sich leicht.
Kurz nachdem sie ihren Vortrag begonnen hatte, betrat ein Mann in einem roten Mantel den Saal. Der Mantel hatte nicht zusammenpassende Knöpfe. Einer davon war ein kleines Fabergé-Ei.
»Verzeihung, Herrschaften!«, sagte er leichthin. »Die Vorlesung fällt aus, Anordnung des Innenministeriums. Und jetzt raus mit euch!«
Grace erhob keinen Einspruch. Bei Männern vom Ministerium tat man das nicht. Die Studenten blickten zwar besorgt drein, trotteten aber brav hinaus. Grace blieb vor der Tafel stehen und bemühte sich, genug von ihrem miserablen Japanisch zusammenzukratzen, um zu fragen, was los sei. Ihre Vorlesungen fanden stets auf Englisch statt, und das war auch gut so, denn Grace war, was Fremdsprachen anging, ungefähr so begabt wie eine Seegurke. Soweit sie das verstanden hatte, waren die japanischen Worte für »Ehemann« und für »Gefangener« identisch. Wahrscheinlich sorgte sich deshalb die halbe Fakultät immer noch, sie könnte Baron Matsumoto auf ihrem Dachboden eingesperrt haben.
»Es ist alles in Ordnung, Dr. Matsumoto«, sagte der Mann auf Englisch und setzte eine amüsierte Miene auf. »Sie haben nichts falsch gemacht. Mein Name ist Tanaka.«
Das war ein japanischer Allerweltsname so wie im Englischen Smith. Und es musste ein falscher Name sein, denn Leute, die tatsächlich Smith hießen, stellten sich meist eher mit ihrem Vornamen vor. Vor Unbehagen versteifte sich Grace’ Genick. Einer der Gründe, weshalb sie Tokyo mochte, war, dass sie selbst als kleine Frau von knapp eins sechzig die meisten Menschen überragte. Sogar zu mitternächtlicher Stunde ging sie dort ganz unbeschwert spazieren. Ihr war bis dahin nie bewusst gewesen, was für eine unsichtbare Last es war, dass sie in London – zwar weder ängstlich noch gar nervös, aber doch – die ganze Zeit die anderen Menschen auf der Straße wahrnahm. In Tokyo hatte sie fast vergessen, wie das war.
»Und ich heiße Carrow«, sagte sie langsam. »Ich habe den Namen meines Mannes nicht angenommen. Was kann ich für Sie tun, Mr. Tanaka?«
Tanaka lächelte. Die Edelsteine auf seinem Fabergé-Ei-Knopf warfen helle Schatten auf ihre Vorlesungsnotizen. »Sie können sich anhören, was ich zu sagen habe. Die Regierung führt ein Verteidigungsprojekt durch, das in Kürze anlaufen wird. Wir brauchen dafür Ätherfachleute. Die genauen Einzelheiten darf ich Ihnen erst mitteilen, wenn wir dort eintreffen, aber Sie wären genau die Richtige dafür. Es ist eine ganz neuartige Sache und streng geheim. Wir müssten sofort aufbrechen. Sie dürften niemandem sagen, wohin Sie gehen. Ich würde dann die Universität und Ihren Mann informieren und mich um alles Weitere kümmern.«
»Das klingt verrückt«, sagte Grace. Am Ausgang des Saals waren inzwischen zwei Männer in gut geschnittenen Anzügen aufgetaucht.
Tanaka nickte. »Ja. Aber die verrücktesten Maßnahmen sind ja oft mit den irrwitzigsten Geldbeträgen verbunden.« Er neigte den Kopf. »Sie erhalten hier fast keine finanziellen Mittel. Die Fakultät hat Sie engagiert, weil Sie mit einem reichen Mann verheiratet sind. Sie haben kein Labor und gerade mal ein winziges Büro. Sie sollten Forschungsarbeit leisten, statt Ihre Zeit mit schnöseligen Studenten zu verschwenden. Es ist eine wirklich ernste Sache, von der ich hier rede. Die Fakultät hat mir Ihren Namen genannt, weil man Sie gerne loswürde, aber ich habe Ihre Arbeiten gelesen, Dr. Carrow, und Sie sind genau die Person, die wir brauchen.«
Grace zögerte. Er hatte nicht unrecht. »Wo wird das denn angesiedelt sein?«
»Das darf ich Ihnen erst sagen, wenn wir dort sind.«
»Hm … Hören Sie, Sie brauchen mir nicht zu sagen, ob es stimmt oder nicht, aber ich sage Ihnen jetzt, was ich glaube, was Sie tun. Wenn das etwas Militärisches ist, dann sind Sie nicht an Theorien interessiert, und für die Äthertheorie gibt es nur eine einzige naheliegende praktische Anwendungsmöglichkeit. Und daher glaube ich, Sie beginnen ein Projekt, bei dem herausgefunden werden soll, ob Hellsehen unter Laborbedingungen reproduzierbar ist oder nicht.«
Tanaka zwinkerte ihr zu. »Wie Sie richtig vermuten, darf ich Ihnen dazu nichts sagen.«
»Und ohne einen echten Hellseher könnte man das unmöglich praktisch erproben«, sagte sie langsam, da das Zwinkern sie dazu brachte, ihn unbedingt ärgern zu wollen. »Wenn Sie keinen zur Hand haben, wäre das alles für die Katz.«
»Sie werden alles bekommen, was Sie für Ihre Arbeit brauchen«, sagte er leichthin.
Die Männer in den dunklen Anzügen schauten auf ihre Taschenuhren. Grace sah zu Tanaka hinüber.
»Im Grunde werde ich gar nicht gefragt, ob ich mitmachen will oder nicht – nicht wahr?«, sagte sie leise und überlegte, in Richtung Fenster zu fliehen.
»Nein, meine Liebe«, erwiderte er und geleitete sie hinaus.
TEIL EINS
EINS
London, 2. Dezember 1888
Nebel quoll an jenem Morgen die Filigree Street hinab. Die dichten braunen Schwaden verdunkelten nach und nach die Lichter der Fenster und verhüllten die vergoldeten Ladenschilder, bis nichts mehr zu sehen war, außer einer gewundenen Spur heller Punkte, bei denen es sich eventuell um die Straßenlaternen handelte. Am Ende der Filigree Street – die immer schmaler wurde, je weiter man kam – verrußte an den zwischen den Giebeln gespannten Leinen die Wäsche. In den Obergeschossen gingen Lichter an, und Leute beeilten sich, die Wäsche hereinzuholen, doch zu spät.
In Haus Nummer siebenundzwanzig öffnete Thaniel die Tür gerade so weit, dass er hinausschlüpfen konnte, um möglichst wenig von dem Nebel und seinem chemischen Gestank in den Hausflur zu lassen, und zog sich seinen Schal über die Nase. Eigentlich war es schon helllichter Tag, doch der Nebel ließ es wie Mitternacht wirken, und er musste nah an den Ladenfronten entlanggehen, um nicht die Orientierung zu verlieren. Er schob sich die Hände in die Mantelärmel.
Normalerweise mochte er den Londoner Nebel – obwohl er den Leuten die Augen, die Lunge und wahrscheinlich auch alles andere verätzte; es war noch etwas Neues für ihn, ebenso wie Schnee, und unweigerlich überlief ihn ein Schauer, wenn er sah, wie anders die Welt unter dieser braunen Brühe ausschaute. An diesem Morgen aber dachte er nur daran, dass die Post nicht kommen würde. Die kam bei Nebel nie. Keine Post, das hieß: kein Telegramm aus Russland. Wie jeden Morgen sah er sich noch einmal zum Haus Nummer siebenundzwanzig und dem dunklen Werkstattfenster um und kniff sich selbst. Mori würde nicht einfach so auf magische Weise über Nacht wieder auftauchen.
• • •
Die U-Bahn-Station South Kensington wirkte mit so wenigen Leuten dort unten ein wenig unheimlich, und jeder einzelne Schritt klang auf dem Holzboden des Bahnsteigs ungewohnt laut. Die neuen, in hellen Farbtönen gehaltenen Reklameplakate für Kondensmilch der Marke Milkmaid strahlten eine gewisse Zuversicht aus. Man hatte sie direkt über ihre verrußten Vorgänger gekleistert. Diese Plakate schienen immer zur gleichen Zeit aufzutauchen wie der Nebel, denn bei Nebel kamen natürlich auch die Milchwagen nicht mehr, da sich niemand, wenn die Straßen voller nebelscheuer Pferde waren, um Hunderte Glasflaschen kümmern wollte. Als der Zug schließlich einfuhr, war er nicht einmal halb so voll wie sonst.
In Westminster waren die Straßen, als Thaniel aus der U-Bahn kam, fast menschenleer. Nirgends waren Droschken oder Kutschen zu sehen, und nicht einmal vor dem Liberal Club oder Horse Guards stand Personal. Die weißen Fassaden ragten gespenstisch empor, die Dächer unter Nebel verborgen, und mit einem Mal konnte er sich vorstellen, wie all das in tausend Jahren aussehen würde, wenn es wahrscheinlich längst in Trümmern lag. Es war eine Wohltat, als er schließlich das Außenministerium betrat und Wärme und Helligkeit ihn umfingen.
Es war ein prachtvolles Gebäude mit einer riesigen Eingangshalle und einer Haupttreppe, die dazu erbaut war, Sultane und Diplomaten zu beeindrucken. Die großen Kronleuchter brannten an diesem Tag jedoch nicht, und die Gewölbe der Decke verschwanden in bräunlichem Dämmer. Am Empfang wurden Kerzen ausgeteilt, und auch Thaniel nahm eine entgegen und ertappte sich bei einem Lächeln, denn das verlieh dem Ganzen ein geradezu weihnachtliches Flair, als ginge man an Heiligabend in die Kirche. Die kleine Flamme mit der hohlen Hand beschirmend, brach er von der mit Fresken geschmückten Eingangshalle ins Labyrinth der Korridore auf, die nicht für Besucher bestimmt waren. Dort waren einige Gasleuchten, wenn auch stotternd, in Betrieb, die allerdings neben eher schwachem Licht vor allem einen seltsamen chemischen Geruch verströmten. Die Gasleitungen hier waren nie die besten gewesen.
In der Fernostabteilung war es deutlich heller. Thaniel wusste nicht, wie offiziell die ganze Sache war – nicht sonderlich, wenn man seinen Vorgesetzten kannte –, aber jedenfalls wurde diese Etage des Gebäudes elektrisch beleuchtet, im Zuge eines Pilotprojekts eines jener Elektrizitätsunternehmen, die ganz Whitehall mit elektrischem Licht ausstatten wollten. Statt der singenden und dann wieder stockenden Gasflammen hörte man hier das freundlich-eintönige Sirren von Glühlampen der Marke Swann. Es war viel leiser, und Thaniel mochte es, aber manchmal, wenn die Stromversorgung zu sehr nachließ, gaben die Lampen ein Zischen von sich, das für ihn grün klang. Dann wurde der ganze Korridor in ein grünes Licht getaucht.
Es war kaum jemand zu sehen. Einige Leute kegelten auf dem langen Korridor, der zum Büro des Ministers führte. Doch da die Kugeln manchmal ihr Ziel verfehlten und an dessen Tür prallten, war der Minister wahrscheinlich auch nicht da. Thaniel schaute den Korridor auf und ab, ließ sich dann auf dem Hocker des Konzertflügels nieder, auf dem sonst niemand spielte, und ging die Eröffnung von Sullivans neuer Show durch. Der Flügel war ungefähr einen Monat nach seinem Dienstantritt auf mysteriöse Weise dort aufgetaucht. Fanshaw, sein Vorgesetzter, war ein großer Gilbert-und-Sullivan-Fan und durchaus passioniert genug, um tatsächlich einen Konzertflügel beschaffen zu lassen, wenn er dadurch früher als die Allgemeinheit Stücke aus neuen Shows zu hören bekam. Normalerweise missbilligte er es, wenn sich Außenamtler am Wochenende ganz anderen Dingen widmeten – der Auswärtige Dienst sei ja schließlich kein Job, sondern eine Berufung –, aber er sah immer überglücklich aus, wenn er Thaniel von Wochenendschichten erlösen konnte, damit der zu Proben ins Savoy konnte. Im Gegenzug wurde er von ihm nicht zu knapp mit Freikarten versorgt.
Thaniel ließ den Fuß auf dem Pedal, damit der Klang nicht durchs ganze Gebäude hallte. Er freute sich über die neue Show. Sie war anders als die Musik, die Sullivan zuvor geschrieben hatte, vielfältiger und nicht so auf Komik aus, und in der Ouvertüre gab es einen fantastischen Moment, der, wenn alle, wie sie es sollten, das große Crescendo erreichten, wie aus einer Krönungshymne klang, es war geradezu kathedralenfüllend gewaltig, und dann erstrahlte der ganze Saal in güldenem Licht.
Wieder begannen die Lampen zu zischen, und Thaniel blickte sich um. Das Grün war unangenehmer als je zuvor. Er kniff die Augen zu und legte sich eine Hand an die Schläfe. Eigentlich gefiel es ihm, dass er die Farben von Klängen sehen konnte. Er mochte die Farbe von Moris Stimme und die Lichter, die wie eine Aurora über einem Orchester schwebten, doch allmählich bekam er so das Gefühl, dass Elektrizität nicht unbedingt etwas für ihn war.
»Woher zum Teufel kommt denn diese Musik?«, fragte eine vornehm klingende Stimme in herrischem Ton. Thaniel erstarrte.
Dann stand er langsam auf und sah sich zur Tür des nächsten Büros um. Darin erblickte er Lord Carrow, der mit Thaniels Vorgesetztem sprach und dabei unbehaglich wirkte, sich auch nur in einem Büro aufzuhalten, als könnte es eventuell ansteckend sein, für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Er hielt seinen Stock fest in beiden Händen.
»Ach, Sie sind’s«, sagte Carrow in garstigem Ton zu Thaniel. »Ich hatte ganz vergessen, dass Sie hier tätig sind.« Er funkelte ihn an und wandte sich dann wieder Francis Fanshaw zu. »Wie gesagt, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie ihr eine Nachricht zukommen lassen könnten, eine kleine Erinnerung daran, dass sie einen Vater hat, der sich freuen würde, wenn sie ihm bei Gelegenheit mitteilen könnte, dass sie nicht von Wilden entführt worden ist.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, schritt er auf den Korridor hinaus und rempelte Thaniel im Vorbeigehen kräftig mit der Schulter an. Thaniel sah ihm hinterher.
Das letzte Mal waren sie einander vier Jahre zuvor in einem unscheinbaren kleinen Standesamt in Kensington begegnet, als Thaniel und Grace Carrow dort ihre Scheidungspapiere unterzeichnet hatten. Sie waren alle ausgesprochen höflich miteinander umgegangen, und zum Abschluss hatte Lord Carrow Thaniel in der Eingangshalle eine schallende Ohrfeige verpasst.
»Sie haben nicht zufällig von Grace gehört, oder?«, fragte Fanshaw, als Carrow außer Hörweite war.
»Wir reden nicht miteinander. Äh … warum kommt er denn damit zu Ihnen?«
»Sie lebt inzwischen in Tokyo, wussten Sie das nicht? Sie hat diesen Japaner geheiratet – das genaue Gegenteil von Ihnen: Dandy, Nervensäge; ich vergesse immer seinen Namen. Und anscheinend hat sie schon eine ganze Zeit lang nicht mehr geschrieben.«
»Tja«, sagte Thaniel, »wenn Carrow mein Vater wäre, würde ich ihm wahrscheinlich auch nicht schreiben.«
»Geht mir genauso«, sagte Fanshaw und hielt dann inne. Er hatte nie danach gefragt, was damals zwischen Thaniel und Grace vorgefallen war, und Thaniel war sehr froh darüber, denn ihm fiel immer noch keine passable Lüge dazu ein. »Apropos«, fuhr Fanshaw fort, »wie geht’s denn eigentlich Ihrem Uhrmacher?«
Fanshaw war wahrscheinlich bloß bei dem Gedanken an einen Japaner auch noch ein anderer Japaner eingefallen, aber Thaniel fuhr eine schreckliche Angst durch Mark und Bein. Er hasste es, nach Mori gefragt zu werden. Fanshaw hatte zwar jedes Recht dazu, denn er kannte Mori, doch Thaniels erster Gedanke, wenn ihn irgendjemand nach Mori fragte, war unweigerlich: Weiß er Bescheid?
Wenn man Glück hatte, landete man im Zuchthaus, wenn nicht, in einer Irrenanstalt. Entweder Zwangsarbeit oder Elektroschocktherapie – und über alles Weitere wusste er nichts, denn die Presse berichtete nicht darüber, und die Ärzte, die in jenen Anstalten tätig waren, veröffentlichten ihre Behandlungsmethoden nicht. Es wurde niemand mehr deswegen hingerichtet – was aber nur daran lag, dass die Medizin es inzwischen als eine Art von Wahnsinn einstufte, die sogenannte moral insanity.
Thaniel hätte den Tod durch den Strang vorgezogen. Das war eine saubere Sache. Lieber das Schafott als das unausdenkliche Grauen, das einen in so einer Anstalt erwartete.
»Tja … gut wahrscheinlich. Aber ehrlich gesagt: keine Ahnung. Er ist auf Reisen.«
»Hören Sie mir jetzt ganz genau zu.«
Thaniel stutzte. Ihm war mit einem Mal viel zu warm; sein ganzer Organismus lief auf Hochtouren, und er war bereit zur Flucht – obwohl es ja gar keinen Ort gab, wohin er hätte fliehen können.
»Es heißt ›Ja‹ und ›Ich weiß es nicht‹, Steepleton. Befördert wird, wer sich klar auszudrücken versteht.«
»Kokolores«, erwiderte Thaniel so erleichtert, dass er sich unwillkürlich erst einmal an die Wand lehnte.
Fanshaw lachte. »Wie dem auch sei. Auch was gegen den Nebel?« Er hielt ihm eine silberne Taschenflasche hin.
Einige Jahre zuvor hätte Thaniel in so einem Fall noch abgelehnt, doch in letzter Zeit war ihm klar geworden, dass eine solche Ablehnung nur einem Armen gegenüber höflich war. Einem Reichen gegenüber wirkte es, als befürchtete man, sich mit irgendwas anzustecken. Also nahm er einen kleinen Schluck, und der Brandy brannte ihm auf angenehme Weise in der Kehle. »Danke.«
»Es gibt da übrigens noch etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss«, sagte Fanshaw und trat beiseite, damit Thaniel seinen eigenen Schreibtisch sehen konnte. Der Telegraf war übers Wochenende sehr aktiv gewesen. Der ganze Tisch war mit Papierstreifen bedeckt.
»Das kommt alles von unserer Gesandtschaft in Tokyo«, sagte Fanshaw.
»Haben die Russen etwa den Krieg erklärt?«, fragte Thaniel und suchte in dem Durcheinander nach dem Ende des Streifens. Als er es gefunden hatte, klemmte er es mit einer Schreibtischlampe an den für China zuständigen Tisch.
»Nein«, sagte Fanshaw. »Wie es scheint, glaubt das japanische Personal der Gesandtschaft, dass es in dem Gebäude spukt. Die kündigen gerade alle. Und jetzt kriegen auch die Briten dort das große Muffensausen. Es besteht die reale Gefahr, dass der ganze Laden dichtgemacht werden muss.«
Thaniel richtete sich auf, immer noch einen Transkriptstreifen in der Hand. Die jüngsten Meldungen waren zusehends in Großbuchstaben verfasst. ANSCHEINEND SPUKT DIE TOTE FRAU VON IRGENDWEM IN DER KÜCHE – STOPP – BITTE DRINGEND UM ANWEISUNGEN FÜR WEITERES VORGEHEN – STOPP. »Hat uns da etwa jemand bei der Psychical Society eingeschrieben, ohne uns etwas davon zu sagen?«, meinte er und musste sich das Lachen verkneifen.
Fanshaw schüttelte den Kopf. Er strich die Transkripte glatt, die Thaniel abschnitt, und sah nicht so aus, als fände er das Ganze sonderlich lustig. »Ich bezweifle sehr, dass es da nur um Leute geht, die sich ein Bettlaken übergeworfen haben.« Er senkte den Kopf und schaute in ein unsichtbares Wörterbuch, das etwa einen Meter über dem Boden zu schweben schien. Es dauerte eine Weile, bis er die richtigen Worte gefunden hatte. »Ich fürchte, es geht um etwas, das die Bediensteten als unaussprechlich empfinden, und deshalb erzählen sie Geschichten über Gespenster, damit sie nicht sagen müssen, was da wirklich vor sich geht. Sie wissen ja, dass wir keine Ahnung haben. Sie wissen, wenn sie sich etwas Übernatürliches ausdenken, werden wir es als Aberglauben der Einheimischen abtun und keine weiteren Fragen stellen. Ich habe so ein Verhalten schon einmal erlebt, in noch ferneren Ländern. Normalerweise wird es durch Diplomaten ausgelöst, die … ihre Immunität missbrauchen und so weiter.«
Thaniel nickte. In seinen Ohren klang das plausibel.
Fanshaw blickte beklommen. »Und wenn das der Fall ist, bedeutet das, dass ein ortsansässiger Dolmetscher keine Hilfe wäre. Denn der würde ja womöglich genau für denjenigen dolmetschen, der das eigentliche Problem darstellt. Ich muss jemanden von außerhalb hinschicken.«
»Fahren Sie also selbst hin und klären die Sache?«
Fanshaw hob den Blick. »Nein. Sie fahren hin. Sie sprechen viel besser Japanisch als ich; es ist idiotisch, dass Sie nicht längst in Tokyo stationiert sind.«
Thaniel schwieg einen Moment lang, musste das erst mal sacken lassen. »Und für wie lange?«
»So lange wie nötig. Ich vermerke es offiziell, aber als regulären Dolmetscher- und Übersetzerposten, damit Sie da nicht auf ein ganzes Gebäude voller Leute treffen, die bereits wissen, dass Sie gegen sie ermitteln. Ein Jahr … anderthalb … jedenfalls auf dem Papier.« Fanshaw runzelte die Stirn. »Geht es Ihnen nicht gut? Sie sehen so gar nicht froh aus.«
Thaniel hatte das kalt erwischt, und er wusste nicht, was er dazu sagen sollte.
Mori war immer noch in Russland. Was auch immer er dort tat – er war schon seit einem halben Jahr dort, und davor war er drei Monate lang in Berlin gewesen. Thaniel hatte keine Ahnung, was dahintersteckte. Dass sie nun schon seit vier Jahren gut miteinander auskamen, lag sehr wahrscheinlich ausschließlich daran, dass Thaniel nie zu viele Fragen stellte. Nun aber fühlte er sich schon ganz ausgehöhlt, so sehr fehlte ihm Mori. Wenn wieder ein Brief zu erwarten war – ungefähr alle acht Tage –, schwankte er auf dem Heimweg vom Büro zwischen Furcht und Hoffnung hin und her. Nun aber hatte es schon seit drei Wochen kein Lebenszeichen mehr gegeben, und Thaniel hatte das düstere Gefühl, dass auch keines mehr kommen würde, da die gesamte russische Infrastruktur inzwischen unter einer drei Meter hohen Schneedecke begraben war.
Er räusperte sich. »Das ist nur der Nebel«, sagte er und musste dann, fast wie aufs Stichwort, den Kopf beiseitedrehen und sich in die Hände husten. »Meine Lunge ist nicht mehr die beste. Ich habe früher nämlich mal in einer Lokomotivfabrik gearbeitet.« Er versuchte, ein paar vernünftige Gedanken zu fassen, doch sie entglitten ihm immer wieder. »Wie lange habe ich Bedenkzeit? Ich habe ja eine kleine Adoptivtochter.«
Six würde das komplett gegen den Strich gehen. Sie konnte es ja schon kaum ertragen, wenn sie beide auf dem Weg zur Schule einen Umweg einlegen mussten; da konnte er sich gut vorstellen, was sie erst zu Tokyo sagen würde.
»Leider nicht lange«, erwiderte Fanshaw und verzog bedauernd die Nase. »Denken Sie heute Abend mal darüber nach, aber morgen brauche ich eine Antwort. Die Russen verharren immer noch im Japanischen Meer. Im Moment bewegen sie sich nicht, aber wenn sie sich bewegen, werden sie direkt auf Nagasaki zusteuern, und dann wird die ganze Passagierschifffahrt erst mal auf Eis gelegt. Das läuft alles über Nagasaki.« Er setzte einen Blick auf, als wäre all das ausschließlich dazu in die Wege geleitet worden, um das britische Außenministerium zu ärgern. »Je eher sie abreisen, desto besser.«
Thaniel zögerte, denn ihm widerstrebte die Vorstellung, Six in ein potenzielles Kriegsgebiet mitzunehmen. »Aber das werden die doch nicht tun, oder? Die Russen. Die werden doch nicht in Japan einmarschieren.«
Fanshaw zuckte die Achseln. »Vielleicht doch. Sie wären nicht dort, wenn sie nicht irgendwas wüssten, und ich nehme an, sie wissen, dass die japanische Flotte auf dem letzten Loch pfeift. Ich denke mal, sie werden langsam immer näher kommen, bis irgendjemand von der japanischen Marine die Nerven verliert und auf sie schießt. Und dann geht sozusagen der Opiumkrieg noch einmal von vorne los. Sobald ein russisches Schiff getroffen wird, haben die Russen das Recht zu tun, was auch immer sie wollen.«
»Aber wenn es nur darum geht, nicht auf sie zu schießen, warum sollte irgendjemand das dann tun?«
Fanshaw fuchtelte raumgreifend mit den Händen. »Warum? Einfach nur so! Haben Sie mal gesehen, zu was für einer geifernden Empörung die oberen Ränge der japanischen Streitkräfte fähig sind? Das sind immer noch Samurai. Die sind damit aufgewachsen, dass sie inoffiziell neue Schwerter an unerwünschten Ausländern ausprobieren durften. Und sie haben immer noch nicht kapiert, dass es auf der Welt Kräfte gibt, die sie nicht einfach schikanieren und einschüchtern können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendjemand feuern wird.«
Thaniel versuchte, diese Vorstellung mit Mori in Einklang zu bringen, den er noch nie jemanden hatte schikanieren sehen.
Fanshaw ließ die Hände wieder sinken. »Also, wie gesagt: Denken Sie heute Abend mal darüber nach. Aber wenn Sie im Auswärtigen Dienst weiterkommen wollen, ist das Ihre Chance. Wenn Sie in England hängen bleiben, bringen Sie es bei uns zu nichts.«
Thaniel nickte erneut. Japan. Er hatte sich sein ganzes Leben lang nie weiter als zweihundert Meilen von seinem Zuhause entfernt. Die Vorstellung war so überwältigend, dass sie alles um ihn her in einem anderen Licht erscheinen ließ, selbst, während er dort auf demselben alten Stuhl saß, unter dessen hinterem Bein, damit er nicht kippelte, ein chinesischer Pass steckte. Noch zehn Minuten zuvor war das Büro einfach nur das Büro gewesen, vertraut und behaglich angesichts des Nebels. Nun aber fühlte er sich dort nicht mehr sicher. Statt des Londoner Nebels dräute nun Japan draußen vor den Fenstern, riesengroß und rätselhaft, und obwohl er der Landessprache mächtig war und mit einem gebürtigen Japaner zusammenlebte, war es für ihn Terra incognita.
Fanshaw klopfte ihm auf die Schulter. »Es gibt so Sachen, die arme Leute ihren Söhnen nicht beibringen, und dazu gehört auch, dass man die Verbindung zur Heimat kappen muss, wenn man auf der Welt irgendetwas erreichen will.«
ZWEI
Tokyo, am selben Tag
Kuroda war Mori zum ersten Mal auf einem Schlachtfeld begegnet. Die Kämpfe waren zu diesem Zeitpunkt schon vorüber. Sanfter Nebel hing malerisch über den menschlichen Überresten, den Pferdekadavern und den zertrümmerten Artillerie-Lafetten, und das Gras war schwarz vor Blut und verschmort von Schießpulver. Die einzigen Menschen, die dort aufrecht standen, waren Angehörige von Soldaten, die nach Überlebenden suchten oder zumindest nach Überresten, die sie bergen konnten. Fast alle, auch Kuroda, bewegten sich auf eine halb grimmige, halb panische Weise, ruckten manchmal vorwärts, um einen Leichnam umzudrehen, um zu sehen, wer es war, und mussten, wenn sie etwas zu Schlimmes erblickt hatten, für einige Zeit am Rande des Schlachtfelds innehalten.
Nur ein Mann bewegte sich zielgerichtet zwischen den Leichen hin und her. Er zögerte nicht, er sah sie nicht an, und er schritt so gelassen durch das Gemetzel, als handelte es sich um ein Reisfeld. Bald schon ertappte sich Kuroda dabei, dass er ihn anstarrte, denn ihn beschlich das Gefühl, dass er da gar keinen Menschen sah, sondern einen Todesgott, der Seelen einsammelte.
Doch da er nicht an Todesgötter glaubte, ging er zu dem jungen Mann und stellte sich ihm vor. Der lachte und versprach, kein Gott zu sein, sondern nur ein niederrangiger Samurai aus dem Hause Mori, gekommen, um die Rüstungen seiner gefallenen Brüder heimzuholen. Und seit diesem Tag waren sie gut miteinander ausgekommen. Kuroda vermochte jedoch nie so ganz den Verdacht abzuschütteln, dass Mori mit der Behauptung, weiter nichts als ein ganz normaler Mensch zu sein, gelogen hatte. Und er wunderte sich nicht im Mindesten, als sich das, was anfangs nur wie ein glückliches Händchen wirkte, als eine sehr viel präzisere Fähigkeit entpuppte.
Und dann war Mori, nach zehn Jahren im Staatsdienst, plötzlich nach London übergesiedelt. Höchstwahrscheinlich, um zu den Briten überzulaufen – die ihm zweifellos ein besseres Angebot gemacht hatten. Der damalige Premierminister hatte ihn daraufhin beseitigen lassen wollen, Kuroda aber hatte im Stillen dafür gesorgt, dass niemand etwas in dieser Richtung unternahm. Es wäre eine große Dummheit gewesen. Denn Panzerschiffe waren ja gut und schön, doch wenn die Russen dann schließlich kommen würden – und er hatte immer gewusst, dass das eines Tages bevorstand –, wäre es sehr viel besser, einen Todesgott in den eigenen Reihen zu haben. Oder wie auch immer man ihn nennen wollte.
• • •
Als Kuroda an diesem Morgen über die Baustelle des Kaiserpalastes schritt, konnte er eine gewisse Verärgerung darüber nicht unterdrücken, dass Mori immer noch nicht aufgetaucht war. Die Russen kamen seit zwei Wochen immer näher, zeigten den südlichen Häfen gewissermaßen schon ihre blanken Ärsche, doch von ihm war immer noch nichts zu sehen. Nicht einmal ein Telegramm hatte er geschickt. Ob er nun übergelaufen war oder nicht: Mori war schließlich immer noch ein Samurai – und außerdem ein guter Freund. Kuroda hatte ehrlich geglaubt, dass er nach Hause kommen würde, um zu helfen, wenn man ihn jemals wirklich brauchen würde.
Er duckte sich, als einige Männer mit einem Bambusgerüst vorbeikamen.
Überall schimmerten neue Glasscheiben. Der Palast war vor nicht allzu langer Zeit niedergebrannt, und nun errichteten die Bauarbeiter anstelle der leicht entflammbaren alten Papierwände neue aus buntem Glas. Wenn man nun die Korridore hinabschritt, kam man sich fast vor wie in einem Kaleidoskop. Manche Dinge bekam der kaiserliche Haushalt doch ganz gut hin.
Aber allzu viele waren es nicht.
Die nun bevorstehende Sitzung des Geheimen Rats hätte Kuroda am liebsten in einer Kneipe um die Ecke abgehalten. Man konnte unmöglich irgendetwas sinnvoll besprechen, während einem der kaiserliche Haushalt mit seiner unfassbaren Pedanterie auf die Finger schaute. Doch da man den Kaiser in keine Kneipe mitnehmen durfte, war Kuroda nicht allzu zuversichtlich, was die Sitzung anging. Sie mussten zum Punkt kommen und nicht endlos herumzimpern. Während sich dort alle über die richtigen Gedecke und die korrekten Anreden den Kopf zerbrachen, kamen die Russen immer näher.
Die Russen mussten lediglich jemanden dazu bringen, auf sie zu schießen. Wenn jemand das Feuer auf ein russisches Schiff eröffnete, herrschte augenblicklich Krieg. Und dann konnten sie im Grunde alle schon mal anfangen, Russisch zu lernen.
Falls jedoch niemand feuerte, gab es zwei Möglichkeiten. Erstens: Alles ging gut. Die russische Flotte würde schließlich fast schon in Nagasaki ankern, wo dann, wenn man den Geist dieser Stadt bedachte, sämtliche Händler von der Promenade einen Haufen Geld verdienen würden, indem sie zu den Schiffen hinausrudern und den russischen Matrosen ausgezeichnetes chinesisches Essen verkaufen würden, und vom Innenministerium mal abgesehen, fänden alle die ganze Sache ziemlich lustig. An diesem Punkt wäre es sogar durchaus denkbar, dass die Amerikaner oder die Briten so eifersüchtig hinsichtlich ihrer Handelsrechte würden, dass sie die russischen Schiffe vertrieben.
Zweitens: Die Russen würden in Nagasaki vor Anker gehen, dort einmarschieren, später vor den internationalen Kriegsgerichten ganz zerknirscht dreinschauen, das einmal eroberte Land aber nie wieder räumen. Die Briten hatten auf genau diese Weise ein riesiges Imperium aufgebaut, und Kuroda sah überhaupt keinen Grund, weshalb der Zar das nicht für eine ausgezeichnete Idee halten sollte.
In zwei von drei Fällen stand ihnen also ein industrieller Krieg bevor, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Und etwas in Kuroda war begierig darauf, die Sache endlich hinter sich zu bringen und zum Auftakt erst mal das Flaggschiff der Russen zu versenken.
• • •
Die Sitzung fand an diesem Morgen in einem großen Saal des Palastes statt, dessen Echo sogar schon vom Korridor aus zu hören war. Der Hofmarschall, Butler, Kaiserliche-was-auch-Immer – Kuroda hatte sich nicht die Mühe gemacht, sich seinen Titel zu merken – verneigte sich am Eingang des Saals auf mustergültige Weise vor ihm.
»Herr Premierminister! Trotz Ihrer Terminschwierigkeiten hoffen wir, dass sich dieser Raum als angemessen erweisen wird«, sagte er mit einer triumphalen Miene, bei der Kuroda unwillkürlich an einen Hund denken musste, der all die alten Schuhe, die man hatte wegwerfen wollen, getreulich wieder angeschleppt hatte. Kuroda hatte die angeblichen Terminschwierigkeiten bewusst vorgebracht. Er hatte viermal angeregt, einen anderen Versammlungsort zu wählen, in der Hoffnung, dass die uniformierten Männer mit ihren Linealen und Namensschildern irgendwann nicht mehr hinterherkommen würden.
»Großartig«, knurrte er und fragte sich, ob man ihn tatsächlich belangen würde, wenn er dem Mann mit dem prachtvoll verzierten Buch, das er in der Hand hielt, eins überbraten würde.
Die Minister der Regierung saßen in weiter Hufeisenform auf tiefvioletten Samtpolsterstühlen hinter einem Tisch, der mit grünem Damast drapiert war. Sie alle trugen tadellose Cutaways beziehungsweise im Falle der Militärminister schwarze Uniformen, deren feiner Goldbrokat auf der Brust im Licht der Kronleuchter und der großen Fenster erstrahlte. Kuroda ließ sich auf seinen Stuhl plumpsen.
Neben ihm war der Tisch des Kaisers rot drapiert, wie Kuroda annahm für den Fall, dass irgendwelche Neulinge oder zufällig anwesende Ausländer nicht mitbekommen hatten, dass es sich bei dem jungen Kerl, der sich mit viel zu vielen Dienern am Hof herumtrieb, um den Kaiser handelte. Wie er es oft tat, kam Mutsuhito nun mit schnellen Schritten herein, um seinem Kometenschweif von Bediensteten zuvorzukommen, und winkte dann einige Männer mit Tee und Kaffee herbei, während sich der ganze Saal ruckartig erhob.
»Behalten Sie Platz, behalten Sie Platz, ich habe doch meine Krone noch gar nicht aufgesetzt«, murmelte er.
Die Versammelten ließen sich umständlich wieder auf ihren Stühlen nieder, saßen dann steif da und lösten sich erst allmählich, als die Tee- und Kaffeekannen herumgingen. Mutsuhito hatte stets ein Stirnrunzeln aufgesetzt und trug einen Bart, um älter zu wirken, was angesichts seiner freudlosen Art aber gar nicht nötig gewesen wäre.
»Die Frage ist doch«, sagte er mit einem Mal zu Kuroda, als wären sie immer noch in der Schlussphase ihres gestrigen Gesprächs, »was geschieht, wenn die Russen tatsächlich fast schon in Nagasaki ankern? Denn es ist ja schließlich Nagasaki. Ehe sie auch nur Privet sagen könnten, werden ihnen die Leute von dort schon vierzehn verschiedene Hühnergerichte angedreht und ihnen die Rettungsboote geklaut haben!«
»Ja, und dann würde man sich in sämtlichen Ländern der Welt über uns lustig machen, Majestät«, erwiderte Kuroda überdrüssig. Es wäre Hochverrat gewesen, es zu äußern, aber er hätte alles dafür gegeben, wenn anstelle des Kaisers die Kaiserin an diesen Sitzungen teilgenommen hätte. Sie gab den Leuten Anweisungen, und dann wurden diese Anweisungen befolgt. So sollte das mit dem Oberbefehl eigentlich ablaufen. Mutsuhito war doch im Grunde mit allem überfordert, was die Komplexität einer Dinnerparty überstieg.
»Und wenn schon«, sagte der Kaiser auf seine unerträglich neutrale Art. »Wir werden gegen keine Verträge verstoßen. Und den Russen ist es von Rechts wegen nicht gestattet, bei uns einzumarschieren.«
Kuroda starrte in seinen Kaffee. Er hasste Kaffee. »Ganz recht, Majestät, aber ab einem bestimmten Punkt werden sie sich nicht mehr darum kümmern, was ihnen von Rechts wegen gestattet ist, und alle anderen werden sich auch nicht mehr darum kümmern. Die Briten und die Amerikaner werden mit den Achseln zucken und sagen, wir seien selbst schuld, weil wir unsere Grenzen nicht verteidigt haben. Und selbst wenn sie dieses Mal nicht einmarschieren, wird eine andere Macht es bald tun, denn wir haben uns ja schließlich nicht gewehrt.«
»Dennoch wäre es … illegal, wenn wir auf die Russen schießen würden. Aber verletzen sie nicht unsere Hoheitsgewässer?«
»Ja, das tun sie, Majestät.«
»Eine verzwickte Situation …«
So ungefähr stellte sich Kuroda das Fegefeuer vor.
Mutsuhito betrachtete mit vollkommener Gelassenheit die nächsten Punkte der vor ihm liegenden Tagesordnung und blätterte mit seinen behandschuhten Fingern die Papiere durch. »Ich glaube, dieser junge Mann möchte mit Ihnen sprechen«, sagte er dann.
Kuroda drehte sich auf seinem Stuhl um. Tanaka wartete am Eingang des Saals und ignorierte den Hofmarschall, der darauf beharrte, dass ein roter Mantel mit Ellenbogen-Patches und einem Fabergé-Ei an diesem Ort keine angemessene Kleidung sei. Kuroda ging so schnellen Schritts zu ihm hinaus, wie der Anstand es ihm gestattete.
»Ich könnte dich küssen«, sagte er.
»Bitte nicht«, erwiderte Tanaka und schien den Hofmarschall nun überhaupt erst zu bemerken. »Ja, Mann, nichts für ungut, aber könntest du dich bitte verpissen?«
Und erstaunlicherweise kam der Mann diesem Ersuchen nach.
»Gibt’s was Neues?«, fragte Kuroda leise. Er konnte sich gerade noch bremsen zu fragen: Kommt Mori?
Tanaka nickte knapp und überreichte ihm eine Akte. »Ja. Das sind die bisherigen Ergebnisse aus Aokigahara. Die Wissenschaftler haben sich eingelebt und scheinen ganz zufrieden zu sein. Wir haben inzwischen schon einige Berichte über Geistererscheinungen im Großraum Tokyo erhalten, aber die kommen bisher hauptsächlich von Leuten aus Kohlelagern und Getreidemühlen. Die Presse hat es bisher nicht aufgegriffen. Aber der leitende Physiker hat eine große Bitte.«
»Und die wäre?«
»Was sie die ganze Zeit gesagt haben. Ohne einen echten Hellseher, mit dem sie Tests durchführen könnten, können sie letztlich nicht allzu viel ausrichten.«
»Ich weiß«, sagte Kuroda und seufzte. Mori kam nicht aus freien Stücken. Also gut. Es wunderte ihn jedoch, denn Mori musste ja schließlich wissen, was Kuroda tun würde, wenn er nicht auftauchte. »Schicken Sie unserem Botschafter in London ein Telegramm, in dem Sie ihm mitteilen, dass wir schwerwiegende Vorwürfe gegen einen britischen Staatsbediensteten erheben werden. Nathaniel Steepleton. Notzucht, begangen am Spross eines bedeutenden Samurai-Hauses.«
»Hä?«, erwiderte Tanaka.
»Das ist England«, half Kuroda ihm auf die Sprünge. »Das sind religiöse Eiferer. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, in die Schlafzimmer der Leute hineinzuregieren.«
»Ach ja«, sagte Tanaka und dachte kurz darüber nach. »Diese Sektenspinner. Also, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum die Leute sich das bieten lassen. Haben die alle eine Gehirnwäsche verpasst bekommen oder so was?«
»Du solltest mal hinfahren und dir das mit eigenen Augen anschauen«, sagte Kuroda. Er hätte für die Phonographenaufnahme von Tanakas Reaktion auf eine Predigt in einer Baptistenkirche ein hübsches Sümmchen hingeblättert. »Wie dem auch sei … Mori sollte jedenfalls schleunigst auftauchen, wenn er nicht will, dass sein Junge nächste Woche schon hinter Gittern sitzt.«
Tanaka nickte langsam. »Aber er weiß doch sicherlich längst, dass Sie diese Drohung aussprechen könnten.«
»Da bin ich mir sicher«, erwiderte Kuroda. Es war durchaus ein wenig besorgniserregend, dass Mori darauf gewartet hatte, dass er es tatsächlich tat. »Aber machen wir ihm ruhig ein wenig Feuer unterm Hintern.«
»Und wir sind ganz sicher, dass er uns nicht alle umbringen wird?«
Kuroda schnaubte. »Tanaka, er ist ein Ritter. Wenn man ihm einen anständigen Kampf in Aussicht stellt, wird er schon kommen. In England nennt man das fun.«
Tanaka blickte, als würden ihm dafür noch ein paar andere Worte einfallen. Er wandte sich bereits zum Gehen, als ein junger Adjutant mit einem Kuvert angelaufen kam.
»Herr Premierminister!«, japste der junge Mann.
»Was?«
»Ein Telegramm … für Sie … von einem Baron Mori …«
Kuroda winkte Tanaka damit zu und riss dann den Umschlag auf.
Das verheißt nichts Gutes, was das Feuern auf die Russen angeht, findest Du nicht auch? Selbst meine Neunjährige hat stärkere Nerven als Du. Man sieht sich am 18. Dezember.
Gleich einem Banner entrollte sich die altvertraute Kampfeslust in Kurodas Herz, leicht angestaubt, nachdem sie so lange weggepackt gewesen war, aber dennoch lodernd wie eh und je. Er hatte sich seit seinem Abschied aus der Marine danach gesehnt und hatte nur bis zu diesem Moment nicht bemerkt, wie sehr. Ein richtiges Turnier mit einem richtigen Ritter zum ersten Mal seit Jahren. Und mit einem Mal wünschte er sich, dass Mori in diesem Augenblick schon dort wäre, um zu sehen, was als Nächstes geschehen würde, und empfand dabei die gleiche herrliche Aufregung wie am Tag seiner Hochzeit.
Tanaka hob die Augenbrauen, als er den Telegrammtext erblickte. »Ihr seid doch alle verrückt«, sagte er.
»Ein guter Krieger wird man nur«, entgegnete Kuroda, der immer noch von einem solchen Hochgefühl erfüllt war, dass er damit wahrscheinlich einen sehr ansehnlichen Heißluftballon in die Lüfte hätte befördern können, »wenn man den Krieg liebt. Das ist es, was einen echten Samurai ausmacht.«
»Großartig. Ganz toll. Und wie sollen wir einen Hellseher dazu bringen, lange genug in einem Raum zu bleiben, damit ein Haufen Wissenschaftler ihm Fragen stellen kann? Nur für den Fall, dass er sich dem nicht anstandslos unterwirft, sobald er hier eingetroffen ist? Er klingt nämlich nicht so, als ob er das vorhätte.«
»Die Wissenschaftler haben da schon einige Ideen«, versprach Kuroda.
• • •
Als Kuroda nach Hause kam, war sein Butler in heller Aufregung. Anscheinend war eine Frau in sein Arbeitszimmer vorgedrungen und weigerte sich, wieder zu gehen. Verblüfft schritt Kuroda dorthin. Er hatte zwar eine Geisha, aber die war eine erlesene Professionelle und hatte die ätherische Angewohnheit, manchmal selbst dann nicht aufzutauchen, wenn man es ersehnte. Als er jedoch die Tür öffnete, erwies sich die Frau in seinem Arbeitszimmer als alles andere als eine Geisha. Sie war klein und unscheinbar und schaute gerade in das Aquarium, in dem sein kleiner Oktopus, als wollte er ihr die Hand schütteln, hinterm Glas einen Tentakel in Richtung ihrer Fingerspitze stupste. Kuroda fühlte sich betrogen. Seit er Moris Uhrwerkoktopus kennengelernt hatte, hielt er einen echten als Haustier. Sie waren viel liebenswerter als Katzen und normalerweise auch viel treuer.
»Mrs. Pepperharrow«, sagte er aufrichtig erschüttert und ertappte sich dabei, dass er wie ein Idiot nach einem Vorwand suchte, um sie loszuwerden. Er ärgerte sich über sich selbst – und über sie, weil sie ihm dieses Gefühl einflößte. »Ich bin sehr beschäftigt, was wollen Sie?«, fragte er grob.
»Die Eulen sind wieder da«, erwiderte sie. Sie klang weder gekränkt noch besorgt – und auch nicht rachedurstig. »Mori kehrt nach Hause zurück.«
»Äh … ja, ich habe gerade ein Telegramm bekommen«, hörte sich Kuroda gestehen.
»Ausgezeichnet. Soll ich Ihnen helfen?«
»Was? Aber … Sie hassen mich doch.«
Sie nickte. Mit ihren seltsamen Augen musterte sie ihn von oben bis unten. Als er hereingekommen war, war sie, statt auf ihn zuzugehen, vor ihm zurückgewichen, bis sie deutlich außerhalb seiner Reichweite war. »Ja. Aber wir wissen ja beide, dass er viel gefährlicher ist als Sie.«
DREI
London, am selben Tag
Thaniel und Fanshaw sprachen immer noch über Gespenster, als die elektrischen Lampen schlimmer denn je zu zischen begannen. Ein paar Sekunden lang wurde alles grün, und dann fiel die Stromversorgung gänzlich aus, und das Büro wurde in eine nur von einzelnen Kerzen erhellte Düsternis getaucht.
»Ich schlage vor«, sagte Fanshaw im Dunkeln, »wir nehmen den Rest des Tages frei. Sie wohnen doch noch in der Nähe von Kensington, nicht wahr? Sollen wir uns eine Droschke teilen?«
»Äh, ich habe eine Fahrkarte für die U-Bahn«, erwiderte Thaniel, der zwar mit einem Brandy klarkam, aber nicht mit unerwarteten Droschkenfahrten. Es war nicht so, dass er sich das inzwischen nicht hätte leisten können. Das Auswärtige Amt zahlte gut. Es lag eher daran, dass Armut ebenso ein Bewusstseinszustand wie eine finanzielle Realität war und er manchmal der wütenden Stimme seines Vaters nicht auszuweichen vermochte, die ihn innerlich anherrschte, warum zum Teufel er sein Geld verprasse.
Fanshaw lächelte. »Haben Sie mich da gerade auf Ihre verblümte nordenglische Art um eine Gehaltserhöhung gebeten?«