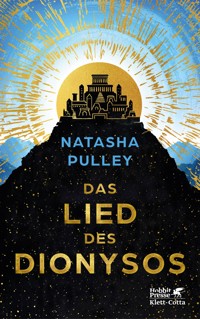Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ein großartiges Lesevergnügen. Stark, voller Energie!« The New York Times Platz 1 der Phantastik-Bestenliste! Sein Leben lief ab gleich einem Uhrwerk. Bis er dem Uhrmacher begegnete. »Der Uhrmacher in der Filigree Street« erzählt eine mitreißende, phantastische Geschichte um eine rätselhafte Uhr und einen ebenso spektakulären wie unmöglich aufzuklärenden Bombenanschlag auf Scotland Yard. Das Buch nimmt die Lesenden mit auf eine Reise durch das viktorianische England und das Japan des 19. Jahrhunderts und es eröffnet Türen in eine ganz andere, seltsame und magische Vergangenheit. London, Oktober 1883. Eines Abends kehrt Thaniel Steepleton, ein einfacher Angestellter im Innenministerium, in seine winzige Londoner Mietwohnung heim. Da findet er auf seinem Kopfkissen eine goldene Taschenuhr. Es ist ihm ein Rätsel, was es mit ihr auf sich hat. Sechs Monate später explodiert im Gebäude von Scotland Yard eine Bombe. Steepleton wurde gerade rechtzeitig gewarnt, weil seine Uhr ein Alarmsignal gab. Nun macht er sich auf die Suche nach dem Uhrmacher und findet Keita Mori, einen freundlichen, aber einsamen Mann aus Japan. So harmlos Mori auch scheint, eine Kette von unheimlichen Ereignissen deutet schon bald darauf hin, dass er etwas zu verbergen hat... »Bezaubernd! Inmitten dieser Thriller-ähnlichen Handlung wirft Pulley nachdenklich stimmende Fragen über den freien Willen, das Schicksal und die Identität auf – eine reichhaltige Mischung aus historischer Fantasie, Philosophie und großen Emotionen.« The Washington Post
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Natasha Pulley
Der Uhrmacher in der Filigree Street
Roman
Aus dem Englischen von Jochen Schwarzer
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Watchmaker of Filigree Street« im Verlag Bloomsbury Publishing Plc, London, New York
© 2015 by Natasha Pulley
Für die deutsche Ausgabe
© 2021, 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung der Daten des Originalverlags
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
ISBN 978-3-608-98713-3
E-Book ISBN 978-3-608-11682-3
Für Claire
TEIL EINS
EINS
London, November 1883
In der Telegrafieabteilung des Innenministeriums roch es immer ein wenig nach Tee. Quell dessen war ein Päckchen Lipton’s, das sich hinten in Nathaniel Steepletons Schreibtischschublade befand. Bevor der elektrische Telegraf allgemein in Gebrauch gekommen war, hatte dieser Raum als Abstellkammer gedient. Thaniel hatte gelegentlich munkeln hören, die Abteilung sei nie erweitert worden, weil der Innenminister Neuerungen der Marine prinzipiell misstraute. Doch auch wenn dem nicht so war, hatte das Budget nie dafür gereicht, auch nur den ursprünglichen Teppich zu ersetzen, dem noch Gerüche längst vergangener Zeiten anhafteten. Neben Thaniels modernem Tee roch es daher auch nach Putzmitteln und Sackleinen und manchmal gar nach Lack, obwohl dort schon jahrelang nichts mehr lackiert worden war. Statt Besen und Bürsten standen dort nun zwölf Telegrafen auf einem langen Pult aufgereiht. Tagsüber kümmerte sich je ein Telegrafist um drei der Apparate, deren Gegenstellen in oder außerhalb von Whitehall irgendein längst vergessener Staatsdiener handschriftlich auf ihnen vermerkt hatte.
In dieser Nacht schwiegen die Telegrafen. Von sechs Uhr abends bis Mitternacht blieb ein Telegrafist im Büro, um dringende Nachrichten entgegenzunehmen, doch in seinen drei Dienstjahren in Whitehall hatte Thaniel nie erlebt, dass nach acht noch etwas kam. Einmal hatte das Außenministerium ein seltsames, sinnleeres Rattern gesandt, aber das war ein Missgeschick gewesen: Am anderen Ende hatte sich jemand versehentlich auf die Tasten gesetzt – und sich dann auf und ab bewegt. Thaniel hatte tunlichst nicht weiter nachgefragt.
Etwas steif im Nacken drehte er sich auf seinem Stuhl von rechts nach links und schob das Buch, in dem er las, auf dem Tisch zurecht. Die Leitungen der Telegrafen verliefen durch Löcher im Pult zum Fußboden hinab, alle zwölf genau dort, wo eigentlich die Knie der Telegrafisten hingehörten. Der Bürovorsteher lamentierte gern, so seitwärts sitzend sähen sie wie höhere Töchter aus, die gerade Reitunterricht erhielten. Weit mehr aber lamentierte er, wenn einmal ein Telegrafendraht riss, denn es war kostspielig, sie zu ersetzen. Vom Boden des Telegrafieraums aus verliefen die Leitungen im Gebäude hinab und dann spinnwebförmig nach ganz Westminster hinaus. Eine führte ins Außenministerium, das sich gleich nebenan befand, und eine weitere zum Telegrafieraum des Parlaments. Zwei schlossen sich den Kabelsträngen längs der Straße an, bis sie zum Hauptpostamt in St Martin’s Le Grand gelangten. Die übrigen führten direkt zur Residenz des Innenministers, zu Scotland Yard, zum India Office, zur Admiralität und zu weiteren untergeordneten Behörden. Einige der Leitungen waren im Grunde nicht nötig, denn es wäre schneller gegangen, sich aus einem Bürofenster zu lehnen und die Nachricht hinüberzurufen. Das aber wäre, meinte der Vorsteher, nicht gentlemanlike.
Der leicht verbogene Minutenzeiger von Thaniels Uhr, der bei der Zwölf immer ein wenig hängen blieb, zeigte Viertel nach zehn. Zeit für eine Teepause. Den Tee hob er sich für die Nächte auf. Es war schon seit dem späten Nachmittag dunkel, und im Büro war es inzwischen so kalt, dass er seinen Atem sah und die Messingtasten der Telegrafen beschlugen. Da war es wichtig, etwas Warmes zu haben, auf das man sich freuen konnte. Er nahm den Lipton’s heraus, steckte das Päckchen in seinen Teebecher, klemmte sich die gestrige Ausgabe der Illustrated London News unter den Arm und ging zu der eisernen Wendeltreppe.
Die Stufen gaben, als er hinabging, bei jedem Schritt ein leuchtend gelbes Dis von sich. Er hätte nicht sagen können, warum ein Dis gelb war. Andere Töne hatten eigene Farben. Als er noch Klavier gespielt hatte, war das hilfreich gewesen, denn wenn er sich einmal verspielte, nahm der jeweilige Ton eine bräunliche Färbung an. Er hatte nie jemandem erzählt, dass er Töne sehen konnte. Gelb klingende Treppenstufen, das hätte verrückt gewirkt, und entgegen dem, was oft in der Zeitung stand, war es bei der Regierung Ihrer Majestät verpönt, Personen zu beschäftigen, die offenkundig geistesgestört waren.
Der große Herd in der Kantine erkaltete nie, denn selbst zwischen den Spät- und Frühschichten blieb der Kohlenglut keine Gelegenheit, vollends zu erlöschen. Als Thaniel sie schürte, erwachte sie aufflackernd zum Leben. Dann lehnte er sich an einen Tisch, wartete darauf, dass das Wasser kochte, und betrachtete derweil sein verzerrtes Spiegelbild auf dem bronzefarbenen Kessel, der sein Gesicht, das vorwiegend grau war, in viel wärmeren Farbtönen erscheinen ließ.
Als er die Zeitung aufschlug, raschelte sie in der Nachtstille. Er hatte auf irgendein interessantes militärisches Schlamassel gehofft, aber es gab nur einen Bericht über Parnells jüngste Rede vor dem Unterhaus. Thaniel senkte die Nase in seinen Schal. Wenn er sich ein wenig Mühe gab, konnte er die Teezubereitung auf fünfzehn Minuten ausdehnen, was zumindest eine der acht Stunden, die er noch abzuleisten hatte, merklich verkürzte. Was die übrigen sieben anging, ließ sich nicht viel machen. Es half, wenn er ein halbwegs spannendes Buch dabeihatte und der Presse Besseres einfiel, als sich in leicht missbilligendem Ton mit den irischen Unabhängigkeitsbestrebungen zu beschäftigen, so als hätte der Clan-na-Gael nicht schon seit Jahren immer wieder Bomben durch die Fenster von Londoner Regierungsgebäuden geworfen.
Er blätterte die restliche Zeitung durch und stieß auf Reklame für die Inszenierung von The Sorcerer im Savoy. Er hatte sie zwar schon gesehen, aber die Vorstellung, noch einmal hinzugehen, munterte ihn auf.
Der Kessel begann zu pfeifen. Schön langsam brühte er seinen Tee auf und trug dann den Becher, den er sich vor die Brust hielt, die gelben Treppenstufen wieder hinauf und in den einsamen Lichtschein seines Büros.
Da klickte einer der Telegrafen.
Thaniel beugte sich über den Apparat, zunächst nur neugierig, bis er sah, dass Great Scotland Yard die Gegenstelle war. Dann beeilte er sich, den Anfang des Papierstreifens zu erhaschen, denn die Maschine zerknüllte ihn fast unweigerlich, wenn man nicht schnell zugriff. Knarrend setzte sie schon dazu an, doch als Thaniel vorsichtig an dem Streifen zog, gab sie nach. Die Punkte und Striche des Morsecodes wirkten zittrig, stammten sichtlich von der Hand eines älteren Mannes.
Fenier— haben mir eine Nachricht hinterlassen mit der Drohung—
Der Rest ratterte immer noch durch die Mechanik, was kleine Sternchen durch den düsteren Raum huschen ließ. Bald erkannte Thaniel den Stil seines Gegenübers. Superintendent Williamson morste ebenso stockend, wie er sprach. Als der Rest der Nachricht dann zum Vorschein kam, war er abgehackt und voller Pausen.
—von Bombenanschlägen auf alle ö—ffentlichen Gebäude am— 30. Mai 1884. In genau sechs Monaten. Williamson.
Thaniel zog den Apparat zu sich heran.
Hier Steepleton, InMin. Bitte letzte Nachricht bestätigen.
Auf die Antwort musste er lange warten.
Habe gerade— Zettel auf meinem Schreibtisch vorgefunden. Bombendrohung. Kündigen an— mich in die Luft zu jagen. Unterzeichnet Clan-na-Gael.
Thaniel stand reglos da, über den Telegrafen gebeugt. Williamson telegrafierte selbst, und wenn er wusste, dass er sein Gegenüber kannte, zeichnete er mit Dolly, so als gehörten sie alle demselben Gentlemen’s Club an.
Geht es Ihnen gut?, fragte Thaniel.
Ja. Ein langes Schweigen. Muss zugeben— ein wenig erschüttert. Gehe jetzt heim.
Gehen Sie nicht allein.
Die werden— mir schon nichts tun. Wenn die sagen Bomben im Mai— gibt’s Bomben im Mai. Das ist der— Clan-na-Gael. Die lauern einem nicht mit Kricketschlägern auf.
Aber warum kam der Zettel jetzt? Könnte ein Trick sein, um Sie zu bestimmter Uhrzeit aus dem Büro zu locken.
Nein, nein. Das soll uns— Angst einjagen. Whitehall soll wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wenn genug Politiker um ihr Leben fürchten, gehen sie eher auf irische Forderungen ein. Da steht »öffentliche Gebäude«. Man wird nicht nur einen Tag lang einen großen Bogen ums Parlament machen müssen. An mir sind die nicht interessiert. Glauben Sie mir, ich— kenne diese Leute. Hab genug von denen eingelocht.
Na dann passen Sie auf sich auf, morste Thaniel widerstrebend.
Danke.
Während der Tongeber noch das letzte Wort des Superintendent klickte, riss Thaniel seine Transkription ab und lief damit den dunklen Korridor hinunter, zu einer Tür am anderen Ende, unter der Kaminfeuerschein hervordrang. Er klopfte an und öffnete. Drinnen blickte der Bürovorsteher mürrisch zu ihm hoch.
»Ich bin nicht da. Das ist hoffentlich was Wichtiges.«
»Eine Nachricht von Scotland Yard.«
Der Vorsteher nahm sie unwirsch entgegen. Dies war sein Dienstzimmer, und er hatte auf dem Lehnsessel am Kamin gelesen, Kragen und Binder neben sich auf dem Boden. Es war jeden Abend dasselbe. Er behauptete, dort zu übernachten, weil seine Gattin so laut schnarche, Thaniel aber glaubte allmählich, sie habe ihn längst vergessen und schon die Schlösser ausgetauscht. Nachdem er den Text überflogen hatte, nickte der Vorsteher.
»Also gut. Sie können jetzt nach Hause gehen. Ich sage dem Minister Bescheid.«
Thaniel nickte und eilte hinaus. Er war noch nie vorzeitig nach Hause geschickt worden, nicht mal, wenn er krank war. Als er seinen Mantel und Hut holte, hörte er am Ende des Korridors erhobene Stimmen.
Er wohnte in einer Pension gleich nördlich der Strafanstalt Millbank, so nah an der Themse, dass der Keller jeden Herbst unter Wasser stand. Nachts war es unheimlich, von Whitehall dorthin zu Fuß zu gehen. Unter den Gaslaternen drifteten Nebelschwaden über die dunklen Fenster der geschlossenen Läden, die zusehends schäbiger wurden, je näher er seiner Unterkunft kam. Es war ein so schleichender Verfall, als ginge er vorwärts durch die Zeit und sähe die Häuser bei jedem Schritt um fünf Jahre altern, wobei eine museumshafte Stille herrschte. Dennoch war er froh, aus dem Büro heraus zu sein. Das Innenministerium war das größte öffentliche Gebäude in London und würde im Mai eines der Anschlagziele sein. Er wandte den Kopf zur Seite, als könnte er dem Gedanken dadurch ausweichen, und vergrub die Hände tiefer in den Taschen. Im vorigen März hatten irgendwelche Iren versucht, eine Bombe durch ein Fenster im Erdgeschoss zu schleudern. Der Wurf ging fehl, und sie sprengten nur ein paar Fahrräder unten auf der Straße in die Luft, doch im Telegrafiebüro hatte die Detonation den Fußboden zum Erbeben gebracht. Das war allerdings nicht der Clan-na-Gael gewesen, sondern nur ein paar wütende Jungs mit ein paar geklauten Stangen Dynamit.
Unter dem breiten Vordach der Pension schlief der Bettler, der dort seinen Stammplatz hatte.
»Guten Abend, George.«
»Nambd«, grummelte der.
Drinnen stieg Thaniel ganz leise die hölzerne Treppe hinauf, denn das Haus hatte dünne Wände. Sein Zimmer befand sich im dritten Stock, zum Fluss hinaus. Die Pension machte zwar äußerlich einen düsteren Eindruck – von der ewigen Feuchtigkeit und dem Nebel waren die Außenmauern mit Schimmel überzogen –, wirkte innen aber deutlich angenehmer. Die einzelnen Zimmer waren schlicht, aber reinlich und verfügten jeweils über ein Bett, einen Herd und einen Ausguss mit fließend Wasser. Die Wirtin vermietete ausschließlich an unverheiratete Männer, und ein Zimmer inklusive einer Mahlzeit pro Tag kostete jährlich fünfzig Pfund. Es war im Grunde ganz ähnlich wie bei den Strafgefangenen nebenan, und das stieß Thaniel gelegentlich bitter auf, denn er hatte es im Leben eigentlich weiter bringen wollen als ein Zuchthäusler. Oben auf dem Treppenabsatz angelangt, sah er, dass seine Tür einen Spaltbreit offen stand.
Er hielt inne und lauschte. Er besaß nichts Stehlenswertes, auch wenn die verschlossene Kiste unter seinem Bett auf den ersten Blick wertvoll wirken mochte. Ein Einbrecher konnte ja nicht wissen, dass sich darin nur Noten befanden, die er seit Jahren nicht angerührt hatte.
Er hielt den Atem an, um besser hören zu können. Alles war still, aber im Zimmer hätte ja auch jemand den Atem anhalten können. Nachdem er eine ganze Zeit lang so dagestanden hatte, stupste er mit den Fingerspitzen die Tür auf und wich schnell wieder zurück. Niemand kam heraus. Die Tür wegen des Lichts offen lassend, nahm er ein Streichholz von der Anrichte und riss es an der Wand an. Während er das Hölzchen an den Lampendocht hielt, kribbelte ihm der Nacken, in der Gewissheit, dass sich gleich jemand an ihm vorbeidrängen würde.
Als die Lampe aufleuchtete, war niemand im Zimmer.
Er stand da, mit dem Rücken zur Wand, das heruntergebrannte Streichholz in der Hand. Alles schien an seinem Platz zu sein. Der Streichholzkopf zerbröckelte und fiel aufs Linoleum hinab, wo er einen Rußfleck hinterließ. Thaniel sah unter dem Bett nach. Die Notenkiste war nicht angerührt. Auch seine Ersparnisse nicht, die er unter einem losen Dielenbrett für seine Schwester verwahrte. Erst als er das Brett wieder eingesetzt hatte, fiel ihm auf, dass der Wasserkessel ein wenig dampfte. Vorsichtig legte er die Fingerspitzen daran. Er war tatsächlich warm, und als er die Herdklappe öffnete, glomm ihm Kohlenglut entgegen.
Der Abwasch, der auf der Arbeitsplatte gestanden hatte, war verschwunden. Verdutzt hielt Thaniel inne. Das musste ja ein sehr verzweifelter Einbrecher gewesen sein, wenn er ungespültes Geschirr mitnahm. Thaniel sah im Küchenschrank nach, ob auch das Besteck fehlte, fand dort aber die fehlenden Teller und Schalen, abgespült und aufgestapelt. Sie waren noch warm. Er wandte sich ab und durchsuchte noch einmal das ganze Zimmer. Nichts fehlte, jedenfalls fiel ihm nichts auf. Anschließend ging er, immer noch verwirrt, wieder nach unten. Die Kälte draußen fühlte sich beißender an als Minuten zuvor. Sie drang ihm entgegen, als er die Haustür öffnete, und er schlang die Arme um sich und trat hinaus. George schlief immer noch neben dem Eingang.
»George! George«, sagte er, rüttelte ihn ein wenig und hielt den Atem an. Der alte Mann stank nach ungewaschenen Kleidern und Tierfellen. »Bei mir ist eingebrochen worden. Waren Sie das?«
»Du hast doch gar nichts, was einer klauen würde«, knurrte George mit einer Gewissheit, auf die Thaniel in diesem Moment lieber nicht einging.
»Haben Sie jemanden gesehen?«
»Könnte schon sein …«
»Ich habe …«, Thaniel suchte in seinen Taschen, »… vier Pence und ein Gummiband.«
George seufzte und richtete sich in seinem Nest aus schmutzigen Decken auf, um die Münzen entgegenzunehmen. Irgendwo unter dem Wust quiekte sein Frettchen. »Ich hab’s nich richtig gesehen, klar? Ich hab geschlafen. Hab’s zumindest versucht.«
»Und was haben Sie gesehen?«
»Ein Paar Stiefel.«
»Ah«, sagte Thaniel. George war schon zu Anbeginn der Zeit nicht mehr der Jüngste gewesen, und so lästig er auch war, musste man doch gewisse Rücksichten nehmen. »Aber hier wohnen ja viele Leute.«
George warf ihm einen gereizten Blick zu. »Wenn du den lieben langen Tag hier auf dem Boden hocken würdest, würdest du auch wissen, was für Stiefel ihr alle so tragt, und braune hat keiner von euch.«
Thaniel war den meisten seiner Nachbarn nie begegnet, war aber geneigt, ihm zu glauben. Soweit er wusste, waren sie alle Büroangestellte; wie er selbst gehörten sie zu den Heerscharen von Männern in schwarzem Gehrock und schwarzem Hut, die London allmorgend- und allabendlich für eine halbe Stunde überschwemmten. Unwillkürlich blickte er auf seine eigenen schwarzen Schuhe hinab. Sie waren nicht mehr die neusten, aber auf Hochglanz gewienert.
»Haben Sie sonst noch irgendwas gesehen?«, fragte er.
»Himmelherrgott noch mal, was hat er denn so Wichtiges geklaut?«
»Nichts.«
George schnaubte. »Was kümmert’s dich dann? Es ist spät. Manche von uns brauchen noch ’ne Mütze Schlaf, bevor uns der Wachtmeister in aller Herrgottsfrüh wieder verscheucht.«
»Ach, jammern Sie nicht. Sie sind doch im Handumdrehen wieder hier. Eine geheimnisvolle Person bricht bei mir ein, macht den Abwasch und nimmt nichts mit. Ich will wissen, was dahintersteckt.«
»War bestimmt deine Mutter …«
»Nein.«
George seufzte. »Kleine braune Stiefel. Irgend ’ne ausländische Schrift auf dem Hacken. Vielleicht eher ein Knabe als ein Mann.«
»Ich will meine vier Pence zurück.«
»Verfatz dich«, gähnte George und legte sich wieder hin.
Thaniel eilte auf die leere Straße hinaus, in der vagen Hoffnung, dort irgendwo einen Jungen in braunen Stiefeln zu erblicken. Der Boden bebte, als unter ihm ein Spätzug passierte und durch das Gitter im Gehsteig eine Dampfwolke heraufstieß. Dann ging er langsam wieder zurück ins Haus. Die Treppe erklomm er immer zwei Stufen auf einmal, was er nach drei Etagen in den Oberschenkeln spürte.
Zurück in seinem Zimmer öffnete er die Herdklappe erneut, ließ sich, noch im Mantel, auf der Bettkante nieder und reckte die Hände in Richtung Glut. Da bemerkte er etwas Dunkles neben sich. Er erstarrte, denn im ersten Moment hielt er es für eine Maus, aber es regte sich nicht. Nein, es war eine kleine Samtschatulle mit einer weißen Schleife darum. Er hatte sie nie zuvor gesehen. Er nahm sie in die Hand. Sie war schwer. An dem Schleifenband hing ein rundes Etikett, das mit einem Laubmuster verziert war. In schöner Handschrift stand darauf: »Für Mr Steepleton«. Er löste die Schleife und klappte die Schatulle auf. Ihr Scharnier war ein wenig steif, quietschte aber nicht. Im Innern lag eine Taschenuhr.
Vorsichtig nahm er sie heraus. Das Gehäuse war aus einem roséfarbenen Gold, das er noch nie gesehen hatte. Die Uhrkette glitt geschmeidig hinterher. Ihre einzelnen Glieder waren makellos glatt und ließen an keiner haarfeinen Lücke oder Lötstelle erkennen, wo sie zusammengefügt waren. Thaniel ließ sich die Kette durch die Finger laufen, bis der Federring am Ende gegen seinen Manschettenknopf klickte. Als er auf den Knopf der Taschenuhr drückte, ließ sich der Deckel nicht öffnen. Er hielt sich die Uhr ans Ohr, aber sie gab nicht den leisesten Laut von sich, und die Krone ließ sich auch nicht drehen. Irgendwo in ihrem Innern musste aber ein Uhrwerk gearbeitet haben, denn trotz der feuchten Kälte war das Gehäuse warm.
»Heute ist doch dein Geburtstag«, sagte er mit einem Mal in das leere Zimmer hinein. Dann ließ er die Schultern hängen und kam sich sehr dumm vor. Annabel musste hergekommen sein. Sie kannte seine Adresse aus seinen Briefen, und er hatte ihr für Notfälle einen Schlüssel geschickt. Da sie kein Geld für eine Zugfahrkarte hatte, war er immer davon ausgegangen, dass ihr Versprechen, ihn einmal in London zu besuchen, nur eine schwesterliche Floskel war. Georges geheimnisvoller Knabe war wahrscheinlich einer ihrer Söhne. Die schöne Handschrift auf dem Etikett hätte sie schon eher verraten, wäre er nicht so müde und abgelenkt gewesen. Sie hatte früher, wenn der alte Herzog ein festliches Abendessen gab, immer die Platzkärtchen beschriftet, obwohl das eigentlich Aufgabe des Butlers war. Thaniel erinnerte sich, wie er damals an ihrem Küchentisch Rechenaufgaben erledigt hatte, als er noch so klein war, dass seine Füße nicht auf den Boden reichten, und sie hatte ihm gegenübergesessen und war mit ihrer guten Feder über die Kärtchen gefahren, während ihr Vater an einem kleinen Schraubstock Angelfliegen band.
Er hielt die Uhr noch einen Moment lang in der Hand und legte sie dann auf den Holzstuhl neben dem Bett, der ihm als Ablage für Kragen und Manschettenknöpfe diente. Das goldene Gehäuse fing den Glutschein ein und leuchtete in der Farbe einer menschlichen Stimme.
ZWEI
Am nächsten Tag grübelte Thaniel lange darüber nach, wie noch mal der Fachbegriff für die Angst vor großen Maschinen war. Es fiel ihm nicht mehr ein, aber in seiner ersten Zeit in London hatte er jedenfalls daran gelitten. Am schlimmsten war es immer an Bahnübergängen unweit von Bahnhöfen, wo die riesigen Lokomotiven Dampf fauchend zum Stehen kamen, nur zehn Fuß entfernt von den Leuten, die sich einen Weg über die Gleise bahnten. Das Gleisgewirr bei der Victoria Station war immer noch alles andere als sein Lieblingsort. Damals hatte es Dutzende derartige kleine Dinge gegeben, Dinge, die keine Rolle spielten, bis mal etwas schiefging, wie dass man sich beispielsweise verlief, woraufhin sie, die sich stets an jeden Gedanken hefteten, das Denken an sich viel schwieriger machten, als es anderswo gewesen wäre.
Er war sich sicher, dass mit Annabel alles in Ordnung war. Sie war schon immer ein pragmatischer Mensch gewesen, auch schon bevor sie ihre Söhne bekommen hatte. Allerdings war sie nie zuvor in London gewesen und hatte weder bei der Pensionswirtin noch am Empfang des Innenministeriums eine Nachricht hinterlassen.
Mehr um sein Unbehagen zu lindern als tatsächlich aus Angst um sie, schickte er von seinem Arbeitsplatz aus ein Telegramm an ihr Postamt in Edinburgh, für den Fall, dass sie schon wieder hatte heimreisen müssen. Für den Fall, dass nicht, kaufte er auf dem Heimweg Kekse und Zucker, um ihr einen anständigen Tee anbieten zu können. Der Krämer am Ende der Whitehall Street hatte neuerdings schon in den frühen Morgenstunden geöffnet, damit die heimgehenden Nachtarbeiter bei ihm einkaufen konnten.
Als Thaniel nach Hause kam, war Annabel nicht da, als er dann aber gerade beim Kochen war, klopfte es leise an der Tür. Er öffnete, die Hemdsärmel noch hochgekrempelt, und wollte sich schon dafür entschuldigen, dass es um neun Uhr früh bei ihm nach Abendessen roch. Vor ihm stand aber nicht Annabel, sondern ein Bursche mit einem Abzeichen der Post und einem Kuvert, der ihm ein Klemmbrett zum Unterzeichnen hinhielt. Das Telegramm kam aus Edinburgh.
Was soll das heißen? Bin in Edinburgh wie immer. War nie weg. Ministerium hat dich wohl endgültig in den Wahnsinn getrieben. Werde dir Whisky schicken. Soll ja hilfreich sein. Alles Gute zum Geburtstag. Tut mir leid, dass ich das wieder vergessen habe. Viele Grüße, A.
Er legte das Blatt mit der Schrift nach unten neben sich ab. Die Uhr lag immer noch auf dem Stuhl, wo er sie zurückgelassen hatte. Ihr Gehäuse war von dem Dampf aus dem Kochtopf beschlagen, aber das Gold summte dennoch in seiner Stimmfarbe.
Am nächsten Morgen ging er auf dem Weg zur Arbeit aufs Polizeirevier, ganz konfus durch den Schichtwechsel, der ihm in der Wochenmitte immer das Leben schwer machte. Der diensthabende Beamte schnaubte nur verächtlich und fragte nicht ganz zu Unrecht, ob nicht vielleicht Robin Hood der Übeltäter sein könne. Thaniel nickte und lachte, doch als er ging, war das schleichende Unbehagen wieder da. Im Büro kam er in einer Teepause auf die Sache zu sprechen. Seine Telegrafistenkollegen bedachten ihn nur mit seltsamen Blicken und gaben lediglich vage interessierte Laute von sich. Danach hielt er sich bedeckt. In den nächsten Wochen wartete er darauf, dass sich jemand dazu bekennen würde, was aber nicht geschah.
Das Knarren der Schiffe vor seinem Fenster bemerkte er normalerweise gar nicht. Diese Geräusche waren immer da, nur lauter bei Flut als bei Ebbe. Doch eines kalten Morgens im Februar verstummten sie. Die Schiffsrümpfe waren über Nacht im Flusseis festgefroren. Von dieser Stille wurde er wach. Er lag reglos lauschend im Bett und betrachtete die Wolken seines Atems. Nur der Wind pfiff leise durch den hier und da undichten Fensterrahmen. Die Fensterscheibe war größtenteils beschlagen, und er sah nur ein Stück von einem aufgerollten Segel. Das Segeltuch bewegte sich nicht mal, als sich das Pfeifen des Winds zu einem Fauchen auswuchs. Als der Wind wieder abflaute, hörte er sonst nichts mehr. Er blinzelte, dann noch einmal, denn alles wirkte mit einem Mal zu fahl.
An diesem Tag hatte die Stille einen silbernen Saum. Er drehte den Kopf auf dem Kissen zu dem Stuhl mit den Kragen und Manschettenknöpfen hin, und ein leises Geräusch wurde deutlicher hörbar. Das Äußere der Bettdecke fühlte sich klamm an, als er den Arm ausstreckte, um die Taschenuhr emporzuheben. Sie war wie immer deutlich wärmer, als sie hätte sein dürfen. Als er sie zur Hand nahm, wäre die Kette fast von der Stuhlkante gerutscht, aber sie war lang genug, um nicht hinunterzufallen, und bildete ein goldenes, durchhängendes Seil.
Als er sich die Uhr ans Ohr hielt, konnte er das Uhrwerk arbeiten hören. Es war so leise, dass er nicht hätte sagen können, ob es gerade erst angesprungen war oder schon die ganze Zeit gearbeitet hatte und nur von anderen Dingen übertönt worden war. Er hielt sich die Uhr ans Hemd, bis er das Uhrwerk nicht mehr hören konnte, hob sie dann wieder an und versuchte, das Geräusch mit seiner Erinnerung an die gestrige Version der Stille und ihre Schattenfarben zu vergleichen. Schließlich setzte er sich auf und drückte auf den Verschlussknopf. Der Deckel ließ sich immer noch nicht öffnen.
Thaniel stand auf und zog sich an, hielt dann aber mit halb zugeknöpftem Hemd inne. Er wusste nicht, ob es überhaupt möglich war, dass ein Uhrwerk nach zwei Monaten Stillstand von selbst wieder zu arbeiten begann. Darüber dachte er immer noch nach, als sein Blick auf den Türriegel fiel. Er war nicht vorgelegt. Thaniel betätigte den Türgriff. Die Tür war nicht abgeschlossen. Er öffnete sie. Auf dem Korridor war niemand zu sehen, aber still war es nicht; Wasser gurgelte in den Rohren, und Schritte und leises Poltern waren zu hören, während sich seine Nachbarn bereit machten, zur Arbeit zu gehen. Seit dem Einbruch im November hatte Thaniel seine Zimmertür kein einziges Mal unverschlossen gelassen, jedenfalls nicht, dass er wusste; allerdings neigte er gelegentlich zu spektakulärer Schusseligkeit. Er machte die Tür wieder zu.
Auf dem Weg nach draußen blieb er stehen, pochte mit den Fingerknöcheln nachdenklich an den Türrahmen und ging noch einmal hinein, um die Uhr mitzunehmen. Falls sich tatsächlich jemand daran zu schaffen machte, hätte er es ja noch erleichtert, wenn er die Uhr den ganzen Tag in seinem Zimmer liegen ließ. Bei dem Gedanken drehte sich ihm der Magen um, auch wenn Gott allein wusste, was für eine Art von Einbrecher das war, der noch einmal wiederkam, um zuvor hinterlegte Geschenke nachträglich zu justieren. Jedenfalls nicht die Art, die mit Kricketschläger und Maske kam – doch andererseits kannte er sich auf diesem Gebiet ja schließlich überhaupt nicht aus. Er wünschte nur, der Polizist hätte nicht so lauthals gelacht.
Der offene Türriegel spukte ihm immer noch im Kopf herum, als er schließlich die gelbe Wendeltreppe hinaufstieg und sich dabei aus seinem Schal schälte. Von der Kälte und dem vielen Morsen waren seine Fingerspitzen ganz rauh und blieben ständig an der Wolle hängen. Auf halber Höhe kam ihm der Bürovorsteher entgegen und hielt ihm ein Bündel Papiere hin.
»Für Ihr Testament«, erklärte er. »Spätestens Ende nächsten Monats, verstanden? Sonst ersticken wir in dem ganzen Papierkram. Und kümmern Sie sich um Park, ja?«
Verwirrt ging Thaniel weiter zur Telegrafieabteilung, wo sein jüngster Kollege in Tränen ausgebrochen war. Er blieb in der Tür stehen und kramte etwas hervor, das zumindest nach Mitgefühl aussah. Thaniel war der festen Überzeugung, dass ein Soldat, der einen chirurgischen Eingriff überlebt hatte, oder ein Bergmann, der aus einem eingestürzten Schacht gehievt worden war, das Recht hatte, anschließend öffentlich Tränen zu vergießen. Nicht im Mindesten überzeugt aber war er, dass jemand, der als Büroangestellter im Innenministerium tätig war, irgendeinen Grund zum Weinen hatte. Er war sich allerdings auch bewusst, dass es wahrscheinlich recht unfair war, so zu denken. Als Thaniel fragte, was denn sei, sah Park zu ihm hoch.
»Warum müssen wir unser Testament machen? Werden wir alle bombardiert?«
Thaniel nahm ihn auf eine Tasse Tee mit nach unten. Als sie wieder ins Büro zurückkamen, fanden sie die anderen Telegrafisten in ähnlicher Verfassung vor.
»Was ist denn hier los?«, fragte Thaniel.
»Haben Sie diese Testamentsformulare gesehen?«
»Das ist weiter nichts als eine Formalität. Da würde ich mir keine Sorgen machen.«
»Wurden die früher schon mal ausgeteilt?«
Da musste Thaniel lachen, riss sich dann aber zusammen. »Nein, aber die überschütten uns doch ständig mit unnützen Formularen. Erinnern Sie sich noch an das, mit dem wir verpflichtet wurden, keine Geheimnisse unserer Marine an den preußischen Geheimdienst zu verkaufen? Nur für den Fall, dass wir mal einem preußischen Agenten über den Weg laufen sollten … Denn die treiben sich ja wahrscheinlich immer in der Nähe der Teebude kurz vorm Trafalgar Square rum, wo’s auch den scheußlichen Kaffee gibt … Also, ich gehe mal davon aus, dass wir da alle seitdem sehr auf der Hut sind. Unterschreiben Sie’s einfach, und wenn Mr Croft das nächste Mal reinkommt, drücken Sie’s ihm in die Hand.«
»Was nehmen Sie denn in Ihr Testament auf?«
»Gar nichts. Ich besitze nichts, für das sich jemand interessieren würde«, sagte er. Dann aber wurde ihm klar, dass das nicht stimmte. Er zog die Taschenuhr hervor. Sie war aus echtem Gold.
»Danke, dass Sie sich ein bisschen um mich gekümmert haben«, sagte Park. Er faltete ein Taschentuch zusammen und fing immer wieder von vorne damit an. »Sie sind wirklich ein guter Kerl. Es ist, als ob ich meinen Vater hier hätte.«
»Nicht der Rede wert«, murmelte Thaniel, aber es versetzte ihm einen leichten Stich. Fast hätte er gesagt, dass er nicht viel älter sei als die anderen, sah dann aber ein, dass es unfair gewesen wäre. Es spielte keine Rolle, wie viel älter er war. Er war älter; und selbst wenn sie alle gleich alt gewesen wären, wäre er dennoch der Älteste von ihnen.
Sie zuckten zusammen, als alle zwölf Telegrafen zu rattern begannen. Unter dem Ansturm der Nachrichten zerknüllten die Papierstreifen, und alle griffen schnell zu ihren Bleistiften, um den Code mitzuschreiben. Und weil sich seine Kollegen auf einzelne Buchstaben konzentrierten, hörte Thaniel als Erster, dass die Apparate alle dasselbe verkündeten.
Eilmeldung, Bombe explodiert in—
Victoria Station zerstört—
—Bahnhof schwer beschädigt—
—in Garderobe versteckt—
—ausgeklügelter Zeitzünder in der Garderobe—
Victoria Station—
—Beamte im Einsatz, Tote und Verletzte—
—Clan-na-Gael.
Thaniel rief nach dem Bürovorsteher, der angelaufen kam und dann wie vom Donner gerührt dastand, mit einem großen Teefleck auf der Weste. Sobald er verstanden hatte, worum es ging, wurde der restliche Tag damit verbracht, Nachrichten zwischen den einzelnen Abteilungen des Innenministeriums und Scotland Yard hin und her zu jagen und der Presse jeglichen Kommentar zu verweigern. Thaniel hatte keine Ahnung, wie sie es schafften, direkte Leitungen innerhalb von Whitehall anzuzapfen, aber irgendwie kriegten sie es immer hin. Vom Ende des Korridors her ertönte Gebrüll. Das war der Innenminister, der den Herausgeber der Times anschrie, seine Reporter sollten aufhören, die Leitungen zu blockieren. Als die Schicht zu Ende war, taten Thaniel die Sehnen im Handrücken weh, und von den kupfernen Tasten rochen seine Finger wie nach Münzgeld.
Ohne es abgesprochen zu haben, gingen sie nach Dienstschluss nicht getrennter Wege, sondern gemeinsam in Richtung Victoria Station. Da der Zugverkehr vorerst eingestellt war, wimmelte es auf den Straßen von Menschen, und als sie dem Bahnhofsgebäude näher kamen, lagen überall Ziegelsteine herum. Da die Passanten vor allem wissen wollten, wann die Züge wieder fahren würden, war es nicht schwer, zu der zerstörten Bahnhofsgarderobe vorzudringen. Die Balken dort waren zerfetzt, als wäre irgendein monströses Wesen aus dem Raum ausgebrochen. Mitten in all der Zerstörung lag ein unversehrter Zylinder, und ein roter Schal haftete mit einer grauen Reifschicht an einigen Ziegeln. Polizisten räumten mit dampfendem Atem Trümmer von draußen nach drinnen. Nach einer Weile blickten sie argwöhnisch zu den vier Telegrafisten hinüber. Thaniel wurde klar, dass sie einen seltsamen Anblick boten: vier magere Büroangestellte in Schwarz, die dort in einer Reihe standen und viel länger verharrten als alle anderen. Anschließend trennten sich ihre Wege. Statt direkt nach Hause zu gehen, drehte Thaniel eine Runde im St James’s Park, ergötzte sich an dem beinahe grünen Gras und den leeren, frisch geharkten Blumenbeeten. Das Gelände dort war jedoch so offen, dass die prachtvollen Fassaden der Admiralität und des Innenministeriums immer noch nah wirkten. Er wünschte sich einen richtigen Wald herbei. Dieser Gedanke weckte in ihm das Verlangen, zu Besuch nach Lincoln zu fahren, doch im Cottage des Wildhüters wohnte nun ein anderer Mann, und im Herrenhaus residierte ein neuer Herzog.
Auf Umwegen ging er nach Hause und machte dabei einen großen Bogen um das Parlament.
»Hast du gesehen?«, fragte George, der Bettler, und hielt ihm, als er vorbeiging, eine Zeitung hin. Auf der ersten Seite prangte ein großes Bild des zerbombten Bahnhofs.
»Gerade eben.«
»Was sind das bloß für Zeiten, hä? Also, in meiner Jugend hat’s so was nich gegeben.«
»Damals haben sie bloß die ganzen Katholiken verbrannt, nicht wahr …«, erwiderte Thaniel. Er betrachtete das Bild. Es in der Zeitung zu sehen, ließ es realer wirken als durch eigenen Augenschein, und mit einem Mal ärgerte er sich über sich selbst. Sie waren angewiesen worden, ihre persönlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, das hieß, in einen Zustand, aus dem ihre Angehörigen schlau werden konnten, falls ihnen im Mai etwas zustieß. Annabel würde niemals seine Taschenuhr verkaufen, selbst wenn sie es kaum schaffte, passende Kleidung für ihre Söhne zu besorgen. Es würde nichts nützen, ihr die Uhr zu vermachen.
»Harr, harr, harr«, knurrte George. »Warte, wo willst du hin?«
»Zur Pfandleihe. Hab’s mir anders überlegt.«
Gleich hinter dem Gefängnis gab es einen Pfandleiher, der sich trotz des Abzeichens mit den drei Goldkugeln draußen am Laden als Juwelier bezeichnete.
Das Schaufenster, in dem schäbig wirkender Goldschmuck hing, war mit Reklame für andere Geschäfte und mit Anzeigen von Leuten vollgeklebt, die etwas Gebrauchtes anboten, das zu groß war, um es herzubringen. Ganz zuoberst klebte einer jener polizeilichen Aushänge, die zu Wachsamkeit mahnten. Thaniel fand es selbst ein wenig pedantisch von sich, aber allmählich gingen ihm die Dinger auf die Nerven. Bombenleger schleiften ja schließlich keine Drähte oder Lunten hinter sich her.
»Albern, nicht wahr?«, sagte der Pfandleiher, als er Thaniels Stirnrunzeln bemerkte. »Seit Monaten kleistern die alles damit voll. Ich sage denen ja immer, unsere Bombenleger sind doch alle hinter Schloss und Riegel.« Er deutete mit einer Kopfbewegung zum Gefängnis hinüber. »Aber die hören ja nicht auf mich.« Sogar auf dem Ladentresen klebte einer der Aushänge, und der Pfandleiher zog ihn ab, um zu zeigen, dass sich darunter noch ein weiterer befand. Der Kleister hatte das Papier durchscheinend gemacht, weshalb man auch den dritten Aushang darunter sah, dessen Überschrift wie ein schräger, blasser Schatten der oberen wirkte.
»Die sieht man überall in Whitehall«, sagte Thaniel und zog dann die Taschenuhr hervor. »Was ist die wert?«
Der Pfandleiher warf einen Blick darauf, schaute dann etwas genauer hin und schüttelte den Kopf. »Nein. Von dem nehme ich keine Uhren an.«
»Wie bitte? Von wem?«
Der Pfandleiher guckte gereizt. »Hören Sie, darauf falle ich nicht noch mal herein. Zweimal hat mir vollkommen gereicht, schönen Dank auch. Die Uhr, die sich in Luft auflöst, ein brillanter Trick, mag ja sein, aber damit müssen Sie schon zu jemandem gehen, der den noch nicht kennt.«
»Das ist kein Trick. Wovon reden Sie überhaupt?«
»Wovon ich rede? Ich rede davon, dass diese Uhren nicht verpfändet bleiben, nicht wahr? Jemand versetzt so eine, ich zahle gutes Geld dafür, und am nächsten Tag ist das verdammte Ding verschwunden. Ich habe in der ganzen Stadt davon gehört, es ist nicht nur mir so ergangen. Und Sie verlassen jetzt mein Geschäft, sonst rufe ich die Polizei.«
»Sie haben da doch einen ganzen Schrank voller Uhren, die alle aussehen, als wären sie durchaus verpfändet geblieben«, protestierte Thaniel.
»Aber eine von denen sehen Sie da nicht, nicht wahr? Und jetzt raus mit Ihnen!« Er zog den Griff eines Kricketschlägers unterm Ladentresen hervor.
Thaniel hob die Hände und ging. Draußen spielten einige kleine Jungen Indianer, und er musste ihnen ausweichen. Dann sah er sich noch einmal zu der Pfandleihe um und wollte zurückgehen und sich nach den Namen der Leute erkundigen, die zuvor versucht hatten, so eine Uhr zu versetzen, bezweifelte aber, dass außer einem Hieb mit dem Kricketschläger viel dabei herauskommen würde. Enttäuscht ging er heim und legte die Uhr auf den Stuhl zurück, der ihm als Anziehtisch diente.
Wenn es stimmte, was der Pfandleiher sagte, würde er niemanden finden, der ihm die Uhr abnahm. Eine kribbelnde Anspannung machte sich etwa auf halber Höhe seines Rückgrats bemerkbar, als würde ihm jemand dort eine Fingerspitze wie eine Pistolenmündung zwischen die Wirbel halten. Er fuhr mit der Hand dorthin und drückte mit dem Daumen auf die Stelle. Betrug mit teuren Uhren, so etwas gab es tatsächlich, und er vergaß auch tatsächlich manchmal, seine Zimmertür zu verriegeln. Doch es war ja höchst unwahrscheinlich, dass jemand zweimal bei ihm eingebrochen war, die Uhr aufgezogen und es ihm unmöglich gemacht hatte, sie wieder loszuwerden. Welche Unsummen es allein kosten würde, sämtliche Pfandleiher von ganz London gegen sich aufzubringen. Nein, das konnte nicht sein.
Am nächsten Tag zog Thaniel die Testamentspapiere unter dem Päckchen Lipton’s aus seiner Schreibtischschublade hervor. Er befreite sie von den feinen Teekrümeln, mit denen sie bestäubt waren, und füllte die Formulare gut lesbar aus. Als er die Taschenuhr beschrieb und wo sie zu finden sei, rann ihm ein Tintentropfen die Federspitze hinab und zerplatzte über Annabels Namen. Er schüttelte kurz den Kopf, ging den Rest der unnützen Seiten durch und unterschrieb auf der letzten.
Bald darauf heiterte das Wetter auf. Der Frühling kam, und Thaniel ertappte sich dabei, dass er Butter oder Käse in Geschäften betrachtete und in Gedanken überschlug, ob ihr Haltbarkeitsdatum das seine überstieg. Er brachte ein paar alte Kleider und Kissenbezüge zu dem Armenhaus auf der anderen Seite des Flusses und putzte, als er wiederkam, seine Fensterrahmen von außen.
DREI
Oxford, Mai 1884
Das akademische Jahr war fast vorbei. Im frühsommerlichen Licht zeigte sich der Sandstein wieder golden und waren die hohen Mauern mit Glyzinien behangen. Unter dem blauen Himmel, die Luft erfüllt vom Geruch des sonnenwarmen Kopfsteinpflasters, rieb sich Grace das Haar und kam sich philisterhaft vor, weil sie sich nach Regen sehnte.
Den Winter über bildete sie sich immer ein, ein Sommermensch zu sein. Doch leider stimmte das nicht, und nach einer Woche gutem Wetter hatte sie die Wärme schon wieder satt. Da der Himmel keinerlei Anstalten machte, sich zu bedecken, hatte sie beschlossen, den Tag mit einem in der Vorwoche bestellten Buch in der Kühle der Bibliothek zu verbringen. Sie plante ein Experiment und wollte herausfinden, wie es zuvor durchgeführt worden war. Bei ihrem Aufbruch hatte das noch wie eine gute Idee gewirkt; jetzt aber, da sie fast schon da war, schwitzte sie und wünschte, dass im Lesesaal Limonade gestattet wäre.
Als sie über den Innenhof der Bodleian Library ging, flatterten in der warmen Brise Plakate an den Mauern, die für College-Bälle und Stücke von Studentenbühnen warben. Letztere waren ihr im Vorjahr durch eine grottenschlechte Inszenierung von Edward II. am Keble College gründlich verleidet worden. Edward war von einem Ordinarius der Altphilologie gespielt worden, Gaveston von einem Studenten. Grace kümmerte es nicht, was Hochschullehrer und -schüler in ihrer Freizeit trieben, sie würde sich aber nie wieder einen Shilling dafür abknöpfen lassen, dabei zuzusehen. So unauffällig wie möglich richtete sie ihren falschen Schnurrbart und schritt dann die Eingangstreppe der Radcliffe Camera hinauf. In deren Untergeschoss befand sich der dunkelste Lesesaal der Universitätsbibliothek. Den Portier am Eingang grüßte sie mit einem Tippen an den Hut. Er beachtete sie gar nicht, sondern eilte los, um eine junge Frau abzufangen, die nicht klug genug gewesen war, um sich aus der Garderobe eines befreundeten Herrn zu bedienen.
»Verzeihung, Miss. Was glauben Sie, wo Sie hingehen?«, fragte er ganz freundlich.
Die Frau blinzelte verdutzt, und dann fiel ihr ein, dass sie keinen männlichen Begleiter bei sich hatte. »Oh, natürlich! Tut mir leid«, sagte sie und machte auf dem Absatz kehrt.
Grace lüpfte unwillkürlich eine Augenbraue und schritt dann drinnen die Treppe hinab. Sie hatte nie verstanden, warum sich jemand an die Regel hielt, die Frauen ohne männliche Begleitung den Zutritt zu den Bibliotheken verwehrte. Alle, Professoren ebenso wie Studenten und Proktoren, wussten, dass man, wenn auf einem Schild »Betreten des Rasens verboten« stand, halt über den Rasen hüpfte. Wem das nicht klar war, der verstand einfach nicht, wie Oxford tickte.
Der Lesesaal war kreisförmig angeordnet. Die Bücherregale sahen alle gleich aus, und obwohl sich Grace nun schon am Ende ihres vierten und letzten Studienjahres befand, musste sie leicht desorientiert erst einmal nach dem Ausgabeschalter suchen. Bis vor kurzem hatte sie sich noch an den Schildern an den Pfeilern orientiert, die anzeigten, zu welchem Studienfach die jeweiligen Regale gehörten, doch im vorigen Monat war die Theologieabteilung verlegt worden. Als sie den Schalter schließlich entdeckt hatte, ging sie über den Fliesenboden dorthin und fragte flüsternd nach ihrer Bestellung. Grace hatte sie unter dem Namen Gregory Carrow aufgegeben, ein entfernter Verwandter von ihr, der die Universität schon Jahrzehnte zuvor verlassen hatte, doch solange unter dem angegebenen Namen ein Student oder Ehemaliger verzeichnet war, wurde das nicht nachgeprüft.
»Das American Journal of Science … Was wollen Sie denn damit?«, fragte der Bibliothekar leicht gereizt, als er ihr den Band aushändigte. Wie Museumskuratoren war es auch Bibliothekaren im Grunde ein Graus, dass sie irgendjemandem gestatten mussten, irgendetwas anzufassen. Sie fanden offenbar, dass die Universität ohne all die Studenten viel besser dran wäre.
Grace lächelte. »Ich baue mir gerade ein Regal, und weil das hier so solide wirkt, wollte ich es als Stütze verwenden.«
Er stutzte. »Sie dürfen doch keine Bücher aus der Bibliothek mitnehmen.«
»Ja«, sagte sie. »Ich weiß. Deshalb habe ich mir hier ja einen kleinen Geheimkeller eingerichtet. Vielen Dank«, fügte sie hinzu und trug ihre Bestellung zu einem Lesetisch.
Lebensmittel waren im Lesesaal verboten, aber sie hatte in der Tasche ihres Jacketts ein paar Kekse hereingeschmuggelt. Das war riskant, denn so etwas wurde mit einem Verweis aus der gesamten Universitätsbibliothek für den Rest des Tages geahndet, aber es ging nicht anders. Vom Oxforder Stadtzentrum aus hätte sich Lady Margaret Hall ebenso gut auch in Brighton befinden können, und Grace blieb bis zum Trimesterende nicht mehr genug Zeit, um ihre Bibliothekstage mit dem Hin und Her zu irgendwelchen Mahlzeiten zu verplempern.
Sie hatte jedenfalls über eine Woche lang auf diese Zeitschrift warten müssen. Die Bodleian Library verwahrte zwar ein Exemplar jedes Buchs, das seit ihrer Gründung im Vereinigten Königreich erschienen war, doch das bedeutete, dass nur die am häufigsten genutzten Werke in ihren Präsenzbereichen Platz fanden. Etwas ausgefallenere Bücher standen in den unterirdischen Magazinen, die weit größer waren als die oberirdischen Bauten, und entlegene Werke kamen in stillgelegte Zinnminen in Cornwall und mussten, wenn sie bestellt wurden, per Zug herbeigeschafft werden. Noch schwieriger zu beschaffen als obskure amerikanische Zeitschriften waren nur die Erstausgaben von Newtons Principia – denn die waren in der Manuskriptbibliothek an Pulte gekettet, und Zutritt dorthin erhielt man nur mit schriftlicher Erlaubnis eines Tutors.
»Nach diesem neuen Jackett habe ich schon überall gesucht, Carrow.«
Grace wirbelte auf ihrem Stuhl herum und schrie leise auf, als Akira Matsumoto ihr den falschen Schnurrbart abriss.
»Du gibst auch ohne den ziemlich überzeugend einen Mann ab«, sagte er, setzte sich ihr gegenüber und schnippte den Schnurrbart quer durch den Raum.
Grace verpasste ihm unter dem Tisch einen Tritt. Ihr tat die Oberlippe weh. Sie wollte ihm schon sagen, dass er leise sein sollte, merkte dann aber, dass sie außer dem Bibliothekar die einzigen Anwesenden waren. Alle anderen waren draußen und genossen den Sonnenschein. Stattdessen fragte sie: »Was machst du hier? Ich dachte, du kümmerst dich drüben im oberen Lesesaal um japanische Lyrik. Oder musst du dir meinen Schnurrbart leihen, damit sie dich überhaupt reinlassen?«
Matsumoto lächelte. Er war der elegante Sohn eines japanischen Adligen, weniger ein Student als vielmehr ein steinreicher Tourist. Am New College eingeschrieben, stand ihm die ganze Universität offen, aber soweit Grace wusste, hatte er bislang in Oxford weiter nichts getan, als sein ohnehin schon makelloses Englisch weiter zu vervollkommnen und einige japanische Gedichte zu übersetzen. Er behauptete immer, das sei harte Arbeit und überaus bedeutsam. Doch je länger er das behauptete, desto überzeugter war Grace, dass es sich dabei um ein rein fiktives Projekt handelte.
»Ich saß gerade im Café«, sagte er, »und da sah ich draußen mein Jackett vorbeispazieren. Ich bin ihm gefolgt. Dürfte ich es bitte wiederhaben?«
»Nein.«
Er drückte mit einem weiß behandschuhten Finger das Buch, das sie in der Hand hielt, auf den Tisch hinunter. Draußen war es Grace in dem geborgten Jackett und dem gestärkten Kragen unangenehm warm gewesen, Matsumoto aber schien überhaupt nicht zu schwitzen. »Die Relativbewegung der Erde gegen den Lichtäther. Was in Gottes Namen ist denn ein Lichtäther?«
»Das ist die Substanz, durch die sich das Licht bewegt. Wie Schall durch die Luft oder Wellen durchs Wasser. Es ist unglaublich interessant. Es ist so ähnlich wie mit den fehlenden Elementen im Periodensystem: Rein mathematisch wissen wir, dass es sie geben muss, aber bisher hat niemand es experimentell bewiesen.«
»Ach du liebe Zeit«, seufzte er. »Wie fürchterlich öde.«
»Der Mann, der diesen Aufsatz hier geschrieben hat, hätte es fast geschafft«, fuhr Grace fort. Sie hatte sich schon vor einiger Zeit vorgenommen, Matsumoto die Naturwissenschaften ein wenig näherzubringen. Es war einfach peinlich, Umgang mit einem Mann zu pflegen, der Newton für einen Ortsnamen hielt. »Sein Experiment schlug letztlich fehl, aber das lag nur daran, dass seine Parameter zu lax waren und er es unter zu starken Fremdschwingungen durchgeführt hat. Sein Versuchsaufbau aber war ausgezeichnet. Dieses Ding hier, dieser Apparat, das ist ein Interferometer. Es müsste eigentlich funktionieren. Wenn ich so etwas aufbauen könnte, mit einigen Verbesserungen, an einem absolut erschütterungsfreien Ort – zum Beispiel im steinernen Keller eines Colleges –, dann könnte das eine sehr spannende Sache sein …«
»Ich will dir mal sagen, was eine spannende Sache ist«, unterbrach er sie. »Meine endlich abgeschlossene Übersetzung des Hyakunin Isshu.«
»Gesundheit!«
»Ach, sei still, Carrow, und tu gefälligst so, als wärst du begeistert.«
Sie rümpfte die Nase. »Na, dann zeig doch mal her.«
Er hob das Buch vorsichtig aus seiner Segeltuchtasche. Es war ein hübscher Quartband, und als er ihn aufschlug, sah sie, dass links jeweils der japanische und rechts der englische Text gedruckt war. »Ich habe dem endlich den letzten Schliff verpasst. Jetzt ist es fertig, und ich bin einigermaßen stolz darauf. Ich habe nur dieses eine Exemplar drucken lassen, auf eigene Kosten; na gut, auf Kosten meines Vaters. Ich habe es heute Morgen aus der Druckerei geholt.«
Grace blätterte das Buch durch. Die Gedichte umfassten jeweils nur wenige Verse.
»Schau dir mal Nummer neun an«, sagte er. »Und mach nicht so ein Gesicht. Das sind einige der schönsten Gedichte der japanischen Literatur und Balsam für deine numerische Seele.«
Grace schlug das neunte Gedicht auf.
The flower’s colour
Has faded away,
While in idle thoughts
My life passes vainly by,
And I watch the long rains fall.
»Männlich-freimütig ist das aber nicht gerade«, meinte sie.
Matsumoto lachte. »Und wenn ich dir sage, dass unser Wort für Farbe dasselbe ist wie unser Wort für Liebe?«
Grace las das Gedicht noch einmal. »Dennoch reichlich abgedroschen«, sagte sie. Einer seiner Fehler war, dass er alle seine Bekannten so lange mit hartnäckigem und suggestivem Charme bombardierte, bis sie ihn verehrten. Mit weniger als dieser Verehrung gab er sich nicht zufrieden. Grace hatte seine anderen Freunde kennengelernt und hielt nichts von ihnen. Sie liefen ihm hinterher wie eine Hundemeute dem Jäger.
»Hoffnungslos …«, seufzte er und nahm den dünnen Band wieder an sich. »Jetzt leg dieses scheußliche Wissenschaftsbuch weg, Carrow, sonst kommen wir noch zu spät.«
Grace verstand nicht. »Zu spät?«
»Die Nationale Gesellschaft für das Frauenwahlrecht. An deinem College. In einer Viertelstunde.«
»Was? Nein!«, protestierte sie. »Ich habe nie gesagt, dass ich da hingehen würde. Das sind doch alles teetrinkende Idioten …«
»Rede nicht so von deinen Mitfrauen«, sagte Matsumoto und zog sie von ihrem Stuhl hoch. »Lass das Buch und komm mit. Das sind außerordentlich wichtige Anliegen, und außerdem nimmt diese Bewegung allmählich beängstigende Züge an. Diese Bertha scheint mir imstande, mit einer Stricknadel auf dich loszugehen, wenn sie feststellt, dass du ihrer Versammlung ferngeblieben bist.«
Grace versuchte, sich zu widersetzen, aber er war einen Kopf größer als sie und verfügte unter seiner makellosen Garderobe über unerwartete Kräfte. Sie schaffte es lediglich, sich weit genug von ihm wegzubeugen, um den Zeitschriftenband auf den Rückgabewagen zu legen. »Du scherst dich doch keinen Deut um das Frauenwahlrecht, also was soll das Ganze?«
»Natürlich ist mir das wichtig! Auch ihr solltet über diese Rechte verfügen!«
»Das sagst du doch bloß, weil du auch Angst vor den Stricknadeln hast.«
»Pscht«, machte Matsumoto, und dann schritten sie schweigend an dem Bibliothekar vorbei. An der Treppe angelangt, nahm er ihren Arm und geleitete sie hinauf. »Wenn du es unbedingt wissen willst: Ich habe in dem Vorraum, in dem die diversen mitgeschleiften Ehemänner und Brüder warten werden, ein ganz vorzügliches Pokermatch organisiert, aber die liebe Bertha lässt keinen Angehörigen des unschönen Geschlechts herein, wenn er nicht von einem Exemplar des schönen begleitet wird.«
»Soso. Ich bin also deine Eintrittskarte zu diesem Spiel.«
»Ja.«
Grace dachte darüber nach. Sie wäre gern empört gewesen, aber nachdem sie in den vergangenen vier Jahren in den Bibliotheken von Oxford hatte ein und aus gehen können, weil sie ihn im Schlepptau gehabt hatte, hätte da selbst ein Oktopus trotz seiner acht Beine einen schweren Stand gehabt. »Na gut …«
»Ausgezeichnet. Ich lade dich heute Abend auch auf ein Glas Wein ein.«
»Danke. Aber wenn du nach dem Spiel laut verkünden könntest, dass du dich nun zu deinem Club begeben wirst …«
»Ja, ja, natürlich.« Er küsste sie auf den Kopf, und sie roch sein teures Rasierwasser. Sie spürte, dass sie rot wurde.
»Wirst du das wohl lassen!«
Sie waren gerade am oberen Ende der Treppe angelangt. Der Portier bedachte Grace mit einem argwöhnischen Blick.
»Du hast dich gerade verraten«, lachte Matsumoto, als sie außer Hörweite des Mannes waren. »Frauen haben die Kunst der Freundschaft wirklich nicht kultiviert.«
»Frauen fallen auch nicht so übereinander her …«
»Oh, da ist eine Droschke! Könntest du die bitte anhalten? Die Kutscher ignorieren mich immer. Die scheinen mich alle für einen Vorboten der gelben Gefahr zu halten.«
Grace lief los, um die Droschke anzuhalten. Die Oxforder Exemplare waren generell in besserem Zustand als ihre Londoner Pendants, und trotz des warmen Wetters rochen die Passagiersitze nur nach Lederpolitur und Putzmittel. Matsumoto ließ Grace den Vortritt und stieg dann geduckt hintendrein.
»Lady Margaret Hall, bitte!«, rief sie, und dann rumpelten sie auf dem Kopfsteinpflaster davon.
Lady Margaret Hall befand sich am Ende einer langen Allee. Die Kutschfahrt führte sie an weiteren Bibliotheken und Stadthäusern vorbei und an den roten Backsteinmauern des Keble College mit ihren Zickzackmustern, die lächerlich aussahen und Grace’ Vermutung nach vor allem die mangelnde Verfügbarkeit von echtem Cotswolds-Sandstein zum Ausdruck brachten. Matsumotos College hatte die Bestände für seine Neubauten aufgekauft.
Auch in Lady Margaret war von Neubauten die Rede. Grace hoffte, dass die Pläne verwirklicht würden. Als die Droschke vor dem Haupteingang hielt, machte das College einen ärmlichen Eindruck, sogar verglichen mit Keble. Da sie so gut wie nie eine Droschke nahm und den Weg von den Prachtbauten der Stadt dort hinaus daher sonst nicht so schnell zurücklegte, fiel Grace fast nie auf, wie klein das College im Grunde war. Es ließ sich eigentlich kaum mit den anderen vergleichen. Von außen wirkte es eher wie ein Herrenhaus aus weißem Stein, hübsch mit wildem Wein und Lavendel bewachsen, aber alles andere als imposant. Und es beherbergte auch nur neun Studentinnen.
An diesem Tag war dort allerdings viel mehr los als sonst üblich. Weitere Droschken trafen ein, und Frauen mit Sonnenschirmen strömten zu zweit oder ein paar Schritte ihren Gatten voraus zum Eingang. Einige der Herren bemerkten Matsumoto und gingen schnurstracks und mit hoffnungsvollem Blick auf ihn zu.
»Ah, Grace, schließt du dich uns endlich an?«
»Guten Tag, Bertha«, erwiderte Grace lächelnd, auch wenn sie selber spürte, dass dieses Lächeln ziemlich aufgesetzt wirkte. Bertha war ihre Zimmernachbarin, studierte aber Altphilologie, das sinnloseste Fach an der ganzen Universität. Es fiel Grace sehr schwer, sich mit jemandem zu verständigen, der jede wache Minute damit verbrachte, über die sprachlichen Feinheiten von Männern nachzusinnen, die schon seit zweitausend Jahren tot waren. Matsumoto war schon schlimm genug, Altphilologen aber waren gewissermaßen Ehrenkatholiken. Und Bertha hatte sich nun wie ein Bischof an der Tür des Haupteingangs aufgebaut.
»Vielleicht möchtest du vorher noch etwas Passenderes anziehen«, sagte sie und besah mit hochgezogenen Augenbrauen das geliehene Jackett, das Grace trug.
»Ja, das ist ohnehin viel zu warm.« Grace zog es aus und überreichte es Matsumoto. »Ich bin in einer Minute wieder da. Wartet nicht auf mich.«
»Wer ist das?«, verlangte Bertha zu wissen. »Du kannst doch nicht deine Diener mitbringen, so viel Platz haben wir nicht.«
»Das ist Akira Matsumoto. Er ist nicht mein Diener – er ist ein Großcousin des Kaisers.«
»Sprechen Sie Englisch?«, erkundigte sich Bertha zu laut.
»Ja, durchaus«, erwiderte Matsumoto ganz gelassen. »Ich fürchte bloß, mein Orientierungssinn ist in jedweder Sprache nicht der allerbeste. Könnten Sie mir noch einmal erklären, wo ich warten soll? Es wurde mir beim letzten Mal gesagt, aber ich erinnere mich leider nicht mehr.«
Damit hatte Bertha nicht gerechnet. »Dort links entlang. Da werden Erfrischungen gereicht und … nun ja.«
Matsumoto schenkte ihr ein Lächeln und entschwand dann dem Pfeifenraucharoma folgend in Richtung Vorraum. Grace sah ihm hinterher. Sie hätte nicht sagen können, ob er aus tief empfundener Menschenliebe so charmant war oder weil er mit seinem Charme unweigerlich bekam, was er wollte. Es war verlockend, Ersteres für naiv zu halten und Zweiteres für weitaus wahrscheinlicher, aber wie dem auch sei: Er machte einfach immer weiter damit. Ihre eigenen Gutmütigkeitsreserven waren hingegen meist schon nach zwanzig Minuten erschöpft. Sie schüttelte kurz den Kopf und ging dann mit langsamen Schritten die Treppe hinauf, um sich etwas anderes anzuziehen.
Ihr Bruder hatte ihr zum Geburtstag eine Taschenuhr geschenkt. Sie ließ sich auf zweierlei Art öffnen. Auf der einen Seite befand sich ein Ziffernblatt und auf der anderen ein filigranes Gitterwerk. Wurde der hintere Verschluss geöffnet, so nahm die Filigranarbeit die Gestalt einer winzigen Schwalbe an. Ein raffinierter Mechanismus sorgte dafür, dass die Schwalbe über die Innenseite des Deckels fliegen konnte und ihre silbernen Schwingen dabei zu hören waren. Grace nahm die Uhr mit nach unten, um etwas zu haben, womit sie sich beschäftigen konnte. Als sie schließlich dort eintraf, hatte die Versammlung bereits begonnen, und sie musste sich hineinschleichen und ganz hinten hinsetzen. Dann fuhr sie mit dem Fingernagel über das Signet hinten auf der Uhr. K. Mori. Wahrscheinlich ein Italiener; Engländer wurden zu oft nassgeregnet, um auf so fantastische Ideen zu kommen.
Bertha stand auf der Empore, auf der sich normalerweise die Speisetafel für die Fellows befand, hatte die Hände gefaltet und war auf hübsche Weise errötet, während sie ihre Ansprache hielt. Hin und wieder gab es ein wenig Beifall. Sie sagte die üblichen Sachen. Grace öffnete und schloss ihre Taschenuhr dreimal und sah der Schwalbe beim Fliegen zu. Das Klicken des Uhrendeckels war deutlich zu hören und hätte die Frauen neben ihr auf der Bank wahrscheinlich geärgert, hätten zwei von ihnen nicht ohnehin gestrickt.
»Und daher«, sagte Bertha, »schlage ich vor, dass diese Gesellschaft Mr Gladstones Bestrebungen auf jede nur erdenkliche Art und Weise unterstützt, sei es durch unseren Einfluss auf männliche Verwandte oder sei es durch Parteispenden. Möchte jemand etwas dazu sagen?«
Jemand unter einer weißen Haube hob die Hand. »Ich weiß nicht recht, was ich von Mr Gladstone halten soll«, sagte sie. »Er wirkt auf mich nicht sonderlich vertrauenswürdig. Mein Onkel ist Phrenologe, und der sagt, er hat den typischen Schädel eines Lügners.«
»Das ist doch weiter nichts als Blödsinn«, sagte jemand anderes. »Mein Mann arbeitet im Innenministerium und hat ihn als absoluten Gentleman kennengelernt. Zu Weihnachten hat er seinem ganzen Stab Wein geschenkt.«
Grace drehte die Uhr hin und her und wünschte sich, der geniale Mr Mori hätte auch eine Methode ersonnen, um die Zeit schneller verstreichen zu lassen. Bisher waren erst fünfzehn Minuten vergangen. Die Versammlung würde mindestens eine Stunde dauern. Bertha brauchte fast so lange, um ihren Antrag durchzubringen. Doch kaum hatte man sich geeinigt, da steckte der Portier den Kopf zur Tür herein und räusperte sich.
»Äh, meine Damen? Die Herren haben die Absicht bekundet, sich zu ihren Clubs begeben zu wollen.«
Die Damen stoben förmlich auseinander und eilten ihrem männlichen Anhang hinterher, ehe dieser sie womöglich allein zurückließ. Grace schlüpfte als Erste hinaus und stieß auf Matsumoto, der draußen an einem Türrahmen lehnte und schon auf sie wartete.
»So«, sagte er. »Pflicht getan. Das war doch gar nicht so schlimm, oder?«
»Du warst ja nicht dabei. Bloß raus hier, bloß raus. Wenn Frauen jemals das Wahlrecht bekommen, wandere ich nach Deutschland aus.«
Seine Mundwinkel zuckten. »Wie ausgesprochen unfraulich von dir.«
»Hast du gehört, was die gesagt haben? Oh, wir können Gladstone nicht unterstützen, denn er hat so seltsames Haar. Aber nein, wartet mal, er ist im Grunde ein wirklich liebenswerter Mann, trotz seiner komischen Nase …«
Als sie nach draußen kamen, wo es inzwischen kühler geworden war, sah er sie mit erhobenen Augenbrauen an. »Ich sage nur ungern etwas so Banales, Carrow, aber du bist eine von ihnen.«
»Ich bin ein untypisches Exemplar«, entgegnete sie gereizt. »Ich habe eine gute Bildung genossen. Und ich verbringe nicht meine Zeit damit, über irgendwelches Geschirr zu faseln. Wer so was tut, sollte nicht mal in die Nähe des Wahlrechts kommen, vom Parlament ganz zu schweigen. Himmelherrgott, wenn wir jetzt weibliche Abgeordnete hätten, würde die Außenpolitik danach entschieden, wie es um den Backenbart des Kaisers bestellt ist. Wer von mir verlangt, eine Petition zu unterschreiben, kriegt einen Tritt verpasst, das schwöre ich.« Sie hielt inne. »Hattest du mir vorhin nicht ein Gläschen Wein versprochen?«
»Ja«, sagte Matsumoto und lächelte. »Wenn du zum New College mitkommst.«
»Gern.«
»Du machst dich lächerlich, das ist dir hoffentlich klar.«
»Ja, ich weiß«, sagte sie und seufzte. »Ist es Weißwein? Der rote schmeckt für mich wie Essig.«
»Natürlich ist es Weißwein, ich bin ja schließlich Japaner. Ich würde gern zu Fuß gehen, wenn du nichts dagegen hast. Es ist ja inzwischen kühler«, fügte er hinzu und wies mit einer Kopfbewegung auf den bewölkten Himmel.
»Ja, das ist mir auch lieber.«
Während sie so gingen, nahm er ihren Arm. »Ich muss sagen, dieses Kleid kann ich nicht gutheißen. Es ist scheußlich. Mein Schneider ist unendlich viel besser.«
»Das ist wohl wahr. Dürfte ich das Jackett wiederhaben?«
»Darfst du.« Er legte es ihr um die Schultern.
Es roch nicht nach ihr, sondern nach ihm. »Das ist ja das, das du vorhin getragen hast.«
»Ich wollte das neue schonen. Die Kekse haben übrigens gut geschmeckt.«
Wind kam auf, und Grace zog sich die Ärmel über die Hände und stutzte dabei. Die Manschetten hatten jeweils nur einen Knopf, und der hatte die Gestalt einer silbernen Schwalbe. Sie sah zu ihm hoch. »Die sind schön.«
»Findest du? Ja, ich habe sie extra gekauft. Ich hatte schon immer eine Schwäche für Schwalben. Als ich ein kleiner Junge war, haben wir ihre Schwärme oft von den Burgmauern aus beobachtet. In Japan fliegen sie manchmal in riesiger Zahl und bilden dabei die absonderlichsten Formen. Da versteht man dann, weshalb die Menschen im Mittelalter so etwas für Geistererscheinungen hielten. Sie erinnern mich an meine Heimat.«
Grace zog ihre Taschenuhr hervor und zeigte ihm die Filigran-Schwalbe auf der Innenseite des Deckels. Matsumoto sprach fast nie von Japan. Er erwähnte es höchstens mal am Rande, um die Unzulänglichkeiten Englands zu verdeutlichen, aber er hatte ihr nie erzählt, wie es dort war. Sie hatte fälschlicherweise angenommen, dass er nicht daran dachte.
Er lächelte. »Darf ich?«
Sie reichte ihm die Uhr. Er drehte sie hin und her. Die Schwalbe flog aufrecht, egal, wie herum man die Uhr hielt.
»Das kommt mir irgendwie bekannt vor«, murmelte er und kniff die schwarzen Augen zusammen. »Wer ist denn der Hersteller?«
»Irgendein Italiener.«
Da wirkte er erleichtert.
VIER
London, 30. Mai 1884
Thaniel lag im Bett und sah zu, wie die Sonne allmählich seine Zimmerdecke erhellte. Er war erst eine Stunde zuvor schlafen gegangen, denn bis dahin hatte er noch geputzt: den Kamin und den Herd und das Innere der Schränke, die nun bis auf das Geschirr leer standen. Jetzt fühlte er sich, als würde er um Mitternacht aufstehen. Freitags hatte er normalerweise Nachtschicht, doch der Bürovorsteher hatte den Dienstplan so umgestellt, dass die flinkesten Telegrafisten um acht Uhr früh antraten und die langsamsten die Nacht übernahmen. Auf die Nachtschicht kam es heute nicht an; wenn der Clan-na-Gael seine Drohung wahrmachte, war das Innenministerium um Mitternacht entweder nicht mehr in Gefahr oder in Schutt und Asche gelegt. Draußen knarrte wieder der Großsegler, die Takelage quietschte von der Feuchtigkeit, und es war laut, weil Thaniel das Fenster über Nacht offen gelassen hatte. Sie besserten offenbar den Rumpf aus, denn es stank nach Teer.
Er wartete noch, bis es sieben war. Der Nebel draußen sorgte für stickige, dumpfige Luft, und er musste sich regelrecht aus dem Bett schälen.