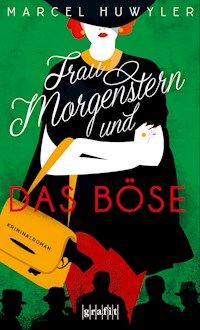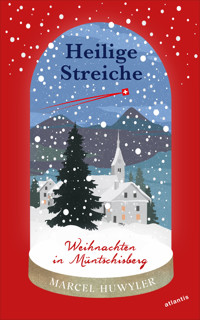Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Eliza Roth-Schild
- Sprache: Deutsch
Ihre Mandanten sind reich, mächtig, prominent - und mit allen Wassern gewaschen. Sie schätzen Eliza Roth-Schilds Geschick bei der Informationsbeschaffung (über unlautere Methoden wird freimütig hinweggesehen) und ihre Diskretion. So auch Kuno Schenk, der sich vom Sanitärinstallateur zum Selfmade-Millionär gemausert hat. Seine Tochter beabsichtigt, einen gewissen Ken Bauer zu heiraten, doch der Vater hegt Zweifel an den Absichten des Zukünftigen. In kurzer Zeit ist der Mann zu viel Geld gekommen, und obwohl seine Geschäfte inzwischen weniger gut laufen, wächst Bauers Privatvermögen weiter an. An seiner Geburtstagsparty soll Eliza den Schwiegersohn in spe intensiv durchleuchten. Nicht weniger als ein ganzes Grand Hotel am Ufer des Bodensees hat er sich selbst zu Ehren gemietet. Im Anschluss will er im kleinen Kreis auf seinem opulenten Hausboot weiterfeiern. In ihrem ersten Leben als Unternehmergattin waren Kreuzfahrtschiffe und Luxusliner Elizas zweites Zuhause, und so mischt sie sich unter die exklusive Gästeschar. Bei ihren Spionagen unterstützt wird sie von Taxifahrer Herrn Wälti, der Eliza in den dunkelsten Stunden zur Seite stand und in dem ungeahnte Talente schlummern. Denn als Chauffeur taugt er nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser, und sein analytischer Blick lässt jeden FBI-Profiler blass aussehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Huwyler
Der lila Seeteufel
Der zweite Fall für Eliza Roth-Schild
Kriminalroman
atlantis
1
Sie hatte ihn nicht kommen hören.
Er kam von hinten auf Eliza zugerannt, und als sie ihn endlich bemerkte, war es zu spät.
Ihr Pfefferspray steckte in der blauen Shopping-Bag, die zu Hause im Entree auf dem Konsolentischchen stand. Natürlich lag sie dort, schließlich trug kein Mensch beim Joggen eine ABC-Waffe in der Dose mit sich. Eliza schon gar nicht. Noch mehr Ballast an ihrem Körper – was hätte das auch für bella figura gemacht. Sie schleppte schon genug an sich selbst herum.
Die zahlreichen Cüpli-Meetings, Info-Snacks, Businesslunches sowie die opulenten Abschluss-Soupers mit hochzufriedenen, spendablen Kunden waren nicht spur- und schwerelos an ihr vorbeigegangen. Elizas berufliche Erfolge der letzten Monate wogen mehr, als ihr lieb war.
Darum die Idee, mit dem Laufen anzufangen. Nicht aus Lust am Sport, vielmehr aus Gründen der Repräsentation der Klientel gegenüber. Elizas aktueller Body-Mass-Index verzerrte das Corporate Design ihrer Einfraufirma doch etwas gar arg.
Schweren Herzens (wobei dieses sich für sie noch am leichtesten anfühlte) hatte sie sich in der Stadt Laufschuhe und -bekleidung besorgt. Und feststellen müssen, dass Sport und Mode, geschweige denn Stil, einander kategorisch ausschlossen. In Stretch und ridikülen Signalfarben glich sie einer Energydrinkdose, ohne allerdings deren Power zu besitzen.
Ein Running Gag – Eliza fand, sie verkörpere den Begriff auf ganz neue Weise.
Und dann diese Qualen. Die von der vielen Büroarbeit verhärtete Schultermuskulatur erwies sich als Elizas Achillesferse. Und die Füße zwangen sie regelmäßig in die Knie. Letztere knarzten wie die Türscharniere ihres Louis-irgendwas-Nachttischchens, einem französischen Original aus dem 19. Jahrhundert – behauptet Fabio jedenfalls. Die Damen von Stand damals hätten darin ihren pot de chambre aufbewahrt, also die kultivierte Art mobiler Sanitärkeramik, so hatte er es zumindest Eliza erklärt. Sie ging davon aus, dass der Filou die Antiquität gefälscht hatte. Allerdings echt gut – wie so viele andere seiner »Originale«.
Gleichwohl joggte sie nun tapfer jeden zweiten Morgen. Bei Tagesanbruch und mit zwei Tassen Kaffee intus, schwarz und ohne alles, zwängte sie sich in ihren Sportkokon und band sich ihr halblanges, noch naturblondes Haar zu einem Pony. Ganz wichtig war ihr, vor dem Loslaufen die Zähne zu putzen. Falls sie unterwegs buchstäblich auf der Strecke bliebe: Schlechter Atem bei einer allfälligen Mund-zu-Mund-Beatmung wäre ihr doch sehr unangenehm.
Eliza lief quer über den Park des Jagdschlösschens zum nahen Waldrand, von dort drei Kilometer den Feldweg entlang – und alles wieder zurück. Die Route besaß einen großen Vorteil: Sie lag so schön abgeschieden. Nie begegnete Eliza anderen Menschen. Hier konnte sie sich ungestört und vor allem ungesehen lächerlich machen.
Brutta figura in bella natura.
Bis heute Morgen.
Eliza befand sich auf dem Rückweg, sie hatte bereits mehrere Kilometer in den Beinen, war dementsprechend erschöpft, engbrüstig, stolprig, das Herz schlug ihr bis zum Hals – und daher leichte Beute. Weglaufen war ausgeschlossen, sie lief ja bereits.
Er glotzte sie an, tänzelte nervös und atmete schnell, kurz und geräuschvoll. Eliza verschränkte instinktiv die Arme vor der Brust und ging in Zehenspitzenposition, um ihren Kopf möglichst weit von ihrem Angreifer wegzubekommen. Er roch streng, nach feuchtem Wischmopp und Talg. Jetzt sprang er gar an ihr hoch. Und diese eklige Zunge …
Sein Name sei Buddy, er wolle »bloß spielen«, rief seine Besitzerin Eliza von Weitem zu. Die verharmlosende Entwarnung so mancher Hundebesitzer, die Attacken ihres Lieblings als köstliche Ringelreiheleien abtaten.
Das Frauchen war unversehens aus dem Dickicht des Waldes auf den Feldweg getreten und hielt jetzt zügig auf Eliza zu. Nach mehrmaligem »Buddy aus!« und »Buddy Fuß!« ließ der Hund endlich von der erlegten Joggerin ab und rannte zur Hündelerin. Sie warf ihm eine gelbe Quietschhenne aus Gummi zu und stellte ihn damit ruhig.
Eliza begutachtete angewidert ihr Sportdress. Die hellblauen Leggins mit Marmorkontrast wiesen überall Dreckpfotenspuren auf. Das Shirt war bis unter den Busen ebenfalls matschbetatscht. Und überall klebte Buddysabber.
Keine Entschuldigung, kein Bedauern, nicht das minimste Pardon. Er sei halt noch jung und ungestüm, ein »Geuggel, aber sonst ein Feiner, gell du?«, sagte die Frau, wuschelte Buddys Lefzen und hakte die Leine an seinem Halsband ein.
Eliza spürte, wie sie zitterte. Das Herz wollte platzen, und der ohnedies überhitzte Körper wurde von Feuerschüben geflutet. Ihre Furcht wich der Wut. Fluchen brächte jetzt auf jeden Fall Linderung. Doch noch bevor sie sich über ihre Wortwahl klar war, ob sie in ihre Schimpftirade »Köter«, »Töle« oder »Kläffer« einbauen wollte, kam ihr die Hundebesitzerin zuvor.
»Diese hochklassige Rasse hat das Jagen halt noch tief in den Genen.« Es klang mehr wie die Begründung einer klugen Kaufentscheidung denn eine Entschuldigung.
Eliza musterte die Hündelerin. Die Frau war um die sechzig, größer als sie und um drei Kleidergrößen schlanker. Royalblaue Wachsjacke, cognacfarbene Stiefel aus Kalbsleder, auf dem Kopf ein Humphrey Bogart aus mojavebeiger Filzwolle. Billig an der Teuersten war lediglich ihre Ausrede vom »bloß spielen wollenden Buddy«.
Die Sorte Madame kannte Eliza nur zu gut – in ihrem früheren Leben als Unternehmergattin hatte sie mit zahlreichen »besten Freundinnen« dieses Dünkelkalibers verkehrt.
Jede Wette, da parkte irgendwo in der Nähe ein großer Land Rover samt Hundebox aus Metall im Kofferraum. Und jede Wette, das Kennzeichen war drei- oder allerhöchstens vierstellig – die Fuhrpark-Allüre geldadliger Sippen. Wo Nummernschilder mit wenig Ziffern hoch im Kurs standen, wie ein Familienwappen hergezeigt und seit Generationen weitervermacht wurden, um damit Reichtum, Prestige und Konstanz in der Erbfolge zu signalisieren.
»Und wenn Ihr Hund mich gebissen hätte?« So leicht wollte Eliza die Hündelerin nicht davonkommen lassen. Zumindest etwas Abbitte musste drin sein.
»Beißen? Nicht doch, so etwas tun Smodjedas nicht«, sagte die Frau entrüstet und zog ihren Hund an der Leine näher zu sich, als ginge von Eliza hier die Gefahr aus.
»Smod… wer? Was ist das für eine Sorte?« Wenn die Kuh sich für ihr Vieh schon nicht entschuldigen mochte, dann wollte Eliza sie zumindest anständig herabsetzen.
»Smodjedas«, kam die schmallippige Antwort. »Diese Edelrasse stammt ursprünglich aus dem Hochland Kirgistans, gilt als hochintelligent und treu. Schwer zu bekommen. Buddy hier hat sogar eine kasachische Zuchtlinie. Wissen Sie überhaupt, was so ein Exemplar kostet?«
Eliza wusste es nicht und tat dies mit einem Prustegeräusch kund.
Buddys Frauchen reagierte pikiert. »Mögen Sie überhaupt Hunde?«
Eliza wiederholte das Geräusch. Wenngleich … Sie hatte da diesen Selbstheiltrick entwickelt. In Seelenschmettermomenten hatte sie sich angewöhnt, ihr umwölktes Gemüt mit dem Betrachten von Welpenfotos am Laptop wiederaufzuhellen. Aber sonst, Hundevieh im Allgemeinen und in natura … Sie zog die Augenbrauen zusammen und machte einen Lätsch.
»Dachte ich’s mir doch.« Die Hündelerin blinzelte ihre Entrüstung weg.
Eliza holte tief Luft. »Ich sage nur: Kot und Köter.«
»Bitte was?«
»Körpergewicht Ihres Hundes mal drei, geteilt durch fünfzig. Stand erst neulich in der Zeitung.«
»Ich verstehe nicht …«
»Ergibt die Menge Kacke, die Ihr Buddy täglich liegen lässt. Und in die irgendwer reintritt.«
»Ich darf doch sehr bitten.«
»Sie tragen jedenfalls keinen Gassibeutel bei sich. Demnach geschäftet Ihr Tier überall in den öffentlichen Raum.«
»Ich verbiete mir Ihren Ton. Ich gehe davon aus, dass Sie keinen Hund besitzen?«
Eliza machte ein Flötengesicht.
»Schon klar. Sie haben keine Ahnung vom Verhalten dieser Tiere.«
Eliza musste an das Markiergehabe einiger ihrer Kunden denken, Leitwölfe und Alpharüden aus dem Segment der Top-Executives. Sie grinste vor sich hin.
»Machen Sie sich gerade über mich lustig? Ich sehe das doch. Sie … Hundehasserin, Sie.«
»Hundehalterinhasserin trifft es wohl eher.«
Die Halsschlagader von Madame schwoll an, ihre Augen flipperten hin und her, sie schien sich den nächsten verbalen Konter zu überlegen, entschied sich dann aber dagegen. Mangels Zeit, Nerv oder Inspiration.
Sie spitzlippelte lediglich ein »Nicht mit mir, und schon gar nicht auf diesem Niveau.«
Damit drehte Herrin sich um und zog mit Buddy Leine.
2
Eliza duschte länger und heißer als üblich. Es galt, Ärger und Gemütsvibration von vorhin rasch loszuwerden.
Unter dem Wasserstrahl machte sie im Stehen ein paar Pilates-Übungen – Powerhouse, Helikopter und Floating Arms – und inhalierte gleichzeitig das besänftigende Odeur der Zirbelkieferseife, die sie eigens bei einer kleinen Seifenmanufaktur im Val Müstair orderte und Haut wie Seele gleichermaßen reinigte. Einen der kleinen Spleens, den Eliza sich gönnte, seit sie wieder jemand war. Und etwas besaß.
Pilates und Zirbelkiefer entfalteten ihre Wirkung, Eliza kam runter und wieder ins Lot. Nichts wäre an dem Tag geschäftsschädigender als eine Unternehmerin, die toughe Informationsbeschaffung anbot und dabei selbst einen enervierten Eindruck machte.
Der für heute Nachmittag angekündigte Kunde war wichtig. Weil reich, mächtig – und bekannt. Allseits bekannt, darum ja seine Heimlichtuerei.
Für gewöhnlich besuchte Eliza ihre Klienten für ein erstes Gespräch in deren vier Firmenwänden, zumeist in Eckbüros oder Sitzungszimmern auf der Teppichetage. Doch dieser Auftraggeber hatte darauf bestanden, sie außerhalb seines Unternehmens zu treffen. Aus Gründen der Diskretion, wie er kryptisch verlauten ließ. Keine Mitseher, keine Mitdenker, keine Mittratscher – ob sie verstehe? Sein Anliegen sei zu privat und überaus delikat. Aus denselben Gründen kam für ihn auch kein Meeting in einem Gastrobetrieb oder einer Hotellobby infrage.
Ob man sich in Ihrer Firma treffen könne?
Aber selbstverständlich, hatte Eliza ihm beschieden – die allerdings im eigentlichen Sinne gar keinen Firmensitz vorweisen konnte. Sondern lediglich ein Büro im Erdgeschoss des Jagdschlösschens, das sie mit Fabios Erlaubnis im Gelben Salon mit dem dänischen Gussofen hatte einrichten dürfen.
Noch nie hatte Eliza Kundschaft bei sich daheim empfangen. Aber sie hatte in den letzten Monaten und mit jedem neuen Auftrag lernen müssen, dass Unorthodoxes und Sonderwünsche in ihrer spinösen Dienstleistungsbranche beinahe schon Daily Business waren.
Um halb zwei Uhr wollte der Neukunde sie treffen.
Eliza hatte bei einem Eisenwarengeschäft in der Stadt ein dreißig mal zwanzig Zentimeter großes Messingschild anfertigen lassen und es mit Doppelklebeband an die Mauer rechts des Hauseingangs gepresst. Die vier mitgelieferten Schrauben warf sie in den Müll, das Firmenschild sollte lediglich den heutigen Nachmittag überstehen beziehungsweise kleben bleiben. Eine dauerhaftere Installation hätte Fabio ihr womöglich als zu breitmachend ausgelegt. Er ließ sie hier wohnen, Eliza wollte seine Gastfreundschaft nicht überstrapazieren.
Auf dem Schild war Elizas vollständiger Name eingelasert, darunter ihre Wirtschaftsspionagetätigkeit, auf Englisch, das klang akademischer und cleaner: Business Research. Mit Wolltuch und etwas Zahnpasta hatte sie das Messing auf Goldglanz gebracht.
Im Aufpolieren matter Wahrheiten war sie ja neuerdings Expertin.
Jedes Detail dem Kunden gegenüber war wichtig und entschied über Fortüne oder Misserfolg. Winzigkeiten konnten Großes bewirken. Das wusste niemand besser als Eliza Roth-Schild – mit dem klitzekleinsten Bindestrich zwischen ihren Familiennamen.
Der aktuelle Auftrag war über Veil, Spörry & Bovier hereingekommen. Die Zusammenarbeit mit der Kanzlei lief hervorragend. Seit Elizas Feuertaufe vor einem Dreivierteljahr wurden ihre Geheimdienste gut gebucht. Veil, Spörry & Bovier betreute zahlreiche Mandaten, die Elizas Fähigkeiten und Diskretion nutzten und schätzten.
Ihren erfolgreichen Geschäftsgang hatte sie primär Pierre Bovier zu verdanken. Ihm gehörte ein Drittel der Kanzlei – und Elizas ganzes Herz. Wenigstens glaubte er das. Sie war mit der Vergabe ihres liebenswertesten Organs zurückhaltender geworden, in letzter Zeit sowieso. Aber das war eine andere Baustelle.
Heute galt ihre volle Konzentration Kuno Schenk.
Im ganzen Land bekannt als »Kanal-Kuno«, ein mit allen Abwassern gewaschener Selfmade-Millionär. Und selbst ernannter »Fernsehdirektor eines Kloakensenders«, wie er gern überall herumerzählte.
Die Geschichte ging so: In den Achtzigern entdeckte der kleine Sanitärinstallateur Schenk mit seiner Dreimannbude als einer der Allerersten im Land das Kanalfernsehen. Mit auf ferngesteuerten Raupenwagen montierte Schwenkkameras konnten Abwasseranlagen und Rohrleitungen auf Zustand und Lecks überprüft werden – schneller, effizienter und präziser als je zuvor.
Schenk erkannte sofort das Potenzial dieser revolutionären Art der Kanalbewirtschaftung und investierte. Er wurde erst zum Gespött der Branche – und bald darauf die Nummer eins im Land. Die Schweiz besaß ein Abwasserleitungsnetz von hundertdreißig Millionen Metern. Und jeder Einzelne wurde von Schenks Kanalfernsehen abgefahren, kontrolliert – und berechnet. Ein Riesengeschäft. Oder wie der Patron es gegenüber Journalisten formulierte: »Ich verdiene mit Scheißefilmen Gold.«
Wegen seiner hemdsärmeligen Art, dem leutseligen Wesen und der herzerfrischend unkorrekten Sprüche war Kanal-Kuno regelmäßiger Gast in Talkshows und allemal gut für ein schlagzeilenträchtiges Bonmot im Wirtschaftsteil der Presse.
Kuno Schenk war einer der zehn reichsten Personen im Land.
Eliza hatte nicht die geringste Ahnung, was der Alte von ihr wollte.
Dieser Juli hatte bisher ausschließlich sengende Sommertage im Angebot. Auch heute lag die fiebrige Landschaft im stumpfen Licht. Bäume, Gebäude und die Luft flirrten, als wären sie zornig, und über den Landstraßen schwebten Hitzeschlieren. Es roch nach Asphalt, würzdürrem Gras und durchgebranntem Elektrozeugs.
Eliza bildete sich ein, mit sparsamen Bewegungen, flacher Atmung und innerer Coolness ihre Transpiration unterdrücken zu können. Beim Thema Schwitzhitze kam ihr stets Hardy – von ihm wird noch die Rede sein – in den Sinn, wie er einmal von einem CEO geschwärmt hatte, der über enorm viel Charisma verfügte, »weil, stell dir vor, Schatz, der Mann nie schwitzt«. Sie hielt Hardys Schlussfolgerung zwar für Schwachsinn, gleichwohl versuchte sie jetzt zu verhindern, dass ihre eigene Strahlkraft infolge Schweißbatik auf dem kornblumenblauen Leinenkleid befleckt wurde.
Drei Minuten vor der vereinbarten Meetingtime hielt ein Wagen auf dem gekiesten Vorplatz des Schlösschens – und Eliza schnappte nach Luft.
Jesses, der Wälti. Spinnt es dem jetzt total? Vor Ärger bekam sie rote Flecken an Hals und Dekolleté.
Zu Herrn Wälti hatte Eliza ein ganz besonderes Verhältnis. Der Anfangsechziger war jener Taxifahrer, der sie in den dunkelsten Stunden ihres Lebens wieder zurück auf die Spur gebracht hatte. Als ihr bankrotter Ehemann Hardy beim versuchten Versicherungsbetrug die Villa und unseligerweise sich selbst gleich mit in die Luft gesprengt hatte und Eliza vor dem buchstäblichen Nichts stand – tief gefallen, hoch verschuldet –, hatte Herr Wälti sich erbarmt, die abgebrannte Unternehmerwitwe in seinem Mercedes herumchauffiert und ihr mit seiner ritterlichen Art und ein paar pflichteifrigen Was-Oma-noch-wusste-Ratschlägen einen Ausweg aus ihrer Einbahnstraße aufgezeigt.
Eliza war dem Täxeler zu großem Dank verpflichtet. Seither buchte sie ihn regelmäßig für »Dienstfahrten«.
Als Kuno Schenk darum gebeten hatte, von Elizas Personal abgeholt und zum Firmensitz von Roth-Schild Business Research gebracht zu werden, hatte sie Herrn Wälti mit dieser Fahrt beauftragt.
»Aber ob es wohl möglich wäre, dass Sie das Taxischild vom Dach nehmen?«
»Sie möchten, dass ich wie Ihr … Privatchauffeur auftrete?«
»Ist halt ein besonderer Kunde.« Eliza hatte versucht, nicht allzu verlegen zu wirken.
»Dann erfordert die Situation auch einen besonderen Wagen, Frau Roth-Schild.«
Herr Wälti hatte ihr von seinem Hobby erzählt, seinem Oldtimer. Eine absolute Rarität, eine gepflegte Schönheit auf Originalreifen, noch immer prima in Schuss. »Ich könnte mir vorstellen, dass der Wagen Ihren Gast beeindruckt.«
Eliza hatte zugestimmt. In der Annahme, es handle sich bei besagtem Oldtimer um einen prächtigen alten Rolls-Royce, einen Bentley oder zumindest einen Cadillac, so wie Hardy ihn eine Zeit lang gefahren war. Oder wenigstens einen betagten Daimler.
Doch Herr Wälti fuhr in einer Witzkarre vor.
Oldeimer.
Ein alter Opel »Popel« Rekord in der Vatikan-Farbkombi Gold und Weiß. Elizas Kiefer verkrampften sich. Ja, waren sie hier denn auf dem Filmset von Grease?
Ihre Laune wurde nicht besser, als Herr Wälti sich aus der Fahrerkabine schwang, trug der Kerl doch eine schwarze Chauffeursmütze, dazu eine hellgraue Uniform im Kartoffelsackschnitt mit zwei aufgenähten Brusttaschen und Jackettknopfleiste vom Rundkragen bis hinunter zur Hüfte. Er sah aus wie der Lakai von Mao Zedong.
Wälti nickte ihr steifwürdig zu und eilte mit kleinen Hüpfschritten zur Hintertür, um seinem Fahrgast beim Aussteigen behilflich zu sein.
Eliza stornierte im Geiste schon mal den Auftrag.
Vor ihren Augen verpuffte gerade ein fünfstelliges Honorar. Kuno Schenk musste stinksauer sein. Verreckt lustig von Ihnen, Frau Roth-Schild, mich in so einer Teddy-Pomaden-Kiste vorzuführen. Ich bin doch nicht John Travolta!
Danke auch, Herr Wälti.
Doch Kuno Schenk strahlte wie ein Schulbub im Spielwarenladen, als er mit seiner Pranke Eliza beinahe die Hand zerquetschte und ihr für diese Überraschung dankte.
»Läck Bobby. Eine größere Freude hätten Sie einem alten Sack wie mir nicht machen können. Opel Rekord P1, Sondermodell Ascona von 1959. Gibt nur noch ganz wenige davon. Ist die Farbkombination nicht rattenscharf? Das Traumauto meiner Jugend. Woher wussten Sie …«
Eliza suchte nach dem richtigen Lächeln und schielte zu Herrn Wälti. Der hatte die Arme hinter dem Rücken verschränkt, machte ein Grabmachergesicht und schien sich über alle Maßen für den Mischforst am Ende der Parkanlage zu interessieren.
»Ach, ich Löli.« Schenk klatschte sich seine Schnitzelhand an die Stirn. »Was frage ich auch so blöd. Informationsbeschaffung ist ja Ihr Job. Da haben Sie aber grad eindrücklich bewiesen, was Sie draufhaben, heh.« Er boingte ihr die Faust gönnerhaft in den Oberarm und sagte, er müsse dringend aufs Klo.
Zehn Minuten später saßen sie in Elizas Büro – mit Boudoircharme auf einer zeitlosen Sitzgruppe von Van Belt – und besprachen den Auftrag.
Schenk trug am Gürtel doch tatsächlich eine Handy-Cliptasche aus schwarzem Leder, wie man das heutzutage nur noch bei Bauhandwerkern sah, bei Go-go-Bar-Besitzern und über neunzigjährigen Kunstgalleristen mit nikotingelben Haarwellen.
Es ging um Schenks Tochter.
Sein einziges Kind, Halbwaise seit dem elften Lebensjahr. Schenk zückte aus der Brieftasche ein Foto seiner verstorbenen Frau und reichte es Eliza. Eine bildschöne Tessinerin mit einem kastanienbraunen kinnlangen French Bob. Ihr Name war Marilena, Schenk hatte sie während seiner Rekrutenschule in Airolo kennengelernt. »Es war der Krebs …« Obwohl über zwanzig Jahre her, brüchelte ihm auch jetzt noch die Stimme, wenn er von der Liebe seines Lebens sprach. Eine neue Frau Schenk gab es nicht.
Er atmete mehrmals tief durch, um sich wieder zu fangen, und fixierte dabei die riesige Jackson-Pollock-Lithografie an der Wand gegenüber. Auf seiner Stirn bildeten sich kleine Fleischwellen. Eliza verbiss sich ein Schmunzeln. Womöglich erinnerte ihn dieses Action Painting an die Rechenbecken einer Kläranlage.
»Ja, eben, meine Kleine also«, führte Schenk nach ein paar Heiserräusperern endlich weiter aus. Sie werde demnächst fünfunddreißig und beabsichtige zu heiraten. Endlich. »Und genau darum brauche ich Ihre Hilfe, Frau Roth-Schild.«
Sie hieß Serafina.
»Ein wunderschöner Name«, sagte Eliza.
»Um ehrlich zu sein: Leider das einzig Schöne an ihr.« Schenk griff nach seiner Mappe, die am einen Sofabein anlehnte. Ein dünnes, abgegriffenes Lederteil, wie es Männerchordirigenten und pensionierte Bankangestellte von Regionalsparkassen gern benutzten. Er zog ein blaues Plastikmäppchen heraus.
»Hier. Da ist alles drin. Bitte, für Sie.«
Seite 2 des Dossiers zeigte ein Foto von Serafina. Eliza konnte sich nicht gegen den reflexartigen Nasenkräusler wehren.
»Sag ich doch.« Schenk wippte mit seiner Wampe nach vorn und massierte sich die Knie. »Der Name ist das einzig schöne an ihr. Ja, nun, die Natur scheißt uns manchmal gehörig ins Nest. Kann man nichts machen. Hauptsache, gesund, sage ich immer.«
Alles im Gesicht von Serafina Schenk war schief oder knollig. Als hätte jemand ein Puzzle mit Gewalt falsch zusammengesetzt.
»Meine Kleine wird einmal alles erben, meine ganzen Kanalkack-Millionen. Und das ist, Läck Bobby, ein Riesenhaufen.« Der ganze Schenk bebte, und aus seiner Kehle grollte ein hotzenplotziges Lachen.
Eliza war versucht, weiter im Dossier zu blättern, konzentrierte sich dann aber darauf, die Informationen aus Schenks eigenem Mund zu erfahren. Männer wie ihn ließ man besser ungestört berichten, die Informationen kamen dann um einiges ungeschönter.
»Wie lautet mein Auftrag?«, fragte Eliza.
Serafina Schenk hatte einen Mann zum Heiraten gefunden. So wie Schenk die Worte »endlich doch noch« betonte, verdeutlichte Eliza, wie verzweifelt der Herr Papa über Töchterchens Chancen auf dem Hochzeitsmarkt gewesen sein musste. »Meine Kleine ist ja nun nicht mehr die Allerjüngste. Sie wissen schon, die tickende biologische Uhr – und ich hätte halt nur zu gern ein paar Enkel.«
Eliza sollte den Bräutigam genauer unter die Lupe nehmen.
Schenk war zum einen heilfroh, seine Kleine endlich an den Mann gebracht zu haben, zum andern hegte er gewisse Zweifel über die wahren Gefühle und Absichten des Zukünftigen.
»Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Meine Serafina ist nun mal nicht gerade eine Helena. Da frage ich mich halt, in welchem Maße mein Vermögen sie aufhübscht. Weil … na ja, die beiden passen zusammen wie ein rechteckiger Gullideckel auf eine runde Kanalöffnung. Aber bitte, schauen Sie selbst.« Schenk beschied Eliza mit seinem Gallertekinn, weiter im Dossier zu blättern.
Auf Seite 3 fand sie das andere Foto.
Er war gleich alt wie die Braut, das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Er sah wahnsinnig gut aus, besaß einen auffallend muskulösen Körper, den stylishen Schmuddel-Look eines jungen Jonny Depp und hieß Benjamin Bauer. Nannte sich aber Ken.
»Wäre denn … Ben nicht logischer?«, fragte Eliza.
Schenk streckte die Arme aus, als hebe er ein unsichtbares Möbel in die Höhe. »Eine der vielen offenen Frage, die sich bei meinem Schwiegersohn in spe stellen. Ich hoffe, Frau Roth-Schild, Sie finden die noch fehlenden Antworten für mich. Ich möchte einfach genau wissen, wer der Kerl wirklich ist, ehe er meine Kleine schwängert und nach meinem Abgang von meiner Kohle lebt.«
Schenk hatte Ken Bauer bereits checken lassen. Familie, Jugend, Ausbildung, Leumund. Sogar dessen Finanzen, Bankkonten, Steuerakten, seine Krankenakte sowie ein zwar bestehendes, aber harmloses Vorstrafenregister (eine Anzeige mit einundzwanzig wegen Störung der Nachtruhe) hatte der Alte beschaffen und durchleuchten lassen. Dabei mussten seine Schnüffler unweigerlich Grenzen überschritten und Gesetze gebrochen haben. Was Eliza zufrieden zur Kenntnis nahm; Schenk würde ihr demnach bei den Ermittlungsmethoden keine Auflagen sittlicher Art machen. Schon mal gut zu wissen. Nichts widerte Eliza bei ihrer Arbeit nämlich mehr an, als Auftraggeber mit scheinheiligem Tugendwächter-Getue. Doppel-Moralisten, das hatte sie in dem Job schnell gelernt, besaßen nämlich nicht mal halb so viel Ethik.
»Der Herr Bauer scheint mir von Ihnen bereits vollständig durchleuchtet worden zu sein. Ich weiß nicht, was ich da noch …«
»Da ist etwas«, sagte Schenk. Mit einem Male war da eine kalte Schärfe in seinem Ton. »Kens Geschäfte laufen nicht sonderlich gut, sein Privatvermögen hingegen wächst und wächst. Woher, frage ich mich also, hat der Kerl das frische Geld?«
Schenk musste erneut aufs Klo. Er ummantelte seine Verlegenheit mit einem Prostatawitz, den Eliza nicht begriff.
Sie nutzte die Pause, um in der Küche ihrer La Piccola Rapid gehörig Dampf zu machen. Die edelstählerne Kaffeemaschine machte caffè. Das gleiche Gerät stand im Tino’s an der Ecke Diamantstraße und Herzogplatz, wo Eliza sich früher während kräftezehrender Boutiquentouren gestärkt hatte. Einen Teil der Erfolgsgage ihres allerersten Auftrags als Business Researcher hatte sie in diese neapolitanische macchina investiert.
»Aha, kaum kommst du wieder zu etwas Geld, kehrst du in deine alte Luxuswelt zurück«, hatte Fabio gemault.
»Guter Kaffee ist kein Luxus, sondern reine Überlebenskultur.«
»Und welche Extravaganz leistet sich Madame als Nächstes?«
Es sollte wie flapsiger Spott daherkommen, aber sie merkte sehr wohl, dass Fabio sich sorgte, sie könnte dank frischem Geld wieder ganz die alte Neureiche werden.
»Keine Angst, das ist kein Rückfall in meine Hardy-Zeit als Unternehmergattin. Früher kaufte ich teure Dinge, weil ich es konnte – und vorzeigen wollte. Erst mein Vollabsturz hat mich gelehrt, wie sinnentleert ich zwei Jahrzehnte mit Schein und Protz vergeudet habe. Ich weiß jetzt, was wirklich zählt. Pomp ist bei mir out, aber ab und zu etwas Formschönes salbt die Seele. Weißt du, Fabio, ich sage immer: Wer gar nichts genießt, wird ungenießbar.«
»Und dieser Kaffeeferrari macht dich happy?«
»Mein Lieber, ich kann mittlerweile sehr wohl unterscheiden, was bloß Ego und Angeberei dient und was mein Dasein wirklich aufwertet. Ersteres macht das Herz hart und arm, Letzteres leicht und reich. Und ja, du Meckertante, diese La Piccola Rapid gönne ich meinem Gaumen und Gemüt.«
»Ich fand meine Tasse Koffein am Morgen jahrelang auch ohne Schnickschnackautomat ganz okay.«
»Honey, du hast früher Instantkaffee getrunken.«
Schenk kam händetrockenwedelnd von der Toilette zurück, sank wieder in den Sessel und ließ die ihm gereichte Kaffeetasse in seinen Flossen verschwinden. Dazu servierte Eliza auf einer Etagere assortierte Patisserie von Gümpli. »Läck Bobby, der mit Abstand beste Confiseur der Stadt«, begeisterte sich Schenk mit vollem Munde.
Anschließend gingen sie zusammen das Dossier durch.
Benjamin »Ken« Bauer war eine kleine Programmier-Berühmtheit. Nachdem er mit sechsundzwanzig sein Wirtschaftsstudium abgebrochen hatte, entwickelte er zusammen mit zwei Freunden eine Handy-App für Mobile-Dating. Und zwar für ein ganz bestimmtes Kundensegment.
Für Hundebesitzer mit Singlestatus.
Die Software verkuppelte alleinstehende Hündeler auf Partnersuche, Herrchen fand mithilfe der App ein Frauchen. Oder umgekehrt.
Love dank Bello – weswegen die App den Namen Bellove bekam.
Ganze zweieinhalb Jahre rangierte das Handy-Programm in den Top Twenty der App-Download-Charts – und zwar weltweit. Bellove bescherte den drei Jungunternehmern ein paar Millionen.
Da Ken Bauer sich schon immer für Bodybuilding interessiert hatte und jede freie Minute im Gym Hanteln stemmte, investierte er seinen Geldregen in eine bestehende Fitnessstudio-Kette. Eineinhalb Jahre später übernahm er sie ganz, erweiterte sie auf zwölf Trainingszentren und taufte den Laden um.
In Power with Bauer.
Eliza schauderte belustigt. Kalauer mit Bauer. Branding war wohl nicht gerade Kens Stärke. Farbpsychologie im Marketing auch nicht. Der Schriftzug der Powerbauerhäuser war lila. Fand Eliza jetzt etwas gar mystisch, passte es doch eher zu einem Spirituellentempel. Kens Werbeslogan lautetet denn auch: The lila way to lose weight.
»Erstaunlich, dass sich mit so einem Firmennamen kräftig Kasse machen lässt«, sagte sie.
»Tut es eben nicht.« Schenk wippkippte seine Kaffeetasse mit einem einzigen Kopfrucker leer und leckte sich das goldbraune Cremaschnäuzchen von der Oberlippe. »Die Studios blieben von Beginn unter den Erwartungen. Man kann halt auch nicht all seinen Freunden und jedem C-Promi Gratismitgliedschaften gewähren, so was weiß doch jeder halbwegs schlaue Geschäftsmann.« Er machte ein Geräusch wie ein knurrender Hund. »Ken verlor mehr und mehr Geld. Bis er dann vor etwa einem Jahr auf eine neue Goldgrube gestoßen sein muss. Sein Privatkonto schwillt seither stetig an, und das nicht zu knapp. Nur weiß niemand, woher der Geldregen stammt.«
»Sie glauben, er …«