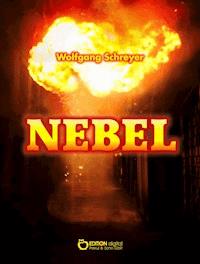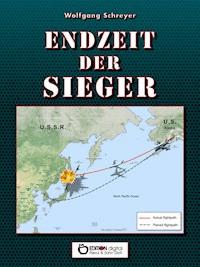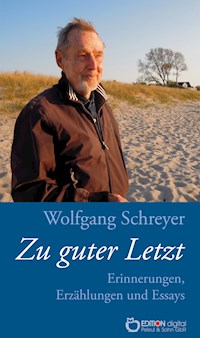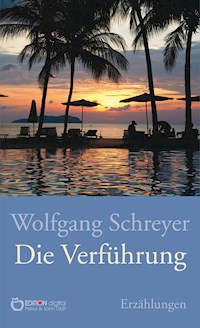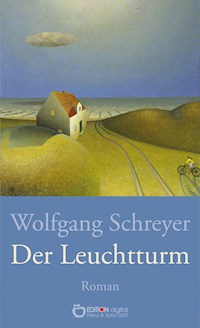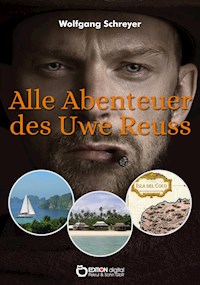8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die erfolgreiche BRD-Journalistin Judy wird 1983 in das Grenzgebiet zwischen Honduras und El Salvador geschickt, um weiße Flecken auf der Landkarte (der Grenzverlauf ist nicht exakt festgelegt und in diesem Gebiet halten sich Guerilla-Kämpfer beider Länder auf) zu untersuchen. Sie erfüllt ihren Auftrag, doch ihr sympathischer junger Reisebegleiter und Dolmetscher ist tot. Judy kann das nicht verkraften und fällt in ein tiefes Loch. Ihr Chef schickt sie, sozusagen zur Ablenkung und Erholung, nach Grenada. Ihren Auftrag, dort nach einem kubanischen bzw. sowjetischen Militärflugplatz und U-Boot-Hafen zu suchen, erfüllt sie schnell. Sie besteht darauf, ihren Jahresurlaub in Grenada dranzuhängen; denn sie hat sich Hals über Kopf verliebt. Sie zieht in sein Haus, herrlich einsam auf einem Hügel direkt am Meer gelegen. Von der Terrasse des Hauses sieht sie die amerikanischen Kriegsschiffe, die sich Grenada nähern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der Mann auf den Klippen
Roman
ISBN 978-3-86394-111-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1987 bei VEB Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2011 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com
Für Hannes Bahrmann und Christoph Links
Der Autor folgte bei seiner Darstellung den zeitgeschichtlichen Tatsachen, soweit sie ihm bekannt geworden sind und in dem Roman berührt werden können, beansprucht als Erzähler aber für sich das Recht, sie aus eigener Sicht – oder der seiner Figuren – zu deuten.
August
I
All der Reiserei müde, verbrachte ich meinen Urlaub diesmal fast vor den Toren der Stadt an jenem Strand, an dem meine früheste Erinnerung hängt. Damals, gegen Ende des Krieges, war ich drei oder vier gewesen, und vom verbrannten Hamburg aus kam man in quälender Bahnfahrt an den Rand der Halbinsel Eiderstedt, wenn man in Husum umstieg in eine Kleinbahn, die einen anfangs rückwärts fuhr. Die Station hieß St. Peter-Ording... Nun trug es mich weich über die Bundesstraßen 5 und 202 in gut zwei Stunden hin, ein Katzensprung an die Quellen der Kindheit.
Am Tage der Abfahrt, vor Dirks Bücherschrank – er behielt ja sein Zimmer, obwohl ich ihn kaum noch sah, seit er in Westberlin studierte –, fiel mir zwischen seinen Kunstbänden in Chateaubriands Memoiren ein Lesezeichen auf, wildledern und kupferfarben wie mein Rock. So stieß ich auf den Passus: "Eines demütigt mich: das Gedächtnis ist oft ein Zeichen von Dummheit, es ist schwerfälligen Geistern eigen, die durch das Gepäck, mit dem es sie belastet, noch träger werden. Dennoch, was wären wir ohne Gedächtnis? Wir vergäßen unsere Freundschaften, unsere Geliebten, unsere Vergnügen, unsere Geschäfte; das Genie könnte seine Gedanken nicht mehr sammeln; das liebevollste Herz verlöre seine Anhänglichkeit, wenn es sich nicht mehr erinnern könnte; unser Dasein würde sich auf die einzelnen Momente einer unablässig abrollenden Gegenwart beschränken; es gäbe keine Vergangenheit mehr, welch ein Unglück! Unser Leben ist so eitel, dass es nur der Widerschein unseres Gedächtnisses ist..."
Ich schob das Buch zurück. Ach, das Edle und Vage, die Eleganz und Banalität französischer Prosa! Das Gedächtnis ein Zeichen von Dummheit, nur leider unentbehrlich. Ohne es keine Freundschaften, keine Geliebten (wo sind die geblieben?) und kein Vergnügen, selbst die Geschäfte vergäßen wir (wohl kaum, dafür war gesorgt). Das liebevollste Herz verlöre seine Anhänglichkeit – nun, Dirk hatte die auch ohne Gedächtnisschwund verloren. Es war bloß der Erguss einer schönen Seele.
Das Seebad war mir fremd. Dies sollte der zauberhafte Ort meiner Kindheit gewesen sein? Ich hatte erwartet, ihn geschrumpft zu finden, doch er erschien mir gebläht. Der Sandweg, über den man die Koffer im Handwagen vom Bahnhof zu den reetgedeckten Katen zog, wo war der hin? Es gab sie noch, diese freundlichen Häuser – tief geduckt, überragt von klinkerverblendeten Bettenburgen. Blitzend glatt oder porös und brutal eiferte das Dorf mondäneren Bädern nach. Später erst, auf dem Außendeich, südwärts im warmen Seewind, kam ein Hauch von Erinnerung. Es war Ebbe und Essenszeit, der Wind pfiff in Böen über den Priel, über den graugelb gekräuselten Grund des Wattenmeers, über die grünen Marschen, die silbrig zitternden Pappeln und den Dünensand, aus dem er kleine Wirbel riss. Es war wie im Kino, wenn ein Aktionsfilm anfängt: der weite, noch unbestimmbare Strand, an dem gleich jemand landet oder im Wellensaum eine Leiche rollt... Aber hier fing nichts an, am wenigsten ein Abenteuer. Ich suchte keines, grub nur ein bisschen nach Spuren der Vergangenheit, um mich auszuruhen vom irren Alltag, der Hetzjagd draußen oder in der Redaktion.
Ja, der Salz- und Jodgeruch, stark wirkende Medizin, die Farben des Meeres und des Himmels erkannte ich wieder; den Flug der Seemöven, die mit reglosen Schwingen jäh wegkippten und entglitten; auch die Sandbank hinter dem Priel, nun genutzt von Strandseglern, deren dreirädrige Flitzer durch die Pfützen des Wattenmeers zischten. Das Unermessliche, die traurige Schönheit der Natur. Ziehende Wolkenschatten, ganz fern die geflochtenen Strandkörbe von einst und ein paar Menschen in der Einsamkeit. Damals hatte ich, nahte die Flut, im waschbrettartig gerippten Watt Wälle geschippt, eine Festung, jedes Mal vom vordringenden Wasser umzingelt und Stück für Stück erobert, bis sie Meeresgrund war. Meine Mutter fand, ich spiele wie ein Junge. Angriffslust defensiv getarnt, während Mutter von der Vorkriegszeit sprach, vierzig Pfennig habe die Tafel guter Schokolade gekostet – ich schrieb eine 4 spitzgieblig in den Sand, wusste nämlich, dies war mein Alter –, und auf Helgoland, fuhr sie fort, wohin allwöchentlich von Tönning ein Motorsegler fuhr, sei die Tafel noch viel billiger gewesen! Man habe sie nur leicht geknickt, nicht mehr Handelsware, durch den Zoll bringen müssen.
In der ersten Augustwoche schlug das Wetter um. Der Jahrhundertsommer, so nannte man ihn dann, schob eine Pause ein. Ich lief im Trenchcoat umher, den Schirm stülpte es einem um, die Scheiben beschlugen, das Bett wurde klamm, die krummen Bäume trieften im Wind. Und im glänzenden Holz des Hotelrestaurants begannen Familien zu streiten. Der junge Mann vom Nebentisch pirschte sich an mich heran. Wiederholt stand er auf, ein zuckendes Flämmchen in der Hand, wenn er sah, dass ich rauchen wollte. Ein weißer Porsche gehörte ihm. Er schlug mir einen Trip nach Sylt vor. "Was fängt man hier schon bei Regen an?"
"Was fängt man dort an?"
"Oh, da wüsste ich einiges."
"Ich hab nicht vor, etwas anzufangen."
Wohlerzogen wich er zurück. Ich schätzte ihn auf Anfang dreißig. Er gab mir das Gefühl, auch für junge Männer noch zu zählen, bei soviel taufrischer Konkurrenz, doch seine Nachbarschaft war lästig. Der sanfte Blick, die Hundeaugen, das Aufspringen, all dies nahm kein Ende. Ich verkniff mir die Zigarette – seine Anbetung aber blieb. Er sah aus, als wisse er wenig mit sich zu beginnen. Abends trug er zum marineblauen Clubjackett hellgraue Hosen, weiße Socken, Druckknopfhemden und schmale Querbinder. Die kecke Fliege, einem zweiblättrigen Propeller gleich, unterstrich sein derbes Kinn, das ein Grübchen hatte. Außer zu flirten und sich umzuziehen fiel ihm nichts ein; ein gepflegter Esel also.
Einmal, an der Bar, bestieg er den Nachbarhocker und bat, mich zu einem Glas Sekt, oder was immer ich möge, einladen zu dürfen. Es misslang ihm zu verbergen, dass er selber sich schon gestärkt hatte, vielleicht für ebendiesen Schritt. "Na gut", sagte ich. "Hoffentlich ist Ihnen klar, ich könnte Ihre Mutter sein."
Er zupfte an seiner dynamischen Fliege. "Sehr übertrieben, Frau Janssen! Ein Abiturient bin ich auch nicht mehr."
"Sie kennen meinen Namen, haben sich erkundigt?"
"Das ist nicht nötig gewesen, gnädige Frau. Wer kennt denn Judy Janssen nicht?"
Die Schmeichelei, aufs Berufliche zielend, tat mir wohl. Offenbar sagte ihm sein Gespür, wie mir beizukommen war. "Wollen wir tanzen?", fragte er beim zweiten Glas. "Sie sind doch nicht schon zu müde?"
"Ich würde es werden. Was langweilt, macht auch müde."
"Ist es wenigstens erlaubt, Ihre Arbeit zu erwähnen?"
"Erlaubt ist immer, was gelingt."
"Ihnen gelingt einfach alles. Die Reportagen aus Tripolis und Teheran zum Beispiel – eine Wucht. Das Interview, das ein so schwieriger Mann wie Chomeini Ihnen gab, als der bisher einzigen Frau..."
"Sind Sie denn aus der Branche?"
Er senkte den Kopf wie ertappt. "Freischaffend."
"Kein Grund, sich zu schämen."
"Tue ich auch nicht. Bei mir ist das so: Es muss immer was passieren; action is satisfaction."
"Sehr männlich, Ihr Wahlspruch."
Er lächelte etwas starr, maskenhaft, so als prüfe er, was da bei mir überwog – Ironie oder doch Respekt. Mein Gott, action is satisfaction, Handeln bringt Zufriedenheit, es war die närrischste Unterhaltung, die ich je geführt hatte. Bestimmt hielt er mehr solcher Worte bereit, etwa dass er island-hopping-holiday und out-door-life liebe. Doch es kam nicht mehr dazu. Handeln bringt Zufriedenheit, dies war das einzige, das mir von ihm blieb.
Meine Sicht der Dinge, fuhr er fort, sei ihm Vorbild; er schreibe für das "Geo"- Magazin. Leider spare man dort in letzter Zeit, schicke eher die angestellten Mitarbeiter hinaus, auch auf Kosten der Qualität. Nirgends habe man's mehr leicht ohne festen Job.
"Und nun denken Sie, wenn wir hier nett beisammen sind, könnte ich Ihnen behilflich sein?"
Er hielt sich an der Chromstange fest, als tue sich der Boden auf, um ihn zu verschlingen. Zu meiner Verblüffung gestand er alles – jedenfalls den heimlichen Wunsch, unter meine Fittiche zu schlüpfen... "Aber ich hab's wohl ganz falsch gemacht ", schloss er mit sanftem Hundeblick.
"Es fällt schwer, Ihnen zu widersprechen."
Nicht mal seine Zerknirschung war echt. Ich zahlte für mich und ging hinauf. Auf dem Nachttisch lag Reiselektüre, ein Thriller des Autorenpaars Boileau-Narcejac, voll von Sätzen wie: "Ich litt auch körperlich, alles tat mir weh. Vielleicht muss jedes Glück solch einen Beigeschmack von Trauer haben. All dies zerreißt mir das Herz, nun, da es vorbei ist. Und es war mir physisch unmöglich, von hier wegzugehen."
Nun, mir nicht. Ich hatte genug; der Urlaub war mir verleidet. Am nächsten Tag fuhr ich ab, in strömendem Regen.
Die Wohnungstür klemmte vor einem Berg von Werbung und Post. Kein Brief von Dirk, nicht mal eine Ansichtskarte aus Griechenland, wohin er hatte trampen wollen. Doch vom Tonband des automatischen Anrufbeantworters wenigstens seine Stimme, wie immer klang sie unreif, bestürzend schutzlos. "Hallo Judy", hörte ich ihn forsch sagen. "Weißt du, ich wandere aus, für ein paar Monate nach Nicaragua, mit ein paar Typen aus der Gruppe. Auf der Suche nach Sinn, nach was Echtem und so. Gib Laut, wenn du zufällig in der Nähe bist! Mich zu finden war ja nie ein Problem für dich. Wir helfen drüben bei der Ernte, war das kein Stoff für dein Blatt? Du, das Land hat ehrliche Berichte nötig... Tschüss, dein verlorener Sohn."
Dem Datum nach war er längst weg, schmiss einfach das Studium hin! Welche Ernte überhaupt? Zuckerrohr schnitt man im Winter, was gab's da noch, Kaffee, Bananen? Es war schon ein Kreuz mit ihm.
Der letzte gespeicherte Anruf war von geschäftlicher Glätte. Dr. Holger Baron, rechte Hand des Leiters der Auslandsabteilung, bat mich, sollte ich des Wetters wegen schon vor Ablauf meines Urlaubs verfügbar sein, mit einfühlsamen Worten in die Redaktion. Er verstand es, stets den Eindruck zu erwecken, es erwarte einen höchst Bedeutsames, eine glanz- und ehrenvolle Mission. Auch wenn es dann bloß ein Flug in das zerstörte Beirut, das orthodox-islamische Teheran oder in ein charmant verwildertes Villenviertel von Poona war, dem Märchenort des großen Gurus und Nabel der Befreiung in hysterischer Ekstase.
II
"Fein, Sie schon zu sehen", sagte Strathmann, der Mensch mit dem Nussknackerkopf, Haupt der Auslandsabteilung meines Magazins, von unerschütterlicher Vitalität, die er in sein immenses Tageswerk steckte. "Gleich wieder am Ball, recht so, Judy." Er sprach jeden mit dem Vornamen an, während er selber Gunar Strathmann blieb, das Leitbild, der große alte Mann, ein Denkmal des deutschen Journalismus. Ich setzte mich unter seinem gütigen Blick. Zwecklos, sich gegen ihn zu wehren. Man sollte ihn lieben, ihm folgen, nicht aber kritischen Abstand wahren.
"Es geht um höchst Diffiziles", sagte Dr. Baron auf die bekannte geheimnisvolle Art. Er hatte empfindsame, lang bewimperte Augen – ein Softy, der in seiner leisen Müdigkeit auf mich stets dekadent wirkte, so zart besaitet und hübsch, dass er auf dem Satinpolster eines Etuis hätte ruhen können. "Wenn wir's überhaupt jemandem zutrauen, da Licht hineinzubringen, dann Ihnen."
"Sehr spannend. Ich höre."
Aber sie schwiegen, als wüssten sie nicht, wie es mir zu erklären sei und wer von ihnen das tun sollte. Strathmann zeigte sein informiertes Lächeln, ließ mich in Wohlwollen baden, einer fast somnambulen Leutseligkeit, während seine Hände grob und behaart auf dem Schreibtisch lagen, zwischen dem goldenen Druckstift und der grünledernen Garnitur mit dem Tagesplan.
"Ein Grenzkonflikt in Übersee." Behutsam ergriff Holger Baron das Wort. "Weiße Flecke auf der Landkarte, zwischen Honduras und El Salvador."
"Was soll uns das? So was ist doch ganz alltäglich."
"Manchmal wird aus solchem Streit ein scheußlicher Krieg, wie zwischen dem Irak und dem Iran."
"In El Salvador ist schon Krieg, Bürgerkrieg."
"Das eben macht es so brisant." Strathmanns Hände begannen zu wandern; sparsam und schonend, mit ordnungsliebender Vorsicht, bewegten sie sich zwischen seinem Eigentum. "Vor genau vierzehn Jahren, Sie erinnern sich gewiss, gab es dort den sogenannten Fußballkrieg. Ein Spiel für die Weltmeisterschaft artete aus zu Krawallen, Mord und Totschlag. Und El Salvadors Armee, der von Honduras überlegen, stieß vor."
"Angeblich zum Schutz der dreihunderttausend Gastarbeiter auf den Plantagen des Nachbarn", flocht Dr. Baron ein. "Ein blutiges Kapitel: dreitausend Tote in hundert Stunden, dann Waffenstillstand entlang einer nordwärts verschobenen Linie bei formellem Kriegszustand, zwölf Jahre lang! Erst im vorletzten Sommer kam unter Washingtons Druck ein Friedensvertrag zustande, sehen Sie..." Sein Bericht wurde dunkel. Er schnipste mit den Fingern, suchte nach Namen, Daten, Umschreibungen. Man merkte ihm an, dass er Wörter wie Blut oder Krieg (selbst Fußballkrieg) nur ungern in den Mund nahm. Als Ästhet verabscheute er Gewalt in jeder Form. Vielleicht beirrte ihn auch der Umstand, dass sein Chef dabei war, einen so abseitigen Fall aufzuwärmen.
Ich fragte: "Passt das nicht besser in die Zeitschrift 'Damals'?"
"Warten Sie ab, Judy, das sind keine ollen Kamellen", sagte Strathmann autoritär und dennoch so behaglich, als sei ein knackendes Kaminfeuer hinter ihm entfacht worden. "Dieser Friedensvertrag schrieb nämlich die Grenze gar nicht fest. Um die wird seit hundert Jahren gefeilscht. Der Vertrag sah nur vor, dass die strittigen Gebiete einstweilen beim Sieger von 1969 verbleiben; er gibt aber El Salvador nicht das Recht, dort oben Soldaten zu stationieren."
"Und dieses Vakuum zog die Rebellen magnetisch an", fuhr Holger Baron fort. Er hatte schöne weiße Zähne; man sah, dass er einen teuren Zahnarzt hatte. "Die entmilitarisierten Zonen in den Bergen boten ihnen ja den idealen Unterschlupf!" Es klang, als sei er persönlich betroffen von der Hinterlist der Guerrilleros. "Das ist deren Basis geworden."
Er war sehr wandlungsfähig. Und stets kam er mit moralischer Bugwelle daher, ganz gleich auf welchem Kurs. Es passte zum Bild der Wende, die gegen erheblichen Widerstand allmählich im Hause durchgesetzt wurde, von einer fernen Befreiungsfront abzurücken und lieber auf das Herkömmliche zu bauen, auf Solideres, Bürgertugenden wie Ruhe und Ordnung. Vielleicht empfand Baron sein Einschwenken als schmählich und überspielte das Unbehagen, indem er eine Oktave zu hoch griff. Denn obwohl ihm keiner widersprach, fügte er hinzu: "Das geht auch uns etwas an. Wer heute zum Beispiel in Westberlin ein Taxi besteigt, dem kann es wie mir passieren, dass er wider Willen in obskure Waffengeschäfte verstrickt wird. Stellen Sie sich vor, ich sitze in einem Wagen der 'Ikarus Taxi GmbH' und hab plötzlich vor mir an der Lehne ein Schild mit dem Text: 'Die Gesamteinnahme dieser Schicht wird gespendet für Arbeitsbrigaden in Nicaragua und/oder Waffen für El Salvador'!"
"Ich fühle mit Ihnen", sagte ich. "Man hat Sie gezwungen, die Terrorszene dort zu finanzieren."
"Sie müssen da gar nicht ironisch sein."
"Zur Sache." Strathmann klopfte auf den Tisch. "Die Armee El Salvadors hat das auf die Dauer nicht hingenommen. Gelegentlich ist sie schon mal in diese Zonen eingedrungen. Daraus leitet nun wiederum Honduras das Recht ab, bis zu seiner alten Grenze vorzurücken. Judy, können Sie mir folgen?"
"Ich denke schon. Mir scheint, aus dem Grenzstreit ist ein Komplott beider Staaten zur Bekämpfung des Aufstands geworden."
"Immer langsam; wir wollen nicht spekulieren. Fliegen Sie hin, ohne Vorurteil, und finden Sie's heraus."
"Das dürfte kaum gelingen. Es sind Kampfzonen, da kommt doch kein Mensch hin."
"Müssen Sie's denn?" Dr. Baron neigte sich mir zu. "Sie wissen ja, wie man wichtigen Leuten auch fern vom Schuss die Wahrheit entlockt."
"In solch einem Krieg bleibt die Wahrheit als erstes auf der Strecke."
"Aber, aber! Wer hat denn Idi Amin blamiert und den Guru von Poona entlarvt? Wer hat den Präsidenten Mobuto gefragt, ob er an Gott glaube oder meine, selbst Gott gleich zu sein?" Baron ließ sich nicht stoppen, er reihte die Sternstunden meiner Laufbahn auf zu einer Perlenschnur lächelnder Beredsamkeit. "Ihr erfrischender Mut vor den Mächtigen ist bei uns Legende. Wem glücken stets die schmerzhaftesten Fragen? Niemand anderem als Ihnen."
Ich fühlte mich eingekreist. Barons Zähne blinken von Speichel und Schmeichelei; wieder einmal fand ich die schimmernden Eigenschaften eines Satans in ihm vereint (um im Stil des Blattes zu bleiben). Was wollte er wirklich, sollte ich etwa drüben scheitern? War er scharf auf meinen Job? Lehnte ich ab, flog er am Ende selbst, um mit einer Story heimzukommen und sich als künftiger Chefreporter zu empfehlen. Oder wartete im Hintergrund ein kleiner Protegé? Man schrieb ihm eine Schwäche für junge Männer zu.
"Gut; aber in zehn Tagen ist da nichts zu holen. Drei Wochen müssten es wohl sein."
Strathmann sagte: "Das ist uns die Sache wert."
"Wir geben Ihnen Klaus Ziesel mit." Die Luft war raus, Holger Baron gähnte kaum merklich, als ob er keinem Zwang mehr unterliege und nur noch aus guter Familie war. "Mit dem haben Sie ja bereits in Kampala und anderswo gearbeitet. Dessen Fotos sind glänzend auf Ihre Texte abgestimmt."
"Viel Glück", schloss Strathmann, ganz der alte Herr, schlau und eingeweiht, rosig vom Bluthochdruck und beginnender Verkalkung. "Wir drücken Ihnen beide Daumen, Judy." Die Sache war abgehakt, sein Nussknackermund klappte zu.
"Exakt gesagt, alle vier", fügte sein Assistent hinzu.
Mit solchen Sprüchen entließen sie mich.
Auf dem Heimweg begriff ich, es war soweit. Der Geist der Wende griff nach meiner Arbeit. Hätten sie mich früher losgeschickt, dann eher zu einem Bericht über deutsche Entwicklungshelfer in Mittelamerika. Einer von denen schien Dirk zu sein, solch eine Reportage erhoffte er von mir. Aber unsere Wünsche spielten keine Rolle. Unter dem Blick des neuen Chefredakteurs kroch man nach rechts oder verschwand vom Fenster. Wo blieb das liberale Gewissen? Auf der Strecke. Meine Unerschrockenheit gegenüber den Mächtigen galt nur fürs Ausland. Den Ajatollah am Bart zu zupfen war lobenswert, sich hausinternen Weisungen zu entziehen glatt unmöglich. Dabei sein, am Ball bleiben, das galt einem inzwischen als die ganze Kunst.
Zu Hause stieß ich auf Dirks letzten Brief. Zwei Jahre war der alt, da stand Dirk im zweiten Semester, seither war unser Austausch zu Kartengrüßen oder dem üblichen Anruf geschrumpft, wenn er klamm war oder wenn ich etwas für sein Blatt "radikal" spenden sollte, das ihn völlig in Anspruch nahm: "Zeitung für die Jagd aus Leidenschaft ", wie es im Untertitel hieß. Eine alternative Monatsschrift, sie erschien nur in fünftausend Exemplaren und hatte statt des I-Punkts in der Wortmitte frech den roten Stern.
"All Deine Erfolge, die großen Reportagen, bedrücken mich auch", hatte er damals geschrieben. "Es klingt mächtig undankbar, Judy, aber der fast literarische Reiz dieser Texte vertieft mein Gefühl, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Auf jeder Seite spürt man die Grenzen Deiner Darstellung. Enthüllungen allein bringen die Welt doch nicht voran, selbst wenn sie reinigend wirken können. Du entwickelst einfach keine Gegenposition zu den Haltungen und Zuständen, die Du so clever hinterfragst. Bei Dir erscheint das Leben als Kampf aller gegen alle, geht es um Eitelkeit, Besitzgier und Macht, will man erobern, bewältigen, was erreichen oder auch bloß überleben... Gedanken um historische Etappen, um die Frage, wie die Menschheit herauskommt aus der Misere – nämlich durch Umwälzungen, durch soziale und nationale Befreiung –, bleiben immer aus! Statt in der Geschichte die Glut zu suchen, siebst Du die Asche."
Na schön, womöglich hatte er recht. Aber brach ich jetzt nicht auf, um in der Glut zu stochern? Und zwar mit soviel deutscher Gründlichkeit, dass ich mich vielleicht dabei verbrannte. Jedenfalls würde ich in seiner Nähe sein. San Salvador war von Managua wohl nicht mal so weit entfernt wie Hamburg von Köln.
III
Immer war ich auf die Reise gegangen, von einem Thema ins nächste gestürzt; ich lebte, indem ich unterwegs war... Im Transitraum von Frankfurt a. M. stieß Klaus Ziesel zu mir, er schwenkte sein Handgepäck mit den drei Kameras. Hatte ich das nicht schon früher erlebt? Da wiederholte sich eine Szene von Paris-Orly oder dem Kennedy-Airport, Flughäfen ähneln einander fatal.
Im Pfeifen der Triebwerke dämpften wir das Reisefieber, das uns noch immer ergriff, er mit einem großen Bier, ich mit dem italienischen Kräutersaft Campari. Ziesel war Ende dreißig, ein dünner Mann, recht witzig unterwegs. Ein Mann ohne Durchblick und Schliff, der wenig auf sein Äußeres gab. Er hatte eine seltsam geformte Nase, sie ließ an die Rückenflosse eines Raubfisches denken. Ihr allein folgte er, wenn er, wie jetzt mit mir, auf ein Schlachtfeld flog – ins war theatre, wie es auf Englisch heißt. Meisterlich hielt er Kriegsszenen im Bilde fest, stets neu empört über sinnloses Leiden, ohne die tieferen Ursachen zu sehen: zuständig nur für die Hochglanzfotos zum Text.
"Nicht drängeln", sagte er an der Gangway zu mir, "wir kommen noch früh genug in den Himmel." Das ewige Kind in ihm sehnte sich nach einer gewaltfreien Gesellschaft, ohne Profitsucht und Militär; bisher hatte er die bloß nirgends entdeckt. Ihm schwebte wohl ein Zusammenschluss von Schrebergärtnern und Kleingewerbetreibenden vor, die Schafe hielten, in Bächen ihr Selbstgestricktes wuschen und einander rostige Sensen ausliehen. Dass sein Traum ein Leben in Armut bedeutete, störte ihn nicht, solange es noch Whisky gab. Den bestellte er sich, kaum dass wir abgehoben hatten und die Leuchtschrift (angurten, nicht rauchen) vorn erloschen war.
Von dem Drink beflügelt, stieg er auf zur Hochform seiner Beredsamkeit. Wiederum erfuhr ich: Klaus Ziesel sah das Schlechte im Menschen, glaubte aber an dessen innere Erneuerung. Anspruchslos mussten wir werden, duldsam und dankbar, uns selber läutern, bevor wir versuchten, die Außenwelt zu verändern. (Die Folgen von Poona! Den Bhagwam Shree Rajneesh hatte er im Rolls Royce entlarvend abgelichtet, doch dessen Lehren oder auch die Sexorgien hatten ihn nachhaltig umnebelt.) Dass allenfalls ein Wandel der Zustände Menschen bessern konnte, leuchtete ihm keineswegs ein. Er nahm sogar an, moralische Mahnrufe könnten Herrschende dazu bewegen, ihre Machtstellung zu schwächen. Seine Fotos rührten an das Gewissen der Welt, dass der Appell ins Leere ging, schmerzte ihn, doch ganz mochte er's nicht glauben. Irgendwann würde die Saat, in feinkörnigen Film gesenkt, schon mal sprießen und blühen, es brauchte nur etwas Geduld.
Der Flug nach Mexico-Stadt über New York dauerte reichlich vierzehn Stunden, genug Zeit, sich an Ziesel zu reiben. Doch erst mal legte er sich mit der Stewardess an. "Hei Honey", rief er, als sie ihm das zweite Glas gab, "wo bleibt mein Lächeln?"
"Wissen Sie was", sagte das Mädchen am zentnerschweren Servierwagen, "Sie lächeln zuerst, dann lächle ich zurück, okay?"
Bereitwillig strahlte Ziesel sie an.
"Sehr gut! Und nun lächeln Sie bis México weiter so."
"Verdammt, die hat ja recht", brummte er. "Man muss es wirklich mal von ihrer Seite sehen."
Ich ließ ihm Zeit, diese Erkenntnis zu vertiefen, und zog mein Material hervor. Obenauf lag eine Touristenkarte El Salvadors, präsentiert von der Ölfirma Esso in den sechziger Jahren. An der Grenze zu Honduras liefen die Worte frontera indefinida entlang: Grenze unbestimmt. Diese Grenzlinie, so hatte Dr. Baron auf einem angehefteten Blatt vermerkt, war im Jahre 1884 zwischen den beiden Ländern provisorisch vereinbart worden. In El Salvadors Nordostprovinz Morazán folgte sie dem Lauf des Río Negro. Aber die offizielle Karte des Landes von 1978 wies auch einen rund hundert Quadratkilometer großen Streifen nördlich des Flusses als salvadorianisches Staatsgebiet aus! Dies also schien einer der weißen Flecke zu sein. Er war tatsächlich weiß, fast ohne Eintragungen, selbst die Schraffur der Gebirgszüge fehlte, als hätte es den Kartenzeichnern der Regierung an topographischen Daten, an jedweden Unterlagen gemangelt. Dafür hatten sie área sin fotografiar dort eingetragen, und ich fragte mich, ob dies bedeute, dass ihnen für diese Fläche keine Luftbilder zur Verfügung standen, oder ob es ein Fotografierverbot für Reisende war. Die Straßenkarte von Esso gab mir gleichfalls Rätsel auf. Rechts oben in der Ecke wies ein stilisierter Tankwart lustig auf den Spruch: Maneje con cuidado, la vida que Ud. salve puede ser la suya. In meinem armen Verständnis des Spanischen hieß das etwa: Sorgsam behandeln, es kann Ihr Leben retten.
"Hör mal", sagte Ziesel mitten über dem Atlantik, "was ist das für ein Kram, den du da liest, anstatt ein bisschen nett zu mir zu sein?"
"Das Übliche. Finger weg, du bringst mir's durcheinander."
"Wetten, dein Text ist fertig, ehe wir landen."
"Du glaubst, ich schreibe das bloß ab?"
"Du zerlegst das und klebst es neu zusammen. So macht ihr's doch, Judy. Täte ich auch so, geht nur nicht bei Fotos."
"Die kann man kaufen. Horrorbilder aus Amerikas Hinterhof, so was bieten die Agenturen an wie saures Bier."
"Und weshalb sitzen wir hier? Was ist unsere Mission?"
"Herauszufinden, was dort gespielt wird im Grenzgebiet."
"Dein Spürsinn ist eben legendär. Wir zwei sind Spitze, meinst du nicht?"
"Ich rede es mir jedenfalls ein. Woher sonst den Mut nehmen? Es wird soviel geschrieben."
"Die Größten in der Branche... Bist ein prima Kumpel, Judy."
"Trink nicht soviel und sei noch ein bisschen still."
Er nahm die Hand von der Armstütze und widmete sich wieder seinem Glas. Von Zeit zu Zeit musste man ihn aufmuntern. Ein Pressefotograf zu sein war viel, zumal an einem Blatt, bei dem jahrelang zunächst nach den Bildern zur Geschichte und dann erst nach dieser gefragt worden war. Doch überall, wo gedruckt wird – auch dort, wo man Bilder zu wichtig nimmt –, setzt sich schließlich die Feder durch, hat der Vorrang, der schreiben kann. Ziesel gab das Beiwerk, man bezahlte ihn gut, aber er war kein Schreiber, blieb die Nummer zwei im Team... Der Jumbo stieg durch eine Wolkenbank in Richtung der Neuen Welt ab, die Klarsichtmappe mit den Unterlagen aus dem Redaktionsarchiv zitterte mir auf den Knien. Nach einer Weile tauchte draußen aus dem Dunst die Skyline von Manhattan auf. Es quietschte wie üblich, das Flugzeug setzte auf.
Leicht taumelnd kam Ziesel auf der falschen Seite, nämlich durch den Backbordgang, von der Toilette zurück, vorbei an der händeringenden Stewardess. Nun erst fiel mir auf, dass er zu kakaobraunen Gabardinehosen ein graugrünes Jackett im Fischgrätenmuster trug. Zusammen mit seinem Polohemd entsprach das – meine Mutter hatte dies einst in St. Peter erwähnt, es haftete in mir so zäh wie nur Nebensächliches – ungefähr der Sommermode von 1938. Für die Tropen war es ganz bestimmt zu schwer.
"Hast du's durch?" Er zwängte sich neben mich, um verspätet den Gurt anzulegen. "Bist du jetzt schlauer?"
"Es ist sehr verzwickt, fast ein Dissertationsstoff für Völkerrechtler." Meine Stimme bebte unter den Stößen der Landebahn. "Immerhin wird klar, wir stehen vor der kniffligsten Aufgabe seit langem."
"Na, das sagt man mir jedes Mal. Immer entspannt bleiben!"
"Glaub mir, Chomeini war nichts dagegen..."
Erinnerungen bedrängten mich, während der Jumbo ausrollte. Auf dem Weg in die heilige Stadt Ghom hatte ich mir den Lack von den Fingernägeln gerieben und ein schwarzes Tuch umgelegt, unter dem Haar und Schultern verschwanden. Da Ziesel fand, das Bußgewand lasse noch weibliche Formen ahnen, hüllte ich mich obendrein in den Schador, den düsteren Umhang der rechtgläubigen Iranerin. So vermummt, eher ein Paket als ein menschliches Wesen, trat ich dann vor den Ajatollah hin und fand Gnade in seinen Augen. Aber am Ziel dieser Reise würde uns keine Vermummung schützen.
Ich saß vorm Balkon meines Zimmers im Western International, einem der neuen Hotels von San Salvador, spähte vom Schreibtisch aus über die Stadt im Tal und hörte den fernen Gefechtslärm vom Guazapa-Vulkan. Er lag dreißig Kilometer nordwärts und war seit drei Jahren heiß umkämpft. Irgendwie hielten die Guerrilleros all den Attacken stand. Ich zündete mir eine Zigarette an, erfüllt von geheimer Spannung, dem vertrauten Gemisch aus Entdeckerlust und Furcht. Es war erregend, ein Thema zu haben und den Stoff dafür zu holen – Stoffe und Themen, die Furore machten. Stoffe, verdichtet zu Geschichten. Recherchieren hieß Fakten und Belege sammeln. Das Material, das ich zusammentrug, wurde gekrönt von Geschichten. Es galt, die Realität so komplett zu erfassen, dass man die anderen aus dem Felde schlug. Doch man konnte darin auch ersticken, den Bezug zur Wirklichkeit verlieren – oder die Aufmerksamkeit des Publikums, falls es zu wenig Geschichten gab.
Es widerstrebt mir, die letzten Etappen und unsere Ankunft zu schildern, minutiösbanal. So etwas ist vielfach nachzulesen, auch in meinen Reisebüchern. Wen es kümmert, wie man umsteigt, Geld wechselt oder fragwürdige Papiere durch den Zoll bringt, der mag darin blättern. Durch die Zeitverschiebung waren wir gegen zehn Uhr abends auf Ilopango gelandet, dem einzigen Zivilflugplatz der Pazifikrepublik, nach Mitteleuropäischer Zeit um fünf Uhr früh. Und ich hatte dann versucht, die innere Uhr mit Schlaftabletten um sieben Stunden zurückzustellen... Matt verträumte ich den ersten Tag, bis Ziesel von unten anrief, um mir zu sagen, wir hätten ja einen Korrespondenten hier! In Hamburg habe man glatt versäumt, uns das mitzuteilen.
Bestimmt nicht, Dr. Baron war darin sehr genau. In meinen Notizen fand ich gleich den Namen, Helmut v. Kaden, Hotel El Salvador Intercontinental, zwischen diesem Haus und unserer Botschaft... Da starrte man auf die Grenze und übersah das Nächstliegende! Im herben Duft des Zedernholzes der Wandtäfelung (es riecht auch dann noch aromatisch, wenn es ganz getrocknet ist) zog ich mich um und fuhr hinab. Herr v. Kaden wartete schon im Hotelrestaurant. Er war freier Mitarbeiter, eher rechtsstehend, ein Karibik-Spezialist. Ich bin da ohne Vorurteil, saubere Reportagen konservativen Zuschnitts sagen mir meist mehr als die emotionsgeladenen Äußerungen linker Hitzköpfe, wie mein Sohn einer ist.
"Ich kenne Ihre Berichte", sagte ich, als v. Kaden mich zu einem trockenen Martini einlud. "Glanzvoll und finster."
"Danke." Er setzte das. Glas ab, das Eis klirrte leise. "Zu finster? Es ist unmöglich, solch eine Nacht noch zu schwärzen. Wer will Ihnen denn daheim nicht wohl, dass man Sie hierher schickt?"
Ich lachte, v. Kaden blieb stumm, er hatte gar nicht scherzen wollen. Ein ausdrucksarmes Gesicht, von ihm sprang kein Funken über, nein, da knisterte nichts. Er war um die fünfzig, hager, gebräunt, ein bisschen steif und würdevoll. Äußerlich glich er einem Firmenvertreter, etwa einem 60 000-Dollar-Mann der Elektronikfirma IBM: dunkelblauer Anzug, blaues Hemd, schwarze Schuhe, die Konzernuniform saß wie angegossen. Ein Typ aus der Chefetage von Mother Blue, wie IBM-Leute ihr Haus 13 gern nennen. Eigentlich konnte man sich ihn fern von Schreibtischen mit Rufknöpfen und dem Summen blaugrauer Büromaschinen schwer vorstellen.
"Das ist doch nicht Ihr erster Bürgerkrieg. Gefiel es Ihnen denn in Argentinien oder Chile besser?"
"Sicher, Frau Janssen; für unsereins herrscht da Ordnung."
"Hier nicht?"
"Nein. Ein bedrückendes Klima. Es lähmt die Berichterstattung." Etwas von seinem schwarzen Haar stand drahtig hoch wie eine Antenne zum Orten von Gefahr. Der ganze Mann wirkte erschöpft und alarmiert. Vielleicht spielte er den Geschäftsmann, damit man ihm den Reporter nicht ansah. Touristen, unter die er sich hätte mischen können, schien es ja kaum noch zu geben.
"Ich spreche gar nicht von den Inlandsmedien", sagte er, als das Steak kam. "Früher hatte noch 'El Independiente' gewisse Möglichkeiten, das Blatt der militärischen Reformer, die längst gekippt worden sind. Nach dem Mord an den amerikanischen Nonnen wurde die Redaktion zerbombt. Das hiesige Nachrichtenbüro und auch 'La Cronica' haben die Arbeit eingestellt, der Kirchensender YSAX ist in die Luft geflogen..."
Beim Dessert fiel mir an ihm ein Zug nach unten auf. Sein Kopf hing über der hochstieligen Silberschale, in der – zerteilt und auf Eis – die gezuckerte Grapefruit lag. Mit hängenden Lippen löffelte er die Frucht, das Kinn zitterte, selbst wenn er beim Kauen innehielt. Es war, als habe er längst genug gesehen und ziehe es vor, mit geschlossenen Augen zu meditieren.
"Ich hoffe, uns zeigt man bloß die Krallen?"
"Gewiss – solange Sie die Spielregeln beherzigen."
"Was verstehen Sie darunter?"
"Bleiben Sie bei den 'Extremisten von rechts und links', gegen die das Regime im Zweifrontenkampf steht, und es wird Ihnen nichts geschehen. Allenfalls dürfen Sie das Los der leidenden Mehrheit beklagen, der es ganz gleich ist, wer über sie herrscht, die Armee oder die Guerrilleros, wenn man sie nur in Ruhe lässt, am Leben."
"Das ist aber kaum Ihr Rezept."
"Deshalb hat man mir auch dies geschickt." Helmut v. Kaden entnahm seiner Brieftasche einen Zettel. In der Perlschrift einer elektrischen Schreibmaschine stand dort auf Spanisch der Satz: In drei Tagen bist du weg per Flugzeug oder Blei! "Bei einem belgischen Kollegen lautete der Spruch: 'Du kannst wählen zwischen Koffer und Sarg.' Sehr bildkräftig, nicht wahr? Es gibt ihn in mehreren Versionen. Da entfaltet die Sprache ihre ganze Farbenpracht."
"Wann ist das gekommen?"
"Vorgestern. So haben Sie mich also noch erreicht. Und bis zum Abendflugzeug bleibt mir ja noch etwas Zeit. Wie ist übrigens Ihr Spanisch?"
"Modico, señor. Keine tausend Worte."
"Das reicht nicht aus. Wie steht's mit Ihrem Begleiter?"
"Nicht besser; er ist meist in Afrika gewesen."
"Das dachte ich mir. Er schreibt dort drüben Ansichtskarten." Herr v. Kaden sagte dies so, als wundere es ihn, dass Klaus Ziesel überhaupt schreiben konnte, da er doch Bildreporter war. Selber ging er, um zu telefonieren, kehrte jedoch bald zurück, unverrichteterdinge. "Um diese Zeit erreicht man ihn schlecht."
"Von wem reden Sie?"
"Verzeihung: von Ihrem künftigen Dolmetscher, wenn Sie ihn akzeptieren. Na, ich weiß schon, wo er zu finden ist. Falls Sie wirklich hinauf zur Grenze wollen, kommen Sie ohne ihn kaum aus."
"Geht er auch mit zu den Behörden? Kann er mir helfen, eine Fahrt ins Kampfgebiet genehmigt zu kriegen?"
"Das weniger; die wird man Ihnen auch schwerlich genehmigen. Für die Provinzen Chalatenango und Morazán wär das übrigens witzlos, dort hat nämlich die Guerilla das Sagen."
"Aber die Armee kontrolliert doch wohl die Zufahrten."
"Nicht lückenlos, dazu reichen deren Kräfte niemals aus. Der größte Teil El Salvadors ist Niemandsland, Frau Janssen. Die Macht hat, wer gerade durchmarschiert; meistens ist keine der Kampfparteien präsent. Das ist Ihr Risiko und Ihre Chance."
"Glauben Sie, Ihr Mann hat Kontakte zum Untergrund?"
"Wer hat die hier nicht? Es gibt fast in jeder Familie einen, der abgetaucht ist, so oder so."
"Das klingt ja recht verheißungsvoll."
"Vielleicht in Ihren Ohren." Höflich rückte Helmut v. Kaden an meinem Stuhl, um mir das Aufstehen zu erleichtern. "Faktisch aber heißt es, jeder fünfte Einwohner dieses unglücklichen Landes ist entwurzelt. Jeder fünfte ist hier Soldat oder Polizist, Guerrillero oder Sympathisant, ins Ausland geflüchtet, verschwunden oder tot."
IV
Sonst waren Leihwagen vorteilhaft, Helmut v. Kaden aber zog Taxis vor – das erschwere die Verfolgung. Auf keinen Fall sollte man sehen, wohin wir uns jetzt wandten. Geheimhaltung war alles. Aufrecht, als habe er einen Stock verschluckt, saß er neben mir im Fond, ab und zu nach hinten spähend auf die Avenida Cuscatlán, ein Geflecht aus Licht und Schatten, bis er überzeugt zu sein schien, es habe sich niemand angehängt. Wie er's bei dieser Paranoia über sich brachte, Regimegegner zu treffen, war mir ein Rätsel.
Von der Stadt begriff ich wenig, ihre Struktur erschloss sich mir nicht, eine tropisch üppige Hauptstadt im Krieg ohne Barrikaden. Militär auf den Straßen, patrouillierende Polizei, bunte Sprayparolen an mancher Wand, Bankportale schwer bewacht, dort ein Sandsackwall, ganz selten ein zerstörtes Haus oder von Einschüssen zernarbte Fassaden... Dass wir in die Calle Modelo bogen und in sanfter Kurve den Zoologischen Garten streiften, ging mir erst abends überm Stadtplan auf.
"Journalisten, die neu sind, werden bespitzelt, bis man sich klar ist über sie, Frau Janssen. Treten Sie also kurz, nehmen Sie nur Kontakt zu amtlichen Stellen auf. Nach einer Woche lässt das Interesse an Ihrer Person dann nach. Schließlich kann man nicht jeden rund um die Uhr beschatten..." Wir passierten den Stadtrand, Slums auf Sand und Geröll, gewöhnliches Elend. Hinter einer abgebrochenen Palme stand Los Planes – 7 kilómetros auf einem verstaubten Schild. Kurvenreich wand sich die Straße am Südhang des Tals empor, in dem San Salvador liegt.
An einer Tankstelle wechselten wir das Taxi, vorsichtshalber. "Wenn Ihnen mein Zeug noch halbwegs erinnerlich ist", sagte v. Kaden, "kennen Sie doch nur das, was Strathmann stehenließ. Ihm sind die Texte immer zu lang, zu wenig pointiert. Informations– und Unterhaltungswert schließen einander oft aus. Zu einer Tragödie fällt einem dann keine Pointe ein..."
Das übliche Lamento, der Zwiespalt des Reporters. Ich verstand ja auch die Gegenseite, den Verlegertraum. Wie prächtig stünde das Haus da mit seinem Endprodukt aus Leistung und Genauigkeit, mit der perfekten Organisation, all den Beschäftigten in Druck, Vertrieb, Layout, Illustration, Dokumentation, Rechtsabteilung, kaufmännischer Leitung und so fort, wären nicht die Reporter mit ihrer spitzen Feder! Denn mit dem Neuesten aus aller Welt, soweit es nicht beruhigend vorgefiltert war durch die großen Agenturen, kam von dieser schreibenden Minderheit stets Reizung und Störung des Geschäftsgangs. Auch das Verlegen von Zeitschriften war ja so trefflich eingespielt, fast automatisiert, anfällig gegen Fremdkörper, dass der Herausgeber sich fragen mochte, wann endlich der Störfaktor Mensch auch im Journalistischen ersetzbar wurde; letzter Schritt zur Vollendung.
Nun wechselte die Szene, ein feines Restaurant glitt vorbei. Märchenhafte Pflanzen umgaben uns, Riesenbäume, leuchtende Blumen und nachgeahmte Maya-Skulpturen. Inmitten des Baiboa-Parks, einem Ort der schwelgerischen Natur, des Wohlstands und der Erholung, hielt das Taxi an – unterhalb einer turmhohen Klippe, die rostfarben aus dem Steilhang sprang. Der Fels lag im Schatten, an seinem Fuß standen zwei dunkle Kombiwagen, ich sah ein paar Männer umherkriechen in der Haltung von Leuten, die eine Müllkippe nach Verwertbarem absuchen. Sie bückten sich zwischen Steinen und Gestrüpp, ihr Tun wirkte deplaziert.
"Sehen Sie die Öffnung unterhalb der Spitze?", fragte mein Begleiter. "Sie heißt das Teufelstor, ist auf der Rückseite des Berges bequem im Auto erreichbar und bietet den schönsten Ausblick auf die Stadt bis zu den Gipfeln von Honduras in violetter Ferne. Einst ein beliebtes Fotomotiv. Heute aber stößt man dort Nacht für Nacht, während der Sperrzeit ganz ungestört, verschleppte Personen und Häftlinge hinab. So trägt der Ort seinen Namen jetzt zu Recht."
"Und diese da – bergen die Leichen?"
"Das tun sie. Es sind Wagen der Bestattungsfirmen La Protectora und El Respeto, die 'Schützerin' und die 'Ehrfurcht'..." Herr v. Kaden rollte das R, er glänzte überhaupt in der makellosen Aussprache des Spanischen selbst innerhalb deutscher Sätze. "Sie laden auf, forschen dann nach zahlungskräftigen Angehörigen, und wenn es keine gibt, kippen sie die Leichen kurzerhand am Zentralfriedhof in der Calle del Cementerio ab. Ein Ort von starker Anziehungskraft. Das ist mal ein Geheimtipp gewesen, mein Vorgänger hat ihn mir gezeigt."
"Also ein kollegialer Brauch."
"Der Mann ist ausgewiesen worden wegen eben dieses Reports vom Teufelstor, Puerta del Diablo. Darin stand der Satz: 'Die junge Frau, deren nackter Körper mit gefesselten Händen und verbundenen Augen heute da unten in den Dornen hängt, ist vor dem tödlichen Sturz noch vergewaltigt worden.'"
"Das hat man ihm so gedruckt?"
"Gewiss, ihm war's doch geglückt, zugleich mit der Wahrheit lüsternes Grauen zu verbreiten, das heißt, im selben Atemzug informativ und unterhaltsam zu sein."
Wozu rieb er mir das hin? Natürlich füllten wir den Musikdampfer, die Wundertüte unseres Magazins jede Woche neu, gierten die Chefs nach frischen Reizen, maßlos in ihren Forderungen an den Redaktionsstab und sicher im Urteil, wann eine Nackte oder ein Tier hermussten, um zwischen zwei ernsthaften Themen das Blatt aufzulockern, es genießbar zu machen, bekömmlich. Und so den Jahresgewinn auf sechzig Millionen zu heben. Was waren dagegen die Schriften der Alternativen, die nie aus den roten Zahlen kamen, obschon sie kein Honorar zahlten und in jeder Nummer um Spenden baten oder auch bloß um Bezahlung des Abonnements? Wackere Zwerge im Land der Medienriesen.
"Fakten und Emotion, wie sich das stößt", klagte v. Kaden. "Soviel langweilige Sachverhalte, Zusammenhänge. Da sucht man dann krampfhaft nach der Story, die den trockenen Kram würzt... Hier nicht, an diesem Punkt trifft sich das, Politik und Verbrechen. Hier werden journalistische Hoffnungen und Leserwünsche prompt bedient, die ewigen Medienbedürfnisse Sex und Gewalt! Wer aus dieser Quelle schöpft, der trägt ganz von selbst so dick auf, dass ihn der Hintergrund nicht mehr kümmern muss; einfach weil kein Hintergrund mehr sichtbar wird."
Er ging mir auf die Nerven. Für seinen Karibik-Bericht hatte man ihn mit einem der drei Egon-Erwin-Kisch-Preise ausgezeichnet, die alljährlich vergeben werden. Die Belehrungen waren lähmend. Welch eine Idee, mich herzuschleppen! Da sahen wir den Bestattungsleuten zu, gar nicht weit von denen weg, Leichenfledderer auch wir; wenn auch nicht mit solch widerlicher Ausschließlichkeit. Umhüllt von Gerüchen der Verwesung, die uns in süßlichen Wellen streiften, nahm ich mir vor, herauszufinden und zur Sprache zu bringen nicht wie, sondern warum hier so gestorben wurde – auf beiden Seiten der unsichtbaren Front, die das kleine Land zerriss, die Gartenrepublik, wie es in meinem Reiseführer hieß... Was übrigens tat der junge Mann dort, ein Mensch im Hawaii-Hemd? Er barg den Körper zu seinen Füßen keineswegs, fotografierte ihn nur schamlos. Ich trat näher und fragte, wozu er das mache.
Der Jüngling ließ die Kamera sinken. "Wir versuchen, die Opfer zu identifizieren."
"Wer ist 'wir'?"
Er fingerte an seinem Apparat und antwortete nicht. Jemand vom Beisetzungsdienst rief mir zu: "Comisión de los derechos humanos."
"No, no", sagte der Jüngling. "Socorro jurídico."
Herr v. Kaden holte mich ein. "Das ist Carlos Rivas vom Rechtshilfebüro des Erzbistums, mit ihm wollte ich Sie zusammenbringen..." Er hielt sich ein Taschentuch vor die Nase. "Am besten, Sie geben ihm Ihre Hotelanschrift. Er dolmetscht hervorragend englisch-spanisch und kann Ihnen auch sonst behilflich sein."
Obwohl v. Kaden mir davon abriet, begleitete ich ihn zum Flugplatz in dem Gefühl, ihm das zu schulden. Und für diese Geste wurde ich am Schluss auch noch belohnt. Als wir am Hauptbahnhof vorbei über den vierspurigen Boulevard Ilopango ostwärts fuhren, zeigte er mir links oben am Hang den Vorort Mejicanos. Bis dorthin seien die Aufständischen bei ihrer Offensive vor zweieinhalb Jahren gelangt, die Gruppen der Volksbefreiungskräfte (FPL) und des Revolutionären Volksheers (ERP). Dort erst hätte die Armee sie gestoppt, weil es ihnen an schweren Waffen gefehlt habe und der Generalstreik in der Hauptstadt gescheitert sei.
Beim Griff nach der Zigarette bebte meine Hand. Bei mir setzt die Wirkung meist verspätet ein. Das demonstrativ Beiläufige, die kalte Routine der Exekutionen! Gleichgültig gegenüber der Weltmeinung, nur auf blinde Abschreckung aus. Ich bekam plötzlich den Mund nicht wieder zu, rang nach Luft und warf die Zigarette aus dem Fenster.
Der Flugplatz lag nur acht Kilometer vor der Stadt am Rande eines Kratersees, des Lago de Ilopango, grausilbern wuchs er auf uns zu. Im Militärsektor standen zwei Dutzend leichte Kampfhubschrauber und Jagdbomber des US-Typs "Dragonfly" mit Zusatztanks an den Spitzen der Tragflächen. Die französischen "Magister"-Strahljäger, sagte v. Kaden, gebe es nicht mehr. Zweimal schon hätten die Guerrilleros fast die gesamten Luftstreitkräfte zerstört, durch Sprengkommandos hier am Boden. Aber Washington ersetze beharrlich jedweden Verlust – und mehr als das.
Den Checkpoint kannte ich schon. Der Chauffeur glitt so behutsam hindurch, als fahre er Nitroglyzerin über eine besonders heikle Strecke. "Steigen Sie bitte nicht mit aus", riet mein Kollege. "Der Mann wird bereits nervös, er muss ja zu Haus sein, wenn um neun Sperrstunde ist. Schade, mir blieb kaum Gelegenheit, Ihnen wirklich zu helfen! Aber nehmen Sie doch das, damit riskiere ich nur Ärger vorn beim Zoll. Nicht ins Hotelsafe tun, lesen und weg damit..." Er zog einen Hefter aus dem Aktenkoffer und ließ ihn neben mir zurück.
Anderntags, nach dem Erkundungsmarsch durch das Zentrum, duschte ich und legte die Füße hoch. Sie schwollen leicht an, manchmal saß mir ein ziehender Schmerz im Bein. Wie lange würde ich noch taugen für meinen Beruf? Die Papiere deprimierten mich. Sorgsam hatte v. Kaden notiert, was Auslandskorrespondenten in diesem Land widerfahren war, und zwar von Anfang an, seit Beginn der Unruhen im Herbst 1979. Drohungen, Diebstahl des Arbeitsmaterials, Verhöre. Journalisten wurden beschossen, entführt und misshandelt. Proteste, Solidarität, Hilfe durch Diplomaten? Kaum der Rede wert. Offenbar eisten nur die Yankees manchmal ihre Leute los; auch um Briten und Italiener hatten sie sich schon bemüht. Ihr Einspruch war der einzige, der zählte. Der Freilassung folgte stets die Ausweisung.
Jeder dritte Fall schien tödlich zu enden. Vom Dach des Regierungssitzes aus wurde der mexicanische Korrespondent Rodriguez erschossen. Rache, wofür? Das Papier verriet es nicht. Drei Kollegen fuhren am Stadtrand auf eine ferngezündete Straßenmine; einer war gleich tot, die zwei anderen schwer verletzt... Herr v. Kaden hatte dazu notiert: "Jan Mates filmte den Mord an einer Schülerin, US-Fotograf John Hoghland war Augenzeuge der Ermordung von Rodriguez, seine 'Newsweek'-Partnerin Susane Moirelas hatte die Leichen der vier nordamerikanischen Nonnen entdeckt." Den französischen Reporter Rebbot traf es im zurückeroberten San Francisco Gotera fern jeder Kampfhandlung in die Brust.
Ich legte die Mappe weg. Ein Eishauch entstieg ihr, etwas Dumpfes, Schicksalhaftes, als sei dies normal und lohne keine Gegenwehr. Der Zug nach unten an v. Kaden fiel mir ein, die hängenden Augenlider, der abwärts gekrümmte Mund. Melancholie im Anfangsstadium, das war Trauer, in sich selbst verliebt, in die Passivität der Hoffnungslosigkeit. Zu lange, das spürte man, befasste er sich aus dem Blickpunkt Lateinamerikas mit dem Zustand der Welt, als dass er noch an Rettung glaubte. Am Ende sah der schwermütige Mann sich selbst in jedem bedrängten Menschen und jeden Menschen bedrängt von Mächten der Finsternis. Aber man musste sich hüten, die Mächte zu dämonisieren.
Später kam Klaus Ziesel mit einer Flasche Whisky. Auf der Vorderseite klebte mein Porträt, auf der Rückseite das Bild eines hiesigen Polizisten, der es sich mit ausgestreckter Hand verbat, fotografiert zu werden. "Sie sind sehr kamerascheu", sagte Ziesel. "Weißt du, woran sie mich erinnern? An die chinesischen Pandabären. Die sind mir so lange entwischt, bis ich sie dann im Freigehege schoss. Der einzige Türke, den ich je gebaut hab, glaub mir das."
"Ich glaube es dir, aber diese Burschen sind gefährlicher. Sie kriegen es fertig und schießen zurück."
"Das musst du mir nicht groß erklären. Wer so lange im Geschäft ist wie ich, der spürt schon, wenn es brenzlig wird."
Auf dem Servierwagen schob der Etagenkellner Gläser, Tonicflaschen und einen Chromkübel voller Eis herein, genug, eine Zimmerparty zu bestreiten. Ziesel steckte ihm eine Dollarnote zu. Während er die Getränke mixte, fragte ich mich, ob er auch spürte, dass dies ein ziemlicher Aufwand war: die Fotos, der Whisky, das Eis. Es war verdächtig, ein gründlich vorbereiteter Annäherungsversuch, den es zu bremsen galt – taktvoll, damit der Mannschaftsgeist nicht litt. Ich hatte das schon zwei- oder dreimal bei ihm geschafft und eigentlich Anspruch darauf, dass er mich in Ruhe ließ.
Ziesel gab mir den Drink. "Judy, ich muss mit dir reden... Über das weitere Vorgehen, noch bewegt sich zu wenig, wir treten auf den Fleck... Aber auch über uns."
"Über uns? Die Aufgabenverteilung?"
"Nicht in erster Linie. Die Verteilung ist ganz okay. Du weißt ja, wie sehr ich dich schätze, als Mensch und als Boss."
"Klaus, das haben wir doch schon gehabt."
"In deiner Gegenwart stellt sich die Frage immer neu."
"Du bist ein lebensfroher Mensch. Kaum bist du im Ausland, da fehlt dir weibliche Nähe."
"Auch daheim, nicht bloß im Ausland... Ja, ich mag Frauen, ist das nicht normal? Dich aber bewundere und verehre ich, weil du einfach super bist! Auf dich, Judy."
"Auf unseren Erfolg."
"Was verstehst du denn darunter?"
"Na, auf zur Grenze! Das Rätsel der weißen Flecke lösen."
Er setzte sein Glas ab und füllte es neu. "Sag mal, warst du immer so?"
"Das ist das, wofür man uns bezahlt."
"Nie ein Privatleben gekannt?"
Ich war nicht sicher, ob diese Unterhaltung mir gefiel. Seine Worte schienen die Intimsphäre zu streifen, den verletzlichen Kern, bei mir wie auch bei ihm; ich hätte dies gern auf nette Art beendet. "Frag die zwei Männer, die mir weggelaufen sind."
"Ich wette, es war umgekehrt. Du hast sie sausen lassen."
"Kein Kommentar."
"Ich weiß, du denkst, Gefühle knechten einen. Du verlässt dich ganz allein auf deinen Kopf."
"Und dazu rate ich auch dir."
"Deshalb mein Vorschlag: Lass uns ein Team sein, auf Dauer. Das ist ein ernsthaftes Angebot. Zusammen sind wir unschlagbar, die größten in der Branche..." Wiederum setzte er sein Glas ab und goss sich nach. "Ich denke mir das so, ein halbes Jahr wird geackert, den Rest genießen wir. Ich hab ein Landhaus in der Lüneburger Heide... Weißt du eigentlich, dass Blumen und Tiere vor der Kamera mir mehr bedeuten als jeder gottverdammte Krieg?"
"Das hast du mir schon in Kampala gesagt."
"Verzeih die Wiederholung. Ich hab mich übrigens ungenau ausgedrückt..." Er schluckte und schloss: "Wir könnten nicht bloß ein Team sein, sondern ein Paar."
In diesem Augenblick läutete das Telefon.
Ich hob ab. "Señora Janssen?", fragte eine jugendliche Stimme. "Hier ist der Mann aus dem Balboa-Park. Ich hab etwas für Sie, darf ich heraufkommen?"
"Aber ja", sagte ich wie erlöst.
V
Mit seinem Eintritt begann das, was mich lange in Atem hielt und noch heute erschreckt. Der junge Mann war braun und lebhaft, ich sah ihn unscharf in der Tür, dann stand er, ein Glas in der Hand, mit dem Rücken zum Balkon, wohin es ihn zu ziehen schien; im Gegenlicht verschwamm sein Bild. (Ich habe Mühe, es mir in Erinnerung zu rufen.)
Damals fiel mir eine Ähnlichkeit mit Dirk auf. So ungefähr, dachte ich, würde mein Junge aussehen, wenn er aus Nicaragua heimkam. Bei der ersten Begegnung, unterhalb der Klippe, hatte ich nichts davon bemerkt. "Nehmen Sie doch Platz", wiederholte ich. Wir klärten gleich die Honorarfrage. Ich bot ihm den üblichen Tagessatz für Dolmetscher an, mit einer Geste legerer Überheblichkeit willigte er ein, als lohne es nicht, diesen Punkt zu berühren. Rivas' Vater, hatte v. Kaden erwähnt, sei Geistlicher; ich kannte mich zu schlecht aus in der katholischen Hierarchie, um mir den Kirchenrang zu merken.
Die Ähnlichkeit lag mehr im Wesen als im Äußeren, in einer Art unpraktischer Verträumtheit. Auf mein Fragen hin sprach Rivas zögernd von seiner Arbeit, dem täglichen Versuch, ein paar Tote zu identifizieren. Ja, ein schlimmer Job, man gewöhne sich auch nicht daran. "Gott sei Dank", sagte er. "Wenn ich mich dabei manchmal übergeben muss, zeigt es mir, dass ich noch ein Mensch bin."
"Das Regime, es duldet Ihre Nachforschungen?"
"Das ist ja direkt nicht verwickelt. Alles geschieht heimlich, angeblich hinter seinem Rücken. Als die Presse Leichenfunde noch gemeldet hat, hieß es immer: 'Tote durch Gewalt, durch Unbekannte, keine Gruppe übernahm die Verantwortung, Hergang nicht zu bestimmen.' Die Junta betrachtet sich da als neutral."
Ziesel sagte: "Wo sie tatsächlich die Linken jagt."
Carlos Rivas nickte. Solange wir zu dritt waren, sprach er wenig, zurückhaltend lag sein Blick auf Ziesel. Er hatte schöne Augen, eine Nummer zu groß, und einen indianischen Blutsanteil wie viele Salvadoreños. Er schien reichlich Zeit zu haben. Es war, als wollte er meinen Helfer aussitzen – abwarten, bis der ging. Ich hatte ihm Ziesel als den Mann vorgestellt, der für mich die Fotos schoss, doch er zögerte, ihn einzubeziehen. Ziesel hatte am Teufeltor gefehlt, Rivas tat, als sei er sich über ihn nicht ganz klar. Und ich, warum sagte ich ihm nicht, dass es vor meinem Assistenten kein Geheimnis gab? Es gehört zu dem Merkwürdigen dieser Begegnung, dass ich selber wünschte, Ziesel möge gehen. Ich wollte mit Rivas allein sein, obschon ich an der Wichtigkeit seiner Nachricht zweifelte. Ich fühlte, er ging sonst nicht aus sich heraus. Im Grunde wollte ich ein Interview, seine Geschichte, und er gehörte zu den Menschen, die sich nur im Zwiegespräch öffnen.
Es ist wahr, ich sah in ihm einzig die Quelle, den Informanten. Er war für mich der Einstieg in das Land: ein gebildeter Vertreter jenes Großteils der Bevölkerung, dem es gleich war, wer gewann, wenn nur das Blutvergießen ein Ende nahm. Diese Tendenz verkörperte er schon durch seine Tätigkeit. So ordnete ich ihn ein in den Raster, jenes Liniennetz, das ich unbewusst über alles zu breiten pflegte, um mir ein Bild von fremder Wirklichkeit zu machen. Rivas bedeutete mir nichts, er war ein Objekt meiner Berufsroutine, der professionellen Neugier und journalistischen Dynamik. Denn so oft ich irgendwo hinflog, stets sprang in mir derselbe Motor an, wurden Reserven freigesetzt, Energien mobilisiert und verschlissen. Ich nutzte jeden Gesprächspartner aus, entriss ihm seine Erinnerungen, eben das war mein Rezept. Und während ich geschmeidig durch den rätselhaften Dschungel schlich, dem Gipfel zu, meiner großen Reportage, konnte ich, dort angelangt, rückblickend oft nur fassungslos die eigene Öde anstarren. Wozuwozuwozu? Ich war ein Wirklichkeitsschaufler, der kaum Partei ergriff, ein Genremaler, dessen Bild mit wachsender Breite an Tiefe verlor... Als das nämlich sah mich Dirk, wenn er schrieb: Du entwickelst einfach keine Gegenposition zu den Haltungen und Zuständen, die Du so gekonnt hinterfragst.
Mein Aufstieg in der Branche, ach, ich wurde dessen manchmal nicht mehr froh. Solange ich solche Menschen bloß ausnahm, blieb ich selber ja ein Instrument, degradierte ich auch mich zum Zulieferer, der Weisungen folgt, keinem eigenen Impuls. Saftige Stücke entriss ich der Realität, um sie, zwischen report und thrill jonglierend, in den Schlund des Molochs zu werfen, unter den Heizkessel des Musikdampfers, der unser Bilderblatt war, damit es mit glitzernder Bugwelle daherkam, ein Traumschiff der Unterhaltsamkeit. In dieser Lage und bei solchem Arbeitsstil ging einem der Sinn allmählich verloren.
Der Gedanke kam mir so scharf zum ersten Mal, als Ziesel in dem Gefühl, zu stören, nun aufstand und ging. Rivas saß noch immer im Gegenlicht, was die Täuschung förderte, er sei ein Doppelgänger meines Sohns. Ich achtete auf das Spiel seiner Hände, einziges Zeichen von Nervosität. Seine schlanken Finger verjüngten sich zu den Kuppen hin; Augen und Hände sind mir immer wichtig. Auch die Stimme berührte mich angenehm, fast war sie zu klangvoll für einen schmalen jungen Mann, mit Dirks Stimme hatte sie keine Ähnlichkeit. Die Übereinstimmung der zwei, falls es sie gab, lag tiefer, in ihrer Empfindsamkeit wohl, dem sozialen Gewissen als Ursprung ihres Engagements. Beide kamen aus "gutem Haus". Die Jugend verlieh ihnen Frische, aus ihrer Erziehung schöpften sie Lässigkeit, Geldsorgen kannten sie kaum, das machte sie großzügig. Mit der Liebe wurde man in ihrem Alter leicht fertig, ein eher beiläufiges Vergnügen, die wahre Leidenschaft galt der Politik.
Ich erfuhr, zwei Gruppen suchten hier die Leiden des Bürgerkriegs zu lindern: die Menschenrechtskommission von El Salvador und das Büro für Rechtsbeistand, beides Anhängsel der Kirche. Die Kommission, gegründet vor fünf Jahren, sollte Verletzungen der Menschenrechte registrieren; sie bestand aus Rechtsanwälten, Journalisten und Ärzten, manch einer lebte nicht mehr, andere waren ins Exil gegangen. Es gab ja nicht nur anonyme Drohungen, die Vorsitzende war gleich anfangs umgebracht worden. Doch man hielt durch, machte weiter. Das Büro für Rechtsbeistand verteidigte Angeklagte vor Gericht, wo es noch zu Prozessen kam, es unterstützte Angehörige von Verschwundenen, begrub die Toten der Repression und schickte Ärzte zu solchen Verletzten, die im Krankenhaus Gefahr liefen, ermordet zu werden.
Sei es das, was er mir habe sagen wollen, fragte ich Rivas – bestrebt, ihn tiefer ins Gespräch zu ziehen. Unvermittelt missfiel es mir, nicht auf seinem Platz zu sitzen, das grelle Abendlicht im Rücken; es hätte mich in seinen Augen verjüngt. Innerhalb dieser beiläufigen Empfindung begriff ich, ich wollte ihm gefallen; ganz grundlos übrigens, aus Eitelkeit, dieser weitverbreiteten Schwäche. Statt zu antworten stand er auf, drehte das Radio an und bat mich auf den Balkon hinaus.
Dort gab er mir leise zu verstehen, Herr v. Kaden habe ihm erklärt, wohinter ich her sei. Er wolle mir helfen, Erkundigungen einzuziehen über die Vorgänge im Grenzgebiet, zumal ich es nicht bereisen könne. Morgen Nachmittag könne er mich mit einem Vertreter der Revolutionär-Demokratischen Front zusammenbringen, doch seien Vorsichtsmaßregeln unerlässlich. Polizeispitzel hängten sich oft an, um Leute im Untergrund aufzuspüren. Den Behörden sei bekannt, dass Auslandsreporter auch im Stadtgebiet Kontakt zum Widerstand suchten. Ein paar Umständlichkeiten müsse ich schon auf mich nehmen.
"Ich weiß, wie man Schatten loswird."
"Hier muss man mehrmals den Wagen wechseln. Fahren Sie zuerst zur First National City Bank an der Kreuzung 1a Calle Poniente und 9a Avenida Norte; dann zu Sears Roebuck 6a Avenida Sur 126. Das Warenhaus hat einen Ausgang zur Calle Oriente, den benutzen Sie beim Verlassen."
Ich notierte die Details, wider Willen belustigt von der Präzision seiner Angaben. Rivas sah mich streng, ja zwingend an, so als behage es ihm, meine Schritte zu lenken; vielleicht wertete es ihn vor sich selber auf. Ich sollte dann zur Britischen Botschaft fahren und dahinter den Campo de Marte durchqueren. Auf der Rückseite des Parks befinde sich ein Taxistand. In der Avenida El Progreso müsse ich aussteigen und auf das Nationalstadion zugehen. Er würde mich vor der Turnhalle auf der Südseite in einem grünen japanischen Auto erwarten.
"Darf Herr Ziesel dabeisein?"
"Nur bis zum Campo de Marte. Sie trennen sich im Park. Sollte dort noch wer an Ihnen hängen, weiß er nicht, wem er folgen soll. Danach wird Ihr Landsmann nicht mehr gebraucht. Keine Fotos – Sie verstehen."
"Okay. Sie wissen wenigstens, was Sie wollen."
"Ich will dasselbe wie Sie: niemanden gefährden."
Als Rivas gegangen war, suchte ich die Orte auf dem Stadtplan. Sie lagen zumeist im Zentrum, das ergab kurze Strecken. Am weitesten sprang das Nationalstadion heraus – vom Campo de Marte in Luftlinie auch bloß zwei Kilometer... Der Abend sank, unten flammten die Lichter auf. Ehe ich mit Ziesel zum Essen ging, las ich in meinem Reiseführer (Guide to the Caribbean and Central America by James Felton): San Salvador is a fantastic dream. To feel its full impact, try to arrive at night, when the wonders of the city can steal upon you, piecemeal and slow... Ich sah hinab auf das Schachbrett der City. Deren Wunder würden, so hatte Mr. Felton vor vier Jahren noch gemeint, bei nächtlicher Ankunft langsam über einen kommen, so dass man full impact verspürte, vollen Anprall, also den ganzen Genuss davon hatte.
Vorm Schlafengehen duschte ich und stand einen Augenblick vor dem riesigen Spiegel, rieb ihn mit dem Badetuch blank, in der schwülen Trägheit des warmen Wassers, das an mir herabgeprasselt war. Ich hob das feuchte Haar hoch und verharrte in dieser Haltung; sie ließ die Brüste hervortreten und schmeichelte der Figur, an der nur wenig auszusetzen war. Der Körper altert zuletzt, glattes Fleisch unter der schimmernden, überperlten Haut... In einer jähen Hitzewelle begriff ich, dass ich mich wie mit Rivas' Augen musterte, und ging verwirrt zu Bett.
Bis zum Einschlafen las ich ein paar schwarze Geschichten von Roald Dahl; eine Droge, die beruhigen und trösten kann. Trügerisch kaschierte Scherze ließen Raum für eigenes Erinnern, wobei mir das Buch dann aus der Hand fiel. In dieser Umgebung aber war es wohl die falsche Lektüre, Fiktion und Realität addierten sich und plagten mich im Schlaf. In jagenden Fortsetzungsträumen, die einander überlappten, sah ich an allen möglichen Orten Spitzel, wurde sie auch los, doch nur, um nach sämtlichen Regeln konspirativer Vorsicht in eine Falle zu laufen. Das grüne Auto, in das ich stieg, entführte mich.
Man muss Träumen ihren Lauf lassen, sie vergessen, der aber ließ mein Herz hämmern, quälend, durch wechselvolle Wiederholung. Zuletzt saß stets ein Mädchen am Steuer, eine aufgedonnerte Vorstadtschönheit. Sie sprach ein sinnlich angerautes, höhnisches, leicht krächzendes Englisch. Ihr Gesicht, ohne Ebenmaß, bestand aus langen graugrünen Augen mit schräg aufsteigenden Brauen und einer zugunsten des aggressiv geschnittenen Mundes plump abgestumpften Nase. Die Fahrerin grinste mich an. Die Tür ließ sich nicht öffnen.
Was bedeutete das? Vielleicht war's bloß eine Fußnote zum Tage, eine erotische Arabeske. Ich war kein ängstlicher Mensch. Für mich galt das Prinzip, auf Reisen häufig Feindberührung zu haben. Wie im Krieg lief das auf ständige Gefechtsbereitschaft und manches Scharmützel hinaus. Doch der zweite Grundsatz hieß: Geh nie zu einem Treff, der eine Falle sein kann! Hab alles unter Kontrolle, besonders dich selbst, und behalte die Initiative.
Irgendwann in dieser Nacht sprang mich ein Gedanke an, der monströse Verdacht, Rivas sei womöglich gar nicht Rivas. Der Besucher musste nicht identisch sein mit dem Jüngling, den v. Kaden mir an der Klippe vorgestellt hatte. Ein verwandter Typ, das schon, darauf würden sie geachtet haben, sonst roch ich ja Lunte. Aber ich war mir nicht sicher – der Anblick der Leichen hatte mich erheblich abgelenkt, ja geradezu betäubt. Die Ähnlichkeit mit Dirk war mir erst gestern aufgefallen. Immer hielt er sich im Gegenlicht, so dass sein Umriss ausfranste, eine grelle Schnur, und der Rest verschwamm. Auf mein Personengedächtnis konnte ich kaum bauen, das ließ mich oft im Stich. Solange ein Mensch mich nicht beschäftigte, passierte es mir, dass ich ihn beim Wiedersehen verwechselte oder schlicht übersah. Nachbarn und Berufskollegen hielten mich deshalb für hochmütig. Nun, damit konnte man durchaus leben – daheim, aber hier?
Immerhin, so sagte ich mir gegen Morgen, war wohl noch Verlass auf das Empfinden, aufs Gespür. Rivas hatte gute Augen, ein Spiegel der Seele, der eigentlich niemals trog. Wohlgeformte Hände, eine schöne Stimme und klare, sensible Augen mit langen Wimpern. Dass ich Gesichter verwechseln konnte, hieß ja nicht, dass es mir an Menschenkenntnis fehlte. Schwerlich hätte es mich auch nur im Geringsten zu ihm hingezogen, wäre er ein Falschspieler gewesen.
Den nächtlichen Spuk verschwieg ich Klaus Ziesel; mein Alleingang missfiel ihm sowieso. Nach dem Frühstück wogen wir das Risiko ab. Aus v. Kadens Papieren las er mir die Notiz über den Tod der vier holländischen Journalisten im März vor, Angestellte der niederländischen Fernsehgesellschaft "Radiotelevision News". Das Team bestand aus dem Leiter, einem Interviewer namens Koster, dem Toningenieur und dem Kameramann. Koster war am 11. März von der Policia de Hacienda verhört worden, angeblich hatte sie bei einem toten Guerrillero Kosters Hotelanschrift nebst Telefonnummer gefunden. Im Beisein seiner drei Gefährten leugnete er jeden Kontakt zum bewaffneten Widerstand. Wenig später geriet das Team bei dem genehmigten Versuch, in der Provinz Chalatenango zu filmen, unter Feuer... Der Fall war nie aufgeklärt worden.
Ziesel zitierte noch einen Vermerk jüngsten Datums. Danach hatte eine "Antikommunistische Allianz El Salvadors" Todesdrohungen an fünfunddreißig ausländische Journalisten gerichtet, sogar an Howard Lane, den Presseattaché der US-Botschaft. Die ultrarechte Allianz warf den Presseleuten vor, Handlanger eines "sowjetisch-cubanisch-sandinistischen Kommunismus" zu sein, der "sich unseres Landes bemächtigen will". Es war vollkommen absurd. Auf der Liste standen weitere Nordamerikaner, so die Korrespondenten von UPI, AP und der Fernsehfirmen NBC und ABC. Auch wurden Reporter der "Washington Post", der "New York Times", des "Miami Herald" und des Nachrichtenmagazins "Newsweek" genannt. Dazu hieß es, dies sei "nur die erste Gruppe von Pseudo–Journalisten im Dienst der internationalen Subversion, die wir zum Tode verurteilt haben". Über andere Reporter, die im Lande hin und her reisten, stelle die Allianz noch Ermittlungen an.
"Wahnsinnige soll man nicht reizen", sagte Ziesel.
"Denk an die Größenordnung. Zwanzig Kollegen sind bisher umgekommen, gegen vierzigtausend Salvadorianer."
"Das ist deren Sache. Judy, ich bin ganz und gar nicht dafür, mich im Park von dir zu trennen."
"Es ist so vereinbart. Sei froh, wenn uns das eine Fahrt ins Grenzgebiet erspart... Klaus, wir sind beide erwachsen."
"Eben! Es passt mir nicht, dass der Bursche uns Weisungen gibt."
"Er hat sie plausibel begründet."
"Du vertraust ihm mehr als mir? Was haben wir überhaupt an diesem lausigen Ort verloren!"
"Du weißt ganz gut, es ist das, wofür man uns bezahlt."
"O Gott, es muss doch noch andere Arten geben, mit Anstand sein Geld zu verdienen!"
Unter solchen Klagen ging er, mir die üblichen Interviews zu verschaffen – Gesprächstermine mit Lokalgrößen und Amtspersonen. So hielten wir's überall, es lieferte mir den Hintergrund und nebenbei auch Alibis in jenem Hauch aus Komik und Gefahr, wie ihn nur die Pressearbeit bietet. Ziesels Rastlosigkeit war da stets hilfreich. Im Grunde brauchte er Druck und Chaos. Trotz der Seufzer, erst das Tohuwabohu pulverte ihn auf, es kitzelte seinen lmprovisationsgeist wach. Ich wusste genau, was ich an ihm hatte.
VI
Wir nahmen eines der Taxis vorm Hotel. Im Stadtkern fand ich mich schon zurecht, er bot sich heiter dar, oder war es meine Erwartung, die ihn in mildes Licht tauchte? San Salvador, zuletzt 1922 durch ein Erdbeben zerstört, ist eine Metropole voll moderner Bauwerke und Marmordenkmäler, raschelnder Palmen an den Boulevards, die zu eleganten Plätzen und Parkanlagen führen. Ihre Höhenlage am Fuß zweier Vulkane, 700 Meter überm Meer im lieblichen Tal, lindert die Nachmittagsglut. Wenn der Wind blies, war es erträglich, im Schatten ideal.
Während ich in dem Bankhaus mit meiner Kreditkarte etwas Bargeld holte, behielt Ziesel die Schwingtür im Blick und suchte sich die Gesichter der Nachfolgenden einzuprägen. Auf der Fahrt zum Kaufhaus, dem zweiten Anlaufpunkt, spähte er wieder durch die Heckscheibe, ohne bei dem Verkehr herauszufinden, ob sich ein Wagen angehängt hatte. Die Strecke war zu kurz, sieben Blocks ostwärts, fünf nach Süden, nur einmal bogen wir rechts ab. Vor Sears Roebuck griff Ziesel zur Kamera, aus einer schnellen Drehung heraus schoss er durch sein Weitwinkelobjektiv die 6a Avenida Sur.
Wir kauften nichts, verließen das Haus zur Calle Oriente und fanden im Gewühl gleich wieder ein Taxi. Beim Einsteigen nahm Ziesel die Szene hinter uns auf. Dasselbe tat er von den Stufen der Britischen Botschaft aus, um mögliche Spitzel abzuschrecken. Nach meinem Gefühl waren wir sie los, falls es sie überhaupt gegeben hatte; die Tricks erübrigten sich, doch wir hielten uns ans Drehbuch. Beim Empfang fragte ich nach der eigenen Botschaft und hörte, sie sei seit langem geschlossen.
Nun zu Fuß in den Campo de Marte, ein hübscher Park, auch recht belebt. Mehrmals knipste Ziesel mich vor wechselndem Hintergrund. So hatten wir in Conakry einmal Späher entlarvt, doch hier machte es mich nervös – mir war, als könne uns dies gefährden. "Weißt du", fragte ich ihn, "an wen mich das erinnert? An Bill Stewart von ABC, damals in Managua."
Er kannte die Story und hörte auf. Vor vier Jahren war der Bildreporter Stewart von einem Nationalgardisten erschossen worden. Ein Tod für ABC und das lüsterne Publikum, denn natürlich – gelernt ist gelernt – hatte Stewart im entscheidenden Moment auf den Auslöser gedrückt. Das Foto des Mörders ging um die Welt, was mit dazu führte, dass Washington dem Diktator Somoza in letzter Minute seine Gunst entzog. Inzwischen freilich war der Präsident aus härterem Holz und das Weltgewissen durch all die Journalistenmorde abgestumpft. Ronald Reagan hätte solch ein Bild, wäre Ziesel US-Korrespondent gewesen, höchstens noch zu einem Stimmbeben auf der nächsten Pressekonferenz veranlasst, zu ein paar Sätzen gut gespielten Bedauerns.