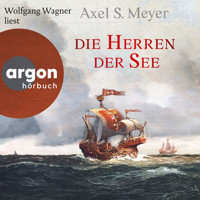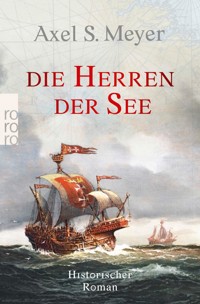9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Gott schuf, Linné ordnete»: ein faszinierender Roman über den schwedischen Botaniker Carl von Linné Von Leidenschaft, Ehrgeiz und Besessenheit getrieben, ringen zwei Forscher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts um Anerkennung. Carl von Linné will Gottes Schöpfung, die Flora und Fauna, nach einem von ihm entwickelten System ordnen und zum berühmtesten Botaniker aller Zeiten werden. Zunächst wird der Schwede verkannt, publiziert aber schließlich bahnbrechende Schriften und unternimmt abenteuerliche Forschungsreisen. Erbittert bekämpft wird er dabei von dem deutschen Arzt Johann Georg Siegesbeck. Der Wissenschaftler hat sich einen bescheidenen Namen gemacht und verfasst selbst botanische Schriften. Schriften, die hinfällig werden, sollte sich Linnés Sexualsystem zur Pflanzenbestimmung durchsetzen – in Siegesbecks Augen nichts als Ketzerei …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Axel S. Meyer
Der Mann, der die Welt ordnete
Roman
Über dieses Buch
Von Leidenschaft, Ehrgeiz und Besessenheit getrieben ringen zwei Forscher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts um Anerkennung. Carl von Linné will Gottes Schöpfung, die Flora und Fauna, nach einem von ihm entwickelten System ordnen und zum berühmtesten Botaniker aller Zeiten werden. Zunächst wird der Schwede verkannt, publiziert aber schließlich bahnbrechende Schriften und unternimmt abenteuerliche Forschungsreisen. Erbittert bekämpft wird er dabei von dem deutschen Arzt Johann Georg Siegesbeck. Der Wissenschaftler hat sich einen bescheidenen Namen gemacht und verfasst selbst botanische Schriften. Schriften, die hinfällig werden, sollte sich Linnés Sexualsystem zur Pflanzenbestimmung durchsetzen – in Siegesbecks Augen nichts als Ketzerei …
Ein farbenprächtig erzählter Roman über die Fehde zweier Botaniker, von der heute kaum etwas bekannt ist. Nur die Siegesbeckia orientalis zeugt noch davon: ein unansehnliches Unkraut, das Linné nach seinem Widersacher benannte.
Vita
Axel S. Meyer, 1968 in Braunschweig geboren, studierte Germanistik und Geschichte. Heute lebt er in Rostock, wo er als Reporter und Redakteur der «Ostsee-Zeitung» tätig ist. Den deutschen Lesern ist er bereits durch seine erfolgreiche Roman-Reihe um den Wikinger Hakon bekannt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2022
Copyright © 2022 by Axel S. Meyer und Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Katharina Rottenbacher
Verse auf S. 96 u. S. 234 aus Martin Opitz: «Über den Abschied einer edelen Jungfrauen»
Verse auf S. 188 aus Julius Wolff: «Wegewart»
Verse auf S. 287 aus Heinrich Heine: «Du bist wie eine Blume»
Verse auf S. 288 aus Johann Wolfgang von Goethe: «Liebhaber in allen Gestalten»
Verse auf S. 331/337 aus Albrecht von Haller: «Die Alpen»
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung The Picture Art Collection, Historic Images/Alamy
ISBN 978-3-644-00685-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Im Gedenken an Elfriede Zimmermann, die ihre Blumen liebte.
Wenn ein Baum seine größte Höhe erreicht hat,
dann muss er fallen;
was auch immer seine höchste Vollendung erreicht,
stürzt von da ab sogleich seinem Ende zu.
Carl von Linné
Prolog
Uppsala, 23. Mai 1753
Wenige Stunden bevor das Monster mein Lebenswerk zerstören wird, erwache ich mit Kopfschmerzen. Ich liege in meinem Arbeitszimmer auf dem Bett, in dem ich schlafe, wenn ich bis tief in die Nacht arbeite, und das kommt häufig vor. Viel zu häufig. Vor dem Fenster graut der Morgen. Vermutlich habe ich nicht mehr als zwei Stunden geschlafen.
Mir fällt ein, dass heute mein Geburtstag ist. Vor sechsundvierzig Jahren erblickte ich in Råshult am Möckelnsee das Licht der Welt. Warum man diesen Tag feiert, habe ich nie verstanden. Was hat man denn dafür getan? Das waren doch andere, vor allem die Mutter; der Vater trinkt Schnaps und steht dumm daneben, wenn er noch stehen kann.
Während ich still im Bett liege, warte ich darauf, dass das hämmernde Pochen in meinem Schädel nachlässt. In der sich erwärmenden Morgenluft höre ich, wie unter dem Dach die Holzbalken knacken. Ich höre die Geräusche trampelnder Füße unten im Haus. Die Kinder quengeln. Sara schimpft mit ihnen, schon am frühen Morgen schimpft sie, ihre Stimme klingt schrill, sehr schrill.
Nach einer Weile stehe ich auf und ziehe den Vorhang am Fenster zur Seite. Dünnes Sonnenlicht fällt auf meinen Schreibtisch, auf dem die Stapel mit den Papierbögen liegen, zusammen mit den Manuskripten und meinem neuen Werk, das ich vor wenigen Tagen veröffentlicht habe. Es ist mein Meisterwerk, und es wird – bei aller Bescheidenheit – meine bisherigen Arbeiten in den Schatten stellen und nicht weniger als den Beginn einer neuen Epoche für die Naturwissenschaften markieren. Viele hassen mich dafür. Sie nennen mich einen Aufschneider, einen Unruhestifter, einen Förderer der Hurerei. Über Letzteres müsste ich am lautesten lachen, wenn es nicht so traurig und närrisch wäre. Die Männer, die mich bekämpfen und verachten, klammern sich ans Althergebrachte wie Ertrinkende im weiten Meer an die Außenplanken eines überfüllten Rettungsboots; doch sie finden keinen Platz in dem Boot und ersaufen.
Über der Schüssel schöpfe ich mir kaltes Wasser ins Gesicht. Dann ziehe ich meine Lappentracht an, die ich mir einst für meine große Reise gekauft habe: den Mantel aus Rentierleder, den runden Hut, die Lederstiefel, den Gürtel mit Taschen und den Geräten. In diesem Aufzug schleiche ich die Treppe hinunter und werfe im Erdgeschoss einen Blick in die Küche. Am Tisch sitzen meine fünf Kinder, zwischen zwei und zwölf Jahre sind sie alt. Sie bemerken mich nicht. Auch Sara nicht. Sie ist ganz grau im Gesicht und klatscht den Kindern Haferbrei in die Schüsseln. Und ich ahne, dass ihre Laune noch schlechter wird, wenn sie nachher feststellt, dass ich wieder meinen Geburtstag schwänze, weil ich nur an mein blödes Unkraut denke, wie sie es nennt. Manchmal tut sie mir wirklich leid, denn ich kann nur wenig Zeit für Sara opfern, für die Kinder auch, ja natürlich, auch für die Kinder.
Aber muss nicht jeder mit Leib und Seele dem Weg folgen, der ihm vorbestimmt ist?
An diesem Morgen führt mich mein Weg durch die Hintertür aus unserem Wohnhaus. Ich schließe die Tür und atme. Atme die frische Luft. Rieche den Duft der taufeuchten Erde und der Blumen, die am frühen Morgen ihre Blüten öffnen, als hätten sie damit auf mich gewartet. Ich atme und atme und beginne, ich zu sein, beginne zu leben, und ich spüre, wie die Kopfschmerzen allmählich nachlassen.
Wie ein Dieb ducke ich mich unter dem Küchenfenster vorbei, was mir ziemlich albern erscheint, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, unbemerkt zu verschwinden.
Dann laufe ich über den geharkten Kiesweg durch den Botanischen Garten. Beim Tor werde ich langsamer und richte mich zur vollen Größe auf, die leider nicht viel hergibt, körperlich zumindest nicht. Vor dem Tor erwarten mich ein paar Dutzend Leute. Sie sehen mich kommen, rufen meinen Namen, und als ich bei ihnen bin, befühlen sie meinen Rentiermantel und loben meine Lappentracht. Immer mehr Leute stoßen aus der Stadt dazu. Studenten, Professoren, Bürger, auch Adlige sind darunter. An die zweihundert Menschen haben sich schließlich um mich herum versammelt.
Die Kopfschmerzen sind jetzt nur noch ein schwaches Echo, das verhallt wie das Geräusch eines Steins, der ins Tal hinunterrollt. Als ich das Kommando zum Aufbruch gebe, ist mein Kopf kristallklar. Ich schreite vorweg, und die Teilnehmer der Exkursion folgen mir. Jemand stößt in ein Waldhorn. Über uns flattern die blaugelben Fahnen. Eine Pauke wird geschlagen, und der Takt zwingt unsere Schritte in einen militärischen Marsch.
«Vivat», rufen die Leute. «Vivat Linnaeus – er lebe hoch!»
Ich kann nicht sagen, dass mir der Trubel um meine Person unangenehm wäre. Meine Brust weitet sich, mein Kinn hebt sich, und so ziehen wir unseres Weges und lassen die Stadt Uppsala hinter uns. Mauern, Dächer und der Kirchturm verschwinden hinter den Hügeln. Auf den Äckern sprießt Getreide, an Buchen, Eichen und Birken entfaltet sich Blattgrün. Das Gras auf den Wiesen ist saftig und durchsetzt von den farbigen Tupfern frischer Blüten. Lerchen trillern, Spatzen tschilpen. In den Bächen laichen Fische. In der Luft tanzen Mücken zu Tausenden, flattern Fuchsfalter, summen Bienen; Mistkäfer rollen Pferdedung. Es ist Mai, und Gottes Kraft lässt die Natur explodieren. Auch ich bin ein Maikind.
An einem Waldstück, in dem die Bäume dicht und dunkel stehen, lasse ich Halt machen. Ich ahne nicht, dass mir das Monster schon sehr nah gekommen ist. Man verteilt Botanisiertrommeln, längliche Büchsen mit Schulterriemen für die gesammelten Pflanzen. Damit schicke ich die Leute zum Botanisieren fort und bin gleich darauf mit mir allein.
Ich muss daran denken, wie die Kinder vielleicht genau in diesem Moment in mein Arbeitszimmer schleichen. Wie sie feststellen, dass ich nicht im Bett liege. Wie die Kleinsten zu weinen beginnen. Trotz ihrer Geheimhaltung ist mir nicht entgangen, welche Mühe sie sich mit ihrem Geschenk gemacht haben, die Spuren der Verwüstung im Garten waren nicht zu übersehen.
Und wie wird Sara reagieren? Oh, ich kann mir ihr Gesicht gut vorstellen. Es ist geballt wie eine Faust, die zum Schlag ausholt. Das ist ihr Gesichtsausdruck, der mich häufig verfolgt, seit ich damals nach Schweden heimkehrte.
Die ersten Pflanzensammler kommen aus dem Wald zurückgelaufen. Sie zeigen mir ihre Fundstücke, fragen, wie dieses und jenes heißt. Ich nenne Pflanzennamen, doziere über Wuchsformen von Pflanzenstielen, erzähle von Blättern, Blüten und Wurzelgeflecht.
«Die Lichtnelke Lychnis», erkläre ich anhand eines Pflanzenfunds, «liegt wie tot am Boden, bis die Blüte naht und sich entfaltet wie eine junge Frau. Sie hebt sich, richtet sich auf, zeigt sich, und der Wind bestreicht die Blüten, und der Blütenstaub wird in die Höhe geblasen. Einst sah ich eine Lychnis im dreckigen Staub der Bergwerksstadt Falun blühen. Und verblühen. Wenn ihre Blüten vergehen und abfallen, legt die Lychnis sich wieder nieder, sie vertrocknet und wird gram und grau, so wie eine Frau nach der Blüte ihrer Jahre.»
Die Leute lachen, sogar die Frauen. Ein Student reicht mir ein Ästchen mit lanzettförmigen Blättern. Das sei der Echte Seidelbast, den ich mit dem lateinischen Namen Daphne mezereum beschrieben habe, erkläre ich. Vor langer Zeit sei die Bergnymphe Daphne von ihrem Vater, dem Flussgott Peneios, in einen Lorbeerbaum verwandelt worden, damit Daphnes liebestoller Verehrer Apoll, der Sohn des Zeus, sie nicht finden konnte. Und weil die Laubblätter des Seidelbasts denen des Lorbeers ähneln, hätte ich der Pflanze Daphnes Namen gegeben.
Als ich an dem Zweig eine vertrocknete Beere entdecke, rufe ich überrascht: «Seht nur! Hier hängt zufällig noch eine Beere aus dem Vorjahr. Aber Vorsicht: Daphnes Früchte sind sehr giftig. Sie brennen schrecklich im Hals. Mit Wasser allein ist ein solches Feuer nicht zu löschen.»
Ich rupfe die Beere ab, verstecke sie in meiner Faust, ohne dass es jemand sieht, und tue so, als würde ich mir die Beere in den Mund stecken. Und dann – um dem Schauspiel das nötige Drama zu verleihen – reiße ich die Augen auf. Ich ächze, würge und stöhne, als erleide ich qualvollste Schmerzen. «Das einzig wirksame Gegenmittel ist Branntwein», keuche ich. «Hat denn niemand einen Schluck Branntwein dabei?»
Ein Mann reicht mir eine Trinkflasche. Ich nehme einen Schluck, und einen zweiten, und, man weiß ja nie, noch einen dritten. Dann, auf wundersame Weise genesen, zeige ich die Beere vor. «Wie schnell man doch zu einem guten Tropfen kommt.»
Die Leute lachen und klatschen Applaus, auch der Mann, dessen Branntwein ich mir erschwindelt habe.
Nach dieser Vorstellung will ich die Exkursion gerade für beendet erklären, als wie aus dem Nichts ein Mann vor mir auftaucht. Er scheint sehr alt zu sein und ist wie ich nicht besonders groß. Er sieht krank aus, blass, und sein Gesicht ist verdorrt wie eine getrocknete Pflaume. Kopf und Schultern hält er leicht vorgebeugt wie unter einer niederdrückenden Last. Er trägt keine Perücke, das graue Haar steht ihm ungekämmt vom Kopf ab. Unter halb geschlossenen Lidern stiert er mich an, trotzdem kann ich seine Augen sehen, scharfe, durchdringende Augen, die leuchten wie die blauen Blüten des Vergissmeinnichts. Mir ist, als spieße er mich mit seinem Blick auf, als sehe er tief in mich hinein, mit seinem wilden, feindseligen Blick.
Ich habe diesen Mann nie zuvor gesehen, weder in Uppsala noch anderswo. Glaube ich. Oder täusche ich mich? Aus einem unerfindlichen Grund drängt sich mir das Gefühl auf, ihn doch zu kennen. Aber woher nur?
Er greift unter seinen Mantel und holt eine Botanisiertrommel hervor, die er mir hinhält, ohne ein Wort zu sagen. Ein unangenehmes Kribbeln durchfährt mich. Ich weiß nicht warum, aber ich will diese Büchse nicht von ihm haben. Die anderen Leute stehen im Kreis um uns herum und warten ab, was geschieht. Nach kurzem Zögern überwinde ich mich und nehme ihm die Trommel ab, öffne sie und greife hinein, vorsichtig und behutsam, als könne darin etwas sein, das nur darauf wartet, in meine Finger zu beißen. Als ich den Fremden erneut anblicke, sehe ich, wie er den Mund zu einem hämischen Grinsen verzieht. In der Trommel ist etwas, das sich wie eine Pflanze anfühlt. Ich ziehe es heraus und halte ein vertrocknetes, krautiges Gewächs mit eigenartig geformten, schwefelgelben Blüten in der Hand.
Ich erkenne die Pflanze sofort und zucke zurück, als hätte ich mir daran die Finger verbrannt. Die Pflanze fällt zu Boden, und als ich wieder aufschaue, sehe ich, wie der Fremde in der Menschenmenge abtaucht, nur sein Kopf mit dem wirren Haar ist noch zu erkennen, dann ist der Mann verschwunden.
Ein Student hebt die Pflanze auf, betrachtet sie und sagt: «Sie gleicht in Wuchs und Blattform dem Leinkraut Linaria. Solche Blüten habe ich aber noch nie gesehen.»
Ich beginne zu schwitzen und wische mir mit der Hand über die feuchte Stirn. Die Kopfschmerzen sind zurück, schlimmer als am Morgen. «Stecke er das Ding in die Botanisiertrommel», herrsche ich den Studenten an. Meine scharfe Stimme verunsichert ihn, sodass er umgehend gehorcht, und ich drücke den Deckel fest zu.
«Diese Pflanze gibt es nicht», flüstere ich mit heiserer Stimme. «Sie hat nie existiert, und sie wird nie existieren. So etwas Ungeheuerliches hat Gott in seinem Schöpfungsplan nicht vorgesehen. Diese Pflanze ist – ein Monster!»
Und damit beginne ich zu fallen und stürze meinem Ende entgegen.
1.Zwanzig Männer im Bett mit einer Frau
Sankt Petersburg, 1736
Der verhängnisvolle Brief aus Holland erreichte den deutschen Botaniker Johann Georg Siegesbeck in Sankt Petersburg zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Er war spät dran, und im Gewächshaus des Botanischen Gartens auf der Apothekerinsel warteten die Studenten auf seine Vorlesung. Dennoch erlag Siegesbeck der Neugier. Er öffnete den Umschlag. Darin steckten ein kurzes Anschreiben und eine dünne gebundene Schrift.
Obwohl die Zeit ihn drängte, las er das Anschreiben: Ein ihm unbekannter schwedischer Naturforscher, der mit den Initialen C.L. unterzeichnete, bat um die Zusendung von Samen des seltenen Nordischen Drachenkopfs Dracocephalum ruyschiana aus Sibirien. Als kleines Dankeschön im Voraus erlaube er sich, seine bescheidene Schrift dem lieben und höchstgeschätzten J.G. Siegesbeck zu überreichen.
Siegesbeck fühlte sich geschmeichelt. Er schubste die Katze, die auf seinem Schoß schlief, hinunter und blätterte durch die Seiten der Schrift, die viele Tabellen enthielt, bis er an einer Stelle hängen blieb. Er stutzte, las genauer, und kaum hatte er das, was dort geschrieben stand, zu Ende gelesen, vergaß er die Studenten. Er vergaß die Vorlesung. Er vergaß alles um sich herum.
Er las die Abhandlung ein zweites und drittes Mal. Dann hob er den Blick, seine Hände zitterten, er starrte wie erschlagen ins Nirgendwo.
Der Impuls, etwas kaputt zu machen, war übermächtig. Siegesbeck stürzte aus seiner Kammer im Verwaltungsgebäude und lief die Treppe hinunter. Beinahe stolperte er über die Katze, als sie ihm zwischen die Beine sprang. Er fing sich und rannte über den Hof zum Gewächshaus, in dem die Studenten auf ihn warteten. Beim Brennholzhaufen riss er die Axt aus dem Hackklotz und knallte ein Holzstück auf den Klotz. Er packte die Axt mit beiden Händen und hob sie hoch über den Kopf.
Schweiß tropfte von seiner Stirn. In der Maserung der Rinde des Holzstücks erkannte er die verzerrten Strukturen eines Gesichts – ein ihn, Siegesbeck, auslachendes schwedisches Naturforschergesicht.
Der Student Uchitsya sah durch die Glasscheiben des Gewächshauses den deutschen Professor am Hackklotz stehen. Seit einer halben Stunde warteten Uchitsya und seine Kommilitonen auf den Botaniker und eine seiner quälend langweiligen Vorlesungen.
Uchitsya trat auf den Hof und rief dem kleinwüchsigen Mann mit dem grauen Haar und der Axt in den Händen zu, jetzt sei vielleicht nicht der richtige Moment zum Holzhacken. Ob er nicht endlich mit der Vorlesung beginnen wolle?
Siegesbeck hörte nichts. Er sah nur das Gesicht auf dem Holzstück. Seine Arme bebten vor Wut. Dann holte er aus und hackte auf den Schweden ein, dass die Späne nur so herumwirbelten.
Student Uchitsya zog den Kopf ein, und als der Professor im Takt der Axthiebe zu brüllen anfing, bekam es Uchitsya mit der Angst. Er floh ins Gewächshaus. Alle Studenten waren aufgesprungen und drückten ihre Nasen an den Scheiben platt.
«Was ist in den Deutschen gefahren?», fragte der Student Sopli.
Ein wenig merkwürdig war ihnen der Deutsche gleich vorgekommen, als er im Sommer zunächst im Sankt Petersburger Seehospital in den Dienst trat und dann zum Verwalter des Botanischen Gartens ernannt wurde. Dass er offensichtlich vollkommen irrsinnig war, überraschte sie aber doch. Oder waren alle Deutschen so jähzornig?
«Was schreit der überhaupt in seiner komischen Sprache», fragte Sopli.
Uchitsya war der deutschen Sprache durchaus mächtig. Das glaubte er zumindest. Als er die herausgeschrienen Worte ins Russische übersetzte, war er sich dessen aber nicht mehr so sicher und ließ die anderen Studenten am Ergebnis seiner Translation teilhaben: «Zwanzig! Männer! Im Bett! Mit einer Frau!»
Die anderen blickten ihn irritiert an. Zwanzig Männer im Bett mit einer Frau? Das ergab doch keinen Sinn. Wo blieb denn da der Spaß? Und was hatte ein solches Aufkommen im Bett mit Holzhacken zu tun?
Darauf wusste Uchitsya keine Antwort. Nein, einen Sinn ergab das nicht. Und schon gar keinen Sinn ergab das aus dem Mund eines rasenden teutonischen Botanikers, der bislang vor allem dadurch aufgefallen war, dass er gängige wissenschaftliche Theorien anzweifelte.
Draußen hackte und brüllte der Deutsche: «Zwanzig! Männer! Im Bett! Mit einer Frau!»
Drinnen im Gewächshaus dachte Uchitsya, dass die deutsche Sprache wohl doch nichts für ihn sei. Er beschloss, sich künftig dem Studium logischerer Fremdsprachen zu widmen. Dem Finnischen vielleicht. Oder gleich dem Chinesischen?
Auf dem Hof keuchte Siegesbeck vor Anstrengung in den Spänen seines Gemetzels. Er warf die Axt weg und rief in Richtung der plattgedrückten Nasen hinter den Glasscheiben, die Vorlesung werde auf den Nachmittag verschoben. Und dass sich bloß niemand erlaube, sie zu schwänzen.
Er hielt die Atemluft einige Sekunden in der Lunge zurück, bevor er zischend ausatmete und zurück in seine Kammer im Verwaltungsgebäude stapfte. Die Schrift lag auf dem Tisch, wo er sie hatte fallen lassen wie eine heiße Tartuffel.
Siegesbeck sank vor dem Tisch auf die Knie.
Er presste die Handballen gegen seine Schläfen, zwischen denen es schwankte und polterte wie im Bug eines Schiffs auf sturmwogender See. Wie ein Gewitter waren die Worte des Schweden über ihn gekommen und hatten in Siegesbeck ein Unwetter entfesselt. Er musste die Kontrolle über seine Gedanken zurückerlangen.
Da schwang sich also ein Möchtegernwissenschaftler auf, der Welt die Botanik nicht nur neu zu erklären, sondern ihr ein System aufzudrängen, mit dem alle althergebrachten und bewährten Methoden über den Haufen geworfen werden sollten. Es war ein verabscheuungswürdiges Sexualsystem, mit dem der Schwede alle Pflanzen klassifizieren wollte – und zwar anhand ihrer Fortpflanzungsorgane.
Siegesbeck schauderte. Der schwedische Scharlatan erdreistete sich, menschliche Genitalien mit pflanzlichen Organen zu vergleichen! Und dafür fand er sogar noch Gehör! Offensichtlich war man ihm in Holland auf den Leim gegangen und hatte die von sexuellen Abartigkeiten bestimmten Theorien tatsächlich gedruckt. Zugleich verweigerte man ihm, dem braven und gottesfürchtigen Johann Georg Siegesbeck, in Sankt Petersburg den Druck seiner wissenschaftlichen Schriften, etwa über diesen Blender Kopernikus.
Siegesbeck war felsenfest davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für jede Wissenschaft Tugendhaftigkeit, Wahrhaftigkeit und Gottesfurcht sein mussten. Was der Schwede aber abgeliefert hatte, war Gotteslästerung; es war ein einzig und allein auf fragwürdigen Ruhm bedachtes Getöse.
Er schüttelte sich angewidert. Wie Pech klebten die unzüchtigen Worte des Schweden an ihm, und Siegesbeck wusste, dass er dieses Pech nicht mehr loswerden würde, wenn er nicht zur Tat schritt, um dem schändlichen Tun dieses Hochstaplers Einhalt zu gebieten.
Mit gefalteten Händen hob er den Blick zur Zimmerdecke und begann zu beten, um Gottes Zorn für die Ungläubigen zu erflehen. Von solchen Gebeten hatte er Dutzende auswendig gelernt, nachdem seine Frau damals ums Leben gekommen war und er selbst in seiner Trauer beinahe den Lebensmut verloren hatte. Doch es war Gott gewesen, der ihn vor dem Untergang bewahrt hatte, und der ihm den Weg zurück ins Leben gezeigt hatte nach dem schmerzhaften Verlust des einzigen Menschen, den er geliebt hatte. Dafür war er dem Herrn zu ewigem Dank verpflichtet und würde alles in seiner Macht Stehende tun, um Gottes Namen rein zu halten. Und die Schrift des Schweden war Blasphemie. Sie war der Schmutz, mit dem ein Sünder Gottes Namen besudelte.
Siegesbeck überwand Ekel und Abscheu und senkte den Blick auf das Deckblatt der Schrift.
Systema Naturae stand darauf. Und der Name des Verfassers.
Das System der Natur. Von Carolus Linnaeus.
2.Der Blumist
Råshult und Stenbrohult, 1707–1714
Carl Linnaeus wurde in der Nacht des 23. Mai 1707 geboren. Während er sich in einer Hütte im Dörfchen Råshult aufmachte, den Bauch seiner Mutter zu verlassen, irrte sein Vater Nils Linnaeus draußen durch den Garten.
Nils war ein gottesfürchtiger, in Glaubens- und Erziehungsfragen strenger Mann, der aber durchaus in der Lage war, innige Gefühle zu entwickeln. Seine Frau hatte er beispielsweise fast so lieb wie seinen Garten. Obwohl in der stockdunklen Nacht nicht viel von der Natur zu sehen war, begann es doch in diesen Frühlingstagen überall zu sprießen, zu blühen und zu duften. Auch die Knollen aus der Neuen Welt steckten schon ihre grünen Triebe aus der Erde.
In dieser Nacht, in den Stunden nervenstrapazierenden Wartens, riss Nils Äste von Büschen, trampelte durch Beete und stapfte über Trollblumen, Nelken und Primeln. Er trat gegen den Stamm der alten Linde und verstauchte sich den Fuß. Da kündigte ein Schrei seiner Frau Christina die Geburt an.
Er wollte zu ihr eilen, als etwas Merkwürdiges seine Aufmerksamkeit fesselte. Durchs kahle Lindengeäst schien vom Nachthimmel ein gleißend helles Licht auf ihn herab. Nils Linnaeus stockte der Atem. War das ein Zeichen? Ja! Und was für ein Zeichen! Das Licht war ein Fingerzeig Gottes, der ihn, seinen Diener Nils Linnaeus, auf die Bestimmung des neugeborenen Sohnes hinwies.
Wenn es denn hoffentlich ein Sohn war.
Nils humpelte in die Hütte, wo er das Bündel inspizierte, das sich in den Armen der Hebamme rekelte. Ja – es war ein Sohn!
«Der Kleine muss Priester werden», rief Nils. «Ein Priester, wie ich einer bin. Ich werde ihn unterrichten.»
Seine Frau Christina war erschöpft von den Anstrengungen der Entbindung. Sie blickte ihren Mann an und erwiderte: «Aber noch nicht heute.»
Nils hörte ihr nicht zu. «Soeben ist mir die Lichtgestalt der Jungfrau Maria erschienen – genau in dem Moment, als der Junge zur Welt kam. Ich habe die Jungfrau gesehen und sie summen gehört. Ganz deutlich. So klang das.» Er breitete die Arme aus und ließ die vibrierenden Stimmbänder kehlige Laute produzieren.
Christina dachte: Das Zeug, das er aus den Tartuffelknollen brennt, bekommt ihm nicht. «Natürlich wird er Priester, was sonst», sagte sie. «Aber mit dem Unterricht wirst du eine Weile warten müssen. Ich muss mich ausruhen, der Kleine auch. Für den ist so eine Geburt auch nicht alltäglich.»
Nils Linnaeus betrachtete den Säugling. «Ein prächtiger Bursche ist das», murmelte er. «Ganz der Vater. Einen Namen habe ich auch für ihn: Er soll Carl heißen. Carl! Wie König Carl!»
König Carl XII. trug in jenen Jahren die blaugelbe Fahne und den Stolz der schwedischen Nation durch Europa. Die Dänen hatte er besiegt, Zar Peters russische Armee bei Narwa geschlagen, Russen und Sachsen bei Düna überrannt und vertrieben, in Polen Krakau und Warschau erobert und den Sachsen bei Klissow in den Hintern getreten. Einem sächsischen Kurfürsten hatte er in Altranstädt einen Friedensvertrag aufs Auge gedrückt, und einen livländischen Aristokraten, der diesen ganzen Krieg angezettelt hatte, hatte Carl in vollendeter Hinrichtungskunst erst rädern, dann in vier Teile reißen lassen.
«Ja, so ein Rex ist unser König», sinnierte Nils Linnaeus, «und auch aus der linnaeischen Hütte im småländischen Forst wird dereinst ein großer Carl heraustreten.»
Christina nickte müde und verschenkte alle von ihr während der Schwangerschaft gehäkelten und genähten Mädchenkleidchen an die Hebamme.
Ach, ein Töchterchen wäre fein gewesen, dachte Christina und schlief ein.
Bald nach Carls Geburt starb Christinas Vater, der Pfarrer Samuel Broderson. Er hatte im Nachbarort Stenbrohult am See Möckeln den Gottesdienst gehalten. Nach Brodersons Tod war die Pfarrstelle vakant und mit Schwiegersohn Nils Linnaeus schnell ein Nachfolger gefunden.
Die Familie siedelte von Råshult nach Stenbrohult über und bezog das Pfarrhaus, zu dem ein größerer Garten gehörte. Dorthin nahm Nils Linnaeus seine in Råshult gepflanzten Sträucher, Büsche, Blumen und Obst- und Gemüsepflanzen mit. Was man hatte, das hatte man, vor allem die Tartuffeln. Christina konnte den Knollen nichts abgewinnen. Sie war überzeugt, dass ihr Mann diese Knollen gar nicht zum Essen anbaute, sondern ausschließlich, um daraus dieses Getränk zu brennen.
Die Familie richtete sich in Stenbrohult ein. Christina nähte neue Mädchenkleider. Vielleicht hatte sie mehr Glück bei einem zweiten Kind. Mädchen waren schließlich nützlicher als Knaben. Sie halfen im Haushalt, beim Putzen, Kochen und Wäschewaschen, auch waren sie zahmer und weniger versoffen. Von ihrem Ehemann forderte Christina, dass er sein Bestes gab und sie mit einem Mädchen schwängerte.
Und Nils gab sich auch wirklich Mühe bei der Erfüllung seiner ehelichen Pflichten. Nebenher predigte er in der Kirche, arbeitete in der Landwirtschaft, pflegte seinen Garten. Vor allem konzentrierte er sich darauf, den Erstgeborenen auf seine Bestimmung vorzubereiten. Ein Knabe, dem durch göttliche Vorsehung das Priesteramt in die Wiege gelegt worden war, konnte nicht früh genug mit dem Lernen anfangen.
Carlchen übte sich gerade erst im aufrechten Gang, als der Vater mit dem Unterricht loslegte. Er trichterte seinem Sohn die theologischen Grundkenntnisse anhand großer und kleiner Propheten ein. Bei jeder Gelegenheit, etwa nachdem Nils Linnaeus abgekämpft vom Liebesspiel mit Christina aus dem ehelichen Bettlager kroch, rief er Carl zu sich und betete ihm die Namen vor – von Stammvater Abraham bis Zacharias, dem Sohn Berechjas und Enkel Iddos.
Carl musste nachsprechen: A-bra-ham … Za-cha-ri-as … Be-rech-jas. Häufig vernuschelte er dabei eine Silbe, weil seine Sprachfähigkeit noch nicht ausgereift war. Der Vater vermutete hinter der undeutlichen Aussprache jedoch ein mangelndes theologisches Interesse, wenn nicht gar kindlichen Trotz.
«Es bereitet mir keine Freude, dich zu züchtigen, mein Sohn», sagte Nils. «Vielmehr bereitet es mir selbst große Schmerzen. Aber was sein muss, muss sein.» Dann prügelte er mit der Weidenrute jede gottesfürchtige Silbe auf den Po des Bübchens. «Was kann so schwer sein an Manaën und Maleachi?»
«Ma-nä-ä-ä und Malatschie», wimmerte Carl.
Und die Rute klatschte: Ma-na-ën und Ma-le-a-chi.
Carlchen heulte Rotz und Wasser. Doch der Vater ließ sich nicht erweichen. Oft endete der Unterricht erst, wenn Christina ihn in die Schlafkammer befahl. Dann legte Nils die Rute weg, wischte sich übers erhitzte Gesicht und trollte sich. Gleich darauf stieß Mutter spitze Schreie aus, und da wusste Carl, dass er ein wenig Ruhe vor den Propheten hatte. Obwohl Carl keine Ahnung hatte, was es mit den Schreien auf sich hatte, wurde das weibliche Luststöhnen seine Erlösung. Aber die Pausen waren meist von kurzer Dauer. Daher reifte Carls Entschluss, eine Strategie gegen den Prophetenunterricht zu entwickeln. Tatsächlich half ihm ein glücklicher Zufall, der Weidenrute vorübergehend zu entkommen.
Als Vater eines Tages aus der Schlafkammer wankte – das Haar verwuschelt, das Hemd hing ihm aus der Hose –, floh Carl in den Garten. Erst nach langer Suche spürte der Vater ihn auf. Carl kauerte zwischen verwachsenen Sträuchern am Boden. Schnell zeigte er auf ein Gewächs und sagte: «Lein.» Dann zeigte er auf einen Baum und sagte: «Baum.» Und auf die Rute in Vaters Hand: «Weide.»
Nils Linnaeus ließ die Rute sinken und verkündete, wenn Carlchen sich diese Namen auf Latein merke, verlege man den Unterricht vorerst von den Propheten aufs Pflanzliche. Der Wechsel des Lehrplans kam gerade rechtzeitig, denn mit einem Mal rief die Mutter ihren Ehemann nicht mehr in die Schlafkammer. Ihr Bauch wurde dick und rund – und das bedeutete, dass der Vater wieder mehr Zeit zum Unterrichten hatte.
Bald darauf schrie ein neues Wesen in der Schlafkammer. Es war aus Mutters Bauch gekommen und zu ihrer hellen Freude ein Mädchen, dem sie den Namen Anna-Maria gab.
Inzwischen hatte Carl immer mehr Gefallen an der Pflanzenwelt gefunden. Munter plapperte er die Namen von allerhand Gewächsen nach. Es fiel ihm bemerkenswert leicht, Dinge zu benennen, die er sehen und anfassen konnte, wie die Eibe tax-us, den Hornstrauch cor-nus oder die Kastanie cas-ta-ne-a.
So vergingen die Jahre in Stenbrohult, und bald betete Carl die Namen der Pflanzen aus dem Pfarrgarten schneller herunter als das Vaterunser.
Währenddessen kam seinem Namensvetter, dem schwedischen König, im Ausland das Kriegsglück abhanden. Carl XII. musste eine Niederlage nach der anderen einstecken. Bei Lesnaja verlor er eine Schlacht gegen russische Truppen. In der Ukraine wurde er verwundet und musste tatenlos mit ansehen, wie seine Mannen bei Poltawa von den Russen niedergemetzelt wurden. Als der König ins Osmanische Reich floh und der Niedergang des schwedischen Heeres nicht mehr aufzuhalten schien, überlegte Nils Linnaeus im fernen Stenbrohult ernsthaft, seinem Sohn einen anderen Namen zu geben.
Er tat es nicht. Stattdessen freute er sich über die botanischen Fortschritte des Jungen. Im Garten des Pfarrhofs teilte Nils ihm ein eigenes Beet zu, das Carlchen nach Belieben bepflanzen durfte. «Ein richtiger Blumist ist er, mein Filius», lobte der Vater.
Carl schwoll vor Stolz die schmale Brust. Er nahm den Vater beim Wort und unternahm Streifzüge in die Umgebung, wo er mit Händen und Schaufel alles aus dem Erdreich buddelte, was sich wegtragen ließ. Kleine Bäume, Büsche, Kräuter, Sträucher, Moose und Flechten schleppte er auf den Pfarrhof und pflanzte die Gewächse in sein Beet. Bald wucherten darin Unmengen unspezifischer Unkräuter. Sie breiteten sich aus und schoben ihre Ausläufer zwischen Vaters Primeln, Tulpen und Rosen und rankten an Gebüschen und Stauden empor. Die Unkräuter griffen auch auf das Herzstück des Pfarrgartens über: ein rundes, vom Vater liebevoll gepflegtes Hochbeet, auf dem die darauf arrangierten Sträucher, Blumen und Kräuter einen Tisch mit verschiedenen Speisen und Gästen darstellten.
Carl staunte über das Streben der Natur, sich der von Vaterhand geschaffenen Ordnung zu widersetzen. Mit großer Freude brachten die Gewächse alles durcheinander, was der Vater mit Winkelmaß und Lot in Reih und Glied fügte.
Nils Linnaeus teilte die Begeisterung seines Sohnes für das wuchernde Unkraut nicht. Nach langer Zeit kramte er die Weidenrute wieder hervor, und auf Carls Hosenboden setzte es Hiebe, bis die Rute zerbrach.
Carl schniefte und schluckte Tränen herunter. Zu seiner Verteidigung argumentierte er, Gott habe doch alle Pflanzen lieb, auch die, die wuchsen, wie sie wollten.
«Aber nicht so ’n verdammtes Unkraut», schimpfte der Vater und schnitzte eine neue Rute.
Eines Tages erzählte der Vater Carl die Geschichte von einer Göttin. Sie saßen auf der Holzbank in dem vom Unkraut befreiten Garten. Es blühte und duftete, es summte und brummte. In den Sonnenstrahlen tanzten Insekten.
Nils Linnaeus trank von seinem Getränk, das er irgendwo im Wald in einer geheimen Hütte aus Tartuffelknollen herstellte. Mit den Knollen aus der Neuen Welt hatte es Ende des vergangenen Jahrhunderts auch in Schweden erste zaghafte Versuche eines wirtschaftlichen Anbaus gegeben, die aber bald wieder eingestellt worden waren. Daher nahm Nils Linnaeus für sich in Anspruch, die Bedeutung dieser Knollen frühzeitig und als einer der Ersten erkannt zu haben – zum Essen, aber vor allem, um daraus sein berauschendes Getränk zu brennen. Niemand außer ihm durfte es kosten. Er nannte den Trank seine Medizin, sie helfe ihm gegen Hunger und Kälte, auch heile sie Verdauungsprobleme und Trübsinn.
Bisweilen heilte sie ihn tatsächlich, zumindest vorübergehend. Wenn er die Medizin trank – in letzter Zeit trank er reichlich davon –, wurde er heiter, sogar richtig lustig, bald darauf aber grau im Gesicht und seine Stimme undeutlich. Manchmal schlief er im Sitzen ein und fiel vom Stuhl.
Als der Vater an diesem Tag von der Göttin erzählte, war sein Blick noch klar, seine Stimme aber schon belegt. Etwas zu laut rief er: «Die Göttin ist das schönste Wesen auf Gottes Erden. Ihrem Ehemann ist sie immer treu gewesen, obwohl der Idiot in der Weltgeschichte herumreiste. Alle Freier hat die Göttin abgewiesen. Sie behauptete einfach, sie müsse ein Leichentuch weben.» Nils überlegte und fuhr fort: «Irgendwann und aus irgendeinem Grund, der mir entfallen ist, verschwand die Göttin dann unter der Erde. Seither webt sie da unten in den Wintermonaten alle Pflanzen, die im Frühling aus dem Erdreich sprießen.»
Der letzte Teil der Erzählung war kaum zu verstehen, der Becher fast leer, und der Vater schloss die Augen.
Carl stieß ihn an. «Wie ist denn ihr Name?»
Der Vater fuhr hoch. «Hm, was? Der Name? Welcher Name?»
«Der Name der Göttin.»
«Göttin?» Der Vater rülpste und blickte irgendwohin, dann sagte er: «Ich rufe dich, Nemesis, göttlich waltende Königin! Allsehende, du überschaust der vielstämmigen Sterblichen Leben. Dein ist der Menschen Gericht. Ja, du Nemesis, du Göttin des gerechten Zorns. Amen.»
Der Vater schien in sich hineinzuhorchen, als spüre er den Worten seiner rätselhaften Dichtkunst nach. «Das könnte man mal in ’ne Predigt einbauen», murmelte er, bevor ihm das Kinn auf die Brust sank und er zu schnarchen begann.
Carl hatte nicht mal die Hälfte der Geschichte begriffen. Ein Detail aber setzte sich in seinem Gedächtnis fest: Diese Göttin, diese rächende, treue Weberin der Pflanzenpracht, musste das herrlichste Geschöpf der Welt sein, und Carl musste sie finden. Sie finden – und sie besitzen, die Ne-me-sis; ganz allein seine Göttin musste sie sein.
Und tatsächlich sollte es gar nicht mehr so lange dauern, bis er ihr begegnete.
3.Die Vorlesung
Sankt Petersburg, 1736
Am Nachmittag verdunkelte sich der Himmel über Sankt Petersburg. Schwere Wolken jagten von Sturmböen getrieben die Ostsee hinauf, zogen durch den Finnischen Meerbusen in die Mündungen des Newaflusses. Der Sturm knickte Äste, entwurzelte Bäume, rüttelte an Dachschindeln und Fensterläden der jungen Stadt, die der inzwischen verstorbene Zar Peter der Große erst vor wenigen Jahren von Tausenden Zwangsarbeitern in den Sumpf an den Gestaden der Newa hatte bauen lassen.
Siegesbeck saß in seiner Kammer im Haus der Akademie auf der Apothekerinsel. Er hatte gebetet und den Inhalt seiner Vorlesung überarbeitet. Eigentlich wollte er über die Tartuffel dozieren. Stattdessen würde er den rotznäsigen Studenten nun eine botanische und moralische Lektion in Sachen Unzucht erteilen.
Er warf der Katze ein Stück Hartkäse hin. Sie schnupperte daran und rümpfte die Nase. Siegesbeck fuhr sie an, er habe für sie nichts anderes zu fressen, sie solle Mäuse fangen. Dann entschuldigte er sich, weil er an seine Frau denken musste, die völlig vernarrt gewesen war in dieses dumme Tier. Und er dachte an jenen Tag, an dem die Katze versucht hatte, auf der Linde vor ihrem Haus eine Amsel zu fangen. Der Vogel machte sich einen Spaß daraus, die Katze dicht herankommen zu lassen, bevor er auf den nächsten Ast flog, immer einen Ast höher, immer weiter hinauf, bis die Katze merkte, dass der Vogel sie narrte, und hoch oben in der Linde vor Schreck erstarrte. Siegesbecks Frau wollte die Katze herunterholen und kletterte ihr hinterher. Als Siegesbeck heimkam, hingen seine Frau und die Katze in einer Höhe von dreißig Fuß fest. Und dann brach unter ihnen der Ast entzwei. Die Katze landete mit den Pfoten auf dem Dach des Hauses, Siegesbecks Frau mit dem Kopf voran auf dem gepflasterten Hof. Als er bald darauf die Stelle in Sankt Petersburg annahm, brachte er es nicht übers Herz, die Katze zurückzulassen. Nicht, weil er sie besonders mochte, aber sie war das Einzige, was ihm aus seinem früheren Leben geblieben war.
Er steckte mit spitzen Fingern die Schrift des Schweden in eine Mappe und ging hinaus. Auf dem Hof brausten ihm Wind und Regen ins Gesicht. Er trat ins Gewächshaus und blieb stehen. Auf den Stühlen zwischen Blumen, Büschen und Bäumen saßen nur sechs Studenten.
Wo waren die anderen? Das Fehlen der jungen Männer war unverzeihlich. Ausgerechnet jetzt, da Siegesbeck ihnen einen richtungsweisenden Vortrag halten wollte, wagten es die russischen Studenten, den Vortrag zu schwänzen? Hatten die Feiglinge etwa Angst vor ein bisschen Gewitter?
Eine Böe knallte hinter ihm die Tür zu. Im Gewächshaus klirrten die Scheiben.
Siegesbeck nahm Haltung an. Von einem Strauch zupfte er eine Handvoll roter Beeren ab, mit denen er sich ans Dozentenpult stellte. Die Mappe legte er aufs Pult und hämmerte mit der Faust drauf. «Ruhe, verdammt noch mal!», rief er auf Russisch.
Die Studenten blickten sich ratlos an. Niemand hatte ein Wort gesagt. Das wagte bei dem Deutschen eh niemand, schon gar nicht nach der ruppigen Vorstellung mit der Axt heute Morgen. Man musste ja befürchten, dass der Deutsche einem eins überzog, wenn man ihn nur schief anguckte.
Siegesbeck hielt die roten Beeren hoch. «Kennt jemand den Namen dieser Pflanze? Die Herrschaften sollen gut nachdenken. Es werden Bewertungen verteilt.»
Keiner der hoffnungslosen Fälle meldete sich. Nur ein Student, der Streber Uchitsya, saß direkt vor dem Pult, die anderen fünf lümmelten hinten in der letzten Stuhlreihe herum. Sopli, der Schlimmste von allen, riss den Mund auf und gähnte so selbstgefällig wie ein Löwe, nachdem er seinen Anteil an der Antilope verspeist hatte, die andere für ihn hatten erlegen müssen.
«Die Beeren gehören zur Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes Officinarium», gab Siegesbeck die Antwort selbst.
«Wie bitte?», fragte Uchitsya.
«Der Schweizer Botaniker Johann Bauhin, Sohn des Arztes Johann Bauhin und Bruder des Botanikers Casper Bauhin, hat die Pflanze einst beschrieben und ihr diesen Namen gegeben. Der Name ist eindeutig. Er muss für alle Ewigkeit Bestand haben. Übersetzt bedeutet er: die Grossularia mit den vielen Einzeltrauben, auch genannt dornenlose Rote aus dem Garten oder auch Ribes für den medizinischen Gebrauch.»
«Aha, ja – schön, ein langer Name, aber schön … Ribes und so weiter», sagte Uchitsya.
«Ribes und so weiter», äffte Siegesbeck ihn nach. Unwissenheit und Desinteresse der Burschen gingen ihm auf die Nerven. Student Uchitsya war noch der Einzige, der eine gewisse botanische Neigung vermuten ließ. Die anderen studierten Botanik ja nur, weil es eine Voraussetzung fürs Medizinstudium war.
Siegesbeck forderte die Studenten auf, den botanischen Namen mit ihm zusammen im Chor aufzusagen. Uchitsya tat es. Die anderen klappten in der letzten Reihe nur die Münder auf und zu. Und Sopli besaß nicht einmal den Anstand, so zu tun, als würde er den Anweisungen seines Dozenten Folge leisten.
Eine Böe krachte gegen das Gewächshaus. Scheiben schepperten. Unterm Dach knirschte das Gebälk.
Siegesbeck nahm die Schrift aus der Mappe und hielt sie hoch. «Wie fundiert und klar im Ausdruck die bauhinschen Klassifikationen sind, haben Sie also gerade erfahren, meine Herren. Doch nun versucht ein Schwede – ich vermeide mit Absicht die Bezeichnung Wissenschaftler –, unter anderem die Nomenklatur, die botanische Namensgebung, zu reformieren. Was kommt dabei heraus? Das unwissenschaftlichste, widerlichste Geschmiere, das je aus der Feder eines Schreiberlings geflossen ist.»
Student Uchitsya nickte, die anderen schauten hierhin und dorthin. Sopli bohrte in der Nase.
Siegesbeck biss die Zähne zusammen, bis es knackte. Als Windgeheul und Regengetrommel eine Pause einlegten, dehnte er die Brust. «Ich muss Sie warnen, meine Herren. Das Machwerk ist ein von wollüstiger Hurerei getränktes Pamphlet. Ich bezweifle zwar, dass Sie moralisch und sittlich gefestigt sind, um gegen solche Obszönitäten gefeit zu sein, aber im Dienste der Wissenschaft muss ich Sie damit behelligen.»
Alle Studenten machten plötzlich große Augen. Sopli nahm sogar den Finger aus der Nase.
«Der Schwede – Gott verdamme ein Volk, das eine solche Kreatur hervorbringt! – vergleicht die Vermehrung der Pflanzen mit dem Beischlaf zwischen Mann und Frau. Staubblätter wären die Hoden, Blumenstaub der männliche Samen. Und in den Blüten soll es zugehen wie bei einer Hochzeit, wenn in einem Bett eine große Anzahl an Männern eine einzige Frau begattet.»
Siegesbeck bekreuzigte sich. Uchitsya machte es ihm schnell nach. Den anderen standen die Münder weit offen. Entsetzt sahen sie jedoch nicht aus. Im Gegenteil.
«Diese Unsittlichkeit darf man nicht weiter oder gar zu Ende denken», warnte Siegesbeck.
Da rumpelte es im Gewächshausdach. Regenwasser tropfte auf die Studenten herab. Sie merkten nichts davon, sondern hingen gebannt an Siegesbecks Lippen, wie Kinder einem Märchenonkel lauschten.
Gottes Zorn, dachte Siegesbeck und sagte: «Wenn also acht, neun, zehn, zwölf oder zwanzig oder noch mehr Männer in demselben Bett mit einer Frau gefunden werden, wenn Dirnen von verheirateten Männern begattet werden …» Er verstummte. Immer mehr Wasser pladderte herunter. Wind zischte durchs Gewächshaus. Der Wind musste ein Loch hineingeschlagen haben.
«Ja, was ist denn dann?», rief Sopli erregt. «Wie geht es dann weiter? Das will ich jetzt aber genau wissen.»
Diese überraschend entfachte Leidenschaft irritierte Siegesbeck. «Glaubt jemand von Ihnen etwa, dass Gott eine so verabscheuungswürdige Unzucht im Pflanzenreich eingerichtet hätte? Wie könnte ich der akademischen Jugend ein so unkeusches System darlegen, ohne Anstoß zu erregen und auf den Widerstand eines jeden Gelehrten und Studenten zu treffen?»
«Ach, egal», rief Sopli. «Ich will mehr davon hören. Wird in der Schrift der Vorgang des zwanzigfachen männlichen Begattens einer Frau ein bisschen detaillierter beschrieben? Diese Ausführungen sind sehr aufschlussreich …»
«Aufschlussreich?», entgegnete Siegesbeck. «Diese ketzerischen Gedanken findet der junge Herr aufschlussreich? Wenn Blüten und Pollen, wenn Staubblätter und Stempel, wenn das alles nichts anderes sein soll als die Genitalien von Huren und ihrer Freier?»
«Das ist doch mal ’ne nachvollziehbare Botanik», sagte Sopli. «Was für eine Vorstellung. Im Blütenstand herrscht ein Treiben wie im Hurenhaus.»
Die Studenten trampelten mit den Füßen und riefen: «Interessant ist das! Interessant!»
«Wie heißt der Schwede eigentlich?», fragte Uchitsya.
«Carl», knurrte Siegesbeck. «Carl Linnaeus heißt er.»
«Es lebe Linnaeus», riefen die Studenten. «Vivat Linnaeus! Es lebe Schweden! Es lebe die Botanik! Die Wissenschaft und Hurerei …»
Dann brach das Dach ein. Eine Lawine aus Glas, Holz und Steinen ergoss sich in das Gewächshaus. Wind brauste herein. Als der Staub sich legte, klaffte ein großes Loch im Dach, und das Wasser pladderte auf einen Schutthaufen, um den die Studenten verschreckt herumstanden. Aus dem Schutt schauten eine Hand und ein verdrehter Fuß heraus. Die Kommilitonen gruben Sopli frei, der aussah wie ein zerfleddertes Huhn.
Siegesbeck blickte zum zerstörten Dach hinauf und dachte: Gott hat mir ein Zeichen gesandt. Er faltete die Hände und sprach einen Psalm: «Herr, du bist gerecht, und gerecht sind deine Urteile.»
4.Die Göttin
Stenbrohult, 1715
Bevor Carl die Göttin Nemesis erschien, brach in Stenbrohult das Grauen in Gestalt eines hageren Burschen über sein Leben herein. Der Bursche hieß Johann Telander und stammte aus dem Nachbarort Diö. Carls Eltern stellten ihn als Hauslehrer ein. Er war ein sogenannter Informator, der ihrem Sohn die Grundkenntnisse in Latein, Sittenlehre und Geografie beibringen sollte, denn sie folgten unbeirrt ihrem Plan, der Erstgeborene müsse Pfarrer werden.
«Die Botanisiererei ist ja schön und gut, nun wird es aber allmählich Zeit für den Ernst des Lebens», verkündete Nils Linnaeus mit gewichtiger Miene.
Johann Telander war ein unförmiger junger Mann mit langem Gesicht, riesigen Ohren und spitzer Nase. Als Lehrer taugte er überhaupt nichts. Er war vor allem ein talentierter Sadist.
Im Pfarrhaus bezog er die Gästekammer und machte sich an sein grausames Werk. Er empfand eine unverhohlene Freude, seinen körperlich unterlegenen Schüler die Lateinvokabeln rauf- und runterkonjugieren zu lassen, bis Carl sich irgendwo zwischen cruciare, cruciat und cruciabor verhaspelte. Und wenn es kam, wie es kommen musste, ließ Telander den Lederriemen auf Carls nackten Hintern klatschen, dass es zwiebelte.
Der Unterricht war eine Qual. Carls Gebete an den lieben Gott verhallten ebenso ungehört wie seine flehentlichen Appelle an die Eltern, ihn aus den Klauen seines Peinigers zu befreien. «Er schlägt viel zu hart mit dem Riemen zu», klagte Carl.
«Hab dich nicht so», erwiderte der Vater.
Die Mutter war damit beschäftigt, das Töchterchen zu herzen, und sagte beiläufig: «So schlimm kann es gar nicht sein. Wir wissen doch, welch lebhaft-blumige Fantasie du hast, Carl. Und ein paar Prügel haben noch niemandem geschadet. Du musst nur eifrig lernen und Pfarrer werden wie dein Vater und dein Großvater. Nun fort mit dir! Deine Niedergeschlagenheit bedrückt ja unser kleines Mädchen.»
Des elterlichen Urvertrauens beraubt, zog Carl ab und leistete den Schwur, sich Telander selbst vom Hals zu schaffen. Wie, das wusste er noch nicht, aber irgendetwas musste geschehen, sonst brachte ihn Telander noch um mit den Vokabeln und Riemenschlägen.
In den unterrichtsfreien Stunden floh Carl in die Einsamkeit des Waldes. Immer tiefer hinein führte ihn sein Weg – fort vom Pfarrhof, fort von den unverständigen Eltern, fort von Telander. Zwischen Bäumen und Büschen, zwischen Blaubeergestrüpp und Kiefergeäst wurden seine Gedanken leichter, sein Kopf klarer. Eines Tages werde ich ferne Gegenden bereisen, dachte er. Ich werde Pflanzen, Tiere und Gesteine sammeln und erforschen. Sollen sich die Eltern daheim vor Sorgen ruhig die Augen ausheulen.
Auch an jenem schicksalsweisenden Sommertag war sein Kopf mit trübsinnigen Gedanken gefüllt. Er stromerte durch den Forst und lenkte sich mit Kräutersammeln ab. Unweit des Möckelnsees traf er auf eine Ente. Das Tier war hübsch anzusehen. Es hatte einen rotbraunen Kopf und eine rahmgelbe Blässe an der Stirn. Ihr Gefieder war blassgrau, der Bauch cremefarben. Die Ente blickte ihn an, stieß pfeifende wiu-wiu-wiu-Rufe aus und watschelte weiter. Carl stieg ihr durchs Unterholz nach, bis er an den Waldrand kam, wo hinter dichten Büschen die Böschung zum Ufer des Möckeln steil abfiel, der hier eine ihm unbekannte Ausbuchtung bildete. Die Ente glitt ins braune Wasser und paddelte durch die Seerosen davon.
Carl bog in dem Gebüsch ein paar Zweige auseinander, um bessere Sicht zu haben, als er unten am Ufer eine Frau auf einem Stein sitzen sah, die ihm ihre linke Seite zukehrte und mit den Füßen im Wasser plätscherte, und diese Frau war – nackt.
Carl stockte der Atem. Die Frau war tatsächlich so vollkommen nackt, wie er nie zuvor eine gesehen hatte, nicht einmal seine Mutter. Das strohblonde Haar fiel der Frau lang und offen über Schultern und Rücken. Ihr Körper war schlank und hell wie eine Birke, und ihre Brüste schienen weich wie Mooskissen zu sein.
Wie alt sie wohl war? Auf jeden Fall ziemlich alt, überlegte Carl. Vielleicht nicht so alt wie Mutter, aber doch bestimmt fast zwanzig Jahre alt, und sie war so unglaublich nackt und schön, dass Carls Mund trocken wurde wie eine Handvoll Sand in einer biblischen Wüste aus dem Prophetenunterricht.
Sie beugte sich über einen kleinen Strauch, zupfte eine rosafarbene Blüte ab und hob die Blüte an ihre Nase. Der Anblick, wie sie mit geschlossenen Augen den Duft einatmete, ging Carl durch Mark und Bein. Er liebte diese Blumen mit ihren zarten, hängenden Blüten, die so süß nach Vanille dufteten, dass es einem die Sinne vernebelte.
Auf dem Möckeln machte die Ente krr krkrkrr und pfiff ihre wiu-Rufe.
«Ne-me-sis», flüsterte Carl und dachte: Das muss sie sein – die Göttin, die die Pflanzen webt und die Welt erblühen lässt. Sie war aus dem Schoß der Erde emporgestiegen, um sich ihm, Carl, zu zeigen. Wenn er doch nur einen Blick auf ihr Gesicht werfen könnte! Er beugte sich vor, schob sich weiter in das Gebüsch über dem Abhang. Da trat er mit einem Fuß gegen eine Wurzel, die aus dem Boden ragte wie die Hand eines Untoten aus einem Grab. Er stolperte, verlor den Halt und stürzte ins Bodenlose, kullerte die Böschung hinunter, überschlug sich dabei mehrfach, rollte und rutschte gefährlich nah an scharfkantigen Steinen vorbei, bis er schließlich im Wasser landete.
Als er auftauchte, war die Göttin aufgesprungen, und er blickte in ihr blasses Gesicht. Schnell bedeckte sie ihren Körper mit einem Tuch. Ihre weit aufgerissenen Augen strahlten hell wie Sterne, und ihr Mund formte ein großes O.
Carl kroch aus dem Wasser und floh in die entgegengesetzte Richtung am Seeufer entlang.
Er rannte und rannte und war dabei von einer seltsamen Heiterkeit erfüllt, von einer aufbrausenden Hochstimmung, wie sein Vater sie vielleicht nach dem Genuss einiger Becher Medizin fühlte, kurz bevor er vom Stuhl kippte. An einer Stelle, an der die Böschung nicht so steil war, kletterte er hinauf und tauchte in den Wald ein. Bald hatte er die Orientierung verloren. Die Kleider klebten ihm nass am Körper, aber daran konnte er nicht denken, ebenso wenig an die Prügel, die ihm drohten, wenn er zu spät und tropfend wie ein Bündel Seegras nach Hause kommen sollte.
Nach längerer Suche stieß er auf einen Pfad, von dem er annahm, dass er zum Pfarrhaus führte. Erleichtert erkannte er das eine oder andere bemooste Felsgestein wieder. Und da – diese schiefe Kiefer, die hatte er doch auch schon mal gesehen. Er folgte dem Pfad eine Weile, als zwischen den Bäumen ein Schatten auftauchte.
Carl versteckte sich hinter dem Stamm einer umgekippten Buche und sah den Schatten näherkommen. Die Haut prickelte ihm vor Aufregung. Suchte etwa die Göttin nach ihm? Warum war er nur so ängstlich gewesen und fortgelaufen? Noch einmal durfte er sie nicht erschrecken.
Als der Schatten an dem Versteck vorbeilief, sah Carl, dass es nicht die Göttin war, sondern Telander, der es sehr eilig zu haben schien. Was hatte denn der Hauslehrer hier verloren? Als Waldspaziergänger und Naturfreund war er bislang nicht in Erscheinung getreten.
Carl zögerte und dachte an Vaters Weidenrute. Trotzdem siegte seine Neugier, und er folgte Telander. Bald darauf sah Carl ihn den Weg verlassen und im Unterholz verschwinden. Er schlich hinterher und stieß hinter dicht stehenden Tannen auf eine aus Brettern gezimmerte Hütte. Sein Herz pochte heftig. Er lugte durch die Tür. In der Hütte standen Gerätschaften herum: Eimer, Schalen, Fässer, Kessel, Kisten. Auf dem Boden lagen Tartuffeln. Ein scharfer Geruch stieg Carl in die Nase. Vaters Medizin!
Aus einer Ecke hörte er Geräusche und sah im Halbdunkel Telander aus einem Fass etwas in einen Becher zapfen. Dann nahm er einen Schluck davon und ließ ein anhaltendes Ahhh! hören. Hier also, versteckt im dunklen Tann, brannte Vater seine Medizin, und Telander, der Dieb, stahl sie.
Er füllte nach, setzte sich auf einen Schemel und streckte zufrieden die Beine aus, trank, rülpste, trank weiter, füllte wieder nach und trank, bis er mit dem Rücken gegen die Bretterwand sank. Mit einem Lächeln auf den Lippen schloss er die Augen und schlief ein.
Carl zog die Tür zu und lief zum Pfarrhaus.
Nils Linnaeus schaute durch das Fenster seines Arbeitszimmers nach draußen in den blühenden Garten, während er den Text aufsagte, den er der Gemeinde am nächsten Tag predigen wollte. Die Predigt handelte von einem Mann namens Onan, den man genötigt hatte, mit der Witwe seines verstorbenen Bruders ein Kind zu zeugen. Doch Onan hatte sich geweigert und seinen Samen lieber auf die Erde fallen und verderben lassen. Darüber war Gott sehr wütend geworden und hatte Onan getötet …
Der Vater drehte sich zu Carl um, der in der Tür stand und die Geschichte mit angehört hatte, ohne ihren Sinn zu verstehen. «Warum bist du nicht beim Unterricht?», fragte der Vater.
«Telander ist nicht hier», erklärte Carl. «Zufällig war ich gerade im Wald und habe gesehen, wie er in eine Hütte gegangen ist.»
Vaters Gesicht straffte sich. «In eine Hütte? Welche Hütte?»
«Eine einsame Hütte, irgendwo im Wald.» Carl deutete in die Richtung, aus der er gekommen war.
«Hast du in der Hütte irgendetwas gesehen?»
«Nein, ich sah nur Telander hineingehen», ließ Carl sich zu einer Notlüge hinreißen. Es gefiel ihm nicht, dem Vater nur die halbe Wahrheit zu erzählen. Sein Gefühl sagte ihm aber, dass es geschickter war, dem Vater nicht zu offenbaren, dass er dessen Geheimnis herausgefunden hatte.
Nils Linnaeus nickte nachdenklich, schweigend, und sein Kiefer mahlte.
Als der Abend dämmerte, sah Carl durch das Fenster seiner Dachkammer Vater und Telander aus dem Wald kommen. Telander schwankte, stolperte am Gartentor über seine eigenen Füße und fiel hin, Tränen liefen ihm über die Wangen. Vater zog ihn hoch und stieß ihn unsanft durch den Garten zum Pfarrhaus, wo er ihn in die Gästekammer sperrte, die Tür zuknallte und abschloss.
Carl hörte seine Mutter nach dem Grund für den Lärm fragen, woraufhin Vater erwiderte, er werde den Lump morgen früh freilassen, mehr sei dazu nicht zu sagen. Im Pfarrhaus wurde es still.
Carl legte sich ins Bett und dachte an die Göttin. Vielleicht war sie es gewesen, die ihn auf Telanders Spur gebracht hatte? Ja, ohne sie wäre er dem Dieb doch gar nicht auf die Schliche gekommen. Nemesis, die Göttin der Rache. Die Göttin seiner Rache. Carl musste sie unbedingt wiedersehen, um ihr für ihre Hilfe zu danken. Zufrieden schlief er ein.
Am nächsten Tag predigte Nils Linnaeus in der Kirche von den Sünden des Onan. Nach dem Gottesdienst holte er Telander aus der Gästekammer und sprach sein Urteil: Telander müsse das Pfarrhaus unverzüglich verlassen, und er solle sich hüten, auch nur ein Sterbenswörtchen über eine Knollenbrennerei im Wald zu verlieren. Sonst werde er Telander des Diebstahls bezichtigen. Außerdem habe der Informator dem lieben Carl ganz übel mitgespielt; man könne ihn daher wegen unverhältnismäßig grausamer Züchtigung drankriegen.
Telander sah so unglücklich aus, dass er Carl ein bisschen leidtat. Jahre später sollte Carl von seinem Vater erfahren, dass Gott den Hauslehrer ebenso hart bestraft hatte wie diesen Onan: Telander war beim Bierbrauen in den Kessel gefallen und zu Tode gekocht worden.
Zu Carl sagte der Vater: «Und dich, mein Sohn, werden wir auf eine Schule schicken. Einem Besuch der Trivialschule in Växjö steht nichts mehr im Wege.»
«Växjö?», fragte Carl entsetzt. Über diese Stadt wusste er nur, dass sie unendlich weit entfernt war, also fast schon im Ausland, und da herrschte Krieg. Außerdem musste er doch die Göttin wiedersehen.
«Jawohl, Växjö», bestätigte Vater in einem Tonfall, der keine weiteren Fragen duldete.
5.Ein Meisterwerk
Sankt Petersburg, 1736
Der Sturmwind heulte durchs eingestürzte Gewächshausdach, unter dem die Studenten um den von den herabgefallenen Trümmern verletzten Sopli herumstanden. Sopli heulte Rotz und Wasser und drohte, sein Vater, ein ranghoher städtischer Beamter, werde diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die dieses marode Gewächshaus gebaut hatten. Siegesbeck versorgte notdürftig Soplis Wunden, dann brachten ihn seine Kommilitonen ins Hospital.
Beinahe hätte sich Siegesbeck von der düsteren Stimmung mitreißen lassen, als ihm ein Gedanke kam, zunächst nur ein Geistesblitz, eine vage Idee, die in seinem Kopf aber schnell zu einem Plan heranreifte.
Er kehrte mit der Schrift des Schweden in seine Kammer zurück, zündete eine Kerze an und nahm mit Tintenfass, Feder und Papier am Tisch Platz. Er schrieb und schrieb, schlief kaum in den nächsten Tagen, aß nur das Nötigste, das greifbar war, und das war das aus Pflanzenhäckseln und Erbsen- und Leinsamenmehl gebackene Pferdebrot, das er aus einem Trog auf dem Hof stibitzte, wenn niemand in der Nähe war. Das Brot war hart wie Holz, und es schmeckte auch so.