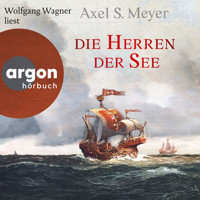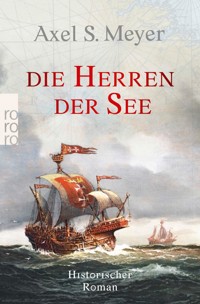9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein faszinierender Roman über die großen Pioniere der Luftfahrt Otto Lilienthal und Graf von Zeppelin. Zwei Männer machen sich im 19. Jahrhundert auf, den Himmel zu erobern. Im pommerschen Städtchen Anklam sucht der junge Otto Lilienthal Zuflucht in der Natur. Als er in den Niederungen den Flug der Störche beobachtet, keimt in ihm der Wunsch, selbst einmal wie ein Vogel fliegen zu können. Unterdessen wächst Ferdinand Graf von Zeppelin als Spross einer Adelsfamilie bei Konstanz am Bodensee auf. Schon früh interessiert er sich für Technik und Mechanik, muss sich aber den Wünschen seines Vaters fügen und schlägt zunächst eine Militärkarriere ein. Und doch hält er an seinem großen Traum fest, eines Tages ein mächtiges Luftschiff zu bauen. Zwei Männer, besessen von dem uralten Traum des Fliegens, die in einem Fernduell um die Herrschaft der Lüfte ringen. Von ihren Mitmenschen als Fantasten verspottet, lassen sie sich nicht beirren, auch wenn es zunächst scheint, als würden ihre Kritiker recht behalten … Eine unterhaltsame Verbindung von Fakten und Fiktion, kenntnisreich und mit opulentem Zeitkolorit erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Axel S. Meyer
Der Sonne so nah
Roman
Über dieses Buch
Zwei Genies, die Welten trennen.
Vereint durch den Traum vom Fliegen.
Zwei Männer machen sich im 19. Jahrhundert auf, den Himmel zu erobern. Im pommerschen Anklam sucht der junge Otto Lilienthal Zuflucht in der Natur. Als er in den Niederungen den Flug der Störche beobachtet, keimt in ihm der Wunsch, selbst einmal wie ein Vogel fliegen zu können.
Unterdessen wächst Ferdinand Graf von Zeppelin als Spross einer Adelsfamilie am Bodensee auf. Schon früh interessiert er sich für Technik und Mechanik, muss sich aber den Wünschen des Vaters fügen. Und doch lässt ihn der Gedanke nicht los, eines Tages ein mächtiges Luftschiff zu bauen.
Zwei Männer, besessen vom uralten Traum des Fliegens. Von ihren Mitmenschen verspottet, lassen sie sich nicht beirren, auch wenn es zunächst scheint, als würden ihre Kritiker recht behalten …
Ein faszinierender und unterhaltsamer Roman über die großen Pioniere der Luftfahrt Otto Lilienthal und Graf von Zeppelin.
Vita
Axel S. Meyer, 1968 in Braunschweig geboren, studierte Germanistik und Geschichte. Heute lebt er in Rostock, wo er als Redakteur der Ostsee-Zeitung tätig ist. Bei Rowohlt hat er bereits mehrere historische Romane veröffentlicht, darunter die erfolgreiche Reihe um den Wikinger Hakon und zuletzt den Roman «Der Mann, der die Welt ordnete» über den schwedischen Naturforscher Carl von Linné.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2023
Copyright @ 2023 by Axel S. Meyer und Rowohlt Verlag GmbH
Redaktion Katharina Rottenbacher
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung Zeichnung von Graf F. von Zeppelin/Deutsches Patent- und Markenamt; Smithsonian Institution/Bridgeman Images; INTERFOTO/Mary Evans; Archiv any.way
ISBN 978-3-644-01102-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vieles in diesem Roman hat sich so zugetragen. Manches vielleicht. Einiges entspringt dem Reich meiner Fantasie.
Axel S. Meyer
Für Hans-Ludwig Meyer,
den leidenschaftlichen Flieger
Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht kein körperlicher Flügel sich gesellen.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust
Es kann Deines Schöpfers Wille nicht sein,
Dich, Ersten der Schöpfung,
dem Staube zu weih’n,
Dir ewig den Flug zu versagen.
Otto Lilienthal
Man muss nur wollen und dran glauben,
dann wird es gelingen.
Graf Ferdinand von Zeppelin
Prolog
Von Hugo E. Aves
Berliner Lokal-Anzeiger, Central Organ für die Reichshauptstadt, Montag, 8. August 1894
Wer einen Verrückten sehen will, der sollte nach Groß-Lichterfelde gehen. Hier hat sich der Ingenieur Otto Lilienthal, der glaubt, er könne fliegen wie ein Vogel, aus Sand einen fünfzehn Meter hohen Berg aufschütten lassen. Man kann den modernen Ikarus sehen, wie er mit zwei mächtigen Flügeln auf der Schulter den Berg hinaufsteigt, um sich dann mit den Flügeln wieder hinabzubewegen. Halb schwebend, halb laufend gelangt er oft nur bis zur Mitte des Abhangs, dann klappen die Flügel zusammen.
Der Berichterstatter kann als Augenzeuge bestätigen, dass Lilienthal nur ein einziges Mal über den Fuß des Hügels hinausglitt, und zwar bis zu einer großen Pfütze, in die er hineinstürzte. Die Flügel brachen entzwei, der Fliegende verletzte sich empfindlich.
Die Zuschauer, die wie immer zahlreich an dem Berg erschienen waren, lachten und buhten und beklatschten den Vogelflieger, der, das muss man wohl so sagen, glücklicher als sein sagenhaftes Vorbild Ikarus nur in eine Pfütze und nicht ins Meer fiel. Lilienthal bekümmerte das Missgeschick nicht. Nass, wie er war, stieg er, ein bisschen humpelnd, den Berg wieder hinauf und holte aus einem in die Bergspitze eingebauten Lagerschuppen neue Flügel. Dann fuhr er fort mit seinen Jahrmarktkunststückchen, bis die Dunkelheit anbrach. Die Zuschauer gingen nach Hause und ließen ihr Stullenpapier am Berg liegen; man wird noch lange etwas zu erzählen und zu lachen haben.
Der Berichterstatter möchte dem Ikarus alles Gute wünschen, damit er eines Tages nicht doch zu hoch hinausfliegt und ihn das Schicksal des gefiederten Sagenhelden ereilt. Aber diese Gefahr scheint nicht zu bestehen, denn dafür müsste Lilienthal ja richtig fliegen können. Was jedoch niemals der Fall sein wird, denn die allermeisten Experten sind sich einig, dass die Eroberung des Luftozeans dereinst allenfalls mit einem anderen Gefährt gelingen kann: dem lenkbaren Luftschiff.
I. TeilAm Boden
1847–1871
1.Auf dem Mond
Schloss Girsberg, 1847
«Flieg endlich, bleedes Vogelding – flieg, flieg, flieg!»
Der Junge galoppierte auf seinem Pony über die frisch gemähte Wiese hinter Schloss Girsberg und schrie seinen Ärger raus. In der einen Hand hielt er den Zügel, in der anderen eine Schnur, an deren Ende ein aus Papier und Holzstäben gebastelter Drachen durch die Luft taumelte wie eine sturzbetrunkene Möwe.
Am Rande der Wiese, in sicherer Entfernung zu dem aufgebrachten Buben und den wirbelnden Ponyhufen, standen bei einem Heuhaufen zwei weitere Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die die Szenerie beobachteten. Der wütende Reiter war neun Jahre alt und hieß Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, genannt Ferdi. Der andere Junge war sein jüngerer Bruder Eberhard, das Mädchen hieß Adelina. Sie war ein Jahr älter als Ferdinand und, wenn man so wollte, der Grund für dessen zornige Raserei: Eigentlich wollte Ferdinand ihr nämlich mit dem Drachen imponieren. Adelina war die Tochter einer Tante mütterlicherseits, also seine Cousine, sie war wunderschön und das tapferste Mädchen, das er kannte, was er natürlich nie zugeben würde, nicht einmal unter der Folter.
Man schrieb das Jahr 1847. Adolph Menzel malte den unaufhaltsamen, technischen Fortschritt jener Zeit in Gestalt eines dampfenden Eisenbahnzugs und gab dem Gemälde den Titel Die Berlin-Potsdamer Bahn. In München brannte der Hauptbahnhof ab. Auf dem nordamerikanischen Michigansee ging der Raddampfer Phoenix in Flammen auf. Das britische Kriegsschiff HMS Driver schipperte rund um die Welt. Jesse James machte noch in die Windeln, auch der Pazifist und Sozialethiker Moritz von Egidy wurde geboren, der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy machte seinen letzten Atemzug, ebenso Jeanne Labrosse, die erste Ballonfahrerin und Fallschirmspringerin der Welt. In Irland und in anderen Gegenden verfaulten die Kartoffeln in der Erde und Hafer und Weizen am Halm; viele Menschen litten Hunger, eine Million Tote, überall in Europa stiegen die Lebensmittelpreise.
Währenddessen war auf der Wiese bei Schloss Girsberg am Bodensee Graf Ferdinand der Verzweiflung nahe. Schon ritt er im vollen Galopp auf das Birkenwäldchen zu, ohne dass der Drachen auch nur ansatzweise das tat, was er tun sollte: fliegen. Zwar stieg er wohl ein paar Meter in die Luft auf, kippte aber gleich wieder zur Seite ab, drehte sich im Kreis, schlug Kapriolen, bockte, zickte, schlug Haken und krachte schließlich mit der Spitze voran auf den Erdboden. Der Drachen wurde hinter dem Pony hergeschleift, dabei zerbrachen die Holzstäbe, das Papier zerriss, die Schnur verhedderte sich.
Und das war’s dann auch. Am Birkenwäldchen hielt Ferdinand das Pony an. Sein Gesicht war rot wie eine reife Tomate. Wütend sprang er vom Pony herunter und lief zu den Überresten des Drachens. Er hatte ihn in mühevoller Kleinarbeit zusammengebaut in der Absicht, Adelina, die heute mit ihren Eltern zu Besuch auf Schloss Girsberg war, zu beeindrucken. Und jetzt war der Drachen ein zerfetztes Knäuel aus Holz, Papier und Schnur und Ferdinand blamiert bis auf die Unterhose.
«Dein Drachen ist doch ein bisschen geflogen», tröstete ihn Klein Eberhard, der mit Adelina herbeigelaufen kam. Eberhard war erst fünf und verehrte den großen Bruder wie einen Gott.
«Na ja», meinte Adelina, «geflogen würde ich das nicht unbedingt nennen. Du solltest warten, bis Wind aufkommt, Ferdi. Im Moment weht doch kein Lüftchen.»
«Jetzt ist das bleede Ding eh nicht mehr zu gebrauchen …», knurrte Ferdinand, der bemüht war, seinen Zorn zu unterdrücken. Immerhin war er ein Graf und wusste, wie man sich im Beisein einer Dame zu verhalten hatte, und unkontrollierte Wutausbrüche gehörten nicht dazu.
Ein solches Feingefühl ließ Ferdinands Vater vermissen, als er in diesem Augenblick lärmend durchs Unterholz im Birkenwäldchen zwischen der Wiese und dem Schloss brach. Kaum war er bei den Kindern angelangt, zeterte er los: «Ja, zom Donndrweddr abbr au! Hier seid ihr. So an Lombagruschd, so an verregta!» In seinen Augen hatte Adelina wahrscheinlich noch nicht den Status einer Dame erreicht. Der Vater hieß mit vollem Namen Friedrich Jerôme Wilhelm Karl Graf von Zeppelin, genannt: Fritz, wie der Alte Fritz, der Preußenkönig. Was in Gegenwart des Grafen aber niemand erwähnen durfte, denn er war ein aufrechter Württemberger, einer, dem der Stolz aufs Vaterland aus jedem Knopfloch leuchtete und der die Preußen aufs Blut hasste.
Graf Fritz von Zeppelin – vierzig Jahre alt, fürstlich-hohenzollernscher Hofmarschall und reicher Baumwollfabrikant – bot eine plumpe Erscheinung: kleiner Wuchs und ein Gesicht wie ein blasiger Pfannkuchen mit Kartoffelnase. Vor einigen Jahren war er mit den Kindern, zu denen auch Tochter Eugenia gehörte, und seiner Frau Amélie Françoise Pauline, eine geborene Macaire d’Hogguèr, von Konstanz aufs Schloss Girsberg gezogen, das ihnen Amélies Vater, der Fabrikant und Bankier David Macaire d’Hogguèr, zu Weihnachten geschenkt hatte. Es war ein prächtiges und, wie Fritz meinte, seiner Stellung angemessenes Anwesen: ein großes Herrenhaus im Stile des Klassizismus mit einer uralten Eiche davor und einer breiten Auffahrt, mit Nebengebäuden fürs Gesinde, mit Dienern, Köchen, Gärtnern, sowie weitläufigen Ländereien für Ackerbau und Viehzucht.
Ja, hier ließ es sich gut leben, vorausgesetzt, alles lief so, wie Fritz wollte, dass es lief. Und dass die Bagasch sich ohne ordnungsgemäße Abmeldung aus dem Haus gestohlen hatte, war eine Unverschämtheit, eine Ovrschemdheit. Somit endete Ferdinands erster und einziger Drachenflugversuch damit, dass der gräfliche Hofmarschall die abtrünnigen Söhne an den Ohren gepackt durchs Wäldchen zum Schloss zurücktrieb wie Vieh. Adelina und das Pony trotteten hinterdrein.
Später am Abend saßen Ferdinand, Klein Eberhard und ihre elfjährige Schwester Eugenia mit ihrer Mutter Amélie auf dem Kanapee im herrschaftlichen Wohnzimmer. In Amélies Schoß lag das Buch, aus dem sie den Kindern eine Gutenachtgeschichte vorlas. Onkel, Tante und Adelina waren abgereist, der Ärger des Vaters fast verraucht und Ferdinands Herz schwer wie ein Klumpen Eisenerz. Noch immer trauerte er der verpassten Gelegenheit nach, Adelina mit dem Drachen zu beeindrucken. Sie liebte Vögel, besonders Steinadler, die Könige der Lüfte. Ewigkeiten konnte sie im Gras liegen, die Hände hinterm Kopf verschränkt, einen Grashalm zwischen den Lippen, und zusehen, wie so ein majestätischer Vogel mit ausgebreiteten Schwingen am Himmel kreiste. «Fliegen müsste man können», hatte sie einmal gesagt und so ergriffen geseufzt, dass Ferdinand die Haut kribbelte. «Ja – fliegen», hatte er zugestimmt.
Ganz warm war ihm ums Herz geworden. Adelina neben ihm im weichen Gras, das seine Wangen streichelte, umwölkt vom Duft des Frühlings und Adelinas Haut und Haar, und hoch über ihnen schwebte ein Steinadler unter der Sonne. Vielleicht wurde hier der Wunsch in ihm geboren, eines Tages selbst in die Lüfte aufzusteigen. Aber vielleicht hing es ja auch mit einer anderen Gelegenheit zusammen: mit der Geschichte, die Amélie an jenem Abend nach dem misslungenen Drachenflug ihren Kindern vorlas.
Über Ferdinands Vater, der in seinem Ledersessel versunken an der Pfeife nuckelte, stiegen blaue Rauchkringel auf und schwebten hinauf zu der hohen, mit Stuck verzierten Zimmerdecke. In der Ecke tickte die Standuhr. In dem mit goldenen Säulen eingefassten Kamin knackten brennende Holzscheite, und auf dem Sims starrten kostbare, aus Elfenbein geschnitzte Elefanten in einen riesigen Spiegel, der das Wohnzimmer noch größer erscheinen ließ.
Amélie schlug das Buch auf. Klein Eberhard gähnte, Eugenia popelte, und Ferdinand kuschelte sich an Amélies weiche Hüfte. Er liebte seine Mutter. Diese Liebe begründete sich auf dem Gefühl von Geborgenheit und Urvertrauen, es gab nichts, das diese reine Liebe hätte trüben können, auch nicht die körperlichen Veränderungen, die Amélie seit einiger Zeit durchmachte, seit ihr Leib begann, sich ins Uferlose zu dehnen. Im Gegenteil, je breiter sie wurde, desto inniger wurde Ferdinands Zuneigung zu ihr. Jeden, der es gewagt hätte, seine Mutter aufgrund ihrer Leibesfülle zu beleidigen, den hätte er vermöbelt. Zumindest hätte er es versucht, er war ja nicht der Stärkste, sondern körperlich eher unterer Durchschnitt in seiner Altersklasse, was bisweilen gehörig an seinem Ehrgefühl kratzte.
Den Grund für Amélies Veränderung kannte niemand, kein Arzt, kein Heiler, kein Alchemist. In ihrer Kindheit hatte sie unter einer Herzschwäche gelitten und war mit Pulver, Medizin und Ziegenmilchkuren behandelt worden. Kaum war ihr Herz geheilt, drohte sie zu erblinden, erlangte aber auf wundersame Weise ihre Sehkraft zurück. Schlank wie ein Schilfrohr war sie damals gewesen, man rief sie im Scherz Hopfenstange. Dann war ihr im Alter von siebzehn Jahren Fritz über den Weg gelaufen und hatte sich in die Hopfenstange verliebt. Und er liebte Amélie auch noch, als sich ihre Taille wölbte und die Leibesfülle sie in ihren Bewegungen einschränkte. Obwohl ihr das Körpergewicht auf Gelenke, Geist und Gemüt drückte, ließ sie sich zu Scherzen hinreißen: Es sei ihre Wohlbeleibtheit, die ihr eine morgenländische Trägheit verleihe, aber ihr Herz und Geist würden immer wach und lebendig bleiben.
Wach und lebendig war auch ihre Stimme, mit der sie den Kindern die Geschichte vorlas. Die Geschichte hieß Das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfaall und handelte von ebenjenem Hans Pfaall aus Rotterdam, einem trunksüchtigen Blasebalgflicker und dreifachen Mörder, der mit einem selbst gebauten Heißluftballon zum Mond aufstieg. Während der Fahrt umschloss er den Ballonkorb mit einem luftdichten Kautschuksack, denn je höher er aufstieg, umso mehr nahm die Konzentration der Luft ab. Unterwegs führte er Experimente mit einer Katze und einer Taube durch, um zu beweisen, dass zwischen Erde und Mond kein Vakuum besteht. Auf dem Mond traf er auf kleine, ausgesprochen hässliche Leute. Weil Hans Pfaall wegen seiner Verbrechen in Rotterdam von der Gendarmerie gesucht wurde, schickte er einen der kleinen Mondbewohner als Boten mit dem Ballon auf die Erde hinunter. Das Männchen teilte dem in Scharen herbeilaufenden Volk mit, wenn man Hans Pfaall Straffreiheit gewähre, wolle dieser das Kollegium der Astronomen an seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen von der Ballonfahrt teilhaben lassen …
Ausgerechnet an dieser Stelle ergriff Ferdinands Vater im Sessel das Wort: «Was liest du den Kindern für einen Unfug vor, Amélie? Eine Ballonfahrt auf den Mond? Kleine, hässliche Männchen? Das sind Ammenmärchen! Davon will ich nichts mehr hören, die Kinder kriegen noch Albträume.»
Amélie klappte das Buch zu. Ferdinand sollte also nicht erfahren, ob der Mörder Hans Pfaall begnadigt wurde oder nicht. Später lag er hellwach im Bett und starrte durchs Fenster hinaus zum Mond, der über dem schwarzen Schattenriss der Baumkronen wie ein hell erleuchteter Silbergroschen am Nachthimmel hing. Und wie Ferdinand so dalag und starrte, wartete er auf ein Zeichen. Auf eine Bewegung am Himmel. Einen huschenden Schatten auf dem Mond. Irgendetwas, das Vaters Behauptung, die Geschichte von Hans Pfaalls Ballonfahrt sei ein dummes Märchen, als Irrtum entlarvte. Irgendwann übermannte ihn der Schlaf, und seine Gedanken flossen in einen Traum: Er schwebte in einer mit Kautschuk umhüllten Gondel durchs Weltall, umgeben von Millionen Sternen in endlosen Weiten, begleitet wurde er weder von einer Katze noch von einer Taube, sondern von einem Mädchen. Von Adelina.
2.Revolution
Anklam, 1847–1848
Phytophthora infestans liebte es dunkel und warm und feucht, und er nistete sich im Erdboden ein, wo er seinen Wirt fand, die Kartoffel. Die Knollen boten dem Parasiten Nahrung, sie gaben ihm ein Zuhause, den Nährboden für Wachstum und Vermehrung. Phytophthora infestans war ein Pilz und sein Feldzug ein einziger Erfolg – ein Triumphmarsch, der in Nordamerika begann, zunächst schleichend, dann immer schneller und mit ungezügelter Kraft. In den Sommermonaten breitete er sich rasanter aus als die Menschen, von denen in jenen Jahren Millionen mit Schiffen aus Europa in die Neue Welt reisten. Hier bescherte dieser listige, kleine Parasit den Menschen einen gebührenden Empfang. Er vernichtete ihre Ernten, hinterließ Hunger, Elend und Tod. Dann wanderte er zu den Häfen an der Ostküste, schlich – versteckt im Knollengewebe der Kartoffeln – auf die Schiffe und reiste dem Strom der Auswanderer entgegen in ihre alte Heimat. Nach Europa.
Er kam nach Flandern. Nach Irland. Nach Württemberg. Mit einer einzigen befallenen Knolle infizierte der Pilz ganze Äcker. Ach, du schönes Parasitenleben! Man machte es ihm leicht. Die Böden waren ausgelaugt durch die intensive Bewirtschaftung, kraftlos dem Feind ergeben, nichts war mehr in der Erde, was die Ausbreitung des Parasiten hätte eindämmen können. Nun verdarben auch in Europa die Ernten, die Lebensmittelpreise stiegen, Menschen verhungerten. Wagenladungen voller klapperdürrer, ausgezehrter Gestalten verreckten wie die Fliegen. Fielen einfach um, und das war’s dann.
Im Jahr 1846 drang der fleißige Phytophthora infestans bis nach Preußen vor. Das Wetter war herrlich. Im Frühjahr öffnete der Himmel alle Schleusen, und es schüttete aus vollen Kübeln. Dann kam die Trockenheit. Und die Hitze. Der Pilz liebte das Wetter, und er schickte seine Sporen aus, seine Kavallerie, ganze Armeen davon. Sie fielen über die Feldfrüchte her. Die Kartoffeln, die einst der Alte Fritz, der große Preußenkönig, selig, dem Volk untergejubelt hatte, faulten, vergammelten, wurden von Phytophthora infestans’ Heerscharen zerfressen. Ernten fielen aus. Essen wurde Luxus. Das Volk litt, und es grummelte und rumorte, begann zu brodeln, zu beben.
Dann kam das Jahr 1847, der Hungerwinter.
Berlin war das pulsierende Herz Preußens. Die Stadt war ein Moloch, übervölkert, es stank wie in einer Kloake. Arbeit war knapp, die Löhne waren niedrig, wenn überhaupt welche gezahlt wurden. Auf den Straßen bettelten Arbeitslose um Almosen, gruben im Abfall nach Essen. Die Mägen waren leer. Der Hunger entfachte die Wut. Es kam zu Pöbeleien, Schlägereien. Läden wurden überfallen, Bäckereien und Marktbuden geplündert. Doch die Herrschenden schlugen zurück. Drängten den Pöbel mit eiserner Gewalt in seine Löcher, Keller und Hütten.
1848 baute sich ein neuer Sturm auf.
In Frankreich stiegen Handwerker, Industriearbeiter und Studenten auf die Barrikaden. Der französische König dankte ab, und eine solche Nachricht blieb natürlich auch in Berlin nicht ungehört. Was die Franzosen schafften, konnten die Preußen schon lange. Die Menschen krochen aus ihren Löchern, strömten wie Ratten in die Rinnsteine und Straßen. Öffnet die Kornkammern, forderten sie. Freiheit! Freiheit für die Rede! Für die Presse! Für das Volk!
Im Berliner Schloss auf der Spreeinsel tupfte sich König Friedrich Wilhelm IV. den Schweiß von der hohen Stirn. Das Volk dürfe nie souverän werden, jammerte er, sonst zerbreche seine Krone, und es folge ein Jahrhundert des Aufruhrs. Dabei wolle er immer nur das Beste, doch sein undankbares Volk sei unersättlich. Da konnte er noch so viele Zugeständnisse machen – weniger Zensur, Amnestien politisch Verfolgter und anderen liberalen Unsinn –, der Pöbel verlangte mehr, mehr, mehr. Friedrich Wilhelm rang die Hände und flehte: «Oh Gott, meine Nerven, meine armen, strapazierten königlichen Nerven. Oh Gott, hast du mich verlassen?»
Schon rottete sich vor dem Schloss die Meute zusammen und stürmte gegen das Portal. Soldaten zogen Säbel, Schüsse lösten sich. Panik ergriff den Pöbel. Man floh. Man hielt inne. Man sammelte sich erneut. Arbeiter, Gesellen, Arbeitslose, Schüler, Tagelöhner. Sie plünderten Zeughaus und Waffenlager, hoben Gräben aus. In den Straßen türmten sich die Barrikaden drei Stockwerke hoch. Steine flogen, Schüsse knallten, Kanonen donnerten. Berlin versank in Pulverdampf und Feuerrauch. Berlin ertrank im Blut.
Der König schwankte zwischen Diplomatie und militärischer Härte, zwischen Verhandlung und Vergeltung. Dann gab er nach. Der Qualm verzog sich. Die Aufständischen karrten die Leichen ihrer Genossen auf die Spreeinsel vors Schloss und gaben erst Ruhe, als der König sich dem Volkswillen beugte. Er verneigte sich vor den Leichen und kündigte, wieder einmal, Reformen an, und er knirschte mit den Zähnen, als man oben auf der Schlosskuppel diese gottverdammte Fahne hisste. Diese Fahne in den Farben Schwarz und Rot und Gold. Wartet nur, dachte er grimmig, wartet nur, ihr Parasiten!
Die Berliner sangen: «Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme!»
Und der König dampfte vor Groll.
Auch in der preußischen Kleinstadt Anklam, nördlich von Berlin gelegen, erhob im Schankraum von Böhmers Hotel ein Mann die Faust und sang: «Zum Kampfe denn, zum Kampfe jetzt, der Kampf nur gibt die Weihe!»
Der Saal war proppenvoll mit erhitzten Fischern, Bauern, Handwerkern, Tagelöhnern und Torfstechern und erfüllt von Tabakqualm und Alkoholdunst. Die Männer grölten: «Und kehrst du rauchig und zerfetzt, so stickt man dich aufs Neue! Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme!»
Der Vorsänger heizte die Stimmung an. Sein Name war Gustav Lilienthal. Er verdiente sein Geld als Tuchhändler in Anklam, einer Stadt mit einigen Tausend Einwohnern, die zum Beten in die Marienkirche oder die Nikolaikirche und zum Vögeln nach Hause gingen. An Anklam floss der Fluss Peene vorbei ins Haff. In den Peeneniederungen wurde Torf gestochen. Windmühlen mahlten Mehl. In Öfen brannten Kalk und Tontöpfe. Anklam war Provinz, von Sumpf und Morast umzingelte Provinz und Berlin weiter weg als der Mond. Doch Gustav Lilienthal sorgte dafür, dass die revolutionären Beben aus der Hauptstadt auch in Anklam ihr Echo fanden. Gustav Lilienthal, der Unruhestifter; die Gutsherren hassten ihn wie die Kartoffelfäule.
Lilienthal leerte den Krug in einem Zug. Bier schwappte über seine Lippen, sickerte in seinen Bart und tropfte auf sein Hemd. So kannte man ihn. Beim Trinken machte ihm niemand etwas vor. Er war Anfang dreißig, ein großer und kräftiger Mann. Seine Vorfahren waren im Dreißigjährigen Krieg aus Schweden nach Vorpommern eingewandert. Er hatte Schultern wie ein Ochse, sein Gesicht die Farbe eines frisch geräucherten Schinkens. Seine Nase war krumm und schief. Sein bester Freund und Zechkumpan, der Torfstecher und Freizeitdichter Max Burwitz, hatte ihm die Nase im Streit gebrochen. Lilienthal hatte sich revanchiert und Burwitz zwei Zähne ausgeschlagen. Damit war die Sache aus der Welt.
Eigentlich war Lilienthal ein stiller, nachdenklicher Mann, der gerne seine Pfeife rauchte. Eingehüllt in Wolken aus Tabakqualm, löste er Rechenaufgaben oder erfand technische Geräte, die so fantastisch waren, dass bislang keine seiner Zeichnungen den Weg vom Papier in die praktische Umsetzung gefunden hatte.
Wenn aber Teufel Alkohol sich seiner bemächtigte, was häufig vorkam, veränderte sich sein Wesen, dann häutete er sich, dann wurde er zum Werwolf, dann lief er zu großer Form auf. Er zockte in Böhmers Hotel mit Würfeln und Karten, bis sein Geld verspielt war, und er hielt Reden und blies den Herrschenden den Marsch. Auch an diesem Tag, dem 23. Mai 1848, hatte er schon mächtig was intus, Bier und Schnaps, was halt gerade serviert wurde.
Jemand reichte ihm einen vollen Becher Bier. Mit der freien Hand stützte er sich am Tisch ab und rief: «Sie müssen uns – dem Volk! – das volle Stimmrecht gewähren! Alle Herrenrechte müssen aufgegeben werden! Freie Jagd, Fischerei und Krebserei für alle! Saat und Brot für die Bauern! Und die Gutsherren, diese Ausbeuter, die setzen wir auf Hungerdiät!»
Jubel brandete auf. Der Schankraum schwitzte kollektiv in revolutionärer Erregung. Nüchtern war hier niemand mehr. Die Männer prosteten Lilienthal zu, lobten ihn für die kämpferischen Worte. Da war es auch egal, dass er bei jedem Gelage eigentlich immer dasselbe sagte.
Der ganze Saal sang: «Am Montag aßen wir wenig, und am Dienstag aßen wir nicht. Und am Mittwoch mussten wir darben, und am Donnerstag litten wir Not, und ach, am Freitag starben wir fast den Hungertod! Drum lass am Samstag backen, das Brot fein säuberlich – sonst werden wir sonntags packen und fressen, oh König, dich …»
Plötzlich flog die Saaltür auf. Eine Horde Männer stürmte herein: stämmige, muskulöse Kerle, die mit Knüppeln bewaffnet waren. Man kannte sie. Es waren die Knechte des Gutsherrn Güldenpenning, loyaler Anhänger der Monarchie und Verfechter der Leibeigenschaft. Der Gutsherr hatte sich selbst zum Anklamer Außenposten des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm ernannt und fühlte sich berufen, alle revolutionären Auswüchse im Keim zu ersticken. Nicht zum ersten Mal schickte er seine Schläger in Böhmers Hotel.
Der Schankraum versank im Chaos. Die Zechbrüder waren zwar in der Überzahl, deutlich sogar, aber sie waren betrunken und unbewaffnet. Geschrei und Gestöhne. Holz splitterte, Lippen platzten, Knochen brachen.
Güldenpennings Knechte prügelten eine Schneise durch den Saal. In ihrem Fahrwasser schwamm der Gutsherr höchstselbst dahin, ein fetter Mann, mit Doppelkinn, das Gesicht glänzte schweißnass. Er trieb seine Männer voran. Keine Gnade! Wer den König beleidigte, der beleidigte auch ihn.
Lilienthal bekam einen kräftigen Hieb aufs Kinn und fand sich unter einem Tisch wieder. Andere Männer wären still liegen geblieben und hätten abgewartet, bis die Schläger wieder abzogen. Nicht so Gustav Lilienthal. Er schüttelte sich, griff nach einem abgebrochenen Stuhlbein, stand auf, noch ein bisschen benommen, reckte die Faust und schmetterte den Schlachtruf: «Auf die Barrikaden!»
Doch seine Genossen – diese revolutionären Maulhelden, die noch vor wenigen Minuten Güldenpenning enteignen und den König fressen wollten –, sie stoben auseinander und rannten zum rettenden Ausgang. Und die Schläger wandten sich gegen Lilienthal. Der wehrte sich mit Leibeskräften, schlug mit Faust und Stuhlbein um sich, trat mit den Füßen, kratzte, spuckte, biss. Fünf Knechte waren schließlich nötig, um ihn zu überwältigen.
Güldenpenning pflanzte sich vor ihm auf und drohte mit dem Wurstfinger: «Dich werd ich ruinieren, Lilienthal. Deine Tage als Geschäftsmann sind gezählt. Niemand wird dir noch ein einziges Stück Stoff abkaufen.»
Dann kam von irgendwoher ein Knüppel geflogen, und Gustav Lilienthal versank in Finsternis.
3.Adelina
Schloss Girsberg, 1848
Adelina also. Warum aber hatte sich Ferdinand ausgerechnet in dieses Mädchen verguckt? Auf den ersten Blick sprachen einige Tatsachen gegen sie, zunächst einmal war sie ja ein Mädchen, und was sollte ein fast zehnjähriger Bub mit einem Mädchen anfangen? Außerdem war sie ein Jahr älter, und dann war sie auch noch seine Cousine. Auf den zweiten Blick jedoch war sie etwas Besonderes. Sie verhielt sich nämlich gar nicht wie ein Mädchen. Sie angelte die größten Fische, schoss mit Pfeil und Bogen wie ein englischer Bogenschütze, und sie kämpfte mit dem Holzschwert wie ein nordischer Krieger, während fast alle anderen, Ferdinand selbst ausgenommen, fochten wie dämliche Preußen.
Und dann war da diese Geschichte mit den Rindviechern und dem Geheimnis, das er ihr anvertrauen wollte. Einige Zeit nach dem erfolglosen Drachenflug war Adelina mit Onkel und Tante wieder zu Besuch auf Schloss Girsberg. Alle Kinder wurden genötigt, bei den Erwachsenen im Salon unter dem glitzernden Kronleuchter am Tisch zu sitzen, Kaffee, Tee und Milch zu trinken, Kekse und Kuchen zu essen. Die Eltern unterhielten sich über Missernten, verfaulte Kartoffeln, Proteste und Unruhen der Bevölkerungen in Württemberg und Baden, und die Kinder langweilten sich. Als die Erwachsenen zu Wein und Cognac übergingen, gelang es Ferdinand, sich unter einem Vorwand («I muass aufs Abordd.») mit Adelina («I muass a a Gschäfdle macha.») zu entfernen.
Sie spazierten durch Feld und Flur, doch bevor Ferdinand die passende Gelegenheit fand, zu seinem Geheimnis überzuleiten, trafen sie auf den Senner, der auf einer Weide eine zeppelinsche Kuhherde hütete. Der Senner war ein klapperdürrer Bursche mit flatternden Segelohren, den ewig der Hunger plagte. Er bat die Kinder, einen Moment auf die Rindviecher aufzupassen. Er wolle ganz schnell für einen Teller Chäschnöpfli, Käsespätzle, in die Wirtschaft. Ferdinand hatte nichts dagegen einzuwenden, Adelina auch nicht. Die Tiere grasten friedlich. Was sollte schon schiefgehen?
Der Senner lief zum Gasthaus. Ferdinand und Adelina gingen zu den Kühen und legten sich ins Gras.
So lagen sie eine Weile auf der Wiese, die Hände hinter den Köpfen verschränkt, ihre Ellenbogen berührten sich beinahe, und blickten in den blauen, mit milchweißen Wölkchen gesprenkelten Himmel. Ferdinand lauschte Adelinas Atemzügen und dem Summen der Bienen, bis er sich ein Herz fasste.
Er dämpfte die Stimme, obwohl außer den grasenden Rindviechern und den Bienen niemand in der Nähe war: «Wenn du mir schwörst, zu niemandem ein Wort zu sagen, verrate ich dir mein allergrößtes Geheimnis.»
Adelina drehte sich zu ihm. «Ich schwöre!»
Auch Ferdinand drehte sich auf die Seite. Seine Nase war nur eine Handlänge von ihrer Nase entfernt. «Und worauf schwörst du?»
«Auf die Bibel?»
«Ne, haben wir grad nicht hier.»
«Auf mein reines und unverbrauchtes Leben?»
Ferdinand runzelte die Stirn. «Wie meinst du das denn?»
«Weiß ich auch nicht, das hab ich mal gelesen. Dann vielleicht auf meine Ehre oder so?»
«Na gut.» Ferdinand rieb sich übers Kinn, überlegte einen Moment, dann sagte er leise, aber mit Nachdruck: «Ich baue einen Heißluftballon.»
«Aha.» Adelina sah irgendwie enttäuscht aus. «Und warum keinen Drachen?»
«Weil ich mit einem Ballon hoch in den Himmel aufsteigen kann, bis auf den Mond – so wie der Mörder Hans Pfaall, der lebt auf dem Mond bei den kleinen Leuten. Und rate mal, wen ich auf den Mond mitnehme?»
«Klein Eberhard vielleicht?»
Ferdinand schüttelte den Kopf. «Nein, nicht Eberhard, und Eugenia auch nicht …»
In dem Moment begann eine Kuhglocke alarmierend zu scheppern. Eine kräftige Mutterkuh machte sich auf die Suche nach neuen Weidegründen und trottete in Richtung einer Weide des Nachbarbauern, dessen Familie sich seit unzähligen Generationen mit den Besitzern von Schloss Girsberg um Grundstücksfragen stritt. Anlass des Streits war der Verlauf eines Zauns, den man Mitte des 15. Jahrhunderts gezogen hatte. Weil das verrottete Holz immer wieder erneuert worden war, verschob sich die Grenze ein bisschen, bis schließlich niemand mehr wusste, wo genau diese Grenze eigentlich verlaufen war. Die einen sagten hier, die anderen dort. Und so war der Streit bei jedem Besitzerwechsel in Verkaufsverhandlungen und Erbmasse mit eingeflossen, ohne jemals geklärt worden zu sein.
Als sich die Leitkuh mit schwankendem Euter in Bewegung setzte, beschloss die gesamte Herde, bestehend aus gut zwei Dutzend Rindviechern, ihrer Chefin zu folgen. Ferdinand und Adelina sprangen aus dem Gras hoch. Über den Weiden erhob sich das scheppernde Gebimmel der Trycheln, der an den Kühen baumelnden Halsglocken.
«Und was machen wir jetzt?», fragte Ferdinand.
«Wir könnten den Senner aus der Wirtschaft holen», schlug Adelina vor.
«Das dauert zu lange», entschied Ferdinand und rannte los. Allerdings hatte er keine Ahnung vom Kühehüten, weswegen er irgendeine Kuh am Schwanz packte und ihr befahl stehen zu bleiben. Das Rindvieh war ein massiver Berg aus Fleisch und Muskeln, gestählt durch jahrelanges Wiederkäuen. Es ging einfach weiter, der an ihrem Schwanz hängende Bub fiel für sie kaum mehr ins Gewicht als eine lästige Fliege.
Adelina ging neben Ferdinand und der Kuh her und überlegte laut: «Sollten wir nicht zuerst die Leitkuh einfangen und zum Umkehren bewegen, damit die anderen ihr folgen?»
Ferdinand nahm Adelinas Vorschlag an und warf sich in den Kampf mit der Leitkuh. Er zog an ihren Hörnern, drückte gegen ihr Hinterteil und schimpfte: «Du elendr Heilandzagg! Du liadrichr, i schlag dr glei so uff die Kappadach, dass de aus de Auga gugsch wia an Aff em Käfig …» Allein: Weder das Gezeter noch die körperlichen Attacken schienen das Rindvieh zu beeindrucken. Ferdinand hätte sich genauso gut an einem Baum abarbeiten können.
Schließlich ergriff Adelina die Initiative und begann, der Leitkuh zärtlich die Locken zwischen den Hörnern zu kraulen. Dabei flüsterte sie der Kuh liebevolle Worte ins Ohr, und siehe da: Im Nu war das Tier ihr hörig und ließ sich von Adelina zur zeppelinschen Weide zurückführen, mit der ganzen Herde im Schlepptau.
Ferdinand wurde ganz still. Plötzlich kam es ihm vor, als sehe er Adelina mit anderen, mit fast erwachsenen Augen, und er traf eine Entscheidung für sein Leben: Adelina, die kluge, Kühe bezaubernde Adelina, sie war das einzige Mädchen, das es jemals wert sein würde, von ihm geheiratet zu werden. Dass sie seine Cousine war, sah er nicht als Problem an; er kannte Jungen, die wollten allen Ernstes ihre Mütter heiraten.
In der Geheimsache Heißluftballon ging Ferdinand frisch ans Werk. In einem fast vergessenen Schuppen, der abgeschieden auf dem Gelände von Schloss Girsberg stand, begann er, versteckt hinter alten Kisten und Fässern, mit der Herstellung eines Ballons. Die einzige Fachliteratur, auf die er Zugriff hatte, war das Buch mit der Geschichte von Hans Pfaall, in der der englische Schriftsteller Edgar Allan Poe die Herstellung eines Ballons genau beschrieben hatte. Allerdings würde Ferdinands Ballon kleiner ausfallen müssen. Für die Anschaffung der Utensilien fehlte ihm schlicht das nötige Geld.
Er war auf Materialien angewiesen, die er aus Schloss und Werkstätten abzweigte. Für die Ballonhülle verwendete er altes Leinen statt des teuren Musselins, das Hans Pfaall genommen hatte. Die Leinenbahnen bestrich Ferdinand mit Kautschuklack und nähte sie in Ballonform zusammen. Aus Seilen flocht er ein Netz, das er der Anleitung gemäß mit einem Reif bestückte, und aus alten Fischreusen baute er einen Weidenkorb, in dem er – wenn der große Tag gekommen war – stehen und Adelina winken würde.
Die Arbeiten zogen sich im Geheimen über Wochen dahin, und als der Ballon fertig war, stellte sich die Frage, wie Ferdinand ihn würde aufsteigen lassen können. Hans Pfaall verwendete dafür ein Gas, über dessen Zusammensetzung in dem Buch jedoch nur vage Andeutungen gemacht wurden – aus Gründen des Urheberrechts, wie es hieß. Daher entschied sich Ferdinand für ein Verfahren, mit dem die französischen Gebrüder Montgolfier vor mehr als sechzig Jahren ihren ersten Ballon in die Luft gebracht hatten: mit heißer Luft. So stand es in einem Zeitungsartikel, den der Vater vorgelesen hatte. Ferdinand hütete den Artikel wie einen Schatz, und jetzt baute er also ein entsprechendes Rohrsystem, durch das die von einem Ofenfeuer erhitzte Luft in die Ballonhülle geleitet werden sollte.
Was noch fehlte, war ein Anlass, bei dem Adelina in Girsberg sein würde. Doch ein solcher Anlass stand bald bevor, da man im Schloss ein großes Fest feiern wollte. Nicht nur Adelina und ihre Eltern waren eingeladen, sondern sogar der König von Württemberg, Wilhelm I.
In Girsberg, sogar in Konstanz, sprach man von nichts anderem als vom bevorstehenden Besuch der königlichen Hoheit. Diese Attraktion verdrängte vorübergehend andere Themen wie die Missernten, Hungersnöte und revolutionären Umtriebe in der Bevölkerung. Auf Schloss Girsberg litt ja niemand Hunger. Für das Fest wurde Fleisch gebraten, Fisch geräuchert, Gemüse geputzt, wurden Kartoffeln gekocht. Fußböden wurden gefegt und gewischt, Tischdecken gewaschen, Besteck, Teller, Gläser blitzblank geschrubbt.
Als der große Tag kam, bemerkte niemand im allgemeinen Trubel, wie sich Ferdinand schon am frühen Morgen davonstahl. Auf einer Wiese beim Schuppen, die vom Schloss aus nicht einsehbar war, breitete er die Ballonhülle im Gras aus und legte die Rohre bereit. Dann heizte er den rostigen Ofen ein, den man irgendwann im Schuppen eingelagert hatte, und sah zu, wie die heiße Luft langsam in die Hülle zu strömen begann.
Weil das Befüllen ein paar Stunden dauern würde, kehrte Ferdinand vorerst ins Schloss zurück. Später würde er sich dann – so sein Plan – von der Feier entfernen. Der Wind stand günstig und würde den Ballon direkt zum Schloss treiben, wo alle Gäste – insbesondere Adelina – dieses einzigartige Schauspiel mit dem stolzen Ballonfahrer Graf Ferdinand von Zeppelin bewundern könnten.
Nach und nach trafen die Gäste ein. Ferdinands Herz begann heftig zu klopfen, als er Adelina mit ihren Eltern aus einer Kutsche steigen sah. Er platzte beinahe vor Aufregung, als er sich zu ihr gesellte und sie im Saal mit gespielter Lässigkeit in eine lockere Konversation übers Fischefangen verwickelte. Er erwähnte das halbe Dutzend Barsche, die er neulich in einem Weiher geangelt habe. Adelina konterte mit einem Hecht, den sie gefangenen habe und der sooo groß gewesen sei. Zur Demonstration der Fischlänge reichten ihre ausgebreiteten Arme nicht aus. Ferdinand nickte anerkennend, zugleich dachte er: Nachher wirst du etwas erleben, das deinen Hecht in den Schatten stellen wird.
Plötzlich kam Bewegung in die dicht gedrängte Menschenschar, als vor dem Schloss eine helle, mit Gold beschlagene und von vier Rappen gezogene Kutsche vorfuhr. Diener mit weißen Handschuhen öffneten die Kutschentür, und König Wilhelm I. von Württemberg, mit rosigem Teint und blondem Schnauzbart, gekleidet in einen blauen, mit Orden und goldenen Kordeln geschmückten Rock, trat aus der Kutsche. Ferdinands Vater begrüßte den König wie einen alten Freund. Die tuschelnden und Luft fächernden Gäste bildeten ein Spalier, durch das König Wilhelm und Graf Friedrich Jerôme Wilhelm Karl von Zeppelin, gefolgt von Ministern und Aristokraten, die Treppen hinauf in den Saal spazierten, wo Ferdinands Mutter Amélie auf sie wartete. Der König hatte sie seit Jahren nicht mehr gesehen, war aber Diplomat genug, sich seine Verwunderung über ihre körperliche Veränderung kaum anmerken zu lassen. Ganz kurz nur hoben sich die hellen Augenbrauen, und in den blauen Augen blitzte Irritation auf, dann lächelte er wieder, und man begab sich zu Tisch.
Der König und die Minister nahmen am Kopf der Tafel bei Ferdinands Familie Platz. Amélie saß auf einem Stuhl mit extra breiter Sitzfläche, der aus hartem Holz getischlert worden war. Adelina wurde mit ihren Eltern ans andere Ende des langen Tischs platziert, was Ferdinand bedauerte. Natürlich war es auch für ihn ein kaum zu übertreffendes Ereignis, dieselbe Luft zu atmen wie der König. Dennoch hätte er Adelinas Nähe sogar der Gesellschaft des Königs vorgezogen. Mit ihr hätte er über Angeln und Bogenschießen oder andere interessante Dinge reden können. Die Erwachsenen waren ja gleich wieder bei ihren Erwachsenenthemen, die von Ferdinands Lebenswirklichkeit so weit entfernt waren wie Girsberg von der Hauptstadt der segglbleeden Preußen.
«Bei der Zuteilung von Getreide soll es schon wieder zu Aufständen gekommen sein», hörte Ferdinand seinen Vater sagen.
«Leider, leider», erwiderte König Wilhelm. «Aber wir haben die Lage unter Kontrolle.»
Dann wurde das Essen aufgetragen: Rehrücken, mariniert und mit Speck gespickt. Man schnitt dem König eine daumendicke, rosafarbene Scheibe ab. «Herrlich!», frohlockte er. «Ich liebe Rehrücken, mein lieber Fritz.»
Ferdinands Vater strahlte wie ein Kind am Weihnachtsbaum, aber Amélies Miene verdunkelte sich. «Ich hörte, die armen Menschen müssen ihr Brot jetzt aus verdorbenem Getreide und Queckenwurzeln backen», sagte sie.
«Bitte – Amélie!», mahnte Fritz, dann sagte er schnell zum König und den Ministern: «Lassen Sie uns das Festmahl genießen, Hoheit. Ja, die Zeiten mögen hart sein, aber wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, Euch einen unvergesslichen Tag zu bereiten.»
Wilhelm hob die Gabel mit einem aufgespießten Stück Fleisch wie ein Zepter. «Das ist die richtige Einstellung, mein lieber Fritz», murmelte er mit vollen Backen, auf einem Happen Rehfleisch kauend, und forderte einen Diener auf, die dampfenden Kartoffeln mit einem Schwapp brauner Soße zu tränken.
Amélie gab nicht nach: «Gewöhnliche Leute könnten sich so etwas nicht mehr leisten. Die ganze Ernte ist verfault.»
Ferdinands Vater sah aus, als bereue er zutiefst, seine Frau überredet zu haben, am Festmahl teilzunehmen, statt, wie sie selbst es gewünscht hatte, sie oben in ihrer Kammer sitzen zu lassen, um sich den Blicken der Öffentlichkeit nicht auszusetzen.
«Mhm, schlimm, schlimm», murmelte der König. «Kann man nichts machen, ist höhere Gewalt, Gottes Zorn, Plagen und so weiter. Aber das Schlimmste an dem ganzen Unglück sind ja nicht die Missernten, sondern diese Liberalen und Demokraten, die allerorts aus ihren Löchern kriechen.»
Die Minister stöhnten wie auf Befehl: «Oh Gott, diese De-mo-kra-ten.»
«Stellen Sie sich vor, werte Gräfin von Zeppelin», fuhr der König fort, «ich ließe das Volk tun, was es will. Und diese Schmierfinken dürften in ihren Zeitungen schreiben, was sie schreiben wollten. Was würden die wohl schreiben? Dass alle Menschen gleich wären? Dass ein jeder Mann das Recht auf Freiheit und Essen haben müsse? Dass jeder seine Meinung, und sei sie noch so abwegig, öffentlich kundtun dürfe? Dass sich Württemberg den Preußen beugen solle … ah … mein lieber Fritz – da kommt auch schon der Champagner. Wie aufmerksam von Ihnen!»
An der Tafel wurden reihum die Glaskelche vollgeschenkt. Ferdinands Vater brachte einen kurzen Toast aus, lobte König Wilhelm für seine politische Weitsicht und das Sentiment für alle Belange Seiner Untertanen. Dann wurden die Kelche geleert, und die Kinder tranken Apfelsaft und Milch und langweilten sich.
Der König, satt und vom Schampus angeschickert, war jetzt in seinem Element und hob zu einer Rede an: «Schauen Sie doch nur einmal nach Preußen, meine Damen und Herren. Die preußische Obrigkeit lässt sich vom Pöbel auf der Nase herumtanzen. Da werden Bäckereien und Getreidelager geplündert, Scheiben eingeworfen, Brände gelegt. Wollen Sie etwa, dass in unserem geliebten Württemberg preußisches Chaos einzieht? Hätte ich in Stuttgart den Tumultanten nicht sofort mit aller gebotenen Härte die Grenzen aufgezeigt, hätte der Pöbel aufgemuckt wie bei den Preußen. Wir sind doch nicht dafür zuständig, dass Milch und Honig vom Himmel regnen!»
Zustimmendes Gemurmel am Tisch.
Das war der Moment, an dem Ferdinand beschloss, nach dem Ballon zu schauen, der bald mit ausreichend heißer Luft gefüllt sein müsste, als ihm plötzlich ein Gedanke kam: Hatte er den Ballon überhaupt mit den Seilen im Boden verankert?
Er wollte sich gerade vom Tisch entfernen, als er König Wilhelm noch sagen hörte: «Mein lieber Fritz, Ihr Champagner ist ausgezeichnet. Was gibt es denn zum Nachtisch … ja, du meine Güte – was, oh Allmächtiger, was ist denn das da draußen?»
Alle im Saal folgten dem Blick des Königs, der mit weit aufgerissenen Augen durch ein Fenster starrte. Schlagartig wurde es totenstill, bis jemand zu kreischen begann, andere stimmten ein, und binnen weniger Sekunden erhob sich ohrenbetäubender Lärm. Männer und Frauen schrien, Stühle krachten zu Boden, jemand wurde ohnmächtig, jemand rief nach Riechsalz, andere flehten um göttlichen Beistand. Vor dem Fenster schwebte Ferdinands Ballon, prall gefüllt und führerlos, auf das Schloss zu wie ein von Geisterhand bewegtes, graues und gewaltiges Ungetüm. Der Weidenkorb, in dem Ferdinand mit einem Taschentuch hätte winken sollen, schwang hin und her. Schon verdunkelte der auf Kollisionskurs fahrende Ballon im Saal das Licht. Und dann krachte er gegen die Schlossfassade. Fensterglas splitterte, Putz bröckelte, die Ballonhülle riss und platzte, und heiße Luft knatterte mit flatulierendem Getöse heraus. Binnen weniger Sekunden fiel die Hülle in sich zusammen, verlor an Höhe und plumpste auf die in der Auffahrt parkende königliche Kutsche. Im Saal liefen die Menschen in Panik durcheinander, stolperten, fielen übereinander. König Wilhelm zog seinen Säbel. Er rief nach seiner Leibgarde: «Der Pöbel verübt einen Anschlag auf den König!»
Alles war auf den Beinen oder lag ohnmächtig auf dem Fußboden. Nur drei Personen saßen noch am Tisch: Ferdinand, der nicht wusste, was er sagen sollte, sowie neben ihm seine Mutter und Adelina am anderen Ende des Tisches. Beide blickten Ferdinand an, und dann begannen sie, laut zu lachen.
4.Karl Wilhelm Otto
Anklam, 1848
Als Gustav Lilienthal seine Augen öffnete, blickte der Mond auf ihn herab. Sein Kopf fühlte sich an, als wäre ein Ochsenkarren darüber hinweggerollt. Gustav setzte sich auf. Neben ihm floss die Peene im Mondschein träge dahin. Nicht weit entfernt zeichneten sich die Umrisse von Böhmers Hotel vor dem Nachthimmel ab. Die Lichter waren gelöscht, keine Personen zu sehen, keine huschenden Schatten. Gustav konnte sich nicht erinnern, wie er aus dem Schankraum ans Flussufer gekommen war.
Die Pfeife steckte in seiner Hosentasche, der Stiel war zerbrochen, aber er musste unbedingt rauchen. Er stopfte Tabak in den Pfeifenkopf, zündete den Tabak mit einem Streichholz an und sog den Rauch in die Lunge. Schon besser. Der Tabak tat seine belebende Wirkung, und nachdem Gustav den Inhalt seines Magens der Peene übergeben hatte, begab er sich auf den Heimweg.
Er wohnte in dem Haus in der Peenestraße 8, Ecke Wollenweberstraße, in der Nähe der Nikolaikirche, in der er vor einem Jahr seine Caroline geheiratet hatte, und bald darauf hatte er das Haus für die zu gründende Familie gekauft. Die Geschäftsräume des lilienthalschen Tuchhandels befanden sich im Erdgeschoss, in den Etagen darüber die Wohnräume. Es war ein gutes Haus, feste Mauern aus Stein, ein dichtes Dach, beste Lage. Aber auch: viel zu teuer. Beim Kauf hatte er sich finanziell übernommen und würde nun sein Leben lang die Schulden abzahlen müssen. Deswegen investierte er einen guten Teil des wenigen Geldes aus dem Tuchhandel ins Glücksspiel und die dazugehörigen Getränke in Böhmers Hotel. Sein Glauben, dass eines Tages, womöglich schon sehr bald, eine Glückssträhne ihm einen dicken Sack voll Münzen bescherte, war unerschütterlicher als sein Glauben an den lieben Gott.
Wie er nun also wankend vor seinem Haus stand, lichtete sich in seinem Kopf der Nebel, hinter dem sich die Erinnerungen an den Abend im Gasthof versteckten. Aber er konnte die Bilder nicht fassen, sie blieben verwaschen wie ein von trübem Wasser überspültes Gemälde. Es hatte etwas mit Geld zu tun. Und mit seinem Laden. Und mit dem Gutsherrn Güldenpenning. Aber was nur?
Bevor Lilienthal der Gedankenspur weiter folgen konnte, erforderte eine andere Merkwürdigkeit seine Aufmerksamkeit. Er kniff ein Auge zu, und mit dem anderen sah er, dass im ersten Stock die Fenster hell erleuchtet waren. Ungewöhnlich für diese nachtschlafende Zeit. Und dann fiel ihm ein, warum er an diesem Abend eigentlich rechtzeitig wieder hatte daheim sein wollen …
Er brauchte sieben Versuche, um den Schlüssel ins Loch zu stecken. Dann hetzte er die Treppe hinauf, stolperte, schlug sich die Knie auf und hätte am oberen Treppenabsatz beinahe eine Alte mit faltigem Gesicht über den Haufen gerannt. Er konnte ihr in letzter Sekunde ausweichen, fiel dafür allerdings ein zweites Mal zu Boden. Die alte Frau, die ihm bekannt vorkam, beugte sich über ihn und blickte ihn fassungslos an. Ihr Gesicht sah aus wie ein zerknülltes Taschentuch.
Und dann erkannte er sie. «Mutter! Ich bin hoffentlich nicht zu spät gekommen.»
Seine Mutter sagte gar nichts. Ihre Lippen waren ein dünner Strich. Wortlos zeigte sie auf die einen Spalt weit geöffnete Schlafzimmertür. Dahinter war Licht zu sehen. Und etwas zu hören: ein dünnes, quiekendes, neues Stimmchen.
Caroline Lilienthal war dreiundzwanzig Jahre alt, als sie ihr erstes Kind gebar, einen strammen blonden Jungen, an dem alles dran war, was dran sein musste. Jetzt lag sie im Bett, erschöpft nach der kräftezehrenden Geburt, und betrachtete mindestens zum hundertsten Mal das Bübchen, das in ihren Armen schlummerte. Dieses kleine Näschen, der süße Mund, diese Öhrchen, das Gesichtchen zerknautscht und faltig, wie bei einem Gnom – einfach unglaublich schön. Carolines Herz schäumte über vor Mutterliebe. Als die winzigen Augenlider zu zittern begannen, sang sie ihm ein Schlaflied, sie sang mit einer Stimme, die so sanft war wie der Hauch eines Schmetterlingsflügelschlags: «Der Pfarrer, der aufs Tanzen schalt und Filz und Wuchrer war, steht nachts als schwarze Spukgestalt um zwölf Uhr am Altar. Drum übe Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab, und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab …»
Bevor Caroline ihren Gatten Gustav Lilienthal kennenlernte, hatte sie Gesang studiert, in Berlin und Dresden. Fachleute hatten ihr eine große Karriere prophezeit, womöglich einen ähnlich kometenhaften Aufstieg, wie ihn seinerzeit die schwedische Nachtigall Jenny Lind hingelegt hatte. Berühmte Männer wie der deutsche Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy oder der dänische Dichter Hans Christian Andersen hatten für Jenny Lind Liebesgedichte geschrieben, ganze Opern nur für sie komponiert.
Ob Caroline eine Karriere beschieden gewesen wäre wie der märchenhaften Jenny Lind? Wer weiß. Unsinnig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Caroline war, wie sie war, und sie war nun mal eine Vorpommeranerin, bodenständig, treu, das Herz am rechten Fleck. Als ihre verwitwete Mutter, der ein ausgeprägter Hang zur Weinerlichkeit zu eigen war, sie bat, nach Anklam heimzukehren, da packte Caroline in Dresden die Koffer. Und mit der Karriere war’s Essig. Vorpommern statt Venedig, Rom oder New York. Malzextrakt statt Champagner. Trockenbrot statt Kaviar. Putzfeudel statt Orchester. Gesangsunterricht für Anklamer Frauenzimmer statt Haydns Schöpfung oder Händels Messiah. Und, ja auch ein Tuchhändler namens Gustav Lilienthal statt gut betuchte Verehrer.
Jetzt hörte Caroline ihren Göttergatten Gustav die Treppe hinaufpoltern, hörte ihn stolpern und fluchen. Sie seufzte, schaute auf ihr Kind und fand ihr Lächeln schnell wieder.
Gustav kam ins Zimmer. Wie er wieder aussah: Sein rechtes Auge war geschwollen, die Oberlippe aufgeplatzt, an einer Wange klebte getrocknetes Blut. Er machte eine entschuldigende Geste, murmelte: «Die Revolution verlangt Opfer.»
Sie roch Alkohol und Tabakrauch in seinem Atem, als er ans Bett kam, sich über seinen Sohn beugte und zärtlich flüsterte: «Gustav, mein Gustavchen …»
«Otto», entgegnete Caroline entschieden. «Er heißt Karl Wilhelm Otto.»
5.Der Tod hält Ernte
Schloss Girsberg, 1852–1853
Amélie Gräfin von Zeppelin lag in eine Decke gewickelt auf einem Liegestuhl vor dem Schloss unter der großen Eiche und verdaute ein Stück Zuckerkuchen, als ihr plötzlich schwindelig wurde. Sie mühte sich in eine sitzende Haltung, und dann kam es über sie wie ein Schlag. Sie kippte um, fiel aus dem Liegestuhl auf den Boden und bewegte sich nicht mehr.
Es brauchte vier Bedienstete, um Amélie in ihr Bett zu schleppen. Ärzte kamen und gingen, sie verabreichten ihr Medikamente, empfahlen Atemübungen, Rohkost und Spaziergänge an der frischen Luft. Amélie befolgte die meisten Ratschläge, weigerte sich aber beharrlich, das Bett zu verlassen. Sie stand nicht einmal auf, um den Mann namens Robert Moser zu begrüßen, als der die Stelle des Hauslehrers für ihre beiden Söhne antrat.
Während Amélie die Fliegen an der Zimmerdecke über ihrem Bett zählte, mühte Moser sich redlich, Ferdinand und Eberhard die Grundkenntnisse alter Sprachen, Algebra und Landeskunde beizubringen. Er war jung und eifrig, als Lehrer jedoch nur bedingt geeignet. Vor allem bei Ferdinand hatte er keinen leichten Stand, weil der nicht einsehen wollte, warum er seinen Kopf mit unnützem Wissen über Altgriechisch oder Latein vollstopfen sollte. Ferdinand zog es vor, auf seinem Pony durch die Botanik zu reiten und mit Holzgewehr und Blechsäbel unsichtbare Preußen niederzumetzeln.
Manchmal konnte er seine Mutter überreden, Geschichten von Ballonfahrern vorzulesen. Die ganze Familie versammelte sich dann bei ihr im Zimmer. Ferdinand, Eberhard und Eugenia legten sich zu ihr auf das große Bett, Vater ließ sich in den Sessel sinken, der Rücken gebeugt, das graue Gesicht gezeichnet vor Sorge um seine geliebte Ehefrau. Einmal las Amélie ihnen von einem Franzosen vor, der als Erster die Alpen überquerte, dann aber über dem Mittelmeer verschwand, ohne dass man ihn jemals wiedersah. Ein anderes Mal las sie von einem Aeronauten, der auf einem Pferd saß, das man unter einen Ballon festband, aber das Pferd erstickte beim Aufstieg an den giftigen Gasen.
«Das ist ja interessant», sagte Ferdinand ergriffen.
«Nein, das sind Verrückte, allesamt Verrückte», knurrte sein Vater, und es war klar, dass er auf Ferdinands Husarenstück mit dem Ballon anspielte. Die Sache war damals ja noch glimpflich ausgegangen. Nachdem der König festgestellt hatte, dass es keine Revolutionäre waren, die ihm ans Leder wollten, sondern der Sohn des Grafen dahintersteckte, hatte er Ferdinand für dessen Bastelgeschick sogar noch gelobt. Die Kutsche war nur ein bisschen eingedellt, und die Gäste hatten sich bald erholt. Dem zerknirschten Grafen Fritz von Zeppelin war also nichts anderes übrig geblieben, als seinem Sohn Straffreiheit zu gewähren, aber vergessen hatte er die Sache nicht.
Amélies Zustand verschlechterte sich zusehends. Fritz flehte sie an, sie möge sich bitte, bitte, bitte doch endlich von Experten helfen lassen, nicht von diesen Quacksalbern, die sich auf Schloss Girsberg die Klinke in die Hände gaben. Er hatte für Amélie in Montpellier einen Platz in einem Sanatorium reserviert. Dort praktizierten die besten Ärzte, sagte er, es gebe die besten Therapien, die beste Medizin. Die Luft sei mild und frisch, das Meer nah.
Amélie sagte nichts und drehte ihr Gesicht zur Wand.
Fritz erhob selten seine Stimme, höchstens wenn die Kinder etwas ausgefressen hatten oder er sich über die Preußen aufregte, aber seiner geliebten Ehefrau gegenüber wurde er nie laut. Doch jetzt ertrug er es nicht mehr, wie sie sich ihrem Schicksal kampflos ergab. Er stampfte mit dem Fuß auf, dass die Dielen krachten, und als sie noch immer nicht reagierte, griff er nach der chinesischen Vase, ein Geschenk von Amélies Vater zu ihrem zehnten Hochzeitstag. Fritz besah sich das feine blaue Muster; eine gewöhnliche Familie konnte sich vom Gegenwert der Vase ein halbes Jahr ernähren. Dann warf er sie an die Wand. Das gute Stück zersprang in tausend Scherben.
Amélies einzige Reaktion war ein Seufzen. Da sank Fritz vor ihrem Bett auf die Knie und begann, hemmungslos zu schluchzen. Keine Sekunde länger könne er mit ansehen, wie sie sich dem Tode hingebe. Seine Kraft sei aufgebraucht. Er werde jetzt durch diese Tür gehen, das Zimmer verlassen und es nie wieder betreten.
Das Bettgestell knarzte unter Amélies Gewicht, als sie sich umdrehte, und es rührte ihr das Herz, ihren Gemahl auf Knien weinen zu sehen. Ein weiterer Seufzer bahnte sich den Weg aus den Tiefen ihres gewaltigen Busens, dann gab sie ihren Widerstand auf und sagte, sie werde mit ihm nach Montpellier fahren. Und fügte leise hinzu: Obwohl das alles nichts ändere.
Die vier Diener, die Amélie ins Bett geschleppt hatten, waren wieder nötig, um sie ein paar Tage später hinunter auf den Hof zu bringen, wo eine Kutsche wartete. Das Gefährt knirschte und bekam deutlich Schlagseite. Als Fritz sich neben Amélie auf die Bank quetschte, sah er dünn und klein aus, als wäre er um die Hälfte geschrumpft.
Die Kinder blickten der Kutsche nach. An jenem Tag im März 1852 wehte ein scharfer, kühler Wind übers Land, er zerrte an Ferdinands Haar und warf es von einer Seite auf die andere. Das Letzte, was er von seiner Mutter sah, war ihr Arm, der aus dem Kutschenfenster hing. Kurz bevor die Kutsche das Tor an der Hofeinfahrt passierte, hob sich die Hand zum Winken, sank aber gleich wieder herab. Dann war die Kutsche verschwunden.
Eberhard und Eugenia trotteten mit hängenden Köpfen ins Schloss. Ferdinand blieb draußen, den Blick starr auf die Einfahrt gerichtet, von kaltem Wind umweht. Eine Stunde später stand er noch immer da. Er hörte und sah nichts. Stand einfach da und wartete, dass seine Mutter heimkehrte, und ignorierte die Stimme in seinem Kopf, die böse, böse Stimme, die mit eiskaltem Hauch flüsterte, sie käme nicht zurück, niemals wieder.
Einige Wochen später starb Amélie Gräfin von Zeppelin in einem weichen Sanatoriumsbett in Montpellier an der vom Frühling geküssten Mittelmeerküste. Amélie hatte das Mittelmeer nur ein Mal bei der Ankunft kurz gesehen, danach ihr Bett nicht wieder verlassen. Als Vater Fritz, noch grauer, noch schmaler, noch geschrumpfter nach Girsberg zurückkehrte und den Kindern die Nachricht überbrachte, brachen Eberhard und Eugenia in Tränen aus, sie schrien ihren Kummer heraus, sie weinten, fluchten, flehten; es war im ganzen Haus zu hören.
Ferdinand versank in stummes Brüten. Er verschwand auf sein Zimmer, schloss die Tür hinter sich ab und packte einen Koffer. Stopfte Kleidung, ein paar Bücher über Ballonfahrer und Kriegsführung, natürlich eine Bibel und Schreibsachen hinein. Von außen klopfte jemand an die Tür, rief Ferdinands Namen. Er reagierte nicht und packte weiter, bis in den Koffer nichts mehr hineinging. Dann setzte er sich auf einen Stuhl am Fenster, blickte hinaus und wartete. Zweimal noch klopfte jemand und rief nach ihm, dann wurde es still im Schloss. Die Nacht senkte sich über Girsberg wie eine Grabplatte. Als der Morgen graute, stand Ferdinand auf, ging mit dem Koffer aus seinem Zimmer die Treppen hinunter nach draußen in den Stall, wo er das Pony sattelte und in den sich aufhellenden Tag hinausritt. In der Gegend von Engwilen, ein paar Meilen südwestlich von Girsberg, fielen ihm im Sattel die Augen zu. Beim Sturz vom Pony landete er mit dem Kopf auf einem Stein. Ein Bauer fand ihn bewusstlos am Wegesrand liegend, das Pony graste in der Nähe.
Im Koffer fand der Bauer einen Hinweis auf Schloss Girsberg und brachte Ferdinand dorthin zurück, der, kaum wieder zur Besinnung gekommen, schon wieder loswollte. Er redete wie im Fieberwahn, er müsse Buße tun, Missionar werden. Es sei Mamas Wunsch gewesen, dass er dem Herrn diene, irgendwo und überall auf der Welt den Ungläubigen das Evangelium predige, womöglich im afrikanischen Dschungel. Und wenn man ihn auf einem fernen Kontinent erschlüge, zerteilte, am Spieß briete, zu Roulade oder Hackfleisch verarbeitete und über offenem Feuer im Kessel kochte, sei das die gerechte Strafe. Mama sei doch seinetwegen gestorben, nur seinetwegen, weil er ihren Wunsch nicht erfüllt habe …
Nachdem er erneut das Bewusstsein verlor, schlief er drei Tage und drei Nächte am Stück, und als er wieder erwachte, saß neben ihm auf der Bettkante ein Engel und hielt seine Hand. Der Engel war Adelina, die sagte: «Du bist nicht schuld an ihrem Tod.»
Bevor er protestieren konnte, drückte sie seine Hand so fest, dass ihn ein stechender Schmerz durchfuhr. Sie beugte sich zu ihm herunter, näherte sich ihm, ihr Gesicht schwebte dicht über seinem. «Deine Mama hat dich geliebt, so wie jede Mutter ihre Kinder liebt», flüsterte sie. «Komm wieder zu Sinnen, Ferdi.»
Ihr Haar roch nach der Sonne eines endlosen Sommers, ihre Haut wie die Erde, wenn sie nach langer Trockenheit vom Regenschauer getränkt wird. Ihr Atem streichelte seine Wangen, er spürte ihre Lippen sanft und weich und feucht auf seiner Stirn. Unter ihm tat sich die Welt auf, über ihm zerriss der Himmel, gleißendes Licht durchströmte ihn.
Plötzlich rief jemand sehr laut und sehr wütend: «Kind, was tust du da? Im Namen des Herrn, unterlass das – sofort!»
Adelina fuhr zusammen. Ihre Eltern standen im Zimmer. Der Vater packte Adelina am Arm und zog sie von Ferdinand weg. «Er ist dein Cousin!», rief ihre Mutter empört. Und dann waren alle drei aus dem Zimmer verschwunden, Adelina im festen Griff ihres Vaters.
Ferdinand sah und hörte nichts mehr von Adelina. Sie beantwortete keinen seiner Briefe, und als er einmal am Haus ihrer Eltern auftauchte, behaupteten sie, Adelina wolle ihn nie wiedersehen. Die Tür wurde ihm vor der Nase zugeschlagen und von innen abgeschlossen. Er glaubte ihnen kein Wort. Doch was hätte er tun sollen?
Im Sommer 1853 verließen Ferdinand – er war jetzt fünfzehn Jahre alt – und sein Bruder Eberhard Schloss Girsberg und zogen zu Lehrer Moser nach Stuttgart, um dort die höhere Schule zu besuchen. In der Kutsche fuhren sie über die Straße, die an Adelinas Haus vorbeiführte. Ferdinand sah, dass an den Fenstern ihres Zimmers die Vorhänge zugezogen waren. Dahinter schien kein Leben zu sein.
6.Die Störche
Anklam, 1849–1856
Gustav und Caroline Lilienthal ließen nicht viel Zeit verstreichen. Anderthalb Jahre nach Ottos Geburt brachte Caroline ihren zweiten Sohn zur Welt. Dieses Mal schwänzte Gustav die Entbindung nicht, was vor allem daran lag, dass er fast ständig pleite war, weswegen er ganz allein zu Hause trinken musste statt mit Max Burwitz und den anderen Zechern in Böhmers Hotel. Die Geschäfte liefen schlecht, eigentlich liefen sie überhaupt nicht. Niemand wollte mehr bei ihm Stoffe, Tuche und Nähbedarf kaufen. Güldenpennings Drohung tat ihre Wirkung. Dennoch würde Gustav niemals zu Kreuze kriechen und den Gutsherren, diesen Ausbeuter und Menschenschinder, um Entschuldigung bitten. Was für Gustav ja letztlich bedeuten würde, die lilienthalsche Revolution für gescheitert zu erklären.
Während Caroline den zweiten Knaben aus ihrem Schoß presste, ging Gustav im Nebenraum auf und ab, Pfeife paffend wie ein Überseedampfer, und als er die ersten dünnen Schreie über den Flur hallen hörte, verlor er die Nerven, sein Gesicht die Farbe, und dann fiel er um. Es brauchte eine Flasche Riechsalz, verabreicht von seiner Mutter, ihn wieder aus seiner Ohnmacht zu erwecken. Anschließend genehmigte er sich eine halbe Flasche Schnaps für die flatternden Nerven, bevor er sich in der Lage fühlte, seine Forderung zu artikulieren, dass, wenn schon nicht der erste Sohn, dann aber bitte schön der zweite so heißen müsse wie er selbst, der stolze Vater.
Caroline seufzte erschöpft. Und so nannten sie ihren zweiten Sohn: Gustav.
Der Erstgeborene entwickelte sich zu einem aufgeweckten Jungen. Seine Augen waren blau wie das Wasser im Haff, und sein Haar leuchtete wie ein erntereifes Weizenfeld. Er lachte laut und viel, sang Lieder mit seiner Mutter und hüpfte auf einem Bein durchs ganze Haus. Er war Mamas Sonnenkind, auch wenn er beim Toben eine Tasse vom Tisch stieß, vom Spielen den Straßendreck ins Wohnzimmer schleppte oder die zum Angeln ausgegrabenen Regenwürmer über den Küchenboden kriechen ließ.
Der kleine Gustav hingegen gab Anlass zur Sorge. Er wuchs langsam, blieb dünn und zart, war schweigsam und wurde von Hustenkrämpfen geplagt. Er musste häufig das Bett hüten und weinte ohne ersichtlichen Grund, als laste ein Schatten auf seiner Seele, ein Schatten so dunkel wie die Ringe unter seinen Augen.
Viel zu essen gab es nicht im Hause Lilienthal. Otto schienen die mageren Rationen in seiner Entwicklung nicht zu beeinträchtigen. Meist gab es dünnen Brei, etwas Brot und Käse, sonntags mal ein Ei und ein Stück saftiges Fleisch nur, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen wären. Auf Gustavs Brust sah man die Rippen, sie lagen fast bloß auf der Hühnerbrust, nur ein bisschen dünne Haut über spitzen Knochen. Er war das Küken, das im Nest den Schnabel erst öffnete, wenn das Futter schon verteilt war, das Küken, das, ob mit oder ohne Absicht, von anderen Küken aus dem Nest gedrängt wurde und auf den Erdboden fiel, wo es so leise um Hilfe piepste, dass niemand es hörte, bis es vom Fuchs gefressen wurde.