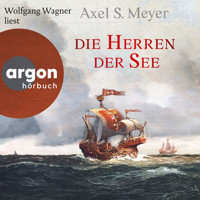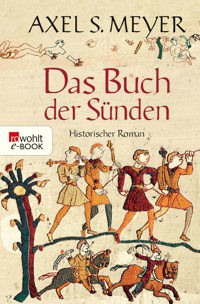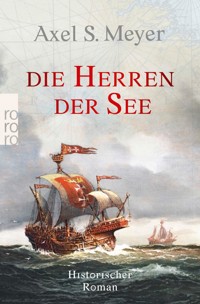
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Seeschlacht. Eine tragische Liebe. Ein Mann, der nichts zu verlieren hat. Nordeuropa, 1471. Zwischen der Hanse und England tobt ein erbitterter Seekrieg um die Vorherrschaft über die Nordsee. Till Landers, ein junger Kaufmann aus Wismar, heuert auf dem «Mariendraken» an, mit dem der Kaperfahrer Paul Beneke gegen England segelt. Benekes Ruf als genialer Seeheld und grausamer Krieger ist legendär. Wie Landers herausfindet, sind es dunkle Dämonen, die ihn antreiben. Seit dem Verlust seiner großen Liebe Margreta ist Beneke ein gebrochener Mann. Für ihren rätselhaften Tod macht er deren Vater, den Danziger Kaufmann Bernt Pawest, verantwortlich. Nun ist Pawest mit dem «Peter von Danzig» – dem größten Kriegsschiff seiner Zeit – auf dem Weg in die Nordsee. Und für Beneke ist die Zeit der Rache gekommen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Axel S. Meyer
Die Herren der See
Historischer Roman
Über dieses Buch
Eine dramatische Seeschlacht. Eine tragische Liebe. Ein Mann, der nichts zu verlieren hat.
Nordeuropa, 1471: Till Landers, ein junger Kaufmann aus Wismar, gerät auf einer Handelsreise in Not. Völlig mittellos heuert er auf dem «Mariendraken» an, mit dem der Kaperfahrer Paul Beneke auf der Nordsee gegen England segelt. Zwischen der Hanse und England tobt ein erbitterter Seekrieg, Benekes Ruf als grausamer Krieger ist legendär. Wie Landers herausfindet, treiben ihn dunkle Dämonen an: Seit dem Verlust seiner großen Liebe Margreta ist Beneke ein gebrochener Mann. Für ihren Tod macht er deren Vater, den Danziger Kaufmann Bernt Pawest, verantwortlich. Nun ist Pawest mit dem größten Kriegsschiff seiner Zeit auf dem Weg in die Nordsee. Und für Beneke ist die Zeit der Rache gekommen …
«Für Freunde historischer Romane ein absoluter Genuss!» (Westfälische Nachrichten über «Das Handelshaus»)
Vita
Axel S. Meyer, 1968 in Braunschweig geboren, studierte Germanistik und Geschichte. Heute lebt er in Rostock, wo er als Redakteur der Ostsee-Zeitung tätig ist. Im Rowohlt Verlag hat er bereits mehrere historische Romane veröffentlicht, darunter die erfolgreiche Reihe um den Wikinger Hakon, den Hanse-Roman «Das Handelshaus» und zuletzt «Der Sonne so nah» über die Pioniere der Luftfahrt Otto Lilienthal und Graf von Zeppelin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2025
Copyright © 2025 by Axel S. Meyer und Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Ilona Jaeger
Karte © Peter Palm
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung Der Peter von Danzig 1462. Gemälde von Adolf Bock, 1945. Sammlung Malmö Museum; © VG Bild-Kunst, Bonn 2024; akg-images
ISBN 978-3-644-01859-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Im Gedenken an Thomas «Tom» Niebuhr
Prolog
Der Sund – Frühjahr 1468
Als Aldwyn Godric mit seinen Handelsschiffen in den Sund segelt, sollen sich seine bösen Vorahnungen bestätigen. Die ganze Zeit schon hatte er das Gefühl, dass diese Fahrt kein gutes Ende nehmen würde. Jetzt steht der Schiffer an der Reling des Achterkastells und beschattet die Augen mit einer Hand gegen die Sonne, als sich von der Küste Seelands mehrere Schiffe unter vollen Segeln nähern.
«Die haben viele Krieger an Bord», sagt Godric zu Veland, seinem Hauptbootsmann. Godric zählt drei Holke – große, dreimastige Schiffe mit Achter- und Vorderkastellen. Auf den Decks blitzen Lanzenspitzen, Schildbuckel und Helme im grellen Sonnenlicht auf, und an den Mastkörben, die mit Armbrustschützen besetzt sind, wehen dänische Flaggen.
Veland, der auf irgendetwas herumkaut, spuckt einen dunklen Flatschen über Bord, wischt sich mit dem Hemdsärmel über Bart und Lippen, dann sagt er: «Vielleicht meinen die gar nicht uns.» Aber er klingt wenig hoffnungsvoll.
«Doch, die meinen uns», gibt Godric bitter zurück und denkt daran, wie sie vor einigen Wochen in der französischen Baie de Bourgneuf an der Mündung der Loire aufgebrochen sind, ein Konvoi aus sieben Handelsschiffen, deren Laderäume mit Salzfässern gefüllt sind. Und weil Godric schon damals kein gutes Gefühl hatte, ließ er jedes Schiff mit einem halben Dutzend bewaffneter Söldner bemannen. Damit, so hoffte er, würden sie ausreichend gegen Seeräuber geschützt sein. Ihre Fernhandelsfahrt soll sie bis nach Nowgorod führen. Dort wollen sie das Baiensalz mit reichlich Gewinn verkaufen und dafür Pelze und Felle von Bibern, Nerzen, Wölfen und Bären erwerben. In London wird man ihnen die Waren aus den Händen reißen.
«Aber das sind doch Dänen», sagt Veland.
«Na und?», entgegnet Godric. «Die wollen uns kapern, glaub mir.»
Woher diese Gewissheit stammt, weiß er selbst nicht. Vermutlich ist sie das Ergebnis seines Bauchgefühls sowie einer nüchternen Einschätzung der politischen Lage. Vor einiger Zeit haben die Spannungen zwischen England auf der einen Seite sowie Dänemark und der Hanse, mit Städten wie Lübeck, Hamburg, Wismar und Danzig, auf der anderen Seite, weiter zugenommen. Die Engländer waren schon seit Jahren erpicht darauf, die Vorherrschaft auf der Nordsee zu erringen, weswegen es zu ersten kriegerischen Konflikten kam. So sorgte kürzlich ein Überfall der Engländer auf dänische Handelsposten in Island für erhebliche Unruhe. Englische Kaufleute erschlugen den königlich-dänischen Vogt, warfen seine Leiche ins Meer, plünderten sein Haus und raubten die königliche Kasse. Godric war klar, dass sich der dänische König eine solche Provokation nicht würde gefallen lassen.
Auf den englischen Handelsschiffen macht sich Aufregung breit. Seemänner, Söldner und Kaufleute sammeln sich auf den Großdecks. Sie brechen in erregte Rufe aus, denn jeder kann sehen, dass die Dänen zwar weniger Schiffe, aber viel mehr Krieger und Waffen haben.
«Wir können nur noch beten, dass wir schneller sind als die Dänen», sagt Godric. «Auf einen Kampf dürfen wir uns nicht einlassen.»
Veland legt die Hände als Trichter um den Mund und gibt das Kommando, hart an den Wind zu gehen. Sogleich folgen die anderen Handelsschiffe seinem Beispiel. Godric hört den Wind in der Takelage heulen, und er denkt, dass er diese Fahrt nicht hätte machen dürfen. Aber die Gelegenheit für ein lukratives Handelsgeschäft war äußerst günstig, und die Gier hat ihn verblendet. Da hört er Veland einen panischen Schrei ausstoßen, und als Godric sich umdreht, sieht er drei weitere Schiffe aus der anderen Richtung auf sie zuhalten. Offenbar haben sie an der schonischen Küste gelauert, und auch ihre Decks sind voller Söldner.
«Die haben die Flaggen Danzigs gesetzt», sagt Veland. «Vielleicht machen die Danziger mit den Dänen gemeinsame Sache.»
«Sieht so aus», sagt Godric mutlos. Dann gibt er den Befehl, die Segel zu streichen, als Zeichen der Kapitulation, um zu retten, was zu retten ist.
Bald darauf geleiten die dänischen und Danziger Holke die englischen Handelsschiffe bis vor die seeländische Küste. Vom Land fliegen Möwen herbei und kreisen unheilvoll über den Masten, als die Schiffe im seichten Wasser die Anker setzen. Die Danziger bemannen ihre Beiboote, die Espings. Bewaffnete Männer klettern an Strickleitern hinein und rudern zu Godrics Schiff herüber. Der hat unterdessen allen an Bord eingebläut, unter jeglichen Umständen den Mund zu halten. Er allein werde die Verhandlung führen. Die Lage ist zwar bedrohlich, dennoch hat Godric die Hoffnung nicht aufgegeben. Vielleicht kann er die Angreifer überzeugen, seine Schiffe ziehen zu lassen.
Man lässt eine Strickleiter herab, und eine Abordnung der Danziger klettert aufs Großdeck, wo Godric sie erwartet. Er hat sich ein paar Sätze für den Empfang der ungebetenen Gäste zurechtgelegt und ringt sich ein Lächeln ab. Doch es verschlägt ihm die Sprache, als ihm plötzlich ein riesenhafter Mann gegenübersteht, der ihn mindestens um anderthalb Köpfe überragt, und Godric ist selbst nicht gerade klein. Der Hüne hat ein breites, bartloses Gesicht, und seine dunklen Augen stehen irritierend weit auseinander. Er hat die Schultern eines Ochsen und Hände wie Bratpfannen. Unter dem grauen Umhang trägt er ein Kettenhemd, und in einer ledernen, mit Fell gefütterten Scheide steckt ein langes Schwert. Klinge und Rüstung, beide offensichtlich sehr wertvoll, weisen ihn als einen Krieger höheren Ranges aus.
Godric legt den Kopf in den Nacken und schaut zu dem Hünen auf, aus dessen seltsamen Augen ihn ein finsterer Blick trifft. «Mein Name ist Aldwyn Godric», sagt er in der Sprache der Deutschen, die er leidlich beherrscht. «Seid Ihr der Schiffer der Danziger?»
Der Hüne zuckt nur mit den Schultern, dann dreht er sich um und befiehlt seinen Männern, von denen inzwischen gut ein Dutzend an Bord geklettert sind, die Besatzung auf dem Großdeck zusammenzutreiben und zu fesseln.
«Ich protestiere gegen diese Behandlung», sagt Godric. «Mit welchem Recht überfallt Ihr uns? England befindet sich weder mit Dänemark noch mit Danzig im Krieg. Wir sind rechtschaffene Seefahrer und Kaufleute, und wir segeln nach Nowgorod, um …»
«Halt dein Maul», schneidet ihm der große Kerl das Wort ab.
Doch Godric denkt nicht daran. Er darf nicht klein beigeben, sonst haben sie gleich verloren. Auch wenn er vor Angst innerlich bebt, kommt es jetzt auf sein Verhandlungsgeschick an. Er hat schon Überfälle von Seeräubern im Mittelländischen Meer, im Atlantik und in der Nordsee erlebt. Und überlebt. Nicht umsonst hat man ihn zum Schiffer einer ganzen Handelsflotte gemacht. Dennoch hat er noch nie so ein ungutes Gefühl gehabt.
«Nennt mir Euren Namen», sagt er.
Der bärengroße Kerl beugt sich zu Godric vor. Die auseinanderstehenden Augen funkeln böse, die Nasenflügel weiten sich bebend, und dann legt er seine Pranken um Godrics Hals und sagt: «Ich reiße dich auseinander und füttere die Möwen mit deinen Eingeweiden …»
Godric ringt verzweifelt um Atem, als plötzlich noch eine andere Stimme zu hören ist: «Warte damit noch, Eler.» Der harte Griff um Godrics Hals löst sich, und er sinkt auf die Knie nieder, während er keuchend Luft einzieht und das Herz ihm gegen den Brustkorb hämmert.
Ein anderer Mann tritt vor ihn hin. «Händigt mir Eure Schiffspapiere aus, Engländer», sagt er mit nicht unangenehm klingender Stimme.
Godric blickt zu dem Mann auf. Sein Haar ist so dunkel wie das eines Südländers. Im harten Kontrast dazu stehen seine hellen Augen. Der Blick ist kalt wie eine Frostnacht, und zugleich ist es der traurigste Blick, den Godric je gesehen hat.
«Seid Ihr … der Schiffer der Danziger?», fragt Godric japsend.
«Der bin ich», antwortet der Mann, der aussieht wie ein Krieger, ein dunkler Krieger. Die hervortretenden Wangenknochen zucken, und auf den Lippen inmitten des ungepflegten dunklen Barts liegt ein zorniger Ausdruck.
«Darf ich Euren Namen erfahren?»
«Erst gebt Ihr mir die Schiffspapiere.»
Godric steht langsam auf. Er hofft, mit dem unheimlichen Schiffer verhandeln zu können, denn der scheint verständiger zu sein als das riesige Monster. «Ich kann mir nicht vorstellen», sagt Godric, «dass Ihr einen Kaperbrief besitzt, der Euch berechtigt, englische Schiffe aufzubringen.»
«Mag sein, dass ich keinen Kaperbrief habe», erwidert der Schiffer und streicht sich über den Bart. Dass ihm dabei die Hand zittert, entgeht Godric nicht. «Aber Eure Ladung ist so oder so beschlagnahmt», fährt der Mann fort. «Die Schiffspapiere würden es einfacher machen, uns einen Überblick über den Wert Eurer Ladung zu verschaffen.»
«Dazu habt Ihr kein Recht», sagt Godric. Obwohl ihm klar ist, dass es besser wäre, der Forderung nachzukommen, versucht er, Zeit zu schinden. Außerdem widerstrebt es ihm, diesen Seeräubern ohne Widerstand nachzugeben. «Wir stehen unter dem Schutz der englischen Krone», sagt er.
«Wo ist sie denn, die Krone?» Der Schiffer schaut sich zu seinen Kriegern um, die die Besatzung inzwischen auf dem Großdeck zusammengetrieben und gefesselt haben. Die Männer brechen in lautes Gelächter aus. Nur der Hüne lacht nicht. Aber der sieht auch nicht so aus, als würde er jemals lachen.
«Der englische König Edward wird Euch dafür zur Verantwortung ziehen», beharrt Godric.
Der Schiffer wendet sich an den großen Kerl: «Wolltest du ihn nicht zerreißen und an die Möwen verfüttern?»
«Ja.»
«Mit bloßen Händen? Glaubst du wirklich, dass du das schaffst?»
«Wenn nicht, schneid ich ihn mit dem Messer auf.»
Der Schiffer schaut in den Himmel, der sich in der Abenddämmerung allmählich verdunkelt. Über den Masten kreisen noch immer die Möwen. «Sie haben Hunger», sagt er tonlos. «Vielleicht riechen sie schon sein Blut.»
Das ist der Moment, an dem Godric endlich bewusst wird, dass sein Widerstand zwecklos ist. Er hört die Vögel kreischen, als er ergeben sagt: «Bitte nicht, Herr. Ich gebe Euch ja die Papiere!»
«Das hättet Ihr Euch früher überlegen sollen, Engländer.» Jetzt schaut der dunkle Krieger zu Veland, der etwas abseits mit auf den Rücken gefesselten Händen auf dem Großdeck sitzt, und sagt dann: «Wir werden die Papiere auch ohne Eure Hilfe finden, nicht wahr?»
Veland, der feige Verräter, nickt mit gesenktem Kopf, und der dunkle Krieger sagt zu seinem schauerlichen Gehilfen: «Dann lass mal sehen, ob du den Engländer mit bloßen Händen zerreißen kannst.»
Als der Hüne drohend die Pranken hebt, legt ihm der Schiffer eine Hand an den Arm und hält ihn zurück. «Warte noch, Eler, wirf ihn einfach über Bord. Vielleicht kann er schwimmen und schafft es bis zur Küste, dann soll er frei sein.»
«Hat er das verdient?», fragt der Hüne.
«Hat nicht jeder Mann eine zweite Gelegenheit verdient?»
«Ich weiß nicht. Wirklich jeder?»
Der dunkle Krieger schüttelt den Kopf. Er wirkt erschöpft. «Nein», sagt er dann, «du hast recht. Nicht jeder Mann hat das verdient, einer nicht.»
Dann dreht er sich um und geht weg, und der große Kerl packt Godric, zerrt ihn unter dem Gelächter der Krieger übers Großdeck. Godric schlägt das Herz bis zum Hals, er kann zwar schwimmen, aber wird er es bis an die Küste schaffen? Das Wasser ist kalt, und seine nassen Kleider werden ihn in die Tiefe ziehen …
Schon hat der Hüne ihn auf die Reling gewuchtet, als Godric ihn anfleht, ihm noch eine Frage zu beantworten: «Wer … ist dieser Mann?»
«Er heißt Paul Beneke. Merk dir den Namen, Engländer. Wenn du das hier überlebst, wirst du ihn ganz sicher bald wieder hören.»
I. TeilBeneke
Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen,
das hatte zehn Hörner und sieben Häupter
und auf seinen Hörnern zehn Kronen
und auf seinen Häuptern lästerliche Namen.
Offenbarung des Johannes 13.1
1.London – Juli 1468
Der Tag, an dem der Kaufmannsgeselle Till Landers den Namen Paul Beneke das erste Mal hören wird, beginnt mit einer Katastrophe. Ein dünner Lichtstrahl quält sich im Morgengrauen durch den Dunst über Londons Hafenviertel und bohrt sich durch die Ritzen zwischen den Fensterläden. Till Landers, der aus der Stadt Wismar stammt, blinzelt in die matte Helligkeit. Etwas hat ihn geweckt, aber nicht das Licht, sondern es sind die lauten Geräusche draußen. Er setzt sich im Bett auf und schaut sich in der kleinen Kammer um, in der er zusammen mit David Divessen seit einigen Wochen zur Miete wohnt. Divessen ist aus Danzig, genau wie Landers neunzehn Jahre alt und ebenfalls Kaufmannsgeselle.
Landers schüttelt sich. In seinem Kopf machen sich die Nachwirkungen des Rotweins vom gestrigen Abend bemerkbar. Deutlich hört er jetzt aufgeregte, laute Stimmen, die aus Richtung der Thames Street zu kommen scheinen. Irgendetwas ist da unten im Gange, eine lärmende Unruhe, und es klingt anders als üblicherweise, wenn Landers in der Kammer über der Weinschenke The Laughing Goose im belebten Dowgate-Viertel aufwacht. Jeden Morgen klappen die Händler die Auslagen vor ihren Läden herunter, Kinder weinen, Frauen schimpfen, Männer husten und spucken, Karrenräder knallen aufs Kopfsteinpflaster, Hunde bellen, Pferde schnauben, und Schweine quieken.
Doch an diesem Morgen geht da draußen etwas anderes vor sich.
Im Bett sitzend, massiert Landers sich die Schläfen mit den Daumenballen. Eine Böe drückt gegen die Fensterläden, und der modrige Geruch des Themsewassers zieht durch die Gassen hinauf in die Kammer. Divessen, der hagere Kerl, der neben Landers im Bett liegt, schläft noch. Der Atem entweicht in pfeifenden Stößen seinem halb geöffneten Mund.
Sie haben gestern Abend mit anderen Gesellen und Kaufleuten unten in der Schenke auf Landers’ erstes erfolgreiches Handelsgeschäft angestoßen. Bald wird er nach Wismar heimkehren können – auf einem Schiff, beladen mit englischem Tuch, das Landers in London günstig eingekauft hat. In Wismar wird ihn Juta, die Tochter des Wismarer Ratsherrn und Kaufmanns Hinrich Reckemann, voller Sehnsucht erwarten. Mit Gottes Segen werden sie heiraten, Kinder bekommen, und Landers wird als Kaufmann in Reckemanns Dienste treten und irgendwann das Handelshaus übernehmen. Er wird wohlhabend und einflussreich sein, ein angesehener Kaufmann, ein Ratsherr. Das ist Landers’ Plan, und es ist ein guter Plan, vor allem für einen Jungen, dem das Glück nicht in die Wiege gelegt wurde.
Draußen werden die Stimmen lauter, irgendwer schreit, dann brüllen Leute durcheinander.
Der Lärm weckt jetzt auch Divessen. Er öffnet die verquollenen Augen. «Was’n das für ’n Krach?»
«Weiß ich nicht», erwidert Landers. Er steigt aus dem Bett und schiebt sich vorbei an den Holztruhen, in denen sie ihre Habseligkeiten aufbewahren: Kleidung, Bücher, Schreib- und Rechengeräte. Als er die Fensterläden aufstößt, sieht er den Rauch, der über Londons Dächern hängt wie eine Glocke. Unter dem Fenster führt die mit Unrat übersäte Windgoose Lane von der Thames Street hinunter zum Kai am Themseufer. Sie ist auf der einen Seite gesäumt von zweistöckigen, schmalen Wohnhäusern und auf der gegenüberliegenden Seite von den hohen Mauern der Guildhall, der hansischen Niederlassung in London, in der Landers und Divessen ihre Geschäfte tätigen.
Durchs Fenster schwappt die vom Gestank des Hafenviertels getränkte Luft in die Kammer, es riecht nach Schwefel und Fisch, Rauch und Fäkalien. Landers beugt sich weit in die Fensteröffnung vor und wirft einen Blick die Windgoose Lane hinauf. An der Einmündung in die Thames Street hat sich eine aufgebrachte Menschenmenge versammelt. Landers kann kaum glauben, was er sieht. Die Menschen drängen sich vor dem Tor des Stalhofs, wie das Kontorsgelände mit der Guildhall genannt wird. Sie recken die Fäuste und rufen Schmähungen. In der Menge befinden sich auch mehrere Büttel, die Gerichtsdiener, die Landers an ihrer Kleidung zu erkennen glaubt. Er sieht Stadtknechte, die mit Knüppeln, Hellebarden und Kurzschwertern bewaffnet sind, und etwas abseits der Menge Schützen mit Armbrüsten. Männer schlagen mit Fäusten und Knüppeln gegen das Holztor des Stalhofs und fordern Einlass. Was ist da nur los? Landers hat kein gutes Gefühl bei der Sache, schließlich lagern im Stalhof noch seine Tuchballen für den Abtransport.
Divessen scheint ähnliche Sorgen zu haben, als er sich neben Landers in die Fensteröffnung schiebt und beide dem irritierenden Treiben in der Thames Street eine Weile zuschauen. Plötzlich verstummen die Männer am Tor, lassen Fäuste und die Knüppel sinken und drehen die Köpfe zur Pfarrkirche All Hallows the Great. Aus Richtung der Kirche kommt ein beleibter Mann herangelaufen, der die Leute am Tor mit lautstarken Flüchen überzieht.
«Den Dicken hab’ ich schon mal gesehen», sagt Divessen.
«Das ist Hermen Bloting, ein Kaufmann aus Hamburg», erwidert Landers. «Dem gehört ein Haus in der All Hallows Lane.»
Bloting sieht aus, als wäre er gerade aus dem Bett gefallen. Schief über seinen Schultern hängt ein scharlachroter Mantel, das helle Haar steht ihm wirr vom Kopf ab. Die Menge weicht vor der wuchtigen Gestalt zurück, als Bloting in der Sprache der Engländer ruft: «Was hat dieser Aufruhr zu bedeuten? Der Stalhof gehört den Hansen. Hier haben die Londoner nichts zu suchen. Euer König Edward hat den hansischen Kaufleuten alle Privilegien gewährt und erneuert.»
Die Menschen rufen wild durcheinander. Offenbar finden ihre Worte nicht Blotings Zustimmung. Als er die Stimme wieder erhebt, hört Landers zum ersten Mal den Namen Paul Beneke.
«Ich kenne keinen Paul Beneke», ruft Bloting. «Habe nie was von dem gehört. Wenn der Mann englische Schiffe gekapert hat, müsst Ihr Euch an diesen Beneke halten, anstatt ehrenwerte hansische Kaufleute zu belästigen. Und jetzt schert Euch allesamt zum Teufel!»
Doch die Leute denken gar nicht daran. Sie fordern, man solle das Tor zum Stalhof öffnen, die Hansen müssten Waren und Geld herausgeben für die Schäden, die Beneke angerichtet habe.
«Ich kann diesen Bloting eigentlich nicht leiden, so ein geiziger, jähzorniger Pfeffersack», sagt Landers. «Aber er ist der Einzige, der sich gegen die Menge stellt, um den Stalhof zu beschützen.»
Divessen stimmt ihm nickend zu. «Meine Sachen sind da auch noch drin. Ich bete dafür, dass die Leute nicht den Stalhof stürmen und sich unser Zeug unter den Nagel reißen.»
Bloting versucht jetzt, Büttel, Stadtknechte und Schaulustige vom Tor wegzudrängen, während er brüllt: «Weder ich, Hermen Bloting, noch irgendein anderer hansischer Kaufmann wird sich von Euch beschissenen Londonern ausplündern lassen!»
Landers bekommt es mit der Angst. Sie müssen ihre Güter vor der tobenden Menge beschützen. Wo sind denn nur die Torwächter aus dem Stalhof und all die anderen Hansen, die zu Hunderten im Dowgate-Viertel leben? Niemand steht Bloting bei. Auch Landers ist nicht wohl bei dem Gedanken, sich da unten auf die Thames Street zu wagen, um sich mit Stadtknechten und anderen Bewaffneten anzulegen. Er ist ja keiner, der in der ersten Reihe stehen muss, wenn es Ärger gibt. Gewalt schreckt ihn ab, und er hat Angst vor Schmerzen, er zuckt ja schon zusammen, wenn jemand in seiner Nähe zu laut redet. Nein, als Krieger taugt er nicht, er versteht sich auf Zahlen, auf Schrift, Wörter, aber, nun ja, ein Feigling ist er natürlich auch nicht, und deshalb sagt er: «Wir müssen Bloting helfen!»
«Aber … warum denn ausgerechnet wir …?», entgegnet Divessen entsetzt.
In dem Moment öffnet sich das Tor des Stalhofs, und hansische Kaufleute stürmen zusammen mit ihren Knechten auf die Thames Street. Viele sind mit Knüppeln und Messern bewaffnet und drängen die Londoner vom Tor weg. Doch sogleich strömen aus allen Ecken Leute herbei, alte und junge Männer, sogar Frauen und Kinder kommen aus den Gassen. Offenbar hat sich der Aufstand am Stalhof schnell herumgesprochen, und nun will jeder dabei sein, wenn es den Hansen an den Kragen geht, denn die sind bei den Londonern so beliebt wie Durchfall. Die anwachsende Menschenmenge schwappt über die Thames Street. Einige Leute haben sich mit Holzlatten und Knüppeln bewaffnet, andere sammeln lose Steine von der Straße. Man ergeht sich in Drohgebärden und schimpft auf die Hansen: Sie sollen aus London verschwinden, denn sie nehmen den Einheimischen die Arbeit weg und zahlen keine Steuern an den König; stattdessen verdrecken sie die Gassen mit ihrem Unrat, lärmen betrunken in den Schenken, belästigen englische Frauen und treiben die Preise für Lebensmittel und Häuser in Höhen, die für die Londoner selbst unerschwinglich sind. Die Menge brodelt.
Landers hat genug gesehen. Er muss helfen, den Stalhof zu verteidigen. Er zieht sich an und hängt sich an einem Band das kleine Ledersäckchen um den Hals, in das er vor seiner Abreise in Wismar eine Haarsträhne von Juta gesteckt hat – als Andenken und als Glücksbringer. Vom Brennholzhaufen am Kamin greift er sich ein Aststück, um es als Knüppel einzusetzen. Vor Aufregung trommelt sein Herz heftig. So hat er sich seine letzten Tage in London bestimmt nicht vorgestellt.
Divessen liegt noch immer weit vorgebeugt in der Fensteröffnung und ruft panisch: «Landers – sieh doch nur!»
Als Landers hinzueilt, sieht er, dass Bloting einen Büttel am Hals packt und ihn heftig schüttelt wie einen toten Dorsch. Doch da springt ein Stadtknecht herbei und stößt sein Schwert in Blotings Bauch.
Landers stockt der Atem. Dieser verdammte Aufruhr wächst sich ja zu einer blutigen Schlacht aus.
«Diese Schweinehunde», schreit Divessen. Sie stürmen aus der Kammer, die Holztreppe hinab, raus auf die Windgoose Lane und hinauf zur Thames Street. Sie werden von ohrenbetäubendem Geschrei empfangen. Mehrere Männer liegen inzwischen auf dem blutigen Straßenpflaster. Überall hauen, stechen und knüppeln die Leute aufeinander ein.
Landers steht verloren mit dem Aststück da. Was soll er nur tun? Einen solchen Kampf hat er noch nie erlebt. Da bemerkt er einen Jungen von höchstens zwölf Jahren, der ihn aus der prügelnden Menschenmenge heraus anstarrt. Sein Gesicht ist bleich und schmutzig, die Kleider sind zerlumpt und löchrig. Landers ist wie gebannt vom hasserfüllten Blick des Burschen, als er plötzlich Divessens warnende Stimme hört: «Pass auf, Landers, der Junge hat ’nen Stein!»
Doch der Bursche holt bereits aus und wirft. Landers verspürt einen harten Schlag gegen die Stirn. Blitze zucken durch seinen Kopf, und dann kommt Dunkelheit über ihn.
2.London – August 1468
Der Hass in den Augen des Jungen verfolgt Landers bis in die Kerkerzelle, in die man ihn mit Divessen und zwei anderen Männern sperrt. In den Tagen nach dem Angriff auf den Stalhof findet Landers kaum Schlaf. Wirre Träume schrecken ihn auf; es sind Albträume, in denen der Junge mit irrem Blick Steine auf Juta wirft, während Landers zusehen muss, wie sie von den Steinen zerschmettert wird.
Landers liegt rücklings auf dem harten, mit einer dünnen Schicht Stroh bedeckten Boden, eingehüllt in Schwärze. Er hält das Ledersäckchen in der Faust, atmet staubige Kerkerluft und wartet, bis die Panik abklingt. Dann öffnet er das Säckchen, nimmt Jutas Haarsträhne heraus und riecht daran. Ihr Haar ist sein Licht in der Finsternis, der liebliche Duft in dem Gestank aus Schweiß, fauligem Stroh und dem, was in dem Eimer schwappt, in den die vier Gefangenen ihre Notdurft verrichten. Er atmet Jutas Duft ein und denkt an sie. Wie Milch riecht sie, wie Milch und Gras, frisch gemähtes Gras.
Wie konnte es nur so weit kommen? Wo ist er da nur hineingeraten? Er sollte längst wieder in Wismar sein – ein erfolgreicher Kaufmannsgeselle mit einer Schiffsladung englischen Tuchs für Hinrich Reckemanns Handelshaus. Mit hohem Gewinn hätten sie das Tuch weiterverkauft, und Landers’ Lohn wäre die Anstellung in Reckemanns Handelshaus gewesen – und Jutas Hand.
Nun wird er all das verlieren, wovon er geträumt hat. Alles steht auf dem Spiel, was er in seinem Leben erreichen wollte. Die Londoner haben die gesamte Ladung Tuche, die Landers nach Wismar bringen wollte, konfisziert, und es sieht nicht so aus, als würde er einen einzigen Ballen wiedersehen. Er wird also mit leeren Händen nach Wismar zurückkehren müssen, vorausgesetzt, er überlebt den Kerker. Und das viele Geld, das Reckemann in die Reise seines Gesellen investiert hat, ist verloren. Reckemanns Warnung war unmissverständlich: Landers würde nur eine Anstellung als Kaufmann in der Compagnie bekommen, wenn sein erstes großes Handelsgeschäft erfolgreich wäre. Wenn nicht, würde Landers’ Karriere vorbei sein, bevor sie begonnen hatte.
Und Juta würde nie seine Frau werden.
Um diese verlorene Zukunft kreisen Landers’ Gedanken in der Dunkelheit des Kerkers – und auch um den Überfall auf den Stalhof. Mindestens sechzig hansische Kaufleute und ihre Angestellten sind in Gefangenschaft geraten. Die Londoner haben die Guildhall versiegelt und alle Waren beschlagnahmt, die sie in die Finger bekamen, so wie Landers’ Tuche. Einige Kaufleute wurden in den Kerker des Tower of London gesperrt, die übrigen verteilte man auf Verliese im Stadtgebiet. Landers und Divessen landeten in diesem Kerker in einer Gegend Londons, in der Landers nie zuvor gewesen war.
Die Verhandlungen vor Gericht waren ein Possenspiel, bei dem die Urteile vorher feststanden. Die Anklage warf den Hansen vor, sie hätten in London für Kaperfahrer aus Danzig und Dänemark spioniert, die im Frühjahr 1468 im dänischen Sund sieben englische Handelsschiffe überfallen, ausgeplündert und mehrere englische Seeleute getötet hatten. Dass diese Seeräuber im Auftrag der Städte und Länder andere Schiffe plünderten und zerstörten, war nicht ungewöhnlich. Die Verteidigung der hansischen Kaufleute versuchte, die alleinige Schuld für den Überfall auf die Dänen zu schieben. Die Dänen seien erbost über die englischen Übergriffe in Island, wo die Dänen das Monopol für sich beanspruchten. Dennoch hielten die Engländer an ihrem Vorwurf fest, hansische Schiffe – und zwar Schiffe aus Danzig – hätten die Dänen bei dem Überfall unterstützt. Dafür gebe es Zeugen. Daher sei es das gute Recht der Engländer, die Hansen in London zu inhaftieren und ihre Güter zu beschlagnahmen. So ging es lange hin und her, ohne dass eine Seite von ihren Behauptungen abwich. Letztlich ausschlaggebend für die Verurteilung der Hansen war vermutlich, dass die englischen Kaufleute verlangten, die Hansen dürften nie wieder Geschäfte in England machen. Denn die hansische Konkurrenz war für die Engländer bedrohlicher als ein möglicher Seekrieg. Und so nahm König Edward den Überfall auf die Baienfahrer zum Vorwand, um mit der Hanse zu brechen.
Während der Verhandlungen hörte Landers wieder den Namen Paul Beneke. Er sei, so hieß es, der Anführer einer Seeräuberbande. Die Anklage zeichnete ein monströses Bild von ihm: «Dieser Mann aus Danzig ist der abscheulichste und gewissenloseste Seeräuber, der je unter englischen Schiffen geheert hat», behauptete ein Ankläger im Gerichtssaal. Beneke sei der Teufel in Menschengestalt. Überlebende hätten berichtetet, dass Beneke den englischen Gefangenen die Bäuche aufgeschnitten und ihre Gedärme an die Möwen verfüttert habe.
Landers erschauerte bei der Vorstellung dieser Grausamkeiten. Viele Kaufleute bezweifelten indes, dass die Vorwürfe der Anklage der Wahrheit entsprachen. Auch Landers hatte arge Zweifel am Vorgehen der Londoner Justiz. Als man ihn zu seiner angeblichen Spionagetätigkeit befragte, sagte er aus, dass er erst vor wenigen Wochen nach London gekommen sei, also lange nach dem Überfall im dänischen Sund. Wie hätte er da für Beneke spionieren können?
Die fetten Richter in den scharlachroten Roben glotzten ihn unter ihren staubigen Perücken an wie schleimigen Auswurf, und dann lachten sie ihn aus. Es kam, wie es kommen musste: Das Gericht verurteilte die hansischen Kaufleute zu einer Kollektivstrafe. Sie sollten die unvorstellbare Summe von 20000 Pfund Sterling an König Edward IV. zahlen. Damit seien dann die Verluste für die Schiffe und das Baiensalz ausgeglichen. Am lautesten protestierten Kaufleute aus Köln gegen das Urteil, die behaupteten, sie hätten mit dem Streit zwischen der Hanse und England nichts zu tun. Schuld seien die östlichen Hansen, die Osterlinge, wie die Wendischen und die Danziger genannt wurden, die unter der Führung Lübecks gegen England vorgehen würden. Die Kölner schworen, sie seien unschuldig, und sie beriefen sich auf ihre seit alters her guten Beziehungen zu England. Tatsächlich ließ man daraufhin einige Kölner frei und gab ihnen ihre Kammern im Stalhof und die konfiszierten Güter zurück. Aber angesichts der vielen Gefangenen hatten die Engländer den Überblick verloren, und so wurden nicht alle Kölner begnadigt, weswegen ein beleibter, unwirscher Kaufmann aus Köln mit Landers und Divessen in der Zelle landete. Sein Name ist Alf Sweinheim.
Der vierte Mann in der Zelle, ein schmalbrüstiger Handelsgeselle aus Rostock, heißt Hinrik Droste, und der scheint zusehends dem Wahnsinn zum Opfer zu fallen.
Landers steckt Jutas Strähne wieder in das Ledersäckchen und blinzelt in den Lichtstrahl, der durch eine Öffnung oben im Mauerwerk in das etwa zehn Fuß im Geviert messende Kerkerloch fällt. Landers gegenüber sitzt Divessen mit dem Rücken an die Wand gelehnt, neben der massiven Holztür. Der Kölner Sweinheim sitzt zu Landers’ linker Seite und Droste mit bis auf die Brust herabgesunkenem Kopf rechts von ihm. So verbringen sie ihre Tage, schweigend, abwartend. Die quälende Eintönigkeit zerrt an ihren Nerven, und wie es scheint, hat Droste den Kampf gegen den Irrsinn fast verloren. Den ersten Anfall hatte er schon nach wenigen Tagen im Verlies. Er fing an zu brüllen und war durch nichts zu beruhigen. Es hörte sich an, als schrie er sich die Eingeweide aus dem Leib.
Jetzt sind hinter der Kerkertür gedämpfte Stimmen und Schritte zu hören. Der Schlüssel knirscht im Schloss, und die Tür öffnet sich. Stadtknechte bringen das Mittagessen in einer Schüssel herein, aus der sie mit einer Kelle Brei in vier kleine Schalen schöpfen. Dann fällt die Tür wieder zu, und der Schlüssel dreht sich im Schloss.
Das Geräusch des Schlüssels lässt Droste zusammenzucken. Sein Kopf ruckt hoch, der Mund öffnet sich, und er beginnt wieder zu schreien, dass es einem durch Mark und Bein fährt. Sweinheim löffelt seinen Brei und verdreht genervt die Augen, während Landers und Divessen Droste mit Sorge beobachten, als die Schreie plötzlich abbrechen. Er hält sich die rechte Hand vor den Mund, dann beißt er in sein Handgelenk. Die Adern platzen auf, und Blut fließt über sein Gesicht und färbt den hellen Bart dunkelrot. Dabei stößt er gurgelnde Geräusche aus, die wie irres Gelächter klingen, bevor er sich das andere Handgelenk vornimmt.
Landers und Divessen sind schnell bei ihm. Divessen versucht, ihn festzuhalten, während Landers von seinem Hemd einen Streifen abreißt. Als er das Leinen um Drostes rechtes Handgelenk binden will, wehrt der sich aus Leibeskräften, und das Blut strömt nur so aus ihm heraus.
«Du musst es schaffen, sonst verblutet er», ruft Divessen.
Sweinheim stöhnt über seiner Breischale. «Na und? Der Verrückte will doch sterben.»
Die Zellentür wird wieder geöffnet, und die vom Lärm alarmierten Stadtknechte kommen hereingelaufen. «Droste verblutet», ruft Landers auf Englisch. «Wir müssen ihm den Arm abbinden, allein schaffe ich das nicht …»
Die Stadtknechte drängen Landers und Divessen weg und schleifen Droste an den Füßen aus der Zelle. Eine Blutspur bleibt hinter ihm im zerwühlten Stroh zurück. Die Tür fällt zu, und dann ist nur noch Drostes irres Lachen zu hören.
Landers zittert vor Zorn und Verzweiflung am ganzen Leib. Inzwischen müssen mehrere Stunden vergangen sein. Im Kerker ist es dunkel, von draußen dringt schon seit einer Weile kein Licht mehr herein. Von Droste ist nichts zu hören, kein Lachen, kein Geschrei.
«Ob sie seine Wunde versorgt haben?», fragt Divessen in die finstere Stille.
«Sollen sie ihn doch verrecken lassen», gibt Sweinheim zurück. «Ist ja alles Eure Schuld. Euch Wendischen und Danzigern haben wir es zu verdanken, dass wir in dem verdammten Verlies sitzen. Ihr habt die Engländer überfallen, dafür sollten sie Euch aus London verbannen. Aus der ganzen Nordsee sollen sie Euch jagen. Wir Kölner haben das Recht, die Guildhall auch ohne Euch zu betreiben. Schließlich waren es Männer aus Köln, die die Guildhall mit dem Weinhandel einst etabliert haben …»
«Ja, ja», sagt Landers mürrisch. Sweinheims Gerede geht ihm auf den Geist, und er will gerade etwas darauf erwidern, als er vor der Tür Stimmen hört.
Der Schlüssel dreht sich knirschend im Schloss. Dann fällt Licht in die sich öffnende Tür. Im Schein einer Fackel schleppen die Stadtknechte einen leblosen Körper in die Zelle und legen ihn neben dem Notdurfteimer ab. Landers entfährt ein Stöhnen, als er in das zur Maske erstarrte, bleiche Gesicht Drostes blickt. Ein weiterer Mann tritt in der Zelle. Er trägt einen pelzbesetzten Mantel und hält sich angewidert vom Gestank ein Tuch vor die Nase. Er blickt in ein kleines Buch und sagt mit vernuschelter Stimme in der Sprache der Engländer: «Die Herren Till Landers, David Divessen und Alf Sweinheim sollen eine behördliche Erklärung unterzeichnen. Darin bestätigen die Herren, dass der Häftling Hinrik Droste gegen Gottes Gebot verstoßen und sich selbst das Leben genommen hat. Londons Justiz trägt keine Mitschuld an seinem Tode …»
«Ich unterschreibe, Herr», ruft Sweinheim eifrig. «Mein Name ist Alf Sweinheim. Ich bin Kaufmann aus Köln, ein Freund Eurer großartigen Stadt und aller ehrenwerten Londoner. Meine Inhaftierung ist ein Irrtum. Man muss mich sofort freilassen, Herr, so wie man es mit den anderen Kölner Kaufleuten getan hat.»
Der Mann zuckt mit den Schultern. Ein Stadtknecht wirft einen leeren Sack neben Drostes Leiche, dann stellt er ein Kästchen und eine brennende Öllampe auf dem Brett über dem Notdurfteimer ab.
«In der Kiste sind Nadel und Faden», nuschelt der Mann hinter dem Tuch. «Wenn sich die Herren von dem Leichnam verabschiedet haben, sollen sie ihn in den Sack stecken und ihn zunähen. Er wird morgen früh abgeholt, und dann unterzeichnen die Herren die Erklärung.»
«Darf ich eine Frage stellen?», wagt sich Divessen vor.
Der Mann, er könnte ein Advokat sein oder gar ein Richter, nickt widerwillig.
«Was geschieht mit der Leiche?»
«Nun, wir sind keine Unmenschen», antwortet der Mann. «Ein Pfarrer wird ihn segnen. Dann wird er außerhalb der Stadtmauern auf einem Elendfriedhof bestattet, in einem namenlosen Grab, ohne Glockenklang, Gesang und Abdankung.»
Als der Mann zur Tür geht, springt Sweinheim vom Boden auf und eilt ihm nach. «Man muss mich freilassen …», kreischt er. Doch er stößt mit den Füßen gegen Drostes Leiche und fällt ins Stroh. Die Tür wird geschlossen. «Es ist ein Irrtum, ein Irrtum», jammert Sweinheim und fängt an zu weinen.
Später kniet Landers im Licht der Öllampe neben Drostes Leiche, die seltsam friedlich und erlöst aussieht. Vor dem Überfall auf den Stalhof war Landers Droste einige Male begegnet. Er mochte ihn. Droste lachte viel, er war ein lebensfroher Mann, der einen solchen Tod nicht verdient hatte. Schritte rascheln im Stroh, als Divessen herankommt und neben Landers niederkniet. In seinem Gesicht sind Spuren von Tränen. Sie nicken einander traurig zu, dann ziehen sie den Sack über Drostes Leiche und machen sich daran, den Sack mit Nadel und Faden aus dem Kästchen, das die Wärter dagelassen haben, zuzunähen.
«Immerhin findet er nun seinen Weg aus dem Kerker», sagt Divessen.
Da kommt Landers ein merkwürdiger Gedanke. Was wäre, wenn er Drostes Platz einnehmen würde? Nein, das ist unmöglich, das kann nicht gelingen. Oder doch?
Nach einer Weile beginnt Sweinheim zu schnarchen, auch Divessen hat sich hingelegt. Landers sitzt noch immer bei dem Leichensack, unter dem sich die Konturen von Drostes Körper abzeichnen. Soll er es wirklich versuchen? Landers spielt den Gedanken immer wieder durch. Er könnte die Naht auftrennen, Droste aus dem Sack ziehen, ihn unter eine Decke legen und sich dann selbst in den Sack einnähen. Morgen früh werden die Stadtknechte den Leichensack mitnehmen, und bevor man Landers’ Verschwinden bemerkt, wird er sich aus dem Sack befreien und fliehen. Ja, so könnte es laufen. Im günstigsten Fall. Und im ungünstigsten Fall? Kann er sich überhaupt alleine in den Sack einnähen? Und was ist, wenn Sweinheim aufwacht und Landers an die Wachen verrät? Oder wenn die Wachen feststellen, dass Droste nicht im Leichensack, sondern unter einer Decke auf Landers’ Platz liegt?
Aber hat er denn eine andere Wahl? Es wäre viel zu unsicher, darauf zu warten, dass die Hansen die 20000 Pfund Sterling für die Freilassung der Geiseln – denn nichts anderes sind die Gefangenen – aufbringen. Je länger Landers über den waghalsigen Plan nachdenkt, desto überzeugter ist er, dass er es tun und sich verbieten muss, daran zu denken, was geschehen wird, sollte der Plan scheitern.
Er lauscht angespannt auf Sweinheims Schnarchgeräusche und Divessens gleichmäßige Atemzüge, dann gibt er sich einen Ruck. Er beißt den Faden durch, löst die Naht und fängt an, Drostes bereits steif werdende Leiche aus dem Sack zu ziehen. Als er es fast geschafft hat, hört er hinter sich Divessen leise sagen: «Allein schaffst du das nicht, ich helfe dir.» Landers hat einen Kloß im Hals. Kann er Divessen vertrauen? Wie soll er sicher sein, dass der ihn nicht an die Wachen verrät, wenn sie die Leiche holen kommen?
Divessen scheint seine Gedanken zu erraten. «Ich muss zugeben, dass mir vorhin derselbe Einfall kam, aber offensichtlich bin ich nicht so mutig wie du», sagt er und nickt Landers aufmunternd zu. Sie ziehen Drostes Leiche auf Landers’ Platz, verstecken sie unter der Decke, dann schlüpft Landers in den Sack.
Divessen nimmt Nadel und Faden. «Wo willst du hingehen, wenn dir die Flucht gelingt?»
«Ich weiß es nicht», flüstert Landers. «Zunächst werde ich wohl abwarten, bis sich die Lage zwischen England und der Hanse wieder entspannt, und dann versuchen, meine Tuchballen zurückzubekommen, bevor ich nach Wismar heimkehre. Mit leeren Händen kann ich da nicht aufkreuzen.»
Divessen schüttelt den Kopf. «Das ist kein guter Plan. Ich glaube, es wird Krieg geben. Die Hanse kann sich den Überfall auf den Stalhof durch die Engländer nicht bieten lassen, und der Krieg könnte lange dauern, viele Jahre.»
«Was soll ich denn sonst tun?»
Divessen zuckt mit den Schultern. «Ich kann dir nur sagen, was ich tun würde, und ich würde mich der Danziger Flotte anschließen, um meinen Beitrag dafür zu leisten, dass wir diesen Krieg gewinnen. Wenn es zum Krieg kommt, schicken sie bestimmt Paul Beneke in die Nordsee.»
«Nach allem, was man so hört, muss er ein wahrer Teufel sein.»
«Kann schon sein. Man erzählt sich, dass er wegen irgendeiner Sache in Danzig im Kerker saß. Aber jetzt hat man ihn freigelassen, damit er gegen die Engländer kämpft. In meiner Heimatstadt feiern sie ihn als Helden. Aber nun lass uns schnell fertig werden. Die Morgendämmerung bricht bald herein.»
Und dann näht Divessen den Sack über Landers zu.
3.Brügge – Februar 1471
Während der Bankier und Kaufmann Tommaso Portinari durch die Gassen Brügges zur Vlamingstraat eilt, zieht über den Dächern der flandrischen Handelsstadt eine Gewitterfront herauf wie ein schwarzes Gebirge. Portinari hasst dieses Wetter, und er hasst Brügge. In diesen Wintertagen geht der Morgen nahtlos in die Abenddämmerung über. Die Tage sind grau und dunkel, kalt und feucht und so scheußlich wie Portinaris Laune, der auf dem Weg zu einem Schneider ist, um die Stoffe für Marias Hochzeitskleid auszuwählen.
Schon beginnt der Regen zu tröpfeln. Portinari gibt acht, dass er beim Gehen nicht in einen der dunklen Haufen tritt, die Menschen und Tiere überall auf den Straßen hinterlassen. Die Stadt ist eine Kloake, ein einziger Abort. So sieht Tommaso Portinari das, der stolze Florentiner und Faktorist des Bankhauses der berühmten Medici in Brügge. An diesem Morgen hat er es bislang immerhin geschafft, mit seinen geputzten Stiefeln weder in einen Kothaufen noch in eine der schmutzig braunen Pfützen zu treten. Vorhin ist er im Bladelinhof, in dem er wohnt und arbeitet, aufgebrochen. Aus einer Gasse kommend, biegt er jetzt nach links in die Vlamingstraat ein und hält auf die Vlamingbrug zu, die über eine der vielen Grachten führt, von denen Brügge durchzogen ist. Hinter der Vlamingbrug mit ihren steinernen Sitzbänken links und rechts befindet sich das Künstlerviertel an der Sint-Jorisstraat. Hier ist auch die Werkstatt des Schneiders in einer Nebengasse. Die Brücke ist in Sichtweite, als es dann doch passiert. Nur einen Moment hat er nicht aufgepasst, schon steht er mit einem Stiefel in einem stinkenden Haufen.
«Merda», ruft er hinter dem Schwein her, das mit verschmiertem Hintern über die Vlamingbrug davontrabt und das er für den Verursacher des Haufens hält. Die Stiefel haben viel Geld gekostet, sind aus nordischem Rentierleder gefertigt und mit Fellen russischer Eichhörnchen gefüttert. Was soll er nur tun? So mit Kot verdreckt kann er nicht vor den Schneider treten. Das würde sich herumsprechen, schließlich kennt man Portinari in Brügge. Soll er etwa zum Bladelinhof zurücklaufen und andere Stiefel anziehen? Während er noch mit seinem Missgeschick hadert, nimmt der Regen zu.
«Maledetta merda», ruft er in den trüben Himmel. Oh, wie er dieses Brügge hasst! Er hatte keine Ahnung, worauf er sich einließ, als die Medici ihn vor sieben Jahren nach Flandern schickten. Damals war Portinari voller Tatendrang, obwohl er schon über vierzig Jahre alt war. Und er fühlte sich den Medici verpflichtet, deren Patriarch Cosimo de’ Medici, der reichste Mann Europas, kurz zuvor, im Jahre des Herrn 1464, verstorben war. Nach dem frühen Tod von Portinaris Eltern hatten die Medici ihn als Ziehsohn aufgenommen. Er genoss eine hervorragende Ausbildung, lernte das Handwerk eines Kaufmanns und Bankiers. Danach arbeitete er sich stetig nach oben, und da erschien ihm das Angebot verlockend, die Leitung der Faktorei in Brügge von seinem Vorgänger Angelo di Jacopo Tani zu übernehmen.
Doch Portinari wusste nicht, in welches Drecknest man ihn schickte. Verglichen mit seiner Heimat, dem sonnigen Florenz, wo es nach Pinien, Zypressen und Thymian duftet, ist Brügge ein Vorort der Hölle, wenn nicht die Hölle selbst. Ja ja, es mag eine reiche und bedeutende Stadt sein, wenn nicht die bedeutendste Stadt Nordeuropas. Aber in den Gassen suhlen sich Schweine und Hunde im Dreck. Die Menschen hängen ihre nackten Hintern über die Kanäle und Straßen, um sich zu erleichtern. Es stinkt nach Abort, nach Kaminfeuer und Räucherfisch, nach saurem Hering und vergorenem Kohl. Und es regnet, es stürmt, es friert.
Und wegen des verdammten Krieges liegt jetzt auch noch die Wirtschaft am Boden. Vor etwa zweieinhalb Jahren eskalierte der lange schwelende Streit zwischen England und der Hanse. Die Osterlinge erklärten den Engländern den Krieg und schickten ihre Kriegsschiffe, die Orlogschiffe, in die Nordsee. Doch die verfluchten hansischen Seeräuber kapern mit Erlaubnis ihrer Städte nicht nur englische Schiffe, sondern auch Schiffe anderer Länder, die Waren von und nach England transportieren. Die Engländer wiederum überfallen die Schiffe der Hanse, und das Ergebnis ist, dass aus Flandern kaum noch Waren ausgeschifft werden oder hierhergelangen.
Portinari hört schreckliche Geschichten über diesen Seekrieg. Dabei fällt häufig der Name eines grausamen hansischen Kaperfahrers. Paul Beneke heißt der Kerl, und er soll ein wahrer Teufel sein. Die Engländer nennen ihn daher The Devil. Portinari hat den Mann noch nie gesehen, obwohl der sich häufig ganz in der Nähe in der Hafenstadt Sluis aufhalten soll. Und Portinari wünscht diesem Beneke, dessen Überfälle zu großen Verlusten bei seinen Geschäften führen, wirklich die Pest an den Hals.
Der Regen pladdert ihm auf den Kopf, während er seinen dreckigen Stiefel betrachtet, als er aus den Augenwinkeln eine Gestalt bemerkt, die die Vlamingbrug überquert. Es ist ein dürrer Knabe von zehn oder elf Jahren in fleckigen, fadenscheinigen Kleidern, der aussieht, als wäre er aus einem Erdloch hervorgekrochen.
«He, du da, Junge, komm er mal her», ruft Portinari in der Sprache der Flandern.
Der Junge zieht den Kopf ein. Ängstlich schaut er den in Pelz und Seide gewandeten Bankier an, der, jetzt um etwas mehr Freundlichkeit bemüht, ruft: «Komm er schon her zu mir.»
Der Knabe bleibt einige Schritte entfernt stehen. Sein Gesicht ist mit Dreck und Rotz verschmiert. Das Haar hängt ihm in nassen Strähnen ins bleiche Gesicht. Portinari schüttelt es innerlich vor Ekel. Hoffentlich hat der Bursche keine ansteckende Krankheit.
Portinari fischt aus der Geldbörse an seinem Gürtel eine Münze, die so winzig ist wie der Nagel seines kleinen Fingers, und hält sie dem Knaben hin. «Willst du dir den Pfennig verdienen?», fragt er großzügig.
Der Junge nickt schüchtern wie ein scheues Tier.
Portinari zeigt auf seinen kotverschmierten Stiefel. «Mach ihn sauber!»
Der Junge blickt ihn fragend an, dann kommt er näher, sinkt vor Portinari in einer Pfütze auf die Knie und fängt an, mit einem Ende seines nassen Hemdsärmels den Stiefel abzuwischen.
Portinari schaut ihm interessiert zu. Der Schweinedreck ist frisch und feucht und lässt sich gut entfernen. Portinari lobt sich selbst für den klugen Einfall, den Jungen für diese unappetitliche Arbeit zu gewinnen, als er ihn plötzlich laut husten und schniefen hört.
«Pass mit deinem Rotz auf, Bursche», ruft Portinari.
Doch bevor der Junge die letzten Kotspritzer abwischen kann, landet ein Tropfen aus seiner Nase auf Portinaris Stiefel.
«Verdammter Kerl», schimpft er. «Ich habe dich gewarnt. Wisch deinen widerlichen Rotz von meinem Stiefel.»
Der Junge gehorcht, und als er fertig ist, beschließt Portinari, ihm eine Lektion zu erteilen. Er steckt den Pfennig demonstrativ in die Geldbörse zurück, dann geht er schnell weiter. Auf der Brücke dreht er sich noch einmal um. Der Junge kniet ratlos in der Pfütze. Er sieht traurig aus. Das wird ihm eine Lehre sein, denkt Portinari, denn jeder Mensch muss lernen, achtsam mit fremdem Eigentum umzugehen, und als er hinter der Vlamingbrug in die Sint-Jorisstraat kommt, hat er den Knaben schon vergessen.
4.Der Zwyn – Februar 1471
An einem Wintertag des Jahres 1471 nähert sich auf der Nordsee unter bleigrauem Himmel ein kleines Handelsschiff der Mündung des Zwyn an der Küste Flanderns. Der Zwyn ist ein Meeresarm, der sich vor mehr als dreihundert Jahren bei einem heftigen Unwetter ins Land gegraben hat. Viele Menschen sagten damals, Gott habe diese Furche gezogen, um den Städten im Binnenland wie Sluis, Damme und Brügge einen Zugang zum Meer zu verschaffen. Und bald zeigte sich, dass der Zwyn wirklich ein Gottesgeschenk war, denn von nun an liefen die Handelsschiffe Brügge zu Hunderten an. Sie kamen von den Küsten der Ostsee, aus Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund und Danzig. Sie kamen aus Dänemark, Schweden und Norwegen. Sie kamen aus England und Frankreich, aus Portugal und Spanien, und sie kamen sogar aus dem Mittelländischen Meer. Die Schiffe waren beladen mit Getreide, Holz, Wachs und Teer, mit Pelzen, Gewürzen, Seide, mit Wein, Wolle, Hanf und Flachs. Brügge wurde reich, es wurde zum Zentrum eines blühenden Welthandels, des intercurrus communis mercandisie, und Flandern eine florierende Produktionsstätte für die begehrten Tuche. Vom Mittelländischen Meer bis in die Ostsee, das mare balticum, kauften Händler flandrische Tuche auf. In Brügge, aber auch in anderen am Zwyn gelegenen Städten wie Sluis und Damme pulsierte das Leben. In den Straßen und Gassen sprach man über Nachrichten aus aller Welt. Kaufleute in bunten Kleidern besiegelten die Geschäfte mit Umtrunk und Gottespfennig, zechten in Bier- und Weinstuben. Auch die Geldhändler machten gute Geschäfte, denn die Händler brauchen Kredite, und die Bankhäuser – wie die florentinischen Medici – richteten in Brügge ihre Faktoreien ein.
Doch mit den Jahren begann der Zwyn zu versanden. Zunächst konnten die Schiffe nicht mehr bis nach Brügge durchfahren. Mit Hacken, Schaufeln und Rammen wurde ein Kanal von Brügge nach Damme gegraben, vertieft und begradigt, und später, als die Versandung weiter fortgeschritten war, bis zu der Stadt Sluis, die nun der Hafen Brügges war. In Sluis verlud man die Kisten, Fässer und Ballen von den Handelsschiffen auf flachbödige Schuten, mit denen man die Waren auf dem Kanal zum Stapelplatz in Damme transportierte und dann weiter nach Brügge.
Das Schiff, das an diesem Tag die Zwynmündung ansteuert, ist mit einem Haupt- und einem Besanmast sowie mit breitem Seitenschwert gegen die Abdrift ausgestattet. In der englischen Hafenstadt Dover hat das Schiff Wolle geladen, die in Flandern für die Tuchproduktion dringend benötigt wird. Für die Überfahrt nach Sluis hat der Schiffer, ein ernster Mann aus Flandern namens Lejeune Claes, die zu Ballen verschnürte Wolle von seinen Bootsleuten unter Segeltuch verstecken lassen. In diesen Kriegszeiten ist es auch für Claes gefährlich, den Kanal mit englischen Waren zu überqueren, obwohl sein Schiff unter der neutralen Flagge Burgunds fährt.
An Bord sind außer Lejeune Claes sechs weitere Männer: vier Bootsleute, ein Jungknecht sowie ein merkwürdiger Bursche, der in Dover um Mitfahrt gebeten hat. Eigentlich nimmt Claes keine Fremden mit, und jemanden wie diesen Burschen schon gar nicht. Er ist ungepflegt, seine Kleider sind dreckig, seine Haare fettig, auch wirkt er gehetzt und übervorsichtig, wie einer, der auf der Flucht ist. Doch Claes ist in einer Notlage. Wie alle Schiffer hat er seit Ausbruch des Krieges hohe Einbußen erlitten. Seine Frau und die Kinder haben kaum genug zu essen, das Dach seines Hauses in Damme muss repariert werden. Daher hat er in Dover eine Ausnahme gemacht, als der junge Mann so viele Münzen abzählte, bis Claes bereit war, ihn mitzunehmen.
Claes nimmt Kurs auf die Mündung des Zwyn, während der junge Mann in seinem fleckigen Mantel sich mit einer Hand am Hauptmast abstützt wie eine Landratte, um die Bewegungen der Wellen abzufangen. In Dover hat der Bursche behauptet, Engländer zu sein. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er ein englischer Spion. Nur ein verrückter Engländer würde in diesen Zeiten freiwillig nach Flandern fahren, seit die Hansen mit ihren Orlogschiffen die Häfen besetzen und in den Städten herumlungern, als gehörten sie ihnen.
Bald darauf fährt das Schiff in die Mündung des Zwyn ein. Hier kennt Lejeune Claes jede Untiefe und manövriert geschickt an Sandbänken und unter der Oberfläche lauernden Steinen vorbei. Allmählich fällt die Anspannung von ihm ab. Auf dem Meer sind ihnen weder hansische noch englische Orlogschiffe begegnet; jetzt muss er nur noch an den verfluchten hansischen Seeräubern im Hafen von Sluis vorbeikommen. Claes versteht nicht, warum ihr Regent, der burgundische Herzog Karel de Stoute, die hansischen Kaperfahrer in seinem Reich gewähren lässt. Wahrscheinlich macht er es des Geldes wegen, das die Hansen ins Land bringen, dennoch darf das doch kein Grund sein, vor den Osterlingen den Schwanz einzuziehen. So sieht Claes das. Er würde die Hansen zum Teufel jagen; aber er hat ja nichts zu sagen.
Endlich tauchen über dem mit Gräsern, Büschen, Weiden und Erlen spärlich bewachsenen Marschland die Kirchtürme auf. Der Bursche aus Dover dreht sich am Mast zu Claes um und fragt in der Sprache der Engländer, ob die Kirchtürme zu der Stadt Sluis gehörten. Claes nickt nur, und dem Engländer scheint dies als Antwort zu genügen.
5.Der Zwyn – Februar 1471
Till Landers schmerzt die Brust vor Anspannung, als hätte er seit der Abfahrt in Dover keinen Atemzug mehr getan, und er ist erleichtert, als der Schiffer mit mürrischem Kopfnicken bestätigt, dass die Mauern, Türme und Dächer, die jetzt in Sicht kommen, zu der Stadt Sluis gehören. Die ganze Zeit während der Überfahrt hat Landers befürchtet, sie könnten von englischen Orlogschiffen aufgebracht werden. Doch nun ist das Ziel nicht mehr weit: die Hafenstadt Sluis, in der der berüchtigte Kaperfahrer Paul Beneke mit Schiffen und Mannschaften überwintert, wie Landers gehört hat. Er lässt sich im Laderaum auf das Segeltuch nieder, unter dem der Schiffer die englische Wolle versteckt hat.
Landers’ Arme, Beine und Füße sind steif vor Kälte und von der verkrampften Haltung während der Überfahrt. Er massiert seine Finger, um sie beweglicher zu machen. Bald zwei Jahre ist es nun her, seit der Krieg ausgebrochen ist – so wie es Divessen im Kerker vorausgesagt hatte. Damals waren Landers’ Finger noch weich und biegsam gewesen. Sie hatten Schreibgriffel geführt, Rechenschieber bedient, Waren geschleppt. Oder sie streichelten das weiche Fell der Katzen in Hinrich Reckemanns Kontor, während Landers sich fragte, ob Jutas Haar auch so weich war. Jetzt sind seine Hände hart wie trockenes Leder und mit verschorften Schnittwunden der Schermesser überzogen. Während er seine Hände betrachtet, fragt er sich, wann er das letzte Mal so erleichtert war. Fast drei Jahre hat er sich auf einer englischen Schaffarm verstecken müssen. Sein Zuhause war ein zugiges Stallgebäude, durch dessen Dach der Regen tropfte. Er schlief zwischen Schafsköteln, Gerümpel und Schafscherern, während der Wind durch die Bretterwände pfiff.
Doch Landers hat die Zähne zusammengebissen und Dinge überlebt, die er nie für möglich gehalten hat. An dem Morgen, nachdem er im Leichensack den Platz mit Droste getauscht hatte, haben die Stadtknechte ihn abgeholt und an zwei Totengräber übergeben, die ihn auf einem Handwagen zu einem Elendfriedhof karrten. Dort sollte der vermeintliche Selbstmörder bestattet werden. Während die Männer das Grab aushoben, riss Landers die Naht auf, und als er dem Leichensack entstieg, fiel der eine Totengräber in Ohnmacht und der andere ins halb fertige Grab.
Landers lief über Straßen und Feldwege, Wiesen und Äcker. Er lief fast ununterbrochen, war mehrere Tage und Nächte unterwegs. Hin und wieder gönnte er sich eine kurze Ruhe im Unterholz, bibbernd vor Angst, Kälte und Hunger. Er aß Flechten, Birkenrinde und Regenwürmer. Nachts stahl er manchmal von den Höfen Eier und Brot, einmal auch Kleider, die er gegen seine alten, längst verschlissenen Sachen tauschte. Er lernte, sich in den Schatten zu bewegen wie ein scheues Tier, bis er die Gegend um Canterbury und Dover erreichte. In jenen Tagen plagte ihn das Gewissen. Er fragte sich, ob Divessen für seine Flucht verantwortlich gemacht und bestraft worden war. Vielleicht würde er nie erfahren, was mit Divessen geschehen war und mit all den anderen eingekerkerten Kaufleuten.
Als der Sommer in den Herbst überging, wagte sich Landers aus der Deckung der Wälder und bat auf einer Schaffarm um Arbeit. Man fragte nicht nach seiner Vergangenheit und speiste ihn mit einem Hungerlohn ab. Er arbeitete jede Woche sechs Tage, vom frühen Morgen bis tief in die Nacht. Er rammte Pfähle in die Erde, flocht Weidezäune, errichtete Mauern, jagte Schafen hinterher, stand bis zu den Knöcheln in ihrer Scheiße, trieb mit Hütehunden Herden zusammen und klemmte, wenn die Zeit dafür gekommen war, trampelnde Schafe zwischen seine Beine, um ihnen die Wolle vom Leib zu scheren.
Das bisschen Geld, das man ihm gab, sparte er eisern, ohne zu wissen, wofür. Doch da war dieser Gedanke, diese vage Idee, die Divessen ihm im Kerker eingepflanzt hatte wie einen Samen. Dieser Samen keimte, ging auf und wuchs. Sollte sich Landers wirklich den hansischen Kaperfahrern anschließen, die unter dem Kommando Benekes standen, dieses Teufels in Menschengestalt? Das fragte sich Landers immer wieder. Er war kein Söldner, konnte nicht mit einer Waffe umgehen. Als Kind hatte er sich nur selten geprügelt, und er fuhr ja nicht einmal gerne zur See. Die Voraussetzungen für sein Vorhaben waren also denkbar schlecht. Je länger er aber auf der Schaffarm das harte Leben eines schlecht bezahlten Tagelöhners fristete, desto häufiger tauchte dieser Gedanke wieder auf. Die Einsamkeit und die Arbeit veränderten ihn. Irgendwann hatte er kaum noch etwas mit dem Till Landers gemeinsam, der als junger Kaufmann mit hochtrabenden Plänen nach England aufgebrochen war, bevor man ihm in London seine Ladung und somit seine Zukunft genommen hatte. Mit jeder Nachricht aus dem Seekrieg, die bis auf die Schaffarm drang, wuchs sein Verlangen, die Idee in die Tat umzusetzen: Er würde sich den hansischen Kaperfahrern anschließen, kämpfen lernen und mit ihnen diesen Krieg gewinnen. Nur dann würde er nach Wismar heimkehren können und als erfolgreicher Krieger und Kaufmann Reckemanns Haus betreten und Juta zur Frau nehmen.
Doch zunächst musste er einen Weg finden, England zu verlassen. Sonntags lief er nach dem Gottesdienst nach Dover, wo er sich in den Hafenschenken einen oder zwei Becher Bier genehmigte – nicht um sich zu berauschen, sondern um den Gesprächen der Seeleute zu lauschen und Neuigkeiten aus dem Krieg zu erfahren. Die Sprache der Engländer beherrschte er mittlerweile fast wie ein Einheimischer. Wenn ihn mal jemand auf seinen Akzent ansprach, behauptete er, er sei Schotte, und wenn Schotten mit am Tisch saßen, behauptete er etwas anderes. Er blieb wachsam. Niemand durfte herausfinden, woher er wirklich kam. Feinde lauerten überall, denn die Hansen waren bei den Engländern verhasst. Die hansischen Kaperfahrer ruinierten die englische Wirtschaft, die durch die jahrelangen Rosenkriege mit ständig wechselnden Allianzen zwischen den verfeindeten Yorks und Lancasters ohnehin schwer in Mitleidenschaft gezogen war.
An den klebrigen Biertischen der Tavernen hörte Landers von Benekes Gräueltaten. Der habe, so erzählte man, als Admiral den Oberbefehl über eine Flotte mehrerer Danziger Schiffe. Er selbst fahre auf dem Holk Mariendrake, einem mit Bombarden und blutrünstigen Söldnern ausgerüsteten Orlogschiff. Wenn die Gespräche um Beneke kreisten, rückten die Männer dichter zusammen, senkten die Köpfe und dämpften die Stimmen, als könne The Devil jeden Moment aus einer dunklen Ecke hervorspringen, um ihnen die Kehlen durchzuschneiden. Einige Seeleute behaupteten, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie er englische Söldner mit den Füßen nach oben an die Rahen hängen und ausweiden ließ wie Schlachtvieh. Auch würden die hansischen Söldner das Blut ihrer Feinde trinken und ihre Köpfe als Trophäen auf Lanzen spießen. Landers erinnerte sich, dass ein Ankläger in London behauptet hatte, Beneke habe die Gedärme englischer Gefangener an Möwen verfüttert. Landers wusste nicht, ob er diese Geschichten glauben sollte, bei denen er vor nicht allzu langer Zeit angeekelt weggehört hätte. Aber nun war er auf der Flucht. Er war verzweifelt, aber er war bereit zu kämpfen.
Bei einem der belauschten Gespräche hatte er gehört, dass der Teufel in Sluis überwinterte. Und da war ihm eine Idee gekommen, die ihm im ersten Moment völlig abwegig erschien: Sollte er versuchen, dorthin zu gelangen? Er schob den Gedanken gleich wieder beiseite. Das wäre doch Irrsinn. Landers würde vom Regen in die Traufe kommen, wenn er sein Leben in die Hände eines solchen Monsters legte. Dennoch kehrte der Gedanke zurück, vor allem nachts, wenn er wie erschlagen von der Arbeit in dem Schuppen lag, aber vor lauter Grübeln keinen Schlaf fand.
Auch erinnerte er sich an Divessens Worte, der sich den Kaperfahrern hatte anschließen wollen. Und je häufiger Landers darüber nachdachte, desto weniger absurd erschien ihm die Vorstellung. Welche anderen Möglichkeiten hätte er denn? Nicht viele. Er könnte weiter auf der Farm schuften, bis er eines Tages vor Erschöpfung zusammenbrechen würde. Oder es kam ihm doch jemand auf die Schliche, dann würde man ihn wieder in den Kerker oder gleich an den Galgen bringen. Also konnte er auch gleich auf einem Kaperschiff sterben. Und so freundete er sich immer mehr mit dem Gedanken an, bis er eines Abends seine Sachen zusammenpackte, das Messer, ein paar Münzen, Kleider, den Lederbeutel mit Jutas Strähne.
Im Hafen von Dover suchte er nach einem Schiff, das ihn nach Sluis bringen sollte. Doch die meisten Schiffe waren in den Winterlagern, und es war Krieg, weswegen sich kaum ein Schiffer ohne bewaffneten Begleitschutz auf den Kanal wagte, schon gar nicht, wenn die Fahrt nach Flandern gehen sollte. Dort seien überall hansische Söldner, hieß es. Denn der Herzog von Burgund hatte den Hansen erlaubt, die Häfen seines Reichs als Rückzugsort für ihre kriegerischen Ausfahrten zu nutzen. Landers wollte die Suche schon aufgeben und auf das Frühjahr vertagen, als er auf den flandrischen Schiffer traf. Der knöpfte ihm mehr als die Hälfte seiner Münzen ab, bevor er Landers an Bord ließ. Und nun scheint er endlich am Ziel seiner Reise zu sein.
Das zweimastige Schiff mit der Flagge Burgunds gleitet vom leichten Wind getrieben den Zwyn hinauf, bis sie an einen Flussarm kommen, an dessen Ufer die Stadt Sluis auftaucht. Der Schiffer schlägt das Ruder ein, und als sie an einer großen Burg vorbeifahren, ruft er Landers in gebrochenem Englisch zu: «Da staunt Ihr, was? Die Burg wurde vor fast einhundert Jahren errichtet. Seither schützt sie die Einfahrt zum Hafen von Sluis. Hier kommt kein ungebetener Gast vorbei. Und schaut mal da rüber zum anderen Ufer.»
Landers sieht dort einen steinernen Wehrturm emporragen.