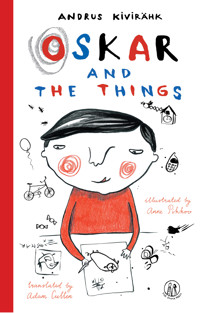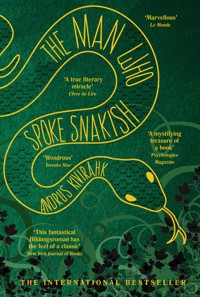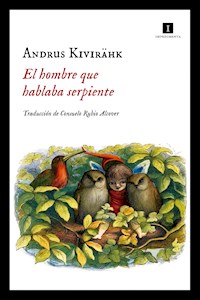12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der junge Leemet lebt mit seiner Familie und einem Clan von Jägern und Sammlern im Wald. Er ist der Letzte, der die Sprache der Schlangen beherrscht, in der er mit den Tieren reden kann. Kreuzritter, Dorfbewohner und christianisierte Ackerbauern bedrohen die alte magische Welt des Waldes. Aber Leemet und seine Freundin, eine Otter, setzen alles daran, sie zu retten. Lemeet und die Waldbewohner leben in einer fantastischen Welt, in der Frösche fliegen können, Läuse so groß sind, dass man auf ihnen reiten kann, und Bären eine Vorliebe dafür haben, Frauen zu verführen. Doch ihr zauberhafter Lebensraum ist bedroht: Die Menschen des Dorfes, die der Magie entsagt haben und stattdessen religiös geworden sind, dringen immer tiefer in den Wald ein. Um Lemeets Welt zu retten, müsste der Nordlanddrache, eine Gottheit für Wohlstand und Schutz, wiedererweckt werden – von einer ganzen Schar von Waldbewohnern, die die Schlangensprache sprechen. Und Leemet ist der Letzte, der diese Sprache beherrscht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Aus dem Estnischen von Cornelius Hasselblatt
Klett-Cotta
Impressum
Der Verlag dankt dem Eesti Kultuurkapital für die finanzielle Unterstützung der Übersetzung durch ein Traducta Stipendium.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Mees, kes teadis ussisõnu«. Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus 2007 © 2007 by Andrus Kivirähk
Für die deutsche Ausgabe
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
nach dem Originalcoverentwurf von Grove Atlantic, © Gretchen Mergenthale
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN978-3-608-98107-0
E-Book: ISBN 978-3-608-10872-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
1.
Es ist leer geworden im Wald. Man trifft kaum noch jemanden, abgesehen vom Ungeziefer natürlich. Das lässt sich offenbar von gar nichts beeindrucken, summt und schwirrt umher wie eh und je, zapft einem Blut ab oder sticht einfach so drauflos. Oder es krabbelt bloß gedankenlos auf deinen Füßen herum, wenn du ihm zufällig über den Weg läufst, trippelt da hin und her, bis du es abschüttelst oder plattschlägst. Ihre Welt ist noch ganz die alte – aber das bleibt nicht so. Auch den Insekten wird noch die Stunde schlagen! Ich werde das natürlich nicht mehr miterleben, niemand von uns. Aber eines Tages schlägt ihnen die Stunde, da bin ich mir ganz sicher.
Ich bin ja kaum noch draußen, vielleicht einmal pro Woche komme ich nach oben und hole an der Quelle Wasser. Dann wasche ich mich und meinen Gefährten und rubbele seinen heißen Körper ab. Das kostet eine ganze Menge Wasser, so dass ich mehrmals zur Quelle muss; aber es passiert kaum noch, dass ich unterwegs mal jemanden treffe, mit dem man ein paar Worte wechseln könnte. Meistens ist weit und breit keine Seele zu sehen, nur ein paarmal bin ich auf ein Reh oder ein Wildschwein gestoßen. Sie sind scheu geworden und meiden mich allein schon wegen des Geruchs. Sobald ich zischele, erstarren sie auf der Stelle und glotzen mich verstört an, aber näher kommen sie trotzdem nicht. Starren mich an wie ein Weltwunder – ein Mensch, der die Schlangenworte kennt! Das macht ihnen richtig Angst, und am liebsten würden sie kopfüber ins Gebüsch springen, die Beine in die Hand nehmen und vor diesem seltsamen Monster die Flucht ergreifen – aber das dürfen sie nicht. Die Worte verbieten es ihnen. Ich zischele sie noch einmal an, nun schon strenger, und zwinge sie mit eisernem Befehl herbei. Die Viecher winseln verzweifelt und schleppen sich gegen ihren Willen zu mir. Ich könnte nun ein Einsehen mit ihnen haben und die Tiere gehen lassen – aber wozu? Irgendwie widern mich diese neuartigen Kreaturen an, die die ursprünglichen Sitten nicht mehr kennen und durch den Wald hoppeln, als wäre er nur dafür geschaffen worden, damit sie hier frei herumtollen können. Deswegen zischele ich noch ein drittes Mal, und diesmal sind meine Worte so stark wie ein Sumpfloch, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Die närrisch gewordenen Tiere fliegen auf mich zu wie ein abgeschossener Pfeil, während gleichzeitig ihre Eingeweide die unerträgliche Spannung nicht mehr aushalten und explodieren. Sie platzen auf wie eine zu enge Hose und ihre Gedärme spritzen aufs Gras. Das ist ein widerlicher Anblick und ich bin überhaupt nicht stolz auf meine Tat – aber trotzdem werde ich immer wieder meine Macht ausprobieren. Schließlich ist es nicht meine Schuld, dass diese Viecher die Schlangenworte vergessen haben, die ihnen meine Ahnen seinerzeit beigebracht haben.
Einmal war es aber doch anders. Ich kam gerade von der Quelle und hatte ein schweres Wasserfässchen auf den Schultern, als plötzlich ein großer Elch meinen Weg kreuzte. Ich zischelte sofort ein paar harmlosere Worte und spürte schon die Verachtung in mir aufsteigen, weil ich davon ausging, dass ich den Elch in Verlegenheit brachte. Aber der Elch zuckte überhaupt nicht zusammen, als er plötzlich die längst vergessenen Befehle aus dem Mund eines Menschenkindes hörte. Er senkte den Kopf und lief auf mich zu, ließ sich auf die Knie nieder und bot mir unterwürfig seinen Hals, ganz wie in jenen alten Zeiten, als wir so für unser Essen sorgten: Wir riefen die Elche und sie ließen sich schlachten. Wie oft habe ich als kleiner Junge gesehen, wie Mutter auf diese Weise unseren Wintervorrat anlegte! Sie wählte aus einer großen Herde eine passende Elchkuh aus, rief sie zu sich und schnitt dem Tier, das sich den Schlangenworten unterworfen hatte, mühelos die Kehle durch. An einer ausgewachsenen Elchkuh hatten wir genug für einen ganzen Winter. Gegenüber unserer einfachen Methode der Nahrungsbeschaffung erschien die dämliche Jagd der Dorfmenschen, die viele Stunden einem Elch hinterherhetzten, massenweise Pfeile aufs Geratewohl ins Dickicht schossen und am Ende trotzdem ziemlich oft mit leeren Händen enttäuscht nach Hause zurückkehrten, geradezu aberwitzig. Es bedurfte ja nur weniger Worte, um den Elch in die eigene Gewalt zu bekommen! Wie auch jetzt. Das große und starke Tier lag mir zu Füßen und wartete auf den Schlag. Ich hätte ihn mit einer Handbewegung töten können. Aber ich tat es nicht.
Stattdessen nahm ich das Fässchen von der Schulter und bot dem Elch zu trinken an. Er schlürfte friedlich. Es war ein alter Bulle, ziemlich alt – musste er ja sein, denn andernfalls hätte er sich nicht mehr daran erinnert, wie sich ein Elch zu benehmen hat, wenn ein Mensch ihn ruft. Er hätte sich widersetzt und gesträubt, hätte versucht sich mit den Zähnen an den Baumwipfeln festzuklammern, während ihn gleichzeitig die Urkraft der Worte zu mir getrieben hätte, und dann wäre er zu mir gekommen wie ein Narr, wogegen er jetzt wie ein König kam. Es machte ihm nichts aus, dass er geschlachtet werden würde. Auch das muss man können. Ist es etwa erniedrigend, wenn man sich den ursprünglichen Gesetzen und Sitten unterwirft? Meiner Meinung nach nicht. Ich habe noch nie einen Elch aus Vergnügen getötet – was für ein Vergnügen könnte einem so was denn bereiten? Wir mussten was zu essen haben, für die Nahrungsbeschaffung gab es das Wort, und dieses Wort kannten auch die Elche und sie gehorchten ihm. Erniedrigend ist alles zu vergessen, wie diese jungen Wildschweine und die Rehe, die wie eine Blase explodieren, wenn sie die Worte hören. Oder die Dorfmenschen, die zu zehnt losziehen, um einen einzigen Elch zu jagen. Dummheit ist erniedrigend, nicht Weisheit.
Ich gab diesem Elch also zu trinken und streichelte ihm übers Haupt, und er rieb seine Schnauze an meinem Wams. Die alte Welt war doch noch nicht ganz untergegangen. So lange ich noch lebe, solange dieser alte Elch noch lebt, erinnert man sich hier im Wald noch an die Schlangenworte, und schätzt sie.
Ich ließ den Elch gehen. Möge er noch lange leben. Und sich erinnern.
Eigentlich wollte ich meine Geschichte mit der Bestattung von Manivald beginnen. Ich war damals sechs Jahre alt. Diesen Manivald habe ich nie mit eigenen Augen gesehen, denn er lebte nicht im Wald, sondern am Meer. Ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht, warum Onkel Vootele mich mit auf die Bestattung nahm. Andere Kinder waren nicht dabei. Mein Freund Pärtel war nicht da, und auch Hiie nicht. Obwohl Hiie damals bestimmt schon geboren war, denn sie war nur ein Jahr jünger als ich. Warum haben Tambet und Mall sie nicht mitgenommen? Es muss doch gerade für sie ein Ereignis nach ihrem Geschmack gewesen sein – nicht in dem Sinne, dass sie irgendetwas gegen Manivald gehabt und sich über seinen Tod gefreut hätten. Nein, weit gefehlt. Tambet verehrte Manivald sehr; ich erinnere mich ganz deutlich daran, wie er am Scheiterhaufen sprach: »Solche Männer werden nicht mehr geboren.« Er hatte Recht, die wurden nicht mehr geboren. Eigentlich wurden in unserer Gegend überhaupt keine Männer mehr geboren. Ich war der letzte, ein paar Monate vor mir war Pärtel gekommen, ein Jahr später bekamen Tambet und Mall Hiie. Sie war aber kein Mann, sondern ein Mädchen. Danach wurden bei uns im Wald nur noch Wiesel und Hasen geboren.
Damals wusste Tambet das freilich noch nicht und wollte es auch nicht wahrhaben. Er glaubte immer noch daran, dass eines Tages wieder die Zeit kommen würde und so weiter und so fort. Er konnte auch nichts anderes glauben, er war nun mal so ein Mann, der eisern an allen Sitten und Gebräuchen festhielt, jede Woche den Heiligen Hain besuchte und mit ernstem Gesicht farbige Stofffetzen an die Linden band, wobei er glaubte, den Schutzgeistern Opfer zu bringen. Der Waldweise Ülgas war sein bester Freund. Oder nein, das Wort Freund passt hier nicht, Tambet hätte den Waldweisen niemals als seinen Freund bezeichnet. Das wäre für ihn der Gipfel der Respektlosigkeit gewesen. Der Waldweise war groß und heilig, ihn musste man ehren, mit ihm konnte man nicht befreundet sein.
Selbstverständlich war auch Ülgas auf der Bestattung von Manivald. Wie könnte es anders sein! Er war es schließlich, der den Scheiterhaufen anzünden und die Seele des Dahingeschiedenen ins Land der Geister schicken musste. Das tat er lang und umständlich: Er sang, schlug auf die Trommel und verbrannte Pilze und Strohhalme. So hatte man immer die Toten verbrannt, so gehörte es sich. Deshalb meinte ich ja auch, dass diese Bestattung so recht nach dem Geschmack von Tambet war. Ihm gefielen alle möglichen Rituale. Hauptsache, man machte es so wie die Vorväter, dann war Tambet zufrieden.
Ich für meinen Teil fand es entsetzlich langweilig, daran erinnere ich mich ganz genau. Da ich Manivald gar nicht gekannt hatte, konnte ich auch nicht trauern; ich schaute also in der Gegend umher. Anfangs fand ich es noch aufregend, das faltige Gesicht des Toten mit dem langen Bart zu betrachten – und auch ziemlich grausig, denn ich hatte noch nie einen Toten gesehen. Aber der Waldweise zauberte und hexte so lange herum, dass es am Ende nicht mehr aufregend und auch nicht mehr furchteinflößend war. Am liebsten wäre ich überhaupt weggegangen – zum Meer, denn auch da war ich noch nie gewesen. Ich war ein Kind des Waldes. Onkel Vootele sorgte jedoch dafür, dass ich dablieb, indem er mir ins Ohr flüsterte, dass gleich das Feuer angezündet würde. Zunächst machte das Eindruck auf mich, denn das Feuer wollte ich unbedingt sehen, ganz besonders eines, mit dem ein Mensch verbrannt wurde. Was kommt aus ihm heraus, was für Knochen hat er? Ich blieb also da, aber der Waldweise Ülgas hörte einfach nicht mit seinem rituellen Getue auf und ich starb beinahe vor Langerweile. Mich hätte nicht einmal mehr interessiert, wenn Onkel Vootele erlaubt hätte, den Leichnam des alten Mannes vor dem Verbrennen noch zu häuten, ich wollte einfach nach Hause. Ich gähnte laut, so dass Tambet mich mit seinen Glupschaugen anglotzte und knurrte:
»Still, Junge, du bist auf einer Bestattung! Hör dem Waldweisen zu!«
»Geh schon, lauf ein wenig herum!«, raunte Onkel Vootele mir zu. Ich rannte zum Meer und sprang mit Kleidern ins Wasser, danach spielte ich im Sand, bis ich aussah wie ein Schlammklumpen. Dann bemerkte ich, dass das Feuer schon brannte, und raste wie ein Wirbelwind zurück, aber von Manivald war nichts mehr zu sehen, so hoch waren die Flammen, sie schienen bis zu den Sternen zu steigen.
»Wie schmutzig du bist«, sagte Onkel Vootele und versuchte, mich mit seinem Ärmel sauber zu machen. Abermals traf mich Tambets wütender Blick, denn natürlich gehörte es sich nicht, sich auf einer Bestattung so zu benehmen, wie ich es tat, und Tambet hielt sich immer ganz streng an die Regeln.
Ich kümmerte mich nicht um Tambet, denn er war weder mein Vater noch mein Onkel, sondern allenfalls ein Nachbar, dessen Wut mich kalt ließ. Ich zupfte Onkel Vootele am Bart und fragte:
»Wer war dieser Manivald denn? Warum lebte er am Meer? Warum wohnte er nicht wie wir im Wald?«
»Am Meer war sein Zuhause«, antwortete Onkel Vootele. »Manivald war ein alter und weiser Mann. Der älteste von uns. Er hat sogar den Nordlanddrachen gesehen.«
»Den Nordlanddrachen, wer ist das?«, fragte ich.
»Der Nordlanddrache ist eine große Schlange«, antwortete Onkel Vootele. »Die allergrößte, viel größer als der Schlangenkönig. Er ist so groß wie der Wald und kann fliegen. Er hat riesige Flügel. Wenn er aufsteigt, verdunkelt er Sonne und Mond. Früher ist er häufig in die Lüfte gestiegen und hat all unsere Feinde verschlungen, die mit ihren Schiffen hier landeten. Und wenn er sie aufgefressen hatte, bekamen wir ihre Schätze. Damals waren wir reich und mächtig. Man hatte Angst vor uns, niemand war lebendig von unseren Ufern zurückgekehrt, aber man wusste, dass wir reich waren, und so war die Gier stärker als die Angst. Immer mehr Schiffe segelten zu unseren Küsten, um uns unsere Schätze zu rauben, und der Nordlanddrache tötete sie alle.«
»Ich will auch den Nordlanddrachen sehen«, sagte ich.
»Das ist leider nicht mehr möglich«, sagte Onkel Vootele seufzend. »Der Nordlanddrache schläft und wir können ihn nicht aufwecken. Wir sind zu wenige.«
»Oh doch, eines Tages werden wir das wieder können!«, mischte sich Tambet ins Gespräch ein. »Sag so was nicht, Vootele! Was ist das für ein demütiges Geschwätz? Ich sage dir – wir beide werden noch den Tag erleben, an dem der Nordlanddrache erneut am Himmel aufsteigt und alle erbärmlichen Eisenmänner und Dorfratten vertilgt.«
»Ach was, selber quatschst du dummes Zeug«, sagte Onkel Vootele. »Wie soll das denn geschehen, wo du doch ganz genau weißt, dass man mindestens zehntausend Mann braucht, um den Nordlanddrachen zu wecken? Nur wenn zehntausend Mann gemeinsam die Schlangenworte aussprechen, wacht der Nordlanddrache in seinem verborgenen Nest auf und steigt an den Himmel. Wo sind diese zehntausend Mann? Wir bekommen ja nicht einmal zehn zusammen!«
»Man darf nie aufgeben!«, fauchte Tambet. »Schau dir Manivald an – der hatte immer noch Hoffnung und erledigte Tag für Tag seine Arbeit! Sobald er am Horizont ein Schiff erblickte, zündete er einen trockenen Baumstumpf an, um allen zu verkünden: Jetzt ist es an der Zeit, dass der Nordlanddrache erwacht! Jahr für Jahr machte er das, obwohl schon lange niemand mehr auf seine Feuerzeichen reagierte und immer mehr fremde Schiffe anlegten und die Eisenmänner ungestraft an Land gehen konnten. Aber er gab nicht auf, sondern hat immer wieder Baumstümpfe entwurzelt und getrocknet, angezündet und abgewartet – einfach abgewartet! Ob sich vielleicht doch noch einmal der mächtige Nordlanddrache über dem Wald erhebt, so wie in den guten alten Zeiten.«
»Er wird sich nie wieder erheben«, sagte Onkel Vootele düster.
»Ich will ihn sehen!«, quengelte ich. »Ich will den Nordlanddrachen sehen!«
»Du wirst ihn nicht sehen«, gab Onkel Vootele zurück.
»Ist er gestorben?«, fragte ich.
»Nein, er ist unsterblich«, sagte mein Onkel. »Er schläft. Ich weiß bloß nicht wo. Niemand weiß das.«
Ich schwieg enttäuscht. Die Geschichte vom Nordlanddrachen war höllisch interessant, aber das Ende war enttäuschend. Was hat man denn von Wunderdingen, die man niemals zu sehen bekommt? Tambet und mein Onkel stritten sich weiter, während ich zurück zum Meer schlenderte. Ich ging am Strand entlang; es war ein schöner Sandstrand, und hier und da lagen große entwurzelte Baumstümpfe herum. Das waren offenbar die, die der verstorbene und soeben verbrannte Manivald getrocknet hatte – um Warnfeuer anzuzünden, die niemanden interessierten. Neben einem Baumstumpf kauerte ein Mann. Das war Meeme. Ich habe ihn noch nie gehen sehen, er lag immer irgendwo ausgestreckt unter einem Strauch, wie ein Blatt von einem Baum, das der Wind von einem Ort zum anderen trägt. Er knabberte ständig an einem Fliegenpilz, und jedes Mal bot er mir davon an, aber ich schlug das Angebot immer aus, weil meine Mutter es mir verboten hatte.
Auch diesmal lag Meeme auf der Seite neben dem Baumstumpf auf dem Boden, und mir war wieder entgangen, wann und wie er hier aufgetaucht war. Ich nahm mir fest vor, noch einmal herauszubekommen, wie dieser Mann aussieht, wenn er auf zwei Beinen steht oder auf welche Art und Weise er sich überhaupt bewegt – aufrecht so wie Menschen, auf allen Vieren wie Tiere, oder vielleicht kriechend wie eine Schlange? Ich ging auf Meeme zu und sah zu meiner Überraschung, dass er dieses Mal gar keinen Fliegenpilz aß, sondern aus einer ledernen Feldflasche trank.
»Ah!« Er wischte sich gerade den Mund ab, als ich mich zu ihm niederhockte und interessiert den fremden Duft einatmete, der der Feldflasche entströmte. »Das ist Wein. Viel besser als Fliegenpilz, gelobt seien die Fremdländer und ihr Spatzenhirn. Von dem Pilz bekam man ungeheuren Durst, aber das hier löscht den Durst und berauscht einen gleichzeitig. Großartiges Zeug. Ich glaube, dabei bleibe ich. Willst du auch was?«
»Nein«, sagte ich. Meine Mutter hatte mir zwar das Weintrinken nicht verboten, aber ich konnte mir ausrechnen, dass Meeme etwas anbot, das kaum besser als Fliegenpilz sein würde. »Wo kriegt man denn solche Feldflaschen?« Im Wald hatte ich so etwas noch nie gesehen.
»Von den Mönchen und den anderen Fremdländern«, antwortete Meeme. »Man muss ihnen nur den Schädel einschlagen – und schon hast du die Feldflasche.« Er nahm wieder einen Schluck. »Ein schmackhaftes Getränk, nichts dran auszusetzen«, sagte er noch einmal anerkennend. »Dieser dämliche Tambet mag brüllen und zetern soviel er will, aber das Gesöff der Fremdländer ist besser als unseres.«
»Was hat Tambet denn gebrüllt und gezetert?«, fragte ich.
»Ach, er erträgt es einfach nicht, wenn sich jemand mit den Fremdländern abgibt oder ihren Kram probiert«, sagte Meeme abwinkend. »Ich sagte ihm, dass ich den Mönch überhaupt nicht angerührt habe, sondern dass bloß meine Axt es getan hat, aber er wettert immer noch. Wenn ich aber nun nicht mehr tagein tagaus Fliegenpilze essen will? Wenn das hier viel besseres Zeugs ist, das einem viel schneller zu Kopfe steigt? Der Mensch muss lernfähig sein, nicht so starr wie dieser Baumstumpf hier. Aber genau so sind wir leider. Was nützt uns denn diese Starrheit? Wie die letzten Fliegen vor dem Winter, langsam surren wir durch den Wald, bis wir aufs Moos plumpsen und verrecken.«
Ich konnte ihm nicht ganz folgen und stand auf, um zu meinem Onkel zurückzukehren.
»Warte mal, Junge!« Meeme hielt mich zurück. »Ich will dir noch was geben.«
Ich schüttelte sofort heftig den Kopf, denn ich wusste – jetzt kam entweder der Fliegenpilz oder Wein oder eine andere Abscheulichkeit.
»Warte, habe ich gesagt!«
»Mama hat es verboten!«, sagte ich entschieden.
»Halt die Klappe! Deine Mutter weiß überhaupt nicht, was ich dir geben will. Da, nimm’s! Ich kann damit nichts anfangen. Häng es dir um den Hals!«
Meeme drückte mir einen winzigen Lederbeutel in die Hand, worin sich ein kleiner, aber schwerer Gegenstand zu befinden schien.
»Was ist da drin?«, fragte ich.
»Da drin? Na, da drinnen ist ein Ring.«
Ich knotete den Beutel auf. Tatsächlich, ein Ring. Ein Silberring mit einem großen roten Stein. Ich steckte ihn mir auf den Finger, aber er war für meine kleinen Finger viel zu groß.
»Bewahre ihn in dem Beutel auf«, empfahl mir Meeme. »Und den Beutel hängst du dir um den Hals, wie ich gesagt habe.«
Ich steckte den Ring wieder in den Beutel, der aus ganz feinem Leder gemacht war. So dünn wie das Blatt von einem Baum; wenn man es aus der Hand fallen lässt, trägt der Wind es sogleich fort. Aber selbstverständlich muss ein teurer Ring auch ein feines und vornehmes Nest haben.
»Danke!«, sagte ich überglücklich. »Das ist wirklich ein schöner Ring.«
Meeme lachte.
»Gern geschehen, Jungchen«, sagte er. »Ich weiß nicht, ob er schön oder hässlich ist, aber notwendig ist er bestimmt. Hüte ihn gut in dem Beutel.«
Ich lief zurück zum Feuer. Manivald war schon verbrannt, nur seine Asche glühte noch. Ich zeigte Onkel Vootele den Ring, und mein Onkel betrachtete ihn lange und gründlich.
»Das ist ein wertvolles Stück«, sagte er dann. »Im Ausland hergestellt und wahrscheinlich irgendwann mit den Schiffen der Eisenmänner hier gelandet. Ich würde mich nicht wundern, wenn der erste Eigentümer dieses Ringes ein Opfer des Nordlanddrachen geworden ist. Ich verstehe nicht, warum Meeme ihn gerade dir gegeben hat. Er hätte ihn eher deiner Schwester Salme schenken können. Was wirst du denn, mein Junge, hier im Wald mit einem so teuren Schmuckstück anfangen?«
»Salme gebe ich ihn bestimmt nicht!«, sagte ich trotzig.
»Nein, tu das nicht«, gab Onkel Vootele zurück. »Meeme tut niemals etwas ohne triftigen Grund. Wenn er den Ring dir gegeben hat, dann sollte das wohl so sein. Ich durchschaue seinen Plan im Moment zwar nicht, aber das hat nichts zu sagen. Irgendwann wird sich schon alles aufklären. Gehen wir jetzt nach Hause.«
»Ja, gehen wir«, sagte ich zustimmend und merkte, wie müde ich war. Onkel Vootele hob mich auf den Wolf und wir wanderten durch den nächtlichen Wald nach Hause. Zurück blieben das erloschene Feuer und das Meer, das von niemandem mehr bewacht wurde.
2.
Tatsächlich bin ich im Dorf zur Welt gekommen, nicht im Wald. Es war mein Vater gewesen, der beschlossen hatte, ins Dorf zu ziehen. Alle zogen damals um, oder beinahe alle, und meine Eltern waren unter den letzten. Wahrscheinlich lag das an meiner Mutter, denn sie mochte das Leben im Dorf nicht, Ackerbau interessierte sie nicht, und sie aß niemals Brot.
»Das ist Dreck«, sagte sie immer. »Weißt du, Leemet, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt jemandem schmeckt. Das ist bloß Angeberei, dieses Brotessen. Man will so unendlich fein sein und leben wie die Fremdländer. Eine gut gebratene Elchkeule ist da ganz was anderes. Komm jetzt zum Essen, mein Schatz. Was glaubst du, für wen ich die Keulen brate?«
Vater war offenbar anderer Meinung gewesen. Er wollte ein Mensch der neuen Zeit sein und ein Mensch der neuen Zeit musste im Dorf leben, unter freiem Himmel und der Sonne, nicht im düsteren Wald. Er musste Roggen anbauen und den ganzen Sommer wie eine erbärmliche Ameise schuften, damit er im Herbst mit gewichtigem Gesichtsausdruck sein Brot herunterwürgen konnte und auf diese Weise den Fremdländern ebenbürtig war. Ein Mensch der neuen Zeit musste eine Sichel im Hause haben, mit der er im Herbst auf den Boden gebückt das Getreide erntete; er musste einen Mahlstein haben, mit dem er schnaufend und prustend sein Korn mahlte. Onkel Vootele erzählte mir, wie mein Vater – als er noch im Wald lebte – vor Aufregung und Neid beinahe platzte, wenn er daran dachte, was für ein interessantes Leben die Dorfmenschen führten und was für tolle Werkzeuge sie hatten.
»Wir müssen schnellstens ins Dorf ziehen!«, rief er. »Sonst geht das Leben an uns vorbei! Heutzutage leben alle normalen Menschen unter freien Himmel, nicht im Unterholz. Auch ich will pflügen und säen, wie man es überall in der entwickelten Welt tut! Bin ich etwa was Schlechteres? Ich will nicht wie ein Bettler leben. Schaut euch doch die Eisenmänner und die Mönche an – da sieht man sofort, dass sie uns in ihrer Entwicklung hundert Jahre voraus sind! Wir müssen uns nach Kräften anstrengen, um es ihnen gleich zu tun!«
Und so führte er meine Mutter ins Dorf; sie bauten sich eine kleine Hütte und mein Vater lernte zu pflügen und zu säen und bekam seine Sichel und seinen Mahlstein. Er fing an, in die Kirche zu gehen und lernte Deutsch, um die Eisenmänner verstehen und von ihnen noch tollere und modernere Kniffe erlernen zu können. Er aß Brot und bekundete schmatzend, wie gut das sei, und als er auch noch gelernt hatte, Gerstenbrei zu kochen, kannten seine Begeisterung und sein Stolz überhaupt keine Grenzen mehr.
»Das schmeckte wie Kotze«, beichtete mir Mutter, aber Vater aß dreimal am Tag Gerstenbrei, verzog zwar ein wenig das Gesicht, behauptete aber, dass es sich hierbei um eine besondere Delikatesse handele, die zu genießen man eben lernen müsse. »Nicht so wie unsere Fleischbrocken, die jeder Trottel in sich hineinstopfen kann, sondern eine europäische Speise, die für Menschen mit verfeinertem Geschmackssinn angemessen ist«, sagte er. »Nicht zu kräftig, nicht zu fett, sondern luftig und leicht. Aber nahrhaft! Eine königliche Speise!«
Als ich zur Welt kam, verlangte Vater, dass ich nur mit Gerstenbrei gefüttert würde, denn sein Kind »soll das Beste bekommen«. Auch besorgte er mir eine kleine Sichel, damit ich, sobald ich auf meinen Beinchen stand, mit ihm gemeinsam aufs Feld ziehen und mich dort bücken konnte. »Eine Sichel ist natürlich ein wertvoller Gegenstand, und man könnte meinen, es habe keinen Sinn, einem Kleinkind so etwas in die Hand zu geben, aber da bin ich anderer Meinung. Unser Kind soll sich schon von klein auf an moderne Werkzeuge gewöhnen«, verkündete er stolz. »In Zukunft wird man ohne Sichel nicht auskommen, soll er also gleich die hohe Kunst der Roggenernte lernen!«
All das hat mir Onkel Vootele erzählt, denn ich erinnere mich nicht an meinen Vater. Meine Mutter sprach nicht gerne über ihn, sie wurde dann immer ganz verlegen und wechselte das Thema. Sie fühlte sich bestimmt immer noch schuldig am Tod meines Vaters, und letztendlich war sie das ja auch. Meine Mutter langweilte sich nämlich im Dorf. Sie interessierte sich nicht für die Feldarbeit, und wenn mein Vater gewichtig hinter dem Pflug her schritt, trieb sich meine Mutter in ihren altbekannten Wäldern herum und lernte dort einen Bären kennen. Was dann geschah, kann sich wohl jeder denken, denn solche Geschichten gibt’s wie Sand am Meer. Nur wenige Frauen wissen einem Bären zu widerstehen, sie sind ja so groß, weich, hilflos und flauschig. Außerdem sind sie die geborenen Verführer, die zu allem Überfluss besonderes Gefallen an Menschenfrauen finden, und so lassen sie keine einzige Möglichkeit aus, um sich an eine Frau heranzumachen und ihr ins Ohr zu brummen. Früher, als der größte Teil unseres Volkes noch im Wald lebte, kam es ständig vor, dass Frauen sich einen Bären als Geliebten hielten, bis der Mann das Paar irgendwann ertappte und den Braunen fortjagte.
Der Bär kam uns immer im Dorf besuchen, wenn mein Vater auf dem Feld schuftete. Er war ein sehr freundliches Tier – meine Schwester Salme, die fünf Jahre älter ist als ich, erinnert sich an ihn und erzählte mir, dass ihr der Bär jedes Mal Honig mitbrachte. Wie damals alle Bären konnte auch dieser Meister Braun ein wenig sprechen, denn Bären sind die pfiffigsten aller Tiere, wenn wir die Schlangen, die Brüder des Menschen, mal eben außer Acht lassen. Bären sprachen zwar nicht gerade viel, und was sie sagten, ergab auch nicht besonders viel Sinn – aber ein Liebhaber braucht auch keine klugen Reden zu schwingen. Die alltäglichsten Dinge konnten jedenfalls ganz gut geregelt werden.
Jetzt ist natürlich alles anders. Ein paarmal traf ich beim Wasserholen auf Bären und rief ihnen ein paar Begrüßungsworte zu. Dann schauten sie mich mit tumbem Gesicht an und verschwanden krachend im Unterholz. Die ganze Kulturschicht, die sie sich durch ihren Umgang mit Menschen und Schlangen in den vergangenen Jahrhunderten angeeignet haben, ist wie weggewischt und Bären sind ganz normale Tiere geworden. So wie wir selbst. Wer außer mir kennt noch die Schlangenworte? Es ist mit der Welt bergab gegangen und selbst das Quellwasser hat einen schalen Geschmack.
Sei’s drum. Damals, in meiner Kindheit, konnten Bären sich noch mit Menschen austauschen. Echte Freunde sind wir zwar nie gewesen, dazu standen die Bären doch zu niedrig. Letztendlich waren wir ja diejenigen, die die Honigtatzen geschliffen und an den Ohren aus ihrer tölpelhaften Urtümlichkeit herausgezogen haben. Sie waren sozusagen die Lehrlinge der Menschen, deswegen stehen wir auch über ihnen. Außerdem kamen da noch ihre Lüsternheit und ihre unerklärliche Anziehungskraft, die sie auf unsere Frauen ausüben, hinzu. Daher betrachtete jeder Mann einen Bären mit einer gewissen Skepsis – dieser flauschige Jammerlappen wird’s doch nicht mit meiner Frau … Nur allzu häufig fand man Bärenhaare im eigenen Bett.
Meinem Vater erging es aber noch schlimmer. Er fand in seinem Bett nicht nur Bärenhaare, er fand dort einen ganzen Bären. An sich wäre das halb so schlimm gewesen – er hätte den Bären nur heftig anzischeln müssen und die auf frischer Tat ertappte Honigtatze wäre mit angelegten Ohren in den Wald gewetzt. Aber mein Vater hatte die Schlangenworte schon halb vergessen, denn im Dorf brauchte man sie nicht, außerdem scherte er sich nicht viel um sie, weil er glaubte, dass Sichel und Mahlstein ihm viel bessere Dienste erwiesen. Deshalb murmelte er, als er den Bären in seinem Bett erblickte, irgendetwas auf Deutsch, woraufhin der Bär, von den unverständlichen Worten in Verwirrung geraten und ohnehin in Panik, weil er auf frischer Tat ertappt war, ihm kurzerhand den Kopf abbiss.
Natürlich bereute er das sofort, denn ein Bär ist überhaupt kein blutrünstiges Tier, im Gegensatz zum Wolf zum Beispiel, der wirklich nur unter Einfluss der Schlangenworte dem Menschen dient, ihn auf seinem Rücken trägt und sich von ihm melken lässt. Der Wolf ist in Wahrheit ein ziemlich gefährliches Haustier, aber weil niemand im Wald schmackhaftere Milch hat, findet man sich mit seiner Boshaftigkeit ab, umso mehr, als die Schlangenworte ihn lammfromm machen. Ein Bär aber ist ein Wesen mit Verstand. Die Honigtatze, die meinen Vater getötet hatte, war verzweifelt, und da der Mord in einem Anfall von Wollust geschehen war, bestrafte er sich an Ort und Stelle und biss sich sein Gemächt ab.
Sodann verbrannten meine Mutter und der kastrierte Bär den Leichnam meines Vaters und der Bär floh in die Tiefe des Waldes, nachdem er meiner Mutter versichert hatte, dass sie einander nie wiedersehen würden. Offenbar war das eine akzeptable Lösung für meine Mutter, denn wie gesagt, sie fühlte sich entsetzlich schuldig und ihre Bärenliebe hatte ein abruptes Ende gefunden. Für den ganzen weiteren Rest ihres Lebens konnte sie Bären nicht mehr ausstehen, sie zischelte sofort, wenn sie einen bemerkte, und zwang ihn auf diese Weise, ihr aus dem Weg zu gehen. Dieser Hass von ihr sorgte noch für ziemlich viel Verwirrung und Streit in unserer Familie, aber davon berichte ich später, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Nach dem Tod meines Vaters sah meine Mutter keinen Grund mehr, im Dorf wohnen zu bleiben. Sie nahm mich auf den Arm und meine Schwester an die Hand, und zog zurück in den Wald. Dort lebte immer noch ihr Bruder, mein Onkel Vootele, der uns unter seine Fittiche nahm, uns half, eine Hütte zu bauen, und uns zwei junge Wölfe schenkte, damit wir immer frische Milch hatten. Obwohl meine Mutter vom Tod meines Vaters immer noch ganz zerknirscht war, atmete sie erleichtert auf, denn sie hatte den Wald nie verlassen wollen. Sie fühlte sich hier wohl, und sie kümmerte sich keinen Deut darum, dass sie nicht so war wie die Eisenmänner und dass sich in ihrem Haushalt keine einzige Sichel befand. Im Haus meiner Mutter wurde nie wieder Brot gegessen, aber Elch- und Rehbraten gab es zuhauf.
Ich war noch kein Jahr alt, als wir zurück in den Wald zogen. Daher erinnere ich mich nicht an das Dorf und das dortige Leben, ich wuchs im Wald auf und der war mein einziges Zuhause. Wir hatten eine tolle Hütte im tiefsten Dickicht, wo ich mit meiner Mutter und meiner Schwester lebte, auch die Höhle von Onkel Vootele war in der Nähe. Damals war es noch nicht so leer im Wald, wenn man ein wenig in der Gegend umherstreifte, traf man ganz sicher auf andere Menschen: alte Mütterchen, die vor ihrer Hütte Wölfe molken, oder Greise mit langen Bärten, die sich mit dicken Kreuzottern unterhielten.
Jüngere Leute gab es weniger und ihre Anzahl ging stetig zurück, sodass man immer häufiger auf verlassene Wohnstätten stieß. Diese Hütten verwilderten völlig, herrenlose Wölfe liefen umher, und ältere Menschen beklagten, dass alles aus dem Ruder gelaufen und dies doch kein richtiges Leben mehr sei. Besonders traurig waren sie darüber, dass keine Kinder mehr geboren wurden, was leider ganz natürlich war – wer sollte sie denn bekommen, wenn alle Jüngeren ins Dorf flohen? So schaute auch ich mir das Dorf mal an, ich beobachtete es vom Waldrand aus, denn näher heranzugehen traute ich mich nicht. Alles war dort so anders, und meiner Meinung auch viel toller. So viel Sonne und Licht, die Häuser, die dort unter freiem Himmel standen, erschienen mir viel schöner als unsere halb unter den Fichten niedergedrückte Hütte, und bei jedem Haus sah ich eine große Anzahl Kinder herumlaufen.
Das machte mich besonders neidisch, denn ich hatte wenig Spielgefährten. Meine Schwester Salme machte sich nicht gerade viel aus mir – sie war ja fünf Jahre älter, außerdem ein Mädchen, sie machte ihren eigenen Kram. Zum Glück gab es aber Pärtel, mit dem ich viel umherstreifte. Und dann war da noch Hiie, die Tochter von Tambet, aber die war wiederum zu klein, stapfte noch steifbeinig um ihr Haus herum und plumpste alle nasenlang auf ihren Hintern. In ihr hatte ich vorerst keine Spielgefährtin, außerdem hielt ich mich nicht gerne bei Tambet auf – obwohl ich noch klein und dumm war, bekam ich doch mit, dass Tambet mich nicht ausstehen konnte. Immer wenn er mich sah, fauchte und schnaubte er, und einmal, als ich mit Pärtel vom Beerenpflücken kam und wir Hiie, die auf der Wiese herumlief, nichtsahnend Erdbeeren anboten, schrie Tambet vom Haus aus:
»Hiie, komm weg da! Von Dorfleuten nehmen wir nichts an!«
Er konnte unserer Familie einfach nicht verzeihen, dass wir seinerzeit den Wald verlassen hatten, und mich und Salme hielt er stur für Dorfkinder. Im Heiligen Hain starrte er uns immer mit unverhohlenem Widerwillen an, als würde er uns übelnehmen, dass Wesen wie wir, die vom Dorfgeruch verdorben waren, es überhaupt wagten, an einen so bedeutsamen Ort zu kommen. Wir gingen auch nicht gerne in den Hain, denn es gefiel uns überhaupt nicht, wie der Waldweise Ülgas die heiligen Bäume mit Hasenblut benetzte. Hasen waren so liebe Tiere, ich konnte nicht verstehen, dass ein Mensch sie allein aus dem Grunde tötete, um mit ihrem Blut Baumwurzeln zu befeuchten. Ich hatte Angst vor Ülgas, obwohl er rein äußerlich nicht furchteinflößend war, er sah eher aus wie ein gutmütiger Großvater, und auch zu Kindern war er freundlich. Manchmal kam er zu uns zu Besuch und erzählte von allen möglichen Schutzgeistern und dass gerade die Kinder ihnen gegenüber eine große Ehrfurcht hegen müssten. Vor dem Waschen an der Quelle sollten sie dem Wassergeist ein Opfer bringen, und nachdem sie mit dem Eimer Wasser geschöpft haben, noch ein zweites. Und wenn man im Fluss baden wollte, musste man gleich mehrere Opfer bringen, wenn man nicht wollte, dass der Wassergeist einen zu sich hinunterzog.
»Was für Opfer müssen das sein?«, fragte ich und der Waldweise erklärte mir freundlich lächelnd, dass man am besten einen Frosch nehme, ihn bei lebendigem Leibe der Länge nach durchschneiden und in die Quelle oder den Fluss werfen müsse. Dann sei der Geist zufrieden.
»Wieso sind die Schutzgeister denn so böse?« fragte ich erschrocken, denn einen Frosch auf diese Weise zu foltern, schien mir schrecklich. »Wieso wollen sie die ganze Zeit Blut?«
»Wie kannst du nur so dummes Zeug reden, die Schutzgeister sind nicht böse«, belehrte mich Ülgas. »Sie sind nun einmal die Herrscher der Gewässer und der Bäume, und wir müssen ihre Befehle erfüllen und ihnen zu Willen sein, so will es der uralte Brauch.«
Danach tätschelte er meine Wange und sagte, ich müsse unbedingt bald wiederkommen – »denn wer den Heiligen Hain nicht besucht, wird von den Waldhunden zerfleischt« – und weg war er. Ich aber blieb mit meinen Ängsten und Zweifeln alleine, denn nie im Leben konnte ich einen lebendigen Frosch durchschneiden, und so badete ich nur noch sehr selten, und möglichst nah am Ufer, damit ich noch aus dem Wasser rauskäme, bevor der blutrünstige Wassergeist mich anfallen konnte, weil er seinen Froschkadaver nicht bekommen hatte. Jedes Mal, wenn ich im Heiligen Hain war, fühlte ich mich dort unsicher und suchte alles nach den grausamen Waldhunden ab, die laut Ülgas dort lebten und Wache hielten, aber ich stieß nur auf Tambets missbilligenden Blick, der mir gewiss übelnahm, dass ein »Dorfbewohner« wie ich sich an dem heiligen Ort umsah, statt konzentriert den Beschwörungen des Waldweisen zu lauschen.
Dass man mich für einen »Dorfbewohner« hielt, störte mich eigentlich nicht, denn wie gesagt, ich mochte das Dorf. Ich versuchte immer wieder von Mutter herauszubekommen, warum wir von dort fortgegangen waren und ob wir nicht zurückgehen könnten – wenn schon nicht für immer, dann wenigstens ein bisschen, um mal zu gucken. Mutter war natürlich nicht einverstanden und versuchte mir zu erklären, wie toll es doch im Wald sei und wie langweilig und mühselig das Leben des Dorfvolks.
»Sie essen dort Brot und Gerstenbrei«, erzählte sie mir, offenbar in der Hoffnung, mich damit abzuschrecken, aber weil ich mich nicht an den Geschmack dieser beiden Speisen erinnerte, rief ihre Erwähnung auch keinerlei Ekel in mir hervor. Im Gegenteil, diese unbekannten Gerichte schienen mir verlockend, gerne hätte ich sie mal probiert. Das sagte ich auch meiner Mutter:
»Ich will Brot und Gerstenbrei!«
»Ach, du weißt ja gar nicht, wie widerlich das ist. Wir haben doch so viel gutes gebratenes Fleisch! Komm und nimm dir was, Junge! Glaub mir, das ist hundertmal besser!«
Ich glaubte es nicht. Gebratenes Fleisch aß ich jeden Tag, das war das normale Essen ohne jegliches Geheimnis.
»Ich will Brot und Gerstenbrei!«, bettelte ich trotzig.
»Leemet, hör jetzt auf mit dem dummen Geschwätz! Du weißt ja selbst nicht, was du redest. Du brauchst überhaupt kein Brot. Du denkst nur, dass du es willst, in Wirklichkeit würdest du es sofort ausspucken. Brot ist trocken wie Moos und klumpt sich im Mund zusammen. Schau mal, ich habe hier Euleneier!«
Euleneier waren mein Leibgericht, und als ich die Eier sah, hörte ich mit dem Quengeln auf und machte mich über sie her. Da kam Salme ins Zimmer und kreischte auf, als sie mich erblickte: Mutter würde immer nur mich verwöhnen – sie wolle auch Euleneier!
»Aber natürlich, Salme«, sagte Mutter beschwichtigend. »Ich habe für dich ein paar Eier beiseitegelegt. Ihr bekommt beide gleichviel.«
Salme nahm sich ihre Eier, setzte sich neben mich, und wir schlürften um die Wette unsere Eier aus. Und an Brot und Gerstenbrei dachte ich nicht mehr.
3.
Es ist natürlich klar, dass ein paar Euleneier meine Neugierde nicht auf Dauer befriedigen konnten, und schon am nächsten Tag lungerte ich wieder am Waldrand herum und schaute begehrlich in Richtung Dorf. Mein Freund Pärtel war dabei, und er war es auch, der schließlich sagte: »Was soll das denn, wir sind hier viel zu weit weg, schleichen wir uns ein wenig näher heran.«
Der Vorschlag kam mir äußerst riskant vor, allein schon der Gedanke daran bereitete mir Herzklopfen. Auch Pärtel sah nicht gerade mutig aus. Er sah mich mit einem Gesichtsausdruck an, als würde er erwarten, dass ich mit dem Kopf schüttele und mich weigern würde – wahrscheinlich erschreckten ihn seine eigenen Worte. Ich aber schüttelte nicht mit dem Kopf, sondern sagte vielmehr: »Dann mal los.«
Als ich das aussprach, hatte ich ein Gefühl, als müsste ich in einen dunklen Waldsee springen. Wir gingen ein paar Schritte weiter und hielten zögernd an. Ich schaute Pärtel an und sah, dass mein Freund kreidebleich war.
»Gehen wir weiter?«, fragte er.
»Naja.«
Und dann gingen wir weiter. Grausam war das. Das erste Haus war schon ganz nah, aber zum Glück sahen wir keine Menschenseele. Ich hatte mit Pärtel nicht vereinbart, wie weit wir gehen sollten. Ganz bis zum Haus? Und wie ging’s dann weiter: Schauten wir auch zur Tür hinein? Das hätten wir uns nie getraut. Ich bekam einen Kloß im Hals und hätte am liebsten Reißaus genommen, zurück in den Wald, aber da mein Freund neben mir ging, ziemte es sich nicht, eine derartige Feigheit zu zeigen. Pärtel dachte bestimmt dasselbe, denn ich hörte, wie er von Zeit zu Zeit lautstark schluckte. Aber trotzdem bewegten wir uns, als wären wir verhext, Schritt für Schritt vorwärts.
Da kam ein Mädchen aus dem Haus, ungefähr so alt wie wir. Wir hielten sofort an. Wäre ein Erwachsener vor uns aufgetaucht, wären wir wahrscheinlich schreiend zurück in den Wald gelaufen, aber vor einem gleichaltrigen Mädchen gab es keinen richtigen Grund wegzulaufen. Sie schien nicht besonders gefährlich, auch wenn es sich um ein Dorfkind handelte. Trotzdem waren wir sehr vorsichtig, starrten sie an und gingen nicht näher heran.
Das Mädchen seinerseits betrachtete uns. Sie wiederum schien nun überhaupt keine Angst zu haben.
»Kommt ihr aus dem Wald?«, fragte es.
Wir nickten.
»Seid ihr gekommen, um hier zu wohnen?«
»Nein«, antwortete Pärtel und ich fand, dass das der richtige Moment war, um ein wenig anzugeben, und teilte ihr mit, dass ich schon mal im Dorf gewohnt hatte, aber wieder weggezogen war.
»Warum bist du denn zurück in den Wald gegangen?«, wunderte sich das Mädchen. »Niemand geht in den Wald zurück, alle ziehen aus dem Wald ins Dorf. Im Wald leben nur Dummköpfe.«
»Selber bist du ein Dummkopf«, sagte ich.
»Bin ich nicht, du bist einer. Alle sagen, dass im Wald nur Idioten leben. Schau dir doch an, was du auf dem Leib hast! Felle! Grässlich! Wie bei einem Tier.«
Wir verglichen unsere Kleidung mit der von dem Mädchen und mussten zugeben, dass sie Recht hatte, unsere Kleider aus Wolfs- und Rehleder waren deutlich hässlicher als ihre und hingen wie Säcke an uns. Das Mädchen dagegen trug ein langes und feines Hemd, das keinem Tierfell ähnelte, es war dünn, leicht und bewegte sich im Wind.
»Was ist denn das für ein Fell?«, fragte Pärtel.
»Das ist eben kein Fell, das ist ein Kleid«, antwortete das Mädchen. »Das wird gewebt.«
Das Wort sagte uns nichts. Das Mädchen brach in Lachen aus.
»Ihr wisst nicht, was Weben ist?«, rief sie. »Habt ihr mal einen Webstuhl gesehen? Ein Spinnrad? Kommt rein, ich zeig’s euch.«
Diese Aufforderung war gleichermaßen furchteinflößend und verlockend. Pärtel und ich schauten uns an und fanden, dass wir das Risiko eingehen konnten. Gerätschaften mit solchen merkwürdigen Namen wollten wir uns gerne angucken. Und was konnte uns das Mädchen schon anhaben, wir waren schließlich zu zweit. Naja, wenn sie bloß keine Verbündeten da in dem Zimmer hatte …
»Wer ist da drinnen denn noch?«, fragte ich.
»Niemand. Ich bin alleine zu Hause, die anderen sind alle beim Heumachen.«
Das war wieder so eine unverständliche Sache, aber wir wollten nicht zu dumm ausschauen und deshalb nickten wir, als würden wir begreifen, was dieses »Heumachen« bedeutete. Wir fassten uns ein Herz und gingen hinein.
Das war ein beeindruckendes Erlebnis. All diese wundersamen Vorrichtungen, von denen das Zimmer voll war, machten einen ganz schwindelig. Wir standen da, als hätten wir einen Schlag mit der Keule bekommen, wir trauten uns nicht uns hinzusetzen oder einen Schritt zu tun. Das Mädchen dagegen fühlte sich wie ein Fisch im Wasser und freute sich darüber, dass sie sich vor uns aufspielen konnte.
»Schaut her, das hier ist ein Spinnrad«, sagte sie und berührte einen höchst merkwürdigen Gegenstand, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. »Damit wird gesponnen. Ich kann auch schon spinnen, soll ich es euch zeigen?«
Wir murmelten irgendetwas. Das Mädchen setzte sich ans Spinnrad und mit einem Mal fing das merkwürdige Instrument an sich zu drehen und zu schnurren. Pärtel stöhnte vor Begeisterung.
»Wahnsinn!«, brachte er hervor.
»Gefällt’s dir?«, fragte das Mädchen kokett. »Egal, ich hab jetzt keine Lust weiter zu spinnen.« Sie stand auf. »Was kann ich euch denn noch zeigen? Da, schaut her, das ist ein Brotschieber.«
Auch der Brotschieber machte großen Eindruck auf uns.
»Und was ist das?«, fragte ich und deutete auf einen an der Wand hängenden kreuzförmigen Gegenstand, an dem eine menschliche Figur befestigt war.
»Das ist Jesus Christus, unser Gott«, antwortete jemand. Das war nicht das Mädchen, es war die Stimme eines Mannes. Pärtel und ich machten einen Pieps wie Mäuschen und wollten zur Tür hinaushuschen, wurden aber abgefangen.
»Lauft nicht weg«, sagte die Stimme. »Ihr braucht nicht so zu zittern. Ihr kommt aus dem Wald, nicht wahr? Ganz ruhig, Jungs, niemand tut euch was zu Leide.«
»Das ist mein Vater«, sagte das Mädchen. »Was habt ihr denn, wovor habt ihr Angst?«
Wir betrachteten ängstlich den Mann, der ins Zimmer getreten war. Er war groß und mit seinen blonden Haaren und seinem blonden Bart eine imposante Erscheinung. Außerdem war er unserer Meinung nach beneidenswert gut gekleidet, er trug ein ebenso helles Hemd wie das Mädchen, und auch die Hose hatte die gleiche Farbe, und um den Hals hatte er genau so eine Kreuzfigur, wie ich sie an der Wand gesehen hatte.
»Erzählt mal, leben noch viele Menschen im Wald?«, fragte er. »Sagt euren Eltern doch, dass sie endlich von ihrer Verbohrtheit lassen müssen! Alle vernünftigen Menschen ziehen derzeit aus dem Wald ins Dorf. Es ist doch dumm, in unserem Jahrhundert noch im dunklen Unterholz zu leben und auf all die guten Dinge zu verzichten, die der heutige Fortschritt bietet. Man wird ganz wehmütig, wenn man an die Armen denkt, die immer noch in der Höhle darben, während die anderen Völker in Schlössern und Palästen leben! Warum muss unser Volk das letzte sein? Wir wollen dieselben Vergnügungen genießen wie die anderen Völker! Erzählt das euren Eltern. Wenn sie schon nicht an sich selbst denken, dann könnten sie doch zumindest ihren Kindern gegenüber ein Erbarmen haben. Was soll denn aus euch werden, wenn ihr nicht lernt, Deutsch zu sprechen und Jesus Christus zu dienen?«
Wir konnten darauf natürlich nichts erwidern, aber solch sonderbare Wörter wie »Schlösser« und »Paläste« ließen unser Herz erbeben. Die waren bestimmt noch beeindruckender als ein Spinnrad oder ein Brotschieber. Die würden wir schon gerne sehen! Vielleicht sollten wir tatsächlich zu Hause besprechen, dass man uns wenigstens für eine Zeit ins Dorf ließ, um all diese Wunderdinge einmal zu betrachten.
»Wie heißt ihr?«, fragte der Mann.
Wir murmelten unsere Namen. Der Mann klopfte uns auf die Schulter.
»Pärtel und Leemet – das sind heidnische Namen. Wenn ihr ins Dorf zieht, werdet ihr umgetauft, dann bekommt ihr einen Namen, der aus der Bibel stammt. Ich zum Beispiel hieß früher Vambola, nun trage ich aber schon viele Jahre den Namen Johannes. Und meine Tochter heißt Magdalena. Ist das nicht schön? Alle Namen aus der Bibel sind schön. Die ganze Welt trägt sie, die starken Männer und schönen Töchter aller großen Völker. Und wir auch, wir Esten. Wer klug ist, handelt so wie die anderen Klugen vor ihm, und rennt nicht kopflos umher wie ein Ferkel, das man aus dem Stall gelassen hat.«
Johannes klopfte uns noch einmal auf die Wange und begleitete uns nach draußen.
»Geht jetzt nach Hause und sprecht mit euren Eltern. Und kommt bald wieder. Alle Esten müssen aus dem dunklen Wald herauskommen, unter die Sonne und die himmlischen Winde, denn diese Winde tragen die Weisheit aus fernen Ländern zu uns. Ich bin der Dorfälteste, ich warte auf euch. Und Magdalena wartet auch auf euch, es wäre doch schön, wenn ihr gemeinsam spielen und am Sonntag in der Kirche zu Gott beten könntet. Auf Wiedersehen, Jungs. Gott schütze euch!«
Es war deutlich zu sehen, dass Pärtel mit sich rang. Er öffnete mehrmals den Mund, wagte aber nicht, einen Laut von sich zu geben. Endlich, als wir uns schon zum Gehen umwandten, hielt er es nicht mehr aus und fragte: »Onkel, was haben Sie da denn für eine lange Stange in der Hand? Mit so vielen Stacheln!«
»Das ist eine Harke!«, antwortete Johannes lächelnd. »Wenn du ins Dorf ziehst, bekommst du auch so eine.«
Pärtel grinste vor Freude. Wir rannten in den Wald.
Eine Zeitlang liefen wir zusammen, dann flitzte jeder in sein eigenes Zuhause. Ich stürmte in die Hütte, als würde ich von jemandem verfolgt, in der festen Überzeugung, dass ich jetzt gleich meiner Mutter klar machen würde, dass das Leben im Dorf viel interessanter sei als im Wald.
Mutter war nicht zu Hause. Auch Salme war nicht da. Nur Onkel Vootele saß in der Ecke und knabberte an einem Stück Trockenfleisch.
»Was ist denn mit dir passiert?«, fragte er. »Du glühst ja geradezu im Gesicht.«
»Ich war im Dorf«, antwortete ich und erzählte ihm schnell, was ich alles in Johannes’ Haus gesehen hatte. Dabei verhaspelte ich mich und vor Aufregung überschlug sich meine Stimme.
Onkel Vootele verzog keine Miene, als er all diese Wundergeschichten hörte, obwohl ich ihm mit einem Stück Kohle sogar eine Harke an die Wand malte.
»Ich habe so eine Harke durchaus schon mal gesehen«, sagte er. »Damit können wir hier überhaupt nichts anfangen.«
Das klang in meinen Ohren unglaublich dumm und altmodisch. Wie war das möglich? Wenn man schon mal so etwas wahnsinnig Spannendes wie eine Harke erfunden hatte, dann konnte man damit doch bestimmt auch etwas anfangen! Magdalenas Vater Johannes verwendete sie doch schließlich!
»Er braucht sie vielleicht wirklich, denn mit einer Harke kann man Heu zusammenraffen«, erklärte Onkel Vootele. »Heu wiederum haben sie nötig, damit ihnen ihre Tiere im Winter nicht verhungern. Wir haben diese Sorge nicht, unsere Elche und Rehe kommen im Winter alleine klar und suchen sich im Wald selbst ihr Fressen. Die Tiere der Dorfleute sind im Winter aber nicht draußen, sie scheuen die Kälte, und außerdem sind sie so dumm, dass sie sich im Wald verirren können, und dann finden die Dorfmenschen sie nicht wieder. Sie kennen die Schlangenworte nicht, mit denen man alle lebenden Wesen herbeirufen kann. Deswegen halten sie all ihre Tiere im Winter in einem Haus in Gefangenschaft und füttern sie mit Heu, das sie im Sommer unter großer Mühe gesammelt haben. Siehst du, darum brauchen die Dorfbewohner diese lächerliche Harke, aber wir kommen auch sehr gut ohne sie zurecht.«
»Und was ist mit dem Spinnrad?«, gab ich nicht nach. Das Spinnrad hatte tatsächlich einen noch viel stärkeren Eindruck hinterlassen, all diese Schnüre und Rädchen und anderen surrenden Bestandteile waren meiner Meinung nach so gewaltig, dass man es mit Worten gar nicht beschreiben konnte.
Mein Onkel lächelte.
»Ja, Kindern gefällt so ein Spielzeug«, sagte er. »Aber wir brauchen auch kein Spinnrad, denn ein Tierfell ist hundertmal wärmer und auch bequemer als gewobener Stoff. Die Dorfmenschen bekommen ganz einfach von den Tieren keine Felle, weil sie sich nicht mehr an die Schlangenworte erinnern, und alle Luchse und Wölfe laufen vor ihnen davon ins Gebüsch, oder umgekehrt, fallen sie an und fressen sie auf.«
»Dann war da noch ein Kreuz und darauf eine Menschenfigur, und der Dorfälteste Johannes sagte, dass das ein Gott sei, dessen Name Jesus Christus ist«, verkündete ich. Mein Onkel musste doch irgendwann mal begreifen, was für tolle Sachen es im Dorf gab!
Onkel Vootele zuckte nur mit den Schultern.
»Der eine glaubt an Geister und besucht den Heiligen Hain, der andere an Jesus und geht in die Kirche«, sagte er. »Das ist nur eine Frage der Mode. Etwas Nützliches kann man mit keinem einzigen Gott anfangen, sie sind eher so wie Broschen oder Perlen, bloß der Schönheit wegen. Um sie sich an den Hals zu hängen oder einfach damit zu spielen.«
Ich war gekränkt – dass mein Onkel all diese Wunder so in den Schmutz ziehen konnte –, und erwähnte den Brotschieber lieber gar nicht mehr. Bestimmt hätte mein Onkel auch darüber irgendetwas Hässliches gesagt, etwa so: Wir essen ja kein Brot. Ich hielt den Mund und schaute ihn missmutig an.
Mein Onkel schmunzelte.
»Sei jetzt nicht böse«, sagte er. »Ich verstehe dich ja, wenn man als Kind zum ersten Mal in seinem Leben das Dorfleben sieht, dann bringt einen dieser Schnickschnack völlig durcheinander. Nicht nur bei einem Kind, bei Erwachsenen auch. Schau dir doch an, wie viele aus dem Wald ins Dorf gezogen sind. Dein eigener Vater war einer von ihnen, er sprach auch von nichts anderem als davon, wie toll und erhaben es ist im Dorf zu leben, und dabei glänzten seine Augen wie die einer Wildkatze. Das Dorf macht einen auch verrückt, denn sie haben da wirklich viele besondere Instrumente. Aber du musst begreifen, dass alle diese Sachen nur aus einem einzigen Grunde erfunden worden sind – weil sie die Schlangenworte vergessen haben.«
»Ich kann die Schlangenworte auch nicht«, gab ich bockig zurück.
»Ja, das ist wahr«, sagte mein Onkel. »Aber du wirst sie bald lernen. Du bist jetzt groß genug. Aber es ist nicht leicht, darum haben heutzutage viele auch keine Lust mehr, sich damit abzuplagen, und denken sich lieber alle möglichen Sicheln und Harken aus. Das ist viel einfacher – wenn der Kopf nicht funktioniert, dann funktionieren die Muskeln. Aber du wirst damit fertig werden, davon bin ich überzeugt. Ich werde sie dir beibringen.«
4.
In früheren Zeiten muss es ganz natürlich gewesen sein, dass ein Kind schon von klein auf die Schlangenworte erlernte. Sicherlich gab es auch damals kundigere Kenner der Schlangenworte und solche, die nicht alle versteckten Feinheiten dieser Sprache verstanden haben – aber im alltäglichen Leben kamen auch sie zurecht. Alle Menschen beherrschten die Schlangenworte, die vor langer, langer Zeit die urzeitlichen Schlangenkönige unseren Vorfahren beigebracht hatten.
Als ich zur Welt kam, war schon alles anders. Die älteren Menschen verwendeten die Schlangenworte noch in einem gewissen Maße, aber wirkliche Weise gab es unter ihnen nur sehr wenige und die jüngere Generation hatte überhaupt keine Lust mehr, sich mit der komplizierten Sprache abzumühen. Die Schlangenworte sind nicht einfach, das menschliche Ohr ist kaum in der Lage, all die haarkleinen Unterschiede wahrzunehmen, die das eine Zischeln von dem anderen unterscheiden und damit dem Ausgesprochenen einen völlig anderen Sinn geben. Gleichzeitig ist die menschliche Zunge zunächst unglaublich plump und unflexibel und alles Zischeln hört sich im Mund eines Anfängers ziemlich gleich an. Das Erlernen der Schlangenworte muss man daher mit Zungenübungen beginnen – man muss ihre Muskeln täglich trainieren, damit die Zunge ebenso beweglich und geschickt wie die einer Schlange wird. Das ist anfänglich ganz schön mühsam und lästig, und deswegen ist es kein Wunder, dass für viele Waldbewohner diese Anstrengung zu groß war; sie zogen es vor, ins Dorf zu ziehen, wo es viel interessanter war und wo man die Schlangenworte nicht brauchte.
Eigentlich gab es auch keine richtigen Lehrer mehr. Die Entfremdung von den Schlangenworten hatte schon vor vielen Generationen ihren Anfang genommen, und auch unsere Eltern konnten von allen Schlangenworten nur noch einige der verbreitetsten und leichtesten, zum Beispiel das Wort, das einen Elch oder Hirsch zu dir ruft, damit du ihm die Kehle durchschneiden kannst, oder das Wort zur Beruhigung eines wild gewordenen Wolfes, sowie das normale Geplauder über das Wetter und dergleichen für Gespräche mit vorbeikriechenden Kreuzottern. Die kräftigeren Worte brauchte man schon lange nicht mehr, denn zum Zischeln der stärksten Worte benötigte man gleichzeitig viele tausend Männer, wenn sie irgendwelchen Nutzen haben sollten. Aber diese Massen gab es schon lange nicht mehr im Wald. So waren denn auch viele Schlangenworte in Vergessenheit geraten und in letzter Zeit machten sich viele nicht einmal mehr die Mühe, die einfachsten auswendig zu lernen, denn wie gesagt, leicht waren sie nicht zu behalten – und wozu sollte man sich anstrengen, wenn man einem Pflug hinterherlaufen und seine Muskeln anspannen konnte?
Ich war also in einer ziemlich besonderen Lage, denn Onkel Vootele beherrschte alle Schlangenworte – zweifellos war er der einzige im Wald. Nur von ihm konnte ich noch alle Feinheiten dieser Sprache erlernen. Und Onkel Vootele war ein erbarmungsloser Lehrer. Mein ansonsten so freundlicher Onkel wurde mit einem Mal eisenhart, wenn es um den Unterricht in den Schlangenworten ging. »Die muss man einfach lernen!«, sagte er klipp und klar und zwang mich immer wieder, das komplizierteste Zischeln zu wiederholen, sodass mir abends die Zunge schmerzte, als ob jemand sie den ganzen Tag lang verdreht hätte. Wenn dann auch noch meine Mutter mit ihrer Elchkeule kam, schüttelte ich verschreckt den Kopf – die bloße Vorstellung, dass meine arme Zunge zusätzlich zu all den täglichen Strapazen auch noch Kau- und Schluckbewegungen machen sollte, füllte meinen Mund mit grausamem Schmerz. Mutter war verzweifelt und bat Onkel Vootele, mich doch weniger zu quälen und mir zunächst nur das allerleichteste Zischeln beizubringen, aber Onkel Vootele war damit nicht einverstanden.
»Nein, Linda«, sagte er zu meiner Mutter. »Ich werde Leemet die Schlangenworte so gründlich beibringen, dass er selbst nicht mehr weiß, ob er ein Mensch oder eine Schlange ist. Momentan bin ich der einzige, der diese Sprache noch so beherrscht, wie unser Volk das seit Urzeiten getan hat und auch tun muss, und wenn ich einmal sterbe, dann ist Leemet derjenige, der die Schlangenworte nicht völlig in Vergessenheit geraten lässt. Vielleicht gelingt es ihm auch, einen Nachkommen auszubilden, vielleicht einen eigenen Sohn, so dass diese Sprache möglicherweise doch nicht endgültig ausstirbt.«
»Ach, du bist halsstarrig und böse wie unser Vater!«, seufzte Mutter und legte mir Kamillenkompressen auf meine malträtierte Zunge.
»War Großvater denn böse?«, murmelte ich mit der Kompresse zwischen den Zähnen.
»Fürchterlich böse«, antwortete Mutter. »Natürlich nicht uns gegenüber, uns liebte er. So ist er mir wenigstens in Erinnerung, obwohl sein Tod schon so lange zurückliegt und ich damals noch ein kleines Mädchen war.«
»Woran starb er denn?«, fragte ich weiter. Ich hatte früher noch nie etwas von meinem Großvater gehört und kam erst jetzt zu der überraschenden Schlussfolgerung, dass mein Vater und meine Mutter natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen sein konnten, sie mussten natürlich auch Eltern haben. Aber warum wurde nie über sie gesprochen?
»Die Eisenmänner haben ihn getötet«, sagte meine Mutter und Onkel Vootele fügte hinzu: »Nicht getötet, sondern ertränkt. Ihm die Beine abgehackt und ins Meer geworfen.«
»Aber mein anderer Großvater?«, fragte ich. »Ich muss doch zwei Großväter haben.«
»Die Eisenmänner haben auch ihn getötet«, sagte Onkel Vootele. »Das war in einer großen Schlacht, die lange vor deiner Geburt stattfand. Unsere Männer zogen tapfer gegen die Eisenmänner zu Felde, wurden aber kurz und klein geschlagen. Ihre Schwerter waren zu stumpf, ihre Speere zu schwach. Das hätte alles nichts zu bedeuten gehabt, denn Schwerter und Speere waren nie die Waffen unseres Volkes, sondern der Nordlanddrache. Wenn es uns gelungen wäre, den Nordlanddrachen aufzuwecken, hätte er die Eisenmänner im Handumdrehen verschluckt. Aber wir waren zu wenige, viele waren schon ins Dorf gezogen und kamen nicht zu Hilfe, als man sie darum bat. Und selbst wenn sie gekommen wären, wären sie doch keine Hilfe gewesen, denn sie erinnerten sich nicht mehr an die Schlangenworte. Der Nordlanddrache steht aber nur auf, wenn er von Tausenden gerufen wird. So blieb unseren Männern nichts anderes übrig, als zu versuchen, die Eisenmänner mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen, doch so etwas ist immer ein hoffnungsloses Unterfangen. Fremde Dinge bringen niemandem Glück oder Vorteil. Die Männer wurden totgeschlagen und ihre Frauen, darunter auch deine beiden Großmütter, zogen ihre Kinder auf und starben dann an ihrem Kummer.«
»Unser Vater wurde übrigens nicht in der Schlacht erschlagen«, präzisierte meine Mutter. »Niemand traute sich in seine Nähe, denn er hatte Giftzähne.«
»Wie das denn – Giftzähne?«
»Wie eine Kreuzotter«, erklärte Onkel Vootele. »Unsere vorzeitlichen Ahnen hatten alle Giftzähne, aber so wie man im Laufe der Zeit auch die Schlangensprache vergessen hat, so verschwanden auch die giftigen Hauer. In der letzten Zeit kommen sie nur noch sehr selten vor und im Moment kenne ich keinen, der sie noch hat, aber unser Vater hatte Giftzähne und er hat seine Feinde gnadenlos gebissen. Die Eisenmänner hatten eine Riesenangst vor ihm und flohen in alle Richtungen, wenn Vater seine Zähne bleckte.«
»Wie haben sie ihn dann bekommen?«
»Sie schafften ein Katapult herbei«, seufzte Mutter, »und schleuderten Steine in seine Richtung. Irgendwann trafen die Vater, sodass er das Bewusstsein verlor. Dann fesselten die Eisenmänner ihn unter Freudenschreien, hackten ihm die Beine ab und warfen ihn ins Meer.«
»Die Eisenmänner haben deinen Großvater wahnsinnig gehasst und gefürchtet«, sagte mein Onkel. »Er hatte wirklich einen ungestümen Charakter und in seinen Adern floss das feurige Blut unserer Vorfahren. Wenn wir alle so wie er geblieben wären, wäre es den Eisenmännern nie und nimmer gelungen, in unserem Land einen Fuß auf die Erde zu bekommen – man wäre ihnen an die Gurgel gegangen und hätte sie bis auf die Knochen abgenagt! Aber leider verkommen Menschen und Völker. Die Zähne verschwinden, die Sprache wird vergessen – und am Ende krümmt man sich fromm auf dem Feld und schneidet mit der Sichel seine Halme ab.«
Onkel Vootele spuckte aus und starrte vor sich auf den Boden mit einem dermaßen grausamen Gesichtsausdruck, dass ich dachte, das grausame Blut des halsstarrigen Großvaters ist auch in seinem Sohn noch nicht völlig erloschen.
»Vater brüllte in den Wellen noch mit einer so entsetzlichen Stimme, dass die Eisenmänner in ihr Schloss flohen und alle Fensterläden zuklappten«, sagte Mutter zum Abschluss dieser traurigen Geschichte. »Das ist jetzt schon gut und gerne dreißig Jahre her.«
»Allein schon aus diesem Grunde musst du die Schlangenworte lernen«, sagte mein Onkel. »Zur Erinnerung an deinen kräftigen Großvater. Hauer kann ich dir nicht in deinen Mund einpflanzen, aber eine wendige Zunge schon. Spuck den Mansch jetzt aus, fangen wir wieder an.«
»Lass ihn doch noch ein wenig ausruhen!«, bettelte Mutter.