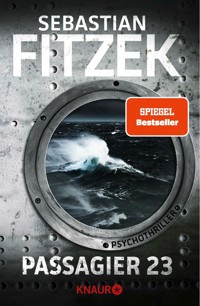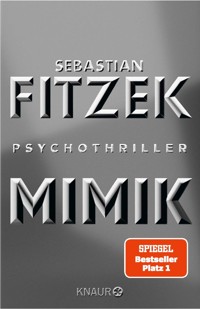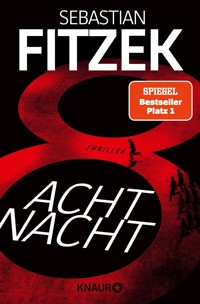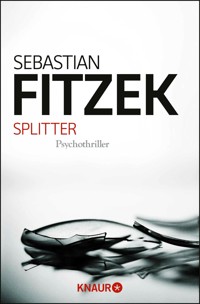19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie dachte, ihre größte Angst ist es, allein zu sein. Bis sie herausfindet, dass sie es nie war... Wer ist der »Nachbar«? Sebastian Fitzeks raffinierter Gänsehaut-Thriller für 2025 Die Strafverteidigerin Sarah Wolff leidet an Monophobie, der Angst vor Einsamkeit. Was sie nicht weiß: Nachdem sie mit ihrer Tochter an den Stadtrand Berlins gezogen ist, hat sie einen unsichtbaren Nachbarn, der sie keine Sekunde lang allein lassen wird … Das Unheimliche lauert im engsten Umfeld - der neue nervenzerreißende Psychothriller von #1-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek sorgt für garantiert unruhige Nächte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Der Nachbar
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sie dachte, ihre größte Angst ist es, allein zu sein. Bis sie herausfindet, dass sie es nie war...
Wer ist der »Nachbar«?
Die Strafverteidigerin Sarah Wolff leidet an Monophobie, der Angst vor Einsamkeit. Was sie nicht weiß: Nachdem sie mit ihrer Tochter an den Stadtrand Berlins gezogen ist, hat sie einen unsichtbaren Nachbarn, der sie keine Sekunde lang allein lassen wird …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Epilog
Zum Buch und Danksagung
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Für Linda,
die Frau, mit der ich in jede Nachbarschaft ziehen würde.
Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben,
wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.
Friedrich Schiller
Prolog
In den meisten Thrillern, die er in den letzten Jahren gelesen hatte, war das Wetter schlecht. Es schneite, stürmte, blitzte und donnerte in biblischem Ausmaß. Als wäre die Natur ein Komplize der Vergewaltiger, Serienmörder und Psychopathen. Wenn ausnahmsweise dann doch mal die Sonne schien, brannte sie einem gleich die Haut von den Knochen. Dabei geschahen seiner Erfahrung nach die schlimmsten Verbrechen bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen. An Tagen wie heute.
Es war 7:20 Uhr. Nach der Lebendkontrolle der Gefangenen durch einen Neuling, den er noch nie gesehen hatte, hatte er im Speisesaal gefrühstückt. Dann war er zu Armin bestellt worden, dem Schichtleiter für diese Woche.
Dessen Büro fand sich auf der Ebene der Zellen und war nicht sehr viel gemütlicher eingerichtet als die, die er sich seit knapp einem Jahr mit einem notorischen Brandstifter teilen musste.
»Na, bist du schon am Packen?«, begrüßte ihn Armin freundlich. Seine Zähne waren so schief wie sein Lächeln. In dem Gesicht des fünfundfünfzigjährigen Beamten konnte er lesen wie in einem offenen Buch. Wenn Armin wütend war, hingen ihm die boxerhundähnlichen Wangenfalten bis zum Doppelkinn. War er gut gelaunt wie jetzt, riss er die Augen so weit auf, dass die Schlupflider verschwanden. Er zog seine Uniformhose regelmäßig bis über den Bauchnabel, was ihm den Spitznamen Obelix eingebracht hatte, dabei war der Gefängnisbeamte nicht einmal annähernd so füllig wie die Comicfigur.
Aber ich bin ja auch kein Genie, und sie nennen mich Einstein, nur weil ich studiert habe.
Armin bat ihn, sich an einen Schreibtisch zu setzen, für den man auf dem Flohmarkt noch hätte draufzahlen müssen, damit ihn jemand mitnahm. Zerkratzt, zerschlissen, die Arbeitsplatte in der Farbe von Babydurchfall. Aber unkaputtbar, weswegen Obelix garantiert früher in Rente gehen würde als das hässliche Ungetüm.
»Was verschafft mir die Ehre?« Einstein sah hoch zu dem vergitterten Oberlicht, durch das die Herbstsonne ihre warmen Strahlen in das kahle Büro schickte. Die Schatten der Balken erzeugten ein Kreuz an der Wand rechts von ihm. Mit etwas Fantasie hätte man denken können, in einer Kirche zu sitzen und nicht im Büro des Stationsdienstes der JVA Frankfurt.
»Du wirst es nicht glauben, aber du hast Post!« Armin schüttelte den Kopf, als hätte er ihm gerade die Nachricht überbracht, zwei Millionen im Lotto gewonnen zu haben.
»Ach ja?« Das war in der Tat ungewöhnlich. Sein letzter Brief war so lange her, dass er sich nicht mehr an ihn erinnern konnte. Er war nicht der Typ für Fanpost, auch wenn er von den Medien damals als »der Irre mit Schlafzimmerblick« beschrieben worden war.
Es gab Verbrecher, die sehr viel mehr Menschenleben noch sehr viel brutaler zerstört hatten als er, und die bekamen Liebesbriefe von Frauen, die an einer Art telepathischem Stockholm-Syndrom litten. Obwohl sie die Bestien, denen sie schrieben, noch nie persönlich getroffen hatten, fühlten sie sich zu ihnen hingezogen. Die meisten hingen der dringend therapiebedürftigen Ansicht an, der Typ, der seine Frau mit Stacheldraht gefesselt und dann im Suff vergessen hatte, wo genau im Garten er sie lebendig mit dem Gartenschlauch in der Luftröhre verbuddelt hatte, könne durch ihre Liebe, die er als Kind nie bekommen habe, geheilt werden. Na dann, viel Erfolg.
Armin stand hinter seinem Schreibtisch auf und trat mit dem Brief in der Hand neben ihn. »Ich will ehrlich sein, Einstein. Als du eingeliefert wurdest, habe ich dir keine zwei Wochen gegeben. Und noch ehrlicher: Ich hab mir sogar gewünscht, dass sie dich noch früher unter der Dusche abstechen.«
Einstein nickte. Das dachte er mittlerweile auch. Zwölf Jahre. Viel zu wenig für das, was er getan hatte.
»Doch nun sieh dich an. In einer Woche kommst du raus!«
»Montag um diese Zeit«, bestätigte er. Nach elf Jahren schon. Die gute Führung hatte ihm zwölf Monate Rabatt verschafft.
»Wie fühlst du dich?«
Gute Frage.
Er war immer der Meinung gewesen, hier falsch zu sein. Sie hätten ihn in die Forensische Psychiatrie stecken müssen und nicht in den herkömmlichen Vollzug. Höchste Sicherheitsstufe. Dafür, dass er hier nur hin und wieder in Therapie gewesen war, hatte es allerdings ganz gut geklappt. Er war natürlich nicht geheilt, das war nicht möglich. Aber er war gut eingestellt. Die behutsam betreute Reintegration hatte funktioniert; die Außenwelt kam ihm zwar fremd vor, logisch, aber er fühlte sich auf seinen kontrollierten Freigängen nicht mehr wie ein Alien. Und das Entscheidende: Er bereute es. Alles. Er verabscheute das, was er ihnen angetan hatte. Den Familien. Vor allem seiner eigenen.
Das Allerwichtigste aber war: Er verabscheute sich selbst.
»Ich habe Angst«, gestand er.
Armin nickte. »Alles andere wäre seltsam. Aber du kannst es schaffen. Halt dich an deine Auflagen, mach die Therapie weiter, vergiss deine Pillen nicht! Und halt dich von Babys in Kinderwagen fern.«
Einstein nickte. Lange Zeit hatte er gedacht, er wäre hoffnungslos verloren. Doch je näher der Tag der Entlassung rückte, umso zuversichtlicher hatte er der Zukunft entgegengesehen. Er würde allein bleiben, für sich. Irgendwo auf dem Land, weitab von Menschen, denen er gefährlich werden könnte. In einer Laube vielleicht, oder auf einem Hausboot. Etwas ohne Nachbarn, mit einem kleinen Garten zum Selbstversorgen. Nur er und seine Bücher, bis zum Ende seiner Tage. Das war sein Plan. Und er fühlte sich gut an. Erfüllte ihn mit etwas, das dem Gefühl von Lebensfreude womöglich schon nahekam.
»Nun, dann schreiten wir zur Tat.«
Im Knast wurde Gefangenenpost im Beisein eines JVA-Beamten geöffnet, der sie erst nach einer Kontrolle übergab. Die Überprüfung des absenderlosen Briefes nahm keine zwei Sekunden in Anspruch, nachdem Armin den Umschlag aufgerissen hatte.
»Hm«, sagte er und reichte den Zettel weiter.
Auf ihm stand nur ein einziges Wort.
Einsteins Augen weiteten sich. Hätte er bei Frau Dr. Paulsen auf der Pritsche gelegen, mit einem Pulsmessgerät am Finger, hätte die Anzeige jetzt dunkelrot aufgeblinkt.
»Geht mich ja nichts an, aber was bedeutet das?«, fragte Armin.
Einstein zwang sich zu einem Lächeln. »Ist ein Insider.« Mit diesen Worten faltete er den Zettel zusammen.
Drei Stunden später war er zur Mittagsruhe wieder eingeschlossen. Sein Mitbewohner hatte seine Zigarettenschulden nicht bezahlt und lag mit Milzriss auf der Krankenstation. Einstein musste also keine neugierigen Blicke fürchten, als er den Brief zum ersten Mal wieder öffnete:
Nahgibur
Blauer Kugelschreiber auf einer schneeweißen DIN-A5-Seite. Er las das eine Wort. Fuhr mit der Fingerkuppe drüber. Wieder und wieder.
Schließlich hielt er das Blatt ins Gegenlicht der Deckenlampe. Herkömmliches Druckerpapier. Mitteldick. Etwa fünfundsechzig Mikrometer. Also ideal. Besseres gab es nicht für seinen Zweck, abgesehen von dem, was man früher in diesen Endlosrollen in Nadeldrucker gespannt hatte.
Einstein seufzte. Faltete es mehrmals und setzte es schräg an.
Dann schnitt er sich mit dem Papier die Pulsadern auf.
Kapitel 1
»… befindet sich der Psychopath trotz eines Großaufgebots der Frankfurter Polizei seit seinem jüngsten Säure-Anschlag auf ein Kleinkind noch immer auf der Flucht.«
Nicht einmal eine Viertelstunde bevor die sonore Stimme des Radiomoderators den ersten Schatten der Vorahnung in das Halbdunkel der Waldhütte werfen sollte, küsste Sarah Calau die Wange ihrer schläfrigen Tochter.
»Erzählst du mir noch eine Geschichte, Mama?«
Ruby hatte die Fahrt über geschlafen und war eben erst aufgewacht, als sie in der Zufahrt den Motor ausgestellt hatten. Dementsprechend müde klang ihre Stimme, und dementsprechend warm fühlte sich der Körper der Dreijährigen an, als Sarah ihre Tochter aus dem Kindersitz hob und in das Wochenendhäuschen trug. Eingewickelt in Papas Lieblingsjacke, einen schwarzen Collegeblouson mit weißen Kunstlederärmeln.
»Aber es muss eine selbst ausgedachte Geschichte sein, Mama«, forderte Ruby mit dem für sie typischen sanften Lächeln.
Natürlich, was denn sonst, mein Schatz!
Sarah seufzte innerlich.
Sosehr sie es liebte, wenn ihr »Baby« sich an sie schmiegte und noch vor dem Ende der improvisierten Gutenachtgeschichte in ihren Armen einschlief, so sehr hatte sie gehofft, heute ausnahmsweise drum herumzukommen.
Zum einen, weil sie völlig erschöpft von der Woche war. Hauptsächlich aber, weil sie sich kaum auf etwas anderes konzentrieren konnte als auf die anstehende Aussprache mit Ralph. Wie sollte sie sich da eine halbwegs vernünftige Geschichte aus den Fingern saugen?
Sie warf einen Blick über die Schulter zu ihrem Mann, der gerade die Taschen für ihren Wochenendausflug aus dem Kofferraum des Familienkombis hievte.
Ob er es ahnt?
Immerhin waren sie beide auf der Fahrt hierher erstaunlich schweigsam gewesen.
Ganz sicher ahnt er was! Er konnte kaum davon ausgehen, dass sie nach dem Vorfall einfach zur Tagesordnung übergehen würde.
»Bitte, Mami. Nur eine kurze Geschichte!«
»Natürlich, Süße«, versprach Sarah und schaffte es irgendwie, Ruby nicht aus den Armen zu verlieren, während sie die Holztür zur Hütte aufschloss.
Im Inneren ihres Refugiums empfing sie wie immer ein staubiger, holziger Duft, der sehr viel schlichter war als das edle Raumparfum der Kanzlei, in der sie im Westend als Strafrechtlerin arbeitete. Dennoch gefiel er ihr viel besser.
Ruby war bereits wieder im Halbschlaf. Sarah legte sie auf der gepolsterten Bank in der Nische mit dem Esstisch ab und blickte durch das Wohnzimmerfenster nach draußen.
Das Holzblockhaus ruhte am Rand einer Anhöhe, die sanft zum Ufer des Edersees abfiel, weswegen man von der Terrasse aus einen atemberaubenden Blick über die Steganlagen bis weit übers Wasser hatte.
Nirgendwo sonst schien Sarah die Atmosphäre so friedlich, wie wenn sie hier mit der Familie ihre knapp bemessene Freizeit verbrachte.
Normalerweise.
Aber heute war kein normaler Tag. Ganz und gar nicht.
Sie hatte sich in der Waldhütte am See immer geborgen gefühlt, fernab vom »Sud«, wie ihr Mann den Frankfurter Großstadt-Moloch nannte. Die zwei Stunden Fahrt von der Innenstadt bis nach Waldeck nahm sie dafür gerne in Kauf. Schon in dem Moment, wenn sie von der Landstraße links in den unbefestigten Weg einscherten, erhellte sich gewöhnlich ihr Gemüt. Meist zog sie sich noch im Auto um. Auch heute hatte sie auf den letzten Metern bereits ihr »Anwalts-Kompetenz-Outfit« abgelegt; hatte den hellen Business-Anzug gegen Shorts und T-Shirt getauscht, den Zopf gelöst und den strengen Mittelscheitel verwuschelt, damit die braunen Locken ihr ins Gesicht wehen konnten, sobald sie ausstieg. Doch trotz der vertrauten Rituale hatte sich die innere Willkommensruhe heute partout nicht einstellen wollen.
Vielleicht kommt sie ja, wenn ich mit Ruby ins Reich der Fantasie springe.
»Hab ich dir schon mal vom Riesen erzählt, der sich in eine Maus verliebt hat?«
Ruby schüttelte schläfrig den kleinen Wuschelkopf.
»Der Riese wurde von allen gefürchtet, weil er so groß war. Er hatte keine Freunde und wünschte sich nichts sehnlicher, als klein zu sein. Am besten so winzig wie eine Maus«, begann Sarah. »Eines Tages ging er an einem Haus vorbei, das so hoch war wie der höchste Baum, den du kennst. Und ganz oben auf dem Dach saß in der Dachrinne eine Maus und kam nicht mehr herunter. Der Riese hat sich sofort in die Maus verliebt, aber die Maus hatte große Angst vor ihm und piepste ihn mit heller Mäusestimme an: ›Bitte lass mich, geh weg!‹
Dabei wollte der Riese doch nur nett sein.«
»Armer Riese«, befand Ruby gähnend. Sarah strich ihr über die Stirn und gab Ralph ein Zeichen, dass er beim Hereintragen der Taschen etwas weniger poltern sollte.
»Der Riese hat lange überlegt, was er der Maus schenken könnte, um ihr Herz zu gewinnen«, fabulierte sie weiter, ohne eine konkrete Ahnung zu haben, wohin die Geschichte sie noch führen würde. »Blumen!, dachte er. Ich werde ihr Blumen schenken.« Sarah schilderte, wie der Riese in den Wald ging, um einen großen Strauß zu pflücken. »Doch als er mit den Blumen zu der Maus auf dem Dach zurückkam, fiepste die noch sehr viel ängstlicher als bei ihrer ersten Begegnung. ›Bitte, nein. Tu mir nichts!‹, sagte sie, als der Riese ihr den Blumenstrauß entgegenstreckte.«
»Wieso freut die Maus sich denn nicht?«, wollte Ruby wissen, die Augen längst wieder geschlossen.
»Na ja, der Riese hat doch Hände so groß wie die Schaufeln eines Baggers. Mit denen hat er keine Blumen gepflückt, sondern Bäume ausgerissen. Keine Tulpen, Rosen oder Butterblumen, sondern Eichen, Birken und Kiefern. Und jetzt stell dir mal vor, welche Angst die Maus ausgestanden haben muss, als der Riese mit einem Strauß voller dicker, großer Bäume vor ihr herumwedelte … Ruby?«
Sie strich ihr ein weiteres Mal sanft übers Köpfchen und beobachtete lächelnd ihre sanfte, gleichmäßige Atmung.
So zierlich, dachte Sarah sorgenvoll. Während sie in der Schwangerschaft siebzehn Kilo draufgepackt und seitdem nicht wieder verloren hatte, schien Ruby Tag für Tag dünner zu werden.
»Schon wieder eingeschlafen.« Sie sah zu ihrem Mann, der die Vorräte aus der Provianttüte in den Schränken der kleinen Küchenzeile verstaute.
Er warf Sarah einen kritischen Blick zu.
»Was?«
»Ich finde, wir sollten ihr nicht so viel Quatsch erzählen. Irgendwann glaubt sie das noch.«
WIR erzählen schon mal gar nichts!, lag ihr auf der Zunge. Immerhin war sie die Einzige, die Ruby vorlas oder sich für sie Geschichten ausdachte. Mittlerweile kam es schon einem Wunder nahe, wenn Ralph überhaupt noch unter der Woche nach Hause kam. Immer öfter übernachtete er nach langen Arbeitstagen im Krankenhaus oder in seiner Praxis.
Sarah schluckte ihren Groll herunter. Noch fühlte sie sich nicht bereit für das drohende Streitgespräch. Vielleicht würde sie es das ganze Wochenende nicht sein.
Was für eine bescheuerte Idee, es ausgerechnet hier im Waldhaus führen zu wollen, dachte sie auf einmal. Sie hatte gehofft, hier die Kraft dafür zu finden, und dabei übersehen, dass sie damit womöglich ihren letzten Wohlfühlplatz vergiften würde. Dies war der einzige Ort, an dem ihre Albträume sie bislang noch nicht heimgesucht hatten, die Träume, die sich wie eine True-Crime-Dokumentation anfühlten. Deren Schrecken auf einem wahren Ereignis basierten. Wieder und wieder durchlebte sie in ihren Albträumen den Frühlingstag, an dem sie ein wehrloses Kind tötete …
Kapitel 2
Der Traum, in dem sie vier Jahre alt war, begann immer damit, dass sie durchs Schlüsselloch starrte. Aus ihrem Kinderzimmer hinaus in den Flur, um zu sehen, ob Papa sie hören und befreien würde.
»Schschsch, Leon. Alles ist gut«, rief sie ihrem kleinen, elf Monate alten Bruder zu, ohne zu wissen, wie sie ihn ohne Milch oder Brei beruhigen sollte. Sie kam nicht in die Küche, denn aus irgendeinem Grund war die Zimmertür abgeschlossen, was Papa noch nie getan hatte. Wahrscheinlich hatte er Angst, sie würden ihn stören. Er hatte einen privaten Physiotherapie-Termin (dieses Wort hatte sie erst sehr viel später aussprechen gelernt). Der war wichtig für seine Gesundheit, und er hatte doch so wenig Zeit nach der Arbeit in der Firma. Die zwanzig Minuten, in denen er in Behandlung war, solle sie brav sein, hatte er gesagt. Sarah möge sich bitte wie eine große Schwester verhalten. Wozu wahrscheinlich zählte, dass sie Leon jetzt beruhigen musste. Aber der wurde und wurde nicht still. Er schrie sogar noch lauter. Selbst nachdem sie ihm den Bonbon gegeben hatte, den sie nach langem Suchen in der Schale auf dem Schreibtisch fand. Leon hatte kurz an ihm gelutscht und ihn dann einfach runtergeschluckt.
Vier Tage später war er tot.
Als die Eltern aus dem Krankenhaus zurückkamen, mit einer leeren Babyschale und noch leereren Augen, hatten sie Sarah gefragt, ob sie Leon etwas zu essen gegeben habe.
»Nur einen Bonbon«, hatte sie gesagt. »Damit er aufhört zu weinen!«
Aber es war kein Bonbon gewesen, sondern eine Knopfbatterie. Eine flache Zelle, wie man sie in Fernbedienungen und Körperwaagen findet. Sie war in Leons Speiseröhre stecken geblieben. Leider so, dass er noch unproblematisch Luft bekam, was ihm zum Verhängnis wurde, sonst hätte man den Fremdkörper vermutlich früher entdeckt. So aber setzten die feuchten Schleimhäute einen Stromfluss in Gang, der ätzende Hydroxidionen freisetzte. Diese fraßen sich durch die Speiseröhre bis zur Hauptschlagader, wo sie eine unkontrollierte Blutung auslösten. Als die Eltern Leon zum Arzt brachten, weil er nach einer Phase der Appetitlosigkeit nicht aufhören wollte, sich zu übergeben, war es bereits zu spät.
»Es ist nicht deine Schuld«, sagten sie ihr unter Tränen. Vor, während und nach dem Begräbnis. »Knopfzellen haben in Kinderzimmern nichts verloren. Wir hätten besser aufpassen müssen!«
Doch je öfter ihre Eltern sich Selbstvorwürfe machten, umso weniger glaubte sie ihnen. Denn insgeheim hatte Sarah gewusst, dass die silberne, flache Zelle nicht so aussah wie ein herkömmlicher Bonbon, den sie sonst immer lutschte. Sie hatte überlegt, ob sie ihn Leon trotzdem geben sollte, und eine fatale Entscheidung gefällt. Einfach, weil er zu schreien aufhören sollte.
Bis heute, viele Jahre später, wenn sie schweißgebadet erwachte, weil sie von ihrem toten Bruder geträumt hatte, war es eine offene Wunde. Sie war schuld. Sie hatte ihn vergiftet. Weil sie ein Problem, dem sie als Vierjährige nicht gewachsen war, allein hatte lösen wollen. Und dabei war sie aufs Grauenhafteste gescheitert. Ihre Therapeutin Elke Reiners sah darin den Auslöser ihrer Monophobie. Der Angst, allein zu sein, ohne einen starken Partner in der Nähe, der im Notfall die richtige Entscheidung treffen konnte.
Wie Ralph.
Bei dem sie jetzt allerdings nicht das vertraute Gefühl der Geborgenheit spürte, hier in der Hütte. Und das lag nicht allein an der Tatsache, dass sie es ihm heute sagen wollte. Es ging nicht mehr so weiter. Erst recht nicht, nachdem ihm bei Ruby die Hand ausgerutscht war.
Ausgerutscht.
Was für ein grausam verniedlichendes Wort. So passiv und zufällig. Absichtslos. Dabei hatte die Ohrfeige zielsicher getroffen. Den Handabdruck auf Rubys Wange meinte Sarah noch immer zu sehen, aber das war natürlich Einbildung.
Dass sie sich so schlecht fühlte, rührte auch von dem Zwischenfall an der Autobahntankstelle. Der blonde Fahrer eines vor Dreck starrenden Transporters eine Zapfsäule hinter ihnen hatte beim Tanken mit wildem Blick ihre Tochter gemustert, die mit ihnen ausgestiegen war, um sich die Beine zu vertreten. Als Sarah nach dem Bezahlen zurückkam, hatte er sie mit einer seltsamen Mischung aus Furcht und Aggression im Blick angestarrt. Im Rückspiegel war der Mann immer kleiner, ihre Beklemmung immer größer geworden.
Und jetzt, eine halbe Stunde später, zuckte sie erneut zusammen, als Ralph das Küchenradio einschaltete und der Nachrichtensprecher einen Satz vollendete, der auf unheimliche Art zu ihrer beängstigenden Erinnerung passte:
»… befindet sich der Psychopath trotz eines Großaufgebots der Frankfurter Polizei seit seinem jüngsten Säure-Anschlag auf ein Kleinkind noch immer auf der Flucht. Der sadistische Killer sucht sich junge Eltern«, setzte der Nachrichtensprecher im Radio seinen Sensationsbericht fort, »Familien, denen er ihr Kinderglück nicht gönnt!«
Sarah sah zu Ruby, die jetzt mit halb offenem Mund auf der Bank schlief. So tief und fest, dass man die Waldhütte um sie herum hätte abreißen können, ohne dass sie wach geworden wäre. Ein Händchen unters Kinn geschoben, ihr geliebtes Drachen-Kuscheltier vor dem Bauch.
»Es ist nun schon der vierte an Grausamkeit kaum zu überbietende Fall, in dem …«
Die sonore Stimme erstarb.Unddraußen vor der Tür knackte es, als hätte ein dicker Ast unter dem Gewicht eines schweren Männerstiefels nachgegeben.
Kapitel 3
Sarah drehte sich um. »Hey, ich wollte die Nachrichten zu Ende hören«, beschwerte sie sich bei Ralph, der das Küchenradio abgestellt hatte. Der Fall berührte sie sowohl als Mutter als auch als Strafrechtlerin.
»Diesen morbiden Blödsinn?«
Ralph Calau sprach mit der tiefen, unverwechselbar rauchigen Stimme, in die sie sich als Erstes verliebt hatte. Vor zehn Jahren, als Ralph in der Gemeinschaftspraxis als angestellter Psychiater seine ersten Patienten empfing. Heute war sein dunkles Haar längst nicht mehr so dicht – was seiner Attraktivität jedoch keinen Abbruch tat. Ebenso wenig wie die durch einen markanten Acht-Tage-Bart kaschierte Kiefer-Gaumen-Spalte. Unter der Lippenkerbe, die sich ypsilonförmig von der Oberlippe Richtung Nase zog, musste er als Kind mehr gelitten haben, als er heute zugab. Ruby hatte diese Fehlbildung von ihm geerbt, aber in sehr viel sanfterer Ausprägung. Während sie bei der Kleinen wie eine haarfeine Narbe aussah, hatte Ralph in jungen Jahren mehrfach operiert werden müssen. Heute bemerkte man die Kiefer-Gaumen-Spalte auch bei ihm kaum noch. Ralph rasierte sich manchmal sogar absichtlich die Oberlippe, wenn er besonders kompetent wirken wollte, etwa, wenn er vor Gericht als Sachverständiger in psychiatrischen Fragen hinzugezogen wurde und sich zur Schuldfähigkeit von Gewaltverbrechern äußern sollte. Womit der »Makel«, dessentwegen er in seiner Kindheit gemobbt worden war, ihm heute, im Alter von einundvierzig Jahren, zum Vorteil gereichte. Er verlieh seinem sonst gleichmäßigen Gesicht einen durchsetzungsstarken Ausdruck, den Sarahs beste Freundin »verwegen« nannte. Und nicht nur Marion Reiners fand Ralph attraktiv. Wann immer ihn Sarah in seiner Praxis besuchte, konnte sie es in den Augen der Empfangsmitarbeiterinnen lesen: »Weshalb hat der Doktor sich ausgerechnet die ausgesucht? Er könnte doch eine so viel Bessere bekommen!«
Wobei »besser« sich vermutlich als »schlanker«, »trainierter« und »püppchenhafter« definierte.
»Das sind keine Nachrichten«, entgegnete er jetzt auf ihre Bitte, das Radio wieder anzuschalten. »Das ist perverse Unterhaltung unter der Überschrift …«
»… Nacktes und Zerhacktes«, ergänzte Sarah einen seiner Lieblingssprüche, wenn es um die Sensationsgeilheit in den Medien ging. Für einen Psychiater, der als Gerichtsgutachter potenzielle Mörder, Vergewaltiger und Triebtäter untersuchen musste, war er erstaunlich dünnhäutig, was die True-Crime-Berichterstattung über diese »Patienten« anging. Als Strafrechtlerin wusste sie natürlich ebenso gut wie er, dass gerade die widerwärtigsten Täter meist hochkomplexe Vorgeschichten hatten, die sich nicht zu einer reißerischen Zwanzig-Wort-Meldung verdichten ließen. Ein Beleg dafür war ausgerechnet ein Fall, an dem sie beide beteiligt gewesen waren. Sie als Verteidigerin, er als Gutachter. Die Öffentlichkeit kannte von ihm nur die Schlagzeile:
Vater schüttelt Baby in den Tod – Freispruch!
Tatsächlich hatte Sarahs Mandant zugegeben, seinen zwei Monate alten Sohn aus dem Beistellbettchen genommen und zu Tode geschüttelt zu haben.
»Weil ich dachte, er atmet nicht mehr. Er war reglos und kalt, und ich bin in Panik geraten. Ich wollte ihn wiederbeleben, ihn retten. Deshalb habe ich mein Baby geschüttelt!«
Jemand, der nicht im Gerichtssaal dabei war, konnte das leicht als Lüge abtun. Doch wer wie sie den gebrochenen, für sein Leben gestraften Vater erlebt hatte, wusste, dass er die Wahrheit sagte und eine Strafe sinnlos war. Der Vater würde nie wieder glücklich werden.
Ein erneutes Knacken unterbrach Sarahs Gedankenstrom.
Sie sah zur Tür. Normalerweise schloss sie die erst vor dem Schlafengehen, und auch das nur widerwillig. Sie hasste abgeschlossene Räume. Jetzt bat sie Ralph, den Riegel vorzulegen.
»Was war das?«, fragte sie ihn.
Normale Waldgeräusche der Natur? Oder Schritte?
»Keine Angst«, sagte ihr Mann und lächelte sie an. Automatisch löste er damit den Impuls aus, sich an ihn zu kuscheln. Schon im nächsten Moment ärgerte sie sich über diesen »Armes Häschen braucht starke Schulter zum Anlehnen«-Reflex. Diese Emotion konnte sie gerade heute gar nicht gebrauchen.
Hatte sie sich doch fest vorgenommen, mit ihm Klartext zu reden.
Koste es, was es wolle.
»Der Typ an der Tanke hat dich nervös gemacht?«, fragte Ralph.
Der und der Streit, der uns bevorsteht.
Normalerweise hätte sie der feindliche Gesichtsausdruck eines Fremden nicht so lange beschäftigt, doch heute war sie besonders dünnhäutig. Denn heute wollte sie ihm sagen, was sie fühlte, was sie bedrückte. Und vor allem, dass die Ehe mit ihm so nicht mehr funktionierte. Ralphs ständige Abwesenheit, seitdem er zusätzlich zu seiner Privatpraxis als Leiter der Psychiatrie im Schlossparkklinikum arbeitete. Vor allem aber sein Jähzorn, seine Stimmungsschwankungen, die ebenfalls von seiner Überarbeitung herrühren mochten. Die Veränderung war mit Rubys Geburt eingetreten. Der Schlafentzug, die ausbleibende körperliche Nähe, die häufigen Kinderkrankheiten, all das hatte ihn wohl überfordert. Er war kaum noch zu Hause, und wenn doch, schien er nur körperlich anwesend. Geistig war er abwesend. Ausgenommen die Momente, in denen er sie wegen der geringsten Kleinigkeit anschrie. Auch das hätte sie noch eine Weile ertragen. Doch als er Ruby geohrfeigt hatte, weil sie am Esstisch ihren O-Saft auf seinen Anzug verschüttet hatte, war der Point of no Return erreicht.
Ihr Entschluss stand fest, sie brauchte eine Auszeit, auch wenn das bedeutete, dass sich damit ihre Monophobie wieder manifestierte. Prophylaktisch hatte sie bereits ihre Therapiestunden bei Marions Mutter Elke wieder aufgenommen und nahm erneut Cipralex gegen die Angst, alleine zu sein. Sie würde es schaffen.
Ich muss es ihm nur noch sagen …
»Hör mir bitte zu, Ralph!«
»Ja?«
Er sah sie fragend an, und da war es wieder. Dieses kaum merkliche Zucken des rechten Augenlids, das sie immer so sehr an ihm gemocht hatte. Vielleicht nicht das Zucken selbst, sondern eher das, was es symbolisierte: Ralphs Unsicherheit, die er nie vollständig abgelegt hatte, trotz seiner beeindruckenden Karriere.
»Schatz, glaube mir. Hier sind wir sicher«, beschwor er sie, nicht ahnend, dass es nicht die reißerischen Nachrichten waren, über die sie mit ihm reden wollte. Er sah zu Ruby.
»Der Kinderwagen-Killer ist weit von uns entfernt.«
Sie musste wider Willen lächeln. »Hör auf, mich zu provozieren.«
»Inwiefern?«, stellte er sich unwissend. Er wusste so gut wie sie, dass der Täter juristisch gesehen kein »Killer« war. Noch war keines der Babys gestorben.
»Strafrechtlich betrachtet verübt er schwere oder gefährliche Körperverletzungen«, erklärte sie ihm, wohl wissend, dass sie die unangenehme Aussprache bewusst hinauszögerte, indem sie einen kurzen Abstecher auf das für sie sichere Feld der Rechtswissenschaften machte. »Bekäme er die Ippen als Staatsanwältin, ginge die allerdings sicher auf versuchten Mord, immerhin bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Säure, die er über die schlafenden Babys in den Kinderwagen gegossen hat, zum Tode führen kann. Wobei natürlich strittig ist, ob Säuglinge überhaupt arglos ermordet werden können, da sie ja per definitionem hilflos sind. So oder so ist der Gesuchte kein ›Kinderwagen-Killer‹, wie ihn die Presse nennt. Allenfalls ein ›Kinderwagen-Attentäter‹, doch das hört sich wegen der fehlenden Alliteration im Boulevard-Journalismus natürlich nicht so gut an.«
Er musterte sie mit einer Mischung aus Neugier und Streitlust. »Ich wette, du würdest ihn als Mandanten annehmen.«
»Selbstverständlich.« Sarahs Antwort kam ohne Zögern.
»Auch wenn seine Schuld zweifelsfrei feststeht?«
Sie seufzte. »Hatten wir das Thema nicht zur Genüge?«
»Ich weiß«, antwortete er und hätte vom Tonfall her auch »Bla, bla, bla« sagen können. »Es geht darum, den Rechtsstaat zu schützen. Jeder ist unschuldig, solange er nicht verurteilt ist.«
Er zeigte auf ihre schlafende Tochter.
Irrte Sarah sich, oder suchte er bewusst den Streit mit ihr?
»Nun stell dir doch nur mal vor, der Kerl würde Ruby etwas antun! Sie entstellen. Gar töten. Und ich als Gutachter würde seine Zurechnungsfähigkeit einwandfrei feststellen. Würdest du mir dann auch mit der Unschuldsvermutung kommen, Sarah?«
Ihr Handy machte ein Geräusch, als hätte sich gerade eine Fahrstuhltür geöffnet. Das Erkennungszeichen einkehrender Eilmeldungen, für die sie einen Google-Alert eingestellt hatte. Wie jüngst für den »Kinderwagen-Killer«.
Er griff nach ihrer Hand, doch sie zog sie zurück, als sie draußen ein schabendes Geräusch hörte. Ein vom Wind bewegter Ast? Oder ein schlurfender Mensch?
Ralph hatte offenbar auch etwas gehört. »Soll ich nachsehen gehen?«, fragte er und stand auf, ohne Sarahs Antwort abzuwarten, die am liebsten gleichzeitig »Ja« und »Nein« gerufen hätte. Unschlüssig, was sie mehr fürchtete: allein mit Ruby zu bleiben oder weiter bei jedem Knacken mit dem Schlimmsten zu rechnen.
»Sei vorsichtig!«, rief sie Ralph noch hinterher und fröstelte, als mit dem Öffnen der Tür ein Schwall kühler Nachtluft hereindrang.
Kapitel 4
Nachdem die Dunkelheit Ralph verschluckt hatte, spürte sie die Angst wie ein Gewicht auf den Schultern. Sie wollte aufstehen, ihm durchs Fenster nachsehen, doch sie fühlte sich bleiern. Und die Schwere, die auf ihr lastete, nahm mit jeder Sekunde zu, die Ralph nicht zurückkehrte.
»Ralph?«
Als sie auch nach dem dritten Rufen keine Antwort bekam, wuchtete sie sich vom Stuhl hoch und ging zur Tür. Sie entschied sich dafür, den Querriegel wieder umzulegen, obwohl sie geschlossene Türen hasste und es ihr widerstrebte, ihren Mann auszusperren. Doch sie durfte Ruby keiner Gefahr aussetzen.
»Ralph? Ist alles okay?«, rief sie noch einmal durch die verschlossene Tür.
Ihr Handy pingte erneut.
Sie überlegte, ob sie ihren Platz an der Tür verlassen konnte, um ihr Telefon zu holen (immerhin wäre es ihr dann möglich, die 110 anzurufen), da hörte sie ihn schreien.
Aus einiger Entfernung, aber unverkennbar Ralph.
Aufgeregt und laut und …
Panisch?
Er hatte noch nie so außer sich geklungen. Die Stimme voller Furcht und Angst, die noch größer schien als die, die sie in der Sekunde empfand, als er mit voller Wucht von außen gegen die Tür prallte.
»AUFMACHEN!«, schrie ihr Mann, eindeutig Schmerzen leidend.
Großer Gott.
Mit schweißnassen Händen löste Sarah den Querriegel, und Ralph fiel mit der Tür regelrecht in die Hütte. Er stolperte, fing sich gerade noch, bevor er hinschlug. Als er sich mit angstgeweiteten Augen vor ihr aufrichtete, bemerkte Sarah seinen rechten Arm. Er baumelte ihm blutend von der Schulter herab wie ein Gummischlauch, aus dem jemand die Luft gelassen hatte.
»Schließ die Tür! Schließ die verdammte Tür!!!«, schrie er und riss sie aus ihrer Schockstarre. Sie gehorchte.
Draußen hörte sie jemanden brüllen.
Einen Mann. Wie im Wahn. Sie hatte keine Ahnung, wer sie bedrohte. Und weshalb?
»Was ist passiert?«, fragte sie. »Wer hat dir das angetan?«
Ralph atmete schwer. Offenbar unfähig zu einer klaren Antwort.
»REDE MIT MIR!!!«
In dieser Sekunde erzitterte die Tür.
»Kommt raus!«, brüllte ein Mann vor der Hütte. Er klang so, wie sie sich die Stimme eines Tollwütigen vorstellte.
Offenbar flogen Fäuste gegen das Türblatt. Drohten, es zu zersplittern.
»Wir müssen hier weg!« Ralph hatte seine Stimme wiedergefunden und blickte sich gehetzt um, als gäbe es in der Wochenendhütte einen Hinterausgang, der ihnen bislang entgangen war.
»Ich rufe die Polizei!«, entschied Sarah und ging zum Küchentisch. Hastig entsperrte sie das Display, auf dem sich automatisch der Artikel öffnete, der vor einer Minute noch mit einer Push-Meldung angekündigt worden war.
Sie las die Überschrift. Und begann vor Entsetzen zu zittern.
»Ich weiß jetzt, wer da draußen ist!«, flüsterte sie und sah angsterfüllt von ihrem Handy auf. Zu Ruby, die auf der Sitzbank am Küchentisch so fest schlief, dass selbst das Hämmern gegen die Tür sie nicht aufweckte.
»ZEUGE HAT KINDERWAGEN-KILLER GESEHEN. ES GIBT PHANTOMBILD«, lautete die Schlagzeile auf ihrem Handy.
»Das gibt es doch nicht! Das kann nicht sein …«, krächzte sie, obwohl sie den Mann auf der Zeichnung eindeutig erkannte. Wie es der Blonde von der Tankstelle getan haben musste, der sie daraufhin verfolgt und Ralph angegriffen hatte.
Ihr Puls wurde immer schneller, als wäre er ein Hundert-Meter-Sprinter, der auf den letzten Metern vor der Ziellinie noch einmal anzieht.
Unmöglich …
»Bleibst du dabei?«, keuchte Ralph und riss ihr das Handy aus der Hand.
Sarahs Mund öffnete sich zu einem lautlosen Schrei.
Ihr Mann sah zu Ruby und stellte die grausamste Frage, die ihr jemals gestellt wurde: »Würdest du mich verteidigen?«
Ralph öffnete mühsam mit einer Hand seine Reisetasche, die er für den Wochenendausflug gepackt hatte.
Und zog aus ihr eine Säureflasche hervor.
Kapitel 5
Mitkommen, Junge!«
Der Siebenjährige war glücklich, dass er den alten Kunstlederkoffer, den Papa trug, nicht selbst schleppen musste. Doch er hatte große Angst, seinem Vater zu folgen.
Aber was soll ich sonst machen?
Der Junge hatte in seinem kurzen Leben schon mehrfach aufs Grausamste erfahren müssen, was geschah, wenn man sich Papa widersetzte. Zuletzt, als Mama heimlich ins Krankenhaus hatte fahren wollen, um dort ihr Baby zu bekommen.
Amalia, seine kleine Schwester.
Mama hatte wohl gedacht, er würde es nicht hören, wenn sie die Tür des alten Pick-ups öffnete, den Papa immer direkt vor dem Bauernhaus parkte, in dem sie wohnten.
»Weit genug entfernt von den Pissern«, wie sein Vater alle Menschen nannte, die er nicht leiden konnte, und das war definitiv die Mehrheit auf diesem Planeten.
Der alte Bauernhof hatte in seiner Blütezeit schon fernab vom Schuss gestanden. Heute allerdings waren selbst die unmittelbaren Nachbargrundstücke unbewohnt, seit jeder, der nicht den Rest seines Lebens von staatlicher Stütze leben wollte, aus dieser trostlosen Gegend weggezogen war.
»Nur wir waren so doof, hierherzukommen«, hatte Mama einmal zu sich selbst gesagt, die Hand auf dem Bauch, als sie durch das Fenster über der Spüle zu den verwaisten Feldern sah. Sie hatte wohl geglaubt, sie wäre allein in der Küche und niemand hätte sie gehört; genauso wie sie gedacht hatte, Papa würde sie nicht beobachten, wie sie den Pick-up »stahl«.
Diebstahl!
So hatte er es tatsächlich genannt, als er Mama an den Haaren aus dem Auto zurück ins Haus gezogen hatte.
»Ins Krankenhaus? Nein, nein, nein. Du kriegst das Balg schön hier bei uns. Daheim. Du brauchst für eine Geburt doch keine Quacksalber«, hatte er Mama angeschrien. »Kalb ist Kalb. Das ist bei dir nicht anders als in den Ställen!«
»Wir haben letztes Jahr drei entbunden«, hatte Mama gewagt, ihm zu widersprechen. »Zwei davon sind gestorben, weil du den Tierarzt nicht holen wolltest!«
Papa hatte den Handkantenschlag so schnell ausgeführt, dass der Junge ihn gar nicht gesehen hatte. Nur das Ergebnis war unübersehbar. Mama bekam noch Tage danach nur unter Schmerzen Luft, so sehr war ihr Kehlkopf gequetscht.
»Wohin gehen wir?«, wagte er jetzt seinen Vater zu fragen.
»Heute ist der Tag gekommen, an dem du Verantwortung übernehmen musst, mein Junge. Weißt du, wie man das macht?«
Er schüttelte den Kopf.
»Indem man schwierige Entscheidungen trifft. Du bist jetzt fast acht. Du kannst dich nicht länger davor drücken!«
Simeon nickte und wäre um ein Haar ausgerutscht.
Mama hatte immer gesagt, der Weg zu den Ställen müsste gepflastert werden, aber dafür war kein Geld da.
Immerhin, jetzt, wo sie rechts abgebogen waren, musste er kein zweites Mal nach ihrem Ziel fragen. Es lag direkt vor ihnen. Die alte Scheune mit dem löchrigen Dach, die an Silvester vor zwei Jahren beinahe abgebrannt wäre.
Papa öffnete das unverschlossene, schief in den Angeln hängende Tor. Beim Eintreten empfing sie ein modriger Gestank aus verschimmeltem Heu und Rattenkot.
Der Junge begann zu zittern. Was um Himmels willen sollte er hier für eine Entscheidung treffen?
»Da wären wir!« Sein Vater spuckte auf den Boden.
Er hatte sich mit ihm einmal einen alten Western anschauen müssen, in dem der Revolverheld immer Kautabak gekaut hatte, den er vor jeder Schlägerei ausspuckte. Papa schien es zu gefallen, das nachzuahmen. Nur ohne Kautabak, aber mit der gleichen grimmigen Miene.
»Weißt du eigentlich, weshalb du getauft wurdest, mein Sohn?«
Er schüttelte den Kopf und zog instinktiv die Schultern nach oben, denn er erwartete Papas typischen »Wachrüttler«, einen Faustschlag gegen den Hinterkopf, den er immer von ihm bekam, wenn er bei den Hausaufgaben etwas nicht wusste.
»Weil du nicht frei von Sünde warst, als du auf die Welt gekommen bist. An dir hafteten die Verfehlungen deiner Eltern. Die Taufe wäscht diese Erbsünden fort, und du kannst dein Leben in Unschuld fortsetzen.« Er lächelte schief. »Glücklicherweise kommst du nach mir und hast nur wenig Taufwasser gebraucht.«
Papa spuckte wieder verächtlich aus. »Deine Mutter jedoch ist voll von Sünde, verstehst du?«
Etwas im Blick seines Vaters sagte ihm, dass er besser nicken sollte. Er stand kurz davor, zu heulen, weil seine Angst immer größer wurde. Und die Furcht vor Tränen verstärkte die Angst, denn er wusste, sollte er jetzt zu flennen beginnen, würde Papa wieder seinen Gürtel lösen und ihn bei jedem Schlag als Schwuchtel, Tunte oder Homo bezeichnen.
Doch sein Vater sah ihm zum Glück nicht ins Gesicht, denn er war jetzt mit dem Koffer beschäftigt und löste den Schnappverschluss. Mit den Worten »Kommen wir also zu der Entscheidung, die du treffen musst« schlug er den Deckel zurück.
Die Augen des Jungen weiteten sich.
Gestern Abend erst hatten Mamas Schreie im Schlafzimmer aufgehört. Heute sah er sie zum ersten Mal.
Amalia.
Ohne Decke, wund gescheuert von dem rauen Transport, doch sie schrie nicht. Sie hatte nicht einmal die Augen geöffnet in dem viel zu ballonartigen Gesicht, das noch größer wirkte durch den einen, viel zu kurzen Arm, mit dem seine Schwester in der Luft herumwedelte, als wollte sie ihm zuwinken. Oder wollte sie darauf aufmerksam machen, dass sie keinen zweiten hatte?
»Was ist mit ihr?«, fragte er seinen Vater entsetzt.
»Tja, so sieht es halt aus, wenn die Sünden der Mutter zu schwer waren!«
Der Junge trat mit offenem Mund einen Schritt näher an den Koffer heran. »Wie können wir Amalia helfen?«
Papa gab ihm einen »Wachrüttler«, der ihm endgültig die Tränen in die Augen trieb.
»Das hab ich dir doch gerade erklärt!«
Sein Vater zeigte auf einen tonnenförmigen Kunststofftank, in dem früher Diesel gelagert worden war und dem jetzt der Deckel fehlte. Er stand unter dem größten Loch in der Scheunendecke.
»Ich gehe jetzt für zehn Minuten ins Haus zurück und sehe bei Mutter nach dem Rechten. Wenn ich wiederkomme, ist es passiert.«
»Was?«, rief er Papa hinterher.
Was ist dann passiert?
»Du hast Taufe mit deiner Schwester gespielt. Um sie von ihren Erbsünden freizuwaschen. Nur leider ein paar Minuten zu lang, verstehst du mich?«
Sein Vater spuckte ein letztes Mal auf den Boden, bevor er das Scheunentor hinter sich zuzog und seinen Sohn mit dem jetzt wimmernden, völlig zerkratzt und unterkühlt wirkenden Baby zurückließ, dem der Junge nie und nimmer etwas zuleide tun wollte, auch wenn es ein so unnatürlich großes Gesicht und nur einen Arm hatte.
Er trat einen Schritt an den Tank heran und sah, dass er voll mit Regenwasser war.
Aber was soll ich sonst machen?, dachte der Siebenjährige und weinte verzweifelt.
Schließlich hatte er in seinem kurzen Leben schon mehrfach aufs Grausamste erfahren müssen, was geschah, wenn man sich Papa widersetzte.
Kapitel 6
Sie wusste, wenn sie die Tür öffnete, würde es nach Tod riechen. Nach Fäulnis und Leiche. Schimmelstaubig und ranzig süß. Die Hölle für einen gesunden Menschen. Das Paradies für Fliegen und Maden, die sich schmatzend durch verwesendes Fleisch wühlten.
Verdammt, wie hatte sie nur so achtlos sein können?
Auf der anderen Seite …
Wer konnte schon damit rechnen, dass es Mitte Oktober noch einmal so heiß werden würde? Von zwölf auf neunundzwanzig Grad – im Schatten!
Zum Glück waren Türen und Fenster gut isoliert. Der Todesgestank dürfte niemandem aufgefallen sein.
Hoffentlich.
»Hey, du!«
Der Schreck schoss ihr durch die Glieder. Kurz, schmerzhaft und mit anhaltender Wirkung.
Sie kniete vor dem Schaufenster ihres Ladens, um das Schloss der Außenrollos zu öffnen, und hatte nicht gehört, dass sich jemand von hinten genähert hatte.
»So früh schon am Arbeiten, Frau Wolff?«
Eine dunkle Wolke schob sich vor die Herbstsonne, als sie zu ihrer besten Freundin aufsah, die es aus irgendeinem Grund lustig fand, sie mit ihrem Geburtsnamen anzusprechen, den sie nach der Blitzscheidung von Ralph vor elf Jahren wieder angenommen hatte. Sarah spürte, wie sich die Säurenarbe in der Handinnenfläche schmerzhaft zusammenzog, wie so oft, wenn ein Wetterumschwung bevorstand. Oder sie Angst hatte.
»Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken«, sagte Marion und streckte ihr die Hand hin, als wäre Sarah zu alt, um ohne fremde Hilfe aus der Kniebeuge hochzukommen. Unwillkürlich fasste sie sich beschämt an die viel zu großen goldenen Ohrreifen, die vielleicht in den Neunzigern mal Mode gewesen waren. Ihre Freundin trug einen dezenten Diamantstecker, Sarah billigen Modeschmuck, und sie ärgerte sich über ihre eigene Oberflächlichkeit, dass ihr das nicht gleichgültig war.
»Steht dir gut«, sagte Marion und meinte es gewiss auch so. So gegensätzlich sie sich in ihrem Äußeren waren, so sehr ähnelten sie einander charakterlich.
Marion war zierlich und ging Sarah gerade einmal bis zur Schulter. Deren T-Shirts hätte sie problemlos als Nachthemd tragen können. Während Sarah jeden Morgen eine Viertelstunde damit zu tun hatte, ihre dunkle Lockenmähne zu bändigen, musste sich ihre Freundin allenfalls einmal durch die kurze, platinblonde Ponyfrisur fahren, um perfekt gestylt auszusehen. Nur in ihren geschwungenen Wangenknochen ähnelten sie einander sowie in ihren festen Überzeugungen, dass Freundinnen einander immer die Wahrheit sagten, sich gegenseitig niemals einen Jungen ausspannten, bei Geld die Freundschaft begann und nicht aufhörte und das Leben einfach zu kurz war, um nicht alles einmal auszuprobieren, vorausgesetzt, es brachte einen nicht um oder ins Gefängnis.
Mit dieser Einstellung hatten sie etwas geschafft, das nur wenigen gelang, nämlich, sich ihre Kindergartenfreundschaft über all die Jahre hinweg zu bewahren – und das trotz der räumlichen Distanz. Schon als Kinder hatten sie nicht nah beieinander gewohnt. Marion hier in Spandau, Sarah in Charlottenburg. Sie waren nur durch Zufall im selben Kindergarten gewesen, weil der für die Eltern günstig auf dem Weg zur Arbeit lag. Die Schulen, die sie gemeinsam bis zur achten Klasse besucht hatten, hatten geografisch etwa in der Mitte gelegen, jeweils knapp eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Zehn Jahre nach dem Tod von Sarahs Bruder Leon war die Familie Wolff nach Frankfurt gezogen. Da war Sarah vierzehn, und ihre Freundschaft entwickelte sich zu einer funktionierenden Fernbeziehung. Nahezu in allen Oster- und Sommerferien hatte Sarah Marion hier in Spandau besucht. Und jetzt waren sie erstmals Nachbarn. Es gab wohl niemanden, der sich mehr darüber gefreut hatte als Marion, dass Sarah vor sechs Wochen nach Berlin zurückgezogen war. Oder, besser gesagt, geflüchtet.
»Ruby hat darauf bestanden, dass ich ihren Modeschmuck trage«, sagte sie und fasste sich an ihre Ohrringe. Eine Rechtfertigung, wenn auch die Wahrheit.
»Ich meinte eigentlich deine Selbstständigkeit«, erwiderte Marion und zeigte ins Ladenlokal hinein, dessen Schaufenster Sarah gerade aufgeschlossen hatte.
»Du hast zwar noch immer deinen ›Frisch aus dem Schlaf geweint‹-Gesichtsausdruck wie am Umzugstag«, stellte sie ungeniert fest. »Aber die Augenringe sind nicht mehr ganz so dunkel. Und du hast endlich deinen liebenswert melancholischen Blick zurück!«
Mit dem ich mein Leben lang die falschen Männer angezogen habe, dachte Sarah und versuchte, Marions Lächeln zu erwidern, das erkennen ließ, dass ihr letztes Zahnbleaching nicht lange zurückliegen konnte. Die monatlichen Kosten für Pedi- und Maniküre, Friseur und Strom-Sport mussten höher als Sarahs Miete sein. Von der cremefarbenen Handtasche, die perfekt auf ihr Cashmerekostüm abgestimmt war, ganz zu schweigen.
All das konnte Marion sich locker leisten.
Sie arbeitete als Psychologin mit derselben Spezialisierung wie ihre Mutter – Angststörungen und Panikattacken. Sarah hingegen hatte all ihre Karriereambitionen aufgegeben und war nach der Tragödie mit Ralph von der beruflichen Überholspur in die Sackgasse der Nebenjobs eingebogen. Zuerst als Telefonistin im Callcenter einer Versicherung, dann als Kurierfahrerin. Eine sehr lange Zeit hatte sie gekellnert, bis sie sich jetzt, gut zwölf Jahre nach dem schlimmsten Tag ihres Lebens, hinter dem Tresen eines Kiosks versteckte. Ein gerade mal dreißig Quadratmeter großes Geschäft, das ihr Vater »Tante-Emma-Laden« nannte. In hipperen Bezirken der Berliner City würde es wohl als Späti durchgehen, immerhin hatte es ein begehbares Ladenlokal. Der Kiosk war schön gelegen an einem kleinen, belebten Platz vor der evangelischen Dorfkirche, der von der Straße Alt-Kladow umkreist wurde. Grün, ruhig und dennoch zentral, wenn man letzteren Begriff für diese Gegend überhaupt benutzen durfte.
»Wolltest du nicht den ganzen Monat über im Sudan sein?«, fragte Sarah. Marion arbeitete ehrenamtlich für Ärzte ohne Grenzen und leistete in dem vom Krieg zerstörten Land psychologische Nothilfe für traumatisierte Flüchtlinge.
»Ich musste nach Berlin zurück. Ein Notfall.« Ihre Augen verdunkelten sich. »Mama geht es gar nicht gut.«
»Elke?«, wunderte sich Sarah. Sie hatte sie erst vor zwei Wochen gesehen, wenn auch nur bei ihrer Online-Therapiesitzung. Da hatte die Zweiundsiebzigjährige wie immer gewirkt, eine unverwüstliche Urgewalt, der man ihr Alter nicht ansah. Dr. Elke Reiners war nicht nur die Mutter ihrer besten Freundin, sondern auch ihre Therapeutin seit der Teenagerzeit, als Sarah mit den Schuldvorwürfen, die sie sich wegen Leons Tod machte, nicht mehr allein klarkam. Die Psychologin hatte ihr auch später sehr geholfen, nach dem Trauma mit Ralph, mit zum Teil höchst unkonventionellen Therapieansätzen.
»Was um Himmels willen hat sie denn?«, fragte Sarah.
»Schlaganfall. Aus heiterem Himmel. Sie liegt seit einer Woche im Klinikum Havelhöhe und ist halbseitig geläh…« Marions Stimme stockte. Eine Träne zeigte sich im rechten Augenwinkel.
»Großer Gott, das tut mir leid«, sagte Sarah und hätte beinahe auch angefangen zu weinen.
Marion nickte und wischte sich gezwungen lächelnd die Träne weg. »Mir tut es auch leid, dass ich mich nicht früher bei dir gemeldet habe. Aber die Nachricht kam wie ein Schock. Und ich wollte dir und Ruby die Herbstferien an der Ostsee nicht versauen. Du hättest ohnehin nichts tun können.« Sie lächelte tapfer. »Oder gibt’s bei dir neuerdings auch Blumen? Die wollte ich Mama nämlich gerade für meinen nächsten Klinikbesuch kaufen.«
Sarah schüttelte den Kopf. »Ich fürchte eher, ich habe seit Neuestem den Tod im Angebot.«
Marion sah sie schräg an. »Wie um Himmels willen meinst du das?«
Sarah schloss die Ladentür auf und öffnete sie. »Ich an deiner Stelle würde lieber draußen bleiben.«
Kapitel 7
W