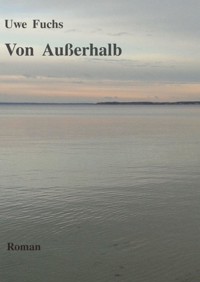Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Spaziergang am Elbstrand im Oktober. Aber Sven Bohland kann sich an der herbstlichen Schönheit der Natur nicht erfreuen. Seine bislang steil verlaufene Karriere hat im Zuge der Finanzkrise ein jähes Ende gefunden. Dem Jobverlust folgten Burnout und Vereinsamung. Warum ist alles so gekommen? Und wie soll es weitergehen? Unversehens wird der Ausflug zu einer Reise in die Vergangenheit, einer intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der nächste Winter
Ebook
Ein Ausflug
„Du suchst Ruhe?“, hat mich Tim gefragt, ein Arbeitskollege. „Fahr raus nach Wedel, mach einen Spaziergang an der Elbe. Abends sind da außer dir nur noch Schafe.“
Als ich die Haustür öffne, bin ich wie geblendet. Greller Sonnenschein, wolkenloser Himmel, dazu eine fast unwirkliche Wärme. Ich will schon wieder kehrtmachen, in den kühlen, schützenden Hausflur zurückgehen, aber im letzten Moment nehme ich mich zusammen. Verdrossen mache ich mich auf den Weg.
Ich habe extra den Ausgang zur Wasserseite genommen, in der Hoffnung, dass hier nur wenig los sein wird. Irrtum! Etliche Leute sind unterwegs, bedecken die Kaimauern, ergießen sich über die hölzernen Pontons, verstopfen die Fußgängerbrücken. Der Sandtorhafen, an den Wochenenden sonst ein beschauliches Plätzchen, gleicht heute einem Bienenstock.
Dabei ist es hier schon unter der Woche recht ungemütlich, wegen des permanenten Baulärms. Gerade werden überall stählerne Duckdalben in den Boden des Hafenbeckens gerammt, um daran später alte, ausgediente Schiffe zu vertäuen – als Attraktion für Touristen. Am Fuß der Magellan-Terrassen hat eine erste, schicke Café-Bar eröffnet. Zahlreiche Leute sitzen auf der Terrasse in der Sonne. Sicher überwiegend Spaziergänger, aber möglicherweise sind auch Anwohner unter ihnen. Meine Nachbarn... bei dem Gedanken muss ich grinsen. Gleichzeitig macht sich ein Gefühl von Bitterkeit in mir breit.
Jenseits des Kleinen Grasbrooks ist alles noch Baustelle. Die Rohbauten ragen wie bleiche Skelette in den Himmel und lassen die Straße zu einer Schlucht werden. Ob die Häuser jemals fertig werden? Das scheint angesichts der sich rapide verschlechternden Wirtschaftslage fraglicher denn je.
Ich haste durch die Speicherstadt, ohne Blick für die pittoresken, backsteinernen Lagerhäuser zu beiden Seiten. Das Gebäude des „Spiegel“ lasse ich rechts liegen. Je weiter ich mich der Innenstadt nähere, desto mehr verdichtet sich das Menschengewühl. Schließlich sind es wahre Massen, die sich über die Straßen und Plätze schieben.
Wie kann es mitten im Oktober so warm sein? Aber die Herrlichkeit wird nicht lange währen: Bereits für heute abend hat der Wetterbericht Regen, Sturm und deutliche Abkühlung vorhergesagt. Der Winter naht, auch wenn man es angesichts des sonnendurchfluteten Straßenbildes gar nicht glauben mag.
„Und nimm besser nicht den Wagen“, hat Konrad mir geraten, ein anderer Arbeitskollege, „da stehst du bloß im Stau. Fahr lieber mit der S-Bahn.“
Jetzt nähere ich mich der Alster. An der Bahnstation werde ich Teil des Menschenstroms, der auf der Rolltreppe in die Tiefe gleitet. Die Sonne verschwindet, kaltes Neonlicht tritt an ihre Stelle.
Am Fuß der Treppe beginnt ein Labyrinth aus Tunneln und Treppen. Als ich halt mache und versuche, das Schilder-Wirrwarr zu verstehen, werde ich von Passanten angerempelt, zur Seite geschubst. Der Geräuschteppich zerrt an den Nerven. Ich bin kurz davor, endgültig die Geduld zu verlieren und umzukehren, als ich die rettende Aufschrift entdecke: „S1/S3“. Neue Hoffnung schöpfend arbeite ich mich weiter voran und finde schließlich den Bahnsteig.
Nun stehe ich zwischen den Wartenden: Shopper mit prall gefüllten Einkaufstüten, Gruppen von gackernden Teenies, eine Meute lärmender Touristen. Viele Leute klackern auf ihren Handys herum oder starren den Werbe-Bildschirm jenseits des Gleises an. Überall laufen Tauben pickend umher.
Wann habe ich zuletzt öffentliche Verkehrsmittel benutzt? In Hamburg jedenfalls noch nicht, obwohl ich hier nun schon vier Jahre lebe. Normalerweise nehme ich das Auto, egal ob ich ins Büro fahre oder zu einem Kunden will. Zum Flughafen rufe ich mir ein Taxi. Über die Jahre ist meine Abneigung, mich in Bussen und Bahnen unters Volk zu mischen, immer größer geworden. Außerdem kann ich mich im Taxi oder im eigenen Wagen besser auf die anstehenden Termine konzentrieren.
Endlich kommt die Bahn. Als ich sehe, wie die Leute ins Innere des Zuges drängeln, zögere ich wieder. Dann steige ich ebenfalls ein.
***
Die Luft im Zug ist zum Schneiden dick, obwohl alle Fensterklappen offen stehen. Ich sitze eingequetscht zwischen Menschen und Einkaufstüten. Von irgendwoher ertönt meckernder Sprechgesang, unterlegt von rhythmischem Zischen und Klappern. Ich versuche die Lärmquelle ausfindig zu machen, was sich als schwierig herausstellt: Kaum ein Ohrenpaar, aus dem nicht Kabel heraushängen. Besonders junge Leute stopfen sich, kaum dass sie den Zug betreten, fast automatisch die Stecker in die Gehörgänge. Offenbar die Standardausrüstung zum Bahnfahren...
Tim. Konrad. Noch immer denke ich an die beiden als meine Arbeitskollegen. Dabei wird es Zeit, dass ich mich an die neue Situation gewöhne: Sie sind meine ehemaligen Arbeitskollegen! Es ist vorbei. Ich bin raus.
Warum musste die Kündigung gerade jetzt kommen? Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich finanziell etwas gewagt, mich verschuldet. Eigentumswohnung, noch dazu eine so teure. Hätte es nicht etwas bescheidener ausfallen können? Ein schlichterer Stadtteil, in dem die Preise nicht so exorbitant hoch sind? Nein, es musste die Hafencity sein. Wenn schon, denn schon, habe ich mir gesagt. Aber ein gutes Gefühl hatte ich bei der Sache von Anfang an nicht.
Kaum hatte ich mein Vorhaben in die Tat umgesetzt, passierte es prompt: Die Turbulenzen an den Finanzmärkten erwischten unser Unternehmen. Krise – bislang hatte niemand im Kollegenkreis ernsthaft einen Gedanken an diese Möglichkeit verschwendet. Jahrelang immer nur Wachstum, Expansion, steigende Gewinne. Auch nach dem Crash sah es eine ganze Weile so aus, als würde der Kelch an uns vorübergehen. Aber dem war nicht so. Plötzlich hieß es: Die Kunden bezahlen ihre Rechnungen nicht mehr, stornieren die Aufträge reihenweise. Offenbar ging es nun auch bei uns bergab. Alle ahnten, dass bald Köpfe rollten würden.
Es war mein Telefon, das als erstes klingelte. Als ich die Nummer des Chefs auf dem Display las, konnte ich mir denken, was die Stunde geschlagen hatte. Ich ging in sein Büro wie zu einer Hinrichtung. Als erstes schloss er hinter mir die Tür, die sonst grundsätzlich offen stand. Dann kam er ohne Umschweife zur Sache: „Herr Bohland, wir können Sie nicht länger beschäftigen.“
Ich hätte gedacht, dass man bei einer solchen Nachricht von Emotionen schier überwältigt würde. Heillose Verzweiflung spürte, grenzenlose Wut oder etwas in der Art. Aber in mir war nur Leere.
Der Chef schaute mich mit einer maskenhaften, Betroffenheit simulierenden Miene an und wartete. Als offensichtlich war, dass es mir die Sprache verschlagen hatte, nahm er den Faden wieder auf. Er murmelte Plattitüden von Krise, der Notwendigkeit zu schrumpfen, einer auch für ihn unangenehmen Situation und dergleichen. Ich hörte kaum hin.
Erst als er seinen Vortrag mit den Worten „Sie sind ab sofort freigestellt“ schloss, erwachte ich aus meiner Erstarrung. Freigestellt. Das hieß ja wohl, dass ich gehen konnte. Feierabend. Für immer.
„Ihr Gehalt läuft selbstverständlich bis zum Vertragsende weiter.“ fügte er noch hinzu, aber da war ich schon wieder in Gedanken.
Der Gang zurück in mein Büro geriet zu einem Spießrutenlauf. Aus sämtlichen Türen wurden mir mitleidige Blicke zugeworfen. Jeder konnte sich denken, welche Art von Gespräch ich mit dem Chef geführt hatte.
Als ich nach Hause kam, so ungewohnt früh am Tag, machte es endlich „klick“. Ich betrachtete die unausgepackten Umzugskartons, die überall herumstanden, und fing plötzlich an zu zittern. Irgendetwas drückte mir die Luft ab, mir wurde schwindelig, ich bekam Schweißausbrüche. Nachts wurde es so schlimm, dass ich mir nicht mehr anders zu helfen wusste, als den Notarzt zu rufen. Der gab mir eine Beruhigungsspritze und riet mir, einen Psychologen zu konsultieren.
Das war vor vier Wochen. Mittlerweile geht es mir wieder besser. Aber noch immer fällt es mir schwer zu begreifen, was eigentlich passiert ist.
***
Der Zug hält an den Landungsbrücken. Angeblich ein beliebtes touristisches Ziel, aber es steigen nur ärmliche, abgerissene Gestalten ein. Einer der Typen stellt sich neben zwei Kinderkarren und öffnet eine Dose Bier. Die beiden dunkelhäutigen Kinder in den Karren schauen ihn aus großen Augen an. Ihre Mütter blicken betreten zur Seite. Anscheinend erleben sie eine solche Situation nicht zum ersten Mal. Es ist grotesk und abstoßend. Ich möchte aussteigen.
Dann wird mir mit Grausen klar, dass solche Situationen von nun an zu meinem Leben gehören werden. Ich kann ihnen nicht mehr ausweichen. Mein Auto, für das ich vor kurzem noch viel Geld bezahlt habe, ohne dass es mir sonderlich weh tat, werde ich wohl wieder verkaufen müssen. Der Wohnungskauf hat mein Konto komplett leer geräumt. Und nun arbeitslos. Ich bin so blank, dass nicht mal mehr ein alter, klappriger Gebrauchtwagen drin ist.
Ein lauter Rülpser. Die Gestalt mit ihrem Dosenbier wankt im Rhythmus des fahrenden Zuges hin und her. Welche Umstände mögen einen Menschen derart verwahrlosen lassen? Was muss passieren, damit man sich dreckstarrend zwischen die Leute stellt und billiges Bier säuft? Hat ein Schicksalsschlag den Kerl aus der Bahn geworfen?
Der Gedanke treibt mir den Schweiß aus den Poren. Da ist es wieder, das Gefühl der Beklemmung. Genau wie vor vier Wochen, als mir gekündigt wurde und ich vorzeitig nach Hause kam, niedergestreckt, gedemütigt.
***
Dabei bin ich längst nicht mehr der Einzige, den es erwischt hat. Mittlerweile verlieren die Leute reihenweise ihre Arbeit. Auch in meiner Branche, der Softwareentwicklung, hat der Jobabbau voll eingesetzt. Ich bin nur einer von vielen.
Aber warum musste ich der Erste sein? Warum haben sie nicht jemand anderen herausgepickt? Zum Beispiel Tim: Um Punkt 17 Uhr knipst er den Rechner aus und sucht das Weite, mögen die Termine und Deadlines noch so sehr drängen. Er macht nur, was man ihm sagt. Anregungen und Ideen für die Projekte kommen von ihm nie.
Oder Konrad: Ständig inszeniert er sich als den großen Unabkömmlichen, tut so, als liefe ohne seinen genialen Input gar nichts. Die eigentliche Arbeit aber überlässt er stets den Kollegen im Team.
Nein, die Wahl fiel auf mich, Sven Bohland. Und das, obwohl ich mich so reingehängt, oft bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet habe.
Vor allem beim letzten Projekt. Mein Baby! Ein Strategie-Tool zur Optimierung von Kundenansprachen im Finanzdienstleistungssektor. Das System konnte sowohl in Service-entern als auch im Außendienst auf Notebooks und auf Mobiltelefonen eingesetzt werden. In der Branche gab es noch kein vergleichbares Produkt. Ich sah uns schon zum Marktführer aufsteigen.
Aber der Finanzcrash hat alle meine Träume begraben. Plötzlich war Schluss. Nun gibt es kein fertiges Produkt, und einen Job habe ich auch nicht mehr. Ich stehe mit leeren Händen da.
Wie ein Spieler, der alles auf eine Zahl gesetzt hat. Leider ist es die falsche gewesen, und jetzt ist der gesamte Einsatz futsch, verloren, perdü.
***
Vor den Fenstern Schwärze. Der Zug arbeitet sich unter lautem Rattern und Quietschen durch den Tunnel. Nun verlangsamt er sein Tempo, stoppt schließlich ganz. Keine Station ist in Sicht. Wir sind einfach stehen geblieben, im Nichts.
Man hört Räuspern, Husten, ungeduldiges Seufzen. Dazwischen der nervtötende Geräuschteppich aus den diversen Ohrstöpseln. Die Kinder in ihren Karren werden unruhig. Der Trinker hat seine Dose geleert und blickt ins Nirwana. Dann knistert es in den Lautsprechern und eine Stimme ist zu vernehmen: „Liebe Fahrgäste, vor uns ist auf der Strecke ein Zug der Linie S3 liegengeblieben und muss abgeschleppt werden. Die Weiterfahrt wird sich leider um einige Minuten verzögern.“ Knack – Durchsage beendet.
Allgemeines Aufstöhnen, einige schimpfen. Aber schnell hat sich der Tumult wieder gelegt. Die Leute ergeben sich in ihr Schicksal, starren und brüten stumpf vor sich hin. Was bleibt ihnen anderes übrig? Einige Minuten kann viel heißen. Abschleppen – das ist ja wie beim Autofahren.
Jetzt fängt das erste der beiden Kinder an zu wimmern. Die Mutter versucht es zu trösten. Ohne Erfolg: Das Weinen schwillt an, wird zu gellendem Kreischen. Meine Sitznachbarn versuchen es mit Fassung zu tragen. Aus verschiedenen Ecken hört man die Kopfhörermusik lauter werden.
Ein Fahrrad kracht mit lautem Scheppern um. Die ganze Zeit ist es stehen geblieben, trotz des Gerüttels während der Fahrt, aber nun, da der Zug sich nicht mehr rührt, fällt es einfach lang hin. Eine Tüte Äpfel kippt dabei aus, die Früchte rollen über den Boden. Kurz darauf sieht man eine junge Frau zwischen den Beinen der Leute herumsteigen und, Entschuldigungen murmelnd, das Obst wieder einsammeln.
***
Ein Spieler, der sich nicht mehr losreißen kann, der durchdreht und alles auf eine Zahl setzt... welche Ironie, dass ausgerechnet mich dieses Schicksal ereilt. Mich, den kühlen Analytiker, den Perfektionisten. „Kontrollfreak“ werde ich gern genannt. Nicht ohne Grund: Herr der Situation zu bleiben ist für mich eigentlich essentiell, lebensnotwendig.
Und jetzt? Wie soll ich die Hypothek für die Wohnung abbezahlen? Von meinem Arbeitslosengeld bestimmt nicht. Und durch die Finanzkrise purzeln die Immobilienpreise gerade ins Bodenlose. Wenn ich jetzt verkaufe, mache ich einen Riesenverlust, den ich im Leben nicht wieder hereinhole.
Verdammt, ich muss doch nur einen neuen Job finden, um aus dem Tief zu kommen!
Aber gerade das erscheint mir auf einmal vollkommen unmöglich.
Ich denke an letzte Woche. Endlich hatte ich mich etwas gefangen. Ich recherchierte im Netz über moderne Strategien zur Stellensuche, brachte meine digitale Bewerbungsmappe auf Vordermann, begann auf Anzeigen zu antworten. Vorgestern hatte ich ein Telefoninterview mit einem Unternehmen in Berlin, nächste Woche fahre ich nach Frankfurt und stelle mich dort vor.
Die Resonanz ist also gut. Trotzdem liegen die Dinge anders als früher.
Bislang habe ich Bewerbungsgespräche immer als Herausforderung gesehen. Kann ich die andere Seite überzeugen? Halte ich dem Druck stand, wenn ich „gegrillt“ werde? Aber plötzlich nervt mich alles, was irgendwie nach Business riecht: die gelackten Managertypen, die protzigen Büros in den Innenstädten, das ganze Karriere-Sprech, in dem es von Floskeln wie „Herausforderung“, „persönlicher Marktwert“ und „gut aufgestellt sein“ nur so wimmelt.
Schlimmer noch: Ich habe Angst. Angst, im nächsten Job in eine ähnliche Situation zu geraten wie beim letzten Mal. Angst, mich wieder zu übernehmen, den Überblick zu verlieren und am Ende zu scheitern. Sind die Anforderungen in diesem Beruf vielleicht zu hoch für mich? Bringe ich es nicht? Bin ich am Ende doch bloß Mittelmaß, wie Tim und Konrad?
Auf einmal wird mir bewusst, wie allein ich bin. Ich habe mich nie um Kontakte zu anderen Menschen gekümmert, nie einen Freundeskreis aufgebaut, mich immer nur auf mich selbst verlassen. Wo ich hinkam, blieb ich Einzelgänger. Für mich gab es nur die Arbeit, alles andere zählte nicht, hielt bloß auf. Ich war mir stets meiner eigenen Kraft und Energie sicher, das genügte. Nicht mal die Stadt, in der ich gerade lebte, interessierte mich. Auch in Hamburg kenne ich bis auf meine Wohnung, das Büro, die Niederlassungen unserer Kunden und den Flughafen nichts.
Von der geplanten Hafencity las ich in der Zeitung. Ich fand das Vorhaben interessant, wagemutig. Im Internet konnte man in aufwändigen 3D-Animationen die geplanten Loft-Wohnungen bestaunen und virtuell durchwandern.