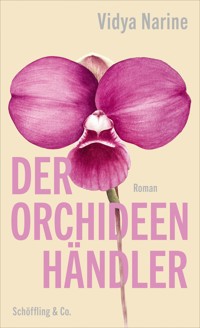
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An jedem Tag im Jahr pflegt Sylvain seine paradiesvogelartigen Blumen. Ihre Gattung ist älter als die der Dinosaurier, anspruchsvoller als die Kundschaft seines Ladens nahe der Comédie Française: Schauspieler, Politiker, Unternehmer, die oberen Zehntausend von Paris, die ihre Wohnungen nicht mit dem Schönsten dekorieren, sondern mit dem, was am teuersten ist. Über Orchideen weiß Sylvain alles. Er kennt die wendungsreiche Geschichte ihrer Entdeckung, Kultivierung und Massenproduktion, die auch vom kolonialen Erbe Frankreichs erzählt. Er weiß, bei welcher Temperatur und Feuchtigkeit sie gedeihen, welche Sorte Kokoserde und welche Rindenmulch liebt. Mit der Orchidee hat Sylvain sich neue Wurzeln gegeben, denn die zu seiner eigenen adeligen Familiendynastie sind gekappt. Doch seine Erschöpfung wächst. Ist er zu lange vor der Vergangenheit geflohen? Und wie soll er, der selbst nicht erben wollte, sein Geschäft weitergeben? Denn für Sylvain steht fest: Wenn es den Laden nicht mehr gibt, verschwindet er selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vidya Narine
Der Orchideenhändler
Roman
Aus dem Französischen von Merle Struve
Schöffling & Co.
Für S.
Für meine Sonnen.
»›Ich‹ ist ein permakultureller Wald-Garten und kein makelloser französischer Garten, wie es die klassischen Morallehren wollten, kein englischer Garten, wie die Romantik es sich vorstellte, und auch keine Parzelle ertragreicher Monokultur, wie es die neoliberale Moral verlangt.«
Baptiste Morizot, Arten des Lebendigseins
»Ich glaube, wir erben als Kinder die Territorien, die wir dann unser Leben lang erobern müssen.«
Nastassja Martin, An das Wilde glauben
WURZEL
ADELSNAME
In der Familie meines Vaters sind alle Männer Ingenieure, Ärzte, hohe Offiziere, Geschäftsleute, Politiker. Nur er nicht. Als ich Kind war, schloss sich eines Tages das Einfahrtstor des Familienanwesens vor uns. Dahinter sah ich meine Großeltern, Onkel und Tanten entschwinden, den französischen Garten und die Berge von Weihnachtsgeschenken; unsere eigene kleine Nation, die wie ein Baum war, in der jeder Bürger einen Zweig bewohnte.
Auf unserem Wappen sind drei Bienen. Das Insekt hatte Napoleon als Symbol für den Adel gewählt, weil es Hindernisse überwindet und Reichtum aus fremden Blumen schafft, außerdem wollte er der Lilie etwas entgegensetzen. Ich liebte es, mit dem Finger über das Bienenrelief auf dem Siegelring meines Vaters zu fahren, und presste meinen Daumen so lange darauf, bis die goldenen Beinchen und Flügel auf der Kuppe einen Abdruck hinterließen. Ich weiß nicht, was mit dem Siegelring passiert ist. Auf dem Wappen ist auch ein Halbmond, die Spitzen zeigen nach oben, er steht für die Anhäufung von Vermögen. Ich bin auf der Seite der Blumen gelandet.
Mein Vater war Möbelpacker, Lastwagenfahrer, Gabelstaplerfahrer, Arbeitsloser. Er ging durchs Leben ohne weiteren Plan; nur den Erwartungen wollte er nicht entsprechen. Manchmal packte er meinen Kinderarm, in seinen Augen glomm ein fahles Feuer, und flüsterte mir ins Ohr: »Leben heißt, ein Chamäleon zu sein.« Doch sosehr ich mich auch anstrengte, wenn ich an das kleine Reptil dachte, sah ich bloß das komische Schielen vor mir und die rosa Zunge, an der eine Fliege klebte. Vorsichtig löste ich mich aus seinem Griff und fuhr mit meinem roten Auto weiter das Teppichmuster ab, während er in die Tiefen des Sofas zurücksank.
Applaus in einer Spielshow, Geschirrklappern in der Küche. Vor dem Fenster der Nieselregen über den Anhöhen Lothringens und, zwischen den Wipfeln der Eichen auf dem Hügel, die Renaissancetürmchen vom Schloss meines Großvaters.
Der Körper eines Chamäleons ist mit Schuppen bedeckt, sogar die Augenlider und Augäpfel, die hervorstehen und so das Sichtfeld vergrößern. Außen an den beiden Augäpfeln bewegen sich die Linsen unabhängig voneinander, um die zweifache Menge an Bildern einzufangen – das Gehirn muss sie nicht zusammenfügen. An meinem dreizehnten Geburtstag starb mein Vater.
In der Schule hatte ich keinen Ehrgeiz; ich wollte nichts, außer Zement in mich hineinlaufen zu lassen, um aus Wut zu Stein zu werden. Man warf mich raus. Ich legte den Kopf in den Schoß meiner Mutter, schmiegte mich um sie, wollte die Zeit bis zur Dunkelheit des Universums zurückdrehen und mit geschlossenen Augen im Duft ihrer Hände leben. Sie saß auf der Bettkante, strich mir übers Haar und fragte: »Was möchtest du jetzt machen?«, dann eilte sie zum Fenster, um ihre Tränen in den Hügeln zu versenken. Nichts. Ich wollte nichts, da mein Vater nicht mehr wollte.
Manchmal dämmerten zwischen meinen Wimpern, die benetzt waren wie Spinnweben im Unterholz, neue Wege auf. Man sagte mir: »Such dir einen Beruf aus«, nannte mir zwei Gartenbauschulen in der Nähe. »Das wäre doch praktisch.« Worauf ich meinen ausgetrockneten Mund öffnete: »Landschaftsgärtner.« Das gefiel mir, ich wollte die orange Sonne über dem feuchten Boden aufgehen sehen, und die eisigen Felsen im Nebel. Aber das Feld war schon von anderen mit besseren Noten besetzt, also: Ausbildung zum Baumschulgärtner.
In der Berufsschule machten sich alle über den Zusatz in meinem Nachnamen lustig. Sie siezten mich, spreizten den kleinen Finger ab, wenn sie mir die Astschere reichten, lachten unter sich. Ihre Eltern waren Bauern oder Gärtner, sie hatten den gleichen Hintergrund, ein breites Kreuz und große Hände, gingen zügig. Eines Tages hätte ich fast einen Freund gefunden: Aurélien, ältester Sohn eines Gemüsebauern, der mit seinen endlosen Reihen von Kopfsalaten und Endivien die Auszeichnung »Stolz Okzitaniens« erhalten hatte. In seiner Gegenwart begann ich, wieder zu sprechen, aber oft unterbrach er mich und runzelte die Stirn, als hätte er Kopfschmerzen: »Mensch, rede doch nicht so kompliziert.« Er fand meine Sätze zu lang, zu verschachtelt. Ich versuchte, mich kürzer und einfacher auszudrücken; vielleicht war ich so aufgeregt wegen des neuen Lebens, eines möglichen Freundes, sodass ich zu viel und zu schnell sprach. Ich versuchte es wirklich. Mal einen Punkt machen, nur halb so viele Worte verwenden – doch Aurélien war es bald leid, er ging zurück zu den anderen und lachte mit ihnen. Für sie war ich ein Kind aus reichem Hause, das hier nicht hingehörte und das ihnen den Platz streitig machte.
Man brachte mir bei, den Boden zu nähren, und im Frühjahr pflanzte ich meinen Adelsnamen ein. Er wuchs zu einem Haselstrauch, einer Rose, einer Schmucklilie her-an. Mit verbranntem Nacken lernte ich, ihn im Sommer vor den Rüsselkäfern zu schützen, im Herbst setzte ich die Stecklinge, und in der weißen Wintersonne verkaufte ich ihn, die Lippen rissig vom starken Südwind.
Bei einem Praktikum im Gartencenter Jardinerie Toulousaine interessierte ich mich für die Tätigkeiten von Vincent, dem Einkaufsleiter. Hinter den blühenden Oleandersträuchern kauernd, lauschte ich seinen klaren Worten und verfolgte seine flinken, entschiedenen Bewegungen zwischen den Düngersäcken und Zitronenbäumen. Die Hände bei minus zehn Grad in der Erde und die Füße in eleganten Schuhen, erkannte er den Gesundheitszustand einer Zeder am Blau ihrer Nadeln. Die von ihm eingekauften Papageientulpen, Stachelbeersträucher und Drillingsblumen färbten die Gänge der Pflanzenabteilung je nach Saison. Ich bedauerte es, wenn er wegging, und sehnte mich danach, dass er zurückkam. Immer nur Schubkarren schieben, das wollte ich nicht; unter der Bedingung, dass ich gute Leistungen erbrachte, erklärte sich Vincent bereit, mir sein Metier beizubringen. Ihm zuliebe schloss ich meine Lehre ab und begann eine kaufmännische Zusatzausbildung. Aber zurück auf der Schulbank trieb ich erneut haltlos umher. Ich verließ die Schule ohne Abschluss.
Ich verstand mehr vom Verkaufen als ein Baumschulgärtner und kannte mich mit Bäumen besser aus als jeder Verkäufer, damit sollte sich eine Arbeit finden lassen. Doch sobald ich vor einem Schlipsträger saß, verschleierte sich mein Blick, wusste ich nichts mehr. In meinem Kopf blieb die Zeit stehen wie ein Hirsch im Scheinwerferlicht eines Autos – man fragte mich nach Himbeeren, ich antwortete mit schwarzen Johannisbeeren.
Zwischen zwei missglückten Bewerbungsgesprächen übernachtete ich bei meinem Bruder in Paris. Er war bereits sehr erfolgreich und begann, jenen Männern zu ähneln, an denen ich scheiterte: blauer Anzug, kerzengerade hinter dem Schreibtisch. Seinen Ratschlägen hörte ich nur mit halbem Ohr zu, dann ging ich wieder durch die Straßen, um die Haussmann’schen Karyatiden zu bewundern.
So entdeckte ich es, verborgen zwischen dem Jardin du Palais-Royal, der Comédie-Française und der Place des Victoires: das kleine Ladengeschäft des Orchideenverkäufers. Ein versteckter Ort, in dem sich einige Schätze befanden, wie von einem Meteoriten in eine Flussmündung gefallen.
Ich kam vom Einkaufszentrum Les Halles, in der Hand eine Tüte von Foot Locker mit reduzierten Turnschuhen, als ich abrupt stehen blieb: In einem dunklen Schaufenster standen drei Brassien, jede einen Meter hoch, mit weißen Blüten wie architektonische Meisterwerke. Die gotischen Bögen der Kathedrale von Metz im Miniaturformat. Gewölbe aus dem 14. Jahrhundert, die sich auf ewig zweiundvierzig Meter über dem Boden erhoben, zwischen zwei Fingern zu fassen – und ist ein Gewölbe nicht der Inbegriff von Beständigkeit, von Unendlichkeit? Als Schlussstein ein Blütenstempel, der seine Kraft bis in die Spitzen der Blütenblätter schickt und das ganze Bauwerk zusammenhält. Elfenbeinfarbene Spinnen, die auf den Blütenrispen galoppierten, ausgestattet mit einem Willen, Instinkt oder Verlangen, und von denen ich meinen Blick nicht lösen konnte.
Ich verstehe den Lebensraum eines Baumes, seinen Platz zwischen der Erde und den Wolken. Wenn ich den rauen Stamm berühre, spüre ich seinen Atem und stelle mir sein Habitat vor, den Tanz der Zweiflügler unter der Rinde. Über Orchideen wusste ich nichts, nichts von den dreißigtausend Arten, die im Blätterdach des Amazonas hingen, an den Klippen der schwarzen Strände Islands und an allen Kassen der Baumarktkette Leroy Merlin.
Ihre massenhafte Existenz – abgesehen von den Polargebieten gibt es sie überall auf der Welt – interessierte mich wenig; ich fand sie obszön mit ihrem klaffenden Geschlechtsteil, angemalt wie ein gestohlener Lastwagen und aufdringlicher als eine Karnevalsmaske, wie einbalsamiert mit ihren schier unvergänglichen Blüten. Dennoch stieß ich die Tür auf, und der Orchideenverkäufer richtete seine salbeigrünen Augen auf mich. Um mich herum sättigte diese Unbekannte, mit der ich die nächsten Jahre meines Lebens verbringen würde, die Luft mit ihrem feuchten Grün und stellte ihre verführerischen Reize zur Schau: Flügel aus gesprenkelter Seide; Vulven, orange wie schreiende Münder oder zart wie die Brust eines Kolibris; Zuckerstangenblätter und knöchelweiche Knollen.
Fünf Jahre später überreichte mir der Orchideenverkäufer vertrauensvoll die Ladenschlüssel, und an jenem Morgen war ich es, der das Rollgitter hochschob. Ich hatte genug über Orchideen und unsere Kundschaft gelernt, um das Geschäft zu übernehmen, nun war ich hier zu Hause.
Das ist zehn Jahre her, aber ich erinnere mich noch genau an die schweren Schlüssel in meiner Hand. Als mein Name auf die Fassade gemalt und der Name des früheren Eigentümers überschrieben wurde, habe ich mein Adelsprädikat weggelassen. Aus Sylvain du Bois des Aulnays wurde Sylvain Dubois. Wer reichen Leuten etwas verkaufen will, darf keinesfalls reicher wirken als sie.
VERMÄCHTNIS
In letzter Zeit herrscht in meinem Kopf nur weißes Rauschen, wie auf einem Fernsehbildschirm. Mein Programm hat eine Störung. Die Kunden kehren aus dem Sommerurlaub zurück, aus Ländern, in denen ich nie war und aus denen einige meiner Blumen kommen. Sie erzählen mir, dass es hier genauso warm ist wie dort. Gestern stellte mir jemand eine ganz banale Frage, aber ich wusste keine Antwort darauf. Die Arbeit mit lebendigen Wesen macht mich müde. Ich muss bald damit aufhören.
»Nehmen Sie beim Gießen den Übertopf ab, sonst steht das Wasser, und die Wurzeln faulen.«
»Richtig gießen? Baden Sie die Orchidee. Wie? Ganz leicht: den Badewannenboden mit Wasser füllen, die Orchidee hineinsetzen und fertig.«
»Topfen Sie die Pflanze unbedingt um, wenn die Wurzeln rausschauen. Sphagnum-Moos, Kokosfasern, Pinienrinde – jede Orchidee hat ihre Vorlieben.«
»Natürlich kann ich das für Sie machen, sagen Sie mir einfach, wann es Ihnen passt, dann komme ich vorbei.«
Jeden Tag dieselben Worte, aber die Müdigkeit wird immer schlimmer. Ich verstecke sie vor Hugo, meinem Angestellten, und den Kunden; ich habe Angst, sie ihnen zu zeigen.
Fünfzehn Jahre lang bin ich durch meinen Orchideengarten gewandelt. Auf diesem bunt gepflasterten Weg, diesem samtenen Teppich, betrat ich die schönsten Häuser von Paris, meine Innenwelt. Dort schlug ich mein Winter- und mein Sommerquartier auf, und in den Privatgemächern bewunderte ich die Seerosen von Monet, die Olivenhaine von Van Gogh und die Calanques von Signac. Die Orchidee ist das Accessoire der Privilegierten. Mein Geschäft, das genau dort liegt, wo die wohlhabendsten Pariser Arrondissements aufeinandertreffen, ist ihr Stammkiosk, ihr Tabakladen.
Mein Garten ist in tadellosem Zustand, er duftet herrlich, aber irgendwann habe ich mich darin verirrt, ohne es recht zu merken. Ich bin über einen Randstein gestolpert und ins Seerosenbecken gefallen, ich kämpfe mich durch die braune Erde der Olivenhaine und fliehe hustend vor den brennenden Calanques.
Wohin ich auch gehe, hinter mir ist immer ein Abgrund. Ich kenne ihn, ich habe ihn schon einmal gesehen, aber beim letzten Mal wusste ich, warum er da war. Ist es derselbe? Er sieht ihm ähnlich. Als mein Vater starb, schrie ich in diesen Abgrund hinein und brauchte ewig, um den Schrei zu ersticken. Eines Tages war er verstummt, und ich dachte nicht mehr daran. Ich hatte ihn unter Sphagnum-Moos, Kokosfasern und Pinienrinde begraben.
Vielleicht scharrt der Tod, wenn man ihm begegnet, ein Loch unter den Füßen der fassungslosen Lebenden und begleitet sie dann wie ein Schatten. Ein Schatten, der kleiner wird, je öfter wir lachen, oder größer, je nach Mondphase, und der immer da ist. Damals war ich gut davongekommen, aber wer weiß, wie viel Raum er wieder einnehmen kann, wie weit er sich ausdehnen will.
Vor den Orchideen war da nur meine abgebrochene Wurzel. Im Dunkeln tastete ich nach dem verlorenen Endstück. Mein Geschäft besteht aus all den Farben, mit denen ich als junger Mann meine Augen gefüllt habe, damit ich sie als Erwachsener öffnen und mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen kann.
Wenn ich diesen Ort zurücklasse, wenn ich nicht jeden Morgen die Tür öffne, bricht der Film meines Lebens ab. Was bleibt mir dann? Ich schaue in mich hinein. In meinem Inneren sehe ich nichts. Wie diese Osterhasen, die immer lächeln: zwei geformte Schalen, vorne und hinten, und dazwischen eine schwindelerregende Leere.
Mein Geschäft ist mein Leben, es ist alles, was ich habe. Nicht nur die Wände, die Möbel, die Blumen, sondern auch das, was man mir beigebracht hat, mit Worten oder ohne. Ich bin zu meiner eigenen Unternehmenskultur geworden. Ein Wissen, ein immaterielles Magma, der Wille derer, die mehr als alle anderen danach strebten, dass diese Schönheit über Generationen hinweg weiterlebt. Ein ererbtes Wissen, gespeichert im Nektar und in den Wurzeln meiner Orchideen.
All diese Erfahrung darf nicht sterben. Ich muss sie weitergeben, sicherstellen, dass mein Nachfolger so ist wie ich und wie die, die vor mir waren. Ich werde ihm meine Geschichte erzählen, und er wird seine eigenen Fäden wie starke Taue daran anknüpfen. Oder vielleicht wird sie mitverkauft, schlüsselfertig geliefert? Wie wird die Erinnerung weitergegeben? Vielleicht ohne, dass man erklären muss. Immer gleich (stets vorwärts) und von unten nach oben, von der Wurzel hin zu den Blüten.
Dann gehe ich fort. Zu Hugo und den Kunden sage ich: »Ich habe im Auge des Eichelhähers gebadet, bin auf den Grund hinabgetaucht. Ein Cenote, in dem ich meine Füße nicht sehen kann. Niemand ist da, ich lausche dem Plätschern des Wassers. Hier bleibt alles an seinem Platz, ob waagerecht oder senkrecht. Sedimente, vergangene Leben, die Erde, der Wind, die Hochhäuser, die Blume, das Kind. Wenn man das Auge des Eichelhähers genau betrachtet, erkennt man an seinen Lidfalten noch den Dinosaurier, der er einmal war, und in den Tiefen seiner Obsidiankuppel sogar das Karbonzeitalter.« Und in ihre verwirrten Gesichter hinein fahre ich fort: »Ich habe mich aufgemacht, die Inschriften auf dem Rücken der Wale zu lesen. Sind sie euch nie aufgefallen? Muscheln und Steine haben darauf Notizen hinterlassen, eilige Symphonien komponiert und Gedanken skizziert, und ich bin losgezogen, um sie zu entschlüsseln.«
Jemand müsste meine Geschichte hören wollen, meinen Wandteppich. Bereit sein, ihn auszurollen und zu studieren, die Hauptfiguren ausfindig zu machen und von ihren Heldentaten zu hören. Daran anknüpfend wird er ihn aufs Schönste fortsetzen, meinen Tausendblumenteppich der Dame mit dem Einhorn. Wenn ich keinen Nachfolger finde, muss ich mich damit abfinden, meinen Wandbehang für immer in eine dunkle Ecke zu stellen – und mich selbst gleich dazu.
Ich klopfe ihn aus, begutachte ihn. Die verworrenen Fäden sind fester als gedacht. Mit der Hilfe von Botanikern, Entdeckern und Kunden habe ich die Risse geflickt, die Pentimenti versteckt. Indem ich mir ihre Geschichten aneigne, suche ich mir andere Väter: jene, die mir ihr Wissen weitergegeben haben und von denen ich möchte, dass man sich an sie erinnert.
Ich folge dem Bild jener Blume, die in den Zweigen wächst, klettere ihren Stängel bis zum Knoten hinab und stoße dort auf einen gerissenen Faden, den meines Vaters. Trotz meiner Bemühungen perlt der Saft noch immer am Fuß meines Baumes. Ich strecke einen Finger vor, um die Wunde auszubrennen. Ich weiß nur eins von diesem Baum: dass er ohne den Wald nicht derselbe wäre.
URWALD
Als die ersten Eisenbahnen England durchschneiden, Dampfschiffe aus den Häfen Europas auslaufen und Ölraffinerien in Pennsylvania aufflammen, kaufen meine Vorfahren, Schmiede mit rußgeschwärzten Wangen, an der Saar einen Wald. Die in diesem Wald, dem Bois des Aulnays, entstehenden Hochöfen schlagen ihre Wurzeln in Frankreichs größtem Steinkohlerevier, und auf den glühenden Kohlen wird bald schon das Eisenerz schmelzen und sich über den gesamten Kontinent ergießen.
Unter dem Wald gräbt man Stollen, die Pulsadern und Lungen der Bergleute. Die Bäume schafft man unter die Erde – Bäume aller Art, wenngleich lieber die Kiefer als die Eiche, denn sie spricht, bevor sie bricht. Zwei lange Beine und ein Querholz stützen die kilometerlangen Tunnel, durch die sich die Schienen der Förderwagen schieben.
Mein Urgroßvater weiß, wie man es anstellen muss; er ist Ingenieur für Straßenbau. Danach wird er Generalinspektor im Bauministerium, Kolonialminister, stellvertretender Vorsitzender der parlamentarischen Groupe colonial, Mitbegründer des Comité du Maroc, dessen Präsident er kurzzeitig ist, Vizepräsident des Comité de l’Asiefrançaise, Mitglied des Comité de l’Afriquefrançaise und der Action coloniale et maritime, Vizepräsident der Gesellschaft für Hütten und Stahlwerke der Marine, Direktor seines eigenen Unternehmens, Präsident der Gewerkschaftskammer der Hersteller von Eisenbahnmaterial, des Arbeitgeberverbands der Metall- und Bergbauindustrie und des Hüttenkomitees. Er baut sein Land auf.
Zwischen zwei Ausflügen auf sein Jagdgut fährt der frischgebackene Großbürger, Nachfahre von Hüttenarbeitern, einmal im Monat in die Hauptstadt zur Versammlung des Hüttenkomitees, er besucht das Theater, wenn seine Pflichten es zulassen, und empfängt in seinem Stadtpalais im 16. Arrondissement die feine Pariser Gesellschaft.





























