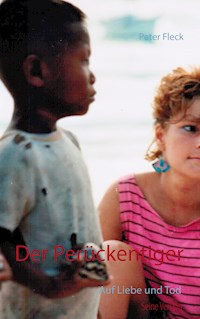
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Teil der Trilogie erzählt die Geschichte von Tini und Tom. Sie, eine junge, liebenswerte Physiotherapeutin aus der rheinland-pfälzischen Provinz. Er, ein dubioser und zwielichtiger Typ aus Frankfurt a. M. - dem man als liebender Vater oder Mutter seine Tochter nicht anvertrauen möchte. Im ersten Band wird die Handlung aus der Sicht von Tom erzählt. Die zwei werden von einem Kinderhändlerring gejagt. Schnell steht die Welt der unbekümmert und behütet aufgewachsenen jungen Frau auf dem Kopf. Zumal der Boss der Verbrecherbande, der in Deutschland als verstorben geglaubte biologische Vater von Tini ist. Eine Jagd durch das philippinische Archipel beginnt. Mal sind sie Jäger und mal die Gejagten. Wer ist Freund und wer Feind? Was ist Wahrheit und was Lüge? Besiegt der Mut der Verzweiflung, die Angst und die Liebe zueinander - den Hass? Wenn die Chance zu überleben bei unter 10% liegt, was würdest Du tun? Kämpfen für das an was Du glaubst oder... .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog:
Zur Person:
Die Traumfrau
Damals
Der Plan
Damals
Im TV
Damals
Das wahre Gesicht
Damals
Auf dem Weg
Damals
Herzlich Willkommen
Der helle Wahnsinn
Der Vater des Gedankens
Pepito´s Place
Kulturschock
Malate Pension
Botschaften
Erstschlag
Keine Gnade
Terrorverdacht
Magic Mushrooms
Father Joey
Babytiger und junge Huren
In der Höhle des Tigers
Recherchen
Die Stadt der gefallenen Engel
Grasgeschäfte
Sackgasse
Resignation
Geheime Pläne
Veränderungen
Die Hafenbullen und ein Kaufhaus für Tini
Wieder unterwegs
Nägel mit Köpfen
Gesteinigt
Lästige Bekanntschaft
Der Asslockwixaa
Richtung Süden
Piraten und Partisanen
Glück gehabt
Vom Regen in die Traufe
Auf den zweiten Blick
Kidnapping
Die Katze ist aus dem Sack
Wie du mir, so ich dir
Geborgte Helden. Oder das Ende vom Lied
Verzweiflungstat
Endgegner
Am Ende des Weges
Epilog
Vorwort
„Innere Gelassenheit braucht Zeit und Worte“
Tom Meister (Camiguin)
Bedanken möchte ich mich bei den vielen Protagonisten dieses Buches.
Dem leider viel zu früh verstorbenen Pepito Bosch. Danke für dein großes Vertrauen und dein ebenso großes und unerschütterliches Zutrauen in uns. Du fehlst!
Dank auch dir, Onofrey (Rey) Barcita! Du hast uns gezeigt, was ein mutiges Herz vermag!
Dir, Father Joey de Leon SJ!
Am meisten habe ich dir, meine Süße, zu verdanken. Ein einfacher Dank wird niemals reichen!
Ich liebe dich!
Nicht zuletzt sei hier auch den vielen Menschen aus allen Bereichen des Lebens gedankt.
Mahal Kita Philippines!
Peter Fleck
Dieses Buch basiert auf einer wahren Geschichte, ist aber kein Tatsachenroman! Deshalb ist der Roman in vielen Punkten und Details frei erfunden! An vielen Stellen habe ich mir schriftstellerische Freiheiten erlaubt, schon um das Buch lesbar und spannend zu halten. Begebenheiten, die sich über Jahre erstreckten, sind hier in geraffter Form beschrieben und zum Teil in einer Art und Weise miteinander verknüpft, wie es nicht den wirklichen Abläufen entsprach. Namen, Dienstbezeichnungen, Hintergründe und Orte wurden zum Schutze der handelnden Personen alle geändert und entsprechen nicht den realen Gegebenheiten. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Alle Markenzeichen und/oder anderweitig geschützten Namen und Produkte sind nur aus literarischen Gründen verwandt worden und stehen in keiner Verbindung zu hier genannten Vorfällen!
Abendstern, im Herbst 2014
Prolog:
Ein ekelhafter Jetlag plagte mich. Gerädert und völlig überdreht versuchte mein Körper zur Normalität zurückzufinden. Müdigkeit war nicht der einzige Grund für meine lethargisch-schwerfällige Reaktion. Ein skurriler Albtraum verfolgte mich hartnäckig bis in den dämmerigen Halbschlaf hinein. Er bekam etwas Kafkaeskes und Symbolhaftes. Ein riesiger Hahn griff einen Pitbull an und hackte ihm die Augen aus. Immer wieder wachte ich auf, ohne wirklich zu erwachen. Ich begriff nicht, wo ich mich befand. Schlaftrunken hörte ich ganz in der Nähe Hähne krähen. Viele Hähne!
Ich schlief noch, das träumte ich nur.
Als erstes realisierten mein Gehör und dann mein Geruchssinn, dass etwas anders war als sonst. Weit weg schien jemand ein Haus abzureißen. Es roch wie in einer alten Waschküche, als Wäsche noch in großen Zubern gekocht wurde. Eine ekelhafte Mischung aus Baustaub und dem Geruch von Bettlaken voller eingetrockneter Pisse. Meine Nasenflügel zitterten, sie witterten Gefahr. Auf meiner Zunge fühlte ich einen zähen pelzigen Belag, der genauso eklig schmeckte, wie er sich anfühlte. Warum schwitzte ich derartig stark, fragte mein noch halbwaches Bewusstsein sich selbst. Wie kurz vor dem Ausbruch einer üblen Erkältung, außen heiß und innerlich fröstelnd. Ich hatte teuflischen Durst und mein Kinn schmerzte heftig. Meine Augen schienen stark geschwollen, die Lider wie zusammenzementiert zu sein. Vielleicht habe ich nur einen üblen Kater, schlich sich ein weiterer Gedanken in mein schlaftrunkenes Hirn. Den widerlichen Kopfschmerz spürte ich schon, nun fehlten nur noch die üblichen Kotzgefühle. Diese Folge eines nächtlichen Alkoholexzesses blieb aus.
Das konnte es auch nicht sein. Mir dämmerte, dass ich seit mehr als zwei Wochen keinen Tropfen mehr anrührte. Das Hämmern und schlagen ließ nicht nach, es kam immer näher, nun kamen noch laute Rufe hinzu.
„Scheiße“, ich schreckte hoch und verfing mich dabei in einem Moskitonetz. Ich war weder krank noch halb besoffen! Dafür war der scharfpulsende Schmerz in meinem Kopf zu echt. Nicht nur mein Gehirn quälte mich. Die Beulen und Blutergüsse, welche ich von Kopf bis Fuß besaß, sendeten ihre dumpf pulsenden Schmerzimpulse wellenförmig durch meinen Körper. Gleichzeitig setzte meine noch bruchstückhafte Erinnerung an die Geschehnisse der vergangenen Nacht ein.
„Western Police Distrikt, öffnen sie die Tür. Sofort!“
Neben mir lag meine Freundin Tini und schlief tief und fest. Endlich fand ich das Ende des Netzes und schlüpfte aus dem Bett.
„Öffnen Sie jetzt oder wir brechen die Tür gewaltsam auf. Dies ist unsere letzte Aufforderung!“ Die meinten es erkennbar ernst, zumindest hörte es sich so an. Eine blaugrün schillernde Spinne seilte sich keine fünf Zentimeter vor meiner Nase entfernt von der Decke ab. Mir war schlecht.
Gestern Nachmittag war ich von Singapur kommend auf den Philippinen eingereist. Ich stand in einem düsteren, leicht modrig muffelnden Kabuff irgendwo in einem Stadtteil, der Ermita hieß. Wenige Schritte entfernt von hier endete Metro Manila und der Pazifik begann. Tini streckte sich und drehte sich zu mir um. Hohlwangig und mit dunklen Augenrändern war sie nur noch ein Zerrbild ihrer selbst. Sie war dürr und völlig erschöpft, sie glich kaum noch der wunderschönen Frau, an die ich mich erinnerte. Bang, jemand hämmerte mit einem Rammbock gegen die Tür. Die Erinnerung setzte wieder voll ein. Ein Filmriss wäre mir lieber gewesen. Reflexartig griff ich mir ans Kinn und zuckte bei der Berührung zusammen. Verkrustetes Blut bröselte zwischen meinen Fingern hindurch und fiel auf meine nackten Füße. Nichts wie weg von hier, ging es mir durch den Kopf. Ich hatte das Apartment am gestrigen Abend auf Fluchtmöglichkeiten geprüft und keine gefunden. Nachdem Tini und ich die Türen fest verschlossen und verriegelt hatten, legten wir uns schlafen. Nun saßen wir fest.
„Die Bullen…“. Ich hätte mir diesen Erklärungsversuch sparen können, im selben Moment flog die Hintertür der Fünf-Zimmer-Wohnung aus den Angeln und mehrere Polizisten stürmten die Bude. Mein Gott, lass es ein übles Schreckgespenst meiner Fantasie sein. Es war natürlich keines! Wie immer, wenn man es sich dringend anders wünscht, hält sich Gott aus allem raus.
In der nächsten Sekunde bekam ich den Lauf einer Schrotflinte wuchtig in die Magengrube gehauen. Es gab eindeutig schönere Wege, geweckt zu werden. Sie trieben uns ins Wohnzimmer und befahlen im üblichen rüden Bullentonfall, dass wir zu schweigen haben. Genauer gesagt, einer von ihnen meinte wörtlich, wir sollten unser Maul halten. Gegenüber von mir befand sich ein Spiegel. Meine blutunterlaufenen, verklebten Augen, das stark geschwollene Kinn und meine wild abstehenden Dreadlocks, welche mir im verschwitzten Gesicht klebten, gaben mir das Aussehen eines karibischen Voodoo-Hexenmeisters. Ich sah aus wie einer, der zum Frühstück lebende Hühner verspeist und aus den Eingeweiden von Fischen die Zukunft liest.
„Hey Mann, was….“, versuchte ich zu protestieren.
„Shut up, Sie sind festgenommen, Sie haben das Recht zu schweigen.“ Ich wollte nicht schweigen und schon gar nicht wollte ich jetzt und hier verhaftet werden.
In mir kochte eine fahrlässige, eine gefährlich irrationale Wut hoch. Die Tatsache, dass ich schon unter normalen morgendlichen Umständen ein Morgenmuffel war, hatte mit diesem irrwitzigen Zorn allerdings nichts mehr zu tun. Abscheu, Empörung, Zorn, Hass waren die Eskalationsstufen gewesen. Jetzt war es Feindseligkeit geworden, also Krieg, und diese Ärsche stellten meine Feinde dar. Wir durften nicht in ihre Gefangenschaft geraten, so viel war klar, nur wie ich dies verhinderte, noch nicht.
Die unglaubliche Geschichte, welche Tini mir am vergangenen Tag erzählte und meine Verbitterung, in etwas absolut Unsägliches mit hineingezogen worden zu sein, machte sich Luft. Dabei verstand ich in jenen Minuten nicht einmal ansatzweise, was hier eigentlich gespielt wurde. Jetzt ging es um siegen oder verlieren, um aufgeben oder kämpfen, und das möglichst ohne Gefühlsausbrüche! Die schmierig grinsende Visage des uniformierten Typen vor mir half mir kein Stück dabei, meine Emotionen zu kontrollieren, sondern stachelte mich erst recht an. Diese korrupten, öligen Figuren, die sich an jeden verkauften, der sie bezahlte, sollten nicht als Sieger vom Platz gehen. Ihr auf Waffengewalt basierendes überhebliches Feixen, ihre anzüglichen Sprüche über Tinis Nacktheit wandelten meinen schon vorhandenen gewalttätigen Impuls in eine riskante Affekthandlung um.
Jetzt oder nie!
Mein gut platzierter Kopfstoß traf den vor mir stehenden schmächtigen Kerl mitten auf die Stirn. Mitsamt seiner großen Knarre riss es ihn von den Beinen. Das nächste Arschgesicht in Uniform stand noch günstiger, ein gezielter Kick in die Familienplanung ließ ihn rückwärts über ein ihm im Weg stehendes Sofa segeln. Bevor ein weiterer Cop einschreiten konnte, griff ich mir die Schrotflinte zu meinen Füßen und hielt sie seinem pockennarbigen Kollegen an die Schläfe. Daktari, der Mann dem wir diese ganze Scheiße zu verdanken hatten, tauchte kurz im Rücken des Einsatzleiters auf und wollte, als er die Lage erkannte, gleich wieder abtauchen.
„Du Schwein bleibst hier“. Es hörte sich an, als hätte ich eine heiße Kartoffel im Mund. Vielleicht war mein Kiefer angebrochen? Das Reden verursachte mir starke Schmerzen. Die Situation war unklar. Befanden sich im Treppenhaus noch mehr von denen? Wie verhielt sich das private Sicherheitspersonal des Hauses? Ich versuchte zu denken, doch mein Hirn brachte keine klaren Gedanken zusammen.
„Was soll der Bullshit? Wir haben niemanden etwas getan“, rief ich verzweifelter als ich wollte, dass es klang. Diese seltsam bizarre Situation war eskaliert. Mir fehlte ein Handlungskonzept oder anders gesagt, ich hatte keinen Plan. Ich wusste nur eines, dass ich aus dieser Nummer nicht mehr mit freundlichen Erklärungen und guten Worten herauskommen würde. Entblößt und entwürdigt standen wir vor den Officer. Schockreaktionen setzten ein. Der Lärm, die Gerüche, der Schmerz, alles schien plötzlich verschwunden, die Zeit übte sich im Stillstehen. Schmerzen gestillt. Das war kein B-Movie! Dieser Film war zwar grotesk, aber real. So wie es aussah, war mir dabei die schauspielerisch undankbare Rolle des Toten direkt zum Anfang des „Films“ zugefallen. Es war nicht die Zeit zu fragen, wie es zu diesem kompletten Wahnsinn kommen konnte. Jetzt war es höchste Zeit, um abzuhauen.
Zur Person:
Name: Meister
Vorname: Tom
Geburtsort: Frankfurt a. Main
Alter: 30 Jahre. Vater schwarz. Mutter weiß. Heimkind.
Besondere Kennzeichen: Tätowierter Löwenkopf auf der rechten Schulter.
Vorbestraft wegen Todschlags an einem Pädophilen und einem Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Er floh kurz vor seiner Festnahme nach Frankreich. Jede Einsicht in die Strafbarkeit von Selbstjustiz fehlt ihm völlig.
Hinweis: Der Verurteilte war in der französischen Fremdenlegion. (Groupement des commandos parachutistes) Laut Mitteilung der Staatsschutzabteilung im LKA Wiesbaden ist er in Kolwezi, Zaire im Mai 1978 bei der Befreiung von europäischen Geiseln als Fallschirmspringer eingesetzt gewesen. Er soll bei div. anderen Kommandounternehmen als Fallschirmspringer im Einsatz gewesen sein. Obwohl er für drei militärische Auszeichnungen vorgesehen war, hat er sich nach dem Ende des Einsatzes unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist als Deserteur in Frankreich zur Fahndung ausgeschrieben. Der Verurteilte äußert sich nicht zu diesen Erkenntnissen. Der Insasse weigert sich darüber hinaus konsequent, an seiner Resozialisierung mitzuwirken. Er lehnt Gespräche mit den sozialen und psychologischen Diensten der JVA ab. Der Verurteilte ist als potenziell gefährlich einzuschätzen! Zelle darf nur mit zwei Beamten geöffnet werden.
KEINE HAFTLOCKERUNGEN.
So stand es in Kurzform in meiner Gefangenenakte.
Die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt versuchten verzweifelt mich zu einem besseren Menschen zu machen. Die Knackis, so sie mich nicht mochten, ließen mich zumindest in Ruhe. So blieb ich im Knast ein Einzelgänger und schloss mich keiner der Gangs an. Die meisten Gefangenen suchten ein einvernehmliches Auskommen mit mir. Weniger aus Furcht vor dem Ex-Legionär, sondern weil ich ihnen beim Schreiben von Eingaben und Beschwerden half. Für einige schrieb ich sogar die Liebesbriefe oder las ihnen die eingehenden Briefe ihrer Frauen und Freundinnen vor. Ich war erschrocken darüber, wie viele Menschen nicht oder nicht richtig lesen und schreiben konnten. Oft genug log ich beim Vorlesen. Einige Frauen beschrieben, scheinbar mit Genuss, ihren einsitzenden Männern, mit wem sie es gerade trieben. Doch meistens waren es Geschichten von Not und Angst. Die Familien der Knackis waren deren indirekte Opfer und wurden durch das System wie selbstverständlich mit bestraft.
Ich entschloss mich, die Kurve zu kratzen. Wut und Selbstmitleid, welche ich in diesen Tagen noch für gerechten Zorn hielt, hatten mich in die Flucht getrieben. Doch lassen wir das an dieser Stelle. Dieser Teil meiner Geschichte soll hier nicht erzählt werden. Es war nicht einfach, aber mit ein wenig Planung und Mut zum Risiko entkam ich dem nordhessischen Knast.
Jetzt war ich auf der Flucht.
Gedanklich war ich schon tausende Male geflüchtet. Vordergründig aus den engen Grenzen meines hochsicheren Wohnsitzes. Tatsächlich jedoch floh ich aus den Zwängen eines fremdbestimmten Lebens, welches meinen Vor- und Nachnamen trug. Allerdings wusste ich dies damals nicht so richtig zu unterscheiden.
Der alte Opel Kadett C sprang ohne zu mucken an. Ein guter Freund hatte ihn zwei Tage zuvor nur wenige Meter vom Gitterpalast entfernt geparkt. Der Zündschlüssel hing durch einen Magneten gehalten unter dem Kotflügel. Im Wagen lag Wäsche bereit und ich zog mich um. In einer Mülltonne entsorgte ich meine Sträflingskluft. Weniger als vier Stunden später war ich in Frankfurt, gab das Auto an meinen Freund zurück und baute Adrenalin ab. Der Ausgang war seit zwei Stunden vorüber, von nun an stand ich auch in Deutschland auf der Fahndungsliste. Im HR3 kam eine Sondermeldung.
„Im Raum Kassel vermutet die Polizei eine männliche Person, die möglicherweise in blauer Häftlingskleidung unterwegs ist. Bitte nehmen sie keine Anhalter mit und versuchen sie nicht, die Person zu stellen. Informieren sie über die 110 die Polizei.“
Es folgte meine Beschreibung.
Glücklicherweise hatte in all den Jahren niemand mein Geldversteck im Wiesbadener Stadtwald entdeckt. Von der ursprünglichen Beute von knapp 350.000,00 DM waren nur noch neunzehntausend Mark übrig geblieben und die betrachtete ich als „meinen“ absoluten Notgroschen. Als erstes brauchte ich Arbeit, um „meine Ersparnisse“ weiterhin nicht anrühren zu müssen. Schwarze Jobs für wenig Knete auf die Kralle gab es damals wie heute noch mehr als genug. Es gab zwar schönere Tätigkeiten als morgens um 6.30 Uhr die unglaublich versifften Frauenklos in einer Frankfurter Szenekneipe zu putzen, brachte mir aber täglich Cash. Die dreißig Märker pro Tag waren mehr als nur mein selbstverdientes Geld, sie beruhigten auch mein Gewissen und ich riskierte so gut wie nichts. Zum einen, weil ich den Mädels mit denen ich um die Häuser und in die Betten zog, nicht auf der Tasche lag. Zum anderen, weil man am Morgen und am frühen Vormittag am wenigsten mit einer Kontrolle durch die Bullen rechnen musste. Wenn die südhessischen Verbrecher pennen, kontrollieren die Ordnungshüter üblicherweise ihren Papierkram und keine Ausweise. Der Putzjob war also ideal. Mit Erlaubnis der Chefin genehmigte ich mir nach der Arbeit ein üppiges Frühstück. Diese frühe Mahlzeit reichte mir den ganzen Tag und wenn nicht, dann tat es eine Currywurst oder ein Döner zwischendurch.
Mein Leben auf der Flucht unterschied sich eigentlich nur in zwei Punkten von dem eines normalen Durchschnittsbürgers. Ich hielt mich erstens peinlich genau an alle Regeln und versuchte zweitens, nie zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
Das wird schnell zu einem halbwegs paranoiden Tick, wenn man nicht aufpasst. Ich versuchte nicht dem Verfolgungswahn zu verfallen, aber immer öfter ertappte ich mich dabei, wie ich meine Umgebung auf ein potenzielles Verhaftungsrisiko scannte. Im Café setzte ich mich prinzipiell so, dass ich die Türen im Auge hatte. Im Bus setzte ich mich dagegen niemals, sondern stand neben dem hinteren Einstieg. Anstatt mit dem Auto fuhr ich mit der Straßenbahn, um nicht in Verkehrskontrollen zu geraten. In dieser Schattenwelt war jeder Schritt in der Öffentlichkeit ein Wagnis.
Meine Tarnung wurde die Auffälligkeit. Polizisten ticken so. Ein Mensch, der auf sie zukommt, ist weniger verdächtig als einer, der wegläuft. Einer, der die Blicke auf sich lenkt, ist eher unbedenklich, nur wer sich duckt, hat was zu verbergen.
Meine Zeit in der Legion und der Knast hatten mich verändert. Ich war durchtrainiert und innen wie außen hart geworden. Meine Reflexe waren geschult und mein Instinkt nahm Gefahren wahr, als hätte ich ein zusätzliches Organ dafür. Gleichzeitig pflegte ich eine gewisse selbstbewusste Lässigkeit. Diese Kombination schien ihren Reiz auf Frauen zu haben, was mir natürlich gefiel. Eine feste Beziehung war mit mir nicht drin, was ich den Mädels aus Prinzip gleich steckte. Sie schienen es zu akzeptieren. Auf den ersten Blick war ich ein von sich selbst überzeugter Macho. Wobei ich die selbstgewählte Bezeichnung „Macho“ natürlich nicht negativ verstand. Ich war ein Kerl und kein weichgespülter Wolf im Schafspelz, der den Frauen vorgaukelte, er wolle ihren Geburtsschmerz mit ihnen teilen. Meine Denke und meine Gefühle waren maskulin. So wie ich es sah, war ein echter Mann kein Frauenunterdrücker und schon gar kein Windbeutel, der es sich auf Kosten von Frauen gut gehen ließ. So sehr ich meine Wirkung auf die Frauen genoss, eine feste Beziehung suchte und wollte ich nicht. Meine verschiedenen Nachholbedürfnisse waren einfach zu groß. Außerdem gab es viel zu viele tolle Frauen, um einer alleine treu zu sein. Deshalb fand ich es eine gute Idee, den Mädels dies von Anfang an auch so zu sagen. Von mir bekamen sie Sex und keine Treueschwüre. Zu meiner großen Verwunderung schien dies zumindest eine Zeit lang ganz gut zu funktionieren. Trotz des auf mir lastenden Fahndungsdrucks freute ich mich über meine Vogelfreiheit und die Tatsache, dass der Staat seine Macht über mich verlor.
Die Traumfrau
Susi Fuchs studierte Sozialpädagogik im sechsten Semester und hielt mich für einen netten Outlaw. Eine Zeit lang hatten wir viel Spaß mit- und ineinander. Verlieben konnte ich mich nicht in sie. Was wohl auch daran lag, dass ich eigentlich nur ihr Lifestyle-Lover war. Eine Art lebendes Schmuckstück, mit dem sie ihre Kommilitoninnen zu beeindrucken suchte. Als ich mich ernsthaft zu fragen begann, ob der immer mittelmäßiger werdende Sex mit ihr diese Farce überhaupt wert war, überredete sie mich, mit auf eine Party zu kommen. Irgendwo zwischen Bad Kreuznach und Idar-Oberstein sollte in einem winzigen Kaff eine Megafête steigen. Ich gab mich spröde und sträubte mich zunächst, weil ich hoffte, einen Weg zu finden, mit ihr Schluss zu machen, ohne viel Theater. Letztlich gab ich ihrer Bettelei nach und wir fuhren nach Sobernheim. Wo immer dies genau war.
Es wurde eine lange öde Fahrt über die Dörfer. Stunden später erreichten wir ein verstecktes Tal des Soonwaldes. Hier wollte ich nicht tot über dem Zaun hängen. Selbst Hase und Igel sagten sich so weit draußen nicht mehr gute Nacht. Hier war nur der Hund begraben.
Eine winzige Straße führte zu dem entlegenen Dorf mit dem mystischen Namen Auen. Ich war mir sicher, dies war die Straße zum Ende der Welt.
Die Bässe einer weit entfernten Musikanlage drangen brummend in die Dunkelheit. Nur die aufgeblendeten Scheinwerfer des wieder ausgeliehenen Kadett C beleuchteten ausschnittartig das finstere Nichts. Ich begann es immer stärker zu bereuen, dass ich mich von Susi zu diesem Trip hatte überreden lassen.
Lange vor dem gelben Ortsschild standen die ersten geparkten Autos. Die meisten Fahrzeuge waren bepflastert mit Aufklebern voller politischen Statements wie „Atomkraft nein danke“, „Ich bremse auch für Kröten“ oder „Auf die Dauer Frauenpower“. Hinter einer leichten Rechtskurve öffnete sich das enge Tal. Ein kleines Dorf, verborgen vor dem Rest der Welt und ganz bestimmt an dessen Ende liegend, empfing uns.
Mit etwas Glück bekamen wir am anderen Ende des Ortes noch einen Parkplatz. Die wenigen Schritte bis zu dem Gebäude, über dessen Eingang auf einem Schild „Künstlerhof“ stand, waren schnell gegangen. Vor dem Hauseingang saßen zwei junge Männer auf der Treppe und rauchten einen Joint. Die Lautstärke der Musik hätte in Frankfurt längst einen Großeinsatz des Ordnungsamtes und der Polizei ausgelöst. Hier dagegen fuhr gerade die Freiwillige Feuerwehr mit Blaulicht vor und lieferte kistenweise Bier. Während die beiden Kiffer mit glänzenden Augen auf die Glut ihrer Tüte starrten, wurde von dem „Löschzug“ die Türe des roten Einsatzwagens aufgerissen.
Schmunzelnd betraten Susi und ich das Haus. Es begann mir zu gefallen.
Susi stellte mich als ihren „Aktuellen“ vor. Okay, das war es, dachte ich mir. Ab jetzt bin ich dein Verflossener. Mit einem gequälten Grinsen sah ich von Susi zu unserer Gastgeberin. Tini lächelte mich an, wünschte uns viel Spaß auf ihrer Fête und war wieder weg.
Woom! Einhundertsechzig Zentimeter Traumfrau. Braune Augen, volle weibliche Sinnlichkeit, dunkelbraune Haut. Lila Stiefel mit schwarzem Schaft, lila getigerte Leggins, ein superknappes lila Top und ein lila Tuch im dunkelblonden Haar. Meine Hormone drehten komplett durch, mein Gehirn repetierte ihren Namen gebetsmühlenartig. Was symmetrische Gesichtszüge, schmale Hüften und ziemlich viel Holz vor der Hütte doch bewirken können. Eine Braut sehen und mich verknallen, nun ja, dies war mir mit meinen dreißig Jahren schon öfter passiert, doch diesmal war es etwas ganz anderes. Tini faszinierte und erregte mich in einer Weise, dass nur lange geübte Machoroutinen mich daran hinderten, herumzustottern, zu sabbern und die Gesichtsfarbe zu wechseln, sobald sie mich ansah. Ich dagegen starrte sie an, als wäre sie die erste Frau, die mir jemals begegnet war und musste mich selbst zur Ordnung rufen, wenn mir meine eigene Gafferei auffiel. Entgegen meinen sonstigen Gepflogenheiten war ich unerklärlicherweise plötzlich sehr schüchtern und schaffte es einfach nicht, sie an diesem Abend anzuflirten. Ich war schon sehr lange nicht mehr derart heftig verknallt gewesen und so verstand ich nicht sofort, was sich gerade in mir abspielte.
Unruhige Tage und schlaflose Nächte später traute ich mich endlich, sie anzurufen. Ihre Begeisterung über mein „Lebenszeichen“ hielt sich leider ziemlich in Grenzen. Was weder meinem Ego noch meinem verliebten Herzen gut tat. Immerhin, sie hatte sich sofort an mich erinnert, dies tröstete mich ein wenig. Nach einer ziemlich üblen Beziehung mit einem Musiker schien sie die Schnauze von dubiosen Typen richtig voll zu haben, wie Susi mir erzählte. Da ich auf ihre Fragen nach meiner Arbeit und wo ich wohnte ausgewichen war, sah sie in mir anscheinend einen ebenso obskuren Macker.
Womit sie völlig richtig lag. Nur zugeben konnte und wollte ich das nicht, ich wollte unbedingt einen guten Eindruck machen.
Ralf, ein guter Freund aus Kindertagen, lieh mir seine Gold Wing, da er den ganzen Sommer in den USA sein würde. In meiner pechschwarzen hautengen Lederkombi, welche noch erstaunlich gut passte, einem Kampfjetpilotenhelm der Luftwaffe, der meine schulterlangen Dreadlocks kaum zu bändigen vermochte, tauchte ich unangemeldet bei ihr auf. Wenn sie auf diesen Auftritt nicht ansprach, dann wusste ich es auch nicht, sagte ich mir, als ich eine extra große Portion Parfüm auf mir verteilte.
Ich bockte die schwere Maschine auf. Die Haustüre des Künstlerhofes stand weit offen. Aus dem ersten Stock war ein ziemlich heftiger, unschöner Streit zu hören. Falsche Zeit, richtiger Ort. Mist! In dem Moment, als ich mich enttäuscht zurückziehen wollte, hörte ich Tini entsetzt schreien.
Ich sprintete die Treppe hoch und riss die Tür zur Küche auf. Mit der anderen Hand zog ich den Helm ab. Das aufgeklappte Stilett an ihrem Hals in der Hand eines langhaarigen blonden Mannes, welcher sich erschrocken zu mir umdrehte, ließ mich nicht zögern. Den Überraschungsmoment nutzend, knallte ich ihm den Helm voll auf die Fresse.
Meine Instinkte und die in der Legion antrainierten Reflexe steuerten mich. Nicht denken, sondern handeln und zwar dem Drill entsprechend, sichert die größten Überlebenschancen. So war es mir eingetrichtert worden. Es ist wie Rad fahren oder schwimmen, einmal gelernt, bleibt die Reaktion immer gleich. Kaltblütig, emotionslos, beherrschtes Vorgehen. Ausschalten und/oder das Kontrollieren einer Gefahrenquelle.
Es machte ein knirschendes Geräusch, als sein Nasenbein brach und dunkelrotes Blut über seinen Mund und sein Kinn zu laufen begann.
Tini fand das ganze Szenario nicht prickelnd. Sie konnte ebenfalls deutlich hören, wie die Nase des blonden Messerhelden brach, als mein Helm eine punktgenaue Landung auf ihr machte. Der ließ das Messer fallen und versuchte, seine zertrümmerte Nase vor einem weiteren Hieb zu schützen. Er würgte laut, während ich das Klappmesser wegkickte.
Wütend sah Tini mich an. Für einen kurzen Augenblick befürchtete ich, dass ich in eine Probe für eine Film- oder Theaterszene geplatzt war.
„Seid ihr Vollidioten noch ganz sauber? Jetzt ist Schluss, Dieter, wir sind getrennte Leute. Verpiss dich ganz schnell, bevor du von mir auch noch eine bekommst.“ Sie wandte sich von ihm ab und zeigte auf mich.
„Hier auftauchen und Leute platt kloppen, den, die…“, sie suchte nach dem Wort „Helm“, fand es aber nicht, „ääh, Keule schwingen. Ihr Kerle verhaltet euch alle wie die Neandertaler.“ Sie zitterte vor Aufregung. Woher sie die Sicherheit nahm, dass ihr Ex nicht zugestochen hätte, wusste ich nicht. Sein zuschwellendes Gesicht, die Blutspur von der Küche ins Bad sowie sein Dauergejammer ließen mich jetzt als brutaler Schläger erscheinen. Kaum war ihr Ex notdürftig verarztet und gegangen, beruhigte sie sich glücklicherweise wieder.
“Mit dem Idioten wäre ich auch alleine fertig geworden. Trotzdem danke“, war alles, was sie dazu sagte. Blöd gelaufen für mich, ich wäre gerne ihr Held, ihr strahlender Ritter und Retter gewesen! Anstatt mich abzuknutschen, drückte sie mir einen Feudel und einen leeren Putzeimer in die Hand.
Wir putzen gemeinsam die Sauerei weg. Mir war es ziemlich egal, ob ihr Gitarre spielender Ex-Freund gerade eben die Bullen anrief, um Anzeige gegen mich zu erstatten. Ich schwelgte im Bewusstsein, ihre Nähe zu bekommen und überlegte fieberhaft, wie ich sie für mich nach diesem Fiasko noch gewinnen könne. Sie hatte mich immerhin nicht gleich mit rausgeschmissen. Wie jeder Verliebte suchte ich natürlich nur nach den positiven Signalen.
Hier beginnt sie, die ziemlich durchgeknallte Geschichte, die uns in Radio- und Fernsehstudios, Fünf-Sterne-Hotels, exklusive Beach Ressorts, in die heftigsten Elendsviertel Südostasiens, in Klöster, Guerilla Camps, Ministerien und Botschaften führen sollte.
Tini ließ mich zunächst zappeln. In einem Anfall von Dreistigkeit sagte ich ihr, dass sie und nur sie, die Mutter meiner zukünftigen Kinder werden würde. Unverfrorenheit, gepaart mit Charme, funktioniert nicht immer, bei ihr war es erfreulicherweise, zumindest in diesem Moment, tatsächlich so.
„Wie viele sollen es denn sein?“, fragte sie mit gerunzelter Stirn und deutlich ironisch. Meinem Totalangriff auf ihr Herz traute sie noch nicht so ganz. Zumal ich zu bestimmten Fragen von ihr ausweichend und hinhaltend blieb.
Tinis Lebensgeschichte war ungewöhnlich und eigentlich sollte sie als eigene Geschichte erzählt werden.
Ihre Mutter war mit vierzig Jahren an Krebs gestorben. Solange ihre Mutter lebte, kannte sie ihren biologischen Vater nicht. Sie wusste nicht, wo er wohnte und was er trieb. Sie hatte niemals ein Foto von ihm gesehen und niemals einen Brief oder Kartengruß erhalten. Genau zwei Monate nach dem Tod ihrer Mama meldete er sich zum ersten Mal.
Kurz und gut, er erzählte ihr, er züchte sibirische Tiger im subtropischen Klima der Philippinen. Er lud sie reumütig, mehr noch demütig zu sich ein.
Sonne, Palmen, Strand und Meer findet fast jeder toll. Bei Tini ging dieses Gefühl, dieser Wunschtraum aber tiefer. Seit ihrer Kindheit besaß sie eine tief verwurzelte Sehnsucht nach genau dieser Ecke der Welt. Ein eigenartiges Heimweh nach einem Ort, den sie bewusst noch nie betreten hatte, doch den ihre Seele gut kannte, erfüllte sie. Für sie war das Leben in Südostasien ein Dauer-Déjà-vu. Dort wollte sie sein, nirgendwo sonst. Schon bei ihrem ersten Besuch verliebte sie sich in einer Weise in das Land, dass man glauben mochte, dass sie eine tiefe innere Verbindung zu ihm fühlte. Bei ihrem zweiten Besuch in Manila bot ihr Tiger Jim-Daktari, wie er genannt wurde, an, zu ihm zu ziehen und in seinem Tigeraufzuchtprogramm mitzuarbeiten. Ihr Papa des Herzens war und blieb ihr Stiefvater und der litt unter dem Gedanken, dass sie ans andere Ende der Welt gehen könnte. Tini wusste nicht, was sie tun sollte. Sollte sie ihrem Fernweh folgen oder sollte sie ihrem Papa zuliebe bleiben? Der Wunsch war da und wurde immer stärker!
Bis ich Tini erzählte, wer und was ich bin bzw. war, vergingen einige Tage. Irgendwie verließ mich jedes Mal der Mut, wenn sie darauf zu sprechen kam.
Ausweichend und es bei vagen Andeutungen lassend, versuchte ich mich mehrfach aus der Affäre zu ziehen. Die Angst, sie könnte als recht behütet aufgewachsene junge Frau, gleich wieder das Interesse an mir Gangster verlieren, nährte meine Selbstzweifel. Anlügen wollte ich sie nicht und deshalb drückte ich mich vor Antworten. Irgendwie musste ich aus diesem bescheuerten Dilemma raus und sie half mir dabei.
Am reichlich gedeckten Frühstückstisch, wenige Meter von dem Ort entfernt, wo ich meinem Vorgänger das Nasenbein gebrochen hatte, schaute sie mich aus den Augenwinkeln an. Ohne eine Ankündigung oder Andeutung ließ sie einen Satz ab, der mir Wort für Wort im Gedächtnis haften geblieben ist.
„Also entweder bist du ein Undercover-Polizist, ein Drogenhändler oder irgend so was Seltsames?“ Es war eindeutig eine Frage und keine Feststellung. Dafür, dass Tini nicht einmal wusste, für was die Abkürzung JVA stand, bewies sie einen erstaunlich guten Riecher.
Tini sah in mir etwas, was ich selbst schon lange nicht mehr in mir sehen konnte. Für sie war ich nicht der Söldner, der vorbestrafte Schwerverbrecher, sie sah in mir einen hitzköpfigen, aber liebevollen und zuverlässigen Mann. Einer, der sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Seit vielen Jahren sah mich zum ersten Mal ein Mensch wieder als das, was ich war. Sah durch meinen Schutzpanzer hindurch, als würde er überhaupt nicht existieren.
Die scheuklappenhafte Sichtweise der Knastbürokraten, die mir ihre Anpassungsstrategien als Resozialisierung verkauften, kapierte nicht das Geringste von mir. Die ebenso scherenschnitthafte, romantische Verklärung meiner Vergangenheit, wie sie die Szene und diverse Freundinnen von mir pflegten, wurde mir auch nicht gerecht. Tini gab mir eine Chance, mich selbst wieder zu finden, ich selbst zu sein.
Noch etwas verband uns. Sie wollte unbedingt und ich musste unbedingt weg und so schlug sie mir vor, ihren „Erzeuger“ zu fragen, wie sie ihren biologischen Vater nannte, ob wir gemeinsam in seinem Reservat arbeiten und leben dürften.
„Du meinst als Tigerpfleger?“ Ich war schon halb eingeschlafen, als sie mich in ihre Pläne einweite.
„Ja klar“, riss sie mich endgültig aus meinem Dämmerzustand. Hellwach setzte ich mich auf und blickte sie ungläubig an.
„Du willst mit mir auf die Flucht gehen, verstehe ich dich richtig?“ Sie legte den Kopf zur Seite und sah mich scheinbar grimmig an.
„Falls du Pfeife es noch nicht bemerkt haben solltest. Ich liebe dich, seitdem ich dich die Treppe heraufkommen sah.“ Sie zog die Augenbrauen noch ein wenig enger zusammen. Da wusste ich zwar nicht, was für ein Bösewicht du doch bist, aber ich wusste, dass ich dich lieben werde. Also…“, weiter ließ ich sie nicht kommen, ein langer intensiver Kuss stopfte ihr den Mund. Wir liebten uns, rauchten, tranken Wein, quatschten und liebten uns erneut. Wir schliefen eng aneinander gekuschelt ein, als die Vögel im Soonwald zu zwitschern begannen.
Ihr Erzeuger war schnell angerufen und gab sich mir gegenüber erstaunlich direkt und wohlgesonnen.
Es knisterte und knackte in der Leitung und nachdem Tini kurz mit ihm gesprochen hatte, reichte sie mir den Hörer weiter und nickte mir aufmunternd zu.
„Meine Tochter scheint mit dir den Mann ihres Lebens gefunden zu haben. Sag mal, meinst du es ernst mit meinem Kind?“
Dafür, dass er Tini kaum und mich gar nicht kannte, kam er ziemlich schnell auf den Punkt.
„Falls du es nämlich ernst meinst, dann steht dir mein Haus offen, Junge.“ Bevor ich auch nur drei Sätze zu meiner Person sagte, machte er sich zu meinem Schwiegervater.
„Nenne mich Jim“, bot er mir an. „Für einen cleveren Kerl, wie du einer zu sein scheinst, findet sich bei mir auch noch ein Job.“ Mir ging dies alles etwas zu schnell. Um wirklich misstrauisch zu werden, fühlte ich mich allerdings zu sehr geschmeichelt. Mein schwacher Punkt.
Das Leben auf der Flucht bekam mehr und mehr geheimnisvolle Züge. Da war ich aus dem Knast abgehauen, verliebte mich in ein Mädel vom Lande und nun so was.
An echte Papiere heranzukommen war damals eigentlich kein Problem. Gefälschte Dokumente waren mir zu teuer, selten wirklich gut und in diesen Kreisen wimmelt es von Spitzeln der Polizei. Wesentlich leichter war es auf dem legalen Weg. Beim Standesamt Wiesbaden bekam ich eine beglaubigte Geburtsurkunde, ausgestellt auf den Namen meines besten Freundes. Mit der ging ich zur Einwohnermeldebehörde, erklärte alle Papiere wären verloren gegangen und ich bräuchte dringend neue. Eine Verlust- bzw. Diebstahlsanzeige später, neue Fotos abgeliefert, fertig. Das Risiko war minimal und überschaubar. Nur wenn mein Freund, mit dessen Daten ich reiste, überprüft würde, würde der Schwindel auffallen. Schnelligkeit war also der entscheidende Faktor. Innerhalb von wenigen Wochen besaß ich einen kompletten Satz an echten, falschen Dokumenten. Personalausweis, Führerschein, Reisepass, sogar Impfbuch und Visitenkarten. Ich hieß jetzt David Valentin und war 34 Jahre alt. Von Beruf war ich Programmierer, nicht verheiratet, keine Kinder. Es fühlte sich absolut fremdartig an, nicht mehr zu heißen, wie man hieß. Dies war mir schon in der Legion unangenehm gewesen. Meine innere Identität bestand allerdings nicht aus den Daten, die ich zurückließ. Sie gehören zu einem Menschen und sagen doch nichts aus. Trotzdem dauerte es einige Tage, bis ich mich an meine neue Legende gewöhnte und ich sogar den Mädchennamen meiner angeblichen Mutter ohne zu zögern aufsagen konnte.
Damals
Tiger Jim-Daktari hatte viele Namen. Jim war keiner davon! Geboren war er 1950 als zweites Kind der Eheleute Schmied unter dem Namen Jürgen Franz in der Nähe von Mainz. Jürgen war von Natur aus zu kurz geraden und durch das Leben zu kurz gekommen, fand er zumindest. In seiner Kindheit war er die bevorzugte Zielscheibe von Hohn und Spott der Gleichaltrigen. Wurden beim Sport Mannschaften gewählt, war er immer der Letzte, der ins Aufgebot kam.
In seiner Jugend lernte er, dass die Mädels ihn ignorierten und Größe eben doch eine Rolle spielte. Jürgen war mit seinen limitierten körperlichen Attributen keine Konkurrenz für niemanden. Er streifte durch die rheinhessische Provinz und durch die benachbarte Rhein/Nahe Region. Immer auf der Suche nach Liebe. Aufmerksamkeit bekam er, wenn er zu reden begann. Mit seiner blumigen Ausdrucksweise verstand er zu überzeugen und recht schnell wusste er diese Gabe zu versilbern. Er brach seine Lehre als Schreiner ab und begann als Drücker Zeitungen zu verticken. Sein gutes Gespür für den „wunden Punkt“ von Menschen machte ihn schnell erfolgreich. Kaum ein Tag, an dem er weniger als 100,00 DM einnahm, was damals wirklich eine Menge Kohle war. Als erstes legte er sich eine Isetta und schon ein Jahr später einen Borgward zu. Einen nicht geringen Teil seiner Einnahmen trug er zum Schuster ins benachbarte Hechtsheim. Der schusterte ihm Schuhwerk mit verdeckten Absätzen, welches ihn zehn Zentimeter größer erscheinen ließ. Die damals modischen Hosen mit weitem Schlag halfen dabei seine psycho-orthopädischen Treter komplett zu kaschieren.
Alles hätte gut sein können, wenn Jürgen sich nicht selbst im Weg stünde. Seine vorgetäuschten 1,68 Meter waren nicht wirklich groß, nicht für einen wie ihn. Jürgen wollte nicht länger das Opfer von Missachtung sein und schon gar nicht wollte er übersehen werden. Man würde eines Tages zu ihm in Ehrfurcht aufsehen und würde man ihn nicht anbeten, würde man ihn eben fürchten.
Was er nicht freiwillig und aus Hingabe bekam, kaufte er sich z. B. bei Nutten, und weil dies nicht wirklich befriedigend war, mampfte er sich täglich mehr voll. Während sein Bauchumfang wuchs, fielen ihm langsam die Haare aus. Er war wirklich keine Schönheit. Männlich war eindeutig anders, doch darauf wäre es nicht angekommen. Er besaß nämlich eine Gabe, die ihn deutlich von den meisten Männern unterschied, doch die hatte er noch nicht entdeckt. Jürgen hätte einfach nur ein liebenswürdiger Mann sein müssen, um gemocht zu werden, aber dieser Zug war längst abgefahren. Die einzigen Menschen, die ihn nahmen wie er war, waren seine Mutter und seine Schwester. Durfte man ihn bisher bedauern, vielleicht sogar bemitleiden, weil man verstehen kann, dass ständige Zurückweisung schmerzlich ist. So sehr begann er nun, es „allen denen heimzuzahlen“, wie er es rechtfertigte, die ihn überragten.
In Odernheim war Kirmes. In diesem kleinen Ort in der Nähe von Bad Kreuznach war Jürgen kein Unbekannter. Ihm fiel eine ausgesprochen hübsche Frau auf. Sie amüsierte sich mit ihren Freundinnen und wartete, bis man sie zum Tanz aufforderte. An der Theke ersoffen zwei Burschen ihren Frust, weil sie sich von ihr eine Abfuhr holten.
„Habt euch wohl einen Korb geholt, was, Jungs.“, spöttelte er.
„Aber du hast bei der eine Chance.“, kam es gereizt zurück. „Das ist die Tochter vom Sobernheimer Wachtmeister, die lässt keinen ran.“, ergänzte er noch. Jürgen streckte sich auf dem Barhocker. Er saß sowieso meistens, weil dies sein Größenproblem am besten tarnte.
„Klar kriege ich die, wenn ich dies will. Wetten?“
„Einen Kasten Bier dagegen.“, mischte sich der zweite Abgeblitzte erstmals ein. Jürgen schüttelte gelangweilt den Kopf.
„Eine Flasche Whisky von jedem und wir sind im Geschäft.“
Die Wette galt.
Bei einem Blumenhändler kaufte er alle Rosen auf und ließ sie vom Kellner zusammen mit einem Glas Sekt überreichen. Als Erika mit ihm morgens um zwei die Kirmes verließ und in seinen Borgward stieg, hatte sie kräftig einen sitzen. Was vor allem am reichlichen Wodka in ihrer Afri-Cola lag, den er mit einem Augenzwinkern und der Unterstützung von reichlich Trinkgeld heimlich beim Ober dazu bestellte. Nicht nur Jürgen war, auch Wodka ist geschmacklos!
Ihr Widerstand fiel geringer aus, als er erwartete, denn die junge Kindergärtnerin war Alkohol schlicht nicht gewohnt. In dieser Nacht wurde Tini gezeugt.
Am Freitag darauf kassierte er seine Siegprämien.
Jim war in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben.
Ein UPS-Bote brachte eine Paketsendung mit einer Unmenge an Fotos, Diplomen, Ehrungen und Zertifikaten. Tiger Jim-Daktari gemeinsam mit Weltstars und Prominenz aus allen Bereichen des Lebens. Vor allem ließ er sich gerne mit den Mächtigen und Reichen des südostasiatischen Pazifikstaates auf unzähligen Fotos ablichten. Diese Bilder und Dokumente gaben ein Bild von einem respektablen Tierschützer ab. Ich fühlte mich ziemlich beschissen ihm gegenüber und fand schlicht nicht den richtigen Zeitpunkt, ihm etwas über meine Vergangenheit zu erzählen.
„Pass auf, mein Junge“, er war völlig enthusiastisch, „ich habe eine Idee. Wenn du in Deutschland die Werbetrommel für unser neues Tierparkkonzept rührst und sagen wir, hunderttausend Mark dabei herauskommen, bist du dabei.“ Mir leuchtete ein, dass der Wildlifepark Geld brauchte. Natürlich hatte er recht damit, dass wir es in Deutschland versuchen sollten, welches zu beschaffen. Einhunderttausend hatte ich allerdings nicht. Selbst der Rest aus der Beute war nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Anstatt ihn aufzuklären und ihn von der Unmöglichkeit der Realisierung seines Wunsches zu informieren, stimmte ich idiotischerweise zu.
Wenige Tage später kam wieder eine schwere Expresssendung aus Manila an.
Jim war der Vorsitzende einer Foundation, die tausend Hektar Land knapp zwei Autostunden nördlich von Manila besaß. Seine Idee, dort einen kommerziellen Wildlifepark zu gründen. Betuchte Investoren sollten die Möglichkeit haben, in abgetrennten Bereichen des Reservates eine komfortable Nippahütte zu kaufen oder zu mieten. Auge in Auge mit der Großkatze sozusagen. Mit diesen und den weiteren Einahmen aus Hotelvermietungen und Serviceangeboten könne die Anlage profitabel wirtschaften, rechnete er vor. Tini und ich bekämen ein Gehalt und könnten uns fortpflanzen, damit er bald Opa würde.
Es war an der Zeit, ihn über mich aufzuklären.
Obwohl ich ihn bei meiner „Beichte“ nicht sehen konnte, kam es mir so vor, als würde sie ihn nicht überraschen und als könnte ich sein virtuelles Grinsen wahrnehmen. Solange ich anständig mit seiner Tochter umginge, wäre dies für ihn alles Schnee von gestern. Das ein gesuchter Knacki nicht einfach mal aus dem Nichts eine Werbekampagne starten kann, nannte er lachend eine „echte Herausforderung“.
Tini blieb ziemlich gespalten in ihrer Haltung Tiger Jim gegenüber. Ihre Mutter war ihren kindlichen Fragen nach ihrem Vater meistens ausgewichen. Falls sie doch einmal etwas sagte, dann blieb es bei dunklen Andeutungen.
Sie selbst hatte ihn bei ihren Besuchen in Manila als einen leicht meschuggen und skurrilen Doktor Doolittle kennengelernt. Alle Arten von Tieren, sogar Reptilien, schienen ihn zu lieben. In seinen Safariklamotten und Schuhen mit zehn Zentimeter hohen Absätzen war er ein landesweit bekanntes Original. Er war der Mann, der mit den Tigern sprach.
Ihre Mutter konnte sie nicht mehr fragen und mit diesem Widerspruch konfrontieren. So entschied sie, dass die Konflikte ihrer Eltern nicht ihr Bier waren. Richtig nahe fühlte sie sich Jim allerdings nicht, dazu war er ihr etwas zu selbstverliebt.
Dabei versuchte er auf seine wunderliche Art, ihre Liebe zu gewinnen. Er ließ sie mit großer Polizeieskorte wie einen Staatsgast vom Flughafen abholen. Jim organisierte Treffen mit Ministern und Senatoren oder lud Filmstars zum gemeinsamen Dinner ein. Sie traf den Chef der größten philippinischen Airline, bekam Gratistickets für Inlandsflüge geschenkt und begleitete ihren Vater zu Talkshows ins TV. Dass er den ganz großen Auftritt liebte, war nicht zu übersehen. Für sie war er nur ein seltsamer Vogel, etwas eigen, ziemlich schräg, leicht chaotisch und kapriziös.
„Der hat einfach zu lange alleine gelebt“, sagte sie mir.
Die wenigen Wochen, welche sie miteinander verbrachten, waren voller absurder Erlebnisse gewesen. Als sie mir erzählte, dass er ein Toupet trage und er „seine“ Haare „Hut“ nannte und ihn ohne diese Kopfbedeckung keiner sehen durfte, krümmte ich mich vor lachen. Einmal drehte er völlig durch, als sie ihn vor dem Bad ohne seine haarige Kappe überraschte. Mit einem winzig kleinen Handtuch versuchte er abwechselnd seine Blößen und seinen Kopf zu bedecken. Zeternd lief er in sein Schlafzimmer und verbat ihr, jemals wieder irgendwo aufzutauchen, wo er ohne „Hut“ wäre.
Jeder hat seine Macken, bei ihm waren die Marotten eben etwas ausgeprägter.
Selbst seinen Hang zu Nutten zu gehen, verstand er ihr gegenüber noch zu romantisieren. Er habe in seinem ganzen Leben nur ihre Mutter geliebt. Weil er sich als komischer Kauz präsentierte, stellte sie in jenen Tagen auch dies nicht in Frage. Seine Briefe waren erheiternd und unfreiwillig komisch. So schrieb er: „Mein God, Vater ist der Bürgermeister von Manila.“ Natürlich war sein Vater nicht der Gemeindevorsteher von der City of Manila. Er meinte den Godfather, also einen Taufpaten, aber auch dies stimmte natürlich nicht. Wie nichts stimmte, was er seiner Tochter erzählte. Als sie ihn darauf ansprach, berichtete er ihr von einer wilden Geschichte, wie er den Bürgermeister bei einem Attentatsversuch gerettet habe. Der habe ihn deshalb quasi adoptiert, dies wäre so üblich auf den Philippinen. Das Jürgen Franz ein notorischer Lügner sein könnte, wäre meiner Freundin im Traum nicht eingefallen. Was immer zwischen ihrer Mama und ihm gewesen war, sie glaubte an das Gute im Menschen und dass jeder Mensch sich ändern kann.
Dass ihr Erzeuger gut mit Tieren konnte, reichte ihr als Charakterzeugnis aus. Seine Tiger liebten ihn geradezu, sobald sie ihn sahen, schnurrten sie und suchten seine Nähe. Verrückterweise schien sie diese Gabe auch zu besitzen und so schloss sie von sich auf ihren biologischen Vater. Sein guter Kern war eben für Menschen nicht so leicht zu erkennen, die nicht ungefährlichen Großkatzen sahen diesen wohl besser, dessen war sie sicher.
Der Plan
Die mir gestellte Aufgabe schien unlösbar! Keine Kohle, keine Kontakte und keinen blassen Schimmer davon, wie ich Werbung für dieses Projekt machen könnte. Etwas wenig, um nicht zu sagen nichts, was mich weiterbrachte. Alles, was ich besaß, waren seine Unterlagen und die Begeisterung meiner Süßen. Sie erstaunte mich immer wieder. Die Welt, in der ich lange genug lebte, kannte sie nur aus Filmen und Büchern. Wobei sie die Milieustudien der Profischreiberlinge oft genug für bare Münze nahm. Ein Krimi war für sie gut, wenn der ermittelnde Bulle besonders neurotisch, ein Trinker oder sonst ein Maniac war. Nach der Realschule hatte sie sich für eine Ausbildung zur Physiotherapeutin entschieden und sie mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie war eine lebenshungrige, neugierige und mitfühlende junge Frau. Wie die meisten Frauen besaß sie den unbedingten Willen etwas umzusetzen, wenn sie es sich einmal vornahm.
Wir stellten zunächst eine Mappe aus großformatigen Fotos, Plänen und seinen Auszeichnungen zusammen. Fast sechs Monate waren wir nun ein Paar und wussten eigentlich nicht weiter, außer eines, wir wollten nach Asien.
Karma, Glück, keine Ahnung wie ich es nennen soll, aber uns würde in den kommenden Jahren, wann immer wir uns in schier aussichtslosen Situationen glaubten, der Zufall oder ein abgefahrenes Schicksal zur Hilfe kommen.
Neben ihrer Arbeit in einer Reha-Klinik jobbte Tini jedes Wochenende an der Bar in einer Mainzer Großdiskothek. Der Laden suchte einen Türsteher. Ich konnte freundlich und falls notwendig auch grimmig gucken. Meine Autorität schien auszureichen und so bekam ich den Job. Da ich es auch noch hinbekam, einigermaßen intelligenten Smalltalk zu führen, machte man mich schon am dritten Abend zur Security in der VIP Lounge. Wenn ich mich im Spiegel betrachtete, musste ich grinsen. Lange Dreadlocks auf dem Kopf, brauner Teint und Man-in-Black-Outfit. Die Schickeria und die Halbweltgrößen, die hier verkehrten, waren zwar nicht meine Welt, doch für 200 Mark am Abend konnte ich deren prolliges Gehabe gut ignorieren. Typen, die in einer Disco für eine Pulle Billigfusel einen Hunderter zahlten, um den billigen, aber teuren Bräuten zu imponieren, waren für mich dämliche Schaumschläger. Tussis, die sich davon beeindrucken ließen, gehörten der Kategorie doofe Schlampen an. Die Gage war deshalb eine Art Schmerzensgeld für mich. Wenn diese unterirdischen „VIP“-Spinner sich das Hirn wegkoksen oder im Separee eine schnelle Nummer mit irgendeinem Flittchen brauchten, dann schaute man eben weg und denkt sich seinen Teil, war meine Devise.
Es war einer dieser Abende, an denen alles schief lief, was schief laufen konnte. Zunächst wurde eines der Barmädchen an der Cocktailbar von einem mittelblonden Bodybuilder angegriffen. Ein südländischer Mann versuchte ein Messer mit in den Laden zu schmuggeln und ein russischstämmiger Typ versuchte mit den Taschen voller Pillen in den Laden zu kommen. So ging es munter weiter.
Ein Mann, um die sechzig Jahre, wurde vom Geschäftsführer persönlich in die Lounge gebracht. In seinem grauen Geschäftsdress wirkte der distinguierte Herr etwas deplatziert in diesem Laden.
Bei sich hatte er ein Küken von vielleicht 18 oder 19 Jahren, wenn sie nicht tatsächlich erst 17 war. Sie zogen, nach dem ihnen Schampus und Erdnüsse geliefert wurden, hinter sich den schweren Bühnenvorhang des Separee zu. Mein Job war es, dafür zu sorgen, dass sie dort ungestört blieben. Eine Stunde später erhielt ich über meinen Funkempfänger im Ohr die Anweisung, den Gast samt Frischfleisch zu seinem Wagen auf den Parkplatz zu begleiten.
Ihnen einen Weg durch die verschwitzte und angetrunkene Meute zu bahnen, war kein Problem, sondern Routine geworden. An der Gardarobe bemerkte ich einen jungen Mann. Er starrte den alten Lüstling hasserfüllt an. Knast schärft die Sinne. Man wittert die Gefahr, bevor man sie sieht.
Seine Körperhaltung, der Blick, die Anspannung, da knallt es gleich, ahnte ich. Bevor ich jedoch meinen ersten Eindruck in Abwehr umsetzen konnte, passierte es auch schon. So muss sich ein Personenschützer fühlen, wenn er merkt, dass er einen halben Schritt zu weit von seiner Schutzperson entfernt steht. Den unmittelbaren Angriff konnte ich zwar nicht mehr unterbinden, doch dem zweiten Schlag konnte ich gerade noch zuvorkommen. Schreie, Gedränge in der Lobby. Irgendwie schaffte ich es, den Heißsporn zu Boden zu werfen und ihn im Schwitzkasten zu halten. Im nächsten Moment waren die Kollegen zur Stelle und nahmen mir den wild um sich tretenden jugendlichen Irren ab. Offensichtlich schien er eigene Ansprüche auf die Kleine zu haben, die ihn ihrerseits hysterisch anschrie.
Das Opfer stellte sich als Bernd Tobal, ein Kölner Fernsehproduzent vor. Er wollte keine Anzeige erstatten und alles diskret behandelt wissen. Kein Wunder, er trug einen Ehering, die Kleine nicht und wie seine Tochter sah sie auch nicht aus. Mir war es recht. Während ich im Büro seinen Kratzer auf der Stirn behandelte, erzählte ich ihm von den Plänen, die Tini und ich hätten. Er hörte nicht nur zu, er stellte mir auch Fragen.
Als die Kollegen an der Türe sicher waren, dass wir ihn und das Mädchen ohne weitere Störung zu seinem Wagen bringen konnten, eskortierten wir sie zum Parkplatz.
„Versprechen kann ich nichts, aber ruf doch mal diese Leute hier an, sag ihnen, du hättest die Nummer von mir. Sie sollen sich mal deine Story anhören.“ Er gab mir seine Karte und kritzelte fünf Namen und Telefonnummern auf ein Stück Papier. Bevor er einstieg, schob er mir zwei Fünfziger in die Reverstasche.
Tobal schien einen guten Ruf unter seinen Kollegen zu haben. Wo immer ich anrief, man hörte sich geduldig an, was ich erzählte. Nach dem dritten Telefonat verstand ich, dass das Fernsehgeschäft mit Fakten und Tatsachen nichts anzufangen wusste. Die exklusive Story und gute Bilder waren wichtiger. Eine Geschäftsidee, gepaart mit Tierschutzaspekten interessierte kein Schwein.
Redakteure können großzügig sein, so sie eine Geschichte nicht selbst verwerten. Neue Nummern, neue Namen, andere Sender und Verlage, immer verbunden mit dem Satz „Grüß mir den und den und die und die, viel Glück.“
Tini packte die Koffer. Ihr One-Way-Flug nach Manila war gebucht und bestätigt. Gegen fünf Uhr waren wir am Morgen ihres Abfluges eingeschlafen, um neun klingelte wieder der Wecker. Als der Flieger von Philippine Airlines in Frankfurt abhob, stand ich auf der Besucherterrasse, sah ihm hinterher, selbst nicht an meine Worte des Abschieds glaubend.
„In spätestens acht Wochen bin ich bei dir, egal was passiert.“ Manila schien unendlich viel weiter weg zu sein in diesem Moment als nur achtzehn Flugstunden.
Kurz vor Tinis Abreise waren wir in eine Polizeikontrolle geraten. Mein echter/falscher Führerschein funktionierte. Das ziemlich mulmige Gefühl in meiner Magengegend habe ich allerdings noch deutlich in Erinnerung, als der Uniformierte mich aufforderte auszusteigen und mir befahl, hinter den Kofferraum zu treten. Er sah mich dabei viel zu dienstlich für meinen Geschmack an. Die Tatsache, dass er und seine Kollegin mit der Hand nicht am Ballermann waren, entkrampfte mich ein wenig. Erleichtert nahm ich die Mängelanzeige über das defekte rechte Bremslicht entgegen und ließ mich einsichtig über meine Pflichten als Autofahrer belehren. Mein falscher-Ort-falsche-Zeit-Ansatz bekam mehr und mehr Risse. Glück und gute Ausweise alleine würden mir sicherlich nicht endlos zu Verfügung stehen. Mit den zwei Monaten bis zu meiner Ankunft, die ich Tini versprach, wollte ich mich selbst unter Druck setzen, auch wenn ich es für aussichtslos hielt, dass ich bis dahin tatsächlich genug Geld für Jims Projekt organisieren könnte.
Tinis Wohnung war aufgelöst. Dies verkomplizierte meinen telefonischen Werbefeldzug. Es schien unmöglich, auch nur einen einzigen Zeitungsredakteur eines x-beliebigen Provinzblattes für das Konzept so zu begeistern, dass er darüber schrieb. Nun hockte ich in einem 76er VW Bus, welchen wir zu einem Campingbus ausgebaut hatten und wusste nicht mehr weiter. „Wenn du nichts zu verlieren hast, dann verliere das Nichts“, würde in einigen Jahren ein buddhistischer Mönch zu mir sagen. Wäre man mir in jenem Augenblick mit diesem Satz gekommen, mein verständnisloses Gesicht hätte mich sofort als ignoranter Trottel entlarvt. Was machte ich falsch bzw. was machte ich nicht richtig?
Über die Abfahrt Schwabing kam ich in der bayrischen Landeshauptstadt an. Ein tiefes Rot färbte den Abendhimmel, nach der Hitze des Tages kühlte es nur langsam ab. Da die ganze Telefonaktion nichts brachte, versuchte ich es nun persönlich. Das brachte schlagartig mehr Erfolg, die Film- und TV-Bräute bekamen einen Silberblick bei meinem Anblick und ich nutzte ihr wuschiges Balzverhalten für meine Zwecke.
Mehrere Pressetermine waren vereinbart und am kommenden Tag war ich bei der Produktion „In der Wildnis“ von Starshoot TV eingeladen. In einer Seitenstraße des ehemaligen Münchner Künstlerviertels fand ich den letzten Parkplatz und ging ziemlich komfortabel und genauso pessimistisch in meinem Campingbus pennen.
„Mein Name ist David Valentin, ich habe einen Termin.“ Der Pförtner musterte mich, verglich meine Ansage mit einer Liste und meldete mich in der Redaktion der „In der Wildnis“ Show an und erklärte mir dann den Weg.
Schnell war mein angeblicher Background erzählt. Ich wäre nach dem Abitur zur Kripo gegangen und Bulle bei der Frankfurter Sitte gewesen. Der Liebe wegen habe ich den Dienst quittiert, um mit meiner Frau Tini nach Asien zu gehen. Dort würden wir mit Jim zusammen Raubkatzen schützen. Dass diese frei erfundene Geschichte funktionierte, hatte ich natürlich gehofft. Dass sie eine derartige Wirkung bekam, wie sie es dann tat, damit rechnete ich allerdings nicht. Zweifel schien es keine mehr zu geben, die Story hatte das, was Medienmenschen lieben. Crime, Love und exotische Tiere.
Leichte Bedenken ließen sich schnell zerstreuen. Warum ich auf keinem der vielen Fotos auftauchte, erklärte ich damit, dass ich der Fotograf gewesen bin und auch nicht so wichtig sei. Vergleichsweise verhielt es sich bei anderen Journalisten, irgendwie neigt man in der Branche dazu, voneinander abzuschreiben und nichts mehr zu prüfen. Tiger Jim bestätigte meine Identität und meinen Auftrag gegenüber der „Starshoot“ Fernsehproduktion. Das philippinische Konsulat bestätigte die Existenz der Tierschutzorganisation, der die gesamte politische Elite des Landes angehörte, sowie die Echtheit der vorgelegten Dokumente. Den Rest glaubte man mir unbesehen und ungeprüft. Das war einfacher, als ich dachte.
Jetzt ging alles wie von alleine, die Medienmaschine übernahm die Regie und ich wurde zum Rädchen in ihrem Getriebe.
Damals
Als Erika klar wurde, dass sie ein Kind bekam, wurde hastig die Hochzeit geplant. Sie war hochschwanger und ihr Bauch symbolisierte diese Mussehe schon überdeutlich. Sie war kreuzunglücklich mit Jürgen. Es war weder seine geringe Größe noch das lichter werdende Haar und auch mit seiner Wampe hätte sie zur Not leben können, es war seine Art, die sie abstieß. In seinen Geschichten war er immer der mutige Haudegen, der Grandiose, der Beste, der Allergrößte eben. Nichts war ihm unmöglich. Erika konnte seine Storys schon nicht mehr hören, als Tini geboren wurde. Nach der Geburt verweigerte sie sich Jürgen immer öfter. Zunächst mit Notlügen und dann mit noch mehr Notlügen. Als er sich nahm, was ihm als sein eheliches Recht zustand, wie er es nannte, zog Erika mit Tini wieder zu ihren Eltern. Als Dorfbulle fackelte Erikas Vater nicht lange und warf ihn ziemlich unsanft aus dem Haus, als sein Schwiegersohn bei ihnen auftauchte. Jürgens Schuldbewusstsein hielt sich in engen Grenzen.
Die rheinland-pfälzische Diaspora wurde ihm jetzt zu klein. Jürgen zog es nach Mainz, wo vergleichsweise der Bär steppte. Im Rotlichtmilieu wurde er zunächst als sehr großzügiger Freier, mehr und mehr auch als exzellenter Hehler bekannt. Er kaufte und verkaufte heiße Ware, die er im Gangsterjargon „Schore“ nannte. Auch die sehr begehrten Artikel aus den PX Stores der amerikanischen Besatzer konnte Jürgen in jeder gewünschten Menge besorgen. Die lokalen Zuhälterbosse waren seine unerreichten Vorbilder. Wie die mit Frauen und ihren Gegnern umgingen, imponierte ihm. Jürgen genoss es, wenn die Halbweltgrößen ihn in die Separees holten, um bei ihm Amikippen oder unverzollte Spirituosen zu bestellen. Vor allem eine kleine Gruppe von belgischen Luden beeindruckte ihn nachhaltig. Einer von ihnen besaß einen zahmen Gepard. Das Tier hörte auf den Namen James und zeigte ungewöhnlich viel Vertrauen ihm gegenüber. Was dem Zuhälter aus Belgien besonders imponierte.
Seine Geschäfte liefen eine Zeit lang sehr gut, bis ihm die amerikanische Militärpolizei dann doch auf die Schliche kam. Die deutsche Zoll- und Steuerfahndung besorgte den Rest. Bei einer oberflächlichen Hausdurchsuchung fanden sie siebzehntausend Mark und viertausend US Dollar. Kistenweise Lucky Strikes und Kartons voller Jim-Beam-Flaschen wurden beschlagnahmt. Er kam für zwei Wochen in die Mainzer Untersuchungshaftanstalt und wurde, nachdem er auspackte und seine Rotlichtkundschaft verpfiff, für dieses Geständnis mit seiner Entlassung belohnt.
Er würde bestimmt nicht bis zum Gerichtstermin warten, soviel stand für ihn fest. Zwei oder drei Jahre im Knast würde er nicht aushalten und wie das Milieu auf seinen Verrat reagierte, konnte er sich nur zu gut vorstellen.
Jürgen hatte auch deshalb so gründlich ausgepackt, weil die Bullen einen Schließfachschlüssel übersahen, der sich im Spülkasten seines Klos befand. Bevor seine Wohnung gekündigt wurde, musste er ihn wieder haben. Mit seiner Hilfe holte er sich die im Banktresor versteckten 15.000 US$ und plante seine Flucht.
Nur seine Schwester Evelyn einweihend, verschwand er, ohne einen Gedanken an seine Tochter 1967 aus Deutschland. Da Jürgen nicht der Typ für die Fremdenlegion war, suchte er sich gezielt ein Land aus, welches a.) weit weg und b.) mit Deutschland kein Auslieferungsabkommen besaß. Zunächst fand er Thailand!
Im TV
Gaby Ullmann gehörte zu den bekanntesten Personen Deutschlands. Sie war mit ihrer Rolle als Moderatorin der Show nicht wirklich zufrieden. Sie weigerte sich, nicht ganz unbegründet, irgendwelche kindischen Texte vom Teleprompter abzulesen und nur die Fragen zu stellen, die ihr die Redaktion vorschrieb.
„Wer schreibt diesen Quatsch? Das ist doch kompletter Mist! Solche Sätze nimmt mir keiner ab, so rede ich doch einfach nicht.“ Wütend warf sie das Manuskript vor sich auf den Schreibtisch, als wir das Büro betraten. Die schlaksige Produzentin der Show schien dankbar dafür zu sein, dass ihre Assistentin und ich eingetreten waren.
„Lass uns gleich noch mal darüber reden, ich möchte dir deinen Studiogast David vorstellen.“ Meine grünen Augen produzierten Sternchen, als sie mich begrüßte. Flirten funktioniert immer, solange man es nicht zu offensichtlich betreibt und charmant dabei bleibt. Frau Ullmann war begeistert von meiner Erzählung und mächtig gerührt dazu. Der Teil, wo ich meinen angeblichen Polizeijob an den Nagel hängte, um zu meiner Frau zu ziehen, ergriff sie am meisten. Das ich mir dabei mies und verlogen vorkam, durfte ich mir nicht anmerken lassen. Es klappte wieder besser als erwartet.
Gaby Ullmann besaß keinerlei Starallüren. Sie wirkte genauso natürlich, wie sie es in den Filmrollen war, welche sie im deutschen Fernsehen bevorzugt spielte.
„Was hältst du von diesem Text, David?“ Ich überflog die Zeilen und antwortete ausnahmsweise ehrlich.
„Das hört sich zu gestelzt und aufgesetzt an…“, ich biss mir auf die Lippen.
„Sehen Sie…“, Frau Ullmann siezte die Produktionschefin und duzte mich, fiel mir auf.
Sie und die Produzentin einigten sich darauf, dass sie die Einspieler nach der redaktionellen Vorlage moderieren und mich dafür interviewen konnte, wie sie es wollte. Die Sendung versprach eine gute Quote. Gaby Ullmann willigte schließlich widerwillig ein.
Am Abend vor der Aufzeichnung ging mir der Arsch auf Grundeis. Innerhalb von wenigen Tagen war ich durch verschiedene lokale Radiostationen gereicht worden, um Werbung für die Sendung und die Foundation zu machen. Mein exotisches Aussehen und mein scheinbar lässiges Auftreten sowie eine Begabung für flüssiges Sprechen ohne Ähs und Ähms halfen. Wer etwas Außergewöhnliches tut bzw. es zu tun vorgibt, mit dem schmückt man sich gerne oder widmet ihm Aufmerksamkeit. Als hätte ich zu allem und jedem was zu sagen, wurde ich auch zu Sendungen eingeladen, die sich u. a. mit dem wichtigen Thema beschäftigten: „Wie hässlich darf ein Mann sein?“ So was muss man nicht diskutieren, aber wenn es half, Geld für die Foundation zu sammeln, gab ich meinen Senf auch dazu. Dieser Fokus auf mich war mir nicht halb so angenehm, wie ich vorgab. Mein Körper reagierte in einer Weise, der zwar nicht das berühmte Fass, aber mein Campingklo fast zum Überlaufen brachte. Ich schüttete einige Jack Daniels herunter und versuchte einzuschlafen. Den Fahrzeughimmel anstarrend, grübelte ich mich in eine melancholische Stimmung hinein. Rechtfertigte mein Wunsch nach Freiheit meine Lügen und Betrügereien? Ich war nicht sicher und fand auch kein Argument, welches mir aus dieser Patsche hätte helfen können.
Erschöpft fiel ich eine kleine Ewigkeit später in einen unruhigen Schlaf, der nur wirre Träume erzeugte und mich völlig unausgeschlafen am nächsten Morgen mit einem Kater aufwachen ließ.
In der Schelling-/Ecke Türkenstraße fand ich eine ausreichend große Lücke für mein fahrbares Domizil. Mit meinen letzten Wasserreserven wusch ich mich mehr notdürftig als richtig. Da man mir im Vorgespräch nahelegte, dass ich mir einen Dreitagebart stehen lassen sollte, brauchte ich mich nicht zu rasieren. Zum Frühstück rauchte ich eine halbe Packung Reval und gurgelte mit einem dreifachen Whisky.
An diesem Tag sollten sechs Folgen der „In der Wildnis“ Show abgedreht werden. Drehbeginn neun Uhr. Über eine Rampe kam ich ins Studio. In der linken Ecke des Raumes war ein Wohnzimmer aufgebaut. Sieht man Studiokulissen aus der Nähe, kann man sich kaum vorstellen, dass sie im Fernsehen realistisch und echt wirken. Aus einer Küche, die sich neben der Kulisse befand, konnte man Geschirr und Besteck klappern hören. Zum ersten Mal erlebte ich, dass die ganze Dreherei zu 95% aus Warten bestand. Die Regisseurin stellte sich vor und erklärte, dass ich auf keinen Fall direkt in die Kamera schauen sollte. Plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Tontechniker verkabelten mich, irgendjemand puderte mein Gesicht und natürlich wurde ich wieder gefragt, ob meine Haare echt wären. Was ich mit einem freundlichen Nicken bejahte, obwohl mich diese dämliche Fragerei nach meinen Haaren langsam mächtig nervte.
Zum Abhauen war es zu spät. Die Geister, die ich rief, fingen zu spuken an.
„Fertig. Achtung und Ruhe bitte am Set“, tönte es aus der Dunkelheit, jenseits der grellen Scheinwerfer wurde es still.
„Und bitte.“





























