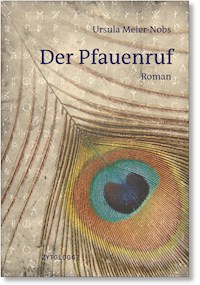
29,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oberitalien, 13. Jahrhundert: Seit Generationen ist das kleinwüchsige Volk der Veneter, das über jahrhundertealtes Bergbauwissen verfügt, im Auftrag des Dogen von Venedig auf der Suche nach Boden- schätzen, dies geheim und oft in fremden Territorien. Abgeschieden von der Welt führen die Bergleute ein Leben im Verborge- nen und verkehren nur über normalwüchsige Mittelsmänner mit der Aussenwelt. Um sie herum toben die guelfisch-ghibellinischen Machtkämpfe, die Städte und Land verwüsten. Inmitten der Kriegswirren treffen der zwergenhafte Gaukler Giorgio und die kleinwüchsige Adelige Lydia aufeinander – und werden sogleich wieder auseinandergerissen. Giorgio wird nach langem Umherirren von den Venetern halbtot im Gebirge aufgefunden und nach einer harten Aufnahmeprüfung als einer der ihren angenommen. Lydia muss sich den Befehlen des Markgrafen Azzo VII d'Este beugen, dessen illegitime Tochter sie ist. Sie wird zwangsverheiratet und gerät Jahre später in höchste Gefahr. Das Schicksal führt Giorgio erneut in ihre Nähe. Er setzt alles daran, sie zu retten. Vor historischem Hintergrund siedelt Ursula Meier eine faszinierende Geschichte an, eine unmögliche Liebe, die sich über Standesgrenzen hinwegsetzt. Kleine Menschen am Rande der Gesellschaft, inmitten des grossen Weltgeschehens. 'Durch meine Recherchen stiess ich auf das alte Volk der, wie es scheint, häufig kleinwüchsig gewesenen Veneter (Herkunft heutiges Slowenien), deren Nachkommen gesuchte Bergarbeiter im Dienste fremder Fürsten und Kleriker waren. Als eine geheime, nicht ungefährliche Gemeinschaft sind sie laut Historikern vermutlich der Ursprung der Zwergensagen. Das, und das Schicksal kleinwüchsiger Menschen in der Gesellschaft jener Zeit hat mich zu diesem Roman angeregt.' U. M. 'Der Autorin gelingt es, Hintergrundwissen der Historie und die Schauplätze (Mongolei, Mailand, Muoatatal, Luzern) meisterhaft und wortmalerisch mit romanhaftem Geschehen zu verbinden. Mit ihrem dritten Buch legt sie erneut ein sehr lesenswertes historisches Sittengemälde vor.' Brigitte Feuz (zu ‹Der Sakralfleck›)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ursula Meier-Nobs
Der Pfauenruf
Für Morris
Ursula Meier-Nobs
Der Pfauenruf
Roman · Zytglogge
Alle Rechte vorbehalten
Copyright: Zytglogge Verlag 2015
Lektorat: Hugo Ramseyer
Satz/Druck/eBook: Schwabe AG, Druckerei, Muttenz/Basel
Printed in Switzerland
ISBN 978-3-7296-0893-1
ISBN (ePUB) 978-3-7296-2036-0
ISBN (mobi) 978-3-7296-2037-7
www.zytglogge.ch
Der Gaukler
Giorgio Melli erzählt1235–37
Der Karneval von Venedig war in vollem Gange. Ein buntes Gemisch maskierter Menschen jeglichen Alters schob sich durch die engen Gassen, über die geschwungenen Brücken, wogte auf dem Markusplatz in dichtem Gedränge. Musik, Gelächter und frohe Zurufe erfüllten die Luft. Unzählige Gondeln brachten Festfreudige von den Inseln zur Stadt. Schausteller, Akrobaten und Bärenführer zeigten ihre Künste und es duftete nach Gebackenem und Gebratenem.
Das war die Zeit, in der ich mich unerkannt in der Öffentlichkeit bewegen konnte. Schon seit einer Woche lag mein Kostüm gelüftet und gereinigt im Schrank meines Zimmers, und wenn es auch nur, wie jedes Jahr, eine Bauta mit Dreispitz und Tabarro war, die Nunzi für mich geschneidert hatte, so vermochte diese doch meinen zu kurz gewachsenen Körper und mit der Kapuze und der Maske meinen zu gross geratenen Kopf zu verbergen. So sah man von mir nichts als die Augen. Selbst wenn diese Art von Verkleidung nicht die bunteste war und den prächtigen Gewändern der mich umgebenden Masken bei weitem nicht ebenbürtig, fühlte ich mich darin sicher vor Spott und Hohn. Diese beiden, der Spott und der Hohn, waren meine steten verhassten Begleiter, waren mir allgegenwärtig, doch in der Zeit des närrischen Treibens konnte ich mich von ihnen befreien.
Deshalb war ich guter Dinge und freute mich meines Lebens, ohne zu ahnen, dass diese bescheidene Freude für lange Zeit meine letzte gewesen sein sollte: Es war nämlich der Tag, an dem mein Vater mich verkaufte!
Ich wusste schon immer, dass er mich hasste. Ich war nicht der Sohn, den er sich gewünscht hatte, und er bestrafte mich dafür mit Missachtung. Er schämte sich meiner, was ich ihm, wenn ich mich in dem spiegelnden Wasser der Kanäle anschaute, kaum verübeln konnte. Meine kurzen Glieder, mein grosser Kopf mit der gewölbten Stirn und der gedrungene Körper passten nicht richtig zusammen, gaben kein harmonisches Bild, sahen vielmehr ziemlich abstossend aus.
Ja, abstossend – ich war abstossend anzusehen!
Meine Mutter kannte ich nicht, sie war bei meiner Geburt gestorben.
Zuneigung erhielt ich nur von meiner Amme Annunziata. Nunzi, wie ich sie nannte, war nicht mehr die Jüngste, musste damals so um die vierzig gewesen sein, was an sich bereits ein recht hohes Alter ist, und da sie mich genährt hatte, liebte sie mich und erfüllte ihre Pflicht, was mein leibliches Wohl betraf, so, wie man es erwarten durfte.
Für die geistigen Belange war Fra Giacomo zuständig, ein Bruder aus dem Benediktinerkloster San Nicolo, der schon früh versuchte, mir die Grundbegriffe von Schrift, Zahl, Latein und Griechisch beizubringen. Natürlich durften dabei auch die religiösen Seiten nicht fehlen. Es gab keinen Sonntag und keine Kirchenfeste, bei denen ich nicht anwesend zu sein hatte. Ich ging in Begleitung von Nunzi zur Beichte und empfing den Leib des Herrn regelmässig inmitten der anderen Kirchgänger – ich wusste, wie man tat und was sich gehörte.
An das Angestarrtwerden durch Erwachsene hatte ich mich mittlerweile gewöhnt, jedoch niemals an die Spottrufe der Kinder, die, sobald ich alleine unterwegs war, hinter mir herliefen, lachten, johlten und hässliche Worte riefen. Das Schönste davon war gerade noch «Knirps», und den Tag, an dem sie mich einfingen, mich an Händen und Füssen banden, mir eine Zipfelmütze über den Kopf zogen und mich auf dem Ponte delle Guglie zur Schau stellten, werde ich nie vergessen. Diese Demütigung inmitten der lachenden Menschen war kaum auszuhalten, brannte tief drin in meiner Seele. Ich weinte vor Zorn, wohl wissend, dass Tränen mein Gesicht noch mehr verunstalteten, und zum ersten Mal in meinem achtjährigen Leben schwor ich Rache: «Wartet nur, euch werd ich es noch zeigen!»
Genau in diesem Augenblick, als ich dies dachte, ertönte der Ruf: Erst war er wie das Miauen einer Katze, dann gellend, langgezogen, durchdringend, unheimliche Schauder auslösend. Er stieg auf vom Palast des Dogen, glitt über die Stadt und deckte sie zu, liess die Menschen um mich herum verstummen. Einige standen starr vor Schreck, andere bekreuzigten sich oder verhüllten ihr Gesicht, meine Peiniger schrien auf und stoben davon, heim, zu Mutters Schürze, und auch die Gaffer liefen auseinander, gingen ihren Geschäften nach. Nur um mich schien sich niemand zu kümmern, man liess mich liegen mitten auf der Brücke, und trotz allem Zerren und Winden konnte ich mich nicht befreien.
«Soll ich dir helfen?»
Es waren zwei Männer, im jüngeren erkannte ich Aldo, den Schreiber aus Vaters Kontor, den anderen hatte ich noch nie gesehen.
Misstrauisch sah ich sie an, doch sie schienen es ernst zu meinen, und ich nickte.
«Du bist Giorgio, nicht wahr, der Sohn des Tuchhändlers Melli?», fragte der Ältere und knotete die Schnüre auf.
«Ja», sagte ich, streifte die Fesseln endgültig ab und stand auf
«Eine hässliche Lage, in der du dich befunden hast. Warum wehrst du dich nicht? Du scheinst ja ziemlich kräftig zu sein.» Dabei befühlte er meine Oberarme. Das war mir unangenehm, ich trat zurück.
«Es waren zu viele», murmelte ich und klopfte meine Beinkleider aus.
«Er wehrt sich nie», meinte Aldo und spuckte aus, «er ist ein Feigling.»
«Das glaube ich nicht, es waren wirklich zu viele. Da überlegt man es sich zweimal, ob Gegenwehr angebracht ist», sagte der Fremde und sah mich nachdenklich an. Sein Blick glitt von meinem Gesicht über meine ganze Gestalt, dann nickte er zufrieden.
«Er hat gute Anlagen, er gefällt mir; ich werde nächstens mit seinem Vater sprechen.»
Dann liessen sie mich stehen und gingen ihres Wegs.
Ich sah ihnen nach, sah, wie ein Geldschein den Besitzer wechselte, überlegte, weshalb er wohl meinen Vater sprechen wollte und was mein Aussehen damit zu tun haben könnte – mein Aussehen, das mir so viel Kummer machte, das mir – so sagte es Nunzi – von Gott auferlegt worden war und das ich zu tragen hatte.
Dann eilte ich durch die Stadt zurück, darauf bedacht, nicht aufzufallen, nicht noch einmal in die Gewalt meiner Peiniger zu gelangen, stahl mich über die geheimen Schleichwege der Dächer und erreichte glücklich unser Haus – da ertönte wiederum der seltsame Ruf, den ich über meinem Elend ganz vergessen hatte. Ich rief nach Nunzi, fand sie in der Küche, warf mich in ihre Arme und grub mein Gesicht in die weiche Fülle ihres Busens.
«Dieser Schrei – hast du ihn gehört, was war das?»
Sie hatte die Arme um mich gelegt und wiegte mich leicht hin und her.
«Das war nur der Ruf der Regenvögel.»
«Regenvögel? Die kenne ich nicht.»
«Pfauen! Es gibt sie bei uns nicht, doch wie es scheint, hat sie der indische Gesandte aus seinem Land mitgebracht – als Geschenk für den Dogen. Sie seien wunderschön und sehr kostbar; sie künden mit ihrem Schrei den kommenden Regen an.»
«Warum weisst du das?»
«Man spricht davon! Man erzählt sich, der Doge lasse sie in einem seiner Höfe frei herumlaufen, damit jedermann im Palast sie bestaunen kann. Wie du siehst, es ist nichts Gefährliches.»
Das beruhigte mich, und der Wunsch, diese Tiere selbst zu sehen, mit meinen eigenen Augen, wurde beinahe übermächtig. In meiner Vorstellung sah ich sie in gold- und silberdurchwirktem Federkleid, mit kostbaren Steinen bespickt, durch die prächtigen Säle des Palastes schreiten und beneidete alle, die sie zu Gesicht bekamen. Was mich aber am meisten beeindruckte, war die Tatsache, dass es am nächsten Tag tatsächlich regnete.
Dies alles war vor einiger Zeit geschehen, und wie gesagt, heute freute ich mich meines Lebens, besonders, da der wichtigste Tag des Karnevals angebrochen war, der Donnerstag vor Aschermittwoch, wo sich dem Brauch gemäss der Doge mit seiner Dogaressa ins Festgetümmel mischt. Ungezwungen bewegte sich das edle Paar, umgeben von seinem Gefolge, durch die von der Menge freigemachte Gasse, grüsste nach allen Seiten, begab sich zur Schiffsanlegestelle und bestieg die geschmückte Gondel. Die Dienerschaft tat es ihnen gleich, der bunte Geleitzug mit all den schönen Masken bewegte sich gegen die Insel Murano, wo die Vorbereitungen zu diesem Besuch schon seit Tagen im Gange waren. Es war wohl das bedeutsamste Ereignis im Dasein der Glasbläser und ihrer Familien, die unter Androhung der Todesstrafe ihr Eiland nicht verlassen durften. Zu gross war die Gefahr der möglichen Preisgabe des Verfahrens dieser geheimen Kunst an Unbefugte.
Gefangene ihres Handwerks waren sie, zwar geschätzt und angesehen, aber seit Generationen abgesondert von der übrigen Welt. Deshalb wohl besassen sie eine eigene Sprache und lebten nach ihren eigenen Gesetzen – so sagte man jedenfalls, so hatte ich es gehört.
Ungeduldig wurde die Rückkehr der Erlauchten erwartet, ungeduldig auf das alljährliche Spektakel, die Feier des venezianischen Sieges von 1162 über den kaisertreuen Patriarchen Ulrico II. von Aquileia.
Schon wurden die zwölf quiekenden Schweine auf den Platz gebracht, der Korb mit den zwölf Broten herbeigetragen. Die Gilde der Metzger stellte sich daneben auf, und erst als das Boot des Dogen wiederum am Steg anlangte, wurde auch der Stier von kräftigen Burschen herbeigeführt. Das Tier, verunsichert durch den Lärm und das Geschrei, schnaubte und stampfte, und die Zuschauer wichen zurück.
Nun betrat der Doge die erhöhte Plattform, und in einer lustigen Gerichtsverhandlung verurteilte er den Stier, der den Prälaten Ulrico darstellte, und die zwölf Schweine, die Diakone darstellend, zum Tode.
Ich lief inmitten der Menge mit, als die Verurteilten durch die Gassen und über die Brücken getrieben wurden, bis hin zu den kleinen Piazzettas. Auf jeder Piazzetta wurde eines der Tiere von einem Adligen erstochen. Der Stier aber wurde den zünftigen Metzgern vorbehalten, die in einer feierlichen Handlung das Werk vollendeten.
Anschliessend wurde das Fleisch unter dem Volke verteilt, wobei ich mich zurückhielt und von abseits zuschaute, denn ich getraute mich nicht in das Gerangel und Gedränge, wo es oft Verletzte oder gar Tote gab.
Mittlerweile war es Nacht geworden, Fackeln beleuchteten das närrische Treiben, der Widerschein der Lichter zitterte über das schwarze Wasser. Eine erregende, geheimnisvolle, ja beinahe gespenstische Stimmung überfiel mich, und auf einmal ängstigten mich die engen Durchgänge, die gewölbten Bogen, die finsteren Hintertreppen, ängstigten mich die vermummten Gestalten, von denen doch auch ich eine war, und die Lust am Feiern wechselte in Überdruss. Zudem bohrte in meinem Leib der Hunger. Ich dachte an die hauchdünn in Fett gebackenen Chiacchiere und die süssen, mit blau und rosa Zuckerguss verzierten Buranelli aus Hefeteig, die Nunzi in diesen Tagen herstellte, und das Wasser lief mir im Munde zusammen. Von Gier getrieben stürmte ich in unser Haus. In der Diele überrannte ich beinahe eine Gestalt im dunklen Mantel, die bei meinem Vater stand. Grob bremste mich dessen harter Griff, dann riss er mir Dreispitz und Maske vom Gesicht.
«Solltest du vergessen haben, wie man sich benimmt, mein Sohn?», fragte er, und seine Hand an meinem Arm schmerzte.
«Es tut mir leid, Papa, ich wollte das nicht.»
«Entschuldige dich bei unserem Gast.»
Dieser schüttelte leicht den Kopf.
«Das ist doch nicht schlimm, Signor Melli, so ist die Jugend, voller ungebändigter Kraft!»
«Entschuldige dich!» Vaters Blick war dunkel und böse, mit einer schnellen Bewegung stiess er mich vor die Füsse des Fremden.
Erschrocken machte ich einen Kratzfuss, stammelte, dass es mir leid tue und ich um Verzeihung bäte – da erkannte ich den Mann. Es war derselbe, der mir auf der Ponte delle Guglie beigestanden hatte. Er sah meine Überraschung und lachte.
«Wir sind uns ja nicht ganz fremd, nicht wahr, Giorgio? Und in Zukunft werden wir uns noch viel besser kennenlernen. Ich bin sicher, wir werden uns gut verstehen.»
Er reichte meinem Vater die Hand zum Abschied und ging.
Unsicher stand ich da, wusste nicht, wie ich seine Worte verstehen sollte, sah hilfesuchend meinen Vater an, der mir mit einer Handbewegung bedeutete, ihm zu folgen. Hinter ihm betrat ich die Bibliothek.
«Setz dich, Giorgio.»
Die Sessel waren für mich alle zu hoch, so musste ich hinaufklettern, was ziemlich unwürdig aussah. Vater beobachtete mich mit hochgezogenen Brauen. Das verunsicherte mich noch mehr, und ich schämte mich, denn meine Füsse erreichten den Boden bei weitem nicht, obschon ich auf der äussersten Kante sass.
«Giorgio, du bist nun acht Jahre alt, und seit einiger Zeit beschäftigt mich deine Zukunft. Du weisst selbst, dass du nicht bist wie die andern – und es auch nie sein wirst. Für den Militärdienst bist du nicht tauglich, ebenso wenig dafür, meine Nachfolge anzutreten. Auch dazu braucht man gerade Glieder und ein ansprechendes Aussehen. Beides ist dir nicht angeboren. Deshalb habe ich – nach langem Nachdenken – beschlossen, dich einem Schausteller in die Lehre zu geben. Die Pflichten, die dich da erwarten, wirst du wohl erfüllen können. Ich bin sicher, es wird dir gefallen, denn Magister Ciccione ist Künstler und der Prinzipal einer grossen Truppe, die durch das ganze Land zieht.»
Entsetzt schaute ich ihn an.
«Ich muss weg von hier, weg aus Venedig, fort von Nunzi?»
«So habe ich es beschlossen. Du wirst mir dafür noch einmal dankbar sein, denn hier wirst du dein Auskommen niemals finden.»
«Aber Papa, warum denn? Ich kann noch lernen, ich spreche schon gut Latein und auch etwas Französisch und Griechisch, und rechnen und schreiben kann ich auch. Ich könnte euch in der Schreibstube nützlich sein.»
Feindselig sah er mich an.
«Keine Widerrede, Giorgio. Zudem werde ich mich wieder verheiraten, und deine Gegenwart ist Donna Rosalba nicht zuzumuten. Du wirst uns schon morgen verlassen.»
Damit und ohne mich eines weiteren Blicks zu würdigen ging er aus dem Raum.
Ich fühlte mich wie erschlagen, war vor Hilflosigkeit, Wut und Angst wie gelähmt – dann begann ich zu weinen, stürzte tränenüberströmt in die Küche und warf mich in Nunzis Arme.
Sie hielt mich fest, wiegte mich leise hin und her, wie sie es immer tat, und erst als ich keine Tränen mehr hatte, merkte ich, dass auch sie weinte.
«Vater schickt mich weg, Nunzi!»
«Ich weiss, Giorgio, ich weiss.»
«Warum tut er das! Nur dieser – dieser neuen Frau wegen? Ich würde ihn doch nicht stören, ich habe ihm doch nichts getan. Ich kann doch nichts dafür, dass ich klein bin!»
«Nein, dafür kannst du nichts. Aber es ist, wie es ist und nicht zu ändern. Aber gräme dich nicht, mein Herz, du wirst viel von der Welt zu sehen bekommen und viel erleben. Bleibe den Geboten Gottes treu, wie Fra Giacomo dich gelehrt hat – und lerne, lerne!»
Eine lange Weile standen wir so schweigend beisammen, ich überdachte ihre Worte, sie trösteten mich nur wenig, und Nunzi begann von neuem zu weinen, schlug heftig mit der Faust auf den Tisch und schrie in plötzlicher Wut:
«Er nimmt mir alles, was ich liebe, das werde ich ihm nie verzeihen!»
Dann sank sie laut schluchzend zu Boden, und nun war ich es, der sie umarmte.
Später verkroch ich mich, gelähmt vor Angst über meine ungewisse Zukunft im Schrank meines Zimmers, verbarg mich zwischen meinen Kleidern, die ich ihrer kurzen Hosenbeine und Hemdsärmel, der kleinen Wämser und winzigen Schuhe wegen auf einmal hasste, denn – so dachte ich – wären sie und ich in der Grösse meinem Alter entsprechend gewesen, so würde mein Vater mich nicht verachten, würde mich nicht fortschicken und mich vielleicht sogar lieben.
Dann muss ich eingeschlafen sein, erwachte über dem Ruf meines Namens, hörte, dass man mich suchte, beschloss, mich nicht auffinden zu lassen, drückte mich in den hintersten Winkel, schloss die Augen und machte mich noch kleiner als ich war.
Als man mich endlich fand, war mein Vater so wütend, dass er mich schlug, was mir den Abschied um einiges erleichterte. Dieser Schlag ins Gesicht zerriss die Bande, die mich an ihn und mein Heim gebunden hatten, für immer.
Wenig später sass ich mit diesem Signor Ciccione im Boot, und ein Gondoliere steuerte uns durch das Gewimmel auf dem Canale Grande. Zum letzten Mal hörte ich die Rufe der Schiffer, sah ich die Geschäftigkeit der Stadt, roch ihren Duft. Die Paläste glitten an mir vorbei, ich kannte sie alle, die Brücken, die ich liebte, blieben zurück, und unser Gondoliere nahm Kurs auf Mestre. Dort, auf dem Festland, war ich noch nie gewesen, ich fürchtete mich davor, glaubte, ohne Wasser unter meinen Füssen nicht leben zu können. Doch die Ohrfeige meines Vaters brannte in meinem Gesicht, in meinem Herzen; mein Entschluss, niemals wieder unter seine Augen zu treten, wankte nur kurz, und als wir anlegten, nahm ich meinen Proviantsack, in dem ich die von Nunzi eingepackten Buranelli wusste, auf den Rücken und trabte hinter meinem Meister in mein neues Leben.
Wir durchschritten den Ort, der ausser einer Pferdestation und einigen Hütten nichts zu bieten hatte und gingen weiter, so lange, bis ich den Geruch des Meeres nicht mehr wahrnehmen konnte. Über die trockenen Felder wehte ein kalter Wind, einige Schafe rupften an den verdorrten Stängeln, hoch oben unter den grauen Wolkenfetzen zogen zwei grosse Vögel ihre Kreise. Eine weitere kleine Ortschaft, wo die wenigen Menschen mich anstarrten und die Hunde uns bellend hinterherliefen, durchquerten wir ohne Aufenthalt, machten erst eine Rast, als der Abstand zwischen mir und meinem Begleiter immer grösser wurde und er auf mich warten musste.
«Ruh dich aus, Giorgio, iss etwas, damit du wieder zu Kräften kommst. Ich habe nicht an deine kurzen Beine gedacht», sagte er freundlich, zog eine kleine Flasche aus seiner Tasche und trank daraus. Durstig sah ich ihm zu, Nunzi hatte mir nichts zu trinken mitgegeben und als er mir die Flasche reichte, nahm ich einen kräftigen Schluck. Die Flüssigkeit war aber kein Wasser, sie brannte in meiner Kehle, rann mir feurig durch den Hals und nahm mir den Atem. Ich hustete, und er lachte.
«Das bist du nicht gewohnt, wie? Es ist Branntwein, gut für die Nerven. Du wirst es schon noch zu schätzen wissen.»
Daran zweifelte ich sehr, mein Durst wurde durch diese Tranksame nicht gelöscht, verstärkte sich noch, und es ging nicht lange und ich hätte alle meine Buranelli für Wasser hergegeben.
Die Dämmerung senkte sich herab, der Wind hatte an Stärke zugelegt, mich fror, ich dachte an meinen gefütterten Überwurf im Bündel. Ich hätte ihn gerne angezogen, was aber nicht möglich war, da Signor Ciccione meine Habe trug und ich ihn darum hätte bitten müssen. Das mochte ich jedoch nicht, und so fror ich vor mich hin.
Der Strasse verlor sich in einem Feldweg, Steine erschwerten das Gehen, dann erreichten wir einen von einem Erdwall eingefassten Platz. Im Schein eines Lagerfeuers sah ich huschende Schatten vor den Flammen, der Duft von Essen wehte uns entgegen, und der Signore streckte die Hand aus.
«Schau, wir sind angekommen, das ist dein neues Zuhause. Er stiess einen durchdringenden Schrei aus, der umgehend erwidert wurde. Hunde bellten, hinter Büschen erblickte ich ein seltsam tuchbespanntes Gefährt auf hohen Rädern, aus dessen Innerem einige Gestalten stiegen und sich wartend zu den Andern ans Feuer stellten. Der Signore schob mich in den Lichtkreis und rief:
«Meine verehrten Damen und Herren, darf ich vorstellen?» Er machte eine weitausholende Armbewegung, die ich in den kommenden Wochen noch oft sehen sollte – «Giorgio Melli, ein Anfänger in der Kunst des Schauspiels!»
Die Leute lachten, klatschten, und ein kleines Mädchen eilte auf mich zu, umarmte und küsste mich, was mich zutiefst erschreckte, zumal ich bemerkte, dass ihr Gesicht Falten hatte, wie Nunzi, dass ihr Haar grau durchzogen und ihre Zähne mangelhaft waren. Ich wich zurück, und die Menschen lachten noch mehr, lachten ganz offensichtlich über mich, was mich traurig und wütend zugleich machte.
«Lasst den Jungen in Ruhe, er muss sich erst eingewöhnen», sagte der Signore, legte mir die Hand auf die Schulter und raunte:
«Nimm es nicht persönlich, sie meinen es nicht böse, nein, sie freuen sich über deine Ankunft. Sieh, Marietta wartet schon lange auf einen Partner, du wirst mit ihr zusammen spielen, und ich bin sicher, ihr werdet ein gutes Gespann.»
Seine Worte begriff ich nicht, wusste nicht, was von mir erwartet wurde, ich hatte Angst, konnte kaum etwas von der Suppe essen, trank nur gierig das kalte Wasser, das mir in einem Steinkrug gereicht wurde und lag später unglücklich unter einer Plane auf hartem Boden auf meinem Kleiderbündel, eingekeilt zwischen zweien meiner künftigen Kameraden. Trotz meiner Müdigkeit lag ich lange wach, vermisste mein weiches Bett, die sauberen Decken, störte mich am Schnarchen und Rülpsen der beiden, denn solches war ich nicht gewohnt. Ich weinte vor Elend, leise nur, damit die andern es nicht merkten – und darüber schlief ich endlich ein.
Das helle Klingeln einer Glocke weckte mich, das Gesicht Mariettas schob sich unter die Plane.
«Aufwachen, Faulpelz, komm schnell, sonst essen dir die andern die Morgensuppe weg.»
Sie lachte, ihre Zähne standen schief, und ich bemerkte, dass auch ihre Augen in verschiedene Richtungen blickten.
Meine Mitschläfer waren verschwunden, sie nahm mich bei der Hand und zog mich mit sich, nahm mich hinein in den Kreis der Menschen, die sich um das Feuer versammelt hatten. Freundliche Zurufe hiessen mich willkommen, eine Schale wurde mir in die Hände gedrückt, die junge Frau im rotem Kleid, deren schwarze Haare lockig und lose über ihren Rücken fielen, lächelte mir während des Rührens im grossen Kessel zu, aus dem es so herrlich duftete, dass mir der Mund wässrig wurde. Umringt von all den Menschen, zu denen nun auch ich gehörte, warteten wir auf das Essen, das sich, als ich es in meinem Napf hatte, als wohlschmeckend und nahrhaft erwies.
Erst als ich zum zweiten Mal die Schale geleert hatte und eine wohlige Wärme meinen Körper durchzog, getraute ich mich richtig umzusehen:
Unser Lagerplatz war von einem Erdwall geschützt. Nur ein Durchgang führte hinaus auf morastige Felder, wo Büsche im heftigen Wind ihre Äste hin und her warfen, als bäten sie um Gnade.
Die Frau im roten Kleid, die ihr Haar in einer Weise trug, wie wohl keine ehrbare Dame es je tragen würde, musste die Frau des Signore sein, denn sie sassen beim Essen nebeneinander und schoben sich hin und wieder gegenseitig den Löffel in den Mund. Meine beiden Mitschläfer, Pedro und Paulo, sassen bei zwei weiteren Männern, von denen einer alt und der andere so gross war, dass ich den Kopf in den Nacken legen musste, um sein Gesicht sehen zu können. Anderseits war da eine entsetzlich dicke Frau, die sich kaum bewegen konnte, ihre Brüste waren riesig, ihre Beine wie Pfosten und ihre Hüften so breit, dass sie eine Bank für sich alleine beanspruchte.
Dann gab es noch die beiden Jünglinge, die sich ganz eng aneinander schmiegten, sich gar die Arme um die Schultern gelegt hatten und immer alle Bewegungen miteinander und zur selben Zeit ausführten. Was mich aber am Meisten beeindruckte, war ein Wesen, dessen Kopf und Gesicht ganz mit Haaren bedeckt war, die bis weit auf die Brust fielen und nur Augen Nase und Mund freigaben.
Entsetzt starrte ich sie an und Marietta flüsterte:
«Das ist Elena, unser Wolfsmädchen. Sie wurde so geboren, sie spielt in unserem Schauspiel das Ungeheuer.»
Ich wies verstohlen auf die Zwillinge.
«Das sind Franco und Blanco, sie sind an den Hüften zusammengewachsen und können sich nicht trennen. Mit ihren Kapriolen bringen sie die Zuschauer zum Lachen.»
Sie zeigte auf die dicke Frau.
«Das ist Anna, sie sitzt bei den Vorstellungen in einem kleinen Verschlag und lässt sich für eine Münze begaffen. Zudem liest sie den Leuten aus der Hand. Sie hat das zweite Gesicht, musst du wissen. Der lange Andrea, der nicht aufhören kann, zu wachsen, spielt den Zauberer, er weiss viele geheimnisvolle Kniffe. Der Alte neben ihm ist Mattia. Er besitzt einen Bären, dem er allerlei Kunststücke beigebracht hat.»
Unsicher schaute ich mich um, und Marietta lachte.
«Keine Angst, Bor sitzt in einem Käfig und tut niemandem etwas, er ist sehr zahm und gutmütig, du wirst schon sehen.»
Ich atmete auf. Bären hatte ich bis heute nur auf Bildern kennengelernt, und da sahen sie immer ziemlich furchterregend aus.
«Und was tun Pedro und Paulo?», fragte ich.
«Pedro ist Jongleur, er arbeitet mit zehn Bällen und sieben Keulen, und Paulo tanzt auf dem Seil, manchmal hoch über dem Boden von einer Seite des Platzes zur andern. Sie sind richtige Artisten, freie Leute, Ciccione hat sie nicht gekauft.»
Langsam begann ich, Namen und Gesichter zu ordnen, prägte mir ihre Aufgaben ein – bis mir einfiel, dass ich meine Arbeit noch gar nicht kannte. Erschrocken sah ich Marietta an.
«Und wir, was machen wir?»
Sie lachte hellauf.
«Wir sind die Spassmacher, wir treiben Unfug, so dass die Kinder Vergnügen haben. Wenn die Eltern sehen, dass sich die Kleinen freuen, geben sie uns mehr Geld, deshalb ist unsere Arbeit wichtig.»
Unfug zu machen, hatte mir mein Vater immer verboten. Ich fand es seltsam, dass man dafür Geld bekommen sollte und das sagte ich Marietta auch.
«Warts nur ab, du wirst schon sehen. Aber komm, wir müssen beim Aufräumen helfen, sonst wird Ilaria böse.»
Damit meinte sie die Frau im roten Kleid, die eben den Arm um den Meister gelegt hatte und ihn auf die Wange küsste.
«Ist sie seine Ehefrau?»
«Nein, sie ist seine Geliebte, aber sie benimmt sich so, wie wenn sie es wäre. Wir gehorchen ihr in allen alltäglichen Dingen, und wenn der Meister weg ist, leitet sie auch die Proben.»
«Und was tut der Meister?»
«Ciccione ist der Herr über die Truppe. Zudem streicht er die Fidel und bläst die Flöte, stellt das Programm zusammen, kümmert sich um die Spielorte, um die Einnahmen und unsere Verpflegung. Wenn jemand von uns krank wird oder stirbt, sorgt er für Ersatz. Er kauft nur vielversprechende Talente ein, wie zum Beispiel dich. Übrigens – du bist der dritte Partner, den ich habe, seitdem ich hier bin.»
«Was ist meinen Vorgängern denn geschehen?»
«Rico – der war noch etwas kleiner als du – wurde in einem Streit erschlagen, und Damian verschwand von einem Tag auf den andern. Keine Ahnung, was ihm geschehen ist. Wir haben ihn alle lange gesucht, aber wir haben ihn nicht gefunden.»
Der Abgang meiner Vorgänger war mir zwar nicht ganz geheuer, doch sie hatte mich ein vielversprechendes Talent genannt. Das und die unverhoffte Erkenntnis, nicht das einzige missgebildete Geschöpf zu sein auf Gottes Erdboden, dass es Menschen gab, die sich mit noch seltsameren Entstellungen abfinden mussten als ich, war für mich wie eine Erlösung. Ich fühlte etwas wie Zuversicht in mir, und da nahm Marietta meine Hand und sagte: «Komm, ich zeige dir den Bären.»
Das mächtige Tier, das in einem Käfig aus dicken Weidenruten sass, schob, als es uns kommen hörte, die Schnauze durch das Geflecht und schnaubte uns an.
«Schau Giorgio, das ist Bor.» Sie strich dem Tier zärtlich über die Schnauze, zeigte dann auf mich, machte eine ebenso weitausholende Armbewegung, wie ich sie am Vorabend bei Ciccione gesehen hatte und sagte: «Bor, das ist Giorgio, er wird mit uns ziehen.»
Ich musste lachen.
«Glaubst du, er versteht das?»
«Aber ja, Bor ist sehr klug. Komm her und streichle ihn, damit er deinen Geruch aufnehmen kann. So weiss er, dass du zu uns gehörst. – Du hast doch keine Angst, oder?»
Ich zögerte kurz, mochte aber nicht als Feigling gelten, berührte vorsichtig mit meinem Zeigefinger seine Nase, fühlte das warme Fell, die feuchte Zunge, die kurz über meine Hand fuhr und trat erschrocken zurück.
Nun war es Marietta, die lachte.
«Du hast doch Angst, das brauchst du nicht zu haben. Er ist ganz zahm. Aber nun müssen wir uns beeilen, Pedro und Paulo helfen heute nicht mit. Ciccione und sie sind mit dem grösseren Maultier und den Körben unterwegs.»
«Mit was für Körben?»
«Oh, Ciccione ist auch Korbmacher.»
«Korbmacher?»
«Ja; damit verdienen wir uns einen zusätzlichen Unterhalt, nicht immer fallen die Einnahmen unserer Schauspielkunst gut aus. Es gibt Orte, da will man uns gar nicht haben. Oft fürchten sich die Leute vor uns.»
«Weshalb denn, tut ihr ihnen was?»
«Aber nein, alles, was man über uns sagt, ist erlogen. Wir verschleppen keine Kinder, wir bestehlen – wenn überhaupt – nur die Wohlhabenden, wir plündern auch die Felder nicht, wie es immer heisst – oder nur ganz selten – und verwüsten keine Allmenden. Um unsere Notdurft zu verrichten, graben wir Löcher und decken sie zu, wenn wir weiterreisen. Darauf achtet Ciccione streng.»
So erzählte Marietta, währenddem wir die Hunde fütterten und das jüngere Maultier striegelten, das nicht mit Ciccione unterwegs war. Mit einem Ledereimer schleppten wir aus dem nahen Tümpel Wasser herbei und halfen mit, die Rüben für die Suppe zu schnitzeln.
Alle arbeiteten etwas, alle hatten ihre Obliegenheiten, je nach Stärke und Können.
So begann meine Laufbahn bei Maestro Ciccione.
In den ersten Tagen hatte ich Mühe mit den mir fremden Alltagspflichten, mit dem Liegen auf hartem Boden. Ich fürchtete mich vor den beiden Maultieren, den Hunden, die die Karren zogen, und auch immer noch etwas vor dem Bären, und ich verwünschte das Leben unter freiem Himmel bei jeder Witterung.
Doch mehr noch quälte mich die Angst vor meinem ersten Auftritt, dem ich mit Unbehagen entgegen sah. Auf all meine diesbezüglichen Fragen bekam ich von Marietta ausweichende Antworten, und der Maestro meinte nur:
«Mach dir keine Sorgen, du wirst es früh genug erfahren, Marietta weiss Bescheid.»
Vorerst aber, und das schon am folgenden Tag, erlebte ich das Schneiden der Weidenruten. Am Bachlauf, der sich durch die morastigen Wiesen schlängelte, wuchsen die seltsam aussehenden Bäume, deren lange, dünne Äste aus einem klobigen, kurzen Stamm trieben. Mit einem halbmondförmigen, mit scharfen, kleinen Zacken bestückten Messer wurden diese durch die Männer vom Stamm getrennt. Wir andern schichteten sie am Boden auf und banden sie zu Bündel zusammen.
Eine harte Arbeit, die mir Schmerzen in allen Knochen bescherte, denn auch solches war ich nicht gewohnt. Der zeitweise feine Regen, der kalte Wind, der ungehindert über die freie Fläche blies, machten alles noch schwerer, und ich war froh, als die Dämmerung einfiel und wir mit vereinten Kräften die gebundenen Zweige in den Schutz unseres Lagers zurückschleppen durften. Dort legten wir sie in Reihen ins nasse Gras, damit sie, wie man mir sagte, geschmeidig blieben.
Am folgenden Morgen wurden sie geschält, und das geschah, indem man sie durch eine hölzerne Zange zog und die nun aufgeplatzte Rinde von Hand vom weissen Holz ablöste. Auf einer Art Rost locker hingelegt, liess man sie zuletzt von Wind und Sonne austrocknen. Obschon auch hier alle mithelfen mussten, beschäftigte uns diese Arbeit mehrere Tage.
Deshalb verging eine geraume Zeit, bis wir mit unseren Maultierwagen und den Hundekarren, auf deren einem die Ruten aufgebürdet lagen, weiterzogen und eine Stadt erreichten. Wir lagerten auf dem Anger vor dem Tor, die Tiere wurden ausgespannt und getränkt und nach einer Rast, die mir sehr kurz vorkam, formierten wir uns zum Umzug.
Ilaria und Ciccione trugen seltsame, bunte Gewänder und ritten die beiden Mulis, die Zwillinge schleppten den mit Bändern geschmückten Bühnenwagen, Andrea blies die Flöte, Marietta und ich schwangen Tambourine, Mattia führte den Bären, Pedro liess die Bälle tanzen, und Paulo, der eine Fahne schwang, auf der unter einer goldenen Krone auf rotem Grund ein weisses Ghibellinerkreuz zu sehen war, verkündete mit lauter Stimme die Sehenswürdigkeiten, die wir zu bieten hatten. Die dicke Anna und Elena, als Wolf verkleidet, sassen auf einem von den Hunden gezogenen Karren und knallten mit der Peitsche.
Markttag wars, auf dem Platz vor der Kirche drängte sich das Volk, Kinder rannten johlend neben uns her. Auch die Erwachsenen schienen erfreut über eine Abwechslung und liessen sich herbei. Schnell war die Bühne aufgebaut, der Vorhang an den Ösen befestigt, wir waren bereit.
Man hatte mich in ein viel zu weit geschnittenes Kostüm gesteckt, die Ärmel fielen mir über die Hände, der Saum schleifte am Boden nach, die Pantoffeln passten nicht, und mein Gesicht mit der feuerroten Nase war weiss und schwarz bemalt. Mir war beinahe schlecht vor Aufregung, ängstigte ich mich doch vor dem, was kommen sollte. In einem Gefühl der Hilflosigkeit stand ich hinter dem Vorhang neben Marietta, die ein langes, weites, rosafarbenes Rüschenkleid trug und mit ihrem weiss bemalten Gesicht beinahe schön aussah. Die Klatsche in ihrer Hand war übermässig gross, wie ich sie nur am Karneval gesehen hatte, und ich fragte mich, was sie wohl damit tun wollte. Zusammen standen wir hinter dem Vorhang, sahen, wie das Wolfsmädchen mit einer Art Zauberstab einen Bann über die Zwillinge legte, die sich nun zur Heiterkeit der Zuschauer verständlicherweise vergebens bemühten, voneinander loszukommen, sahen, wie der lange Andrea im schwarzen Zaubermantel das Wolfsmädchen übers Knie legte und versohlte, die Zwillinge schützend unter seinen Mantel nahm und unter grossem Applaus wegführte.
Nun wurde das Seil für Paulo über den Platz gespannt und um die Wartezeit abzukürzen, kam unser Auftritt – und damit der Albtraum meines Schauspielerlebens:
Nichtsahnend fühlte ich den kräftigen Stoss in den Rücken, der mich bäuchlings auf die Bühne warf, hörte das kreischend Gelächter von Marietta, die mir mit der Klatsche auf Kopf und Gesäss schlug und mich daran hinderte, aufzustehen. So rollte ich mich herum, versuchte, den Schlägen auszuweichen, kroch dazu gar unter Mariettas Kleid, was bei ihr Empörungsschreie und beim Publikum schallendes Gelächter auslöste und fühlte mich schrecklich. Nun spottete man also auch hier über mich! Tränen der Wut brannten in meiner Kehle, ich riss meine Peinigerin zu Boden, entwand ihr die Klatsche und schlug nun meinerseits auf sie ein, wobei ich mich ständig in meinen weiten Kleidern verhedderte. Die Leute krümmten sich vor Lachen, schrien und pfiffen, bis Andrea erschien und uns trennte, uns wie Lausebengel an den Ohren zerrend hinter den Vorhang brachte.
Voller Zorn wollte ich mich wieder auf Marietta stürzen, aber Ciccione packte mich und hob mich hoch, küsste mich schmatzend auf beide Wangen, lachte und rief:
«Ich hab es gewusst: Du warst grossartig, Kleiner! Du wirst ein guter Schauspieler werden und bist das Geld wert, das ich deinem Vater für dich bezahlt habe. So gelacht habe ich noch selten, ich gratuliere dir.»
Ilaria küsste mich ebenfalls, die Männer schlugen mir auf die Schulter, sagten: «Willkommen in unserem Kreis», und Marietta, die ihr zerknautschtes Kleid richtete, meinte:
«Du warst gut, aber zu erschlagen brauchst du mich nicht, daran müssen wir noch arbeiten.»
Ich stand da, kämpfte mit meinem gekränkten Stolz und verstand die Welt nicht mehr.
«Ihr habt mich einfach hineinlaufen lassen, ihr habt mich lächerlich gemacht vor aller Leute Augen. Wenn das euer Schauspielerleben ist, dann danke ich dafür. Lieber gehe ich … gehe ich …»
Auf einmal wurde mir bewusst, dass ich nirgendwo hingehen konnte, und es hätte nicht der Worte des Wolfsmädchens gebraucht, die mir klarmachten, dass es für mich keine anderen Möglichkeiten gab.
«Du kannst nicht gehen, Giorgio, unser Meister hat dich gekauft, du bist sein Eigentum, wie wir Missgestaltete hier es alle sind.»
«Hat er denn wenigstens einen guten Preis für mich verlangt, mein Vater, oder hat er mich spottbillig abgegeben», fragte ich voller Bitterkeit.
Marietta legte tröstend den Arm um mich, und die Vorstellung ging weiter.
Paulo auf seinem Seil erhielt grossen Applaus, Pedros brennende, tanzende Keulen wurden bewundert, die Kunststücke von Mattias Bären beklatscht – und dann tanzte Ilaria.
Die Melodie, die Ciccione auf der Flöte blies, war leicht und fröhlich, das rot geflammte Kleid der Tänzerin wie ein loderndes Feuer, das fliegende Haar glänzend wie das blau schimmernde Gefieder der schwarzen Vögel über den Feldern, so kam es mir vor, und die Menschen verstummten, waren gefangen von der Anmut ihrer Darbietung.
Es war das Schönste, was ich je gesehen hatte.
Der Beifall war überwältigend, Geldstücke regneten auf die Bretter, Marietta und ich gingen mit den Almosenschalen durch die Menge, und wenn auch nur Münzen von geringem Wert gespendet wurden, so war das Endergebnis doch zufriedenstellend und Ciccione lobte uns.
Das waren meine ersten Bühnenerfahrungen mit der Truppe und zugleich meine Prüfung zur Tauglichkeit, die ich ganz offensichtlich bestanden hatte. Und wenn ich auch noch nicht ganz begriff, weshalb, so machte mich die Aufnahme in die Gemeinschaft der Gaukler froh, und das Gefühl, anerkannt zu werden, etwas wichtiger zu sein, als ich es jemals zu Hause gewesen war, tat gut.





























