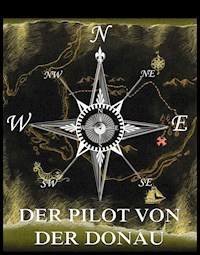
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die illustrierte Version dieses Klassikers. Der Roman erzählt die Abenteuer eines presigekrönten Donaufischers auf seiner Fahrt die Donau entlang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Pilot von der Donau
Jules Verne
Inhalt:
Jules Verne – Biografie und Bibliografie
Der Pilot von der Donau
Erstes Kapitel. Das Wettangeln in Sigmaringen.
Zweites Kapitel. An den Quellen der Donau.
Drittes Kapitel. Der Passagier Ilia Bruschs.
Viertes Kapitel. Serge Ladko.
Fünftes Kapitel. Karl Dragoch.
Sechstes Kapitel. Die blauen Augen.
Siebentes Kapitel. Jäger und Wild.
Achtes Kapitel. Ein Frauenbildnis.
Neuntes Kapitel. Die zwei Mißerfolge Dragochs.
Zehntes Kapitel. Gefangen.
Elftes Kapitel. In der Gewalt eines Feindes.
Zwölftes Kapitel. Im Namen des Gesetzes.
Dreizehntes Kapitel. Eine Untersuchungskommission.
Vierzehntes Kapitel. Zwischen Himmel und Erde.
Fünfzehntes Kapitel. Nahe am Ziele.
Sechzehntes Kapitel. Das leere Haus.
Siebzehntes Kapitel. Auf dem Wasser.
Achtzehntes Kapitel. Der Pilot von der Donau.
Neunzehntes Kapitel. Epilog.
Der Pilot von der Donau, Jules Verne
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849613709
www.jazzybee-verlag.de
Cover Design: © Can Stock Photo Inc. / Angelique
Jules Verne – Biografie und Bibliografie
Franz. Schriftsteller, geb. 8. Febr. 1828 in Nantes, gest. 24. März 1905 in Amiens, studierte in Paris die Rechte, muß sich aber schon früh auch den Naturwissenschaften zugewandt haben, denn gleich sein erster Roman, der die Reihe jener originellen, eine völlig neue Gattung begründenden Produkte Vernes eröffnete: »Cinq semainesen ballon« (1863), zeugt von jenem Studium. Der Erfolg, dessen sich diese Schöpfung erfreute, bestimmte ihn, die dramatische Laufbahn, mit der er sich bereits durch mehrere »Comédies« und Operntexte vertraut gemacht hatte, zu verlassen und sich ausschließlich dem phantastisch-naturwissenschaftlichen Roman zu widmen. V. führt seine Leser auf den abenteuerlichsten, stets aber physikalisch motivierten Fahrten nach dem Monde, um den Mond, nach dem Mittelpunkte der Erde, »20,000 Meilen« unter das Meer, auf das Eis des Nordens, auf den Schnee des Montblanc, durch die Sonnenwelt etc., und man kann nicht leugnen, daß er es verstand, die ernste Lehre, wenigstens die große Fülle seiner realen Kenntnisse, mit dem Faden der poetischen Fiktion geschickt zu verweben und dem unkundigen Leser eine gewisse Anschauung von naturwissenschaftlichen Dingen und Fragen spielend beizubringen. Wir nennen hier seine »Aventures du capitaine Hatteras« (1867), »Les enfants du capitaine Grant«, »La découverte de la terre« (1870), »Voyage autour du monde en 80 jours« (1872), »Le docteur Ox« (1874), »Un hivernage dans le glâces«, »Michel Strogoff (Moscou, Ireoutsk)«, »Un capitaine de 15 aus«, »Les Indes noires« (1875), »La maison à vapeur«, »Mathias Sandorf« (1887), »Claudius Bombarnai«, »Le Château des Carpathes« (1892), alle bereits in vielen Ausgaben erschienen und von der Lesewelt verschlungen, auch meist ins Deutsche übersetzt und in Form von Ausstattungsstücken mit nicht geringem Erfolg auf die Bühne gebracht (vgl. »Les voyages an théâtre« von V. und A.Dennery). Die »Œuvres complètes« Vernes erschienen 1878 in 34 Bänden (illustrierte Ausg. 15 Bde.).
Romane:
Fünf Wochen im Ballon. 1875
Reise zum Mittelpunkt der Erde. 1873
Von der Erde zum Mond. 1873
Abenteuer des Kapitän Hatteras. 1875
Die Kinder des Kapitän Grant. 1875
Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer. 1874
Reise um den Mond. 1873
Eine schwimmende Stadt. 1875
Abenteuer von drei Russen und drei Engländern in Südafrika. 1875
Das Land der Pelze. 1875
Reise um die Erde in 80 Tagen. 1873
Die geheimnisvolle Insel. 1875 und 1876
Der Chancellor. 1875
Der Kurier des Zaren. 1876
Reise durch die Sonnenwelt. 1878
Die Stadt unter der Erde. 1878
Ein Kapitän von 15 Jahren. 1879
Die 500 Millionen der Begum. 1880
Die Leiden eines Chinesen in China. 1880
Das Dampfhaus. 1881
Die „Jangada“. 1882
Die Schule der Robinsons. 1885
Der grüne Strahl. 1885
Keraban der Starrkopf. 1885
Der Südstern oder Das Land der Diamanten. 1886
Der Archipel in Flammen. 1886
Mathias Sandorf. 1887
Ein Lotterie-Los. 1887
Robur der Sieger. 1887
Nord gegen Süd. 1888
Zwei Jahre Ferien. 1889
Die Familie ohne Namen. 1891
Kein Durcheinander. 1891
Cäsar Cascabel. 1891
Mistress Branican. 1891
Das Karpatenschloss. 1893
Claudius Bombarnac. 1893
Der Findling. 1894
Meister Antifers wunderbare Abenteuer. 1894
Die Propellerinsel. 1895
Vor der Flagge des Vaterlandes. 1896
Clovis Dardentor. 1896
Die Eissphinx. 1897
Der stolze Orinoco. 1898
Das Testament eines Exzentrischen. 1899
Das zweite Vaterland. 1901
Das Dorf in den Lüften.1901
Die Historien von Jean-Marie Cabidoulin.1901
Die Gebrüder Kip 1903
Reisestipendien. 1903
Ein Drama in Livland. 1904
Der Herr der Welt. 1904
Der Einbruch des Meeres. 1905
Der Pilot von der Donau
Erstes Kapitel. Das Wettangeln in Sigmaringen.
Eines Sonnabends, am 5. August 1876, füllte eine große, lärmende Menge das Gasthaus »Zum Treffpunkt der Fischer«. Gesang, Geschrei, Gläserklang, Beifallsbezeugungen und schallende Ausrufe mischten sich zu einem Höllenlärm, der in fast regelmäßigen Zwischenräumen von den »Hochs« unterbrochen wurde, womit die Deutschen nun einmal ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen gewöhnt sind.
Die Fenster des Gastraumes boten einen Ausblick nach der Donau, am Ende der reizenden kleinen Stadt Sigmaringen, der Hauptstadt der preußischen Enklave Hohenzollern-Sigmaringen, die fast unmittelbar am Ursprung jenes großen mitteleuropäischen Stromes liegt.
Der Einladung der Firma über der Haustür folgend, deren Inschrift in schönen gotischen Buchstaben ausgeführt war, hatten sich hier die Mitglieder des »Donaubundes« versammelt, einer internationalen Vereinigung von Fischern, die den verschiedensten Völkerschaften an den Stromufern angehörten.
Eine festliche Zusammenkunft ist ohne ein Trinkgelage ja kaum denkbar, und so trank man denn auch hier das gute Münchner Gebräu und den feurigen Ungarwein aus vollen Schoppen und vollen Gläsern. Geraucht wurde natürlich auch, und der große Raum war ziemlich verdunkelt von den wohlriechenden Wolken, die unaufhörlich aus den langen Pfeifen aufstiegen. Doch wenn die Gäste einander nicht sehen konnten, so konnten sie sich doch hören, wenigstens wenn sie nicht taub waren.
Ruhig und schweigsam bei der Ausübung ihrer Berufstätigkeit, sind die Angelfischer gerade die lautesten Leute, sobald sie ihre Geräte weggelegt haben. Im Erzählen ihrer Großtaten wetteifern sie mit den Jägern, und das will doch viel sagen!
Augenblicklich war man hier am Ende eines kräftigen Frühstücks, das um die Tische des Gasthauses gegen hundert Teilnehmer versammelt hatte, lauter Ritter der Angelrute, scharfe Wächter des Schwimmers und Fanatiker des Angelhakens. Die Tätigkeit am Vormittage hatte, nach den vielen, zwischen den Desserttellern umherstehenden Flaschen zu urteilen, augenscheinlich ihre Kehlen ausgetrocknet. Jetzt war die Reihe an den zahlreichen Likören, die man als Begleiter einer Tasse Kaffee erfunden hat.
Die Uhr wies auf die dritte Nachmittagsstunde, als sich die mehr und mehr erhitzten Tischgäste erhoben. Freilich schwankten einzelne darunter nicht unbedenklich und hätten die Unterstützung ihrer Nachbarn nicht wohl entbehren können. Die meisten standen aber doch sicher auf den Beinen, als brave und tüchtige Habitués solcher langen Tafelfreuden, die sich bei Gelegenheit des Wettbewerbs des Donaubundes jährlich mehrmals wiederholten.
Diese sehr besuchten und festlich gefeierten Wettkämpfe genossen eines großen Rufes längs des Verlaufs des berühmten gelben Stromes, der ja nicht blau ist, wie er in dem bekannten Straußschen Walzer genannt wird. Teilnehmer an dem Wettbewerbe fanden sich hier aus dem Großherzogtum Baden, aus Württemberg, Bayern, Österreich, aus Ungarn, Serbien, Rumänien und selbst aus den türkischen Vasallenstaaten Bulgarien und aus Bessarabien zusammen.
Die Vereinigung bestand schon seit fünf Jahren und gedieh sichtlich unter der vortrefflichen Leitung ihres Vorsitzenden, des Ungars Miklesko. Ihre immer zunehmenden Mittel erlaubten es, für die Wettbewerbe ansehnliche Preise auszusetzen, und ihr Banner erglänzte von funkelnden Medaillen, den Preisen der Siege über konkurrierende Vereine. Gründlich unterrichtet über die die Stromfischerei betreffende Gesetzgebung, vertrat ihr Direktor die Bundesmitglieder gegenüber dem Staate und einzelnen Personen und verteidigte ihre Rechte mit jener Zähigkeit, man könnte sagen, jener professionellen Starrköpfigkeit, die dem Zweihänder eigen ist, den seine Instinkte als Angelfischer würdig machen, als besondre Klasse der Menschheit betrachtet zu werden.
Der heute beendigte Wettkampf war der zweite des Jahres 1876 gewesen. Früh um fünf hatten die Teilnehmer die Stadt verlassen und sich, etwas stromabwärts von Sigmaringen, an das linke Ufer der Donau begeben. Sie trugen die Uniform des Bundes: eine kurze, die Bewegungen in keiner Weise hemmende Bluse, die Beinkleider in den Schäften der starksöhligen Stiefel und eine weiße Mütze mit breitem Schirm. Natürlich besaßen sie die vollständige Sammlung aller im »Handbuche des gerechten Anglers« aufgezählten Hilfsmittel: Stangen, lange Ruten, kleine Hamen, Schwimmer, Senkblei, Schrot jeden Kalibers für das Garn, Blei, künstliche Fliegen, Schnürchen, Florentiner Roßhaar usw. Die gefangenen Fische – wenn es solche überhaupt gab – waren rechtmäßiges Eigentum des Fischers, von denen sich jeder seinen Platz nach Belieben wählen konnte.
Punkt sechs Uhr waren genau siebenundneunzig Angler, die Schnur in der Hand und bereit, den Haken auszuwerfen, an Ort und Stelle. Ein Trompetensignal verkündete den Beginn des Wettkampfs, und siebenundneunzig Angelschnüre flogen sofort auf das Wasser hinaus.
Für den Wettbewerb waren mehrere Preise ausgeworfen, deren zwei erste, jeder im Betrage von hundert Gulden, den Fischern zufallen sollten, von denen der eine die meisten Fische und der andre den schwersten Fisch gefangen haben würde.
Alles verlief ohne Störung, bis das zweite Trompetensignal, fünf Minuten vor elf, den Wettbewerb schloß. Der Gesamtsang jedes Mitgliedes wurde dann einer Jury unterbreitet, die aus dem Vorsitzenden Miklesko und vier Mitgliedern des Donaubundes bestand. Keiner zweifelte übrigens nicht im mindesten daran, daß diese Auserwählten ihre Entscheidung mit vollster Unparteilichkeit und so treffen würden, daß jeder Widerspruch ausgeschlossen blieb. Immerhin mußte man sich, das Ergebnis ihrer gewissenhaften Prüfung zu erfahren, mit einiger Geduld rüsten, da die Zuteilung der Preise, des einen für das größte Gewicht, des andern für die größte Zahl, bis zur Stunde der Aushändigung geheim bleiben mußte und dieser eine Tafel vorherging, bei der sich alle wie zu einem brüderlichen Liebesmahl vereinten.
Diese Stunde war jetzt gekommen. Die Fischer – ohne die aus Sigmaringen zugeströmten Neugierigen zu rechnen – warteten auf das weitere, bequem vor dem Podium sitzend, worauf der Vorsitzende und die andern Mitglieder der Jury Platz genommen hatten.
Wie es an Sitzgelegenheiten, Bänken, Stühlen und Schemeln nicht fehlte, so waren auch Tische genug vorhanden, und darauf standen Kannen mit Bier, Karaffen mit verschiedenen Likören, nebst einer großen Menge großer und kleiner Gläser.
Alle hatten sich niedergesetzt, die Pfeifen qualmten und der Vorsitzende erhob sich.
»Hört!... Hört!« erschallte es von allen Seiten.
Miklesko leerte als Einleitung ein perlendes Glas Bier, von dem noch Schaumflocken an den Enden seines Schnurrbartes hängen blieben
»Meine werten Kollegen, begann er deutsch, welche Sprache von allen Zugehörigen des Donaubundes trotz deren verschiedner Nationalität verstanden wurde, erwarten Sie von mir keine klassisch angehauchte Rede mit packender Einleitung, breiter Entwicklung und zugespitztem Schlusse. Nein, wir sind hier nicht, um uns an feierlichen Ansprachen zu berauschen, ich werde nur unsre kleinen Angelegenheiten berühren, wie sich's unter guten Kameraden, ich möchte sagen, unter Brüdern, geziemt, wenn diese Bezeichnung für eine so internationale Versammlung zulässig erscheint.«
Diese beiden Sätze, die etwas lang erscheinen werden, wie gewöhnlich die, die beim Beginn einer Verhandlung gedrechselt werden, selbst wenn der betreffende Redner sich vorher gegen jede Weitschweifigkeit verwahrte, wurden mit allgemeinem Beifall aufgenommen, denen sich zahlreiche »Sehr gut!... Sehr gut!« und verschiedene »Hoch!« beimischten.
Miklesko setzte seine Rede damit fort, daß er dem Fischer den höchsten Rang in der menschlichen Gesellschaft zuwies. Er hob von diesem alle Eigenschaften, alle Tugenden hervor, womit die gütige Mutter Natur ihn ausgestattet habe, er wies darauf hin, wie viel Geduld, Scharfsinn, ruhiges Blut und Kenntnisse dazu gehörten, in dieser Kunst des Fischens Erfolge zu erzielen, denn weit mehr als ein Handwerk, wäre es eine Kunst, die er hoch über alle cygenetischen Heldentaten stellte, deren sich die Jäger rühmen.
»Könnte man denn überhaupt, rief er, die Jagd dem Fischfange an die Seite stellen?
– Nein!... Nimmermehr! antwortete die ganze Versammlung.
– Welches Verdienst ist denn dabei, ein Rebhuhn oder einen Hafen zu töten, wenn man das betreffende Wild in guter Schußweite erblickt und wenn ein Hund – haben wir etwa Hunde als Helfer wir? – uns auf dessen Spur geführt hat? Solches Wild sieht einer schon von weitem, zielt darauf mit aller Bequemlichkeit und überschüttet es mit unzähligen Schrotkörnern, von denen doch die meisten vorbeifliegen! – Dem Fische dagegen kann niemand mit dem Blicke folgen, der ist unter dem Wasser verborgen. Welch geschickten Verhaltens, welch zarter Lockung, welches Aufwandes von Scharfsinn und Aufmerksamkeit bedarf es, ihn zu veranlassen anzubeißen, ihn aus dem Wasser zu ziehen, bis er dann luftschnappend an der Angelschnur hängt oder hin und her zappelt, als wenn er dem Siege des Fischers noch selbst seinen Beifall spendete!«
Jetzt erhob sich ein donnernder Applaus. Der Präsident Miklesko kannte offenbar seine Donaubündler. Im Bewußtsein, daß er seinen Genossen nie genug schmeicheln konnte, und ohne Befürchtung, der Übertreibung geziehen zu werden, zögerte er nicht, ihren edeln Beruf über alle andern zu stellen, die eifrigen Anhänger der »Piscicaptologie«, der Wissenschaft des Fischfangs, bis in die Wolken zu erheben und sogar die Erinnerung an die stolze Göttin wachzurufen, die den piscatorischen Spielen des alten Roms bei den halieutischen Zeremonien vorstand.
Ob diese Worte verstanden wurden? Es schien so, wenigens riefen sie ein enthusiastisches Beifallstrappeln hervor.
Nachdem der Vorsitzende Atem geschöpft und einen Schoppen weißschaumigen Bieres geleert hatte, fuhr er folgendermaßen fort:
»Ich habe jetzt uns nur noch zu beglückwünschen wegen des wachsenden Gedeihens unsrer Vereinigung, die jedes Jahr neue Mitglieder heranzieht und deren Ansehen in ganz Mitteleuropa gesichert dasteht. Von ihren Erfolgen brauche ich hier nicht zu sprechen. Sie kennen diese, Sie haben selbst teil daran, und es ist eine große Ehre, an ihren Wettkämpfen teilgenommen zu haben. Die deutsche, die tschechische, die rumänische Presse haben nie mit ihrer für uns so schätzenswerten, doch – ich füge hinzu – wohlverdienten Anerkennung gespart, und wenn ich jetzt mein Glas erhebe, ersuche ich Sie mit einzustimmen auf das Wohlsein der Journalisten, die sich der internationalen Sache des Donaubundes so warm angenommen haben!«
Selbstverständlich entsprachen alle der Aufforderung des Vorsitzenden Miklesko. Die Flaschen entleerten sich in die Gläser und diese wieder in die Kehlen mit derselben Leichtigkeit, wie das Wasser des großen Stromes und seiner Nebenflüsse sich ins Meer ergießt.
Man hätte es hierbei bewenden lassen, wenn die Ansprache des Vorsitzenden mit diesem Toaste geschlossen hätte; dem drängten sich aber noch andre auf, die heute nicht unterdrückt werden konnten.
Der Vorsitzende hatte sich schon, zwischen dem Schriftführer und dem Schatzmeister, die ebenfalls aufgestanden waren, seiner ganzen Länge nach aufgerichtet.
»Ich trinke auf das fernere Blühen und Gedeihen des Donaubundes!« sagte Miklesko, dessen Blicke die ganze Zuhörerschaft streiften.
Alle hatten sich, den Becher am Lippenrande, erhoben. Die einen auf den Bänken, andre auf den Tischen stehend, taten sie dem vereinigten Vorschlag Mikleskos Bescheid.
Als die Gläser geleert waren, erhob sich dieser aufs neue, nachdem er aus den unerschöpflichen Trinkgefäßen, die vor ihm und seinen Beisitzern standen, genippt hatte.
»Auf das Wohlsein der verschiednen Nationalitäten, der Badener und Württemberger, der Bayern und Österreicher, der Ungarn und Serben, der Walachen und Moldauer, der Bulgaren und Bessarabier, die der Donaubund in seinen Reihen zählt!«
Und Bessarabier, Bulgaren, Moldauer und Walachen, Serben und Ungarn, Österreicher und Bayern, Württemberger und Badener antworteten ihm wie ein Mann, indem sie den Inhalt ihrer Gläser verschlangen.
Endlich schloß der Vorsitzende seine Ansprache mit der Ankündigung, daß er auf die Gesundheit aller einzelnen Mitglieder des Bundes trinke. Da es deren aber vierhundertdreiundsiebzig gab, sah er sich leider gezwungen, alle in einem einzigen Toaste zusammenzufassen.
Man antwortete ihm jedoch mit Tausenden und Abertausenden »Hochs!« die sich fortsetzten, bis die Leistungsfähigkeit der Männerstimmen erschöpft war.
So verlief der zweite Teil des Programms, nachdem der erste mit seinen Tafelgenüssen beendigt worden war. Der dritte Teil sollte nun die Verkündigung der Preisträger bringen.
Jeder wartete darauf mit erklärlicher Spannung, denn das Geheimnis der Jury war, wie erwähnt, bewahrt worden. Jetzt kam der Augenblick, wo es endlich bekannt werden sollte.
Der Präsident Miklesko unterzog sich seiner Verpflichtung, die offizielle Liste der Belohnungen in den beiden Kategorien zu verlesen.
Entsprechend den Bundessatzungen wurden die minderwertigen Preise zuerst verkündigt, was der Verlesung der Namen der Gewinner ein zunehmendes Interesse verleihen mußte.
Auf den Aufruf ihres Namens erschienen die Empfänger der geringern Preise vor dem Podium. Der Vorsitzende erteilte ihnen den Ritterschlag, indem er ihnen ein Diplom und je nach dem errungenen Range eine kleinere oder größere Summe einhändigte.
Die in den Netzen enthaltenen Fische waren von der Art, wie sie jeder Fischer in der Donau fangen kann: Stichlinge, Rotaugen, Schollen, Barsche, Schleien, Hechte u. a. Walachen, Ungarn, Badener und Württemberger gehörten zu den Gewinnern der kleinern Preise.
Der zweite Preis, siebenundsiebzig erbeutete Fische, wurde einem Deutschen Namens Weber zuerkannt, dessen Erfolg alle mit lebhaften Beifallskundgebungen begrüßten. Dieser Weber war unter seinen Vereinsgenossen schon lange gut bekannt. Bei den frühern Wettkämpfen hatte er schon oft zu den Höchstbelohnten gehört, und man erwartete, daß er auch heuer noch den ersten Preis für die größte Anzahl Fische davontragen würde.
Doch nein; in seinem Garn fanden sich nur siebenundsiebzig Fische, siebenundsiebzig wohlgezählt und nochmals gezählt, während ein – wenn auch nicht geschickterer, so doch glücklicherer – Mitbewerber neunundneunzig in seinem Netze hatte.
Jetzt wurde der Name dieses Meisteranglers aufgerufen. Es war der Ungar Ilia Brusch.
Die etwas verwunderte Versammlung spendete keinen Beifall, als sie den Namen des den Mitgliedern des Donaubundes noch unbekannten Ungars hörte, der dem Vereine erst ganz kürzlich beigetreten war.
Da der Preisträger nicht geglaubt hatte, sich zeigen zu müssen, um einen Preis von hundert Gulden zu empfangen, nahm der Vorsitzende ohne Zögern die Liste der Gewinner der Gewichtspreise vor. Die Preisträger waren Rumänen, Slawen und Österreicher. Als der Name dessen aufgerufen wurde, dem der zweite Preis zugefallen war, ertönte ein Beifall, als wenn es der des Deutschen Weber gewesen wäre. Herr Ivetozar, einer der Beisitzer, triumphierte mit einer dreiundeinhalbpfündigen Karausche, die einem minder gewandten und weniger kaltblütigen Angler gewiß entgangen wäre. Ivetozar war eines der bekanntesten tätigsten und dem Bunde ergebensten Mitglieder, und er war es auch, der sich in der letzten Zeit die größte Zahl Belohnungen erworben hatte. Eben deshalb wurde ihm jetzt auch der einstimmigste Beifall zuteil.
Nun stand nur noch die Erklärung des ersten Preises dieser Abteilung aus, und alle Herzen klopften lauter in Erwartung des Namens des Preisträgers.
Wie groß war aber das Erstaunen, ja noch mehr als Erstaunen, die allgemeine Verblüffung, als der Vorsitzende Miklesko mit kaum unterdrücktem Erzittern der Stimme anhub:
»Erster Gewichts-Preisträger für einen Hecht von siebzehn Pfund der Ungar Ilia Brusch!«
In der Versammlung herrschte lautlose Stille. Die schon zum Klatschen bereiten Hände rührten sich nicht, wer den Sieger hatte beglückwünschen wollen, blieb mäuschenstill. Das lebhafte Gefühl von Neugier hatte alle gelähmt.
Würde Ilia Brusch nun endlich erscheinen? Würde er jetzt hervortreten, vom Präsidenten Miklesko die Ehrendiplome und die begleitenden zweihundert Gulden in Empfang zu nehmen?
Plötzlich lief ein Murmeln durch die Gesellschaft.
Einer der Anwesenden, der sich bisher abseits gehalten hatte, ging auf das Podium zu.
Es war das der Ungar Ilia Brusch.
Nach seinem sorgfältig rasierten und mit dichtem, schwarzem Haar umrahmten Gesicht zu urteilen, hatte Ilia Brusch das dreißigste Jahr noch nicht überschritten. Von etwas übermittlerm Wuchs, breitschultrig und mit tüchtig entwickelten Gliedern, mußte er sich einer nicht gewöhnlichen Kraft erfreuen. Es überraschte tatsächlich, daß ein junger Mann von diesem Gusse sich der friedlichen Zerstreuung des Angelns und das so gründlich gewidmet hatte, daß er diese schwierige Kunst wirklich beherrschte, wovon ja sein Erfolg bei dem Wettbewerb einen unanfechtbaren Beweis geliefert hatte.
Eine weitere auffallende Eigentümlichkeit Ilia Bruschs bestand darin, daß er offenbar an irgendwelcher Sehstörung zu leiden schien. Große dunkle Brillengläser verbargen seine Augen, deren Farbe zu erkennen ganz unmöglich gewesen wäre. Das Sehvermögen ist aber einer der wichtigsten Sinne für den, der den oft kaum wahrnehmbaren Bewegungen des Schwimmers folgen muß, und scharfe Augen braucht, wer über die vielfachen Listen des Fisches siegen will.
Doch ob man nun darüber erstaunte oder nicht, hier mußte man sich den Tatsachen fügen. Die Unparteilichkeit der Jury konnte nicht angezweifelt werden: Ilia Brusch war der Sieger im Wettkampfe und das unter Bedingungen, die, soweit sich die Bündler erinnern konnten, vorher von niemand erfüllt worden waren. Die Versammlung taute auch allgemach auf und schallende Beifallsrufe begrüßten den zweifachen Sieger in dem Augenblicke, wo er seine Diplome nebst den Geldpreisen aus den Händen des Präsidenten Miklesko empfing.
Als das erledigt war, hatte aber Ilia Brusch, statt sich vom Podium zu entfernen, noch ein kurzes Zwiegespräch mit dem Vorsitzenden und wandte sich dann an die ihn beobachtende Versammlung, die er durch eine Handbewegung um Ruhe ersuchte. Sofort wurde es auch wieder ganz still.
»Meine Herren und liebe Kollegen, begann Ilia Brusch, ich bitte Sie um die Erlaubnis, einige Worte an Sie richten zu dürfen, nachdem der Herr Vorsitzende mir das gestattet hat.«
Man hätte jetzt in dem eben noch so geräuschvollen Saale eine Mücke dahinfliegen hören können. Worauf mochte diese im Programm nicht vorgesehene Ansprache hinauslaufen?
»Mich drängt es zuerst, fuhr Ilia Brusch fort, Ihnen zu danken für Ihre Teilnahme und Ihren Beifall^ ich bitte Sie aber zu glauben, daß ich mich über den doppelten Erfolg, der mir zuteil wurde, nicht stolzer fühle, als dieser es verdient. Ich weiß recht gut, daß dieser Erfolg, wenn er dem Würdigsten beschert werden sollte, irgendeinem ältern Mitgliede des Donaubundes hätte zufallen müssen, des Vereins, der so reich ist an tüchtigen Fischern, und daß ich den heutigen Sieg weit weniger meinem Verdienste, als einem glücklichen Zufall verdanke.«
Die Bescheidenheit dieses ersten Auftretens wurde von den Zuhörern lebhaft gewürdigt, und aus ihren Reihen hörte man sogar einige halblaute »Sehr gut!«
»Diesem günstigen Zufall muß ich noch gerecht werden und habe deshalb einen Plan entworfen, von dem ich glaube, daß er diese Vereinigung angesehener Angelfischer interessieren dürfte.
Gegenwärtig, verehrte Kollegen, sind die Rekords in der Mode. Warum sollten wir nicht den Champions andrer, dem unsern gegenüber doch niedriger stehender Sports nachahmen und nicht den Versuch machen, einen Rekord im Fischfang zu schaffen?«
Aus dem Zuhörerkreise wurden einzelne halberstickte Ausrufe laut. Man hörte einige »Ah, ah!«, einige »Sieh da!... Sieh da!« und »Warum denn nicht!«, da jeder Genosse dem empfangenen Eindruck seinem Temperamente nach Ausdruck verlieh.
»Als mir dieser Gedanke zum erstenmal kam, fuhr der Redner inzwischen fort, habe ich ihn sofort festgehalten und auch sofort erkannt, in welcher Weise er verwirklicht werden sollte. Mein Verhältnis als Zugehöriger des Donaubundes setzt übrigens der Aufgabe gewisse Grenzen. Als Donaubündler konnte ich zur glücklichen Durchführung meines Planes nur die Donau ins Auge fassen.
Ich habe mir also vorgenommen, unsern berühmten Strom von seiner Quelle bis zum Schwarzen Meer hinunterzufahren und auf der dreitausend Kilometer langen Strecke ausschließlich vom Ertrage meines Fischfangs zu leben.
Der Zufall, der mich heute begünstigt hat, würde, wenn es möglich wäre, mein Verlangen, diese Reise auszuführen, nur noch steigern, einer Reise, die sicherlich nicht des Interesses entbehrt, und deshalb teile ich Ihnen heute schon mit, daß meine Abfahrt auf den 10. August, also auf nächsten Donnerstag, festgesetzt ist, an welchem Tage Sie mich unmittelbar am Ursprung der Donau treffen würden.«
Es ist weit leichter, die Begeisterung, die diese unerwartete Mitteilung erweckte, sich vorzustellen, als sie zu beschreiben. Fünf Minuten lang wütete ein richtiger Sturm von »Hochs!« und maßlosen Beifallsrufen.
Ein solcher Zwischenfall konnte aber nicht in dieser Weise auslaufen. Herr Miklesko sah das ein und handelte, wie immer, als ein richtiger Präsident. Noch einmal erhob er sich, vielleicht etwas mit Beschwerde, zwischen seinen beiden Vorstandskollegen.
»Aufs Wohl unsres Kollegen Ilia Brusch!« rief er, ein Champagnerglas schwingend, mit bewegter Stimme.
»Auf unsern Kollegen Ilia Brusch!« antwortete die Versammlung mit Donnergetöse, dem unmittelbar ein tiefes Schweigen folgte, da es, infolge eines bedauernswerten Versehens der Natur, menschlichen Wesen nicht möglich ist, gleichzeitig zu rufen und zu trinken.
Das Stillschweigen dauerte jedoch nicht lange. Der funkelnde Wein hatte den erschlafften Kehlen bald neue Kraft verliehen, noch unzählige Gesundheiten auszubringen bis zu dem Augenblicke, wo unter allgemeinem Jubel der berühmte, an demselben Tage, dem 5. August 1876, veranstaltete Angelwettkampf des Donaubundes in der reizenden kleinen Stadt Sigmaringen geschlossen wurde.
Zweites Kapitel. An den Quellen der Donau.
War Ilia Brusch wohl von Ruhmsucht geleitet gewesen, als er seinen im »Treffpunkt der Fischer« versammelten Kollegen seinen Plan, mit der Angel in der Hand die Donau hinunterzufahren, verkündigte? Wenn er solchen Ruhm erstrebt hatte, so war ihm das geglückt. Die Presse hatte sich der Angelegenheit bemächtigt, und alle Zeitungen des Donaugebietes ohne Ausnahme hatten eine Abbildung des Wettbewerbes von Sigmaringen mit mehr oder weniger ausführlichem Text gebracht, der aber immer hinreichte die Eigenliebe des Siegers angenehm zu kitzeln, dessen Name schon auf dem Wege war, überall populär zu werden.
Schon am nächsten Tage, am 6. August, enthielt die Wiener »Neue Freie Presse« folgenden Artikel:
»Der letzte Angelwettstreit des Donaubundes hat gestern in Sigmaringen mit einem richtigen Theatercoup geendet, dessen Held ein Ungar mit dem bis gestern unbekannten und heute fast schon berühmten Namen Ilia Brusch gewesen ist.
Was hat denn, fragen Sie, Ilia Brusch getan, einen so plötzlichen Ruhm zu verdienen?
Vor allem ist es diesem geschickten Mann gelungen, die beiden ersten Preise, den für die meisten gefangenen Fische und den für den schwersten, auf sich zu vereinigen, indem er seine Mitbewerber weit hinter sich ließ, ein Ereignis, das seit dem Bestehen der Wettstreite dieser Art noch niemals beobachtet worden ist.
Das war ja nicht übel, doch es kommt noch besser.
Wenn man eine solche Lorbeerernte eingeheimst, einen so glänzenden Sieg davongetragen hat, scheint es doch, sollte man das Recht haben, eine verdiente Ruhe zu genießen. Das ist aber nicht die Ansicht dieses erstaunlichen Ungars, der sich vorbereitet, noch mehr Erstaunen zu erwecken.
Wenn wir recht unterrichtet sind – und man kennt ja die Zuverlässigkeit unsres Nachrichtendienstes – hatte Ilia Brusch seinen Kollegen angekündigt, die ganze Donau von ihrer Quelle im Großherzogtum Baden an bis zu ihrer Mündung am Schwarzen Meer, d. h. etwa eine Strecke von dreitausend Kilometern, mit der Angel in der Hand hinunterzufahren.
Wir werden unsre Leser bezüglich der Vorfälle bei diesem originellen Unternehmen auf dem Laufenden erhalten.
Nächsten Donnerstag den 10. August wird Ilia Brusch dazu aufbrechen. Wünschen wir ihm glückliche Reise, doch wir wollen auch wünschen, daß dieser schreckliche Fischersmann das Getier, das die Fluten der Donau bevölkert, nicht etwa bis zum letzten Vertreter ausrotte.«
So sprach sich die »Neue Freie Presse« Wiens aus. Der »Pester Lloyd« von Budapest zeigte sich nicht minder warm interessiert, ebenso wie die serbische »Srbské Noviné« von Belgrad und der »Românul« von Bukarest, in denen die betreffende Notiz zu einem längern Artikel ausgesponnen war.
Diese Druckerzeugnisse waren höchst geeignet, die Aufmerksamkeit auf Ilia Brusch hinzulenken, und wenn es zutrifft, daß die Presse der Widerschein der öffentlichen Meinung ist, so konnte dieser erwarten, ein mit der weitern Fortsetzung seiner Fahrt immer nur zunehmendes Interesse zu erregen.
In den bedeutenderen an seinem Wasserwege gelegnen Städten konnte er ja überdies darauf rechnen, Mitglieder des Donaubundes zu treffen, die es als eine Pflicht betrachten würden, zum Ruhme ihres Kollegen beizutragen, und im Notfall konnte er bei diesen wohl auch auf Beistand und Hilfe rechnen.
Von jetzt an bekamen die Besprechungen der Presse eine besondre Wichtigkeit für die Angelfischer. In den Augen dieser Professionellen gewann das Unternehmen Ilia Bruschs eine ungeheure Bedeutung, und viele Bündler, die durch den eben abgeschlossenen Wettbewerb nach Sigmaringen gelockt worden waren, verweilten jetzt hier noch länger, um der Abfahrt des ersten Siegers des Donaubundes beizuwohnen.
Wenn sich einer nicht über die Verlängerung ihres Aufenthaltes zu beklagen hatte, war es entschieden der Wirt im »Treffpunkt der Fischer«. Am Nachmittag des 8. August, zwei Tage vor dem von Brusch für den Antritt seiner originellen Fahrt bestimmten Termine, führten noch mehr als dreißig trinkfeste Männer ein lustiges Leben im Saale des Gasthauses, dessen Kasse sich bei der Fähigkeit dieser auserlesenen Kunden, viel zu verzehren, ganz unerwarteter Einnahmen erfreute.
Doch trotz der Nähe des Ereignisses, das diese Neugierigen in der Hauptstadt von Hohenzollern zurückgehalten hatte unterhielt man sich am Abend des 8. August im »Treffpunkt der Fischer« nicht von dem Helden des Tages. Eine andre und für die Uferbewohner des großen Stromes noch wichtigere Angelegenheit bildete den Gegenstand des allgemeinen Gesprächs und erregte nicht wenig alle Anwesenden.
Diese Aufregung war nicht etwa übertrieben, sondern durch verbürgte, sehr ernste Vorkommnisse völlig gerechtfertigt.
Seit mehreren Monaten wurden die Ufergebiete der Donau von ununterbrochenen Räubereien heimgesucht. Die verwüsteten Gehöfte, die geplünderten Schlösser und ausgeraubten Villen waren gar nicht mehr zu zählen, und mehrere Personen hatten ihren Widerstand gegen die unergreifbaren Verbrecher auch schon mit dem Leben bezahlt.
Ohne Zweifel konnte eine so lange Reihe von Schandtaten nicht von einigen vereinzelt operierenden Burschen ausgeführt werden; sicherlich hatte man es hier mit einer wohlorganisierten und, nach den vielen Überfällen zu urteilen, recht zahlreichen Bande zu tun.
Seltsamerweise operierte diese Bande aber nur in der unmittelbaren Nähe der Donau. Jenseits eines Streifens von zwei Kilometern Breite an jedem Ufer konnte man ihr auch nicht ein einziges Verbrechen mit Wahrscheinlichkeit anrechnen. Der Schauplatz ihrer Tätigkeit schien aber nur bezüglich seiner Breite beschränkt zu sein, denn das österreichische, ungarische, serbische und rumänische Ufergelände wurde in gleicher Weise von den Banditen belästigt, die man niemals auf frischer Tat abfassen konnte.
Hatten sie eine Schandtat ausgeführt, so verschwanden sie bis zum nächsten Verbrechen, das vielleicht hunderte von Kilometern von dem letzten entfernt begangen wurde. In der Zwischenzeit war jede Spur von ihnen verschwunden. Sie schienen sich ebenso verflüchtigt zu haben, wie die oft recht umfangreichen Gegenstände, die ihre Beute bildeten.
Die in Frage kommenden Regierungen hatten allmählich aufgehört, sich über ihre fortwährenden Mißerfolge zu erregen, da für diese wegen mangelnder Zusammenwirkung der polizeilichen Kräfte keine einzelne haftbar zu machen war. Über die Angelegenheit hatte sich endlich ein diplomatischer Meinungsaustausch entwickelt, und diese Verhandlungen endigten, wie die Morgenzeitungen vom 8. August mitteilten, mit der Errichtung einer internationalen Polizeitruppe, die unter einem einzigen Chef längs des ganzen Laufes der Donau tätig sein sollte. Die Wahl dieses Chefs hatte freilich Schwierigkeiten verursacht, endlich aber hatten sich die Stimmen auf einen weit bekannten und erfolgreichen ungarischen Geheimpolizisten Namens Karl Dragoch vereinigt.
Karl Dragoch war in der Tat ein hervorragender Polizist, und die ihm anvertraute schwierige Aufgabe hätte gewiß keinem Würdigern zufallen können. Fünfundvierzig Jahre alt, war er ein Mann von Mittelgröße, etwas mager, und mit Geistesgaben mehr ausgestattet als mit besondrer Körperkraft. Immerhin war er imstande, die Anstrengungen, die sein Beruf mit sich brachte, zu ertragen, und an Mut, der Gefahr ins Gesicht zu sehen, fehlte es ihm auch nicht. Eigentlich wohnte er in Budapest meist befand er sich aber, mit einer Takt erfordernden Nachforschung beschäftigt, irgendwo unterwegs. Seine gründliche Kenntnis aller Sprachen Südost-Europas, einschließlich der deutschen, der rumänischen, serbischen, bulgarischen und türkischen Sprache, seiner Muttersprache, des Ungarischen, nicht zu erwähnen, ließ ihn nie und nirgends in Verlegenheit kommen, und in seiner Eigenschaft als Junggeselle brauchte er nicht zu befürchten, daß Familiensorgen seine Bewegungsfreiheit beschränken könnten.
Seine Ernennung machte überall einen guten Eindruck. Die Allgemeinheit billigte sie mit Einstimmigkeit. Im großen Saale des »Treffpunktes der Fischer« wurde sie mit besondrer Genugtuung aufgenommen.
»Eine bessre Wahl hätte man nicht treffen können, erklärte in dem Augenblicke, wo im Gasthause die Lampen angezündet wurden, Herr Ivetozar, der zweite Preisträger in der Gewichtskonkurrenz bei dem eben beendigten Wettkampf. Ich kenne Dragoch. Das ist ein ganzer Mann.
– Und ein äußerst gewandter obendrein, fügte der Präsident Miklesko hinzu.
– So wollen wir nur wünschen, bemerkte ein Kroate mit dem schwer aussprechbaren Namen Sarb, daß es ihm gelinge, die Ufer des Stromes zu säubern. Das Leben da war wirklich fast unerträglich geworden!
– Nun, Karl Dragoch kann sich hierbei die Zähne ausbeißen, meinte Weber, den Kopf schüttelnd. Erst müssen wir ihn am Werke sehen.
– Am Werke! rief Ivetozar; das ist er gewiß schon. Verlassen Sie sich darauf.
– Ja, sicherlich! stimmte ihm Miklesko zu. Karl Dragoch ist nicht der Mann dazu, seine Zeit zu verlieren. Wenn seine Ernennung, wie die Zeitungen berichten, vor vier Tagen erfolgt, ist er jetzt wenigstens schon drei Tage unterwegs.
– Wo will er aber seine Tätigkeit anfangen? fragte ein gewisser Piscea, ein Rumäne mit einem für einen Angler besonders passenden Namen. Ich muß gestehen, ich käme in Verlegenheit, wenn ich an seiner Stelle wäre, und...
– Deswegen hat man Ihnen diese auch nicht übertragen, fiel ein Serbe scherzend ein. Glauben Sie nur getrost, daß Dragoch deshalb nicht in Verlegenheit kommt. Seinen Plan kann man natürlich nicht kennen. Vielleicht hat er sich nach Belgrad begeben, vielleicht ist er in Budapest geblieben... wenn ers nicht etwa gar vorgezogen hat, hierher nach Sigmaringen zu kommen, so daß er sich vielleicht unter uns im, Treffpunkt der Fischer' befindet!«
Diese Vermutung erregte allgemeine Heiterkeit.
»Unter uns! rief Herr Weber. Sie suchen uns da eine derbe Nase aufzuheften, Michael Michaelowitsch. Was hätte er denn hier zu suchen, hier, wo man seit Menschengedenken nicht das geringste Verbrechen zu beklagen gehabt hat?
– Oho, entgegnete Michael Michaelowitsch, könnte er nicht der Abfahrt Ilia Bruschs haben beiwohnen wollen? Das interessiert den Mann doch vielleicht... wenn Ilia Brusch und Karl Dragoch nicht gar einunddieselbe Person sind.
– Was? Einunddieselbe Person? rief man von allen Seiten. Wie kommen Sie darauf?
– Sapperment, das wäre stark! Unter der Haut des Preisträgers würde niemand den Polizisten ahnen, der so die Donau in aller Freiheit inspizieren könnte!«
Der wunderliche Einfall erregte bei den andern Anwesenden großes Aufsehen. Dieser Michael Michaelowitsch! Nur der konnte doch auf solche Gedanken kommen.
Michael Michaelowitsch versteifte sich jedoch nicht auf seine erste Vermutung.
»Wenigstens wenn... begann er, eine Wendung gebrauchend, die ihm vertraut zu sein schien.
– Wenigstens wenn?
– Wenigstens wenn Karl Dragoch nicht einen andern Grund gehabt hat, hierher zu kommen, fuhr er fort, indem er ohne weitres zu einer andern kaum weniger phantastischen Hypothese überging.
– Welchen Grund?
– Nehmen Sie zum Beispiel an, der Plan, die Donau mit der Angel in der Hand hinunterzufahren, wäre ihm verdächtig erschienen.
– Verdächtig!... Warum verdächtig?
– Alle Wetter, es wäre ja nicht dumm, auch nicht von einem geriebenen Gauner, sich unter der Maske eines Fischers, und obendrein eines so viel genannten Fischers, zu verstecken. Eine solche Berühmtheit wiegt alle Inkognitos der Welt auf. Da könnte einer bequem hundertmal einen Schlag ausführen, wenn er in der Zwischenzeit immer friedlich angelt.
– Das Angeln muß man aber verstehen, warf der Präsident Miklesko absprechenden Tones ein, und das ist ein Privileg, das nur ehrlichen, anständigen Leuten vorbehalten ist.«
Diese vielleicht etwas zu gewagte Bemerkung wurde von den leidenschaftlichen Anglern mit einem maßlosen Beifallsrufen begrüßt. Michael Michaelowitsch nahm mit bemerkenswertem Takt davon den ihm zukommenden Anteil in Anspruch.
»Auf die Gesundheit unsres Präsidenten! rief er, sein Glas erhebend.
– Auf die Gesundheit unsres Präsidenten! wiederholten die andern und leerten ihre Gläser wie ein Mann.
– Auf die Gesundheit des Herrn Präsidenten! rief noch ein allein an einem Tische sitzender Gast, der seit einigen Minuten ein lebhaftes Interesse an den rings um ihn gewechselten Reden zu nehmen schien.
Den Vorsitzenden berührte die liebenswürdige Aufmerksamkeit des Unbekannten offenbar angenehm, und wie zum Danke trank er ihm mit einer leicht zu verstehenden Handbewegung zu. Der vereinsamte Trinker, der durch diese höfliche Geste das Eis hinreichend gebrochen glaubte, hielt sich daraufhin für berechtigt, der ehrbaren Gesellschaft gegenüber auch mit den von ihm gewonnenen Eindrücken nicht zurückzuhalten.
»Vortrefflich gesprochen! sagte er. Ja, der Angelfischfang ist nur ein Vergnügen für ehrenwerte Leute!
– Und haben wir hier das Vergnügen, mit einem Bundeskameraden zu sprechen? fragte Miklesko, auf den Unbekannten zutretend.
– O nein, antwortete dieser bescheiden, höchstens mit einem Amateur, der sich über hervorragende Leistung herzlich freut, doch nicht den Ehrgeiz hat, sie nachzuahmen.
– Desto bedauerlicher, Herr... Herr...
– Jäger.
– Desto bedauerlicher, Herr Jäger, denn ich muß daraus schließen, daß wir niemals die Ehre haben werden, Sie zu den Mitgliedern des Donaubundes zählen zu dürfen.
– O, wer weiß? antwortete Herr Jäger. Ich könnte mich doch vielleicht entschließen, die Schnur selbst in die Hand zu nehmen, und von dem Tage an werd' ich auch zu Ihrer Vereinigung gehören, vorausgesetzt, daß ich die Bedingungen erfülle, wovon Sie die Aufnahme abhängig machen.
– Daran zweifeln Sie nur nicht, versicherte eiligst Miklesko in der Hoffnung, einen neuen Anhänger des Bundes zu gewinnen. In dieser Beziehung bestehen nur vier, sehr einfache Bedingungen. Die erste und wichtigste ist die Entrichtung eines geringen jährlichen Beitrags.
– Das versteht sich, erklärte Herr Jäger lächelnd.
– Die zweite ist die, den Fischfang zu lieben, die dritte, ein angenehmer Gesellschafter zu sein, und diese dritte betrachte ich jetzt bereits als erfüllt.
– Zu liebenswürdig! sagte Jäger dankend.
– Was die vierte betrifft, besteht sie einzig und allein in der Einzeichnung des Namens und der Adresse in die Mitgliederlisten der Gesellschaft. Ihren Namen kenne ich ja schon, wenn ich nun noch Ihre Adresse erführe...
– Wien, Leipziger Straße 43.
– Für zwanzig Kronen jährlich wären Sie nun ein fertiger Donaubündler.«
Die beiden Herren singen herzlich an zu lachen
»Andre Förmlichkeiten kommen nicht in Frage?
– Keine einzige.
– Muß man seine Person nicht durch amtliche Papiere ausweisen?
– Ich bitte Sie, Herr Jäger, erwiderte Miklesko, dessen bedarfs für das Angeln nicht.
– Das ist ja richtig, stimmte Jäger ein, und es ist übrigens auch nicht von Bedeutung. Im Donaubunde kennen doch alle einander persönlich.
– O nein, im Gegenteil, belehrte ihn Miklesko. Bedenken Sie nur, einige unsrer Mitglieder wohnen hier in Sigmaringen, andre wieder an der Küste des Schwarzen Meeres; das bedingt doch sozusagen eine Nachbarschaft mit Hindernissen.
– Ja freilich!
– Nehmen Sie zum Beispiel unsern merkwürdigen Preisträger vom letzten Wettkampf...
– Ilia Brusch?
– Ganz recht. Nun sehen Sie, den kennt keiner von uns.
– Unmöglich!
– Und doch ist es so, versicherte Miklesko; freilich gehört er dem Bunde erst seit vierzehn Tagen an. Für alle Mitglieder war Ilia Brusch eine Überraschung, nein, noch mehr, eine wirkliche Neuentdeckung.
– Was man so im Turfjargon einen Outsider nennt.
– Ganz richtig.
– Und aus welchem Lande stammt dieser Outsider?
– Er ist ein Ungar.
– Also wie Sie, denn Sie, Herr Präsident sind, wie ich glaube, auch Ungar.
– Ungarisches Vollblut, Herr Jäger, Ungar aus Budapest.
– Und Ilia Brusch?
– Ist aus Szalka gebürtig.
– Szalka? Wo und was ist das?
– Ein Marktflecken, wenn Sie wollen, eine kleine Stadt am rechten Ufer des Ipoly, eines Flusses, der sich ein paar Meilen oberhalb Budapest in die Donau ergießt.
– Da werden Sie, Herr Miklesko, ihm also leicht einen Besuch als Nachbar abstatten können, meinte Jäger lächelnd.
– Jedenfalls aber nicht vor Verlauf von zwei oder drei Monaten, antwortete im gleichen Tone der Vorsitzende des Donaubundes: diese Zeit wird er wohl zu seiner Fahrt brauchen.
– Außer wenn er sie überhaupt nicht ausführt!« warf der drollige Serbe ein, der ohne Umstände in das Gespräch der beiden Herren eingriff.
Jetzt kamen auch noch andre Fischer näher heran. Die Herren Jäger und Miklesko wurden zum Mittelpunkte einer kleinen Gruppe.
»Was wollen Sie damit sagen? fragte Miklesko. Sie haben eine lebhafte Phantasie, Michael Michaelowitsch.
– O, es war nur ein Scherz, bester Herr Präsident, erklärte der lustige Serbe. Doch wenn Ilia Brusch Ihrer Ansicht nach weder ein Polizist, noch ein Übeltäter sein kann, warum könnte er da nicht ein Spaßvogel sein, der uns an der Nase umherführt?«
Miklesko faßte die Sache weit ernster auf.
»Sie sind wohl etwas gehässiger Natur, Michael Michaelowitsch, erwiderte er. Das kann Ihnen früher oder später noch einmal recht schlecht bekommen. Auf mich hat Ilia Brusch den Eindruck eines braven und gewissenhaften Mannes gemacht. Übrigens ist er Mitglied des Donau »bundes... das sagt genug.
– Bravo!« ertönte es von allen Seiten.
Ohne wegen der ihm erteilten Lektion irgend wie verlegen zu erscheinen, ergriff Michael Michaelowitsch mit bewundernswerter Geistesgegenwart diese neue Gelegenheit, einen Toast auszubringen.
»Wenn es sich so verhält, rief er, seinen Humpen ergreifend, dann einen Schluck auf das Wohlergehen Ilia Bruschs!
– Auf das Wohlergehen Ilia Bruschs!« antwortete der Chor, ohne Jäger auszunehmen, wie aus einem Munde, denn auch... Jäger trank sein Glas gewissenhaft bis zum letzten Tropfen aus.
Der letzte merkwürdige Einfall Michael Michaelowitschs war jedoch vielleicht nicht ebenso unsinnig wie die frühern. Nach der etwas prahlerischen Verkündigung seines Planes war Ilia Brusch noch nicht wieder zum Vorschein gekommen; ebensowenig hatte jemand von ihm reden hören. War es nicht auffallend, daß er sich so verborgen hielt, und konnte man nicht mit Recht vermuten, daß er seinen zu leichtgläubigen Kollegen nur hätte etwas weismachen wollen? Hierüber klar zu werden, das konnte ja in jedem Falle nicht lange dauern: binnen sechsunddreißig Stunden mußten die Bündler wissen, woran sie bezüglich dieser Sache waren.
Die, die sich hierfür interessierten, brauchten sich nur wenige Meilen von Sigmaringen stromaufwärts zu begeben. Dort würden sie sicherlich Ilia Brusch finden, wenn der ein ebenso ehrenhafter Mann war, wie ihn der Vorsitzende Miklesko in gutem Glauben hinstellte.
Immerhin konnte hier noch eine Schwierigkeit auftauchen: War denn die Lage der richtigen Quelle des großen Stromes genau festgestellt? Herrschte über diesen Punkt nicht noch eine gewisse Unsicherheit, da auch die besten Karten die betreffende Stelle nicht zweifellos angaben? Und wenn man sich bemühte, Ilia Brusch an einer solchen zu treffen, konnte der da nicht recht gut gerade an einer andern sein?
Zweifelhaft ist es ja keineswegs, daß die Donau, der Ister der Alten, im Großherzogtum Baden entspringt. Die Geographen erklären sogar, diese Stelle läge unter 6 Minuten östlicher Länge und 37 Grad 48 Minuten nördlicher Breite. Dieser Lagenbestimmung fehlt aber – ihre Richtigkeit angenommen – neben der Zahl der Bogenminuten die Zahl der Sekunden; die Lage der Stelle ist damit also nur ungenau angegeben. Hier handelte es sich aber doch darum, die Schnur genau an dem Punkte auszuwerfen, von dem aus der erste Tropfen Donauwasser nach dem Schwarzen Meere zu rinnen beginnt.
Nach einer Sage, die lange Zeit das Ansehen einer geographischen Tatsache genoß, sollte die Donau inmitten eines Gartens entspringen, und zwar aus dem der Fürsten von Fürstenberg. Ihre Wiege wäre danach ein Marmorbecken, aus dem sehr viele Touristen ihre Becher und Feldflaschen gefüllt haben. Sollte man nun Ilia Brusch am Morgen des 10. August am Rande dieses unerschöpflichen Wasserbeckens erwarten?
Nein, dort ist nicht die richtige Stelle, die authentische Quelle des großen Stromes. Man weiß jetzt, daß er aus der Vereinigung zweier Bäche, der Brege und der Brigach, entsteht, die sich aus der Höhe von achthundertfünfundsiebzig Metern durch den Schwarzwald ergießen. Ihre Wässer vereinigen sich dann bei Donaueschingen, wenige Meilen oberhalb Sigmaringens und fließen von hier unter dem gemeinschaftlichen Namen Donau weiter.





























