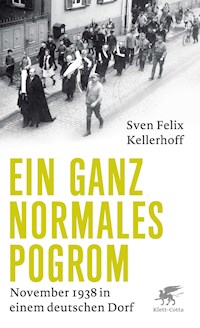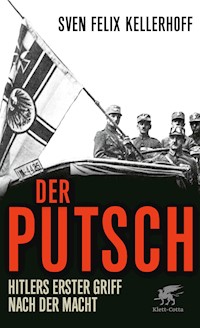
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Demokratie an ihrem Abgrund: Hitlers fast geglückte »Machtergreifung« 1923 Es ist die bis dahin größte Bedrohung für die Weimarer Republik: Mit roher Gewalt wagt Hitler von München aus den Umsturz – und scheitert. Die Demokratie hält stand; doch neueste Erkenntnisse zeigen: Ihr Schicksal stand auf Messers Schneide. Das Vorhaben war so kühn wie radikal. Adolf Hitler und seine gewaltbereite Anhängerschaft setzte in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1923 alles auf eine Karte: Zunächst sollte in München und daraufhin in ganz Deutschland die Macht übernommen werden – mit kompromissloser Härte und roher Gewalt. Krachend scheiterte die Aktion. Doch ihr wirkliches Gefahrenpotenzial wird bis heute unterschätzt: Mitreißend schlüsselt Sven Felix Kellerhoff auf, dass der Handstreich Hitlers Monate im Voraus entwickelt worden war und die Weimarer Republik existenziell gefährderte. Mit scharfem Blick für die historischen Bedingungen – den »Marsch auf Rom« Mussolinis und die geplante Revolution linker Extremisten – und gestützt auf einen breiten Quellenbestand erzählt der Autor die Geschichte des Hitlerputsches völlig neu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sven Felix Kellerhoff
Der Putsch
Hitlers erster Griff nach der Macht
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © SZ Photo/Süddeutsche Zeitung Photo
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98188-9
E-Book ISBN 978-3-608-11991-6
Die Rechtsschreibung wurde den aktuell gültigen Regeln des Duden angepasst, auch in wörtlichen Zitaten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog
Ausgangslage
Republikschutzgesetz
Chance für die NSDAP
Faktor Hitler
Kontakt zu Mussolini
Vorbild
Regierungskrise in Italien
»Marsch auf Rom«
Mussolini am Ziel
Reaktionen in Deutschland
»Deutscher Mussolini«
Angst vor einem Putsch
Ein »Tribun«
Anbiederung
Führerkult
Anlauf
Generalproben
Ruhrkampf
Erster Parteitag
AG der Radikalen
Drohungen zur Maifeier
Blamage für Hitler
Volksfront
Hoffen auf die Krise
»Schlageter-Linie«
Radikalisierung in Mitteldeutschland
Todesstrafe als Programm
Trotzkis deutsche Revolution
Sonderweg
Hitler in der Schweiz
Treue und Untreue
Heerschau
Strategiewechsel
Ende des Ruhrkampfes
Kahr gegen Hitler
Ausweisung von »Ostjuden«
»Grenzschutz«
Konfrontation
Neue Fronten
Trotzkis Plan und Stalins Verrat
Letzte Frist für Sachsen
»Roter Oktober«
Unruhe vor dem Sturm
Aufstand in Hamburg
»Herbstübung«
Reichsexekution gegen Sachsen
Ultimatum an Bayern
Entscheidung
Münchner Verhältnisse
Koalitionsbruch
Seeckts Votum
Provokation
Unruhe in Oberfranken
Weichenstellung
Der 6. November
Hitlers Entschluss
Wettlauf zum Hochverrat
Kriegsrat
Sturm
Polizeidirektion
Infanterieschule
Bürgerbräu
Innenstadt
Maximilianstraße
In Bayern
Außerhalb Bayerns
Scheitern
Marienplatz
Den Haag, Paris, London, Rom
Feldherrenhalle
München
Uffing am Staffelsee
Epilog
Anhang
Dank
Zu den Quellen und der Forschungslage
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Ungedruckte Quellen
2. Gedruckte und digitale Quellen
3. Literatur
Personenverzeichnis
Abbildungsnachweise
Anmerkungen
Prolog
Ausgangslage
Vorbild
Anlauf
Volksfront
Sonderweg
Konfrontation
Entscheidung
Sturm
Scheitern
Epilog
Zu den Quellen und der Forschungslage
Prolog
Der Putsch als Posse: Der Künstler Karl Goetz verspottete Hitlers Coup Ende 1923 mit einer satirischen Medaille.
Eine Posse – was denn sonst? Auf den ersten Blick erweckten die Vorgänge in München am 8. und 9. November 1923 den Eindruck eines »Operettenputsches«: Da war bald nach 20.30 Uhr ein nicht mehr ganz junger, etwas linkischer Mann in Regenmantel und abgetragenem Anzug mitten in eine laufende Versammlung im Bürgerbräukeller am Rande der Münchner Innenstadt geplatzt und zum Podium gestürmt; dort hatte er sich auf einen Stuhl gestellt, eine Pistole gezogen und in die Decke geschossen. Anschließend hatte er die Regierung in Berlin für abgesetzt erklärt. Weniger als 16 Stunden später war derselbe nicht mehr ganz junge Mann an der Spitze eines Zuges von zwei- bis dreitausend Anhängern kaum zwei Kilometer entfernt an der Feldherrenhalle ins Gewehrfeuer von Polizisten geraten, zu Boden gestürzt und geflüchtet, während anderthalb Dutzend Tote und tödlich Verletzte auf dem Pflaster liegen blieben. Nicht einmal die Straßenbahnen hatten wegen der Ereignisse ihren Betrieb wesentlich einschränken müssen, und die meisten Deutschen bekamen erst aus den Zeitungen davon überhaupt etwas mit.
An eine »Zirkusszene« fühlte sich die Vossische Zeitung am 10. November 1923 erinnert; im Berliner Tageblatt trug der Leitartikel am selben Tag die Überschrift »Das Ende der Hanswurstiade«. Dem Vorwärts erschien der ganze Vorgang »jämmerlich«, während die Berliner Morgenpost über den »Spuk« spottete. Das Stuttgarter Neue Tagblatt nannte die Akteure »Dilettanten der schlimmsten Sorte«.[1]
Nicht anders sahen es Zeitungen in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Die Wiener Reichspost diagnostizierte eine »Revolution des Phrasenheldentums«, die Neue Zürcher Zeitung ein »Fiasko«. Das Unternehmen habe »nirgends in Bayern Nachahmung gefunden«, meldete das Oberländer Tageblatt. Das Salzburger Volksblatt befand, die Anführer seien offenbar der »Primadonnen-Eitelkeit zum Opfer gefallen«.[2]
Auch jenseits des deutschsprachigen Mitteleuropas dominierten abschätzige Meinungen. Eine »Karnevalsposse« habe in München stattgefunden, schrieb der Niuwen Rotterdamschen Courant; es sei »operettenhaft« zugegangen, kommentierte der Corriere della Sera aus Mailand. Das Budapester Blatt Az Ujsbg hielt die Geschehnisse für »ganz einfach lächerlich«, der Manchester Guardian wunderte sich über die »Feigheit der Gefolgschaft«, derentwegen der Putsch so rasch zusammengebrochen sei, und das Stockholmer Dagbladet konstatierte einen »hoffnungslosen Versuch«. Dazu passte die Bewertung jenseits des Atlantiks: Der New York Herald sah einen »Sturm im Wasserglas«, die New York Times einen »schmählichen Zusammenbruch« und die Boston Post einen »schweren Reinfall«.[3]
In der Presse Frankreichs überwog Häme. La Victoire druckte die Schlagzeile »Nicht einmal 24 Stunden Diktatur!«. Das Echo de Paris stellte befriedigt fest: »Alles in allem ist Deutschland ohnmächtiger, als wir es uns gewöhnlich vorstellen.« Die rechtsextreme Zeitung Action Francaise freute sich triefend von Zynismus: »Wir haben eine ruhige Zukunft vor uns, denn wir haben mit den Deutschen stets Frieden gehabt, wenn sie sich untereinander schlugen, sonst aber niemals. Gott sei Dank schwärmen sie für den Bürgerkrieg.«[4]
Völlig anders stellten die Nationalsozialisten den 8. und 9. November 1923 dar. Die Hitler-Bewegung machte den fehlgeschlagenen Coup zu ihrem – neben der Verkündung des einzigen Parteiprogramms am 24. Februar 1920 – zweiten, nämlich mythisch aufgeladenen Gründungsakt. Die NSDAP-eigene Tradition behandelte die »Ausrufung der nationalen Revolution im Bürgerbräukeller« und das anschließende »Blutbad an der Feldherrnhalle« ausführlich.[5] Entsprechend verklärten überzeugte Nazis die Ereignisse rückblickend als »Opfergang deutscher Männer und Frontsoldaten« oder als den Beginn der »nationalen Erhebung«, die »das Schicksal der deutschen Nation zu wenden« versucht habe.[6] Wer dabei gewesen war, bekannte sich voll Stolz – seit dem zehnten Jahrestag gab es sogar eine Auszeichnung für jene, die mitmarschiert waren, das »Ehrenzeichen des 9. November 1923«. Diesen Namen benutzte aber kaum jemand, gängig war die Bezeichnung »Blutorden«, angelehnt an die – tatsächlich oder angeblich – mit dem Blut bei der Schießerei gestorbener Putschisten getränkte »Blutfahne«, die zentrale Reliquie der Hitler-Bewegung. Mit ihr wurden alle wichtigen Flaggen und Standarten »geweiht«.
Von 1926 bis 1944 beging die Partei Jahr für Jahr vom Abend des 8. bis zum 9. November mittags ihren wichtigsten Feiertag, den »Reichstrauertag der NSDAP«. Gedenkartikel erschienen, die meisten Parteigliederungen trafen sich und hörten pathetische Reden. Von 1927 fand die zentrale Versammlung jährlich bis 1939 im Bürgerbräukeller statt, danach noch fünfmal im Löwenbräukeller. Die Hauptansprache hielt außer 1944 stets der Parteiführer persönlich; auch noch, nachdem der gescheiterte Tyrannemordversuch von Georg Elser 1939 den Schauplatz der Ereignisse schwer beschädigt hatte und die Veranstaltung verlegt werden musste. Obwohl ein so feststehender Termin an einem bekannten Ort im Krieg ein hohes Risiko für Luftangriffe bedeutete, variierte Hitler lediglich die Uhrzeit seiner Auftritte.[7] Einmal nutzte die britische Royal Air Force (RAF) die Gelegenheit: In der Nacht vom 8. auf den 9. November 1940, Hitlers Rede war schon längere Zeit vorüber, warfen 17 britische Bomber über Münchens Innenstadt Spreng- und Brandladungen ab, ohne größeren Schaden anzurichten; registriert wurden acht Verletzte. Die behaupteten schweren Treffer des Löwenbräukellers und die angeblich nötige Unterbrechung der Feier waren Erfindungen der britischen Propaganda.[8]
Schon seit dem zehnten Jahrestag des Putsches 1933 erinnerte an der Schmalseite der Feldherrenhalle in der Residenzstraße eine Bronzetafel an die »16 Gefallenen des 9. November 1923«. Neben dem Mahnmal standen stets zwei SS-Leute »ewige Wache« und achteten darauf, dass jeder Passant den Toten den »Deutschen Gruß« entbot – wer das nicht tun wollte, wählte als Umweg die Viscardigasse, die im Volksmund bald »Drückebergergasserl« hieß. Am Königsplatz, dem Zentrum des Parteibezirks in der Maxvorstadt, ließ die NSDAP 1935 zwei »Ehrentempel« errichten, in denen seit dem zwölften Jahrestag die Särge der toten Putschisten standen.
Auf dieses völlig verzerrte Bild der Ereignisse folgte nach 1945 ein weiteres, das in anderer Art schief war. Die meisten Historiker, die über Hitler oder die Frühgeschichte des Nationalsozialismus schrieben, schilderten den Ablauf entlang der offiziellen Berichte von 1923/24 und orientierten sich an zeitgenössischen Beobachtern. Alan Bullock zum Beispiel, der Autor der ersten bedeutenden Hitler-Biografie, nannte den Putsch einen »Bluff«; Joachim Fest, Autor des lange wesentlichen Standardwerks über den deutschen Diktator, attestierte dem Geschehen »viele Elemente von Posse und Brigantentum«. Marlis Steinert hielt die Einzelheiten für »historisch kaum von Interesse«, Ian Kershaw sah ein »Abenteuer« und Hans Mommsen »eine ziemlich dilettantische Angelegenheit«, während Volker Ullrich die »burlesken Züge« betonte.[9]
Aber treffen diese Urteile zu? War Hitlers erster Griff nach der Macht tatsächlich so aussichtslos? Handelte es sich um ein von vorneherein zum Scheitern verurteiltes Unternehmen? Oder waren die Ereignisse jener rund 16 Stunden vielleicht das so natürlich nicht vorgesehene Ende eines ganz anderen Plans? Eines Vorhabens, das größer angelegt war als nur auf die wenigen Quadratkilometer der Münchner Innenstadt vom Bürgerbräukeller rechts der Isar bis zum Odeonsplatz zu zielen?
Zieht man die Gesamtheit der zeitgenössischen Quellen, also neben den offiziellen bayerischen Dokumenten und den zeitgenössischen Zeitungen auch die leider nur indirekt und auszugsweise überlieferten Ergebnisse der Ermittlungen, die Zeugenaussagen während des Prozesses gegen Hitler 1924, ferner das vom NSDAP-Hauptarchiv gesammelte Material sowie weitere Bestände heran, entsteht eine neue Perspektive, aus der sich viele der sonst meist übergangenen offenen Fragen zwanglos klären. Sie führt zu der Erkenntnis, dass es mehr als eine Phrase war, wenn Hitler 1922/23 so oft von einem »Marsch auf Berlin« sprach. Auch war es kein Zufall, dass sich gerade zwischen dem 3. und dem 6. November 1923 die Lage so sehr zuspitzte. Und es handelte sich um mehr als die Launen lokaler Anführer, dass in vielen Städten des Reiches am 8. und 9. November bewaffnete Trupps von SA und NSDAP bereitstanden, um auf Befehl aus München loszuschlagen. In Wirklichkeit war der »Bierhallen-Putsch« das Ergebnis von Adolf Hitlers erstem Versuch, die Macht über Deutschland zu ergreifen.
Schon in meinem Band Hitlers Berlin. Die Geschichte einer Hassliebe habe ich 2005, gestützt auf damals noch recht wenige Quellen, die gängige Interpretation des November-Putsches in Frage gestellt: »Dachte Hitler tatsächlich daran, auf die Reichshauptstadt zu marschieren? Oder benutzte er das Schlagwort vom ›Marsch auf Berlin‹ eher metaphorisch?«[10] Für andere meiner Bücher seither, vor allem für »Mein Kampf«. Die Karriere eines deutschen Buches (2015) und Die NSDAP und ihre Mitglieder (2017), sowie für zahlreiche meiner Artikel auf WELTGeschichte bin ich tief in die Quellen zur Frühgeschichte der »braunen Bewegung« eingetaucht. Immer stärker reifte dabei mein Eindruck, dass die bisherigen Interpretationen des Jahres 1923 zu kurz greifen. Sie sind einerseits, vor allem in den überreichlich vorhandenen Biografien, zu stark auf Hitler fokussiert. Natürlich war der innerparteilich mit allen Vollmachten ausgestattete Anführer die zentrale Figur der NSDAP, dennoch aber bei weitem nicht die einzige treibende Kraft.
Andererseits blenden die meisten bisherigen Arbeiten zu stark die Kontexte aus. Aber nur wenn man diese berücksichtigt, wird die Handlungsweise der Verantwortlichen in Berlin und München nachvollziehbar. Denn alle politischen Entscheidungen des Jahres 1923 fielen in einer Situation doppelter Bedrohung: außenpolitisch durch die aggressive Politik Frankreichs und innenpolitisch durch den bevorstehenden, teilweise bereits eingeleiteten Aufstand der Kommunisten. Gleichzeitig gab es ein Vorbild, wie eine Nation sich aus einer ähnlichen Lage befreit zu haben schien: In Italien hatte sich der Faschisten-Führer Benito Mussolini durch den Aktionismus seiner Anhänger an die Macht getrotzt. Natürlich war die Situation nicht direkt auf Deutschland übertragbar, denn in Rom amtierte als Rest der Vorkriegsordnung ein König, während in Deutschland die Revolution im November 1918 den Monarchen fortgespült und einen (sozial-)demokratischen Reichspräsidenten an seine Stelle gesetzt hatte. Dennoch befeuerte die rasch zur Formel erstarrte Vorstellung eines »Marsches auf Berlin« nach dem Muster des »Marsches auf Rom« das Denken auf dem rechten Flügel der Gesellschaft, ebenso die Idee eines autokratischen »Direktoriums« als vermeintlicher Alternative zur parlamentarisch gestützten Regierung. So stand die Demokratie in Deutschland im Herbst 1923, nur fünf Jahre nach ihrem Sieg, tatsächlich am Abgrund. Sie wurde bedroht gleichermaßen von links wie von rechts. Die Aussicht auf einen siegreichen Putsch reaktionärer Kreise erledigte sich vor allem, weil der Reichspräsident anders entschied, als seine Gegner angesichts seiner Parteizugehörigkeit vermutet hatten.
Ausgangslage
Ein Balanceakt: Reichspräsident Friedrich Ebert (vorne) musste nach dem Rathenau-Mord einen Bürgerkrieg verhindern.
Ein politischer Mord löst die entschiedene Gegenwehr des demokratischen Staates aus. Die Verbote antirepublikanischer Organisationen sind eine Chance. Doch als Profiteur erweist sich ausgerechnet eine noch radikalere Bewegung.
Republikschutzgesetz
Der Kanzler war empört. Rund eine halbe Stunde schon hatte der Zentrumspolitiker Joseph Wirth am 25. Juni 1922 im Reichstag an seinen Außenminister Walter Rathenau erinnert, der am Vortag einem Anschlag zum Opfer gefallen war. Gerade hatte Wirth den Populismus verdammt, da gingen die Gefühle mit ihm durch. Vielleicht hatte es einen provozierenden Zwischenruf gegeben, den die Stenografen nicht festhielten, vielleicht war es das Füßescharren aus den Reihen der deutschnationalen Fraktion. Jedenfalls wies Wirth in deren Richtung und schleuderte den reaktionären Abgeordneten ungewöhnlich harsche Worte entgegen: »Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!«[1]
Die Abgeordneten in der Mitte und auf dem linken Flügel des Parlaments sowie die meisten Zuhörer auf den Tribünen honorierten die Worte des Reichskanzlers mit stürmischem Beifall. Der bestens vernetzte Kulturbürger Harry Graf Kessler1, eigentlich kein Freund des Zentrumspolitikers Wirth, saß im Besucherrang und notierte später in seinem Tagebuch: »Man fühlt, es kommt eben wirklich aus der Tiefe seiner Überzeugung. Ich habe dem Mann Unrecht getan; er ist doch jemand.«[2]
Auf den Mord an Rathenau hatten Reichspräsident Friedrich Ebert und das Kabinett mit einer Verordnung zum Schutz der Republik reagiert, durch die republikfeindliche Gruppen aufgelöst werden konnten und schwere Strafen gegen jeden Täter möglich wurden, der »zu Gewalttaten gegen Mitglieder der jetzigen oder einer früheren republikanischen Regierung des Reichs oder eines Landes auffordert, aufwiegelt oder solche Gewalttaten mit einem andern verabredet«.[3] Für derartige Verfahren sollte ein neuer Staatsgerichtshof zuständig sein, an den die Ländergerichte ihre Jurisdiktion abzutreten hätten.
Wenige Tage später, so schnell wie überhaupt möglich, beriet das Reichskabinett den Einwurf für ein Gesetz zum Schutz der Republik, das im Wesentlichen die gleichen Maßnahmen juristisch sorgfältiger formulierte. Wirth bekannte in der Sitzung offen, dass sich dieses Gesetz gegen den rechten Rand richte: »Im gegenwärtigen Augenblick« sehe er »keine Möglichkeit, ein Gesetz zu schaffen, das gleichzeitig den Kampf gegen links eröffne«. Scharfes Durchgreifen sei unumgänglich notwendig, vor allem gegen die »unglaubliche Verhetzung« durch die »Rechtspresse«. Wenn das Kabinett nicht handele, dann gebe sich die von Zentrum, Liberalen und Sozialdemokraten getragene Koalition selbst auf. Auch die Linksparteien, also USPD und KPD, müssten gewonnen werden, um dem verfassungsändernden Gesetz die nötige Zweidrittel-Mehrheit zu sichern. Der Sozialdemokrat Otto Braun, als Ministerpräsident des weitaus größten Landes Preußen innenpolitisch mindestens so wichtig wie der Kanzler, stimmte Wirth zu – »sowohl was die Beurteilung der Lage, als auch, was die zu ergreifenden Maßnahmen« betraf.[4]
Anders Bayerns Ministerpräsident Hugo von Lerchenfeld: Der katholisch-konservative Adlige hatte schon die Verordnung zum Schutz der Republik abgelehnt, gedrängt von seiner Bayerischen Volkspartei. Dieser regionale Ableger des Zentrums kritisierte die Maßnahmen als »unerträglichen Eingriff in die Justiz- und Polizeihoheit der Länder«. Offenbar sehe man in Berlin »die Dinge so schief und so falsch, dass man dort hoffte, die innerpolitische Lage in Bayern hätte sich so verschoben, dass man es wagen könnte, Bayern eine solche Pille zum Schlucken geben zu können«, warnte der parteieigene Informationsdienst BVP-Correspondenz: »Das ist nicht der Fall.«[5] Gegen den inhaltlich ähnlichen Gesetzentwurf, der jedoch fünf Jahre gültig sein sollte, musste Lerchenfeld aufbegehren. Vor allem lehnte er ab, einem Staatsgerichtshof Verfahren zu übertragen, die Bayern beträfen. Württembergs Regierungschef Johannes von Hieber stellte sich an die Seite des Kollegen aus München, denn in seiner Koalition hatten konservative Zentrumspolitiker ebenfalls großes Gewicht, während Joseph Wirth als Linkskatholik skeptisch beäugt wurde.
Schließlich verabschiedete der Reichstag das Republikschutzgesetz zwar am 23. Juli 1922, doch schon zuvor hatte Lerchenfeld angekündigt, es in Bayern nicht anwenden zu wollen. An sich ein ungeheurer Vorgang: Ein Land weigerte sich offen, bindendes Recht umzusetzen. Doch die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen, wäre die Reichsexekution gewesen, also eine bewaffnete Übernahme der Macht in und über Bayern durch die Berliner Regierung, die zum Bürgerkrieg führen musste. Das würde Reichspräsident Ebert nicht tun. Um die Wogen zu glätten, erließ Lerchenfeld mehrere Verordnungen, die sich inhaltlich am Republikschutzgesetz orientierten, jedoch ausschließlich durch regionale Instanzen umzusetzen waren. Anstelle des Staatsgerichtshofs des Reichs sollten bayerische Volksgerichte Verstöße sanktionieren.
So hatte das Republikschutzgesetz eine unerwartete Nebenwirkung: In mehr als drei Vierteln des Deutschen Reiches wurde in den kommenden Wochen unter anderem die mit rund 120 000 Mitgliedern größte rechtsextreme Organisation, der antisemitische Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund (DvSTB), verboten; die jeweils zuständige Polizei löste vorhandene Strukturen auf, beschlagnahmte Drucksachen, Guthaben und ähnliches – nicht jedoch in Bayern.
Chance für die NSDAP
Einer kleinen völkischen Gruppierung namens Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) mit Schwerpunkt in München und Oberbayern kam das Gezerre in mehrfacher Weise gelegen.[6] Erstens als Thema ihrer Agitation, denn der NSDAP-Vorsitzende, der Bierkellerredner Adolf Hitler, sprach das Gesetz in diesem Sommer immer wieder an. »Wer gefährdet denn die Republik? Nicht das breite schaffende Volk«, sagte er am 16. August 1922: »Die Republik ist gefährdet durch diejenigen, die sie als Melkkuh für ihre Interessen betrachten. Darum hat man ein Gesetz zum Schutz der Republik gemacht, das Volk aber schreit nach einem Wuchergerichtshof.« Der Zweck des Gesetzes sei gar nicht der Schutz der Verfassung; vielmehr solle es Bayern, dem »deutschesten Land«, den »Berliner Kurs aufzwingen«.[7] Neun Tage später spottete er, »auch tausend Behörden« würden nicht »verhindern können, dass das Volk in machtvollen Kundgebungen seinen Willen zum Ausdruck bringt«.[8] Bei seinen Zuhörern kamen solche Attacken stets gut an.
Zweitens stießen Anhänger des im Großteil des Reiches aufgelösten DvSTB in jenen Städten und Gemeinden, in denen es bereits Ortsgruppen der NSDAP gab, oft zur Hitler-Bewegung. Sie war vorerst noch nicht vom Republikschutzgesetz betroffen, denn sie schien nicht gefährlich genug, um den Aufwand einer Auflösung zu rechtfertigen. Zwar blieben diese Sympathisanten längst nicht überall, denn die NSDAP war im Gegensatz zur vorwiegend bürgerlichen Anhängerschaft des Antisemiten-Bundes stark proletarisch geprägt. Trotzdem trug das Verbot des DvSTB wesentlich dazu bei, dass die NSDAP ihre Mitgliederzahl von etwa 4300 Ende 1921 auf 8200 Ende 1922 fast verdoppeln konnte.[9]
Der dritte Nutzen, den die NSDAP durch das Republikschutzgesetz hatte, resultierte paradoxerweise aus Bayerns Weigerung, diese Regeln anzuwenden. Denn dadurch wurde München noch stärker als zuvor zum Sammelbecken völkisch-rechtsextremer Kräfte, die damit in den Dunstkreis Hitlers gerieten, dem seit dem Sommer 1921 der spöttische Titel »König von München« anhing. Er war zuerst wohl auf einem Flugblatt innerparteilicher Gegner aufgetaucht.[10]
Schon 1920, nach dem gescheiterten Kapp-Putsch, hatten sich viele Mitglieder des beteiligten Freikorps Marinebrigade Ehrhardt in die bayerische Hauptstadt zurückgezogen und hier entweder die Rückkehr ins bürgerliche Leben geschafft oder sich eigens gegründeten Tarnorganisationen angeschlossen. Auch ihr ehemaliger Anführer Hermann Ehrhardt hielt sich mit falschen Papieren und wohlwollender Ignoranz der Polizei im Spätsommer 1922 in München auf. Ebenfalls hatte der Kreis um Erich Ludendorff, den mythisch überhöhten ehemaligen Generalquartiermeister in den beiden letzten Jahren des Weltkrieges, seinen Schwerpunkt in München.
Bald bot sich der NSDAP eine günstige Gelegenheit, deutschlandweit Aufmerksamkeit zu finden. Der in Bayern nicht verbotene Schutz- und Trutzbund wollte Stärke demonstrieren und rief potenzielle Verbündete aus dem ganzen Reich für Mitte Oktober 1922 zu einem »Deutschen Tag« ins fränkische Coburg. Auch die NSDAP und ihre Sturmabteilung (SA), eine Mischung aus Wehrverband und Parteimiliz, wurden eingeladen. Der DvSTB-Hauptgeschäftsführer Alfred Roth wollte die Nationalsozialisten in eine breite antirepublikanische Bewegung einbinden und lobhudelte: »Nicht jeder kann ein Hitler sein; aber ein Mann, ein ganzer Kerl, ein Bekenner seiner deutschen Art, das kann ein jeder sein und muss es.«[11]
Doch statt sich in die Regie des »Deutschen Tages« zu fügen, setzte sich Hitler selbst in Szene. Trotz Verbots marschierte er mit einigen hundert SA-Männer durch Coburg und schlug sogar Gegendemonstranten mit seinem Stock – die einzige nachweislich eigenhändige Gewalttat Hitlers.[12] Der DvSTB kapitulierte; die Deutschvölkische Blätter schrieben nach dem Treffen in Coburg: »Es ist unzweifelhaft – die NSDAP und der Schutz- und Trutzbund bilden in Bayern zusammen die völkischen Bewegung; beide ergänzen sich in ihrem Wesen und Wirken in erfreulicher Weise.«[13] Statt die NSDAP wie geplant einzubinden, galt sie nun als mindestens ebenbürtig.
Tatsächlich stach vor allem die physische Aggressivität der NSDAP den verbal ebenfalls radikal antisemitischen, sonst aber betulichen DvSTB aus. Zwar schreckte gerade diese Gewalttätigkeit ältere Anhänger des Schutz- und Trutzbundes ab, doch das wurde durch die Anziehungskraft auf Jüngere mehr als ausgeglichen. Mutmaßlich Anhänger der NSDAP griffen in München seit 1920 beinahe täglich auf offener Straße Menschen an, die sie für Juden hielten; es wurde gepöbelt, gespuckt, gerempelt und sogar geschlagen. Die Behörden nahmen anfangs noch Anzeigen auf, beschränkten sich bald aber darauf, die Vorfälle zu registrieren. Denn Polizeipräsident Ernst Pöhner persönlich hatte wiederholt Ermittlungen gegen mutmaßliche Antisemiten wegen angeblich »mangelnden öffentlichen Interesses« einstellen lassen.[14] Die hohe Wahrscheinlichkeit, für solche Übergriffe nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, spornte die Täter an.
Auch nachdem der stadtbekannte NSDAP-Sympathisant Pöhner im September 1921 ans Oberste Landesgericht weggelobt worden war, änderte sich zumindest in Teilen der Münchner Polizei wenig. Am 6. Februar 1922 befand die Fahndungsabteilung zum Beispiel: »Was die Führung Hitlers anbelangt, so ist Nachteiliges gegen ihn nicht bekannt. Er ist ein überzeugter, ehrlicher Politiker, der aus seiner Gesinnung keinen Hehl macht. Seine bisherigen Reden in öffentlichen Versammlungen waren stets im vaterländischen Sinne gehalten.«[15]
Faktor Hitler
Bayerns Politik konnte der NS-Bewegung und ihrem Anführer kaum wirksam entgegentreten.[16] Das zeigte sich im Frühjahr 1922, als der BVP-Innenminister Franz Xaver Schweyer intern angekündigt hatte, eine Abschiebung des in Bayern nur geduldeten österreichischen Staatsbürgers Adolf Hitler zu prüfen – als Grund nannte er das »Bandenunwesen« auf Münchens Straßen, das »allmählich unerträglich« zu werden beginne.[17] Der NSDAP-Chef hatte kurz zuvor bei einer polizeilichen Vernehmung wegen der gehäuften antisemitischen Vorfälle verkündet, er könne »für all diese Sachen nicht verantwortlich gemacht werden«; sein vages Versprechen, »alles zu tun, um Ausschreitungen« zu vermeiden, hatte keine drei Tage gehalten.[18] Damit schien es für die Regierung höchste Zeit zu handeln.
Doch Schweyers Vorhaben sickerte umgehend durch. Hitler verließ aus Sorge vor einer Festnahme und möglicher Abschiebehaft für einige Tage die Wohnung, in der er ein Zimmer zur Untermiete bewohnte, und versteckte sich. Das NSDAP-Blatt Völkischer Beobachter skandalisierte den Plan und verwies auf die Leistungen des Kriegsfreiwilligen Hitler.[19]
Trotzdem gewann der Innenminister noch zwei Tage nach der Veröffentlichung die Zustimmung aller im Landtag vertretenen Parteien für Hitlers Ausweisung – außer der SPD. Deren Parteichef Erhard Auer lehnte den Vorschlag des Konservativen Schweyer ab, denn Hitler sei »doch nur eine komische Figur«. Es wäre für die Arbeiterschaft »ein Leichtes, ihn in die Bedeutungslosigkeit zurückzuschleudern«. Die Vertreter der anderen Parteien zogen daraufhin ihre Unterstützung zurück; der Innenminister musste seinen Vorschlag aufgeben: »So wurde kein Beschluss zur Ausweisung Hitlers gefasst«, hielt ein Teilnehmer der Runde fest.[20] Schweyer sah sich sogar gezwungen, wenige Wochen später im Landtag öffentlich den Gerüchten entgegenzutreten, er habe den NSDAP-Chef abschieben wollen: »Ich möchte hierzu zunächst bemerken, dass die Äußerungen, die ich seinerzeit im Haushaltsausschuss machte, doch nicht ganz richtig verstanden wurden; denn sie hatten keinesfalls den Sinn, als ob die sofortige Ausweisung des Herrn Hitler beabsichtigt gewesen wäre. Sie bezogen sich auf eine im Augenblicke der Erklärung bereits abgeschlossene Überlegung.« Nur am Ende seiner Rede ließ Schweyer durchblicken, was er wirklich vom NSDAP-Chef hielt – er nannte ihn nämlich den »unverantwortlichen Herrn Hitler«.[21] Offensichtlich dachte der Innenminister an die Einlassung des Parteichefs bei der Münchner Polizei.
Hitler jedoch amüsierte sich darüber höchstens, ebenso wie über die Haftstrafe, die er im Juni und Juli 1922 abzusitzen hatte. Zu drei Monaten Freiheitsentzug wegen Landfriedensbruch war er verurteilt worden, kam jedoch schon nach vier Wochen auf Bewährung wieder frei. Nur einen Tag später hielt er eine selbst für seine Verhältnisse besonders aggressive Rede, in die wohl alle während der Zeit im Gefängnis Stadelheim aufgestaute Energie floss. Wie üblich attackierte er die angebliche Verschwörung, die Deutschland zugrunde richten solle und deshalb die Wirtschaft unterminiere. »Wie lange kann dieser Prozess noch währen?«, fragte er rhetorisch, nur um wenig später die Antwort zu geben: »So lange, bis plötzlich aus dieser Masse heraus irgendeiner entsteht, der die Führung an sich reißt, weitere Genossen findet und der nun allmählich die Wut, die zurückgehalten wurde, gegen die Betrüger zum Aufflammen bringt.«[22]
In der NSDAP war Hitler praktisch unumstritten, seit er im Sommer 1921 seine Konkurrenten von der Parteispitze verdrängt hatte; der Völkische Beobachter bezeichnete ihn nun immer öfter als »unseren Führer«. Aber sein bohèmehafter Lebenswandel, geprägt fast täglich von stundenlangen, redundanten Gesprächen mit Anhängern in Cafés und Restaurants, wurde zur Belastung, denn Hitler erledigte die Büroarbeit als Kopf einer stark wachsenden Organisation bestenfalls unwillig; die Männer seiner Umgebung vermochten diesen Mangel nicht auszugleichen. Die Geschäftsstelle der Partei konnte ihre Aufgaben 1922 kaum mehr erfüllen, zumal die damals ein Dutzend zum Teil ehrenamtlichen Mitarbeiter in nur drei Räumen arbeiten mussten; es war nach den Erinnerungen einer Helferin »schrecklich eng«.[23]
Hitler ließ sich nur selten im Parteibüro sehen; öffentliche Auftritte waren ihm viel wichtiger, und dabei entwickelte er ein erstaunliches Selbstbewusstsein. So redete er bei einer gut besuchten Kundgebung gegen das Republikschutzgesetz auf dem Münchner Königsplatz erstmals gleichberechtigt neben den Anführern anderer teilnehmender Gruppen – und das, obwohl seine wenigen hundert Anhänger kaum ein Prozent der rund 50 000 Zuhörer stellten. Bei einer anschließenden NSDAP-Versammlung im Bürgerbräukeller kündigte Hitler an: »Der heutige Tag ist eine Generalprobe.«[24]
Kontakt zu Mussolini
Weil Hitler sich 1922 auf Bayern konzentrierte und höchstens an der Ausdehnung der NSDAP nach Norddeutschland interessiert war, verfolgte er Vorgänge im Ausland nur am Rande.[25] Die Lage in Italien kannte er nur in Umrissen; ob er tatsächlich 1921 »zum ersten Mal etwas vom Faschismus« gehört hatte, wie er rückblickend sagte, ist ungewiss.[26] Zwar erwähnte Hitler schon 1919 bis 1921 Italien gelegentlich in seinen Reden, doch meistens handelte es sich nur um Hinweise auf den Weltkrieg oder die Revision des Versailler Friedensvertrages.[27]
Seit 1918 herrschte in Rom permanent eine Regierungs- und damit Staatskrise. Obwohl auf der Seite der Gewinner, fühlte sich das Land von Frankreich und Großbritannien ausgespielt. Zwar hatte Italien bei den Verhandlungen in Versailles aus dem Erbe des aufgelösten Kaiserreichs Österreich-Ungarn erhebliche Territorien wie das deutschsprachige Südtirol und den Adriahafen Triest erhalten, doch die Erwartungen der Öffentlichkeit waren noch größer gewesen. In der Selbstwahrnehmung war aus der Siegermacht ein gedemütigtes Land geworden. Hinzu kamen Auswirkungen des Krieges: zerrüttete Finanzen, der Verlust der bis 1914 wichtigsten Exportmärkte Deutschland und Österreich, hohe Arbeitslosigkeit unter den demobilisierten Soldaten sowie eine alles durchdringende Vetternwirtschaft. Innenpolitisch war das Land zerrissen; auf die von linken Parteien dominierten »roten Jahre« 1919/20 mit Generalstreiks, Landbesetzungen und anderen sozialistischen Übergriffen folgten die »schwarzen Jahre« 1921/22, in denen reaktionäre und nationalistische Kräfte die Oberhand gewannen.
Zu dieser Zeit gab es tatsächlich Parallelen zwischen Deutschland und Italien: In beiden Ländern herrschte das Gefühl vor, Opfer fremder Mächte zu sein; in beiden Ländern konnten wechselnde, meist schwache Regierungen die Spaltung der Gesellschaft in einen linken, tendenziell sozialistischen und einen rechten, nationalistischen Flügel weder überwinden noch mildern; in beiden Ländern waren die Folgen dieser Konfrontation ähnlich: Gewalt auf den Straßen, die phasenweise bürgerkriegsartig eskalierte und hunderte Menschenleben im Jahr kostete.
Die Parallelen sahen auch manche Politiker. Benito Mussolini, ehemaliger Sozialist und nun rechtsnationalistischer Publizist, außerdem seit ihrer Gründung Ende 1921 Vorsitzender der faschistischen Partei und für sie Abgeordneter im italienischen Parlament, reiste im März 1922 nach Berlin. Hier führte er Gespräche mit dem Reichskanzler und dem Außenminister, was der Vorwärts für einen »Fehler« hielt und scharf kritisierte.[28] Mit deutschen Nationalisten traf sich Mussolini ebenfalls, etwa mit der Führung der Veteranenorganisation Stahlhelm. München aber und Adolf Hitler standen nicht auf seinem Terminplan; auch sonst gab es keinen Kontakt zwischen Faschisten und Nationalsozialisten, die in Berlin noch gar nicht präsent waren.
In der NSDAP dominierte im ersten Halbjahr 1922 eine sehr negative Wahrnehmung Italiens, dem der Eintritt in den Weltkrieg auf Seiten der Gegner Deutschlands 1915 verübelt wurde. Hitler machte sich diese Position offensichtlich zu eigen; jedenfalls eröffnete er am 25. April im Münchner Hofbräuhaus eine Parteiveranstaltung über die »Not der Deutschen in Südtirol«, bei der Italien scharf kritisiert wurde.[29]
Die gegen den klaren Willen fast der gesamten lokalen Bevölkerung vollzogene, in Italien frenetisch gefeierte Annexion der Südalpen-Region war zudem nur eine von zwei unvereinbaren Positionen der beiden Parteien. Die andere war der Hass auf Juden, den die NSDAP für entscheidend hielt, die Faschisten hingegen für unbedeutend. Der Völkische Beobachter stellte deshalb Ende Juni fest, »jeder völkisch denkende Deutsche« müsse den Kontakt zu den Faschisten vermeiden, weil diese Partei »gar keine antisemitischen Zwecke« verfolge. Kontakte zum »Jongleur Mussolini« seien abzulehnen.[30]
Doch schon sechs Wochen später änderte sich der Tonfall deutlich. Nun lobte Hitler auf einmal, Italien sei »als einziges Land« gewillt, den »Kampf zwischen Internationalismus und Nationalismus durchzukämpfen«.[31] Wie es dazu kam, ist nicht klar auszumachen. Vielleicht hatte der NSDAP-Chef mitbekommen, dass Mussolini ein Ziel ausgegeben hatte, das genau in sein Denken passte. »Unser Programm ist einfach«, bekannte der »Duce« der Faschisten nämlich: »Wir wollen Italien regieren.«[32]
Bald darauf, in der zweiten September-Hälfte 1922, akzeptierte Hitler ein Angebot, indirekt Kontakt zu Mussolini aufzunehmen. Vorgeschlagen hatte das der potenzielle Mittelsmann selbst, ein gewisser Kurt Lüdecke. Charmant und sprachgewandt, war der 32-Jährige als Hochstapler erfolgreich. Seit 1921 wohnte er vorwiegend in München, und hier wandte er sich an die NSDAP, um der noch kleinen Bewegung seine Dienste anzubieten – vor allem im Ausland. Weil Hitler nur deutlich österreichisch gefärbtes Deutsch sprach, nahm er das Angebot an: Lüdecke, der fließend Englisch und Französisch beherrschte, wurde Berater für außenpolitische Fragen.
In seinen später im US-Exil erschienenen Memoiren überlieferte der allerdings nicht sehr vertrauenswürdige Gewährsmann seine Version des entscheidenden Gesprächs mit Hitler.[33] »Was er denn, so fragte ich, wisse über Mussolini, dessen Besetzung von Turin mit seinen ›Schwarzhemden‹ Schlagzeilen gemacht hatte?« Hitler gab zurück: Nur das, was jeder in den Zeitungen gelesen habe. Hitler könne doch, führte Lüdecke den Dialog weiter, die Erfolge der Faschisten für sich nutzen, indem man Kontakt zu Mussolini aufnahm und das verbreitete. Er könne doch, schlug Lüdecke vor, im Auftrag der NSDAP nach Italien reisen. Hitler fand Gefallen an der Idee und akzeptierte zudem, dass sich der Emissär zusätzlich der Unterstützung Erich Ludendorffs versicherte. Denn dessen Ruf könne auch in Italien viele Türen öffnen.[34]
In Mailand angekommen, dem Sitz der faschistischen Partei, bat Lüdecke telefonisch um einen Termin beim »Duce«, den er zu seinem eigenen Erstaunen noch am selben Nachmittag bekam. Zunächst bestellte Lüdecke Grüße von Adolf Hitler und erfuhr, dass Mussolini diesen Namen gar nicht kannte. Also schilderte der Besucher die Lage in Deutschland, übertrieb freilich die Bedeutung der NS-Bewegung gewaltig. Der Italiener hörte höflich zu (man hatte sich auf Französisch geeinigt, das beide fließend beherrschten) und stellte Zwischenfragen, sagte aber selbst wenig. Lüdecke sprach vorsichtig die potenziellen Streitpunkte zwischen Faschisten und Nationalsozialisten an, Südtirol und den Antisemitismus, holte sich aber in beiden Fragen deutliche Absagen. Zum Ende des Treffens versicherte Mussolini dem Besucher noch seine Entschlossenheit, den Kampf um die Macht bis zum Ende zu führen.
Der Faschistenchef hatte nichts gesagt, was über die Botschaften in den Blättern seiner Partei hinausging. Trotzdem berichtete Lüdecke seinem Auftraggeber, als habe er wichtige Neuigkeiten zu übermitteln. Er schilderte seinen Eindruck von Mussolinis Persönlichkeit und dessen politischen Fähigkeiten, betonte dabei die Verwandtschaft von Faschismus und Nationalsozialismus. Außerdem prophezeite Lüdecke nach eigenen Angaben einen Sieg der Faschisten in Italien binnen weniger Monate, wenn nicht Wochen.[35]
Hitler erwies sich seinen Ratschlägen gegenüber als aufgeschlossen, denn er hielt nicht nur eine Kooperation von Faschisten und Nationalsozialisten für vorteilhaft, sondern auch eine Allianz zwischen den Staaten Italien und Deutschland. Lüdecke zufolge fand es der NSDAP-Chef vertretbar, dafür die völkisch begründeten Ansprüche auf Südtirol aufgeben zu müssen.[36] Wenige Tage später begann Hitler, sich Mussolini öffentlich anzunähern. Auf dem »Deutschen Tag« in Coburg hielt er eine Rede, in der er erstmals ausdrücklich auf dessen Bewegung einging: »Jetzt wollen wir nach Italien zu den dortigen Faschisten blicken, sie bewundern und ihnen zeigen, dass wir gewillt sind, noch andere Kämpfe durchzuführen als die in Italien.«[37]
Vorbild
Unerwarteter Erfolg in Italien: Benito Mussolini drohte mit Bürgerkrieg und stieg so zum Ministerpräsidenten auf.
Mussolini nutzt die Chance, die ihm die Schwäche seiner Gegner in Rom unversehens bietet. Seine deutschen Bewunderer von der NSDAP erkennen im Vorgehen des »Duce« ein Muster, dem sie nacheifern wollen.
Regierungskrise in Italien
Von Hitlers demonstrativem Bemühen um eine Annäherung bekam Benito Mussolini wahrscheinlich nichts mit.[1] Denn in Italien spitzte sich die Lage just im Spätsommer 1922 dramatisch zu. Nachdem ein Aufruf linker Gewerkschaften zum Generalstreik aus Protest gegen die andauernde politische Gewalt auf den Straßen weitgehend wirkungslos verpufft war, drängten die lokalen Anführer der Faschisten die Parteizentrale in Mailand zum Losschlagen. In verschiedenen Provinzen, vor allem der Toskana und der Emilia-Romana, dominierten deren Anhänger längst die lokale Politik – doch sie verlangten mehr: den offenen Kampf um die Macht im Staate. Mussolini bremste, denn er wollte einen Bürgerkrieg vermeiden. Also verlangte er von dem schwachen Ministerpräsidenten Luigi Facta, die Faschisten als Koalitionspartner zu akzeptieren, und forderte mehrere Ministerien für seine Partei, darunter das Kriegsministerium. »Jedermann sah, dass hier ein Trojanisches Pferd in die Zitadelle der Macht gebracht werden sollte«, schrieb der damalige Parlamentsabgeordnete Emilio Lussu rückblickend: »Nur Facta ahnte nichts; geduldig bemühte er sich um ein Übereinkommen. Aber einige Minister muckten auf, die Verhandlungen platzten.«[2] Das amtierende Kabinett zerbrach – ein »absehbares Scheitern«, kommentierte die New York Times.[3]
Mussolinis daraufhin vorangetriebener Versuch, zusammen mit dem gemäßigten Flügel der italienischen Sozialisten und unter Leitung des früheren Ministerpräsidenten Vittorio Emanuele Orlando eine neue Regierung zu bilden, scheiterte – die Linke bestand auf einem »Ausschluss der Faschisten« und drohte erneut mit Generalstreik.[4] Also bildete Facta auf persönlichen Wunsch von König Vittorio Emanuele III. ein neues Mitte-Rechts-Kabinett, das freilich noch schwächer war als seine vorherige Regierung: Er bekam eine »zweite Chance«, obwohl er sie gar nicht wollte.[5]
Auf parlamentarischem Weg, das war Mussolini nun klar, würde seine Partei nicht an die Macht kommen. Also schlug er einen anderen Weg ein: Im September 1922 ließ er seine Anhänger überall in Italien mobil machen und zahlreiche Demonstrationen, Versammlungen und Aufmärsche veranstalten. Er wollte die Kraft der Faschisten zur Schau stellen. Um den Nervenkrieg mit der Regierung Facta zu bestehen, zu der die Armee weitgehend loyal stand, beförderte Mussolini mit Emilio de Bono einen angesehenen General des Weltkrieges in die Führung der faschistischen Milizen, zusätzlich zu dem Juristen Cesare Maria de Vecchi und dem fronterfahrenen Offizier Italo Balbo sowie dem Ex-Gewerkschafter Michele Bianchi. Dieser Viererausschuss wurde in Anlehnung an die Endphase der antiken römischen Republik und die dort gebildeten Triumvirate »Quadrumvirat« genannt.
Für die wesentlichen Gruppen, die der Faschismus auf dem Weg zur ganzen Macht über Italien gewinnen musste, gab es jeweils eine geeignete Bezugsperson: für die aktiven Soldaten General de Bono, für die Monarchisten Rechtsanwalt de Vecchi, für die meist jungen Weltkriegsveteranen Balbo und für die Arbeiter Bianchi. Mussolini selbst bemühte sich um die Sympathie des Königs und der Armeeführung. Bei einer Kundgebung am 20. September 1922 in Undine beschwor er seine Anhänger, die als eine Art Uniform schwarze Hemden trugen: »Wir müssen den Mut haben, Monarchisten zu sein!« Als Antwort skandierten die Zuhörer, wohl dank geschickter Vorbereitung: »Es lebe das Heer!«[6]
Trotzdem blieb die Sorge virulent, die Faschisten planten einen gewaltsamen Staatsstreich. Bianchi konnte diesen Verdacht nicht ausräumen, obwohl er am 6. Oktober im Interview mit der Mailänder Zeitung Corriere della Sera klarstellte: »Es ist wahr, sehr wahr, dass wir von einem ›Marsch auf Rom‹ gesprochen haben und noch sprechen, aber es handelt sich um einen Marsch, der – das sollten auch die größten Laien verstehen – ganz spirituell, ich möchte sagen: legal ist.«[7] Zumindest Luigi Facta glaubte das offenbar nicht, denn er ließ die Forts rund um Rom alarmieren. Besorgten Abgeordneten seiner Koalition versicherte der Ministerpräsident: »Ich habe befohlen, dass man die Kanonen schmiert.«[8]
»Marsch auf Rom«
Die Entscheidung fiel am 16. Oktober 1922 – nur zwei Tage nach Hitlers Lob der Faschisten in Coburg. Für die folgende Woche setzte Mussolini einen zweitägigen Parteitag in Neapel an, und im Anschluss an diese öffentliche Heerschau würden am 27. Oktober alle »Schwarzhemden« mobil machen. Zuerst sollten sie in ihren Heimatregionen die »öffentlichen Gebäude in den wichtigsten Städten« besetzen, also Rathäuser, Polizeiwachen, Bahnhöfe und Postämter, danach zu Sammelpunkten rund um Rom kommen. Mit dieser Drohkulisse sollte ein »Ultimatum an die Regierung Facta zur generellen Abtretung der Staatsmacht« gestellt werden, anschließend der »Einmarsch in Rom und Inbesitznahme der Ministerien um jeden Preis« erfolgen. Balbo, de Vecci und de Bono sorgten für ein mögliches Scheitern des ersten Angriffs vor: »Im Falle einer Niederlage sollen die faschistischen Milizen nach Mittelitalien ausweichen, unter dem Schutz der in Umbrien zusammengezogenen Reserven.«[9]
An dem Parteitag in Neapel, einer traditionell linken Stadt, nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 30 000 Männer teil; der britische Konsul schätzte immerhin etwa 15 000 Schwarzhemden. Mussolini forderte in seiner Rede nun konkret fünf Ministerien, neben dem Kriegs- auch das Marineressort, das Außenamt, das Arbeits- und das Landwirtschaftsministerium, sowie baldige Neuwahlen. An der Staatsform Monarchie werde er festhalten, verkündete der Faschistenchef. »Ich schwöre, dass entweder die Regierung dieses Landes friedlich den Faschisten übertragen wird oder wir sie uns mit Gewalt nehmen werden!« Die Zuhörer skandierten: »Nach Rom! Nach Rom!«[10] Mussolini selbst aber reiste danach erst einmal heim nach Mailand und überließ es den Männern des »Quadrumvirats«, die Miliz anzuführen. Für ihn spielte der eigentliche »Marsch« auf die Hauptstadt eine kleinere Rolle, denn ihm ging es vor allem um das Drohpotenzial.