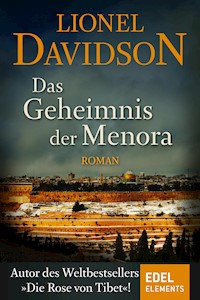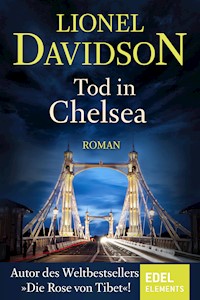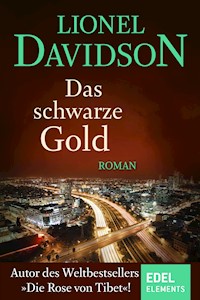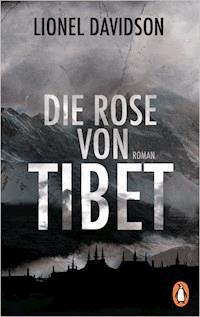2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein intelligenter Spionageroman vom renommierten Gold Dagger Award Preisträger
Inmitten der sibirischen Steppe liegt ein Geheimnis begraben, von dem nur eine Handvoll Menschen wissen: ein unterirdisches russisches Forschungslabor. Offiziell existiert es nicht, und wer einmal dort ist, wird es nie wieder verlassen. Doch der Biologe Rogatschow weiß, dass das, was dort geschieht, nicht im Eis verborgen bleiben darf. Er schickt einen verschlüsselten Hilferuf an den einen Mann, der die Wahrheit ans Licht bringen kann: Dr. Johnny Porter, eigenwilliger Einzelgänger indianischer Abstammung, Mikrobiologe und Sprachgenie, begibt sich auf die lebensgefährliche Mission nach Sibirien …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 868
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lionel Davidson wurde 1922 als Sohn jüdischer Einwanderer im englischen Hull geboren und war nach dem Krieg als Journalist tätig. 1960 veröffentlichte er seinen ersten Spionagethriller, dem sich viele preisgekrönte Erfolge anschlossen. Er gehört seit Jahrzehnten zu den besten und renommiertesten Spannungsautoren Großbritanniens. Davidson starb 2009 in London.
LIONEL DAVIDSON
DER
RABE
Thriller
Aus dem Englischen von Walter Ahlers und Christian Spiel
Für Frances
Prolog
Wie lange, lieber Freund – wie lange? Ich erwarte Sie voll Ungeduld! So vieles ist geschehen (und ich darf es nicht vergessen), dass ich diese Gelegenheit nutze, Ihnen davon zu berichten. Und eine Warnung auszusprechen: Sie werden alles, was hier folgt, sehr merkwürdig finden. Ich bitte Sie sehr, sich unsere Gespräche über das Phänomen des Zufalls ins Gedächtnis zu rufen und sich vor allem zwei Dinge zu vergegenwärtigen:
Wenn Sie hier auf Schwierigkeiten stoßen, seien Sie versichert, dass es mir auch so ergangen ist. Wo Sie zweifeln, habe auch ich gezweifelt. Ich konnte nicht ahnen, was ich hier vorfinden würde.
Ich ahnte es nicht. Ich hatte nicht danach gesucht. Zufall. Aber »blinder« Zufall? Sie werden sehen. Bald nach unserer letzten Begegnung kehrte ich nach Hause zurück und machte zusammen mit meiner Frau einen Kurzurlaub in Pizunda am Schwarzen Meer. Und dort ereignete sich ein Unfall, bei dem meine Frau getötet und ich selbst schwer verletzt wurde. Ich verbrachte einige Wochen in einem Krankenhaus und danach weitere in einem Sanatorium, von einer schweren Depression heimgesucht. Meine Freunde, meine Kollegen, alle haben mich gedrängt, zu meiner Arbeit zurückzukehren. Ich versuchte es, aber ich konnte nicht arbeiten. Mein Institut bedeutete mir nichts mehr, was mir vorher wichtig war, war uninteressant geworden.
Dieser Zustand wurde als eine »klinische« Depression diagnostiziert, und so brachte man mich in eine Nervenklinik! Dort musste ich mich verschiedenen Behandlungen unterziehen, aber nichts konnte mir helfen. Und in dieser Klinik besuchte mich eines Tages ein Wissenschaftler, der dann noch öfter erschien.
Dieser Mann war mir nur vage bekannt, doch schon bald zeigte sich, dass er sich höchst beflissen und kenntnisreich für meine Angelegenheiten interessierte. Er hatte meine Ärzte ausführlich befragt, kannte meine private Situation und wusste natürlich von meinen Publikationen. In einer Reihe von Gesprächen vergewisserte er sich, dass ich in meinem Fach nach wie vor auf der Höhe war. Und dann machte er mir einen Vorschlag.
Für eine Forschungsstation im Norden des Landes, sagte er, werde ein neuer Direktor gesucht. Ihr gegenwärtiger Chef sei sehr krank und habe nicht mehr lange zu leben. Die Arbeiten, die in der Station ausgeführt würden, seien von höchster Bedeutung, und seit einiger Zeit berate ein Komitee, unterstützt von Angehörigen der »staatlichen Organe«, über mögliche Nachfolgekandidaten; dem entnahm ich, dass die Forschungen geheimer Natur sein mussten, was er bestätigte und weiter erklärte.
Jener Teil der Arbeiten, der die »Organe« interessiere, sagte er, finde in wissenschaftlichen Kreisen nicht einhellig Beifall, was durchaus verständlich und ein stichhaltiger Grund für eine Absage wäre. Er selbst wisse darüber nichts, nehme aber an, dass es sich um etwas Ähnliches wie die Untersuchungen in Fort Detrick in Amerika und Porton Down in England, also um Materialuntersuchungen für die chemische und die biologische Kriegsführung handle.
Nicht minder wichtig sei der nächste negative Aspekt: Der Mann, der die Leitung der Station übernehmen werde, könne sie nie mehr verlassen, denn eine Rückkehr ins normale Leben, so sei entschieden worden, könnte nicht zugelassen werden. Das solle nicht heißen, dass es sich um ein Leben in Gefangenschaft handle. Keineswegs. Aber zusätzlich zu diesem Faktor müssten zwei weitere berücksichtigt werden: die geografische Lage der Station und die dort herrschenden Witterungsbedingungen. (Dem entnahm ich, dass sie sich in einer abgelegenen Region mit sehr schlechten klimatischen Bedingungen befand.)
Die folgenden Aspekte seien hingegen ausnahmslos positiv. Die Lebensbedingungen in der Station seien nicht nur gut, sondern luxuriös. Das Budget sei praktisch unbegrenzt; zumindest habe er nie davon gehört, dass das Komitee dem derzeitigen Leiter der Station irgendwelche Bitten abgeschlagen habe. (Und da dieser nicht mehr unter den Lebenden weilt, will ich ihn beim Namen nennen: L. V. Shelikow.)
Wie um das Budget stehe es auch um das Forschungsprogramm. Es sei praktisch unbegrenzt. Er erging sich des Langen und Breiten über dieses Thema, und beim letzten Mal erzählte er mir zum Abschied noch etwas anderes. Bei allen früheren Besetzungen für dieses Amt seien die Bewerber extrem gründlich geprüft worden. Damit habe man vor allem feststellen wollen, ob die Kandidaten psychisch für dieses Leben geeignet seien. Bei vielen sei das verneint worden, und selbst von den Ausgewählten habe dann ein gewisser Prozentsatz versagt. Für diese Unglücklichen habe man nichts tun können. Sie hätten natürlich die Station nie mehr verlassen können und leider Gottes bis zu ihrem Lebensende dort bleiben müssen.
In meinem Fall sei eine solch penible Überprüfung nicht notwendig. Aber er sagte, ich solle mir die Lage dieser »Unglücklichen« dennoch vor Augen halten. Er werde mich nicht mehr besuchen kommen, und wenn ich mir die Sache gründlich überlegt hätte, solle ich ihm eine Postkarte mit einem schlichten Ja oder Nein schicken. Ich erklärte mich bereit, das zu tun.
Ich erklärte mich dazu bereit und schickte ihm die Karte mit einem Ja, obwohl ich mir die Sache überhaupt nicht überlegt hatte. Kaum hatte er zu Ende gesprochen, war mir schon klar, dass ich das Angebot akzeptieren würde. Die Gründe dafür waren ganz einfach – meine Niedergeschlagenheit würde wieder vergehen. Das Leben geht weiter, wie immer, sagte ich mir. Und ebenso war ich überzeugt, dass ich daran etwas entscheidend ändern müsse. Und mit der »abgelegenen Region mit schlechten klimatischen Bedingungen« war natürlich Sibirien gemeint. Darauf komme ich noch.
Zunächst einmal möchte ich wiederholen, dass ich die Postkarte abschickte. Sechs Wochen später brach ich überstürzt auf. Ich konnte mich kaum von meiner Familie verabschieden und auch nicht sagen, wohin die Reise ging. (Ich wusste es ja nicht.) Mit einer Begleitung machte ich mich auf den Weg.
Nach meiner Ankunft in der Forschungsstation erfuhr ich den Grund, warum alles so eilig gegangen war. Shelikow hatte nur noch wenige Tage zu leben. Von seinem Krebsleiden gezeichnet, saß er in seiner luxuriös ausgestatteten unterirdischen Wohnung, in der ich jetzt sitze, in dem mobilen Liegestuhl, den er selbst entworfen hatte (und den er als seinen elektrischen Stuhl bezeichnete), gequält von Schmerzen, die ihn sehr schwächten, und voller Ungeduld. Er hatte an diesem Tag kein Morphium genommen, um einen klaren Kopf zu behalten. Beinahe auf der Stelle begann er, mir genaue Anweisungen zu erteilen, wie ich mit einem Problem umgehen sollte, das sich in ebenjener Woche ergeben hatte.
Bei diesem Problem, sagte er, gehe es um das Bergen eines Mammuts. Bekanntlich seien in dieser Region schon viele Exemplare dieser ausgestorbenen Spezies gefunden worden, und jedes Mal gehe es darum, die Fundstätte unbedingt vor den eingeborenen Jägern zu erreichen, die das Fleisch verzehrten (und außerdem einen schwunghaften Handel mit Elfenbeinschnitzereien betrieben). Die Regierung habe zwar vor einiger Zeit diese Praktiken untersagt und es für strafbar erklärt, solche Funde nicht zu melden. Doch dies habe nicht die geringste Wirkung auf die Einheimischen, die einander nicht »verpfiffen«, hingegen eine beträchtliche auf Bauprojekte. Innerhalb großer Bautrupps machten Neuigkeiten rasch die Runde, weshalb solche Funde sofort gemeldet würden – worauf die Arbeiten augenblicklich eingestellt würden, bis der Fund ordnungsgemäß in Augenschein genommen wäre.
Noch etwas anderes sei wichtig: Jäger hätten solche Funde verschiedentlich in Höhlen oder an anderen Stätten an der Erdoberfläche gemacht, wo die Tiere eines natürlichen Todes gestorben und langsam ausgekühlt seien, was unvermeidlich zu Gewebsentartungen geführt habe. Nirgends sei ein komplettes Mammut, sozusagen schockgefroren und mit intakten Weichteilen, gefunden worden. Was Shelikow jetzt so erregte, war die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Tier in greifbarer Nähe entdeckt worden war.
Auf einem Kap nördlich der Forschungsstation seien derzeit umfangreiche Bauarbeiten im Gange. Während der Ausschachtungsarbeiten habe der Untergrund nachgegeben, und dabei sei eine Felsspalte zutage getreten. Auf einem Vorsprung habe ein Mammut gelegen, ganz von Eis umhüllt. Offensichtlich sei es in die Spalte gestürzt und infolge des tiefen Sturzes augenblicklich tot gewesen. Ein schockgefrorenes Mammut!
Shelikow, vor Ungeduld ganz außer sich, verlangte, dass ich mich sofort zu dieser Felsspalte fliegen ließe. Schon seit vier Tagen wartete er auf mich, außerstande, selbst hinzufliegen, und nicht bereit, die Sache seinen Mitarbeitern anzuvertrauen. Zwei dieser vier Tage war ich selbst unterwegs gewesen und nun hundemüde. Aber seine Energie setzte sich durch, sodass ich keine zwei Stunden nach meiner Ankunft wieder in die Kälte hinausgezwungen wurde – zu einer wirklich schicksalsträchtigen Mission.
Zu dieser Jahreszeit (es war Februar) wird es in unserer Region beinahe überhaupt nicht hell, und die mittlere Temperatur liegt bei minus fünfzig Grad. Darüber hinaus wird sie von heftigen Stürmen heimgesucht. In einen solchen Sturm gerieten wir nach einer halben Stunde, und obwohl unser Hubschrauber groß und robust war, wurde er derart von fliegenden Eisklumpen bombardiert, dass der Pilot gezwungen war, auf eine Höhe zu gehen, in der keinerlei Sichtkontakt zum Boden bestand.
Über dem Baugelände selbst schalteten wir die volle Beleuchtung an und wurden vom Boden über Funk informiert, dass man dort das Gleiche getan hatte; trotzdem aber konnten wir einander nicht sehen. Der Pilot ging vorsichtig tiefer und erspähte mit Mühe das beleuchtete Rautenmuster, doch als er merkte, dass der Sturm die Rotorblätter wütend attackierte, ging er rasch wieder höher und fragte, was er tun solle.
Shelikows erster Assistent und die Techniker an Bord hielten es für geraten, den Versuch abzubrechen und mit dem verbliebenen Treibstoff zur Station zurückzukehren. Ich fragte über Funk Shelikow nach seiner Meinung, obwohl ich keinen Zweifel hatte, wie sie ausfallen würde. Ich erlebte keine Überraschung. Dieser Besessene, den nur ein einziger Grund am Leben hielt, erklärte, wir sollten keine kostbare Zeit verlieren, und wies uns an, zumindest einen Landeversuch, »einen ernsthaften, ordentlichen Versuch«, zu machen. Nach der Bergung des Mammuts sollten wir mit dem Rückflug warten, bis sich das Wetter gebessert habe.
Der Pilot runzelte die Stirn, biss die Zähne zusammen und ging mitten im wütenden Bombardement der Eisklumpen wieder tiefer. Heftig durchgerüttelt, schwankte der Hubschrauber über dem Lichtermuster hin und her, bevor er unsicher aufsetzte. Selbst auf dem Boden wurden wir noch so durchgeschüttelt, dass wir angegurtet warten mussten, bis uns Fahrzeuge abholten und zu der zweihundert Meter entfernten Wohnbaracke brachten.
Hier empfingen uns strahlende Helle und flutende Wärme. Die Blechöfen glühten kirschrot, die Bauarbeiter in Unterhemden rekelten sich in ihren Schlafkojen. Sie sprangen heraus und umdrängten uns erwartungsvoll wie eine Meute Hunde. Der von Shelikow verordnete Stopp der Arbeiten hatte sie beinahe eine Woche lang zum Nichtstun verurteilt.
Ohne dass mir meine Pelze oder auch nur der Hut abgenommen wurden, legte man mir sofort die technischen Zeichnungen der freigelegten Kluft und des Felsvorsprungs vor, auf dem das Mammut ruhte, und schon zehn Minuten später war ich wieder im Freien und wurde in einem »Schneepanzer« in aller Eile zu der Fundstätte gebracht.
Auf dem Baugelände war eine untertassenförmige Vertiefung, in deren Mitte es, dort, wo die Spalte freigelegt worden war, ziemlich steil nach unten ging. Die Senke war von kurzen Stahlträgern umgeben, an denen die Flutlichtlampen montiert waren, die normalerweise Arbeiten rund um die Uhr ermöglichten. Ein Kran mit einem zweisitzigen Bootsmannsstuhl war aufgestellt worden. Darauf wurden ich und Shelikows Chefassistent eilends festgeschnallt und hinabgelassen, zuerst in die Senke und dann, behutsamer, in die Felsspalte.
An der Erdoberfläche war es wegen der heulenden und pfeifenden Winde unmöglich gewesen, miteinander zu sprechen, doch als wir in die Vertiefung und dann in die Spalte selbst hinabgelassen wurden, schwächte sich der Lärm zu einem fernen Raunen ab. Schon bald unterhielten wir uns in normalem Ton, sogar leise, denn in der Enge der gläsernen Klamm war einem nicht danach zumute, laut zu sprechen. Ich hatte, da das Flutlicht nicht bis hierher reichte, eine Taschenlampe mitgenommen, und der Assistent (ich nenne ihn V.) hatte ein Funksprechgerät dabei.
Langsam ging es dem Felsvorsprung entgegen, der sich dem Auge zunächst als ein langer, ungleichmäßig geformter Eisbuckel darbot. Wir pendelten, während V. über sein Gerät Anweisungen durchgab, nach rechts und nach links und sanken dann tiefer, wobei wir im Schein der Taschenlampe die Struktur der Eishülle und die nicht deutlich zu erkennende Form des darin eingesargten Tieres untersuchten. Es war auf die linke Körperseite gestürzt, die Extremitäten nahe der Felswand, sodass nur einer seiner Stoßzähne, aber nichts vom Rumpf deutlich auszumachen war. Überhaupt war nur wenig zu erkennen, außer der ungefähren Größe, etwa zweieinhalb Meter (was für ein Jungtier sprach), und der charakteristischen Rundung des Hinterteils. Die etwa siebzig Zentimeter hohen Eisschichten um das Tier ermöglichten von oben nur einen stark getrübten Blick ins Innere, doch durch ein schmales Fenster aus durchsichtigem Eis an der Seite konnte man Zotteln vom Fell des Tieres erkennen.
Wir schwebten hin und wieder zurück, darüber und darunter, während V. – ein Experte, was die Eigenschaften von Eis anging – sorgfältig die Brüche und Verwerfungen im Gestein der Spalte registrierte und Ergänzungen zu Shelikows Bergungsplan anregte. Dann ließen wir uns hochhieven und erteilten Weisung, mit der Arbeit zu beginnen.
Zwei Trupps mit Dampfstrahlgebläsen und Haken wurden in die Spalte hinabgelassen und hatten binnen weniger Stunden den gewaltigen Eisblock abgelöst und aufgerichtet, der dann mit den Planen und Ketten umwickelt wurde, die wir mitgebracht hatten. Diese Arbeit war im Toben des Sturms, der Eisklumpen durch die Luft peitschte, ungemein schwierig und konnte erst abgeschlossen werden, als sich der Sturm legte und frostklirrende Stille eintrat, wie in diesen Regionen üblich.
Wir stiegen sofort in den Hubschrauber, der abhob und über dem Boden schwebte, während die Ladung daran befestigt wurde und die Rotorblätter den Zug nach unten abfingen. Dann traten wir den Rückflug an, und so wurde, während wir dicht über der Erdoberfläche und sehr langsam dahinschwebten – beinahe wie in einem feierlichen letzten Geleit –, das Tier zur Station befördert.
Wir transportierten es zu der Station und manövrierten es zu der vorbereiteten Position in einem unterirdischen Stollen. Und kaum hatten wir die Planen abgenommen, erschien auch schon Shelikow, der in seinem Rollstuhl die Rampe herabkurvte.
Während unserer Abwesenheit waren dem alten, von seinen Qualen geschwächten Mann unter Zwang schmerzlindernde Mittel injiziert worden. Als er danach in seinem Zimmer allein war, nur halb bei Bewusstsein, hatte er von unserer Rückkehr Wind bekommen und war »ausgebrochen«. Nun begann er den Eisblock zu umkreisen und versuchte dabei vergeblich, sich aufzurichten, um das Tier in Augenschein zu nehmen. V. und ich versicherten ihm zwar, dass außer einem Stoßzahn nichts zu sehen sei, doch in seinem benebelten Zustand tiefer Unruhe argwöhnte er, dass wir ihm irgendetwas verheimlichten – dass der Eisblock bei der Bergung gesprungen und das Mammut beschädigt worden sei. Wir beteuerten, dies sei nicht geschehen, konnten ihn aber nicht beruhigen.
Das unbeugsame Männchen, wegen der Eiseskälte in dem Stollen in Pelze gehüllt, schien während unserer Abwesenheit noch weiter geschrumpft zu sein. Sein Kopf war kaum größer als eine Grapefruit, aber noch immer versuchte er, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Zornig verlangte er, keinerlei Versuche zur Behebung des angeblichen Schadens zu unternehmen, bis das geplante Untersuchungsprogramm mit Röntgen- und Fotoaufnahmen ausgeführt worden war. Und dies habe augenblicklich zu geschehen!
V. und ich waren derart erschöpft, dass wir ihm beinahe auf der Stelle das Geheimnis enthüllt hätten. So fiel uns ein Stein vom Herzen, als Shelikows Arzt und ein Pfleger herbeieilten und ihn wegführten. Wir sahen uns ein paar Augenblicke betroffen an, denn uns war bewusst, dass der Schock Shelikow auf der Stelle hätte umbringen können.
Bei der guten und sogar gleichmäßigen Beleuchtung in dem Stollen hatte man durch das Fensterchen aus klarem Eis einen viel besseren Blick. Der Zottelpelz des Tieres war klar zu erkennen. Es war nicht das Fell eines Mammuts, es war das eines Bären. Die Bären sind keine ausgestorbene Gattung – ja, es gibt sie massenweise. Die Wissenschaftler waren einhellig der Überzeugung, dass die Bären in Millionen Jahren ihr Äußeres nicht verändert haben. Doch wie es schien, hatten wir hier einen Bären mit einem Stoßzahn vor uns.
Aber jetzt ließen wir ihn erst einmal für diese Nacht allein.
Ich schlief den Schlaf des Erschöpften, und am folgenden Tag beaufsichtigte ich die Röntgen- und die fotografischen Aufnahmen. Shelikow, der ein starkes Schlafmittel bekommen hatte, schlief noch. Die ersten Platten wurden innerhalb weniger Minuten entwickelt, und ich erlegte dem kleinen Team der Beteiligten sofort ein striktes Redeverbot auf, bis Shelikow selbst, nach entsprechender Vorbereitung, aufgeklärt werden konnte. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Dieser wackere Streiter, dieser Mann aus der ersten Reihe der Naturwissenschaftler, kehrte nicht von dem Ort zurück, an den er zuletzt gebracht worden war. Kurz vor der Mittagsstunde ging sein Amt an mich über – und damit auch das Problem des Tieres in dem unterirdischen Stollen.
In den folgenden Tagen ließ ich es wieder und wieder aus allen möglichen Winkeln und mit den modernsten Kameras fotografieren. Doch schon die erste Platte hatte Klarheit geschaffen: Wir hatten uns nicht getäuscht, was das Bärenfell oder den Stoßzahn betraf. Doch es war kein Bär mit einem Stoßzahn; auch andere Tiere tragen Felle wie Bären.
Dieses Tier war ein menschliches Wesen – weiblichen Geschlechts, ein Meter neunundachtzig groß, in der fünfunddreißigsten Woche schwanger, und es hatte früher schon ein Kind geboren.
Diese später entdeckten Fakten und einige weitere fand ich natürlich erst in der Folge heraus, doch die wesentlichen will ich hier aufführen.
Sibir (die Schlafende – so nannten wir sie) ist eine anziehende, ja schöne junge Frau mit hellem Teint und gut geschnittenen Gesichtszügen. Ihre Augen sind grau, nur ganz schwach ausgeprägte Schlitzaugen – das einzige »mongoloide« Merkmal an ihr, denn die Lider haben keine Mongolenfalten –, und sie hat hohe, etwas abgeflachte Wangenknochen. Kurzum, man könnte von einem slawischen Typus sprechen, wenn solche Bezeichnungen einen Sinn hätten, was natürlich nicht der Fall ist. Sie war den Slawen und allen heute existierenden Völkern um Zehntausende von Jahren vorausgegangen, denn ihre Todesstunde lag an die vierzigtausend Jahre zurück.
Soweit wir es abschätzen konnten, war sie achtzehn Jahre alt gewesen, als sie in die Spalte stürzte und sich das Genick brach. Sie hatte kurz zuvor Fisch verzehrt und davon noch mehr in ihrer Tasche aus Rentierhaut. Die Tasche hatte auf einem von ihr gezogenen Schlitten gelegen, und der Stoßzahn (das Viertel eines Stoßzahns, das gebogene Ende) war an dem Schlitten als eine der Kufen befestigt gewesen; das andere, also die andere Kufe, war anscheinend abgebrochen und beim Aufprall tiefer in die Felsspalte gefallen. Die Wucht des Aufpralls hatte die Ladung auf dem Schlitten verstreut, um ihren Oberkörper herum und darüber, was den Eindruck von etwas Massigem und Langem bewirkt hatte.
Sie war mit ausgestrecktem linken Arm (sie war Linkshänderin) auf die linke Körperseite gestürzt, vielleicht weil sie ihr ungeborenes Kind schützen wollte. Das Kind, auf das die ausgeprägte Bauchwölbung zurückzuführen war, hätte ihr in jedem Fall eine schwierige Geburt bereitet, denn sein Kopf war sehr groß: Sein Vater war offensichtlich ein Präneandertaler gewesen (nicht die Sonderform des europäischen Neandertalers, sondern die frühere, allgemeinere des Homo primigenius mit höherer Schädelwölbung – sein europäischer Nachfolger war in dieser Hinsicht eine Rückentwicklung; die Evolution vollzieht sich nicht geradlinig).
Von dem gebrochenen Arm und Genick abgesehen, hatte sie keine Verletzungen erlitten. Sie war rasch zu Eis erstarrt, der Gehirnschaden geringfügig. Und sie war vollkommen, alles an ihr perfekt erhalten: Lippen, Zunge, Fleisch, Körperorgane. (Die Verdauungsorgane waren während des Fischverzehrs in ihrer Funktion angehalten worden.) Alles an ihr war von einer gesunden Frische: schockgefroren. Sie hatte sogar Speichel im Mund. Von ihrer Größe abgesehen, wirkte sie in jeder Hinsicht wie eine ganz und gar moderne Art. Und trotzdem war sie genau das – in jeder Hinsicht – nicht. Darüber später mehr.
Jetzt müssen zweierlei Dinge konstatiert werden. Von allen bewohnten Gebieten der Erde ist diese Region, seit prähistorischen Zeiten vom Eis umgürtet, die einzige, wo ein solcher Fund möglich war. Und dann wurde er zu genau jenem Zeitpunkt gemacht, als er genutzt werden konnte – obwohl wir sehr behutsam vorgegangen sind und Sibir kaum Schaden genommen hat. Ich kann mich nicht dazu überwinden, sie zu entstellen.
Ich betrachte sie oft. Noch immer befindet sie sich in dem Stollen in unserer Station, friedvoll-gelassen und zeitlich entrückt, für alle Zeit achtzehn Jahre alt geblieben. Sie werden sie sehen. So stehen wir am Ende einer langen Kette von Zufallsfügungen und am Beginn einer zweiten – der zweiten überaus bedeutsamen Kette, derentwegen Sie hierhergekommen sind.
Ich habe keinen Zweifel, dass Sie mir im Zusammenhang damit viel zu erzählen haben werden. Und darauf warte ich.
Aber jetzt will ich beginnen.
I.Der Briefträger und der Professor
1
Kurz vor neun Uhr an einem leuchtenden, strahlenden Junimorgen, der einen heißen Tag verhieß, fuhr eine dreiundsechzigjährige Frau mit dem Fahrrad durch die Straßen von Oxford.
Langsam radelte sie dahin, von majestätischer Korpulenz wie eine einstige Königin der Niederlande – das geblümte Kleid bauschte sich, der Strohhut wippte auf und nieder. Auf und ab bewegten die blumengeschmückten Oberschenkel die Pedale, bis sie nach dem Einbiegen in die High Street von einer langsam umschaltenden Verkehrsampel zum Halten veranlasst wurden. Sie rutschte sofort aus dem Sattel und zog die Handbremse an – einen Augenblick zu spät, sodass ihre Füße in den breiten Sandalen hektisch vorantrippelten, während sie den Drahtesel zu bändigen versuchte.
Schlechte Koordination. Schrecklich, schrecklich! Heute war alles schrecklich, nicht zuletzt der Zustand ihres Kopfes. Sie nutzte die Gelegenheit, um den Hut abzunehmen und sich Kühlung zuzufächeln, ein Stück des Kleides, das an ihr klebte, von der Haut wegzuziehen und locker zu schütteln.
Ihre Schwester hatte ihr geraten, an diesem Tag im Bett zu bleiben. Kam nicht infrage. Angesichts dessen, dass sie das Pensionierungsalter schon drei gefährliche Jahre hinter sich hatte, konnte sie sich von einer Erkältung nicht ans Bett fesseln lassen. Ihr Chef würde nicht im Bett bleiben, und auf ihren Job lauerten andere Leute. Miss Sonntag bekam ihre Erkältungen nicht wie andere Leute im Winter, sondern im Sommer während der Hitzeperioden, und sie überfielen sie mit betäubender Heftigkeit. Wenn die ganze Welt voller Blumen und Freuden war, verwandelte sie sich selbst in eine Schwachsinnige. Jetzt wurde ihr abwechselnd heiß und kalt, sie war wie vor den Kopf geschlagen, kein normaler Mensch mehr, nur ein Klumpen Fleisch.
Als die Ampel auf Grün schaltete, schob sie sich wieder auf den Sattel und strampelte in königlicher Haltung weiter. In der Stadt der Fahrräder waren an diesem Tag nicht viele Räder unterwegs. Die Universität hatte ihre großen Ferien, nur ihr Professor war noch da. Bis er selbst in die Ferien ging – sicher nicht, bevor im Spey mehr Lachse schwammen –, gab es für sie keine freie Zeit. Ach Gott!
Das College Brasenose glitt vorüber, dann folgten Oriel und All Souls. Sie bog gerade in den Hof ein, als sämtliche Glocken der Stadt mit dem Neunuhrläuten einsetzten. Im Hof stand die Luft, niemand war zu sehen, im Fahrradständer keine Räder. Sie sicherte ihr eigenes mit einer Kette und ging matt vor Müdigkeit hinein. Der Hausmeister hatte die eingegangene Post sortiert und die für den Professor bestimmte mit einem Gummiband umschnürt. Sie nahm den Hut ab und nieste.
Die Luft in ihrem Zimmer war abgestanden, aber kalt. Sie versuchte die Klimaanlage abzustellen, schaffte es aber nicht und öffnete stattdessen das Fenster.
Dann schaltete sie den elektrischen Teekessel an, schaute nach der Post, sah aber keine. Irgendwo hatte sie doch welche gesehen … Ihr Kopf brummte derart, dass sie sich nicht erinnern konnte, wo. In der Halle vielleicht, wo die Briefe angekommen waren? Sie ging hinaus und suchte alles ab. Nichts.
Da der Kessel zu pfeifen begann, ging sie wieder hinein, machte sich eine Tasse Kaffee und hängte ihren Hut an den Haken. Unter dem Hut, auf dem Stuhl lag die Post. Dumpf starrte sie sie an und schnäuzte sich. Dann trank sie ein paar Schlucke Kaffee, machte sich an die Arbeit und wurde beinahe im selben Augenblick durch einen Anruf unterbrochen. Sie nahm den Hörer ab und beschäftigte sich weiter damit, Briefe glattzustreichen und die Umschläge in den Papierkorb zu werfen. Als sie auflegte, war sie mit der ganzen Post fertig. Und im selben Augenblick wurde ihr klar, dass irgendetwas damit nicht stimmte. Es waren sechs Kuverts, aber nur fünf Briefe mit ausländischen Absendern.
Verdutzt schob sie die Briefe hin und her, schaute dann auf den Fußboden und in den Papierkorb. Im Korb lagen die sechs Umschläge aus dem Ausland und zehn von englischen Absendern, alle leer. Sie stellte fest, dass heute ein ganz schlimmer Tag werden würde. Sie stellte außerdem fest, dass ihr Chef eingetroffen war. Seine lange, vornübergeneigte Gestalt war hinter der Glasscheibe der Tür vorbeigetrabt. Sie lehnte sich zurück und ließ sich den Ratschlag ihrer Schwester durch den Kopf gehen. Dann riss sie sich zusammen und begann zerstreut Briefe und Kuverts einander zuzuordnen, um zu sehen, was fehlte.
Sie hatte zehn Umschläge und zehn Briefe aus England vor sich, drei Umschläge mit Briefen aus Amerika, zwei deutsche Kuverts und Briefe, einen Umschlag aus Schweden, aber keinen dazugehörigen Brief. Sie sah sich diesen Umschlag noch einmal an. Er machte einen schlampigen Eindruck. Die Adresse war auf ein abgerissenes Stückchen sehr dünnes Papier geschrieben und mit Tesafilm auf das Kuvert geklebt worden. Innen war nichts. Nach einiger Zeit, als sie gar nichts mehr begriff, brachte sie alles zu ihrem Professor hinein und berichtete ihm, dass ein Brief fehle.
Der Professor blickte auf und sah sie verblüfft an. »Ein Brief fehlt, sagen Sie, Miss Sonntag?«
»In diesem Umschlag war jedenfalls keiner.«
Er sah sich das Kuvert an.
»Aus Göteborg, Schweden«, sagte er. »Was gibt es dort in Göteborg, Schweden?«
»Die Universität vielleicht?«
»Vielleicht mit zerstreuten Professoren?«
Dieser Gedanke kam ihr im selben Augenblick, als er ihn aussprach, und sie verwünschte ihre Erkältung. Zu einer anderen Zeit wäre ihr der Einfall als Erster gekommen, und sie hätte den Umschlag gelassen, wo er war (wie sie es, so dachten später manche Leute, schon einmal zuvor getan hatte). Ihre Dickköpfigkeit war schuld daran, dass sie den verdammten Papierkorb noch einmal durchstöbert hatte.
Sie war nicht nur ein Dickschädel, sondern hatte auch einen gewaltigen Brummschädel. Dennoch sagte sie gleichmütig: »Das sieht mir nicht aus wie der Brief eines Professors. Das heißt, wir haben ja nicht einmal einen Brief, aber …«
»Schon gut, Miss Sonntag.« Der Professor zog seine Jacke aus. Sein ungewöhnlicher Kopf, groß und knorpelig, war ratzekahl. Jetzt glänzte er feucht. »Hier ist es schrecklich heiß«, sagte er. »Läuft denn die Klimaanlage?«
»Ja, schon.« Miss Sonntag schnäuzte sich demonstrativ in ein Kleenex. »Die sorgt dafür, dass mir meine Erkältung bleibt.« Sie sah ihm zu, wie er sich die Brillenbügel hinter die Ohren klemmte und den Umschlag genauer betrachtete.
Die Adresse war mit einem Kugelschreiber in ungelenken Großbuchstaben geschrieben worden:
PROF. G. F. LAZENBY
OXFORD
ENGLAND
Professor Lazenby sah sich die Rückseite des Kuverts an, dann wieder die Vorderseite. Er hielt es gegen das Licht, der Luftpostumschlag war durchscheinend. Dann schaute er hinein und zog einen Augenblick später ein Fitzelchen hauchdünnes Papier heraus, das am unteren Rand teilweise angeklebt war.
»Nanu, das ist mir entgangen«, sagte Miss Sonntag.
»Schon gut, Miss Sonntag.«
Auf dem Stückchen Papier stand nichts. Lazenby hielt das Kuvert am unteren Rand hoch und klopfte es sorgfältig ab.
»Sie nehmen doch nicht an, dass da irgendein Pulver drin war und ich es in den Papierkorb geschüttet habe?«, fragte Miss Sonntag beunruhigt.
»Wir können uns den Papierkorb ja ansehen.«
»Nein, das mache ich! Selbstverständlich. Es tut mir schrecklich leid. Aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen …«
Sie gingen beide nach nebenan, holten aus dem Papierkorb die Briefumschläge heraus und klopften jeden einzelnen über dem Korb sorgfältig ab. Sie nahmen sämtliche Kuverts heraus, doch in dem Korb war kein Pulver zu sehen. Auf dem Boden entdeckten sie lediglich einen zweiten dünnen Papierstreifen.
In diesem Augenblick fiel Miss Sonntag ein, dass das Telefon geläutet hatte, als sie gerade den ersten Umschlag öffnete, der aus Schweden gekommen und natürlich als erster im Papierkorb gelandet war. Sie setzte dazu an, dies dem Professor zu erklären, doch Lazenby sagte nur: »Schon gut, Miss Sonntag.« Und dann gingen beide zurück in Lazenbys verglastes Hauptlabor. Dort waren inzwischen ein paar graduierte Studenten bei der Arbeit; das Labor gehörte zur Abteilung Mikrobiologie.
Lazenby ließ sich auf seinem Stuhl nieder und lockerte die Krawatte. Dann betrachtete er die beiden Papierstreifen und schnupperte daran. »Zigarettenpapier!«, sagte er. Er hielt eines der Blättchen Miss Sonntag vor die Nase und sah den Umschlag an. »Die Adresse ist ebenfalls auf Zigarettenpapier geschrieben«, sagte er.
»So?«, sagte Miss Sonntag schwach. »Ich verstehe nichts davon. Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Sie roch an dem Papier nichts.
»Wie wäre es, wenn Sie mir eine Tasse Kaffee machen würden?«, sagte Lazenby. »Außerdem … vielleicht … dieser junge Mann vom Wissenschaftlichen Dienst. Sie haben ja seine Nummer.« Er blickte an einem der Blättchen entlang. Es war nichts darauf zu sehen, aber dann kam ihm die Idee, dass es etwas enthalten könnte. An der Oberfläche deuteten sich schwach Einkerbungen an.
»Aber natürlich. Sofort, Herr Professor. Ich möchte allerdings feststellen«, erklärte Miss Sonntag steif, »dass ich ohne die Erkältung in meinem Kopf einen solchen Fehler nicht gemacht hätte. So was …«
»Was für einen Fehler? Sie haben doch keinen Fehler gemacht, Dora«, sagte der Professor freundlich und zutreffend obendrein. »Es war schlau von Ihnen, dass Sie das bemerkt haben. Sehr aufmerksam. Ich weiß das zu schätzen.«
»Ja? Oh, danke. Ja. Kaffee«, sagte Miss Sonntag und wirbelte förmlich mit geröteten Wangen durch den Raum in ihr Zimmer. Sie konnte sich nicht erinnern, wann er sie zum letzten Mal mit ihrem Vornamen angesprochen hatte. Ihr Geruchssinn war wunderbarerweise wieder da. Sie roch überall Blumenduft, auch ihr eigenes Lavendelwasser, und durchs offene Fenster die Düfte des herrlichen Oxford und jenseits davon die dieses so gütigen und liebenswerten Landes.
Miss Sonntag und ihre Schwester Sonya, ein paar Jahre älter als sie, hatten kurz vor dem Krieg in England Zuflucht gefunden, dank einem Freund ihres Vaters, ebenfalls Arzt, der für sie bürgte. Der Arzt hatte sie während des Krieges bei sich in Oxford behalten und sich auch später um ihr Wohlergehen gekümmert. In Deutschland hatten Sonya Sonntags Ambitionen dem Medizinerberuf und Doras Neigung einer akademischen Laufbahn gegolten – beides war dort für sie verschlossen und ließ sich auch in England nicht ohne Weiteres verwirklichen, da sie in ihrer Ausbildung jahrelang zurückgeblieben waren. Schließlich war Sonya Krankenschwester geworden, und Dora hatte eine Anstellung bei der Universitätsverwaltung gefunden, beide nach wie vor unverheiratet, bis Professor Lazenby dann Dora in sein eigenes Institut »entführte«. Das lag nun fünfzehn Jahre zurück, und seither hatte sie für ihn gearbeitet. Drei Zuckerstücke in seinen Kaffee … Sie gab sie mit einem Löffel in die Tasse, noch immer glühend vor Stolz über die Würdigung ihrer Sorgfalt. Dann fiel ihr sein zweiter Wunsch ein: der Mann vom Wissenschaftlichen Dienst.
2
Der Mann vom Wissenschaftlichen Dienst war ein früherer Student Lazenbys, und der Professor erinnerte sich hauptsächlich daran, dass er bei der Arbeit ziemlich oberflächlich gewesen war, sich aber aufs Bluffen verstand, wenn Experimente schiefgingen. Er hatte mit einem enttäuschenden Grad dritter Klasse abgeschlossen und eine Anstellung beim damals noch bestehenden Ministerium für Landwirtschaft und Fischfang gefunden. Später hatte er den Arbeitsplatz gewechselt, und danach hatte Lazenby ihn aus den Augen verloren. Er hatte sich unerwartet wieder gemeldet und mit einer dringenden Bitte um Hilfe den Professor zum Lunch eingeladen, ein paar Tage, bevor Lazenby zu einer Konferenz nach Wien abreisen sollte. Obwohl Lazenby eine Menge um die Ohren hatte, konnte er sich nicht gut verweigern, wenn ihn ein ehemaliger Student um Hilfe anging; zu seiner großen Überraschung wurde ihm ein opulentes Mahl vorgesetzt. Und während des Essens forderte ihn dieser frühere Student auf – jedenfalls verstand Lazenby es so –, ein Spion zu werden.
»Oh nein, nichts dergleichen, Prof! Das Wort ist viel zu stark.«
»Sie möchten von mir, dass ich weitergebe, was mir Leute in Wien unter vier Augen erzählen?«
»Natürlich nichts Persönliches. Programme und Finanzielles. Es wird ungeheuer viel Parallelarbeit geleistet. Das kann für die Wissenschaft nicht gut sein, Prof.«
»Ich komme darauf, dass jemand die gleiche Arbeit macht wie ich, und erzähle es Ihnen?«
»Jemand anderes könnte draufkommen und es uns berichten. Dann würde der Wissenschaftliche Dienst Sie davon unterrichten.«
»Ist der Wissenschaftliche Dienst ein staatliches Organ?«
»Eine Art staatliches Organ.«
»Aha.« Er hatte von dieser Art staatlichem Organ in den Vereinigten Staaten gehört. Dort nannten sie es CIA, und zahlreiche amerikanische Wissenschaftler, wie er wusste, arbeiteten tatsächlich dem CIA in der erwähnten Weise zu. Ich bete zu Gott, dachte Lazenby, dass das nicht auch in England Schule macht. »So, Philpott«, sagte er. »Vielen Dank für das Essen. Es war ein Genuss.«
»Versuchen Sie’s doch mal mit uns, Prof! Ich schicke Ihnen ein bisschen Material aus Ihrem eigenen Fachbereich zu.«
»Unbedingt. Von wem haben Sie es denn?«
»Ach, von Leuten, die Sie kennen. Alle erstklassig.«
»Und warum haben die es mir nicht selbst gegeben?«
»Ich nehme an, sie haben die Bedeutung nicht erkannt. Das Zeug muss zusammengesetzt, kombiniert werden. Hier ein paar Krümel, dort ein paar Krümel …«
»So.« Krümel. Das roch verdächtig. »Ja, das wird interessant für mich sein«, sagte Lazenby.
»Ganz sicher, Prof. Das verspreche ich Ihnen. Sehr nützliche Dinge, zumal dann, wenn die Gelder verteilt werden. Das sagen alle, die mit uns zusammenarbeiten.«
»Und ich bekomme diese nützlichen Dinge auch dann weiterhin«, fragte Lazenby, »wenn ich mich nicht dazu entschließen sollte mitzuarbeiten?«
»Das Wohl des Landes, Prof.«
»Des Landes?«
»Der Wissenschaft«, sagte Philpott und blinzelte. »Sie kennt keine Grenzen. Das hab ich von Ihnen selbst, die Republik der Wissenschaft. Die Sache ist so – es zeigt sich manchmal, dass vereinzelte Details, die für den Kollegen ohne Nutzen sind, für einen anderen einen hohen Wert haben. Das kommt sogar sehr oft vor. Ehrlich, Prof, alle tun es.«
»Wer sind diese alle?«
»Ausländer. Sie erwarten, dass man es tut. Würde mich sehr überraschen, von Ihnen zu hören, dass Sie nicht bereits mit jemandem unseresgleichen Verbindung hatten. Das versichere ich Ihnen.«
»Schön, ich werde Ihre Beteuerung annehmen. Und das Material!«, antwortete Lazenby feierlich.
Und zu seiner Überraschung erwies sich die Sache tatsächlich als nützlich. Es waren Krümel, wie Philpott gesagt hatte, aber geschickt zusammengefügt. Und tatsächlich deuteten sie auf eine mögliche Parallelarbeit an irgendeinem Projekt hin. Nicht viel zwar, aber genug, um ihn nachdenklich zu stimmen.
Mit nur schwachen Gewissensbissen war er auf Philpotts Ersuchen eingegangen. Ohne krasse Vertrauensbrüche. Es ging nur um Krümel, die für einen Kollegen in der Republik interessant sein konnten. Und diese Krümel waren dann, mit anderen verwoben, zu ihm zurückgekehrt, in den Berichten, die in periodischen Abständen vom Wissenschaftlichen Dienst eintrafen. Sie kamen nicht mit der Post, sondern per Kurier, begleitet von der Empfehlung, sie bald zu lesen, und dem Ersuchen, das Material nicht zu fotokopieren.
Einmal, als einer der Berichte einige Wochen lang verlegt und ungelesen geblieben war, hatte Miss Sonntag mit Staunen festgestellt, dass er keinerlei Text mehr enthielt. Um eine Wiederholung dieses Missgeschicks zu vermeiden, hatte sie den nächsten Bericht fotokopieren wollen. Doch das Blatt für die Kopie war unbedruckt aus dem Apparat gekommen, und der Text auf dem Original selbst war gelöscht. Die Erinnerung daran – und an das, was Ausländern so einfällt – hatte Lazenby auf Philpott gebracht, während er sich die Zigarettenpapierblättchen besah.
Lazenby traf sich mit seinem ehemaligen Studenten im Mitre. Philpott hatte zwar gedrängt, man solle sich entweder im Institut oder irgendwo in London zusammensetzen, aber Lazenby hatte nicht die Absicht, eigens dafür nach London zu fahren, und im Institut wollte er ihn auch nicht sehen. Das Mitre war ein viel diskreterer Treffpunkt – noch gab es nur wenige Touristen in der Stadt, und die Studenten waren alle fort. So saßen sie denn still in einer Ecke, während Philpott nacheinander verschiedene Papiere aus seiner Aktentasche zog.
Bei einem davon handelte es sich um ein Foto des Briefumschlags und der beiden Blättchen, bei einem anderen um eine Vergrößerung der Adresse, und ein paar weitere zeigten die Resultate von Behandlungen, die daran vorgenommen worden waren.
»Umschlag und Klebeband kommen aus Schweden«, sagte er, »der Kugelschreiber hingegen nicht. Das Zigarettenpapier ist russischer Herkunft. Wir nehmen an, dass ein Seemann den ›Brief‹ aufgegeben hat. Wir vermuten, dass er die Zigaretten mit der Weisung bekam, sie aufzuschlitzen, den Tabak zu entfernen und dann die Blättchen in einen Umschlag zu stecken und abzuschicken. Die Adresse wurde auf dieses dritte Blättchen geschrieben. In schwacher Bleistiftschrift, und vermutlich haben Sie sie nicht bemerkt.«
»Nein«, räumte Lazenby ein.
»Sie stand jedenfalls drauf. Auch die Bleimine des Stifts stammt aus Russland. Vermutlich hat sich Folgendes abgespielt: Irgendetwas wurde so auf eine Lage Papier geschrieben, dass es sich auf eine darunterliegende abdrückte. Die unteren wurden dann als ›Zigaretten‹ in eine Packung gesteckt und diesem Seemann übergeben – zusammen mit diesem anderen Blättchen für die Adresse. Dieses musste er auf den Umschlag kleben und dann die Bleistiftschrift sorgfältig mit einem Kugelschreiber nachfahren.«
»Aha. Sehr schlau.«
»Ja. Und auf dem Blättchen stand Folgendes …«
Lazenby sah sich die Vergrößerung an. Die Einkerbungen waren auf irgendeine Weise sichtbar gemacht worden und ließen eine Zahlenkette ans Licht treten:
18 05 22 (01 18 01–05)
04 05 21 (31 27 12–15)
10 05 18 (46 10 49–52)
16 19 01 (18 11 13–14)
Daran schlossen sich noch einige weitere Zeilen.
»Was ist das?«, fragte Lazenby.
»Wie Sie sehen, gliedert es sich in Abschnitte, von denen jeder mit einer Gruppe aus drei Zahlen beginnt. Lassen Sie erst mal weg, was in Klammern steht. Die erste Gruppe ist achtzehn, fünf, zweiundzwanzig, dann vier, fünf, einundzwanzig, dann zehn, fünf, achtzehn … Es ist ein alphabetischer Code, englisches Alphabet – das heißt, die Eins steht für A, die Zwei für B. Sie werden sehen, was dabei herauskommt.«
Lazenby versuchte es eine Minute lang, vertat sich aber.
»Die erste Gruppe lautet R-E-V«, sagte Philpott, »die zweite J-E-R, die dritte D-E-U und so fort. Das sind Bücher aus der Bibel. Die Gruppen in Klammern geben Kapitel und Vers an, und die Gruppen mit Bindestrich bezeichnen die Wörter, die gebraucht werden. Hier ist der Text.«
Lazenby betrachtete ein neues Blatt.
Siehe, ich bin lebendig/weil ich noch heute mit euch lebe/im nördlichen Lande/in dunklen Wassern/in der Wüste, der dürren Einöde, da es heulet/Warum antwortest du mir nicht?/Siehe, ein Neues will ich künden/Die Augen aller werden aufgetan/So sende mir den Mann/Kundig der Wissenschaften von jeglichem belebenden Wesen/Lass mich deine Stimme in dieser Sache hören/den ersten Tag um Mitternacht/Stimme Amerikas.
»Die ›Stimme Amerikas‹ ist in der Bibel …?«, fragte Lazenby.
»Nein, das nicht«, gestand Philpott. »Diese Gruppe steht für V-O-A, und dafür gibt es kein Buch. Doch aus dem Zusammenhang wird es ganz klar.«
»Aha. Und genauso ist es mit ›Wissenschaften‹, nicht?«
»Wissenschaften? Nein, das stammt aus dem Buch Daniel.« Philpott sah auf einem anderen Blatt nach. »Ja, Daniel eins, Vers vier.«
»Gut.« Lazenby leerte sein Glas. »Sehr gut, dass man das herausbekommen hat«, sagte er.
»Haben Sie irgendeine Ahnung, worum es hier geht, Prof?«
»Nein, keinen Schimmer. Was meinen Sie?«
Philpott legte die Stirn in Falten. »Nun, wir sind der Meinung, es kommt von einem russischen Wissenschaftler, einem Biologen, jedenfalls von jemandem, der in einer Biowissenschaft tätig ist. Offensichtlich kennt er Sie, oder er weiß von Ihnen. Er hat Sie schon einmal zu erreichen versucht. Er ist auf etwas gestoßen, das er für sehr wichtig hält. Sie sollen ihn wissen lassen, ob Sie es bekommen und verstanden haben. Er kann die ›Stimme Amerikas‹ empfangen. Das bedeutet es, mehr oder weniger, nach unserer Auffassung.«
Dies ließ sich Lazenby durch den Kopf gehen.
»Haben Sie in Erwägung gezogen, dass der Mann bekloppt sein könnte?«
»Er hat sich sehr ins Zeug gelegt.«
»Wirrköpfe legen sich ins Zeug.«
»Ganz recht. Dann wäre der hier übrigens ein jüdischer Wirrkopf oder einer von jüdischer Abstammung.«
»Wegen der Bibel?«
»Wegen seiner Daumen. Er hat an jedem der Zigarettenpapierchen zwei deutliche Abdrücke hinterlassen.«
»Man kann einen Juden an seinen Daumen erkennen?«, fragte Lazenby perplex.
»Es gibt anscheinend einen spezifisch jüdischen genetischen Fingerabdruck. Die Israelis sind Experten in diesem Punkt.« Philpott schaute nach und sagte: »Tel Aviv, ja. Abteilung für Kriminologie. Denen liegt viel daran, einen Juden von einem Araber unterscheiden zu können. Genetisch gesehen ist es dominant vererbt und kommt selbst bei einem Mischling oft durch. Das Interessante hier ist … anscheinend will er betonen, dass er am Leben ist, so als könnten Sie das Gegenteil vermuten. Unsere Hoffnung richtet sich jetzt darauf, dass Sie sich vielleicht an einen jüdischen Biologen erinnern, der seit einigen Jahren von der Bildfläche verschwunden ist. Wir glauben, dass er Ihnen tatsächlich irgendwann begegnet ist. Er wendet sich ja sehr direkt an Sie und denkt wahrscheinlich, dass Sie ihn kennen. Und das bedeutet, dass er zu Kongressen und dergleichen ins Ausland gereist ist, da Sie ja nie in der ehemaligen Sowjetunion gewesen sind.«
Lazenby überlegte, wann er gegenüber Philpott wohl erwähnt haben könnte, dass er die ehemalige Sowjetunion nie besucht hatte. Er kam zu dem Schluss, dass er nie etwas Derartiges zu Philpott gesagt hatte.
»Ich werde darüber nachdenken«, sagte er.
»Wir wären Ihnen sehr verbunden. Übrigens ist schon einige Vorarbeit geleistet worden. Es wäre interessant zu erfahren, was Sie über die Leute hier wissen.« Er reichte Lazenby eine Liste.
Sie enthielt ungefähr zehn Namen, alle Lazenby irgendwie bekannt, alle in der Biologie oder in verwandten Disziplinen tätig.
»Von Solnik«, sagte er, während er die Liste überflog, »weiß ich, dass er nicht mehr am Leben ist. Er ist, soviel ich weiß, vor ein paar Jahren gestorben.«
»Ja, wir haben die Nachrufe. Aber darüber würde ich mir nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Wenn der Betreffende von der Bildfläche verschwinden musste.«
»Ach … Wissen Sie, das ist natürlich alles lange her«, sagte Lazenby. Es war wirklich sehr lange her. Er hatte von den meisten Männern auf der Liste angenommen, dass sie inzwischen nicht mehr unter den Lebenden weilten. Einer von ihnen hatte, wie er wusste, einen schweren Verkehrsunfall gehabt.
»Ich nehme an, dass ich ihnen allen irgendwann begegnet bin.«
»Könnte es sein, dass sie in Ihren Tagebucheintragungen auftauchen?«
»Ich führe kein Tagebuch.«
»Oder bei Miss Sonntag vielleicht – in Terminkalendern?«
»Aus welcher Zeit?«
»Aus den letzten fünf Jahren. Zehn vielleicht.«
»Höchst unwahrscheinlich. Und außerdem: Was könnten Sie darin schon finden?«
»Begegnungen. Die wir vielleicht rekonstruieren könnten. Vielleicht wird irgendwo dieser andere erwähnt?«
»Welcher andere?«
»Er möchte, dass Sie ihm einen Mann schicken.« Philpott suchte die Stelle. »›So sende mir den Mann, kundig der Wissenschaft von jeglichen belebenden Wesen.‹ Noch ein Gläschen, Prof?«
»Einverstanden. Aber nur ein kleines und mit viel Soda.«
Philpott holte die Drinks. »Wir haben so das Gefühl«, sagte er, als er sich wieder setzte, »dass es ein ganz besonderer Bursche sein muss. Den Sie beide zusammen kennengelernt oder über den Sie miteinander gesprochen haben. Wäre das denkbar?
»Doch. Ich nehme an, ja.«
»Könnte sich irgendetwas in Ihrer Korrespondenz finden?«
»In Bergen von Briefen aus zehn Jahren …?«
»Nun, da könnten wir natürlich behilflich sein«, sagte Philpott.
Lazenby nahm nachdenklich einen kleinen Schluck.
Philpott war zwar als Wissenschaftler keine Leuchte, aber Lazenby hatte ihn auch nie als Schwachkopf betrachtet. Ihm musste doch klar sein, dass hier ein Witzbold sein Unwesen trieb.
»Philpott«, sagte er, »wie kommen Sie eigentlich darauf, dass jemand sich einfallen lassen könnte, mir auf Zigarettenpapier zu schreiben?«
»Falls er – wenn es überhaupt so war – keine andere Möglichkeit hatte, ist das gar keine so schlechte Idee. Eine Zigarette hat den Vorteil, dass man sie rauchen kann, wenn man festgenommen wird.«
»Schön. Aber warum den Text darauf verschlüsseln?«
»Für den Fall, dass man festgenommen wird, sie aber nicht mehrrauchen kann.«
»Der Code hat Ihren Leuten anscheinend keine großen Schwierigkeiten bereitet, stimmt’s?«
»Nicht, nachdem sie erkannt hatten, dass die Bibel benutzt wurde. Bei Leuten, die damit nicht aufgewachsen sind, liegt es natürlich nicht so nahe. Außerdem ist die russische Bibel anders als die englische – soviel ich weiß, haben die Bücher andere Namen und die Kapitel und Verse sind anders angeordnet. Jedenfalls: Doppelt genäht hält besser. Ein umsichtiger Mann.«
»Hm.« Lazenby sinnierte wieder. »Einen Mann zu ihm schicken«, sagte er. »Wie soll man ihm einen Mann schicken?«
»Nun, die Meinung der Amerikaner dazu …«
»Die Meinung welcher Amerikaner?«
»Er möchte eine Antwort über die ›Stimme Amerikas‹. Den Sender. Der ist eine amerikanische Einrichtung … Jedenfalls, sie sind der Meinung, wenn man den Mann findet, hat man vermutlich auch die Antwort auf das Wie gefunden. Er wird wissen, wie.«
»Meinen Sie nicht, es wäre vernünftiger gewesen, diesem Mann selbst ein paar Blättchen Zigarettenpapier zu schicken?«
»Doch. Viel vernünftiger«, pflichtete Philpott ihm bei. »Man bekommt den Eindruck, dass er entweder nicht weiß, wo der Betreffende ist, oder aber bezweifelt, dass er Verbindungen hat wie Sie.«
»Dass man niemandem die Blättchen zeigen kann?«
»Genau.«
»Ja.« Lazenby betrachtete wieder sinnend die Blättchen. Es war klar, dass jede Frage, die er stellen würde, prompt eine Antwort fände. Es gab durchaus einige weitere Fragen, aber er beschloss, sie nicht zu stellen. Der Spey erwartete ihn in ein paar Tagen, und nichts – vor allem nicht diese hirnrissige Geschichte – sollte ihm sein Vorhaben durchkreuzen.
»Darf ich fragen, Prof«, sagte Philpott, »ob ich mir jetzt gleich Ihr Archiv vornehmen könnte? Die Arbeit ein bisschen aufteilen – haben Sie etwas dagegen?«
»Und ob! Natürlich können Sie das nicht, Philpott.«
»Aha … Miss Sonntag also?«
»Ich werde sie fragen. Worauf genau haben Sie es eigentlich abgesehen?«
»Auf alles, was die Männer betrifft, die auf der Liste stehen. Nach unserer Meinung muss es einer von ihnen sein.«
»Und warum?«
»Sie haben alle irgendwann einmal Kontakt zu Ihnen gehabt und sind jetzt alle aus dem Verkehr gezogen. Sie liegen nicht im Krankenhaus, nicht seit so langer Zeit. Sie sind nicht in den Ruhestand getreten, beziehen jedenfalls keine Pension. Und gestorben sind sie auch nicht. Abgesehen von ein paar Fällen, in denen Zweifel bestehen. Es steht beinahe mit Gewissheit fest, dass sie an irgendetwas arbeiten.«
»So. Und wer sagt das alles?«
»Die Amerikaner. Die sind in dieser Hinsicht bei Weitem die Besten«, antwortete Philpott nickend. »Und sie haben eine hervorragende bibliografische Abteilung – äußerst detailliert und auf dem neuesten Stand. Sie wissen zum Beispiel Bescheid über die Standorte und die Leitungen aller Institute im Bereich … nun ja, in verschiedenen Bereichen. Dieser Mann arbeitet an keinem dieser Standorte, er muss an irgendeinem anderen sein, von dem sie nichts wissen. Und das ärgert sie ungemein. Sie möchten sich dringend mit uns austauschen, sobald wir etwas vorzuweisen haben.«
»Ich verstehe«, sagte Lazenby und zog die Stirn kraus. Was er vor allem verstand, war, dass eine gigantische Zeitverschwendung drohte, wenn man der Sache nicht rechtzeitig einen Riegel vorschob.
»Könnte Miss Sonntag sich die Briefe jetzt gleich vornehmen?«
»Ich werde sie fragen.«
»Die Sache ist von höchster Dringlichkeit. Noch eine andere Frage: Ist so etwas schon früher einmal passiert – dass ein Briefumschlag angekommen ist, der scheinbar leer war? Vermutlich nicht aus Göteborg, eher aus Rotterdam oder Hamburg. Am wahrscheinlichsten aus Rotterdam.«
»Danach könnte ich mich ebenfalls erkundigen. Warum fragen Sie?«
»Das darf ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich werde es tun, sobald ich dazu ermächtigt bin – und dazu werden Sie eine Menge weiterer Informationen bekommen. Und wenn Ihnen selbst irgendetwas einfällt, Prof, werden Sie sich hoffentlich sofort bei mir melden.«
»Aber sicher, Philpott«, sagte Lazenby und war schon nicht mehr richtig beim Thema. Dazu würde ihm nichts einfallen, das stand für ihn fest. Geheimcodes, unbekannte Institute … Damit würden sie allein weiterkommen, auch ohne ihn.
Was sie dann auch taten.
3
Man nahm an, dass es sich bei dem unbekannten Institut um eine biologische Forschungsstätte handelte und dass ihre Arbeit militärischen Zwecken diente. Das war der erste interessante Punkt für den CIA, und in seiner Zentrale in Langley, fünfzehn Kilometer von Washington entfernt, beschäftigte sich ein Spezialistenteam damit, die Station zu lokalisieren.
Ausgangspunkt dabei war die Annahme, dass sie über eine eigene Wasser- und Energieversorgung verfügen müsse und ebenso über Vorratslager für Chemikalien, Ställe, Kläranlagen und Sicherheitseinrichtungen verschiedener Art. Für all dies waren Menschen und für diese wiederum Unterkünfte und irgendeine Verbindung zur Außenwelt notwendig, vermutlich ein Landestreifen. Primäre Voraussetzung war ein abgelegener, isolierter Standort.
»Die dürre Einöde im nördlichen Lande, da es heulet«, offensichtlich Sibirien, war selbst in modernen Zeiten so isoliert wie keine andere Region der Erde. Allein das bewaldete Gebiet war eineindrittel Mal so groß wie das Territorium der Vereinigten Staaten. Das Land lag im Winter unter einer hohen Schnee- und Eisdecke und war im Sommer mit Sümpfen bedeckt. Aus diesen Gründen war das Straßennetz so rudimentär, dass sich der Verkehr hauptsächlich auf den Luftweg und auf Flüsse beschränkte, und ein Zugang zu Sperrgebieten war nur mit behördlicher Genehmigung möglich.
Daraus ergab sich das erste Problem. Wenn die Station so schwer zu erreichen war, wieso nahm dann der unbekannte Absender des Briefes an, dass jemand aus der Außenwelt dorthin gelangen könnte? Und ebenso wichtig: Wie hatte er selbst etwas in die Außenwelt schaffen können?
Experten, die sich auf die Verkehrssysteme der Welt spezialisiert hatten, boten eine mögliche Erklärung dafür an. Das Netz der sibirischen Binnenwasserstraßen war sehr ausgedehnt. Allein an zwei Flüssen im Nordwesten, dem Ob und dem Jenissej, gab es Dutzende von Häfen, und mehrere weitere befanden sich im Bau. Der Grund dafür waren die gewaltigen, ausgedehnten Erdgasvorkommen – die größten auf der Erde – zwischen diesen beiden Flüssen. Da die Ölförderung in Russland zurückging, sollte das Erdgas an die Stelle des Erdöls treten, sowohl für den eigenen Energiebedarf als auch für den Export. Für beides wurde das Gas dringend benötigt, und Satellitenaufnahmen zeigten, dass an der Erschließung der Vorkommen rund um die Uhr gearbeitet wurde.
Zur Finanzierung des Projekts (das eine dreitausend Meilen lange unterirdische Rohrleitung nach Westeuropa einschloss) waren gewaltige Auslandskredite ausgehandelt worden. Die Kredite sollten mit Gaslieferungen getilgt werden und wurden in Form maschineller Ausrüstung zur Verfügung gestellt, deren Umfang immens war. Zu den Bohranlagen und dem Bohrgerät kamen die Rohre, die unterirdisch verlegt werden sollten. Längs der Rohrleitung waren gigantische Kompressoren und Pumpstationen vorgesehen. Tausende von Maschinen zur Erdbewegung und Zehntausende von Traktoren waren im Einsatz.
Bei der Jagd nach Aufträgen waren westliche Reedereien nicht säumig gewesen. Die Ausrüstungsgüter für die Erschließung des ersten Gasfördergebiets waren weitgehend auf Schiffen der ehemaligen Sowjetunion transportiert worden, doch für das neue Projekt hatte das leitende Konsortium bestimmt, dass neue Ausrüstungen nach Möglichkeit mit Fahrzeugen der Länder befördert werden sollten, die sie lieferten.
Bei diesen Staaten handelte es sich um Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und die Niederlande. Schiffe aus diesen Ländern transportierten jetzt Frachtgüter über die Nordpolarmeerroute. Russische Eisbrecher hielten von Anfang Juni bis in den frühen Oktober den Seeweg frei, wobei letztgenanntes Datum je nach der Packeis-Situation schwankte – und dieser Umstand veranlasste die Experten zu einer Prophezeiung.
In diesem Jahr bildete sich schon jetzt, in der ersten Juliwoche, Packeis. Die Prophezeiung lautete, dass man von dem unbekannten Absender des Briefes nach Ende August nichts mehr erwarten könne. Westliche Reeder, die zögerten, ihre Schiffe selbst in einem von den Russen »garantierten« September aufs Spiel zu setzen, traten nun diesen Anteil am Geschäft an Russlands eigene Handelsflotte ab. Man nahm nicht an, dass ein Angehöriger dieser Flotte die Nachricht aufgegeben hatte. Das hatte sicher ein ausländischer Seemann besorgt, der sich in ausländischen Häfen besser auskannte und weniger überwacht wurde, sodass er mit dubiosen Zigaretten hantieren konnte. Und nach August konnte er das nicht mehr.
Doch das gab Anlass zu weiteren Fragen.
Die für die ausländischen Schiffe geöffneten Häfen waren Dudinka und Igarka am Jenissej sowie Nowy Port und Salechard am Ob. Weil die russischen Behörden in diesen Häfen einen raschen Umschlag garantierten, hatten sie für Angehörige ausländischer Besatzungen an Land keine Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Ohnedies war es keinem von ihnen erlaubt, an Land zu gehen.
Wenn aber ausländische Seeleute nicht an Land durften, wie hatte dann einer von ihnen die Nachricht bekommen?
Auch dafür hatte man vorläufige Antworten parat. Ein Mittelsmann hatte dem Matrosen die Nachricht übergeben. Der Mittelsmann musste Zeit gehabt haben, eine Verbindung zu dem Matrosen anzuknüpfen. Der Matrose musste die Route regelmäßig befahren. Doch wie regelmäßig er das auch tat, die einzigen Einheimischen, denen er begegnen konnte, waren jene, die sein Schiff betreten durften, normalerweise Hafenbeamte oder -arbeiter. Aber das Gebiet war eine Sperrzone, die weder Hafenbeamte noch -arbeiter nach Belieben betreten oder verlassen durften. Der Mittelsmann musste von außen gekommen sein. Er musste Zugang zu dem Schiff gehabt haben – und ebenso zu der Forschungsstation. Wie konnte dieser Mittelsmann ausgesehen haben?
Es könnte ein Experte gewesen sein. Ausländische Schiffe verließen russische Häfen nicht ohne Ladung. Manche nahmen spezielle Rückladungen von einer Art an Bord, die einem Mann, der mit der Produktion solcher Spezialerzeugnisse zu tun hatte, den Zugang zu dem Schiff ermöglichen konnten. Eine genauere Überprüfung der betreffenden Häfen ergab, dass Dudinka am Jenissej am wahrscheinlichsten Rückladungen für ausländische Schiffe bot. Dudinka war der Hafen für Norilsk, ein großes Bergbau- und Industriezentrum, wo vor allem Nickel gefördert und Präzisionsteile aus Nickellegierung hergestellt wurden.
Man gab einen Bericht über die Beförderung von Teilen aus Nickellegierung in Auftrag und stellte drei vorläufige Arbeitshypothesen auf:
1.
Die Nachricht war von einem Seemann aufgegeben worden, der die Polarmeerroute regelmäßig befuhr.
2.
Sie war ihm von einem Mittelsmann übergeben worden, der Zugang zu diesem ausländischen Schiff hatte.
3.
Der Mittelsmann hatte einen Spezialberuf und im Rahmen seiner beruflichen Funktionen Zugang zu der Forschungsstation und zum Hafen.
Diesen Hypothesen (jede davon zutreffend, wie sich erwies) ging man mit großer Energie nach.
Lass mich deine Stimme in dieser Sache hören den ersten Tag um Mitternacht, Stimme Amerikas, hatte der unbekannte Absender geschrieben. Die »Stimme Amerikas« wurde vom CIA gesteuert, sodass es in diesem Punkt keine Probleme gab. Der erste Tag war biblisch gesprochen der Sonntag, die »Stimme Amerikas« strahlte an diesem Tag regelmäßig eine auf Band genommene Sendung aus. Diesmal wurde sie ersetzt, und ein Mann mit kraftvoller Stimme hielt eine Predigt über das Thema Kommunikation und Identität. Er zitierte aus dem ersten Buch Mose, 3,10 »Ich hörte deine Stimme« und zwei weitere Stellen aus diesem Buch sowie Ester 7,2 – »Wo bist du?«, »Wer bist du?« und »Worum bittest du?«, und sagte, diese Fragen verlangten nach klaren Antworten von jedermann, besonders aber von jenen in der Wüste, der dürren Einöde, da es heulet.
An der Nachricht selbst fanden sich die Fingerabdrücke des Mannes, der den Text geschrieben und offenbar die Zigaretten gedreht hatte. Auch auf der Adresse entdeckte man sie, nicht aber auf dem Umschlag oder dem Stückchen Klebeband. Auf diesen erschienen andere Abdrücke, einige sehr verschmiert und nur bruchstückhaft, aber ebenfalls ein und derselben Person zuzuschreiben: offensichtlich dem Matrosen.
Der Seemann, so der einhellige Schluss, musste die Route regelmäßig befahren. Er hatte als »Briefträger« fungiert. (Dass er diese Fahrt regelmäßig machte, darauf musste man sich verlassen.) Aus der Stelle in der Nachricht, wo es hieß: Warum antwortest du mir nicht?, ging indirekt hervor, dass man sich seiner schon einmal bedient hatte. Wann das gewesen war oder wo er die frühere Nachricht aufgegeben hatte, ließ sich nicht sagen. Aber es war bekannt, wo er diese in den Briefkasten gesteckt hatte.
Die Liste weltweiter Schiffsbewegungen zeigte, dass drei Fahrzeuge, die aus dem Nördlichen Polarmeer kamen, um das Datum des Poststempels Göteborg angelaufen hatten. Eines davon, ein japanisches Trampschiff, das das Polarmeer nur als billige Transportroute für eine Zufallsfracht nach Westeuropa benutzt hatte, konnte man außer Acht lassen. Dagegen waren die beiden anderen, ein holländisches und ein deutsches Schiff, interessanter. Beide waren regelmäßig zu sibirischen Häfen unterwegs, und der Holländer hatte auf der Rückfahrt eine Ladung Nickelteile an Bord gehabt.
Göteborg war kein Hafen, den dieses Schiff regelmäßig anlief, aber ein Teil seiner Ladung war dorthin bestimmt gewesen, und das Schiff hatte vierundzwanzig Stunden im dortigen Hafen gelegen: Reichlich Zeit für jemanden, Zigaretten aufzuschlitzen, ein Kuvert zu kaufen und den Brief aufzugeben. Das Schiff hatte dann die Fahrt nach Rotterdam fortgesetzt. Zielhafen des deutschen Schiffes war Hamburg gewesen.
CIA-Vertreter in den Niederlanden und in Deutschland erhielten Weisung, unbedingt Fingerabdrücke der Besatzungsmitglieder dieser beiden Schiffe zu beschaffen. Doch man wusste bereits, dass der Holländer aus Dudinka gekommen war.
An der Herkunft seiner Ladung bestand ebenfalls kein Zweifel.
Zwischen Dudinka und den Nickelgruben von Norilsk gab es eine fünfundvierzig Meilen lange Straße, und die kartografische Abteilung hatte jeden Fußbreit davon erfasst. Ähnlich war der größte Teil Sibiriens kartografiert worden: Die Karten kamen aus dem Defense Mapping Agency Aerospace Center in St. Louis und wurden alle paar Wochen auf den neuesten Stand gebracht. Sie zeigten nicht nur geografische Eigentümlichkeiten und Straßen, sondern auch den Fortgang der Bauarbeiten, sowohl ober- als auch unterirdisch.
Das Gebiet um Norilsk war mit einem Netz kleinerer Straßen überzogen, die das Industriezentrum mit umliegenden Distrikten verbanden. Die Straßen wurden sommers wie winters gut in Schuss gehalten und stark frequentiert.
Obwohl der Komplex weiträumig war – der größte am Nördlichen Polarkreis überhaupt –, war er doch nur ein kleiner Fleck in den gewaltigen Weiten der ihn umgebenden Taiga. Ein Großteil dieses Gebiets mit seinen zahlreichen »Zielobjekten« stand seit Jahren unter regelmäßiger Überwachung aus der Luft. Der Zweck der meisten dieser Objekte war geklärt, doch bei einigen bestanden noch gewisse Zweifel, und sie wurden nun einer genaueren Prüfung unterzogen.
Die Haupterfordernisse für die geheime Station waren nach wie vor die gleichen wie vorgegeben, doch bei der Analyse von Satellitenaufnahmen kamen noch ein paar weitere Spezifika hinzu. Sie musste Gebäude haben, deren präzise Funktion noch ungewiss war. Sie musste über Unterbringungsmöglichkeiten verfügen, vermutlich mit abgegrenzten Bereichen für die Wissenschaftler und das Wartungs- sowie das Sicherheitspersonal. Und sie musste über eine Straße verfügen, die der Experte benutzen konnte.
Kurz danach wurde inmitten eines aufgeregten Treibens St. Louis dringend um weitere Informationen ersucht: analytische Daten zur Bestimmung des Mineraliengehalts zweier Seen in dem fraglichen Gebiet und geografisch-lexikalisches Material zur Erhellung des Sinngehalts der Wörter »dunkle Wasser« als lokale Bezeichnung für diese Gewässer.
4
Während diese Recherchen vorankamen, machte Miss Sonntag mit ihrer eigenen Arbeit rasche Fortschritte.
Nach dem Abklingen ihrer Erkältung war ihr etwas eingefallen. Ihr war, als wäre schon einmal ein Kuvert ohne dazugehörigen Brief aufgetaucht – wann, das wusste sie nicht mehr genau, und mit Schweden brachte sie es nicht in Verbindung. Mit Schweden gab es keine nennenswerte Korrespondenz. Ihrer Erinnerung nach war der Umschlag aus den Niederlanden gekommen. In derselben Post waren, wenn sie sich richtig erinnerte, auch einige Reklamesendungen gewesen – Werbebroschüren für wissenschaftliche Literatur aus Amsterdam, Den Haag oder Rotterdam, zumeist mit kleinen Adressenaufklebern. Ziemlich oft kamen solche Sendungen im Doppel, und bei einer davon war ihr, als hätte der Umschlag nichts enthalten – sie hatte ihn in den Papierkorb geworfen und nicht weiter darüber nachgedacht. Doch als sie von ihrer Erkältung kuriert war, dachte sie darüber nach.
Sie erwähnte die Sache gegenüber Lazenby, und der schien überrascht.
»Aus den Niederlanden, sagen Sie?«
»Ja, ich glaube, aus den Niederlanden.«
»So … Glauben Sie, aus Rotterdam?«
»Ich bin mir nicht sicher, ob aus Rotterdam. Ja, vielleicht.«
»Ich sollte ja eigentlich … Mhm, ich frage mich …«, sagte er und überlegte einen Augenblick. »Wann sind Sie weg?«
»Weg? Um Urlaub zu machen? Nächste Woche«, sagte sie überrascht.
Nächste Woche war bereits Mitte Juli, und um diese Zeit trat sie alljährlich ihren Urlaub an; diesmal wollte sie mit Sonya nach Florenz. Der Flug war gebucht, die Pension war gebucht. »Wenn es Ihnen recht ist«, sagte sie besorgt.
»Oh ja, doch. Trotzdem«, sagte Lazenby und zog eine Liste aus der Tasche, »trotzdem wäre es schön, wenn Sie noch die Zeit hätten, mir ein paar Briefe rauszusuchen. Es dauert sicher nicht ewig.«
Es dauerte zwar nicht ewig, aber doch vier volle Tage, und der Schauplatz der Suche war das Souterrain. Als sie mit der Arbeit begann, hatte sie das ganze Gebäude für sich, sogar Lazenby war inzwischen verschwunden. Er hatte ihr seine Adresse am Spey hinterlassen.
Wofür die Briefe gebraucht wurden, hatte er nicht gesagt, aber offensichtlich benötigte er sie für seine Arbeit über Zellstrukturen bei Niedrigtemperaturen. Den Aspekt der Niedrigtemperaturen, das einzige Thema des Briefwechsels mit den Russen, hatte er acht Jahre zuvor fallen lassen. Die gesamte Korrespondenz bis auf die aus den vergangenen acht Jahren befand sich im Souterrain.