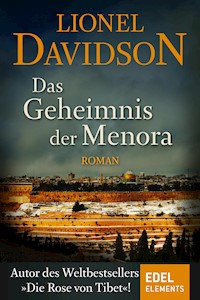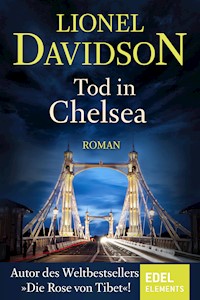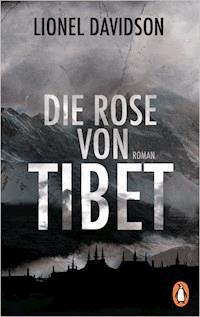
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine gefährliche Suche am anderen Ende der Welt
Januar 1949: Der britische Filmemacher Hugh Whittington soll auf einer Expedition in der Nähe des Mount Everest ums Leben gekommen sein. Doch sein Stiefbruder Charles gelangt an Informationen, die ihn an Hughs Tod zweifeln lassen. Er ist entschlossen, nach Tibet zu reisen und ihn zu finden, doch die Grenzen des Landes sind abgeriegelt. Auf gefährlichen Pfaden gelangt Charles schließlich ins verbotene Land, wo sein Bruder sich in einem Kloster aufhalten soll. Doch statt auf Hugh trifft er dort auf eine faszinierende Frau mit einem tödlichen Geheimnis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LIONEL DAVIDSON, wurde 1922 als Sohn jüdischer Einwanderer im englischen Hull geboren und war nach dem Krieg als Journalist tätig. 1960 veröffentlichte er seinen ersten Spionagethriller, dem sich viele preisgekrönte Erfolge anschlossen. Er gehört seit Jahrzehnten zu den besten und renommiertesten Spannungsautoren Großbritanniens. Davidson starb 2009 in London.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Lionel Davidson
Die Rose von Tibet
Roman
Aus dem Englischen von Ursula Gnade
Prolog
Der Entschluss, dieses Buch Die Rose von Tibet zu nennen, wurde erst zu einem späten Zeitpunkt gefasst, und zwar auf Geheiß des Geschäftsführers unseres Verlages, Mr. Theodore Links. Ich bin seit acht Jahren bei diesem und bei anderen Verlagen als Lektor tätig. Mein Name ist Lionel Davidson.
Es scheint notwendig zu sein, all das vorauszuschicken, da das, was folgt, wie einer der Gutachter des Manuskripts geschrieben hat, »… etwas abwegig …« ist. Es ist jedoch weitgehend wahr: Aber gerade, weil es nur weitgehend wahr ist, sind ein paar einleitende Worte erforderlich.
Charles Duguid Houston verließ am 25. Januar 1950 England, um nach Indien zu reisen, und er kehrte am 16. Juni 1951 zurück. Der interessierte Leser kann einen Bericht über das letztere Ereignis in den Ausgaben von Sunday Graphic und Empire News vom 17. Juni finden, den beiden einzigen Presseorganen, die von seiner Rückkehr Kenntnis genommen haben. Er kehrte auf einer Tragbahre zurück und hätte eine sensationelle Geschichte zu erzählen gehabt, wenn ihn jemand dazu gebracht hätte, sie zu erzählen. Der Umstand, dass niemand es tat, ist vielleicht weniger auf seine eigene Diskretion zurückzuführen als auf die anderen interessanten Dinge, die in diesem Monat in der Welt geschahen.
Im Juni 1951 waren die damals recht dünnen Zeitungen bemüht, lückenlos über den Korea-Krieg zu berichten, über das Sinken des U-Boots Affray, die Suche nach Burgess und Maclean und die Freveltaten des Dr. Mossadeq, dessen Regierung damit beschäftigt war, die Ölraffinerien von Abadan zu verstaatlichen. In England erholte sich König George VI. von einer Operation, auf Capri verbrachte König Farouk seine Flitterwochen mit Narriman, und in Westminster spekulierte der Ernährungsminister über eine Preiserhöhung der Fleischration auf zwei Shilling vier Pence. Mehrere Morde wurden begangen. Die britischen Festspiele strahlten tapfer durch den Regen. Der Marquis von Blandfort ging eine Verlobung ein.
Angesichts einer solchen Qual der Wahl hatten die Zeitungen nur wenig Raum für Houston übrig, und soweit es sich nachprüfen ließ, wurde, nachdem die beiden Sonntagszeitungen die Meldung aufgegriffen hatten, nirgends eine Fortsetzung gebracht. Die Meldung war nicht uninteressant. Sie informierte darüber, dass man den neunundzwanzigjährigen Charles Houston, früher Kunstlehrer, wohnhaft Baron’s Court, London W, mit Verletzungen, die er sich bei den jüngsten Kämpfen in Tibet zugezogen hatte, auf einer Tragbahre aus dem Flugzeug aus Kalkutta gebracht hatte.
Nicht einmal die West London Gazette dachte daran, einen Vertreter in die London Clinic, in die Houston vom Flughafen aus direkt eingeliefert worden war, zu schicken, um sich nach dem Befinden dieses früheren Mitbürgers zu erkundigen.
Während seine rastlosen Zeitgenossen die Bühne für sich beanspruchten, war es Houston möglich, den Monat recht ruhig zu verbringen. Der rechte Arm wurde ihm abgenommen. In den Morphinen suchte er Erlösung von schmerzlichen Erinnerungen. Nur gelegentlich machte er sich Sorgen um den Verbleib seiner halben Million Pfund.
Der Umstand, dass es um eine halbe Million Pfund ging, sollte jedoch später noch recht vielen Menschen Kopfzerbrechen bereiten: Das ist einer der Gründe, warum dieses Buch nur weitgehend der Wahrheit entsprechen darf.
»Warum so heikel?«, steht in Mr. Theodore Links’ Handschrift auf der Hausmitteilung, die vor mir liegt. »Ich sagte bereits, dass es mir gefällt, und es gefällt mir immer noch. Aber R. B. wird erst zufrieden sein, wenn wir die unterstrichenen Absätze irgendwie ›bearbeiten‹ können. Außerdem habe ich entschieden das Gefühl, dass wir aus denselben Gründen eine Art literarischen Titel suchen sollten. Was ist gegen ›d‹ einzuwenden? Er ist weitaus zugkräftiger als die sachlichen. Und wer setzt sich hier über O.s Wünsche hinweg? Ich glaube, mich nur an einen missachteten Wunsch zu erinnern! Aber wenn es Ihnen so ernst ist, schreiben Sie doch ein Vorwort, in dem Sie das Buch und die Hintergründe erklären …«
Wenn wir uns die Abkürzungen der Reihe nach vornehmen, ist R. B. Rosenthal Brown, unsere Anwaltskanzlei, »d« ist der derzeitige Titel – Die Rose von Tibet –, und O. … O. ist Mr. Oliphant. Ohne Mr. Oliphant gäbe es das Buch nicht.
Ich weiß nicht, wann Mr. Oliphant ursprünglich damit angefangen hat, sein Latein-Lehrbuch für Anfänger zu schreiben, aber im ersten seiner beiden Briefe, die ich in meinem Ordner habe, schreibt er: »Es handelt sich um das Ergebnis vieljähriger, sorgfältiger Arbeit, und es sind, wie Sie sehen werden, die meisten der nützlichen Vorschläge aufgenommen worden, die Sie die Güte besaßen, mir vor einiger Zeit zu unterbreiten.«
Dieser Brief erreichte mich, gemeinsam mit dem Lehrbuch, im Mai 1959.
Ich sagte zu meiner Sekretärin: »Miss Marks, wer ist F. Neil Oliphant, und wann habe ich ihm irgendwelche Vorschläge für einen lateinischen Grundkurs gemacht?«
Miss Marks blickte von ihrer Schreibmaschine auf und fing an, mit ihren Fingerspitzen leicht auf ihrer Stirn herumzutrommeln – eine Angewohnheit, die durchkommt, wenn sie sich mit irgendwelchen Sorgen herumquält, aber nicht will, dass ich es bemerke.
Sie sagte: »Ach so. Ja. Das waren nicht Sie. Das war Mr….« – einer meiner Vorgänger.
»Haben wir jemals lateinische Lehrbücher verlegt?«
»Nein. Er hat geglaubt, wir würden es vielleicht tun wollen – ich meine, Mr. Oliphant. Er hat eine neue Methode des Lateinunterrichts entwickelt.«
»Wer ist Mr. Oliphant?«
»Ein Lateinlehrer.«
Miss Marks’ Gesicht war bei dieser einwandfreien Aussage eine Spur von Rosa angelaufen.
Ich sagte: »Wo unterrichtet er?«
»Er war früher an der Mädchenoberschule in der Edith Road in Fulham.«
»An der was?«
»An der Schule in der Edith Road … Das ist eine ganz ausgezeichnete Schule«, sagte Miss Marks. »Es ist eine der besten Schulen für Mädchen im ganzen Land. Die humanistischen Kenntnisse, die dort vermittelt werden, sind ausgezeichnet.«
»Ich war selbst auch in dieser Schule«, sagte sie schließlich und bestätigte damit meine Vermutungen.
»Ach was, tatsächlich?«
»Ja …, sehen Sie, es tut mir leid«, sagte Miss Marks, und sie errötete mehr und mehr. »Ich habe immer wieder zwischendurch Kontakt zu ihm gehabt. Er ist ein netter alter Mann. Zufällig hat er einmal erwähnt, dass er dieses Buch schreibt, und er wusste nicht das Geringste über das Verlagswesen und sonst etwas … Ich meine, ich habe ihm natürlich gesagt, dass ich nicht in einer Position bin, in der ich ihm dafür garantieren kann …«
»Schon gut, Miss Marks. Haben wir eine Kopie des vollständigen Briefwechsels?«
»Die müsste Mr. Links haben. Er hat sie übernommen, als Mr…. gegangen ist.«
»Ach. Und warum?«
»Weil das Ganze eigentlich seine Schuld war«, sagte Miss Marks.
Sie erklärte mir, warum.
Es schien so, als sei Mr. Oliphants Lehrbuch 1955 erstmals im Hause eingegangen. Mr…. hatte das Buch prompt abgelehnt, und damit wäre die Sache erledigt gewesen, wäre nicht T. L. zufällig ins Zimmer gekommen, als das Buch noch bei den Ausgängen lag. T. L. hatte sich zu diesem Zeitpunkt einer seiner vielzähligen und keineswegs ungewöhnlichen Schwärmereien hingegeben; diesmal hatten sie dem geistig erzieherischen Nutzen einer der alten Sprachen gegolten. Er fand, Mr. Oliphants Buch habe etwas. Das Buch war an einen Spezialisten weitergegeben worden, der anderer Meinung war. Dennoch hatte T. L. Mr. Oliphant eine ganze Anzahl von Verbesserungsvorschlägen gemacht. Das überarbeitete Buch war 1957 wieder aufgetaucht. Inzwischen hatte sich T. L.s Enthusiasmus gelegt, doch er hatte das ungute Gefühl, in gewissem Sinne die Verantwortung dafür zu tragen, dass Mr. Oliphant zwei weitere Jahre in diese Arbeit gesteckt hatte. Wäre das Buch in seiner überarbeiteten Form auch nur ansatzweise druckreif gewesen, so hätte er es verlegt. Aber das war es nicht. Es war mit weiteren Vorschlägen an den Autor zurückgeschickt worden.
Das waren die Vorschläge, die Mr. Oliphant in seiner letzten Fassung berücksichtigt hatte.
Glücklicherweise entdeckte ich einen erfreulichen Haken an dem Buch. Drei aufeinanderfolgende Kapitel trugen die Überschrift Was der Schulabgänger vor dem Universitätseintritt wissen muss – (I), (II) und (III). Obwohl ich wenig über dieses Thema wusste, war sogar mir klar, dass die Studienanfänger in einigen Bereichen kein Latein zu können brauchten; erst kurz zuvor hatte sich darüber eine beachtliche Diskussion in der Presse entsponnen, und Mr. Oliphants Latein lehrende Kollegen hatten ein paar starke Geschütze aufgefahren.
Ich sagte: »Ihr Mr. Oliphant ist wohl nicht allzu sehr auf dem Laufenden«, und ich erklärte ihr, warum.
»Ach, du meine Güte«, sagte Miss Marks betrübt, »der arme alte Mann.«
»Wie alt ist er?«
»Er muss jetzt auf die Achtzig zugehen.«
»So, so.«
Es schien so auszusehen, dass Mr. Oliphant zum Umschreiben jeweils zwei Jahre brauchte. Wenn man von der natürlichen Ordnung der Dinge ausging, war es unwahrscheinlich, dass ihm das noch allzu oft gelingen würde.
Ich sagte: »Sehen Sie, Miss Marks, schreiben Sie ihm doch einen Brief.«
Das sollte gar nicht nötig werden. Noch am selben Nachmittag rief Mr. Oliphant an. Vielleicht hatte ihn jemand über das Problem der Studienanfänger unterrichtet und sein Bild zurechtgerückt. Er bat darum, ihm sein Buch zurückzuschicken. Miss Marks und ich tauschten erleichterte Blicke aus, als sie den Hörer auflegte. Ich hatte das Gespräch auf dem anderen Apparat mitangehört.
Unsere Erleichterung war kurzlebig. Mr. Oliphant legte mit Höchstgeschwindigkeit los. Ganze vier Monate später, im Oktober 1959, flatterte uns das vertraute Lehrbuch wieder ins Haus.
Das fiel in eine Zeit, in der ich mehr und mehr geneigt war, den Problemen des Schriftstellerberufs mit einer gewissen wohlwollenden Sympathie zu begegnen. Mein erstes Buch, Die Nacht des Wenzel, stand gerade vor seiner Veröffentlichung, und ich hatte die verschiedensten Nörgeleien ausgestanden. Ich hasste die Leute, die Manuskripte lasen und begutachteten. Gutachter, im Allgemeinen keine kreativen Menschen, so erschien es mir, sollten versuchen, selbst etwas zu schaffen – irgendetwas – wenigstens eine Kleinigkeit. Es war der reinste Frevel, so erschien es mir, dass solche Menschen über die Arbeit kreativer Menschen zu Gericht saßen. Etwas aus dem Nichts heraus entstehen zu lassen, etwas zusammenzusetzen, etwas ganz Neues in die Welt zu setzen – das war eine bewundernswerte, eine mühselige Arbeit. Den Menschen, die das taten, so erschien es mir, standen Worte des Dankes zu, und man sollte ihnen auf den Rücken klopfen und sie für ihre Mühen nicht etwa einem Sperrfeuer gehässiger Kritik aussetzen.
In dieser Geistesverfassung wurde Mr. Oliphant mein Bruder. Ich betrachtete seine Arbeit mit wärmster Bewunderung. Warum sollten wir sein Buch eigentlich nicht verlegen? Wir brachten hundertvierundzwanzig Bücher im Jahr heraus. Warum nicht Mr. Oliphants Buch?
Dennoch schickte ich das Manuskript nicht, wie es mein Herz gebot, direkt in die Druckerei. Ich schickte es wieder an den Gutachter, der Mr. Oliphants Werk keineswegs mit der Bewunderung betrachtete, die ich ihm entgegenbrachte.
Er sagte, das Buch sei in einem pedantischen Stil und in der Art von derbem Witz geschrieben, die beide um die Jahrhundertwende aus der Mode gekommen seien. Soweit er das beurteilen könne, wende sich das Buch an eine Zielgruppe von simplen Kryptologen im Alter von circa siebzig Jahren.
»Nein, nein …«, sagte T. L. »O mein Gott! Sehen Sie, das ist meine Schuld, nicht seine. Ich dachte, er könnte es schaffen … Es ist mein Fehler.«
»Und was fangen wir jetzt damit an?«, fragte ich.
»Hören Sie, sehen Sie mal, ob er seine erste Fassung noch hat. Die hatte etwas. Ich habe es selbst gesehen. Helfen Sie ihm dabei. Geben Sie ihm ein brauchbares Konzept. Sehen Sie, ob jemand hier im Büro eine Rohfassung für ihn entwerfen kann. Ich sehe sie mir selbst an, wenn Sie wollen. Und dann sehen wir weiter. Wir werden es ihm jedenfalls so aufbereiten, dass man es veröffentlichen kann.«
Diese Aufgabe – meinem Bruder Oliphant mitzuteilen, dass seine Arbeit von vier Jahren vergeudet war – erschien mir hochgradig unerfreulich. Das brachte ich zum Ausdruck.
»Ich sehe keine Möglichkeit, all das in einem Brief unterzubringen«, sagte ich abschließend.
»Nein, nein. Ich finde, das sollten Sie gar nicht tun. So war mein Vorschlag nicht gemeint. Wenn ich mich recht erinnere, ist er ein ziemlich alter Mann. Besuchen Sie ihn. Das wäre eine nette Geste.«
Mit äußerstem Widerwillen sagte ich: »Natürlich, wenn Sie der Meinung sind, dass ich das tun sollte …«
»Ja, sicher. Es wird wesentlich leichter sein, wenn man sich persönlich gegenübersteht. Wissen Sie«, sagte er, während er mir das Manuskript wieder in die Hand drückte, »das ist gar keine schlechte Lektion für einen Lektor. Es ist verhängnisvoll einfach, den falschen Leuten Mut zu machen. Freundlichkeit ist keine Hilfe – weder für den Autor noch für uns. Sie kann sogar äußerst grausam sein.«
»Sie finden nicht«, sagte ich zögernd, »dass wir ihn noch einen Anlauf nehmen lassen sollten, ganz auf eigene Faust. Ich habe gehört, dass er inzwischen auf die Achtzig zugeht …«
T. L. holte tief Luft und schüttelte den Kopf. »Das können wir nicht machen … Verstehen Sie, ich habe mich anfangs nicht getäuscht. Die Sache hatte etwas, ein winziger Kern hat daringesteckt. Jemand könnte das Buch verlegen. Gönnen wir ihm diese Freude, ehe er stirbt.«
»Einverstanden«, sagte ich.
Mr. Oliphant wohnte in Fitzmaurice Mansions, Fitzmaurice Crescent, Baron’s Court. Ich rief ihn am selben Tag noch an und fuhr am folgenden Nachmittag zu ihm hinaus. Fitzmaurice Mansions erwiesen sich als ein gewaltiger Gebäudekomplex mit reichen Verzierungen aus rötlich orangenem Stein im Stil des späten neunzehnten Jahrhunderts. In einem kleinen dunklen Aufzug mit einem höchst komplizierten System von Falttüren fuhr ich sehr langsam in den ersten Stock hinauf. Es gab kein Fenster auf dem Treppenabsatz, und das Licht funktionierte nicht. Auf der Suche nach Nummer zweiundsechzig tastete ich mich voran.
Zwei Viertelliterflaschen Milch standen vor der Tür, und die Tageszeitung klemmte noch im Briefkasten. Ich läutete, und ein oder zwei Minuten später sah ich mich gezwungen, noch einmal auf die Klingel zu drücken.
Kurz darauf war in der Wohnung ein Schlurfen zu hören. Ich machte mich auf einiges gefasst, als die Tür geöffnet wurde. Ein großer, dünner, gebeugter Mann in einem Morgenmantel stand vor mir.
»Sind Sie Mr. Davidson?«
»Ja, richtig.«
»Kommen Sie herein. Ich hoffe, Sie haben nicht allzu lange gewartet. Ich bin eingenickt.«
Ich hielt ihm die Hand hin, doch er schien sie nicht zu sehen. Er griff an mir vorbei nach der Milch und der Zeitung. Aus der Wohnung drang ein ganz bestimmter Geruch, der Geruch alter Menschen, die in engen, stickigen Wohnungen hausen.
Er schloss die Tür hinter mir. »Mir geht es in letzter Zeit nicht allzu gut. Ich habe einen kleinen Mittagsschlaf gehalten.«
»Es tut mir leid, dass ich Sie störe.«
»Nein, kein bisschen. Aber auch nicht das geringste bisschen. Hier entlang. Ich habe mich schon auf Ihren Besuch gefreut. Ich weiß selbst nicht, wie es mir passiert ist, einfach so einzudösen.«
Mr. Oliphant machte einen kranken und etwas ungepflegten Eindruck. Sein Gesicht war so übermäßig lang und schmal wie das eines Windhundes, und es hätte eine Rasur dringend nötig gehabt. Er stellte die Milch ab und legte die Zeitung hin, zog seinen grauen Morgenmantel dichter um sich und glättete sein spärliches Haar.
»Es tut mir leid, dass Sie mich ausgerechnet so vorfinden müssen. Ich wollte noch ein bisschen zusammenräumen«, sagte er, während er sich in der schrecklichen Unordnung umsah. Wir schienen uns in seinem Schlafzimmer zu befinden. »Ich dachte mir, ich ruhe mich nach dem Mittagessen mal schnell ein paar Minuten aus. Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen.«
»Das tut mir sehr leid für Sie«, sagte ich, leicht nasal, da ich versuchte, in dem penetranten Geruch des Zimmers durch den Mund zu atmen. »Was fehlt Ihnen?«
»Etwas mit den Bronchien. Ich kriege es jedes Jahr um diese Zeit. Das Atmen fällt schwer, Sie wissen schon«, sagte er, wobei er sich auf die Kehle klopfte.
Sein Atem war leicht pfeifend. Aus seiner Stimme war ein schwacher Anklang des Irischen herauszuhören. Ich sagte: »Wenn Sie es gern auf einen anderen Tag verschieben wollen, Mr. Oliphant – es gibt eine ganze Menge zu besprechen.«
»Nein, nein. Davon will ich nichts hören, junger Mann. Es tut mir nur leid, dass es hier so aussieht. Jetzt hole ich Ihnen erst mal etwas. Was darf es sein? Wir haben uns noch gar nicht richtig begrüßt«, sagte er, und verlegen hielt er mir seine verknöcherte Hand hin.
Ich drückte sie. Ich lehnte eine Erfrischung ab. Er zog zwei Stühle vor ein elektrisches Kaminfeuer, und wir fingen an zu reden.
Es gab jedoch nicht allzu viel, worüber wir hätten reden können. Trotz des Anscheins der Senilität, den er erweckte, hatte Mr. Oliphant seinen Geist nämlich noch beisammen und war gut in Form. Im Handumdrehen hatte er die Situation erfasst, und mit einer altmodischen Höflichkeit begann er augenblicklich, mir die Sache leichter zu machen.
»Ihr Mr. Links ist ein begeisterungsfähiger Mensch«, sagte er. »Das ist etwas, was mir an meinen Mitmenschen gefällt. Er hat mir einen großartigen Brief geschrieben, als ich das Buch in seiner ersten Fassung fertiggestellt hatte. Ich frage Sie aus reinem Interesse, Mr. Davidson, warum war er eigentlich so interessiert daran?«
»Na ja, weil ihm die Idee gefallen hat …«
»Ja«, sagte Mr. Oliphant, »ich frage, weil ich mich mein Leben lang auf die eine oder andere Weise mit lateinischen Werken befasst habe, aber mich nicht wirklich erinnern kann, dabei jemals auf Ihren Verlag gestoßen zu sein. Es lag wirklich nur an Doris Marks – wie geht es diesem netten Mädchen übrigens?«
»Gut. Gut. Sie lässt Sie freundlich grüßen. Das bringt mich auf einen anderen Punkt, Mr. Oliphant. Wir würden Ihnen gern unseren Beistand in jeglicher erdenklichen Form anbieten – sei es durch Schreibarbeiten, durch praktische Hilfe oder was auch immer Sie brauchen können.«
»Das ist ganz außergewöhnlich freundlich von Ihnen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Das bin ich wirklich«, sagte er, und dabei lächelte er mich an. »Ich werde es mir sehr ernsthaft überlegen. Nichtsdestoweniger«, sagte er dann und lachte, »habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht zu alt bin, um noch etwas dazuzulernen …«
Er unterbrach sich und fing an zu husten. Es war das ungewöhnlichste Husten, das ich in meinem ganzen Leben gehört hatte, und im ersten Moment konnte ich gar nicht glauben, dass er diese Laute hervorbrachte.
Ich stand erschrocken auf und klopfte ihm auf den Rücken. Er fing kurz darauf an, mit seinen Händen zum Bett hin zu gestikulieren, und als ich mich umsah, bemerkte ich Arzneimittelflaschen, die auf seinem Nachttisch standen, und ich brachte sie ihm alle und dazu einen Löffel. Mit zitternder Hand deutete er auf eine der Flaschen, und ich schraubte den Verschluss auf, goss einen Esslöffel voll und steckte ihm mühsam die Arznei in den Mund. Es gelang ihm, die Kontrolle über sich selbst wiederzuerlangen.
»Ich hätte nicht lachen dürfen«, sagte er matt.
»Kann ich irgendetwas für Sie tun?«
»Nein, nichts. Später kommt jemand und bringt mir ein paar Dinge, die ich brauche. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Setzen Sie sich. Es ist gleich vorbei.«
Mit äußerster Behutsamkeit setzte ich mich wieder hin.
»Ich werde Ihnen jetzt ein Geheimnis verraten«, sagte er mit einem Lächeln. »Ich habe die Arbeit an diesem Buch aus reiner Eitelkeit heraus begonnen.«
»Eitelkeit, Mr. Oliphant?«
»Ja, Eitelkeit. Ich habe Doris – Miss Marks – bei einem Schülertreffen wiedergetroffen, und aus irgendwelchen Gründen habe ich ihr erzählt, ich würde an diesem Buch schreiben. Ich vermute, ich wollte sie beeindrucken. Wenn man allein lebt, neigt die Zunge dazu, sich in Gesellschaft allzu sehr zu lösen … Ich nehme an, Sie würden wesentlich eher Werke in einer lebenden Sprache veröffentlichen«, sagte er.
»Genau darin besteht unsere Tätigkeit, Mr. Oliphant.«
»Ich nehme an, Sie würden eher eine Geschichte wie die von Houston veröffentlichen«, sagte er im selben Tonfall.
Ich wusste nicht, wovon er sprach. Er stand auf und fing an, in seinem Bettzeug herumzuwühlen. Zwei speckige rote Schulhefte waren unter den Daunen begraben, zwei weitere lagen unter dem Kopfkissen.
»Ich habe die Geschichte gerade jetzt noch einmal gelesen«, sagte er. »Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, sie selbst zu bearbeiten, aber ich war mit meinem lateinischen Lehrbuch beschäftigt. Jetzt bezweifle ich, dass ich es je tun werde. Möchten Sie es vielleicht lesen?«
»Was ist das?«
»Es ist Houstons Bericht darüber, was ihm in Tibet zugestoßen ist.«
Er reichte mir die Schulhefte, und daher nahm ich sie entgegen, während Mr. Theodore Links’ Worte unheilvoll in meinen Ohren widerhallten. »Freundlichkeit ist keine Hilfe – weder für den Autor noch für uns. Sie kann sogar äußerst grausam sein.«
Ich sagte: »Wissen Sie, ich bin nicht sicher, ob das überhaupt das Richtige für uns ist, Mr. Oliphant. Wir bringen kaum Reiseberichte heraus.«
»Ich würde es nicht als einen Reisebericht bezeichnen«, sagte er. »Ich weiß nicht, wie ich es nennen würde. Mit Sicherheit ist es eine äußerst merkwürdige Geschichte.«
Während ich die Hefte durchblätterte, durchforstete ich mein Gehirn und versuchte, darauf zu kommen, wer der geheimnisvolle Houston war. Einzelne Formulierungen sprangen mir ins Auge.
»… eine Absteige wie eine gewaltige Katakombe, eine Art riesige Felsenwohnung mit kleinen Zimmern im Stein, die im Licht von Butterlampen aufflackerten …«
»… legte ganz schlicht all seine Kleider und seine Schmuckstücke ab und verschenkte sie …«
»… achtete den ganzen Tag über darauf, niemandem über den Weg zu laufen, und zog nach Kanchenjunga weiter …«
»… in der Gepäckaufbewahrung von Darjeeling, wo, soweit ich weiß …«
»… so übel zusammengeschlagen, dass ich wusste, ich war verkrüppelt, aber ich musste …«
»Mr. Oliphant«, sagte ich, »wenn Sie meinem Gedächtnis kurz auf die Sprünge helfen könnten – wer war eigentlich dieser Houston?«
»Ein sehr teurer Freund. Wir haben früher an derselben Schule unterrichtet.«
»Er ist mit einem – lese ich recht – Fahrrad nach Tibet gefahren?«
»Ja. Nun ja. Vorwiegend«, sagte Mr. Oliphant.
»Ich frage mich, warum nichts darüber veröffentlicht worden ist.«
Mr. Oliphant gab verschiedene Erklärungen dafür. Er beobachtete die Wirkung, die sie bei mir auslösten, und dabei lächelte er etwas verschlagen.
»Ich dachte mir, dass Ihnen das gefällt«, sagte er.
»Es klingt so, als sei es eine ganz bemerkenswerte Geschichte.«
»Spannender als die des alten Rom, geben Sie es zu.«
»Wer hat das alles geschrieben?«
»Ich«, sagte Mr. Oliphant. »Er hat es mir diktiert. Natürlich hatte er es bis dahin noch nicht gelernt, mit seiner linken Hand zu schreiben.«
»Ich verstehe.«
»Aber einer Veröffentlichung würde nichts im Wege stehen. Er hat mir alles übergeben. Falls Sie interessiert sein sollten?«
Ich sagte vorsichtig: »Es könnte sein. Wo hält sich Mr. Houston denn heute auf?«
»Er ist auf Barbados.«
»Sie stehen in Verbindung mit ihm?«
»Ja, sicher. Das hier ist seine Wohnung. Er zahlt immer noch die Miete. Vor einiger Zeit habe ich ihn besucht – drei Jahre ist das jetzt her. Damals war er in Jamaika. Ich hatte gerade wieder einmal diese Bronchitis, und er hat mich zu sich eingeladen, auf seine Kosten … Natürlich ist er jetzt ein sehr wohlhabender Mann.«
»So?«
»Aber gewiss. Er hat Tibet mit etwa einer halben Million Pfund verlassen. Ich vermute, er hätte wesentlich mehr mitnehmen können, wenn er es hätte tragen können. Er weiß, wo der Rest ist.«
»Ich verstehe«, sagte ich wieder.
Natürlich verstand ich gar nichts. Doch kurz darauf, während Mr. Oliphant nähere Erklärungen abgab, schienen sich ein paar Bruchstücke zusammenzufügen. Es ist leichter, sich an die trockene Begeisterung zu erinnern, mit der er sprach, als sie zu beschreiben – wenn sich der Leser eine bartlose Version Bernard Shaws vorstellt, die in einem muffigen grauen Morgenmantel an einem dunklen Oktobernachmittag über ein elektrisches Kaminfeuer gebeugt ist, könnte er dem Bild vielleicht nahekommen.
Es musste kurz nach vier gewesen sein, als ich bei Mr. Oliphant angekommen war, und als ich ihn verließ, ging es auf sechs zu. In der Zwischenzeit hatte er einen zweiten Hustenanfall hinter sich gebracht. Ich sagte besorgt: »Sind Sie denn ganz sicher, dass jemand kommt, um nach Ihnen zu sehen? Ich könnte ohne Weiteres …«
»Das ist bestimmt nicht nötig. Ich versichere es Ihnen …«, sagte er matt.
»Dann werde ich Sie jetzt verlassen.«
»Ja. Ja. Nehmen Sie doch einfach die beiden ersten Bücher mit, ja? Die anderen möchte ich selbst noch einmal lesen. Und kommen Sie wieder.«
»Bestimmt. Ich komme gern.«
Er wollte eigentlich nicht mehr weiterreden, doch direkt vor meinem Gehen fühlte ich mich gezwungen, eine letzte Frage zu stellen. »Mr. Oliphant, ich nehme doch wohl kaum an, dass er, Houston meine ich, auch nur einen Moment an diese ganzen Sachen geglaubt hat, oder etwa doch – ich meine, diese übernatürlichen Geschichten?«
Er hatte die Augen geschlossen, doch jetzt schlug er sie wieder auf, und sie waren ganz blassblau und irgendwie – wie kann man das beschreiben? – hatten sie wieder diesen verschlagenen Ausdruck.
»Aber nicht doch. Nein, er hat nicht daran geglaubt. Oder zumindest glaube ich nicht, dass er daran geglaubt hat. Er ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, verstehen Sie, ein Kerl von der ganz gewöhnlichen Sorte … Trotzdem seltsam, wie es dazu gekommen ist, finden Sie nicht?«
»Doch, höchst seltsam«, sagte ich.
In den darauffolgenden Wochen setzte ich mich mehrfach mit Mr. Oliphant und verschiedenen anderen Menschen in Verbindung. Doch erst im Mai des darauffolgenden Jahres forderten wir von Professor Felix Bourgès-Vallerin vom Fachbereich Orientalische Studien an der Sorbonne einen Bericht über die Bedeutung der Jahre 1949 bis 1951 in Tibet an.
Da dieser Bericht als ein unerlässlicher Bestandteil der Hintergründe angesehen werden muss, füge ich ihn hier in gekürzter Fassung ein.
VON PROF. BOURGÈS-VALLERIN. Das Jahr 1949, das dem des Erd-Stiers in seinem sechzehnten Zyklus entspricht, war für Tibet ein Jahr lang vorhergesagter böser Omen. Die Ereignisse, die mit ihm in Zusammenhang stehen, waren tatsächlich schon seit mehr als zweieinhalb Jahrhunderten vorausgesagt worden, und zwar in letzter Zeit so exakt und bis in alle Einzelheiten, dass vier der größten Klöster ernstlich angeraten hatten, in einem Versuch, die Ereignisse abzuwenden, den Kalender umzustellen.
Der tibetanische Kalender, der aus dem indischen und dem chinesischen abgeleitet ist, stützt sich auf eine Kombination von Elementen und Tieren, um die einzelnen Jahre zu bezeichnen. So war 1948 das Jahr der Erd-Maus, 1949 des Erd-Stiers, 1950 des Eisen-Tigers und 1951 des Eisen-Hasen. Es gibt fünf Elemente – Erde, Eisen (auch Metall/d. Übers.), Wasser, Holz und Feuer – und zwölf Tiere – Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Vogel (auch Hahn/d. Übers.), Hund, Schwein, Maus (auch Ratte/d. Übers.), Stier (auch Rind/d. Übers.) und Tiger.
Jedes Element taucht zweimal hintereinander auf, erst zur Kennzeichnung eines »männlichen« Jahres, dann zu der eines »weiblichen«. Der Kalender hat nach jeweils sechzig Jahren einen vollständigen Zyklus abgeschlossen.
Da bestimmte Kombinationen, so die des Holz-Drachen, des Erd-Stiers oder des Feuer-Tigers, herkömmlich als unter einem unheilvollen Stern stehend angesehen wurden, hat sich im Laufe der Jahrhunderte um diese Kombinationen herum eine beträchtliche Menge von Omen entwickelt. Die meisten der vorausgesagten Ereignisse sind auch tatsächlich eingetreten, und die bekanntesten sind die nepalesische Invasion von 1791, die britische Militärexpedition von 1904 und 1910 der Einmarsch der Chinesen. Die Vorhersagen, die nicht eingetroffen sind, gelten als »abgewendet«.
Kein einziges Jahr hat je eine solche Fülle von unheilvollen Voraussagen auf sich vereint wie das des Erd-Stiers in seinem derzeitigen Zyklus. Vorbote der Ereignisse, so hieß es, werde ein Komet sein, den man von den drei großen Städten Lhasa, Shigatse und Gyantse aus deutlich werde sehen können. Dem würden vier Katastrophen in einer festgelegten Reihenfolge folgen: Ein Berg werde in Bewegung geraten, der Tsangpo werde sich aus seinem Flussbett hinauswälzen, das Land werde von Angst und Schrecken durchzogen werden, und die Reihe der Dalai Lamas werde abreißen.
Während alle diese Voraussagen aus älteren Zeiten stammten, war die, die sich auf den Dalai Lama bezog, die ernsteste von ihnen. Eine Abfolge von Orakeln hatte vorausgesagt, dass die Inkarnationen mit dem dreizehnten Dalai Lama enden würden. Tatsächlich war der dreizehnte Dalai Lama 1935 gestorben, und sein Nachfolger, ein vierjähriger Junge, war 1939 anerkannt worden. 1949, im Jahr des Erd-Stiers, würde er immer noch nicht volljährig und daher nach den Gesetzen nicht in der Lage sein, seine gesamte Macht als spirituelles und weltliches Oberhaupt des Landes anzutreten.
Aufgrund der alarmierenden Natur dieser Voraussagen wurde in den Orakeln der bedeutendsten Klöster Bestätigung gesucht. Was man herausfand, stimmte vollständig mit dem Staats-Orakel überein; es war sogar möglich, beträchtliche Einzelheiten herauszuarbeiten.
Das weibliche Orakel von Yamdring gab die exakte Prophezeiung ab, in diesem Kloster würden die Widrigkeiten im sechsten Monat des Erd-Stiers einsetzen, im August 1949. Zwischen diesem Zeitpunkt und dem »Grauen« werde das Kloster von einem Gast heimgesucht werden, der »von jenseits des Sonnenuntergangs« komme, von einem früheren Eroberer des Landes, der die Äbtissin sowie auch den Schatz des Klosters mit sich nehmen werde.
(Man rechnete damit, dass der Besucher eine Inkarnation des Tatarenfürsten Hu-Tzung sein würde, der 1717 aus dem Nordosten eingedrungen war, die Provinz Hodzo geplündert und sich erst dann wieder zurückgezogen hatte, als die Äbtissin von Yamdring sich ihm hingegeben hatte. Da er die Gunstbezeugungen der Äbtissin angenommen hatte, wurde dieser Fürst anschließend von Chen-Renzi, dem Gotteshüter Tibets, erschlagen, denn gemäß der Tradition war die Äbtissin göttlich – eine wohlwollende Teufelin, die die ursprüngliche Bewohnerin des Himalaja-Hochlandes gewesen war, bis ein umherziehender Affe aus Indien sie aus ihrer Höhle gelockt, sich auf einer Insel im Yamdring-See mit ihr gepaart und so das tibetanische Volk gezeugt hatte.)
Andere Klöster brachten ähnlich düstere Prophezeiungen hervor, wobei jedoch eines von ihnen – das zweitgrößte des Landes, in Sera – eine entscheidende Abweichung fand. Sie bestand darin, dass das »Grauen«, das in der Prophezeiung angesprochen worden war, sich nicht wirklich im Erd-Stier abspielen werde, sondern im Jahr darauf, dem des Eisen-Tigers, und dass es in der ersten Woche des achten Monats einsetzen werde, im Oktober 1950.
Angesichts dieser finsteren und zunehmend eindeutigen Voraussagen berief der Regent des Landes das Kabinett von fünf Ministern ein. Es trat im April 1948 zusammen und hatte im Hochsommer des Jahres eine Anzahl von Vorkehrungen ausgearbeitet.
Um die Teufel, die in den Bergen lebten, versöhnlich zu stimmen, sollte landesweit das spirituelle Potenzial bemüht werden: Das sollte in Form von Gebeten und Opfergaben geschehen. Ferner wollte man, um die Teufel bestimmt nicht zu provozieren, den Nomaden ihr herkömmliches Recht streitig machen, am Fuß des Gebirges zu überwintern.
Für den Fall, dass die Teufel sich weigerten, sich besänftigen zu lassen, wenn also wirklich ein Berg in Bewegung geraten sollte oder wenn der Tsangpo wirklich aus seinem Flussbett gewirbelt werden sollte, würde man, wenn es wirklich dazu kommen sollte, weitere Maßnahmen ergreifen müssen, um die übrigen Prophezeiungen abzuwenden.
Da angenommen wurde, das »Grauen« sei als eine neuerliche Invasion der Chinesen zu verstehen, würde es notwendig sein, alle Umstände näher zu untersuchen, die den Chinesen einen Anlass für eine Invasion geben könnten. Sämtliche Kontakte mit der westlichen Welt sollten auf ein Minimum zurückgeschraubt und sämtliche Ausländer, die man als »westliche Imperialisten« ansehen konnte, abgeschoben werden.
Da zu diesem Zeitpunkt nur fünf Europäer ihren ständigen Wohnsitz in Tibet hatten und sie alle in ständigem Kontakt mit der Regierung standen, sah das Kabinett keine Gründe, in dieser Hinsicht augenblicklich einzuschreiten.
Diese fünf Europäer waren Hugh Richardson, Reginald Fox, Robert Ford, Heinrich Harrer und Peter Aufschneiter.
Richardson stand der neu gegründeten indischen Regierungsmission vor. Obgleich er Engländer war, handelte er im Auftrag einer anderen asiatischen Macht und noch dazu einer, die gerade das imperialistische Joch abgeschüttelt hatte. Folglich genoss er den höchsten diplomatischen Status.
Fox und Ford waren vertraglich verpflichtete Funker. Es reichte aus, lediglich ihre Verträge auslaufen zu lassen. Harrer und Aufschneiter waren ehemalige Kriegsgefangene, die aus einem britischen Kriegsgefangenenlager in Indien geflohen waren. Sie hatten keinen offiziellen Status und konnten jederzeit kurzfristig ausgewiesen werden.
Somit hatte man einstweilen alles unter Kontrolle. Sollten jedoch die Chinesen trotz allem einmarschieren, würde ein letzter und ausgesprochen schrecklicher Schritt notwendig werden. Man würde einer siebenhundertjährigen Tradition hohnlachen und den Dalai Lama in sein Amt einsetzen müssen, um die Nachfolge abzusichern, obwohl er noch nicht volljährig war.
Keiner der Minister wollte diesen Schritt gern in allen Einzelheiten vorausplanen, und da sie alles getan hatten, was man von ihnen erwarten konnte, wurde die langwöchige Sitzung aufgehoben. Der Regent entschied sich, den Lauf, den die Ereignisse nehmen würden, im Auge zu behalten.
Die Geschichtsschreibung zeigt, dass sie exakt den vorhergesagten Ablauf nahmen.
Im Oktober 1948 tauchte der Komet auf und löste in Lhasa, Shigatse und Gyantse in weiten Kreisen Panik und Unruhen aus. Im Juli und im August 1949 »bewegte sich der Berg«, eine enorme seismologische Störung, und dieses Erdbeben betraf die gesamte Himalaja-Region und lenkte den Lauf des Tsangpo dreizehn Kilometer von seinem bisherigen Flussbett ab. (Noch grandioser »bewegte« er sich im August darauf.) Und im Oktober 1950 – in der »ersten Woche des achten Monats im Eisen-Tiger«, genau wie es das Orakel von Sera prophezeit hatte – kam es pünktlich zum Einmarsch der Chinesen.
Angesichts dieser letzten Katastrophe führte der Regent seinen »letzten Schritt« durch. Am 12. November wurde der noch minderjährige Dalai Lama offiziell als Staatsoberhaupt eingesetzt – und drei Wochen später, am 9. Dezember, floh er.
So weit zu den Prophezeiungen und zu den tatsächlichen Geschehnissen des Jahres des Erd-Stiers.
Ob die zahlreichen regionalen Prophezeiungen in vergleichbarem Maße eintrafen, bleibt Spekulationen überlassen. Unter den Flüchtlingen auf indisch regiertem Grenzgebiet schien jedoch Anfang 1951 der Glaube vorzuherrschen, dass zumindest einige der vorausgesagten Ereignisse tatsächlich eingetreten waren, insbesondere die, die man für das Kloster Yamdring prophezeit hatte.
Ein Bericht in Amritsa Bazar Patrika, einer Zeitung in Kalkutta, vom 3. Februar jenes Jahres zitiert einen der Flüchtlinge: »Gewiss hat der Ärger in Yamdring im sechsten Monat des Erd-Stiers begonnen … Wie jedermann weiß, ist die Äbtissin entführt worden, und mit ihr ist der Schatz im Wert von vier Karor Rupien verschwunden.« Das sind drei Millionen Pfund Sterling.
Die Geschichte wurde von anderen Zeitungen aufgegriffen und löste eine ganze Menge von Spekulationen – sowie auch manche politischen Unstimmigkeiten – darüber aus, was wohl die Bedeutung der Formulierung »eine Heimsuchung von jenseits des Sonnenuntergangs« in der Prophezeiung sei. Einige Zeitungsschreiber hatten das Gefühl, es könne nichts anderes als »aus dem Westen« gemeint sein und dass das Orakel, da die Chinesen unbestreitbar von Norden und vom Osten her angegriffen hatten, Raubzüge aus Ladakh an der westlichen Grenze Tibets vorhergesehen habe.
Das wurde jedoch am 9. Februar von einem Mitglied des Lok Sabha, des indischen Unterhauses, heftig abgestritten, der die »hinterhältigen Anspielungen gewisser Leute in Kalkutta« von sich wies, »die den Ladakhis nur die primitiven Motive unterschieben können, von denen sie sich selbst unter ähnlichen Umständen leiten lassen würden. Es steht außer Frage, dass sich kein Ladakhi oder Kaschmiri je dazu hergegeben hätte, Klöster zu plündern …«
Trotz dieser Dementis, die auch von anderen Seiten kamen, hielt die indische Presse diese Geschichte über Wochen am Leben, denn selbst inmitten der Tragik der grauenhaften Ereignisse blieb der Kitzel nicht aus, den die seltsame Geschichte von einer entführten Äbtissin und vier Karor Rupien auslöste.
Als das Wetter in den Grenzgebieten wieder wärmer wurde und die Flüchtlinge allmählich wieder in ihre eigenen, von Teufeln heimgesuchten Berge zurückkehrten, wurden jedoch auch diese Berichte dünner. Im Juni 1951 war es weitgehend aus damit.
F.B.-V., PARIS 1960
Das war der Monat, in dem Charles Houston auf seiner Tragbahre nach London zurückkehrte. Er war siebzehn Monate lang fort gewesen. Es kam ihm vor, so sagte er, als wären es Jahre gewesen.
Kapitel 1
1.
Im Sommer 1949 war Houston siebenundzwanzig Jahre alt und unterhielt ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Sie war dreißig, und er war nicht in sie verliebt, sondern hatte sich nur auf die Sache eingelassen, weil er sich langweilte. Er glaubte nicht, dass diese Affäre den Sommer überdauern würde, doch das tat sie, und im Herbst, als die Schule wieder anfing, fragte er sich, wie er sie beenden sollte.
Houston lebte zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seinem Stiefbruder Hugh in einer Wohnung in Baron’s Court. Hugh war zwei Jahre jünger und wesentlich lauter als er, und wenn er zu Hause war, hatte er die Unart, sich Houstons Hemden und seine Taschenbücher auszuleihen. Doch Hugh war nicht zu Hause. Er war seit Juni mit einem Filmteam fort, und er war sehr überstürzt aufgebrochen, da die Genehmigung erst im letzten Moment erteilt worden war; das hatte wiederum zur Folge, dass Houston seine Urlaubspläne ändern musste und nicht, wie vorgehabt, einen Monat mit seinem Stiefbruder in Frankreich beim Wandern verbringen konnte.
So, wie die Dinge nun lagen, hatte er sich entschlossen, zu Hause zu bleiben, sich in Galerien umzusehen und selbst ein wenig zu malen, und das hätte er auch getan, wenn dieser Sommer nicht zufällig der heißeste Sommer in London seit zehn Jahren gewesen wäre. So folgte sein Tagesablauf in zunehmendem Maß einem altbekannten trägen Muster.
Allmorgendlich stand er auf, ließ die Reinemachefrau in die Wohnung, frühstückte und las die Zeitung. Anschließend machte er sich an einer kleinen Skizze zu schaffen, und dann ging er aus, um einen Drink zu sich zu nehmen.
Von Zeit zu Zeit besuchte er Partys. Einmal gab er sogar selbst eine. Aber die Leute langweilten ihn, sie waren doch eher Hughs Freunde als seine eigenen. Er hatte das Gefühl, wesentlich älter zu sein als sein Bruder.
Auf zweien dieser Partys innerhalb einer einzigen Woche begegnete er Glynis, und beide Male stellte er fest, dass er sich über sie und ihren kleinen, streitsüchtigen und sehr betrunkenen Ehemann wunderte.
Sie war ziemlich groß und deswegen ein wenig befangen; sie ging leicht gebeugt und trug flache Schuhe. Doch in ihrem Gesicht stand etwas Todgeweihtes und Schutzloses, und das übte eine starke Anziehungskraft auf Houston aus.
Sie lebte mit ihrem Mann in Fulham, recht nahe an Baron’s Court, und nachdem er es sich ein paar Tage lang überlegt und die Sache in seinem Kopf gedreht und gewendet hatte, hatte Houston sie angerufen. Es war an einem Julinachmittag, einem strahlend blauen Tag mit flimmernder Hitze. Houston hatte ihr mitgeteilt, er führe nach Roehampton.
»Sie haben es gut.«
»Warum kommen Sie nicht mit?«
Eine Pause. »Oh, ich glaube, das geht nicht.«
»Können Sie nicht schwimmen?«
»Doch, ich kann schwimmen.«
»Dann hole ich Sie ab.«
So hatte es angefangen. Jahre später schien sich die Gesamtheit dieses merkwürdigen und ziellosen Sommers für ihn in einem einzigen Moment zu kristallisieren; in dem Moment, in dem er in der heißen, leeren Wohnung den Hörer aufgelegt und den ersten leichten Taumel verspürt hatte: den Taumel der Spannung, des Ekels und der Besorgnis.
Er erinnerte sich sehr genau an die Gewissenserforschungen dieses Sommers, an die Zeiten, zu denen er seine Lage einer Bestandsaufnahme unterzogen hatte.
Er hatte vierhundert Pfund auf der Bank, die Miete für die Wohnung und einen Beruf als Kunstlehrer an der Mädchenoberschule in der Edith Road in Fulham; diese Stellung war auch der Grund, aus dem er die nahe gelegene Wohnung genommen hatte.
Im Lauf der Jahre hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, sich um seinen Bruder zu kümmern. Als er 1946 aus der Marine ausgeschieden war, hatte er mit dem Gedanken gespielt, ein Jahr lang von seiner Abfindung und von dem Geld, das seine Mutter ihm hinterlassen hatte, zu leben und sich ganz als Künstler zu etablieren. Wenn alle Stricke gerissen wären, hätte er immer noch unterrichten können. Doch dann war Hugh aus dem Militärdienst entlassen worden und hatte bei einer Filmproduktion eine Stelle für fünf Pfund wöchentlich bekommen, und Houston hatte es verschieben müssen, Künstler zu werden. Stattdessen war er an die Mädchenschule in der Edith Road gegangen, hatte die Wohnung angemietet und Hugh zwei Jahre lang ernährt.
Sein Bruder brauchte jetzt natürlich niemanden mehr, der für seinen Unterhalt aufkam. Sein Einkommen war mehr als doppelt so hoch wie Houstons, er gab das Geld mit Begeisterung aus. Houston machte ihm daraus keinen Vorwurf. Er wusste, dass Hugh, wenn er es wollte, aufhören würde, das Geld mit vollen Händen auszugeben, und dass jetzt er ihn jederzeit ernähren würde. Er konnte jederzeit der Rektorin der Edith-Road-Schule, einer Frau, die er nicht leiden konnte, endgültig den Rücken kehren und sich bei nächstbester Gelegenheit als Künstler niederlassen.
Warum also, fragte er sich, tat er das nicht? Houston wusste nicht, warum. Er fühlte sich ausgesprochen schlapp. Er hatte das ungute Gefühl, den Anschluss verpasst zu haben, das Gefühl, im vergangenen Jahr einen Teil seiner Jugend verloren zu haben. Er wollte gar nicht mehr so unbedingt malen wie früher. Er hatte eine unerklärliche Abneigung dagegen, sich von seinem Bruder aushalten zu lassen. Er wusste nicht, was er wollte.
Mitte Juli glaubte er noch, es sei vielleicht eine Frau, aber Mitte August wusste er bereits, dass es auch das nicht war.
2.
Er begann sich erst Mitte September bewusst Sorgen um seinen Bruder zu machen, doch sowie er anfing, sich zu sorgen, war ihm klar, dass er in seinem Innern schon seit einer ganzen Weile besorgt gewesen sein musste. Er wusste, die Dreharbeiten in Kalkutta mussten inzwischen beendet und das Team bereits in die Ausläufer des Everest weitergezogen sein. Der Film handelte von einem Versuch, den Berg zu besteigen. Post wurde von Boten in die Stadt gebracht und musste daher zwangsläufig unregelmäßig eintreffen. Mitte September hatte er allerdings seit einem Monat keinen Brief mehr bekommen. Er wusste nicht, was er tun sollte. Die Filmproduktion wollte er nicht anrufen, denn das wäre ihm doch leicht überspannt vorgekommen. Er dachte sich, er würde noch ein Weilchen abwarten.
Er wartete noch eine Woche, und dann war es ihm egal, ob sein Anruf überspannt wirkte oder nicht.
Das Mädchen in der Telefonzentrale stellte ihn an eine Sekretärin durch. Die Sekretärin verband ihn mit einem Mr. Stahl. Houston hatte schon von diesem Mr. Stahl gehört; er glaubte, dass es sich um einen der Bosse der Gesellschaft handelte. Es verblüffte ihn, dass man ihn gleich mit diesem hohen Tier verband.
»Wer ist da?«, sagte eine ruhige Stimme.
»Mr. Houston – wegen Hugh Whittington«, hörte er die Stimme der Sekretärin in der Leitung sagen.
»Ah ja. Mr. Houston.« (»Ich sitze den ganzen Tag am Telefon«, sagte die amerikanische Stimme trocken zu jemandem im Hintergrund.) »Wir haben ein Telegramm bekommen, Mr. Houston. Ich dachte, Sie hören es sich vielleicht am liebsten selbst an.« Er begann, mit einer leisen Stimme und ohne irgendwelche Betonungen den Inhalt des Telegramms vorzulesen, ehe Houston sich wirklich über den Sinn dieser Aussage klar werden konnte. Danach war eine sechsundsechzigköpfige Gruppe unter dem Westhang eines Berges gesehen worden; sie befand sich auf einem unbehauenen Pfad, der von einem Handelsweg abzweigt. Es war bisher noch nicht bekannt, ob diese Straße blockiert war.
»Es ist mit Lister-Lawrence unterzeichnet«, sagte Stahl. »Das ist der britische Beauftragte in Kalkutta und im Augenblick unsere einzige Informationsquelle. Natürlich schicken wir so bald wie möglich einen Mann an die Grenze, aber es wird ein bis zwei Tage dauern, bis wir etwas hören. Das Erdbeben hat sämtliche Telegrafenverbindungen unterbrochen.«
»Ach so, das Erdbeben«, sagte Houston benommen, und er spürte, dass der Telefonhörer an seinem Ohr zu zittern begann.
»Allem Anschein nach war es ein recht starkes Beben. Wir mutmaßen, dass es ihnen den Rückweg abgeschnitten hat und dass sie den Berg umrunden. Wie dem auch sei – wir sind sehr optimistisch. Wenn man die Einheimischen mitzählt, die dort angeheuert wurden, sollte unser Team auf sechsundsechzig Leute kommen …«
Das Gespräch ging noch etwa ein bis zwei Minuten weiter, und Houston gab die erforderlichen Antworten, doch im Nachhinein konnte er sich nicht erinnern, was sonst noch gesagt worden war. Kurz darauf legte er den Hörer auf und starrte wie betäubt das Telefon an.
Das war das Erste, was er von diesem Erdbeben gehört hatte.
Hugh und er waren acht und zehn Jahre alt gewesen, als sie erstmals feststellten, dass bei ihnen etwas ungewöhnlich war. Das war, als er ins Internat kam und Hugh noch zu jung war, um mitzugehen. Er war während des gesamten Schultrimesters krank gewesen, und auch Hugh war krank gewesen, und so hatte man ihn wieder von dieser Schule genommen und das Experiment nie wiederholt. Er hatte während des Krieges darüber nachgedacht, als sie einmal fünfzehn Monate lang voneinander getrennt waren und sich dennoch keine Krankheitssymptome einstellten. Damals waren sie keiner wirklichen Gefahr ausgesetzt gewesen. Aber jetzt spürte er die Gefahr.
Ende September hatte er wesentlich mehr über seinen Bruder erfahren. Er hatte gehört, dass er in Sicherheit war, dass das Filmteam in einem Dorf Rast machte, doch dass die Rückkehr durch drei Verwundete verzögert werden könnte, wenn auch keine der Verletzungen allzu ernst war.
All das hatte er in drei Gesprächen mit Stahls Sekretärin erfahren, einer jungen Frau, die Lesley Sellers hieß und mit der er sich jetzt telefonisch bestens verstand.
An einem Montag Anfang Oktober rief sie ihn wieder an, in der Schule, und sie fragte ihn, ob er gut säße. Houston sagte, ja, ganz ausgezeichnet, und er erkundigte sich, welche Neuigkeiten sie für ihn habe.
»Nur die besten, Schätzchen«, sagte die junge Frau. »Sie sind auf dem Rückweg. Der Boss hat gestern Abend von Lister-Lawrence gehört und erwartet im Laufe des morgigen Tages einen Anruf von Radkewicz.«
Houston atmete hörbar auf, denn Radkewicz war der Regisseur des Teams, und das waren wirklich gute Nachrichten. Er sagte: »Von wo aus wird er anrufen?«
»Aus Kalkutta. Für das Team steht ein Flugzeug bereit, und das heißt, dass sie alle bald wieder zu Hause sein müssten. Ich dachte, Sie wüssten das sicher gern.«
»Ja, danke. Ich danke Ihnen vielmals.«
»Ist das alles, was der Überbringer froher Botschaften bekommt – ein Danke?«
»Woran hatten Sie denn gedacht?«
»Ach, das überlasse ich ganz Ihnen. Sie könnten es mir sagen, wenn wir uns sehen. Wir haben uns noch gar nicht gesehen, oder?«
Ihre Stimme war im mitlauschenden Lehrerzimmer unangenehm klar zu hören. Houston sagte ganz ruhig: »Vielleicht sollten wir das als Erstes organisieren. Wann würde es Ihnen denn passen?«
Sie machte ihm einen Vorschlag, und ein paar Abende darauf traf er sie zum ersten Mal.
Sie erwartete ihn an der Ecke Wardour Street, ein hübsches, lebhaftes Ding, das in seinem Pelzkragen zitterte. Ohne Scheu hing sie sich bei ihm ein, und sie gingen nach Soho.
»Sie also sind der Künstler?«
»Stimmt.«
»Sie sind Hugh nicht sehr ähnlich, oder?«
»Wir sind nur Stiefbrüder.«
»Ich frage mich, wer dabei besser abgeschnitten hat.«
Houston mochte sie. Sie konnte Seitenblicke werfen, die provozierend waren, ohne eine wirkliche Herausforderung zu sein, ein kleines, flinkes, bewegliches Elfengesicht. Sie bogen in die Grennaro ein, und als er sie im Licht näher ansah, fragte er sich, warum er sie noch nie gesehen hatte. Er kannte die meisten Menschen, mit denen Hugh arbeitete. Er fragte sie, woran das wohl liegen könnte.
»Na ja«, sagte sie. »Ich gehöre nicht zu den Mädchen, die sich gern auf einen Wettstreit einlassen.«
»Wer wäre Ihre Konkurrenz?«
»Sheila, oder glauben Sie das etwa nicht?«
»Sheila?«
»Sheila Wolferston.« Sie warf ihm einen Blick zu. »Sie wissen schon, von wem ich spreche.«
Er konnte sich dunkel erinnern, eine Sheila auf einer Party gesehen zu haben, aber er begriff nicht, was er Spezielles über sie hätte wissen sollen.
Er sagte: »Wollen Sie damit sagen, dass die beiden sehr gut miteinander befreundet sind?«
»Genau das will ich damit sagen.«
»Arbeitet sie auch im Büro?«
»Ja. Na ja, im Moment nicht. Sie ist mit dem Team unterwegs – sie ist die mit dem Beinbruch. Wussten Sie das wirklich nicht?«, fragte sie, während sie ihn neugierig musterte.
»Nein«, sagte Houston leichthin, doch er war seltsam berührt und bestürzt. Er fragte sich, warum Hugh das Mädchen mit keinem Wort erwähnt hatte.
Aber der Abend machte ihm Spaß, und Lesley gefiel ihm besser als die meisten anderen von Hughs Freundinnen. Er brachte sie nach Hause, nach Maida Vale, und trödelte noch eine Weile mit ihr am Eingang des Wohnblocks herum.
»Vielleicht sieht man sich jetzt etwas öfter«, sagte sie.
»Ja, gerne.«
»Der Haken ist nur, dass mein Leben im Moment etwas verworren ist.«
»Meines auch.«
Sie sahen einander lächelnd an.
Houston beugte sich vor und küsste sie. Er erwartete eine kühle und oberflächliche Reaktion; doch weit gefehlt.
»Vielleicht sollten wir lieber damit anfangen, die Dinge zu entwirren«, sagte sie nach einem Moment.
»Ja, das wäre vielleicht das Beste.«
Sie hatte ihm erzählt, dass ein Empfang für das Team geplant war, wenn es, wie allgemein erwartet, am Samstag zurückkehrte, und so einigten sie sich darauf, sich dort wiederzusehen.
»Dann kehre nur wieder in dein kompliziertes Leben zurück, du Wunderkind«, sagte sie leichthin. »Ich denke, dass ich dich am Donnerstag anrufen werde.«
Doch sie rief schon eher an.
Sie rief am Mittwoch an, und sie fragte, ob er am Nachmittag vorbeikommen könne, um Stahl zu treffen.
»Ich weiß nicht. Ich denke schon«, denn im ersten Moment war er verwirrt. »Weißt du, worum es geht?«
»Das soll er dir lieber selbst sagen. Geht drei Uhr in Ordnung?«
»Ja. Ja, abgemacht.«
Ihrem Gesicht konnte er ansehen, dass er keine guten Neuigkeiten zu erwarten hatte, aber er stellte keine Fragen. Sie führte ihn sofort zu Stahl.
Er hatte ihn noch nie persönlich getroffen, und das, was er sah, erstaunte ihn. Trotz der Autorität, die seine Stimme ausstrahlte, war Stahl klein, ja fast zwergenhaft, und er bestand nur aus Haut und Knochen. Er hatte eine spitze Nase mit einem roten Rücken und ein seltsames Augenleiden, das die Augen hinter den Gläsern des goldenen Brillengestells in fortwährender Bewegung hielt. Er kam um den großen Schreibtisch herum, um Houston die Hand zu drücken.
»Setzen Sie sich. Zigarette? Ich fürchte, ich habe enttäuschende Neuigkeiten für Sie«, sagte er ohne Umschweife.
Houston nahm wortlos die Zigarette an und bemühte sich, sie ruhig zwischen den Lippen zu halten, während Stahl ihm Feuer gab.
»Es hat sich eine geringfügige Verzögerung ergeben. Ihr Bruder kommt diese Woche noch nicht zurück.«
Houston starrte ihn an und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Er ist doch nicht krank oder verletzt oder sonst etwas …«
»Nein, keineswegs. Ganz im Gegenteil. Er bleibt dort, um sich um diejenigen zu kümmern, denen etwas fehlt. Mr. Radkewicz, unser Regisseur, hatte es eilig weiterzukommen. Auf den Pässen dort fällt schon früh im Jahr Schnee, und die Ausrüstung des Teams ist sehr sperrig. Er hatte den Eindruck, es könnte noch weitere zwei bis drei Wochen dauern, bis die Verletzten zufriedenstellend ausgeheilt sind, und daher bleiben sie noch eine Weile dort. Ihr Bruder hat sich dafür entschieden, bei ihnen zu bleiben.«
»Ich verstehe«, sagte Houston. Er stellte fest, dass ihn die ruhelosen Augen beträchtlich aus der Fassung brachten. »Ich frage mich bloß, warum er das tut.«
Stahl rang sich ein schwaches Lächeln ab. »Ich vermute, weil er ein guter Kerl ist«, sagte er. »Es besteht keine Gefahr für ihn, falls es das ist, was Ihnen Sorgen macht. Es werden ihnen angemessene Transportmittel und Führer und dergleichen zur Verfügung stehen, und für den normalen Verkehr sind die Pässe fast das ganze Jahr über passierbar. Er dachte sich, ein freundliches Gesicht und jemand, der Englisch spricht, könnten den Verletzten nicht schaden – wenn auch anscheinend in diesem Kloster ein paar Menschen ein wenig Englisch verstehen.«
»Kloster«, sagte Houston. »Was für ein Kloster?«
»Das, in dem sie sich aufhalten. In Tibet. Das wissen Sie natürlich längst«, sagte er und beobachtete Houstons Gesichtsausdruck.
Da ganz deutlich zu erkennen war, dass Houston nichts davon wusste, nahm er die Zigarette aus dem Mund und hüstelte besorgt. »Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich dachte, ich hätte es Ihnen bereits gesagt. Habe ich denn nicht erwähnt, dass ihnen der Weg abgeschnitten worden ist und sie daher den Berg umrunden mussten?«
»Doch, ja«, sagte Houston. »Ja, das erwähnten Sie.«
»Na sehen Sie«, sagte Stahl, der wieder andeutungsweise lächelte, »und wenn man in dieser Gegend einen Berg umrundet, dann landet man meist in Tibet. Und genau das ist ihnen auch passiert.«
Schweigen senkte sich auf den Raum. Houston beobachtete, wie die länger werdende Asche seiner Zigarette abbrach und auf den Teppich fiel.
»Jetzt mal im Ernst, Mr. Houston«, sagte Stahl, der einen Aschenbecher holte, »ich würde mir deswegen keine Sorgen machen. Sicher, Tibet hat einen seltsamen Klang für uns, so fremd und so weit weg. Aber was ist heutzutage schon abgelegen? Was sind Entfernungen? Gestern Abend habe ich mit Radkewicz in Kalkutta gesprochen. Und in achtundvierzig Stunden wird Radkewicz hier in diesem Zimmer vor mir stehen. Glauben Sie mir, heute ist nichts mehr wirklich abgelegen.«
»Das mag gut sein«, sagte Houston. Er war nicht sicher, ob er es auch wirklich begriffen hatte. »Wissen Sie zufällig, wo dieses Kloster in etwa liegt?«
»Sicher. Das haben wir doch hier«, sagte Stahl, und er wühlte auf seinem Schreibtisch herum. »Nach allem, was ich gehört habe, soll es dort wirklich sehr schön sein. Sie sind sehr gut untergebracht. Es gibt gutes Essen, Ärzte, alles, was sie brauchen. Es handelt sich genau genommen«, sagte er, während er seine Brille zurechtrückte, um die fremdartigen Worte auf dem Papier genauer zu ergründen, »um ein Nonnenkloster.«
Doch der Name sagte Houston überhaupt nichts, als er ihn vorlas.
»Und zwar nennt es sich«, sagte Stahl, »Yamdring.«
3.
Der Empfang für die zurückgekehrten Mitglieder des Filmteams fand am Samstag, dem 8. Oktober 1949, im Savoy Hotel statt. Es war ein rauschendes Fest mit Verwandten und der Presse, und obwohl sein Bruder nicht dort sein würde, ging Houston hin. Er sprach mit Radkewicz und mit einem Kameramann, der Kelly hieß und mit seinem Bruder befreundet war, und er unterhielt sich auch mit einigen anderen, und das, was sie ihm erzählten, hätte ihn zufriedenstellen sollen. Wie Stahl bereits gesagt hatte, war dieses Nonnenkloster ein großartiger Ort. Man hatte sich bestens um sie alle gekümmert, das Essen war gut, es gab Ärzte und so weiter. Tibet war gar nicht so, wie man es sich vorstellte. In den Tälern war es im Sommer saftig grün, auf den Feldern wuchs Getreide, und die Menschen, die die Felder bestellten, waren angenehm und freundlich. Für das Filmteam war es ein Ort unter vielen gewesen, die es aufgesucht hatte, ein Ort, an dem man das Team wesentlich freundlicher aufgenommen hatte als dort, wo es hergekommen war, und der sich doch äußerlich nicht allzu sehr von der übrigen Umgebung unterschied.
Kelly hatte die Bevölkerung ins Herz geschlossen.
»Sehr nett, die Einheimischen«, sagte er. »Ich wünschte, wir hätten länger bleiben können, aber es gab so viel zu schleppen. Ein paar von unseren einheimischen Trägern haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind dageblieben, weil es irgendetwas zu feiern gab.«
Kelly war nicht sicher, um was für ein Fest es gegangen war, aber es musste Mitte September stattgefunden haben.
»Sie waren schon mitten in den Vorbereitungen, als wir abreisten – die Gebetsmühlen haben wie verrückt geklappert, und alles ist geschrubbt worden. Ein wunderbarer Ort«, sagte Kelly.
Es klang ganz danach, als sei es dort wirklich so wunderbar, wie er es beschrieben hatte. Die Ortschaft Yamdring lag in einer Talsohle. Das Kloster war an den Hang gebaut, auf sieben übereinander aufsteigenden Terrassen. Zum ersten Mal hatten sie es von einem Berg, der achthundert Meter darüber aufragte, gesehen, und die Sonne hatte auf den sieben goldenen Dächern geglitzert. Ein ovaler See mit smaragdgrünem Wasser und einer Insel in der Mitte lag unterhalb des Klosters. Auf der Insel stand ein kleines Heiligtum mit einem grünen Dach; eine Brücke aus Fellbooten verband die Insel mit dem Ufer. Sie hatten am Spätnachmittag darauf heruntergeschaut, und über die Brücke hatte sich eine Prozession bewegt.
»Dort gibt es immer Prozessionen«, sagte Kelly. »Reizende Menschen. Wirklich sehr kindlich.«
Es war nach neun, als sie gingen, zu spät, um noch irgendwo hinzugehen, aber auch zu früh, um sich schon zu trennen. Houston brachte das Mädchen nach Hause.
»Komm mit rein, und lass uns etwas trinken.«
»Einverstanden«, sagte Houston, und sie gingen die Treppe hinauf.
Es war eine helle, freundliche, moderne kleine Wohnung, ganz anders als die verschachtelten Räume bei ihm zu Hause; und es stand mehr herum.
»Stör dich nicht daran, dass alles zusammengewürfelt ist«, sagte sie, während sie ihm den Mantel abnahm. »Wir wohnen hier zu dritt, und jede von uns hat ihren Plunder.«
»Sind es Freunde oder Verwandte?«
»Freundinnen. Junggesellinnen, wie man so schön sagt. Gin mit irgendwas?«
»Mit Tonic.«
»Setz dich hin und grüble weiter. Du hast schon den ganzen Abend im Stehen vor dich hingegrübelt.«
Houston setzte sich und grübelte weiter.
»Dein Drink steht auf der Sofalehne«, sagte das Mädchen kurz darauf.
»Danke.«
»Geht es dir jetzt besser?«
»Ja, sehr gut.« Es ging ihm überhaupt nicht gut. Ein unerklärliches Zittern hatte in allen seinen Gliedern eingesetzt. Doch die Frage des Mädchens und frühere leise Andeutungen ließen ihn annehmen, dass er wohl größere Besorgtheit zur Schau stellte, als der Lage angemessen war, und daher lächelte er schief und sagte: »Um kleine Brüder muss man sich kümmern.«
»Ihr beide steht euch recht nahe, stimmt’s?«
»Ja, ziemlich.«
»Aber es scheint doch alles in Ordnung zu sein. Er müsste doch schon bald nach Hause kommen, meinst du nicht?«
»Doch, sicher. Gewiss.«
»Ist dir kalt? Du zitterst ein wenig.«
»Ich muss mich verkühlt haben«, sagte Houston. Er wusste nicht, was über ihn gekommen war, aber er wusste, dass es keine Erkältung war. Er spürte den Drang, das Haus zu verlassen und durch die Straßen zu laufen. Er fühlte sich unruhig und eingeengt in dieser Wohnung.
»Ist dir jetzt wärmer?«, fragte sie eine Weile später.
»Ja«, sagte Houston, und ihm war wirklich wärmer, denn die junge Frau lag in seinen Armen. »Wann kommen deine Mitbewohnerinnen nach Hause?«
»Erst später.«
Etwas in ihrem Tonfall ließ ihn darauf schließen, dass sie die ganze Nacht über nicht zurückkommen würden. Außerdem hatte er den Verdacht, dass er genau das aus ihrer Antwort schließen sollte. Er hatte den Eindruck, dass ihn das im Moment überhaupt nicht interessierte. Er ging früh nach Hause.
Das Mädchen begleitete ihn an die Tür.
»Du solltest deine Erkältung doch besser auskurieren.«
»Das werde ich tun.«
»Du gehörst ins Bett«, versuchte sie es zaghaft.
Houston lächelte. »Genau da gehe ich jetzt auch hin«, sagte er.
Aber er tat es nicht. Stattdessen machte er einen langen Spaziergang. Es amüsierte ihn, dass er doch eine ganze Zeit lang ohne Frauen zurechtgekommen war und jetzt plötzlich zwei hatte. So war es ihm während des Krieges gelegentlich gegangen. Er fragte sich, ob er zu der Sorte von Männern gehörte, die sich in kritischen Momenten den Frauen zuwenden, und er fragte sich, worin seine momentane Krise bestünde. Hugh würde zurückkommen. Er würde zum Monatsende zurückkommen. Er brauchte nichts weiter zu tun, als diesen Monat hinter sich zu bringen.
4.
Im Rückblick blieb der Oktober Houston vorwiegend als der Monat in Erinnerung, in dem er versuchte, Glynis loszuwerden. Seine Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. Es kam zu Tränen, zu Vorwürfen und Anklagen und sogar zu Drohungen, denn sie sagte, sie könne ohne ihn nicht leben. Houston, der, wie viele Künstler, weit entfernt davon war, romantisch veranlagt zu sein, glaubte, dass sie es mit Leichtigkeit könnte, wenn sie sich nur entschlossen dazu durchränge. Doch als er den Schmerz in ihren Augen sah, konnte er sich nicht zu einem endgültigen Schritt überwinden.