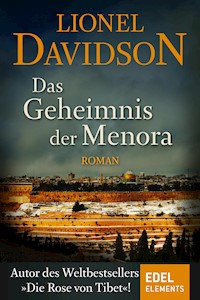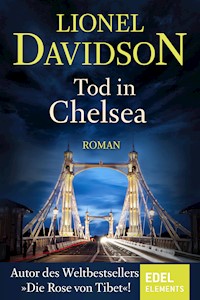
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hochklassiger Nervenkitzel und intelligente Unterhaltung – von einem der erfolgreichsten Spannungsautoren der Welt: Lionel Davidson. "Keiner kann es besser!" (Literary Review) Eine Reihe von spektakulären Morden erschüttert den Londoner Stadtteil Chelsea. Chief Superintendent Warton und seine Ermittler gehen von einem gefährlich intelligenten Serientäter aus, denn der Mörder kündigt anonym seine Bluttaten mit literarischen Zitaten an. Doch nicht nur die Polizei, sondern auch die Presse und besonders die unerschrockene Reporterin Mooney sind hinter jeder Information über die Mordserie her. Außerdem tauchen immer wieder drei Studenten in Verbindung mit den Morden auf, die angeblich einen Low-Budget-Film drehen. Warton gerät an seine Grenzen: Auf welche Karte er auch setzt – immer dann, wenn er einen Täter eingekreist hat, geschieht ein Mord, den ausgerechnet dieser Verdächtige nicht begangen haben kann...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Lionel Davidson
Tod in Chelsea
Roman
Ins Deutsche übertragen von Christine Frauendorf-Mössel
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "The Chelsea Murders" Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2014 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-584-0
I
Sie hatte drei Lilien in der Hand.
Und die Sterne in ihrem Haar
1
In schwarzem Slip und Plüschpantoffeln bügelte Grooters einen Rock. Dabei wippte sie auf dem Fußboden in heller Aufregung hin und her. Grooters hatte eine Verabredung. Sie konnte sich kaum erinnern, wann das zuletzt der Fall gewesen war.
Als die Schranktür aufsprang, drückte sie sie mit dem Ellbogen wieder zu und bügelte weiter. Beim zweiten Mal stieß Grooters einen Fluch auf Holländisch aus und suchte auf dem Fußboden nach dem Stück Pappe, mit dem sie die Tür sonst festklemmte.
Einmal war die Tür nachts knarrend aufgegangen und hatte sie zu Tode erschreckt, als sie gerade einschlief. Damals war es bloß Penny gewesen, die auf der anderen Seite der verschlossenen Verbindungstür in ihrem Schrank herumgekramt hatte; seitdem klemmte Grooters die Schranktür mit dem Stück Pappe fest.
Grooters wohnte im obersten Stock der Comyns Hall of Residence, einem von mehreren Studentenwohnheimen in der Albert Bridge Road. Die Hälfte der Plätze im Comyns war Kunststudenten vorbehalten. Grooters gehörte dazu. Sie studierte Bildhauerei an der Chelsea Art School.
Grooters fand das Stück Pappe und klemmte es fest. Dabei spürte sie eine Bewegung. Das war merkwürdig. Penny war seit einer Woche verreist und sollte auch noch eine weitere Woche wegbleiben.
»Penny?« rief Grooters.
Keine Antwort von der anderen Seite. Aber wie auch? Das Mädchen konnte sie unmöglich hören. Im unteren Stockwerk hatte jemand den Plattenspieler in voller Lautstärke aufgedreht.
Grooters warf einen hastigen Blick durch die Vorhänge, um zu sehen, ob in Pennys Zimmer Licht brannte. Es brannte. Also war alles in bester Ordnung. Penny war früher zurückgekommen.
Grooters bügelte schnell zu Ende. Dann hielt sie sich den Rock und die passende Bluse an und betrachtete sich im Spiegel. Plötzlich war sie nicht mehr so sicher, daß ihre Wahl gut war. Während sie überlegte, kam ihr Spiegelbild auf sie zu und mit ihm zu ihrer Verblüffung der ganze Schrank, um etliche Zentimeter.
Die Türe, die dahinter lag, hatte sich einen Spaltbreit geöffnet.
Grooters dachte zuerst an einen Scherz und dann daran, sich ganz schnell aus dem Staub zu machen. Andererseits hatte sie Hemmungen im Slip nach unten zu rennen.
»Bist du’s, Penny?«
Der Schrank bewegte sich wieder. Grooters Herz setzte einen Schlag lang aus. Dann stemmte sie sich gegen den Schrank, aber er ließ sich nicht ganz zurückschieben. Etwas steckte in dem Spalt, der sich dahinter geöffnet hatte.
»Penny, du bist es doch, oder?« fragte Grooters erneut, brachte vor Angst aber kaum ein Wort heraus.
Sie wußte, es konnte nicht Penny sein.
Jetzt mußte sie so schnell wie möglich raus.
Die Sicherheitskette an der Tür war eingehängt. Man hatte ihnen vor einiger Zeit geraten, die Türen von innen zu sichern.
Grooters hörte ihre Zähne klappern. Den Rücken gegen den Schrank gestemmt, streckte sie die Hand nach dem Tisch aus, auf dem sie gebügelt hatte, zog ihn heran und schob dann den Sessel nach. Dann schlich sie in Pantoffeln und auf Zehenspitzen zur Tür, ohne den Schrank aus den Augen zu lassen und hängte die Sicherheitskette aus. Sie wollte sehen, daß sich der Schrank bewegte, bevor sie die Tür öffnete, wollte sicher sein, daß die Person an jenem Ende des Zimmers und nicht an diesem wartete. Der Schrank bewegte sich. Alles geriet in Bewegung: Schrank, Tisch, Sessel. Mit butterweichen Knien machte Grooters die Tür auf und sah hinaus.
Der Korridor war leer. Alle saßen beim Essen in der Mensa. Aus dem Schallplattenspieler im unteren Stockwerk dröhnte Elton John herauf. Sie schlüpfte aus den Pantoffeln und stieß sie ins Zimmer zurück. Barfuß ging es besser. Auf nackten Füßen schlich sie an Pennys Tür vorbei. Sie sah die Gestalt sofort.
Und die Gestalt sah sie.
Die Tür stand offen. Die Gestalt stand mit ausgebreiteten Armen in der Zimmermitte.
Sie war sehr groß und hatte einen mächtigen Kopf, einen Frauenkopf. Sie trug ein Plastikcape, Gummistiefel und Gummihandschuhe.
Grooters sah das alles mit einem Blick und erstarrte vor Entsetzen. Sie versuchte zu schreien, doch ihre Stimme, die nie besonders kräftig gewesen war, geriet zu einem jämmerlichen Stöhnen. Sie merkte, daß sie von einem Bein auf das andere trat, ohne sich entschließen zu können, entweder zur Treppe oder zurück ins Zimmer zu laufen. Sie glaubte nicht, es bis zur Treppe schaffen zu können, und hastete zurück in der irren Vorstellung, sich in das winzige Badezimmer einzuschließen, bis jemand aus der Mensa zurückkommen würde.
Sie erreichte ihr Zimmer und schlug die Tür zu. Doch dann wurde ihr wie in einer quälenden Zeitlupensequenz, die jeden Bruchteil des Grauens verlängerte, bewußt, daß das Wesen genau damit gerechnet hatte. Blitzschnell war es zum Schrank zurückgekehrt und hatte ihn mit einem Ruck weggeschoben. Polternd und knarrend geriet der Schrank ins Schwanken. Tisch und Sessel gaben nach, und die Schreckensgestalt stand in ihrem Zimmer.
Ihr Anblick gab Grooters das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren und ihre Schließmuskeln versagten.
Dem Karnevalscharakter der Maske – auftoupierte Locken, lächelnder Kußmund – zum Trotz, erinnerten der Umhang, die Stiefel und die Handschuhe eher an einen Schlächter, einen Chirurgen oder einen Leichenbeschauer.
Grooters war eine gesunde junge Frau, und die Arbeit als Bildhauerin hatte ihre Armmuskeln gekräftigt. Sie hatte aber in der Zeitung über diese Erscheinung gelesen, und das Entsetzen lähmte sie. Sie schaffte es trotz gewaltiger Anstrengung nicht bis zum Badezimmer, und auch zur Tür kam sie nicht mehr.
Der Eindringling riß sie herum, stellte sich hinter sie und legte einen Arm um ihre Kehle. Sie hörte den Plastikumhang rascheln und fühlte plötzlich, wie ihr ein Wattebausch über Mund und Nase den Atem nahm.
Sie versuchte den Wattebausch wegzuzerren, doch ein zweiter Arm umschloß sie wie ein Schraubstock. Grooters stieß mit den Ellbogen und trat mit nackten Füßen um sich, ohne aber großen Schaden anzurichten. Die Hand mit dem Wattebausch gab keinen Millimeter nach.
Sie wußte, sie durfte nicht durch diesen Wattebausch atmen. Der süßliche Geruch hatte sie sofort alarmiert. Aber schließlich konnte sie den Atem nicht ewig anhalten. Sie weinte, denn ihr war klar, daß das das Ende war. Sie sah durch den Tränenschleier, wie die Deckenlampe zu kreisen begann und allmählich durch einen langen Tunnel zurückwich, begleitet von Elton John.
Einen Sekundenbruchteil lang wußte sie, daß sie lediglich im Behandlungsstuhl des Zahnarztes saß und alles gut werden würde. Dann schwanden ihr die Sinne.
Der Angreifer merkte, daß Grooters ohnmächtig wurde, wartete einen Moment und ließ sie zu Boden gleiten, ohne den Wattebausch zu entfernen. Eine behandschuhte Hand griff in die große, aufgesetzte Tasche des Umhangs und holte eine Plastiktüte hervor. Dabei fielen zwei Gummibänder heraus. Mit dem einen befestigte er den Wattebausch vor Mund und Nase des Mädchens. Dann stülpte er die Plastiktüte über ihren Kopf und schloß sie mit dem anderen Gummiband unterhalb des Kinns luftdicht ab.
So verpackt, starb Grooters sofort, während ihr Mörder in Pennys Zimmer hinüberging und dort die Tür zum Korridor abschloß. Als er zurückkehrte, drehte er das Mädchen mit dem Gesicht nach unten, ging dann in das kleine Bad, stellte die Dusche an, drehte den Wasserhahn am Waschbecken auf. Der Mörder ließ Grooters noch eine Weile liegen, dann nahm er ihr die Plastiktüte vom Kopf. Er steckte Gummibänder und Wattebausch hinein und ließ alles zusammen in der aufgesetzten Tasche verschwinden, aus der er dann ein handliches Küchenmesser zog. Damit begann er, Grooters Kopf vom Rumpf zu trennen.
Das Messer, aus bläulichem Stahl und von französischer Machart, hatte einen kurzen Sägeschliff, mit dessen Hilfe er die zäheren Partien im Nacken löste. Der Rest war kein Problem. Mit einem kurzen Ruck und einem letzten Schnitt war der Kopf ab. Der Mörder ließ ihn mit dem Gesicht nach unten ins Waschbecken gleiten und stellte sich unter die Dusche.
Zu dieser Zeit war etwa die Hälfte der Morde von Chelsea begangen worden.
Einzelheiten dieser Tat führten letztendlich zur Identifizierung des Mörders; Grooters allerdings hatte nichts mehr davon; sie ruhte zu diesem Zeitpunkt bereits friedlich in einem Grab in Leyden.
2
Drei Wochen zuvor: Für Artie gab es nur noch Mord. Er war mit Blut beschäftigt, das bis an die Decke gespritzt war. Die tödliche Waffe mußte also eine bereits blutende Wunde getroffen haben.
»Herr im Himmel«, sagte er.
Trotzdem schrieb er alles auf. Er hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen.
»Das Gasleitungsrohr sei völlig deformiert und blutbesudelt gewesen, hieß es heute vor dem Coroners Court in Westminster. Die Blutflecken im Zimmer, von derselben Blutgruppe wie die, die man in Lord Lucans Wagen gefunden hatte ...«
»Wären Sie vielleicht so freundlich, Ihre Kommentare für sich zu behalten?« schnappte der alte Herr neben ihm. »Verbindlichsten Dank.«
»Kein Problem«, antwortete Artie. Er hatte das atemlose Gebrabbel des Alten gar nicht verstanden, vorsorglich »Kein Problem« gesagt und einfach weitergeschrieben. Seine Zeit war knapp.
Artie saß in der Handbibliothek von Chelsea. »Die Blutflecken im Parterre gehörten ausnahmslos zur Blutgruppe A (Lady Lucan). Ausnahme: ein blutiges Haarbüschel im Badezimmer. In dem von Lord Lucan gemieteten und in Newhaven herrenlos aufgefundenen Ford Corsair stellte man Blutspuren sicher, die der Blutgruppe sowohl von Lady Lucan als auch von dem ermordeten Kindermädchen Sandra Rivett entsprachen.«
Artie war völlig high (bis zur Bewußtlosigkeit abgedröhnt; er hatte die ganze Nacht mit Speed durchgemacht); trotzdem registrierte er irgendwo in seiner Nähe ein heftiges Schnauben und sah auf. Vor ihm hatte sich der alte Mann aufgebaut und bewegte sprachlos vor Wut die Lippen. Sein altes Gesicht sah gesund aus, rosige Haut und silbergraues, dichtes Haar. Alles daran war in Bewegung. Artie hatte zwar schon von zuckenden Gesichtsmuskeln gehört, aber so etwas hatte er noch nicht gesehen. Dieses Gesicht war unbeschreiblich.
»Sie brabbeln! Sie brabbeln unaufhörlich vor sich hin«, keuchte der alte Mann schließlich. »Sie brabbeln, seit Sie hier sind. Hier muß Stille herrschen. Es ist unmöglich, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren.«
Artie warf einen Blick auf die Arbeit des Alten. Es war die »Times« von 1875. Auf den kleingedruckten Spalten lag ein Vergrößerungsglas. Die Überschrift unter der Linse lautete: »Mr. Disraeli kauft Suez-Kanal-Aktien.«
»Lesen Sie mal das Zeug, das ich hier lesen muß, Kumpel«, riet Artie. »Dann fangen Sie auch an zu brabbeln.«
Arties Lektüre war heißer als die über Disraeli. Er hatte einen Stapel »Evening Standards« vom Juni 1975 vor sich.
»Werden Sie nicht frech. Ich bin nicht Ihr ›Kumpel‹!« schnaubte der alte Herr. Seine Gesichtsmuskeln zuckten so heftig, daß er kein Wort mehr herausbrachte. Er schob den Sammelband einen Platz weiter, setzte sich und rückte dann alles auf den übernächsten Platz. Bebend sah er über die beiden leeren Stühle zurück. Nicht die Spur eines rosigen Schimmers lag auf Arties Haut, geschweige denn ein silbriger auf seinem Haar. Alles an ihm war schwarz wie die Haare, die er im Afro-Look trug. »Unverschämtheit«, zischte der alte Mann empört in seine Richtung.
»War nicht so gemeint«, sagte Artie.
Er starrte aus dem Fenster ins Leere. Er hätte heute im Bett bleiben sollen. Aber es gab noch so viel zu erledigen, und er hatte es Steve versprochen.
Seine Augen brannten jetzt, und er zitterte am ganzen Körper. Daran waren die Amphetamine schuld. Seit Stunden hatte er sich mit Aufputschmitteln vollgepumpt. Zwar hielten die Tabletten das Gehirn in Funktion, ansonsten aber schienen sie etliche Kreisläufe zu unterbrechen.
Außerdem fand er Blut heute widerlich. Es faszinierte ihn, aber eigentlich war es ekelerregend. Wie konnte es überhaupt grün sein?
Er spielte kurz mit dem Gedanken, es doch lieber rot zu lassen. Unsinn! Es war unmöglich. Rot war in jeder Beziehung Schrott. Rot war gleichbedeutend mit Hitchcock und einer Tussi, die schon beim Gedanken an Blut durchdrehte; bedeutete psychedelischen Quatsch in sämtlichen Variationen. Rot war nicht drin.
Außerdem hatten sie alles auf das Grün abgestimmt; ein herrliches altes Grün, bizarr, sehr chemisch. Es sollte nächtliche Stimmung vermitteln. Ein paar Sequenzen hatten sie aus dem Mary-Pickford-Clip der Akademie geklaut. Sie wollten den Stil der Filmuntertitel der zwanziger Jahre kopieren, die sich auf Zelluloid aufblähen und zusammenziehen, abbröckeln, grell aufflimmern und wieder ins Trübe tauchen.
Sie hatten vereinbart, neben Schwarz und Weiß nur eine Farbe zu verwenden; Steve, Frank, alle waren einverstanden gewesen. Frank war der Art Direktor. Er behauptete, das wichtigste sei, die Finger von den beknackten psychedelischen Effekten zu lassen. Das fand Artie auch. Trotzdem war er der Meinung, Frank könne allmählich die zündende Idee für das Blut entwickeln. Wo zum Teufel steckte Frank überhaupt? Gestern war er nirgends aufgetaucht. Und vergangene Nacht war er nicht am Drehort gewesen. Heute hätte er eigentlich hier sein müssen.
Artie blätterte das restliche Material durch und packte zusammen. Er sah, daß das Mädchen hinter der Theke ihm zulächelte, und blieb bei ihr stehen.
»Fertig?« fragte sie.
»Fix und fertig.«
»Was ist morgen dran? Jack the Ripper?«
»Genau.« Er grinste so irre wie möglich. Morgen war bei ihm das Bett angesagt. Und zwar den ganzen Tag lang. »War Frank da?« wollte er wissen.
»Nicht, daß ich wüßte.«
Er sah an ihr vorbei zu der Abteilung mit den Sonderbänden hinauf, wo Frank normalerweise an seinem Manuskript schrieb.
»Da oben ist er jedenfalls nicht.«
Sie mochte Frank nicht. Artie wußte das.
»Arbeitet er heute vielleicht woanders?«
»Was für ein Tag ist heute, – Mittwoch?«
»Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo ich bin.«
»O Mann! Du bist voll drauf, was?«
Sie sprach leicht lispelnd mit Cockney Akzent. Ihr Grübchen kam zum Vorschein, als sie lächelnd auf ihre Hände hinabsah. Artie begriff, daß sie etwas mit ihrem Haar gemacht hatte, und daß er es bemerken sollte. Sie hatte etwas von den Frauendarstellungen der Präraffaeliten. Frank behauptete, wenn sein Buch erst eingeschlagen hätte, würden alle so rumlaufen.
»Versuch’s doch mal gegenüber.«
»Mal sehen. Bis dann.«
Auf der Treppe hatte er das Gefühl, so neben sich zu stehen, daß er beschloß, die Suche nach Frank zu verschieben. Unten auf der Straße allerdings überlegte er es sich anders. Es regnete in Strömen, daß die Tropfen vom Pflaster hochspritzten. Der Glas- und Betonkasten der Kunstakademie auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah aus, als sei er gerade aus dampfender Urmasse entstanden. Der Bau deprimierte ihn, wie immer. Trotzdem hastete er mit hochgezogenen Schultern darauf zu.
Frank war in der ganzen verdammten Akademie nicht aufzutreiben. Schließlich stand Artie wieder auf der Manresa Road. Er war spät dran.
Aus dem strömenden Regen war ein leichter Nieselregen geworden. Er mußte einen Bus in der King’s Road erwischen. Als er dort ankam, stand der Verkehr. Die Busse saßen reihenweise im Stau fest.
Artie machte sich zu Fuß auf den Weg, schlängelte sich zwischen aufgespannten Regenschirmen hindurch, die Hände über den Kopf verschränkt. Er fühlte den Regen nicht, wußte nur, daß er da war. Auf nasse Haare konnte er verzichten.
Hier an der frischen Luft und in Bewegung fühlte er sich völlig losgelöst. Alles um ihn herum hatte etwas Unwirkliches, das ganze Chelsea stand schief über tanzenden Regenschirmen, eine Puppenstadt. Minutenlang wußte er nicht, warum und wohin er lief. Im Vorbeigehen sah er auf dem Plakatanschlag eines Zeitungsverkäufers, daß ein Mord passiert war. Bevor er das jedoch recht begriffen hatte, war er schon ein ganzes Stück weiter.
Ihr Mord konnte es nicht sein. Den hatten sie bereits in der vergangenen Nacht abgedreht. Am Morgen hatte er alles abgeliefert: Kostüme, sämtliche Ausrüstung, einfach alles. Er hatte den Generator und die Scheinwerfer zurückgebracht, hatte die Kassetten mit dem abgedrehten Material im Labor abgegeben. Das war heute morgen gewesen, vor einer Ewigkeit.
Er war seit vierzig Stunden auf den Beinen. Noch acht Stunden, und er hatte es geschafft. Um es durchzustehen, brauchte er mehr Speed; allerdings nicht auf nüchternen Magen. Er mußte zuerst essen und mit Steve sprechen.
Überall waren die Lichter angegangen. Schnell und ohne müde zu werden lief er an unzähligen erleuchteten Boutiquen, Antiquitätenläden und Restaurants vorbei. Die Scheiben glitzerten vor Nässe. Er betrat das »Blue Stuff«.
Drinnen sank seine Stimmung augenblicklich auf Null. Dicht gedrängt, naß und unangenehm ausdünstend standen die Kunden, die dem Regen entflohen waren. Mr. Blue Stuff persönlich war anwesend. Der Chinese hatte nur die Andeutung einer Nase und keinerlei Ausdruck im Gesicht. Er bequatschte ein junges, fettes Mädchen, das eine Cowgirljacke anprobierte. Im ganzen Laden befummelten schräge Typen aufgestapelte Jeanswaren, durchsuchten Kleiderständer und betrachteten sich in den Spiegeln. Steve hatte einem älteren Semester ein komplettes Jeansoutfit verpaßt. Der schräge Vogel hielt die Arme im 45-Grad-Winkel von sich und grinste komisch, während Steve, der aussah wie ein bleicher Gnom, an ihm herumzupfte.
Steve wirkte schmaler und zerbrechlicher denn je. Er ließ den Typ mit den ausgestreckten Armen stehen und kam auf Artie zu.
»Hast du alles rechtzeitig abgeliefert?« wollte er wissen.
»Klar.«
»Den Generator, die Scheinwerfer, alles?«
»Klar doch.«
Sie mieteten die Ausrüstung tagesweise. Eine Stunde Verspätung beim Abgabetermin bedeutete die Miete für einen weiteren Tag.
»Was ist mit den Filmspulen?«
»Im Labor. Ich hab’ die Begleitzettel ausgefüllt. Sie wissen also, daß wir unterbelichtet haben.«
»Gut. Du siehst kaputt aus, Artie.«
»Ja.« Artie zog ein paar Zettel aus der Tasche. »Hier! Und das grüne Blut ist ein Problem. Ich bin auf der Suche nach Frank.«
»Laß Frank in Ruhe, Artie. Er ist fertig.«
»Ich hab’ mir die Hacken nach ihm abgelaufen. Wo zum Teufel ...«
»Laß ihn. Es ist wegen der Tante, die sie aus dem Fluß gefischt haben.«
»Was für ’ne Tante?«
»Liest du keine Zeitung?«
»Mann, ich hatte keine Zeit ...«
»Die vom ›Gold Key‹. Die Bardame. Ertrunken. Laß ihn wenigstens ...«
»He, was los?« sagte Mr. Blue Stuff. »Kunden walten.«
»Nur noch ’ne Minute, Denny.« Blue Stuffs Name war Ogden, nach einem Baptisten-Pfarrer in Hongkong. Aber alle nannten ihn Denny oder gelegentlich »Großer Vorsitzender«, denn er war auch Chef seines Unternehmens »Wu Enterprises«. Wu hatte ’ne Menge Unternehmen. Das stand fest.
»Nichts Minute. Kunden. Was willst du, Artie. Blauchst du Klamotten?«
»Wollte nur mal reinschaun, Denny.«
»Kein Stehimbiß hier. Flank leinschauen, Alabel leinschauen. Kleiderladen hier. Schau andelswo lein.«
»Schon gut. Nur morgen muß ich schlafen«, verteidigte sich Artie. Dann wurde ihm klar, daß er das eigentlich Steve sagen wollte. »Also ruf mich nicht an«, wandte er sich an Steve. »Ich wollte dir das nur bringen. Wir sehen uns heute abend.«
»Du willst doch jetzt nicht arbeiten?«
»Muß ich aber. Ich hab’ vergessen, denen zu sagen, daß ich die Nacht durchmachen muß.«
»Sehen sehl hübsch aus. Sehl schick«, sagte Denny, als Artie ging. Er hatte den schrägen Vogel persönlich übernommen und verwechselte die R’s und L’s wie üblich.
Artie hatte seinen chinesischen Sprachfehler noch im Ohr, als er in den Regen hinaustrat. Glünes Blut. Walum Flank in Laden? Walum Alabel? Artie fiel, Selbstgespräche führend, ins Französische. Den Großteil des vor ihm liegenden Abends würde er sowieso Französisch sprechen. Sein Gehirn begann allmählich müde zu werden. Es funktionierte zwar noch, fühlte sich jedoch wie eine träge Masse an. Es wollte ihm etwas sagen, aber dazu brauchte es mehr Speed.
Bevor er zur Arbeit ging, kam er an einem weiteren Zeitungsplakat vorbei. Diesmal schaltete er sofort. Erwürgt, lautete die Schlagzeile. Ertrunken, hatte Steve gesagt.
War die Rede von derselben Person? Es gab so viele von der Sorte. Ob wach oder im Schlaf, in letzter Zeit drehte sich bei ihm fast alles um Mord.
3
»Was für eine Abscheulichkeit?« fragte Mooney. Ihr Blick glitt an ihren langen Beinen in den abgewetzten Jeans hinab zu den gleichermaßen abgetragenen, flachen Schuhen, die auf der Lehne des nächsten Stuhls lagen. (Das war ein paar Stunden früher und einige Meilen entfernt.) Sie war allein im Zimmer, draußen regnete es, und sie war sowieso in mieser Stimmung. Er hatte sie schon zweimal gefragt, ob er nicht mit dem Chefredakteur persönlich sprechen könne, und sie hatte verneint. Es war Mittwoch, und der Chef war in Dorking, wo das verdammte Blatt in Druck ging.
Ihr Blick fiel auf die letzten Korrekturfahnen. Sie wünschte, er würde endlich »empfängnisverhütende Mittel« aussprechen. Immerhin keine schlechte Geschichte, wenn er das Zeug tatsächlich in seiner Sakristei gefunden hatte.
Mooney entdeckte, daß sie eine nette kleine Überschrift auf der ersten Seite hatte: RENTNER AUS CHELSEA RETTET MÄDCHEN VOR GANG. Reporter vor Ort: Mary Mooney. Das Telefon auf dem anderen Schreibtisch war enervierend. Sie hob ab. »Könnten Sie mal ’ne Sekunde warten, Herr Pfarrer?« In den zweiten Hörer sagte sie: »Redaktion?«
»Kann ich Mary Mooney sprechen?«
»Am Apparat. Chris?« fragte sie. Es war der »Evening Globe«.
»Mary, kannst du zum Gold Key runterfahren? Eine Kneipe in der Nähe von World’s End.«
»Was gibt’s?«
»Keine Ahnung. Könnte ’ne große Sache werden. Germaine, überprüf bitte die Schreibweise Roberts. Bardame. Wir haben sie hier als Diane Germaine Roberts. Man hat sie aus dem Fluß gefischt. Anruf von Scotland Yard. Sie war da halbtags beschäftigt.«
»Ertrunken, sagst du?«
»Exakt. Ich hatte gerade Packer an der Strippe. Er ist drüben. Offenbar hat sie über der Kneipe gewohnt.«
»Gold Key. Germaine Roberts. Und Packer ist wo?« fragte sie.
»Im Yard. Er bleibt da. Der Gold Key liegt an der Ecke ...«
»Ich kenne den Gold Key. Was ist? Taxi?« wollte Mooney wissen.
»Egal. Nur schnell muß es gehen.«
»In Ordnung. Ich melde mich später.« Mooney schwang die Füße vom Stuhl. Nummer Drei? Kaum zu glauben! »Hallo? Tut mir leid, Herr Pfarrer«, seufzte sie. »Wichtiger Anruf. Kann ich später zurückrufen?«
»Nun, vielleicht könnte der Chefredakteur...«
»Natürlich«, beruhigte Mooney ihn. »Er kriegt Bescheid. Ich werd’s dringend machen.«
Mooney lief die Treppe hinunter zu ihrem Fahrrad. Sie hatte es in dem schmalen Korridor zwischen Treppe und Anzeigenabteilung abgestellt. Dort war zwar kaum Platz für ihren fahrbaren Untersatz und es gab ständig Ärger deswegen, aber sie brauchten ja nur den Gang zu verbreitern. Sie wiederholte es immer wieder. Sie war nicht bereit, ihr Fahrrad auf der Straße zu lassen. Mooney angelte ihr Regencape vom Haken und zog es über. Sie haßte diesen schäbigen Schuppen.
Zusammen mit den »Chelsea News« war nach siebzig Jahren auch ihrer Zeitung das Redaktionsgebäude in der King’s Road gekündigt worden. Die Pachtverträge waren abgelaufen. Boutiquen hatten die Räumlichkeiten für zehnmal höhere Mieten übernommen. In ganz Chelsea war es dasselbe. Jetzt versuchten sie mitten aus Fulham heraus eine Zeitung zu machen. Das Management hatte lediglich das Parterre mit Glas, Teppichboden, dem obligaten Gummibaum und dem Schild mit der Aufschrift »Chelsea Gazette« über dem Eingang aufmöbeln lassen. Dort sah es jetzt aus wie in einer plüschigen Reinigung oder in einem Reisebüro. Die Redaktionsräume darüber hatte man in ihrem ursprünglichen Dreck belassen. Wen störte das schon.
Mooney schob ihr Fahrrad auf die Straße und warf die Tür zum Nebeneingang hinter sich zu. Sie sparte sich das Taxi und damit das Feilschen um die Spesen mit dem »Globe«. Sie war mit dem Fahrrad sowieso schneller.
Mooney war einen Meter achtzig groß, dreißig Jahre alt und geschieden. Sie hatte das längliche, schwermütige Gesicht, das an alte spanische Meister erinnerte und die falschen Leute anzog. Das und eine Menge anderer Dinge hatte sie mittlerweile gelernt. Ihre journalistische Karriere war durch Heirat und Mutterschaft (respektive Scheidung und Tod) unterbrochen worden. Sie hatte gelernt, mit vielen Problemen fertig zu werden; einschließlich des Bankrotts zahlloser kleinerer Blätter an der Fleet Street, der es ihr schwer machte, eine Anstellung zu finden. Sie war an ihren ersten Arbeitsplatz bei der Chelsea Gazette zurückgekehrt; den Hungerlohn dort besserte sie durch freie Mitarbeit bei der Londoner Presse auf, was allerdings bedeutete, daß sie hauptsächlich schweißtreibende Laufarbeit erledigte.
Sie bog vor World’s End an der Stanley Street ein. Der »Gold Key« lag an der Ecke. Ihr Blick fiel sofort auf den Streifenpolizisten, der davor Wache schob.
»Morgen«, sagte sie fröhlich und stellte ihr Fahrrad vor der Herrentoilette ab. »Passen Sie ’n bißchen drauf auf? Bitte?«
Der Constable sagte kein Wort. Als er sie jedoch zum Seiteneingang gehen und klingeln sah, kam er hinterher.
»Was wollen Sie da?« fragte er.
»Ich will zu Mr. Logan«, antwortete Mooney. Das kleine Messingschild über der Tür mit der Aufschrift: »Gerald Logan, Bier, Spirituosen, Tabakwaren« hatte ihrem Gedächtnis etwas nachgeholfen.
»Ach ja?« murmelte der Polizist.
Sie stellte fest, daß sie die Erste war. Vor ihr war noch niemand dagewesen. Freudig machte sie ihrer Überraschung Luft.
»Gerry«, sagte sie.
»Geht es um etwas Bestimmtes?« fragte der Constable.
Die Tür ging auf. Vor Mooney stand eine kleine, hagere Frau in Kittelschürze.
»Hallo, meine Liebe«, begann Mooney und nickte ihr freundschaftlich zu. Sie hatte die Frau nie zuvor gesehen. »Sagen Sie ihm, daß ich da bin. Daß Mrs. Mooney da ist.«
Die Frau und der Polizist sahen sie verwundert an.
»Ich bin gekommen, so schnell es ging«, sagte Mooney entschuldigend.
Nachdem beide zuerst Mooney erstaunt gemustert hatten, tauschten Polizist und Haushaltshilfe jetzt hilflose Blicke. »Wie geht es ihm?« wollte Mooney wissen. Dank ihrer schweren Augenlider im langen, südländischen Gesicht konnte sie trotz ihrer Größe und Schlacksigkeit nach Belieben die Rolle der leidenden Madonna aktivieren. »Schrecklich, nehme ich an.«
»Ja, das kann man sagen«, erwiderte die Haushaltshilfe. Sie kratzte sich an einer kleinen Warze an der Lippe. »Sekunde. Ich sehe mal nach.« Mit einem nervösen Blick auf den Constable verschwand sie.
»Warum sind Sie eigentlich hier?« erkundigte sich der Polizist.
»In Zeiten wie diesen«, begann Mooney und schenkte ihm einen Blick grenzenlosen Mitgefühls, »werden wir wirklich gebraucht.« Während Mooney ihn einzuwickeln versuchte, kam ihr die unangenehme Erkenntnis, den Constable schon öfter in der Gegend gesehen zu haben. Allerdings schien er sich nicht an sie zu erinnern, was beachtlich war.
»Ich darf nämlich niemanden reinlassen, wissen Sie«, verriet er schließlich.
»Nicht mal uns?« Mooney starrte ihn ungläubig an.
Plötzlich stand Logan im Türrahmen. Bei seinem Anblick kehrte ihr Erinnerungsvermögen schlagartig zurück. Er hatte einen Bauch und ein pausbackiges Gesicht mit Knollennase. »Oh, Gerry!«
»Ja. Oh, Mann!« sagte er. »Was ist?«
»Mir fehlen die Worte!« erklärte Mooney todernst und schob ihn ins Haus. »Einfach entsetzlich!«
»Ja«, wiederholte Logan. Er beobachtete verdutzt, wie sie dem Polizisten die Tür vor der Nase zuschlug. »Was wollen Sie eigentlich? Keine Ahnung, was das ...«
»Das können Sie auch nicht wissen. Sie Ärmster«, warf Mooney ein. »Machen Sie weiter!« wies sie die Hilfe an.
Mooney wußte selbst nicht, woher sie die Bestimmtheit nahm, mit der sie auftrat. Allerdings war das ein Zeichen, daß sie kreativ zu werden begann ... daß sie auf eine wirklich heiße Story gestoßen war. Und das hier war eine brandheiße Story. Dessen war sie sicher. Bullen vor der Tür ... bei einem harmlosen Fall von Ertrinken? Unwahrscheinlich. Da steckte mehr dahinter. Zum Glück hatte sie es nur mit einem Polizisten zu tun, und dazu mit einem, der reichlich unsicher und unterbelichtet war, sicherlich eilig abkommandiert aus einem der hoffnungslos unter Personalmangel leidenden Reviere. Er sollte vermutlich bis zum Eintreffen der Kripo die Stellung halten. Und die Kripo ließ auf sich warten. Mooney war auf jungfräuliches Terrain gestoßen.
»Gehen wir in ihr Zimmer«, erklärte sie, als ihr zu dämmern begann, wieviel sie in kurzer Zeit abspulen mußte. Sie mußte jeden Augenblick damit rechnen, Polizeisirenen zu hören.
»Ihr Zimmer?« wiederholte Logan.
»Germaines natürlich.«
»Germaines Zimmer?«
»Sie sind wirklich geschafft, Sie Ärmster«, seufzte Mooney und unterdrückte den Impuls, ihn aus dem Weg zu räumen. Sein Haar war zerzaust, und er schien seine fünf Sinne kaum noch beisammen zu haben. In diesem Zustand mußte man sie lassen. »Sie gehen voraus«, fuhr sie fort. »Ich möchte die armen Eltern benachrichtigen.«
»Germaines Eltern? Wovon reden Sie?«
»Ich meine das, was von der Familie noch übrig ist«, verbesserte sie sich. Fehlanzeige. Es gab keine Eltern. Es sei denn, das Mädchen hatte gelogen. Wieso wohnte eine Halbtagskraft überhaupt im Haus? Und wo war die Hausherrin? Es stank. Niemand schien zu lüften. Dabei sollte das Lokal in einer halben Stunde öffnen. Da stimmte doch was nicht. Die Geschichte wurde von Minute zu Minute interessanter. Sie standen in einem dunklen, kleinen Flur. Es stank nach abgestandenem Bier. Ein Korridor führte in die höhlenartige Bar, ein weiterer ins Innere des Lokals. Mooney drehte sich um. »Ich glaube, ich weiß den Weg noch«, sagte Mooney.
»Nein, lassen Sie mich vor«, widersprach Logan. »Wie war doch Ihr Name? Mooney?«
»Mooney ... Mary Mooney«, antwortete sie in leicht vorwurfsvollem Ton.
»Entschuldigen Sie, Mary. Das Ganze ist die Hölle. Sind Sie eine Verwandte?«
»Nein, nein«, wehrte Mooney noch immer vorwurfsvoll ab. »Ich möchte ihre Verwandten benachrichtigen ... Mitten aus dem Leben. Wie ist das nur passiert.«
»Keine Ahnung.« Logans fettes Hinterteil wackelte in abgewetzten Hosen die steile Treppe vor ihr hinauf. »Sie hat gesagt, daß ihr nicht gut sei. Gegen neun ist sie raufgekommen. Wir hatten volles Haus.«
»Sie haben nach ihr gesehen.«
»Ja, ich habe in ihrem Zimmer nachgesehen, was los ist«, stimmte Logan zu. »Könnte gegen halb gewesen sein. Sie hat versprochen wieder runterzukommen. Ist sie aber nicht.«
Eine Hausherrin gab es also nicht. Und er hatte niemand zu ihr hinauf geschickt. Logan war es gewöhnt, nach ihr zu schauen. Auch gut.
»Und später war sie dann nicht da?«
»Richtig.« Logan sah mit offenem Mund zu ihr um. »Sie sind also auch hier gewesen?«
Mooney schüttelte traurig den Kopf und folgte seinem Hinterteil pflichtbeflissen nach oben. Im Geiste sah sie die Einsatzwagen der Polizei, die in diesem Augenblick die King’s Road entlangrasten, sah Taxikolonnen, die sich aus der Fleet Street in Bewegung setzten, die Blicke der Insassen auf die Taxameter geheftet.
Fehlanzeige im ersten Stock. Germaines Zimmer lag unter dem Dach; eine absolute Miefbude; nach dem ersten Augenschein zu urteilen, war die Verblichene eine Edel-Nutte gewesen. In dem mit schweren Vorhängen verdunkelten Raum lag der durchdringende Geruch einer Frau. Das Bett war benutzt und hastig zurechtgemacht, die Decke darüber geworfen worden. Unter einem Polsterschemel lagen achtlos ausgezogene Schuhe, auf der Sitzfläche ein Knäuel von Seidenstrümpfen und schmuddeligen, keinesfalls blütenreinen Slips. Germaine schien Körperpflege weder begeistert noch regelmäßig betrieben zu haben.
Auf der von Puderstaub blinden Glasplatte des Toilettentischs lag ein Kamm voller blonder Haare. Unter dem Glas klemmten Fotos; eines davon, quadratischer und größer als die anderen, zeigte eine Blondine mit Pferdeschwanz, die vom Fußboden aufsah. Riesige Brüste quollen aus einem Bikinioberteil. Wenn es je einen idealen Aufreißer gegeben hatte, dann den hier, dachte Mooney. Vorausgesetzt natürlich, das Foto zeigte die gute alte Germaine. Sie überlegte krampfhaft, wie sie die kritische Frage formulieren sollte.
»Ist das ein neueres Foto?« sagte sie bewundernd.
»Keine Ahnung, wann sie das hat machen lassen«, antwortete Logan düster.
»Ahhh ... es wird ihnen gefallen«, entschied Mooney. Sie hob die Glasplatte hoch und zog mit einem Griff das Foto heraus. Mit wachsendem Erstaunen über das, was hier langsam Gestalt annahm, registrierte sie den Stempel auf der Rückseite. Er lautete: »Eigentum der I. L. E. A.«. Sie verstaute das Bild blitzschnell in ihrer Umhängetasche. »Es erinnert mich stark an ihren letzten Urlaub«, behauptete sie kopfschüttelnd. »Die Zeit vergeht so schnell. Wann ist das nur gewesen?«
Mooney dachte, Logan sei im Begriff zu niesen, gereizt durch den penetranten Geruch des Zimmers, stellte dann aber fest, daß er weinte. »Na vielleicht sagt uns ihr Reisepaß mehr«, bemerkte sie ungerührt.
Aus einer Telefonzelle, keine zweihundert Meter vom »Gold Key« entfernt rief sie den »Globe« an, nachdem sie dem Polizisten für die Bewachung ihres Fahrrades gedankt hatte. Kaum war die Verbindung hergestellt, hörte sie die Sirenen heulen.
»Chris, du hattest recht. Es ist ein Hammer. Gibt’s was Neues von Packer?«
»Ja. Sie ist erwürgt worden. Die Wasserpolizei hat sie flußabwärts unterhalb der Albert Bridge rausgefischt. Aber sie muß zwischen Wandsworth und Battersea, vielleicht sogar bei Lots Road ins Wasser geworfen worden sein. Aber los, zur Sache, Herzchen. Was hast du auf Lager?«
»Zu allererst einmal ein gigantisches Foto. Und zwar exklusiv.«
»Portraitfoto?«
»Portrait? Im Bikini. Mit Titten bis zur Taille.«
»Wirklich?«
»Sieht nach der Arbeit eines Profis aus.« Mooney betrachtete das Foto. »Auf der Rückseite steht I. L. E. A. Das ist doch was, oder?«
»I.L.E.A.?«
»Inner London Education Authority.«
»Und was heißt das?«
»Mahn, was denn schon? Eine Kunstakademie. Sie hat dort Modell gestanden. Wir haben’s nicht mit ’ner schlichten Bardame zu tun. Sie war Modell. Ermordet. In Chelsea.«
»Gütiger Himmel. Weiß das sonst noch jemand?«
»Keiner. Ich bin noch vor der Kripo dagewesen. Sie ist gerade erst auf dem Weg. Ich kann die Sirenen hören. Paß auf, ich komme vorbei. Aber zuerst ein paar Informationen vorab.«
»In Ordnung. Bleib dran. Ich verbinde dich mit dem Schreibbüro.« In der Leitung klingelte es. »Stellen Sie den Anruf zu einer der Schreibdamen durch. Es ist dringend.«
»Bin bereit«, sagte am anderen Ende eine Stenotypistin.
»Mooney, Chelsea«, begann Mooney.
»Schieß los, Mary.«
»Mord an Akademie-Modell in Chelsea.«
»Mord an Akademie-Modell in Chelsea«, wiederholte die Stimme am anderen Ende.
»Der völlig gebrochene vierundfünfzigjährige Gerald Logan, Wirt des Gold Key«, diktierte Mooney. Sie buchstabierte seinen Namen, Namen und Alter des Mädchens, und alle anderen Einzelheiten aus dem Reisepaß. Sie erklärte alles über die vierundvierzigjährige Frau von Gerald, die sterbend im Brompton Hospital lag, und daß er dem fünfundzwanzigjährigen Nachwuchstalent aus Manchester Kost und Logis gewährt hatte, damit diese ihre vielversprechende Karriere weiterverfolgen konnte.
Der vierundfünfzigjährige Gerald und die fünfundzwanzigjährige Germaine, hatten es sich zur Gewohnheit werden lassen, vor dem Schlafengehen noch ein bißchen Themseluft zu schnuppern. Als er sie nicht hatte finden können, war er auf die Idee gekommen, sie könnte allein losgegangen sein, vielleicht zum gegenüberliegenden Ufer, wo er vor einer stillgelegten Werft ein Filmteam bei der Arbeit beobachtet hatte, aber dort hatte er nicht nachgesehen.
»Soll der letzte Satz auch rein?« fragte die Stenotypistin. Mooney war dabei etwas ins Stocken geraten.
»Ja, warum nicht? Dann habe ich noch eine Fotoüberschrift«, fügte Mooney hinzu. »Wollen Sie sie auch?«
»Wer hat das Foto?«
»Ich. Ich bring’s gleich vorbei.«
»Dann lieber nicht, Herzchen. Das machen die Leute vom Layout selbst.«
»Mooney, Chelsea. In Ordnung?«
»Alles klar.«
4
Die Herren, die mit Sirenengeheul angekommen waren, verbrachten Minuten damit, das Rätsel um Mrs. Mooney zu lösen. Rätsel gab es mittlerweile mehr als genug. Völlig schleierhaft blieb es Chief Inspektor Summers allerdings, wie ein junger Trottel wie dieser Constable vor der Haustür je zur Polizei kommen konnte.
»Wie heißen Sie?« erkundigte er sich.
»Nutter«, antwortete der Constable und wurde rot.
»Aha.« Alles weitere ließ der Chief Inspektor bewußt ungesagt. »Ich will ja nicht gehässig sein, mein Junge«, waren die Worte, die ihm auf der Zunge lagen, doch er sprach sie nicht aus. Mit einem solchen Namen war das Leben kompliziert genug. »Und Sie hielten sie wofür?« fragte er laut.
»Na, für ’ne Nonne, eine von der Wohlfahrt, oder so was.«
»In Jeans?« Auf einem Fahrrad, eine Misses?
»So was ähnliches«, beharrte Nutter. »Eine Gemeindeschwester oder Sozialhelferin ... was Kirchliches. Sie wurde erwartet. Jedenfalls dachte ich das, Sir. Sie hat so getan«, fügte er zerknirscht hinzu.
Damit schien er recht zu haben. Die Haushaltshilfe hatte ausgesagt, daß sie dachte, der Wirt habe Mrs. Mooney telefonisch gebeten zu kommen. Und der Wirt hatte behauptet, er habe geglaubt, jemand habe sie geschickt. Sie standen alle in dem nach abgestandenem Bier riechenden engen Flur und sahen sich an. Der Wirt schien völlig durcheinander. Für den Chief Inspektor hatte das seine guten Gründe. Summers hatte einen neuen Hinweis, dem er gern nachgehen wollte. »Also, machen wir weiter«, sagte er daher. »Sie gehen voraus, Mr. Logan. Sie übernehmen hier unten, Mason«, fügte er mit einem vielsagenden Blick auf Nutter hinzu.
Constable Mason von der Kripo nahm den armen Nutter mit vor die Tür.
»Machen Sie sich nichts draus«, tröstete er ihn. »Wir machen alle mal Fehler.«
»Finde ich auch.« Nutter war noch immer glutrot im Gesicht. Anspielungen auf seinen Namen konnte er nicht ausstehen. »Und manche machen sie immer wieder«, setzte er hinzu.
Mason hatte die Anspielung verstanden; das war in letzter Zeit so etwas wie eine Gewohnheit geworden. »Deshalb ist er auch so reizbar«, fügte er schließlich einsilbig hinzu.
»Wenn man im Glashaus sitzt«, beharrte Nutter wütend.
»Schon gut Nutter, mach daß du fortkommst, Nutter. Keine Aufregung, Nutter, alter Junge.« Mason hätte dem Dummkopf gern Beine gemacht. Doch er nickte nur schweigend, als Nutter erhobenen Hauptes davonging.
Mason war ein sehr beherrschter junger Mann, ein Kriminalbeamter mit Zukunft. Er hatte das Gefühl, daß dieser Fall eine Chance für ihn war.
Mittlerweile bewältigte Logans fettes Hinterteil erneut den schmerzlichen Aufstieg zu Germaines luftiger Bleibe. Es dauerte keine fünf Minuten, bis ihm erneut die Tränen kamen. Der Gold Key blieb an diesem Morgen geschlossen; und das, obwohl eine wachsende Zahl von Gästen, unterstützt von dreißig Damen und Herren von der Presse, ungeduldig auf die Öffnung des Lokals warteten.
Das Mädchen war ermordet worden. Es war der dritte Mord in zwei Wochen und im Umkreis von einem Kilometer.
Der Mann, der mit diesen deprimierenden Tatsachen fertig werden mußte, saß übellaunig in seinem Büro im Polizeirevier von Chelsea, in dem das Morddezernat seine Zelte aufgeschlagen hatte. Ihm war klar, daß er wieder einmal in der Tinte saß.
Wie tief allerdings, wußte er noch nicht. Das Mädchen ohne Kopf trug denselben an diesem Morgen noch auf den Schultern, wo er noch eine Weile bleiben sollte.
Der Name des Mannes war Warton, Chief Superintendent Warton; eine imposante, füllige Erscheinung mit mächtigem Brustkorb und vorgeschobenen Schultern, was ihn kleiner erscheinen ließ als er war. Er hatte fast keinen Hals und einen runden, fast kahlen Schädel, dessen weit vorspringende untere Gesichtshälfte in ein paar wulstigen Lippen mündete, was ihm das Aussehen eines Warzenschweins gab.
Von Naturell und Einstellung her war Warton ein unangenehmer Zeitgenosse; mißtrauisch, beinhart und unfreundlich. Er war schon sehr lange in seinem Job; einem Job, der ihm schon länger reichlich lächerlich vorkam. Es schien höchste Zeit zu sein, damit aufzuhören und etwas Solides in der Verwaltung anzufangen, etwas mit geregelter Arbeitszeit und respektabler Anonymität. Sein rastloses Herumzigeunern mit dem Morddezernat und das ständige Rätselraten war für ihn irgendwie anrüchig und unappetitlich.
Allerdings war er überdurchschnittlich begabt im Lösen von Rätseln, und das war der Grund, weshalb er auf diesem Posten saß.
Beim ersten Mord hatte der neu ernannte Commissioner der Kriminalabteilung von Scotland Yard sofort einen seiner Direktoren gerufen und gesagt: »Ich brauche jemanden, auf den in diesen Dingen Verlaß ist. Jemanden wie Ted Warton. Pfusch können wir uns hier nicht leisten.«
Es hatte schon zuviel Pfusch gegeben. Zum Beispiel die Panne mit Lord Lucan und Lady Lucan. Dann die Pleite mit Slipper von Scotland Yard, der ohne seinen Häftling, den Posträuber Briggs, aus Brasilien zurückgekommen war. Der Frauenschänder von Cambridge, der die Universitätsstadt monatelang terrorisiert hatte, bis man bei seiner überfälligen und beinahe zufälligen Verhaftung feststellen mußte, daß er ein ellenlanges Vorstrafenregister besaß; ganz zu schweigen von der Tatsache, daß der Täter auf seinem blutigen Weg reichlich Spuren hinterlassen hatte, einschließlich unterzeichneter Nachrichten.
Das alles war für die Polizei kein Ruhmesblatt.
»Woran arbeitet Ted gerade?« wollte der Commissioner wissen.
Warton arbeitete an gar nichts. In weiser Voraussicht hatte er sämtliche Fälle aufgearbeitet, um jederzeit zu neuen Ufern aufbrechen zu können.
Auf diese Weise hatte er sich die vorliegenden Aufgaben eingehandelt.
Zwei Wochen zuvor war der Amerikaner Alvin C. Schuster unweit seines Hauses in der Bywater Street als wenig dekorative Verzierung eines Laternenpfahls aufgefunden worden. Er hatte zwei Messerstiche in der Brust und war zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Stunden tot.
Eine Nachbarin, die ihren Hund ausführte, hatte ihn wenige Minuten vor Mitternacht entdeckt. Andere Nachbarn waren den ganzen Abend in ihren Häusern ein- und ausgegangen, ohne das Geringste zu bemerken. Letzteres hatte bei Warton die erste üble Verstimmung ausgelöst.
Ganz offensichtlich hatte man Schuster an den Laternenpfosten gebunden, und zwar kurz bevor die Nachbarin ihn entdeckte. Ein leichtes Unterfangen konnte das allerdings nicht gewesen sein, es sei denn, Schuster wäre direkt von seinem Haus aus dorthin gebracht worden. Das war nicht geschehen. Der Hund der Familie schlug zuverlässig immer an, sobald Schuster sich dem Haus auch nur ein wenig näherte. Das Tier hatte nicht gebellt.
Wenn er aber nicht an seinem Haus vorbei zum Laternenpfosten gebracht worden war, wie war er dorthin gelangt? Bywater Street war eine Sackgasse, in der die Autos Stoßstange an Stoßstange parkten. Die einzige Zufahrt führte über die King’s Road. Die besagte Straßenlaterne befand sich im letzten Viertel der Straße. Dorthin gelangen zu wollen, hätte in jedem Fall größeres Aufsehen erregt.
Wartons letzte verzweifelte – und ergebnislose – Anstrengungen richteten sich auf eine mögliche Beteiligung der Geheimdienste. Das wiederum brachte ihm einen frühmorgendlichen Anruf des Commissioners ein. Er wurde barsch angewiesen, gefälligst keinen Unsinn zu verbreiten. Die Amerikaner ließen angeblich einiges durchsickern, die Gerüchteküche kochte. Der Commissioner gab ihm zu bedenken, wer in seinem Amtsbereich wohne, und mahnte ihn, den Fall als normalen Mord zu behandeln.
Warton wußte, mit welchen Leuten er es in der Gegend zu tun hatte, nämlich mit Unruhestiftern aller Couleur, mit Richtern, Bankiers, Politikern. Mrs. Margaret Thatcher, Parteivorsitzende der Konservativen, hatte ihr viel fotografiertes Wohnhaus in der Flood Street, nur wenige hundert Meter von Schusters Straßenlaterne entfernt.
Und Warton kannte normale Mordfälle. Langjährige und traurige Erfahrung hatte ihn gelehrt, daß neunzig Prozent der Morde ihren Ursprung in häuslichen Problemen hatten.
Bei Schuster allerdings schien diese Ursache nicht vorzuliegen.
Nach allem was die überaus gründlichen Ermittlungen ergeben hatten, hatte Alvon C. keinerlei Seitensprünge gemacht, mit niemandem Streit, Alkohol- oder Drogenprobleme oder andere Schwierigkeiten gehabt. Er war offenbar ein fröhlicher Öl-Manager mit Hornbrille gewesen, aufgeschlossen für die Sorgen der Industriearbeiter, verantwortungsbewußt als Manager. Er schuldete niemandem Geld. Niemand schuldete ihm Geld. Und er war auch nicht für mehr Entlassungen zuständig als andere.
Warton erschien es daher sehr wahrscheinlich, daß eine Verwechslung vorlag. Bedauerlicherweise war das noch viel schlimmer. Jedem durchschnittlichen Zeitungsleser war klar, daß selbst hinter dem verblüffendsten und brutalsten Mord ein rationales Motiv steckte. Für alles gab es eine plausible Erklärung oder Ursache. Traf es jedoch das falsche Opfer, lagen die Dinge völlig anders. Jeder konnte der Falsche sein. Es kam zu panikartigen und wütenden Reaktionen und nicht selten zu Briefen an die politischen Vertreter, von denen eine Menge in Chelsea lebte.
Nach dem Telefongespräch war Warton in sein Hauptquartier in Chelsea gefahren – das ausgerechnet am Lucan Place untergebracht war – und dort nahtlos zum nächsten Glanzpunkt des Tages übergegangen. Summers, seine rechte Hand, empfing ihn mit der Nachricht, daß ein zweiter Mord geschehen war. Zwei Straßenzüge weiter, am Jubilee Place, war eine Haushaltshilfe mit einem fröhlichen »Guten Morgen« an ihrem Arbeitsplatz erschienen und hatte ihre Arbeitgeberin splitternackt in der Diele vorgefunden. Die Arbeitgeberin war die zweiundachtzigjährige Miss Jane Manningham-Worsley. Man hatte sie erwürgt und vergewaltigt.
Warton ging in die Wohnung im dritten Stock und sah sich die Sache an.