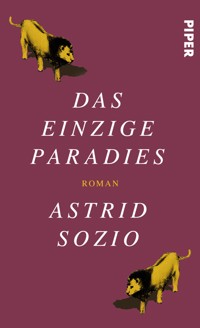21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einem Unfall und von Schuldgefühlen geplagt flieht Benjamin aus der Stadt zu seinem Vater, in ein kleines Dorf im Sauerland. Dort verbrachte er in seiner Kindheit und Jugend die Ferien. Noch heute gelten in der Brüdergemeinde strenge, evangelikale Regeln. Als Teenager war Benjamin mit den Geschwistern Hanna, Lea und Gideon befreundet, machte seine ersten sexuellen Erfahrungen mit Gideon und verliebte sich schließlich in Hanna, die bei einem tragischen Ereignis ums Leben kam. Die traumatischen Erinnerungen an Welsum haben ihn 25 Jahre davon abgehalten, den Ort wieder aufzusuchen. Nun trifft ihn die Rigidität der Fundamentalisten umso heftiger, die in ihrer Hartherzigkeit immer neue Angst schaffen und die Nähe zu Rechtsextremen nicht scheuen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
astrid sozio
Der rechte Pfad
Copyright © 2024 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © akinotombo/Adobe Stock
ISBN 978-3-7117-2146-4
eISBN 978-3-7117-5505-6
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at
astrid sozio
Der rechte Pfad
roman
picus verlag wien
You start walkin’ backwards
though you know that it’s wrong
Bob Dylan,
Last Thoughts on Woody Guthrie
Die den Herrn lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht!
Richter 5,31
Inhalt
So wahr ich lebe, spricht dein Gott
In the Cold, Cold Night
First We Take Manhattan
Still, still, still
Christus, der ist mein Leben
Pass auf, kleines Auge, was du siehst
Green Grass
Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens
When the Wind Blows
Bonnie, Why’d You Cut My Hair
A Hard Rain’s A-Gonna Fall
Down, Down, Down
Es brennt die erste Kerze
O Welt, ich muss dich lassen
Song to the Siren – Take 7
Jockey Full of Bourbon
I’m Your Man
Motorpsycho Nightmare
Careful with That Axe, Eugene
Love Is Just a Four-Letter Word
Dress Rehearsal Rag
Shelter from the Storm
Saved
Let Your Fingers Do the Walking
Verleih uns Frieden gnädiglich
Nowhere
Visions of Johanna
Don’t Go Home With Your Hard-On
Niklaus komm in unser Haus
Guter Mond, du gehst so stille
1/f Rauschen
Gotta Serve Somebody
River of Men
Starving in the Belly of A Whale
Viel Glück und viel Segen
Solo Whale
The Ship Song
You Ain’t Goin’ Nowhere
Whatever Gets You Thru the Night
Es brennt die dritte Kerze
A Country Boy Can Survive
Changes
Selig sind, die den Frieden stiften
Guitar Solo, No. 5
Oscillate Wildly
Out of Time
Can I Sit Next to You Girl
Bird on the Wire
Paper Thin
In the Neighborhood
Always
Melancholy Mood
Octopus’s Garden
Hoist That Rag
Can You Please Crawl Out Your Window?
Weißt du, wie viel Sternlein stehen
Take Care of All My Children
Birthday
You Think You’re a Man
Mad World
Disappearing
Water
When Under Ether
Hunter’s Lullaby
Play Dead
Wir sind nur Gast auf Erden
Who By Fire
You Look Like Shit
It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)
It Ain’t Me Babe
One
Exit Music (for a Film)
Benjamins Playlist
So wahr ich lebe, spricht dein Gott
»Am Ende ist einer tot«, sagt Maria und kann gar nicht hinsehen. Dabei hat sie extra Spiegel in die Obstbäume gehängt, um uns nicht aus den Augen zu verlieren, an den Tagen, an denen sie nicht aus dem Bett kommt. Dann muss sie sich nur aufsetzen, um uns zu sehen. Manchmal flattern ihre Haare aus dem offenen Schlafzimmerfenster. Die Spiegel in den Bäumen blitzen, wenn der Wind sie bewegt, und Licht tropft von unreifen Äpfeln und Birnen auf die Steinplatten, die einen Weg zwischen den Beeten hindurch bilden. Tritt bloß nicht auf die Erde! Der Alte hinter dem vergitterten Fenster im Erdgeschoss sieht alles und mit einem Blinzeln gefrieren die wässrigen Augen zu Eisstückchen, er kommt aus dem Laden und reißt sich im Vorbeigehen eine Rute von der Weide. Seine Strafen, Seine Schläge, unserer Seelen Wohlergehn.
Aber Gideon hört ihn immer kommen, und wir sind schneller, springen über den Bach, was verboten ist, rennen über die Kuhweide und in den Wald.
Der Wald ist auch verboten, aber tagsüber nicht ganz so sehr, wie wenn es dunkel wird. Unter den Bäumen ist es stickig, mehr Mücken in der hautwarmen Luft als Teufel in der Hölle. Ich atme durch meine Finger. Hinter den toten Bäumen kommt der See.
Gottes Antlitz auf der glatten, dunklen Oberfläche – bis Gideon hineinspringt. Hanna und Lea waten hinein. Nur ich traue mich nicht. Ich setze mich auf einen Baumstamm und pule Stückchen aus dem morschen Holz. Grünfaul, blaufaul, schwarzfaul.
Zwischen den Zweigen kann man schon den Mond sehen, als sie endlich aus dem Wasser kommen. Der Himmel ist noch hell, aber wir rennen trotzdem lieber. Gideon ist der Schnellste, obwohl Hanna und Lea fünf Jahre älter sind als er. Ich bin genauso alt wie er, und so langsam, dass sie nie aufhören werden, darüber zu lachen. Hanna läuft hinter mir, damit ich nicht im Wald bleibe. Wenn du hier nachts im Wald bleibst, verlierst du deinen Verstand. Der steigt hoch zum Mond und dann musst du jemanden finden, der ihn für dich zurückholt. Als wir an der Gärtnerei ankommen, ist Hanna nicht mehr da. Dabei habe ich sie gerade noch ganz dicht hinter mir atmen gehört.
Als Maria merkt, dass Hanna im Wald geblieben ist, schaut sie auf den Mond, der so tief hängt, dass die Baumkronen ihn beinah berühren.
»Ich habs gewusst«, sagt sie und klatscht in die Hände. Am Ende ist einer tot, sie hat es immer gesagt. Oder vielleicht ist Hanna unterwegs, Marias Verstand vom Mond zurückzuholen. Gut gelaunt geht Maria ohne Abendessen ins Bett. Wir hören sie singen, während wir essen.
Es gibt Brotsuppe, aber erst wird gebetet. Manchmal vergesse ich das, dann schauen die anderen mich grinsend an und ich lege schnell den Löffel hin und falte die Hände, senke den Kopf, schließe die Augen. Sie beten, ich bewege die Lippen und sage Amen, wenn alle Amen sagen.
Beim Essen wird nicht gesprochen. Die Löffel klingeln in den Suppentellern wie Kuhglocken. Einer hat einen Sprung und klingt ganz dumpf. Plötzlich knallt es, nicht hier, weiter weg, aber ich zucke trotzdem zusammen.
»Das is nur dein Vater, Benni«, sagt Gideon leise, »und auch nur ne ganz kleine Kugl.«
Er kann so was hören.
»Wahrscheinlich n Hase. Oder n Fuchs.«
Augen wie Karfunkelstein.
»Oder Hanna«, sagt Lea.
Gideon lacht: »Bennis Vater hat noch nie danebngeschossn.«
Lea lacht nicht. Sonst lächelt sie immer. Daran kann man sie und Hanna unterscheiden. Alles andere ist genau gleich.
»Trotzdem«, sagt der Alte, »sie hat schon recht: Wer heut is frisch, gesund und rot, is morgn krank, ja wohl gar tot. Kann keiner wissn.«
Er legt seinen Löffel in den Suppenteller, der leer ist, bis auf die aussortierten Zwiebelstückchen, und spricht jetzt ganz allein zu mir, denn Gideon und Lea, die wissen längst, dass sie morgens nur aufwachen, weil Gott es so will. Wenn Er irgendwann nicht mehr will, ist es vorbei. Deshalb beten sie hier so viel und tragen den Heiland immer bei sich, im Herzen. Alle in Welsum haben Ihn, ich glaube, sie werden damit geboren. Nur mein Herz ist leer, ich bin immer nur über die Sommerferien hier. Aber wenn ich wirklich will, kann auch ich gerettet werden vor dem Tod.
Ich will. Wirklich. Ich will auf keinen Fall sterben. Nie.
»Dann hüte dich und bewahr deine Seele gut, dass sie nie vergisst, wer dir dein Lebn geschenkt hat.«
Ich nicke.
»Und jetz ab nach Haus, bevors zu dunkl wird.«
Lea bringt mich. Sie lächelt jetzt wieder und hält meine Hand. Meine andere Hand nimmt Gideon, der unbedingt mitkommen will. Im Wald unter den dichten Baumkronen sieht man nicht mehr viel. Dafür hört man viel mehr als tags. Wir rufen Hannas Namen. Gideon dreht sich immer wieder um.
»Hört ihr das nich? Das Hecheln?«
»Vielleicht ein Hund«, sagt Lea, »von der Jagd.«
»Bennis Vater hat kein Hund.«
»Dann gehn wir ebn Straße«, sagt Lea. Auch wenn es weiter ist und es keinen richtigen Weg, sondern nur einen schmalen Graben gibt zwischen Asphalt und Waldrand. Wir müssen hintereinander gehen. Gideon liest die Namen, die auf den Holzkreuzen stehen. Mike, Jessica. Es sind immer nur Leute von außerhalb, die aus den Kurven in die Bäume fliegen, keiner, den wir kennen.
Die Kreuze hören auf, als auch der Wald aufhört und neben uns wieder Weide ist. Lea steigt über den Stacheldraht, Gideon und ich kriechen darunter durch. Die Kühe schlafen schon, im Stehen, wir müssen nur auf ihre Kuhfladen aufpassen, die wie schwarze Löcher im Gras liegen. Beim Drüberspringen stinkt es kurz. Dann noch einmal Stacheldraht, ein Streifen nackter Erde und dann bin ich zu Hause.
Von vorn sieht es ganz normal aus. Dass es halb aus Glas ist, sieht man nur von hinten. Wir gehen immer hinten rum, durch das Loch in der Gartenhecke, weil da der Kirschbaum steht. Lea und Gideon bücken sich und sammeln ein paar ein. Ich mag sie nicht, sie haben immer braune Stellen. Gideon spuckt die Kerne so weit er kann, Lea fängt ihre in der hohlen Hand.
Klaus sitzt schon vor dem Fernseher, das blassblaue Licht füllt das ganze Haus. Wie ein Aquarium sieht es aus. Wir klopfen und Klaus kommt langsam wie ein halb toter Fisch zur Terrassentür.
»Gutn Abend, Herr Kühn«, Lea geht immer ein bisschen in die Knie, wenn sie Erwachsene begrüßt.
»Habn Sie was geschossn?«, fragt Gideon.
Klaus nickt und geht zur Küche, holt etwas aus dem Kühlschrank. Das können wir alles von draußen sehen, weil es im Glashaus keine Wände gibt, nicht in der unteren Etage. Er gibt Lea die Plastiktüte und ich schaue nicht schnell genug weg und sehe ein schönes schwarzes Auge in rohem rosa Fleisch aufblitzen.
Ich drücke mich an Klaus vorbei ins Haus, damit sie nicht sehen, dass ich weine.
»Danke«, höre ich Lea sagen, und Gideon fragt nach Hanna. Klaus hat sie nicht gesehen. Er wünscht den beiden eine gesegnete Nacht und Lea und Gideon kriechen mit ihrem toten Hasen durch die Hecke. Klaus setzt sich zu mir vor den Fernseher.
Der Tierfilm hat angefangen. Alle Zebrafische sind im Larvenstadium vollkommen transparent, und unter bestimmten Bedingungen bleiben sie auch im Erwachsenenalter durchsichtig. Wenn sie nicht vorher sterben. Ich muss schon wieder weinen und Klaus legt eine Hand auf mein Knie.
Das hat er noch nie gemacht. Er berührt überhaupt nie jemanden.
Wenn ich in Welsum ankomme, schüttelt er meine Hand, als wäre ich ein Erwachsener, und das macht er noch mal, wenn ich wieder fahre. Dazwischen berührt er mich nicht. Nie.
Jetzt liegt seine Hand auf meinem Knie und bewegt sogar den Daumen hin und her. Und dann sagt er, leise und ein bisschen heiser: »Hier in Welsum ist noch keiner verloren gegangen, Benjamin.«
Als er das sagt, weiß ich, dass ich gar nicht um den Hasen weine, sondern um Hanna. Ich bin sicher, dass sie tot ist. Und ich bin sicher, dass Klaus wirklich mein Vater ist. Renée hat doch nicht gelogen und mich einfach zu irgendeinem Freund geschickt, um mich mal loszuwerden. Er ist mein Vater, auch wenn wir uns überhaupt nicht ähnlichsehen, denn er kann in meinen Kopf hineinschauen und meine Gedanken aufräumen wie sonst nur Renée. Denn du wobst mich in meiner Mutter Leib und gabst mir meinen Namen: Benjamin. Das heißt geliebter Sohn.
Auch wenn in seinem Kirschbaum keine Spiegel hängen und er mich nie fragt, wo ich hingehe, mich nie anfasst, mich nicht mal richtig anschaut, sondern immer nur so an mir vorbeiguckt, auch jetzt.
Jeden Abend nach dem Tierfilm ruft Renée an. Und jeden Abend frage ich sie, ob sie sich genug erholt hat und ich nach Hause darf. Heute nicht. Heute stehe ich mit dem Telefonhörer in der Hand da und schaue zu Klaus, der vor dem Fernseher sitzt, und sage: »Ja, gut. Alles gut.«
Renée sagt nichts dazu, aber ich kann hören, dass sie lächelt.
Vielleicht erholt sie sich jetzt schneller.
In the Cold, Cold Night
Heute standen statt Kühen Einfamilienhäuser auf der Weide und aus den matschigen Reifenspuren, die zum Glashaus geführt hatten, war eine asphaltierte Straße geworden, mit Gehsteig zu beiden Seiten und Laternen, deren Licht sich im gewachsten Lack der parkenden Autos spiegelte. Und entlang der Straße ein neues Haus nach dem anderen, und in allen Häusern Licht, in den Erdgeschossfenstern. Sieben Uhr, Abendbrot, o Gott, von dem wir alles haben. Und der Wald schwarz und schweigend, weil kein Wind wehte. Es wären auch gar keine Blätter an den Zweigen gewesen, die hätten rauschen können. Das Rauschen war allein in meinen Ohren. Ich nahm – bestimmt zum hundertsten Mal – den Kopfhörer ab, steckte mir die Spitzen meiner kleinen Finger in die Ohren, rüttelte, hüpfte kurz auf dem einen, dann auf dem anderen Bein, als hätte ich Wasser in den Ohren und nicht das Echo von imaginären Schüssen.
Ich war überzeugt gewesen, dass das Rauschen aufhören würde, sobald ich aus dem Bus stieg. Beide Füße auf Gottes festem Grund. Doch es rauschte weiter. Denn hat Er nicht gesagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. (Ja, der junge Mann kennt seine Bibel.)
Ich setzte meinen Kopfhörer wieder auf und ging weiter.
Ich hatte nicht angerufen. Klaus’ vierstellige Telefonnummer, die ich in einem anderen Leben auswendig gelernt hatte, stimmte sicher nicht mehr, und ich hatte auch nicht versucht, seine neue Nummer herauszufinden. Früher hatte Renée meine Besuche hier mit ihm abgesprochen, und seit ich nicht mehr kam, hatten wir uns nur noch geschrieben. Früher Postkarten, heute E-Mails, zweimal im Jahr, Geburtstag und Weihnachten. Gottes Segen und frohes Fest, fünfundzwanzig Jahre lang. Ein einziges Mal – als Renée gestorben war – hatten wir uns außer der Reihe geschrieben. Telefoniert hatten wir nie.
Die neuen Häuser, das sah ich, während ich langsam weiterging, waren längst nicht mehr neu, da waren Rostreste unter Regenrinnen, abgeplatzter Putz. Nur die Haustüren sahen überall neu aus, fast alle hatten schwere Sicherheitstüren aus Metall und dicken Glassteinen, die überhaupt nicht zu den pastellfarbenen Häuschen passten.
Im letzten Sommer, den ich hier verbracht hatte, waren das noch türlose Rohbauten gewesen. Wenn man sich an die Wände lehnte, kam es kühl durchs T-Shirt. Und in der Ecke neben Lollis Isomatte lag der blaue Müllsack mit Hannas rotem BH. Und Lolli öffnet Bierflaschen an seinen Augenbrauen – wirklich? – und ich trinke, obwohl es meinen Mund austrocknet wie Angst. Wenn es dunkel wurde, mussten wir rennen. In Welsum dürfen Jungs fast alles, aber nicht draußen sein, wenn die Sonne untergeht. Meine Muskeln hatten das nicht vergessen, ich merkte, wie ich immer schneller ging und schließlich fast rannte. Auf kurzen Kinderbeinen und mit pochendem Herzen, als könnte ich den Anschluss verlieren und nicht mehr nach Hause finden.
Der Gehweg endete in einem großen, unförmigen Asphaltflecken, beleuchtet von einer letzten Laterne. Das Glashaus stand immer noch allein vor dem Wald. Von vorn sah es genauso aus wie die anderen Häuser: blassgrau gestrichener Putz, eine neue Sicherheitshaustür, Halbgardinen in den Fenstern. Aber kein Licht. Und kein Auto vor der Tür.
Ein grelles Außenlicht ging an, als ich an die Tür trat, und ich zuckte zusammen – einen Bewegungsmelder hatte ich nicht erwartet. In meinen ersten Sommern hier war das Glashaus nicht einmal an die Kanalisation angeschlossen gewesen, da hatte es eine Grube neben dem Haus gegeben und einmal in der Woche war der Saugtankwagen gekommen. Ich hatte drinnen gestanden, hinter der Glaswand, und dem Mann gewinkt, der den Schlauch anschloss. Er winkte zurück und wir hielten beide den Mund fest geschlossen, der Gestank klebte sonst tagelang auf der Zunge. Oder war ich da hineingefallen?
Jetzt roch es nur nach Wald, feuchtem Wald. Ich setzte meinen Kopfhörer ab, wartete, bis das Rauschen, das im ersten Moment der Stille immer anschwoll, wieder etwas abebbte, und klingelte.
Niemand kam. Es ging auch kein Licht an. Ich klingelte noch einmal und legte mein Ohr an die Tür, aber sie war viel zu dick, um etwas dahinter zu hören.
Was hast du denn erwartet?
Dass Frau Gothel die Tür aufreißt und über die Schulter zu Klaus ruft: »Der Junge is da«? Dass Klaus kommt, dir zunickt, ohne dich anzusehen, kurz und geschäftsmäßig deine Hand schüttelt, dich hereinlässt, als wärst du hier zu Hause, und dich nichts fragt, weil er nie Fragen stellt?
Benni, du Blödmann.
Auf der Fahrt hierher, zwischen Dortmund und Hagen, war mir kurz der Gedanke gekommen, dass auch in Welsum fünfundzwanzig Jahre vergangen sein könnten, dass Frau Gothel vielleicht nicht mehr lebte, Klaus möglicherweise gebrechlich oder krank war und mich gar nicht bei sich aufnehmen könnte. Aber als ich dann in die Regionalbahn nach Iserlohn gestiegen war und hinter den Zugfenstern die ersten kleinen Siedlungen sah, zwischen den jetzt im Winter grauen Hügeln und kahlen Wäldchen, war die Unruhe von mir abgefallen. In Welsum lief die Zeit anders. Ich würde ankommen und Frau Gothel würde uns Fischstäbchen braten und mein Bett beziehen, und nach Tagesschau und Tierfilm mit Klaus würde ich hinauf in mein altes Zimmer gehen, mich unter das Walposter legen, meine Augen schließen und einschlafen. Schnell und ohne Angst. Denn selbst wenn ich starb in der Nacht, war ich doch nicht allein.
Das hatten sie auch im Krankenhaus gesagt: Ich sollte in den nächsten Tagen möglichst nicht allein sein. Nicht wegen des gebrochenen Arms, sondern wegen des psychischen Traumas.
»Das wird Sie erst in ein paar Stunden oder Tagen so richtig treffen«, hatte die Ärztin gesagt. »Leben Sie allein?«
Ich hatte Nein gesagt, ohne zu zögern, und es war nicht gelogen, denn Vicky würde in ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen zurückkommen. Müssen. Es war schließlich ihre Wohnung. Aber als ich dann zu Hause war, allein, und das Rauschen in meinen Ohren immer dichter wurde, sodass selbst Musik nicht dagegen ankam und ich fürchtete, taub zu werden oder zu sterben, da wusste ich, dass ich es keinen einzigen Tag allein aushalten würde. Und schon gar keine Nacht. Ich musste nicht nachdenken, wohin ich flüchten sollte: Ich hatte eine Fahrkarte nach Welsum gekauft, ohne Rückfahrt, meinen Rucksack gepackt und war in den Zug gestiegen.
Und jetzt stand ich hier und klingelte das dritte Mal, wie im Märchen, und niemand öffnete mir.
Vielleicht war Klaus gerade im Wald, jagen. Füchse und Hasen haben nie Schonzeit.
Ich holte mein Telefon heraus, um ihn anzurufen, aber selbst wenn die Nummer noch gültig gewesen wäre – ich hatte keinen Empfang. Oder er saß doch im Haus und hörte die Klingel nur nicht, weil er den Fernseher so laut gestellt hatte.
Ich schaltete die Taschenlampe an meinem Telefon ein und ging durch den Wald, an der Hecke, die den Garten umschloss, entlang um das Haus herum. Das grelle Licht verwandelte die Hecke in eine Wand aus silbrigen Flecken. Sie war höher geworden, oder ich war nicht gewachsen. Das Loch gab es noch, aber das war sehr viel kleiner als früher, ich musste meinen Rucksack absetzen und mich so tief bücken, dass ich fast auf allen vieren ging. Die Zweige schoben mir beinah die Mütze vom Kopf und ich stieß mit der nackten Stirn gegen Metall.
Ein Zaun, ein grüner, engmaschiger Metallzaun, der innen an der ganzen Hecke entlang verlief, die Pfosten oben nach innen umgebogen wie bei einem Zoogehege. Den hatte es früher nicht gegeben. Ich machte das Licht am Telefon aus und wartete, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Wenn irgendwo im Haus Licht brannte, müsste ich es jetzt sehen können. Die gesamte Rückwand und die Dachschräge bestanden aus riesigen Glasplatten, die mit großen silbernen Nieten an einem Metallgerüst befestigt waren, das man allerdings nur von Nahem sah. Im Sommer konnte man die Glaswand weit durch den Wald blinken sehen, so gleißend hell, dass man die Augen zukneifen musste, und wenn die Sonne tief stand, sah man nur eine leuchtende Wand. Wenn aber der Himmel bedeckt war, oder jetzt im Dunkeln, sah man alles dahinter. Das Glashaus war, solange nur irgendwo ein bisschen Licht brannte, ein Aquarium, und es gab kaum Verstecke. Abgesehen vom Windfang hinter der Eingangstür war das Erdgeschoss ein einziger offener Raum. Das Obergeschoss war nur etwa halb so groß wie das untere, sodass der Raum durch die enorme Höhe noch etwas größer wirkte und man sich noch etwas ausgestellter fühlte. Die Küche war nur durch eine Theke vom Rest abgeteilt. Vor der Glaswand stand der riesige Esstisch, dahinter war die Wendeltreppe, die zur Galerie führte, an der die Zimmer des Obergeschosses lagen. Die einzigen Zimmer, die Türen hatten. Klaus’ Arbeits- und Schlafzimmer, das Bad und mein Zimmer. Aber selbst wenn man sich darin versteckte, wussten die Augen im Wald doch, wo man war, denn jedes noch so kleine Licht sickerte unter der Tür hindurch auf die Galerie hinaus. Sicher war man nur, wenn man es vor der Dunkelheit ins Zimmer schaffte und dort kein Licht machte bis zum Morgen.
Bei Klaus war immer Licht gewesen: ein elektrisch blauer Streifen, der weit in den Wald leuchtete.
Ich rieb meine Stirn und starrte durch den Zaun aufs Haus: Die Glaswand wie flüssiges Schwarz. Er war wirklich nicht da.
Ich ging zurück nach vorn, stand eine Weile unschlüssig herum und setzte mich schließlich auf die Stufe vor der Haustür. In den Nachbarhäusern leuchteten jetzt die Fenster in den oberen Etagen. Hier und da gab es Bewegungen hinter Vorhängen, irgendwo spielte jemand Blockflöte. Ich setzte meinen Kopfhörer auf und wartete. Ging das Außenlicht aus, hob ich meinen Gipsarm und schaltete es wieder an. I hope this song will guide you home.
Natürlich fing es an zu regnen, so sehr, dass ich irgendwann aufstehen und mich dicht vor die Haustür stellen musste, um einigermaßen trocken zu bleiben. Und dann ging auch noch die Musik aus. Erst die Blockflöte, dann die in meinem Kopfhörer. Mein Telefonakku war leer.
Vicky hätte laut gelacht. Ich hätte es gern gehört. Doch ich hörte nur Rauschen in meinen Ohren – oder war das der Wind? Jetzt flogen die Regentropfen auch unter das Vordach, in mein Gesicht, auf meinen viel zu dünnen Parka. Eins nach dem anderen gingen die Lichter in den Häusern aus. Ich stand mit meinem nutzlosen Telefon in der Hand da und fror. Meine Füße kalt und nass in den nutzlosen Turnschuhen. Als die Außenlampe wieder ausging, schaltete ich sie nicht wieder an. Ich hielt ganz still und schaute auf das schwache, vom Regen zitternde Licht, das von der Straßenlaterne auf den Asphaltfleck vor dem Haus fiel.
Maximale Tauchtiefe.
Wenn nötig, kann ein Belugawal bis zu siebenhundert Meter tief tauchen.
Fridolins Becken war acht Meter tief gewesen, aber immer hatte der kleine weiße Wal gegrinst, wenn er auftauchte. Auf und ab und auf und jedes Mal, wenn er hochkam, schwappte sein stinkendes Wasser über den Beckenrand auf meine neuen Turnschuhe. Hier in Welsum waren meine Schuhe immer nutzlos gewesen. Wenn ich abends die nassen Socken auszog, juckten meine Füße und die Turnschuhe waren am nächsten Morgen immer noch feucht und stanken nach Fisch. Das ging nie wieder weg – zurück zu Hause musste Renée sie wegwerfen.
»Entschuldigung? Hallo?«
Ich schreckte aus meinen Gedanken auf: Da stand ein Kind im Licht der Straßenlaterne, ein dickes Kind in einem roten Plastikmantel und gelben Gummistiefeln.
»Hallo«, ich machte einen Schritt auf das Kind zu und die Außenlampe ging an: »Bist du ganz allein hier draußen?«
»Schhh!«, das Kind zischte und strich über seinen enormen Bauch. Da sprangen die Druckknöpfe auf und etwas fiel heraus. Erst eine Mütze, dann ein Schrei, dann ein winziger Kopf. Das Kind fing ihn in seiner großen Hand auf und zischte leise und wippte von einem Fuß auf den anderen, es sah ein bisschen aus wie tanzen.
Ich ging hin und hob die Mütze auf.
»Danke«, sagte das Kind, das von Nahem eine Mutter war. Sie lächelte und setzte ihrem Baby die Mütze wieder auf, ohne das Zischen und Wippen zu unterbrechen. Dann starrte sie mich an.
Starrte, wie alle in Welsum starren, wenn sie einen Fremden sehen.
Plötzlich lachte sie leise, schüttelte den Kopf und sagte: »Benni.«
Es war keine Frage, sie wusste, wer ich war. Sie schob ihre Kapuze nach hinten und wartete, dass ich sie ebenfalls erkannte.
Ganz kurz fiel mir das Atmen schwer. Hanna.
Hanna, wenn sie alt geworden wäre.
»Lea«, sagte ich und es klang, als wäre ich gerannt.
Als Kinder waren sie sich ähnlich gewesen wie Spiegelbilder, aber trotzdem verwechselte sie nie jemand. Lea lächelte immer, Hanna fast nie, und wenn, dann schief, mit nur einem Mundwinkel.
Als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, hatte sie mir eine Ohrfeige gegeben. Und dann ohne ein Lächeln gesagt: »Geh nach Haus, Benni, und komm bloß nich wieder.«
Jetzt konnte sie nicht aufhören zu strahlen und meinen Arm zu streicheln: »Benni! Wie schön, Benni, wie schön!«
Dabei spürte sie den Gips unter meinem feuchten Ärmel und sah mich an: »Was is denn da passiert?«
Ich schaute auf meine Hand, als müsste ich mich selbst erst wieder daran erinnern.
»Ach so, ich bin gestolpert.«
»Ach je, Elle oder Speiche oder beides?«
»Speiche.«
»Mein Ältester hatte ma beides, aber an der rechtn Hand. Konnte seine Abiturprüfung nich schreibn deswegn. Immerhin is bei dir links.«
»Ja, nur leider bin ich Linkshänder.«
Lea lachte laut und das Baby unter ihrem Mantel fing sofort an zu schreien und zu strampeln. Sofort begann Lea zischend im Kreis zu laufen, immer um mich herum, bei jedem Schritt tief in die Knie gehend. Als das Schreien fast abgeebbt war, flüsterte sie: »Is dir nich kalt?«
Es dauerte, bis ich verstand, dass sie mich meinte.
»Geht schon«, flüsterte ich zurück. Meine Sachen waren inzwischen so nass, als wäre ich damit in den Waldsee gefallen.
»Wills du bei mir wartn? Das dauert noch ne Weile, bis Klaus kommt, der is beim Stammtisch.«
»Beim Stammtisch?«
»Vom Verein, weiß du nich mehr?«
»Doch, doch, klar«, ich erinnerte mich dunkel an einen realen Tisch, Gideon und ich hatten ein paarmal darunter gesessen, eine düstere Höhle mit einer Decke aus rohem Eichenholz und Wänden aus Hosenbeinen mit scharf gebügelten Falten. Auf dem Boden blinkten wie feuchte Kiesel die geputzten Schuhe der alten Männer. Nie mehr als drei oder vier Paar. Manchmal blieb der Alte, Gideons Großvater, der den Verein gegründet hatte, auch allein. Dann durften wir unter dem Tisch hervorkommen und Bier probieren. Ob wir wollten oder nicht. Das war der Stammtisch gewesen.
Aber Klaus war dort nie hingegangen.
»Doch, schon ganz lang«, sagte Lea, »der is seit fast zehn Jahrn unser Vorstand, zusamm mit Gideon.«
»Gideon ist auch dabei?«
»Fast alle sind dabei. Wir sind ne richtige Institution. Nich nur hier in der Gegnd. Mit dem Internet hat man da ja heute auch noch ganz andere Reichweite.«
Ich versuchte, beeindruckt auszusehen und mich zu erinnern, was genau der Verein überhaupt gemacht hatte. Mir fiel das Schild ein, mit dem der Alte zu den Krankenhäusern in den umliegenden Städten gefahren war. Der Sünde Sold ist der Tod.
»Klaus geht auf Demos? Mit Gideon?«
Lea lachte: »Nee. Demos machn wir kaum noch, eher andere Aktionen. Vor allm Waldschutz. Deshalb heißn wir jetzt auch Verein zum Schutz allen Lebens.«
»Wir? Du machst auch mit?«
»Ja, aber ich mach hauptsächlich online. Zum Stammtisch schaff ich fast nie. Mit fünf Kindern.«
»Fünf?« Es war die Reaktion, die sie sich gewünscht hatte.
»Ja, ich weiß«, sie strahlte. »Und du?«
Ich schüttelte den Kopf: »Gar keine.« (Ein Herz ist noch kein Kind.)
»Na, was nich is«, Lea lächelte. »Aber dir is doch kalt, du zitters ja! Komm, du kanns bei mir im Warm wartn. Und ich finde bestimmt auch ne trockene Jacke für dich.«
»Schon gut«, sagte ich, »bis wir bei euch sind, ist Klaus doch garantiert zurück. Außerdem habe ich nur Turnschuhe an, damit jetzt noch durch den Wald –«
»Ich wohn doch nich mehr bei Vati!«
Lea lachte, lauter als vorher, aber das Baby schlief zu tief.
Vati. Lea war die Einzige der drei, die ihren Großvater so genannt hatte. Für Hanna und Gideon war er immer nur der Alte gewesen.
»Ich hab fünf Kinder, Benni, ich hab mein eigenes Haus. Da«, sie zeigte den Weg hinunter, »das erste in der Reihe. Jetzt komm. Vergiss dein Rucksack nich!«
Ein Herbstlaubkranz an der Haustür, ein kleiner Fisch über dem Klingelschild, eine schwarze Porzellankatze im einzigen schwach erleuchteten Fenster.
»Wo sind denn alle deine Kinder?«
»Na, die schlafn hoffntlich. Deshalb müssn wir auch ganz leise sein.«
Lea stieg aus ihren Gummistiefeln, bevor sie die Haustür aufsperrte. Ich folgte ihr hinein und nahm meinen Rucksack ab. »Ich bring ebn Debbie ins Bett«, flüsterte Lea und stieg, im tropfenden Regenmantel und ohne Licht zu machen, eine Treppe hinauf. Oben brannte ein halbmondförmiges Nachtlicht und ich sah, wie eine kleine Hand aus Leas Schatten herauswuchs und den Mond zu berühren versuchte. Lea flüsterte, und eine kleine Stimme flüsterte zurück. Dann verschwanden sie und alles wurde still. So still, dass ich das Rauschen in meinen Ohren wieder klar und deutlich hören konnte. Ich zog meinen klatschnassen Parka aus und wollte ihn aufhängen, da sah ich zwei nackte Kinderfüße auf der kleinen Bank unter der Garderobe stehen, die Zehen in die Sitzpolster gekrallt. Unter einem dick wattierten Mantel schnaufendes Atmen.
»Keine Angst«, flüsterte ich, »ich …«
»Nichts sagn!«, zischte das Kind aus dem Mantel und kurz darauf ging in der ersten Etage Licht an und Lea kam herunter, auf dem Arm das Baby, das kein Baby mehr war, und hellwach. Lea schüttelte es leicht, als sie vor mir standen: »Das is echt eine Qual mit dir.«
Das Kind starrte mich an. Es hatte verstrubbelte schwarze Zöpfe und einen schiefen Pony. Lea versuchte, es abzusetzen, aber das kleine Mädchen zog die Beine an, als wäre der Boden Lava.
»Jetz geh runter, Deborah!« Lea versuchte, die Hände des Mädchens von ihrem Pullover zu lösen, doch sobald sie eine Hand von ihrem Pullover abbekommen hatte, krallte sie sich sofort wieder fest. Schließlich ging Lea in die Knie, beugte sich so weit vor, dass Deborah mit dem Rücken auf dem Boden lag, und drückte ihr fest auf die Brust. Deborah sah aus, als wollte sie schreien, aber plötzlich lachte sie und zeigte auf die nackten Füße auf der kleinen Bank: »Da! Da! Vid!«
Lea sah die Füße und ihr Gesicht wurde hart.
»Raus«, sagte sie, »sofort.«
Aus dem Mantel trat ein Junge, auch er älter, als ich erwartet hatte. Er trug einen etwas zu großen roten Schlafanzug mit einem blauen Auto auf der Brust. Deborah sprang auf und wollte ihn umarmen. Der Junge rührte sich nicht. Er schaute nur ängstlich auf Lea. Die zeigte mit starrem Gesicht wortlos zur Treppe und David machte Deborah von sich los und stieg von der Bank. Dabei rutschte das Polster herunter. Er hob es hastig auf und wollte es zurücklegen, unter die Mäntel, aber wir hatten alle den dunklen Fleck gesehen. Lea nahm das Polster und drückte es dem Jungen in die Hand, so fest, dass er dabei etwas zurückstolperte.
»Auswaschn. Und deine Hose auch.«
Der Junge nickte, Tränen in den Augen, und lief, das nasse Polster an die Brust gedrückt, an uns vorbei die Treppe hinauf.
»Vid! Vid!« Deborah wollte ihm nach, aber Lea packte sie. Deborah strampelte und traf Lea am Knie.
»Au, spinns du?« Lea stieß das Mädchen von sich weg, dass es rücklings hinfiel. Deborahs Kopf schlug mit einem dumpfen, aber deutlichen Knall auf den Steinboden. Zuerst kam kein Geräusch aus ihrem weit aufgerissenen Mund, und Lea sah entsetzt auf ihr Kind und wollte sich gerade neben sie hinknien, da kam der Schrei. So schrill, dass ich mir beinah die Ohren zugehalten hätte. Lea tat es. Sie hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu und schloss die Augen.
Der Schrei brach plötzlich ab, Deborah hustete, dann kam aus ihrem Mund ein ganz eigenartiges Geräusch und danach gar nichts mehr. Die Stille so dicht, dass mein Rauschen darin unterging. Deborahs Augen zuckten unruhig von mir zu Lea. Um den stummen, weit offenen Mund in dem nassen roten Gesichtchen bildete sich ein weißes Dreieck, das mir mehr Angst machte als jeder Schuss.
»Sie kriegt keine Luft mehr!« Ich schrie es, damit Lea mich hörte. Aber Lea nickte nur, hielt die Augen weiter geschlossen, die Ohren zu.
Mach was, Benni, mach was.
Ich kniete mich neben das Mädchen, schob meine unverletzte Hand unter seinen Rücken, legte die eingegipste auf seine Brust und richtete es vorsichtig auf, bis sein Oberkörper in der eingegipsten Hand ruhte und ich mit meiner gesunden Hand auf seinen Rücken klopfen konnte, vorsichtig, ganz vorsichtig.
Deborah würgte und dann landete auf meiner Jeans ein Schwall saurer Milch.
»Alles gut, das macht nichts, das macht gar nichts.«
Ich streichelte über den winzigen Rücken, der Stoff klebte auf der feuchten Haut und ich konnte deutlich die winzigen Rippen spüren und unter den Rippen ein klopfendes Herz.
(Ein Herz ist ein Mensch.)
»Alles gut, alles gut.« Das winzige Gewicht ihres Oberkörpers in meiner eingegipsten Hand. Ich konnte mich nicht erinnern, mich je so gut gefühlt zu haben. Bis Lea Deborah aufhob, an sich riss und mich ansah, als hätte ich einen nicht wiedergutzumachenden Fehler begangen.
»Klaus sollte jetzt zu Haus sein«, sagte sie, und damit ich verstand, dass sie mich rauswarf, öffnete sie mir, mit Deborah auf dem Arm, die Haustür.
Ich nahm meinen Parka. Die nassen Ärmel klebten innen zusammen, sodass ich meinen Gipsarm nicht gleich hindurchbekam. Ich schüttelte meine Arme und mein Telefon fiel aus der Tasche auf den Boden. Ich hob es auf und fühlte einen Sprung im Glas des Bildschirms. Ich wollte ihn mir genauer anschauen, aber Lea sagte: »Ich muss jetz wirklich Debbie ins Bett kriegn.«(Geh nach Haus, Benni, und komm bloß nicht wieder.)
Ich steckte das kaputte Telefon ein, nahm meinen Rucksack und ging.
Ich war noch nicht an ihrem Vorgarten vorbei, als Lea mir nachgelaufen kam. Ohne Jacke und nur in Strümpfen. »Warte, Benni? Warte!«
Sie hielt ihren langen Rock hoch, damit der Saum nicht durch die Pfützen schleifte. Es regnete noch immer und ihr Pullover war schnell so feucht, dass ich darunter deutlich die Form ihrer Brust sehen konnte.
»Hier«, Lea gab mir einen Schlüssel, an dem ein kleiner Plastikwal hing, »falls Klaus doch noch nich da is.«
»Danke.«
»Aber wenn du dich reinlässt, schreib ihm nen Zettel, den er auch sieht, sons denkt er noch werweißwas. Und du kanns ihm sagn, ich hol den Schlüssl gleich morgn wieder ab. Er mag das nich, wenn keiner den hat. Und wenn du Lust has, könn wir ja dann noch ne Runde spaziern gehn. Du bleibs doch ne Weile, oder?«
»Ja, klar.«
»Im Wald is Debbie auch immer ganz ruhig.«
Sie schaute zurück zum Haus, wo in der offenen Tür in einem hellen Rechteck ein kleiner Schatten stand. Dann umarmte sie mich. Vor langer, langer Zeit waren ihre Brustwarzen genau auf der Höhe meines Schlüsselbeins gewesen. Jetzt lag da ihr Kinn. Trotzdem fühlte es sich nicht an, als wäre sie geschrumpft, wie das Loch in der Hecke – nein, diesmal war ich gewachsen.
»Schön, dass du wieder da bist, Benni. Wirklich schön. Wirklich.«
Sie drückte mich noch einmal sehr fest.
»Gesegnete Nacht.«
»Danke.«
Ich sah zu, wie sie zurück zum Haus ging, den kleinen Schatten aufhob und das helle Rechteck um die beiden herum zu einem immer schmaleren Streifen wurde und verschwand.
First We Take Manhattan
Auf dem Asphaltfleck parkten jetzt drei Autos, aber im Glashaus brannte immer noch kein Licht. Ich steckte den Schlüssel ins Schloss. Mein Gips war an den Rändern aufgeweicht und wenn ich die Finger bewegte, gab er nach. Als ich den Schlüssel drehte, knackte es. Also versuchte ich es mit rechts. Es war überraschend schwierig.
Ich zog den Schlüssel heraus, steckte ihn andersherum ins Schloss, zog an der Tür, lehnte mich dagegen, mit meinem ganzen Gewicht – und wäre beinah hineingestolpert, als sie plötzlich aufging. Im halbdunklen Windfang dahinter stand ein großer Mann, mit etwas Glänzendem in seiner Hand.
»Das is kein Spielzeuch.«
Es war eine Pistole, und der Mann, der damit auf mich zielte, war Klaus.
Seine Stimme klang dünn, verwaschen, fast ein bisschen wie Renée, ganz am Ende, als sie nur noch weiße Flusen auf dem Kopf gehabt hatte und ihren Kaffee aus Schnabeltassen trinken musste, weil sie zu sehr zitterte. Klaus’ Hand war ganz ruhig, er zielte mit der Pistole auf meine Brust und sah mir nicht in die Augen, sondern auf meine Stirn. Wie früher. (Er kann das nicht, bei niemandem, Benji, nicht nur bei dir.) Er sah auch aus wie früher. Ein schöner Mann, hatte Renée immer gesagt, beeindruckend groß. Das war er immer noch, beides. Vor ihm war ich nicht gewachsen. Ein bisschen älter sah er aus, sein Gesicht etwas schärfer gezeichnet, die Haare eher weiß als grau, aber immer noch dicht und ein wenig zerwühlt, als hätte er gerade geschlafen.
»Du has dir das falsche Haus ausgesucht.«
Was hast du erwartet? Dass er dich sofort erkennt? Offene Türen, offene Arme? Bringt das beste Gewand heraus für meinen Sohn und gute Schuhe, endlich gute, feste, wasserdichte Schuhe?
Du warst vierzehn, als er dich das letzte Mal gesehen hat, jetzt bist du vierzig, Blödmann.
Als ich meinen Namen sagte, klang es wie eine Lüge. Seit Renée tot war, hatte mich niemand mehr Benjamin genannt.
»Benjamin«, sagte Klaus und es klang, als wüsste auch er nicht, wer das sein sollte.
Benjamin. Das heißt geliebter Sohn. Er legte die Pistole weg, aber ins Haus ließ er mich immer noch nicht. Er stand nur da und schaute dicht über meinem Kopf ins Nichts.
Ich versuchte zu erklären, weshalb ich da war.
»Ich wollte dich nicht überfallen, aber ich hatte deine Telefonnummer nicht und per E-Mail … das war alles so kurzfristig … aber klar, wenn das jetzt nicht passt bei dir … Ich wusste nur nicht, wo ich sonst unterkommen soll.«
Es klang, als wäre ich schon obdachlos und würde gleich anfangen zu weinen. Aber mittlerweile war ich seit achtunddreißig Stunden wach und in meinen Ohren rauschte es, als stünde ich knietief im Meer. Ich wollte nur irgendwo im Trockenen sitzen. Oder liegen.
»Und wo has du mein Schlüssl her?«
»Von Lea«, ich gab ihm den Schlüssel mit dem Plastikwal, »ich hab sie getroffen, als ich auf dich gewartet habe, und ich war kurz mit bei ihr, weil es so geregnet hat. Sie holt ihn gleich morgen wieder ab, hat sie gesagt.«
Klaus nickte zufrieden und ließ mich endlich hinein. Und nahm mir meinen Rucksack ab, als wäre ich vier. Ich zog meine nassen Schuhe aus. Aus dem Wohnraum kamen leise Stimmen. Ich dachte, es wäre der Fernseher, aber dann hörte ich Schritte und die Windfangtür ging auf.
Ein Mann in meinem Alter starrte mich an. Er war kaum kleiner als Klaus, aber sehr viel schmaler, als hätte er eine lange Krankheit hinter sich. An seinem Kinn klebte ein Pflaster.
»Nee, ne?«, sagte er. »Benni? Ich fass es nich.«
Er breitete die Arme aus, als wollte er mich umarmen, tat es dann aber doch nicht und hielt mich nur an den Schultern fest und schüttelte mich sanft: »Gerade ebn haben wir noch von dir geredet. Wirklich gerade ebn. Du kenns mich doch noch, oder?«
»Doch, klar.«
Ich erkannte die Stimme, den Jungen fand ich nicht in dem knochigen, blassen Gesicht. Seine Augen waren heller als früher, wässrig, wie die vom Alten. Seine Haut war gräulich und wirkte wie zu straff gespannt über den deutlich hervortretenden Wangenknochen. Seine Haare waren grau geworden, aber immer noch erstaunlich dicht und immer noch zu lang für einen Bruder in Christus. Remember me? I used to live for music.
»Gideon.«
Er grinste und der Drachenzahn blitzte kurz auf, immer noch nicht überkront.
»Ich fass es nich, ich fass es nich.« Er half mir aus dem Parka. Als er meinen eingegipsten Unterarm sah, wusste er sofort, was passiert war. Obwohl der vom Regen aufgeweichte Gips aussah, als hätte ich ihn nicht erst seit heute Früh, sondern schon seit Wochen am Arm.
»Is das von gestern? Von dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt? Wir habn da grad ebn noch drüber geredet, du wohns doch da, ne?«
Ich nickte.
»Scheiße«, sagte Gideon noch einmal. »Aber gut, dass du gekomm bis, oder?« Er schaute nickend zu Klaus. Der nickte kurz. »Komm rein, komm rein, wir haben hier noch n paar Leute, die sich freun werdn, dich zu sehn.«
Er schob mich vor sich her in den Wohnraum: »Jetz guckt ma, wer das war zu so später Stund!«
Es brannte nur ein Licht, eine neue Hängelampe, die über dem großen Esstisch schwebte wie etwas Lebendiges, die Aufhängung verschwand, wie der Rest des großen Raumes, im Schatten. Die Gesichter der Männer, die am Tisch saßen, und die kleinen grünen Bierflaschen leuchteten im von Rauchfäden durchzogenen Lichtkegel, es sah aus wie ein altes Gemälde. Vom Wald hinter der gläsernen Wand war nichts zu sehen, da war nur eine glatte schwarze Fläche, die nach oben hin nicht aufzuhören schien.
»Und, kennt ihr den noch?«, fragte Gideon die Männer.
»Komm ma bisschn näher, wir beißn nich … Ach, gerade habn wir noch … Warum has du nich gesagt, dass er kommt, Klaus!«
Sie schüttelten mir die Hand und warteten, dass ich sie erkannte. Ich hätte auch sie kennen müssen, sie hatten alle immer schon hier gelebt, in Welsum verschwindet keiner. Aber ich erinnerte mich nicht. Keiner der Männer war mehr jung, keiner mehr nüchtern, alle waren frisch rasiert. Gideon merkte es und sagte mir ihre Namen, es klang wie ein Auszählreim: »Das sind die Engels, eins, zwei, drei. Nummer vier is zu Haus, die Kinder habn Mumps. Das da is der Sohn vom Reitwein, den kenns du aber nur mit Haarn, und das is Piets Vater.«
Ich nickte, ihn erkannte ich tatsächlich. Bauer Eigendorf, dem hatte früher alles gehört, was nicht Wald war. Der Wald gehörte dem Reitwein, dem alten. Eigendorfs hatte auch die Kuhweide gehört, auf der das Glashaus stand, aber irgendwann waren die Kühe gestorben, alle, innerhalb von vier Wochen. Deckseuche. (Sei froh, dass du nich da wars, Benni, wie das gestunkn hat.)
Danach war er eigentlich kein Bauer mehr, aber sie nannten ihn alle immer noch so. Er zog den letzten freien Stuhl neben sich zurück und sagte: »Setz dich. Aber Mütze nehm wir hier ab.« Als ich das nicht tat, wollte er mir tatsächlich die Mütze vom Kopf ziehen. Ich hielt sie fest, er lachte.
»Na komm, weniger als beim Reitwein wird schon nich drunter sein.«
»Jetz lass doch, sind hier ja nich in der Versammlung.«
Jemand schob mir eine Bierflasche und einen Flaschenöffner über den Tisch. Gideon setzte sich neben mich, ans Ende des Tisches, am anderen Ende nahm Klaus Platz. Vor ihm stand aufgeklappt ein Laptop, den er jetzt wieder anschaltete. Das Bildschirmlicht ließ sein Gesicht so ungesund aussehen wie Gideons. Als ich mein Bier öffnete, bemerkten alle den Gips.
»Was has du denn da gemacht?«, fragte der glatzköpfige Reitwein. Mark, oder Markus, ich erinnerte mich nicht.
»Nichts, ich bin nur blöd gestolpert.«
»Elle oder Speiche?«, fragte einer der Engels, der mir gegenüber saß.
»Speiche.«
»Na, immerhin is es links«, sagte Bauer Eigendorf.
»Benni is Linkshänder«, sagte Gideon und alle lachten. Auch Klaus. (Das macht er nicht, Benni, das kann er nicht.) Es klang falsch und sah auch falsch aus, künstlich, als würde Klaus’ Mund von einer unsichtbaren Hand auseinandergeklappt. Ich hatte Klaus sonst nur manchmal fast lautlos durch die Nase lachen hören, kurze, spöttische Schnaufer.
»Aber so lustig is das einglich nich«, sagte Gideon, »den Arm hat er sich nämich bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt gebrochn. Benni war da mittndrin.«
»Oha.« Die Männer hoben die Augenbrauen und sahen mich erwartungsvoll an.
»Es war kein Anschlag«, sagte ich. Sie nickten und warteten auf mehr.
»Wirklich viel gibt es da auch nicht zu erzählen.«
Ich trank einen Schluck Bier. Sie warteten weiter.
»Ich war nach der Arbeit mit meinem Chef noch einen Glühwein trinken und auf einmal hat etwas geknallt und …«
Bauer Eigendorf half mir: »Da hat er gedacht, dass jemand rumschießt.«
»Ich«, sagte ich, »ich dachte das.«
Ich war sicher gewesen. Absolut sicher. Weil ich, gleich beim ersten Knall, ganz deutlich Klaus vor mir gesehen hatte, auf dem Ansitz, wie er die Büchse runternimmt und lautlos durch die Nase lacht. Bei ihm liegt jedes Stück im Knall.
Ich trank noch einen Schluck.
Keiner fragte, wie der Sohn eines Jägers das Knallen von Feuerwerk mit einem Schuss verwechseln konnte. Sie nickten alle, auch Klaus, und warteten, dass ich weitersprach.
»Ich hab zu meinem Chef gesagt, dass wir besser abhauen sollten und dann …«
Dann waren alle gerannt. Obwohl ich es leise gesagt hatte. Und nur zu Manuel. Und zu dir.
Auch wenn ich dich überhaupt nicht kannte. Ich war dir auf den Fuß getreten, kurz vor dem ersten Knall. »Autsch.« Wie ein Kind, das sich nicht richtig wehgetan hat. Groß warst du, und eine schöne Nase hattest du. Und die gleichen nutzlosen Turnschuhe wie ich. Aber deine waren ganz neu, absolut sauber. Auf der weißen Schuhspitze ganz deutlich der Abdruck meiner Sohle. »Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich kann dir die putzen, ich krieg die wie neu, und wenn nicht, dann bezahl ich die natürlich. Warte, ich geb dir meine Nummer.«
Manuel hatte mich eigenartig angeschaut, aber du hast gelächelt. Das Lächeln so schön und gerade wie die Nase. Genau in dem Moment hatte es geknallt. Nicht direkt bei uns auf dem Marktplatz, sondern ein oder zwei Straßen weiter. Alle sahen sich um. Du hast mich angesehen: »Was war das?« Und ich war ganz sicher gewesen: »Ein Schuss. Das sind Schüsse.«
Ich hatte es gesagt, nicht geschrien. Oder? Trotzdem waren plötzlich alle gerannt. Runter vom Platz, bloß runter vom Platz, zwischen den Buden hindurch, weg von der Musik und den Lichtern und den anderen rennenden Menschen, da ins Haus, nein, nicht das, zu viel Glas, da, die Tür, ich laufe eine Treppe hoch und in einen Flur. Ich höre Manuel hinter mir, aber als ich mich umdrehe, ist keiner da. Der Flur ist lang wie in einem Albtraum, überall Türen, die verschlossen sind. Die allerletzte geht auf, eine ältliche Frau sieht mich an, erst erschrocken, dann erleichtert: »Können Sie helfen?«
Im Zimmer ist ihr Mann dabei, eine der Matratzen vom Doppelbett zu ziehen, um sie vor das Fenster zu lehnen. »Dann können wir Licht machen, im Dunkeln ist es nicht auszuhalten.« Draußen knallt es immer wieder.
Das Haus ist ein Hotel, das ältliche Paar ist für den Weihnachtsmarkt hergekommen. Jetzt sitzen sie auf dem leicht verstaubten Teppich und beten. Ich hole mein Telefon heraus, stelle meinen Status auf In Sicherheit und schreibe an Vicky. Ich liebe dich. Die Nachricht geht nicht raus und mir fällt ein, dass ich versprochen hatte, ihr nicht zu schreiben, solange sie in New York war, sie meldet sich. Ich schicke sie trotzdem noch einmal, und noch einmal. Ich liebe dich. Ich liebe dich.
Nichts kommt bei ihr an. Irgendwann setze ich mich zu den alten Leuten und bete mit. Sie freuen sich, dass der junge Mann seine Bibel so gut kennt. Da hört Gott sicher zuerst hin. Ich bin selber erstaunt, wie viel mir einfällt. Als würde ich in Zungen reden. Herr, lass mich nicht zuschanden werden, neige zu mir dein Ohr und rette mich, du bist mein Schutz, dir befehle ich meinen Geist.
»Gut gemacht«, sagte Bauer Eigendorf und holte mich mit einem Schulterklopfen zurück ins Glashaus, zu den anderen alt gewordenen Jungen, »alle Hilfe kommt vom Herrn.«
»Wars du dann die ganze Nacht da in dem Hotel?«, fragte ein Engels.
»Muss er ja«, sagte ein anderer, »die habn doch ewig gebraucht, weil sie dachtn, da in den Budn hätte sich noch jemand versteckt.«
»Da has du aber ne lange Nacht hinter dir«, sagte der junge Reitwein.
Ich nickte, obwohl es mir nicht so vorgekommen war. Wir hatten gebetet und plötzlich war mein Kopf übervoll gewesen mit Dingen, an die ich seit Jahren nicht gedacht hatte. Marias Pelzmantel, Fridolins ewiges Grinsen, die Zerkarien unter Gideons Haut, getrocknetes Blut an Lollis Augenbraue, Leas Brustwarze an meinem Schlüsselbein. Hannas bierflaschenglasgrüne Augen und ihr roter BH, der Geschmack von Waldseewasser, in dem ich nie geschwommen bin. Ein bisschen wie das Bier, das mit jedem Schluck modriger schmeckte.
»Und wie has du dir dann den Arm gebrochn?«, fragte der junge Reitwein.
»Ich bin gestolpert«, sagte ich, »auf der Treppe, beim Rausgehen.«
»Als alles schon vorbei war?«
Ich nickte wieder.
»O Mann, was für ein Pech.«
Ein paar lachten und dann fingen sie an, darüber zu reden, wie sie die Nacht erlebt hatten.
»Wir habn das ja hier alles im Fernsehn mitgekriegt. Man hat ja bei jedm runtergefallenen Rucksack gedacht, das is ne Bombe.«
»Ich frag mich echt, warum das so lang gedauert hat, bis die da die Kinder gefundn hattn mit ihrn Böllern.«
»Ich frag mich, wo die das Zeug herhattn.«
»Ich frag mich, wo die Mütter von den warn.«
»Ich frag mich gar nichts mehr«, sagte Bauer Eigendorf, »geht doch alles vor die Hunde heute.«
»O ja«, sagte der junge Reitwein. »In Duisburg habn sie letztens die Polizei gerufn, weil sie dachtn, der Hafn brennt. Und was wars? Sonnuntergang.«
»Traurig is das«, sagte der jüngste Engels, »wenn so viel Angst is in der Welt, dass das Abndrot zum Großbrand wird.«
»Aber wenn ich nichts von Schüssen gesagt hätte …«, sagte ich, irritiert, dass ich es aussprach. Meine Schuld, meine große Schuld. Gideon unterbrach mich sofort: »Wenn du nichts gesagt hättes und es wärn Schüsse gewesn, dann wärn richtig viele Menschn gestorbn. So wars nur einer.«
»Kanntes du den?«
»Nein«, sagte ich, und es war nicht gelogen, denn ich kannte nicht einmal deinen Namen.
»Ganz jung war der«, sagte Bauer Eigendorf, »noch keine dreißig.«
»Armer Kerl.«
»Jetz is er beim Herrn.«
Sie senkten die Köpfe und schwiegen kurz, für dich, und kehrten dann allmählich zu dem Gespräch zurück, das sie seit über fünfundzwanzig Jahren jeden zweiten Donnerstagabend beim Vereinsstammtisch führten: Was macht der Wald? Die ungeborenen Kinder? Die Fremden? Im christlichen Abendland herrscht große Hitze. Das setzt besonders der Fichte zu.
Ich wäre gern wie früher unter den Tisch gerutscht, um mit Gideon Kaugummis unter die geputzten Schuhe zu kleben und dann einzudösen. Ich war seit fast neununddreißig Stunden wach. Du warst fast vierundzwanzig Stunden tot. Ich hätte gern meine nassen Socken ausgezogen, meinen Gips trocken geföhnt, mein Gesicht und meine Augen gewaschen, die vom Zigarettenrauch brannten.
Ich schaute blinzelnd zwischen den Engels, die mir gegenübersaßen, hindurch auf die gläserne Rückwand, in der sich die Männer spiegelten, blasse Geister. Mein Blick glitt die Metallstreben hinauf am schwachen Spiegelbild der Zimmertüren oben an der Galerie vorbei zur Dachschräge, die auch aus Glas war.
Es regnete nicht mehr und musste schon vor einer Weile aufgehört haben, denn auf der Glasschräge waren keine Tropfen, die das Bild vom Mond, der durch die Wolken kam, verzerrten.
(Da geht dein Verstand hin, Benni, wenn du ihn verliers.)
Um fünf Uhr Früh war Blaulicht über den Rand der Matratze, die wir vor das Fenster geschoben hatten, geflackert. Das Knallen hatte da schon lang aufgehört und wir wussten, dass es vermutlich nur Kinder gewesen waren. Ich hatte wieder Empfang und alle meine Nachrichten an Vicky waren rausgegangen. Ich stand vom Teppich auf und schaute über den Rand der Matratze nach draußen. Um den Ring aus Weihnachtsmarktbuden stand ein Ring aus Polizeiautos und Krankenwagen. Eine Sanitäterin lief zu dem haushohen Weihnachtsbaum in der Mitte des menschenleeren Platzes und ging in die Knie. Da lag etwas, halb unter dem Baum, ein Haufen Kleider, und ein Arm, eine Hand, auf dem Rücken, die Finger leicht geöffnet.
Mir wurde eng in der Brust. Ich warf die Matratze um und riss das Fenster auf, um besser atmen und besser sehen zu können. In dem Moment hatte das Rauschen angefangen. Nicht besonders laut, ich konnte noch hören, dass die Sanitäterin etwas zu der Polizistin sagte, die mit rot-weißem Plastikband die Lücken zwischen den Buden absperrte. Was sie sagte, verstand ich nicht, aber ich wusste es, denn die Sanitäterin tat gar nichts für den Menschen, der da lag, sie kniete nur da und hielt die verlorene Hand. Die Polizistin knotete erst das Absperrband fest, bevor sie zu der Sanitäterin und dem toten Menschen ging. Unterwegs bückte sie sich und hob etwas auf. Deinen neuen weißen, jetzt vollkommen nutzlosen Turnschuh. Ich wandte mich vom Fenster ab und rannte aus dem Zimmer, auf den Flur, die Treppe hinunter und fiel. Es war wie in tiefes, wildes Wasser fallen. Erst rauschte es laut und immer lauter, dann stolperte mein Herz und dann stolperten meine Füße. Vom Aufprall spürte ich nichts. Als ich zu mir kam, kniete die Sanitäterin von draußen neben mir. Hinter ihr erkannte ich das ältliche Paar, mit dem ich gebetet hatte. Ich wurde auf eine Liege gelegt und ins Krankenhaus gebracht. Von der Fahrt weiß ich nichts mehr, in meiner Erinnerung wurde ich direkt mit der Liege, auf der sie mich transportierten, in die Röhre geschoben. »Durchleuchtet«, wie die Ärztin sagte, um zu sehen, ob bei dem Sturz nichts »durcheinandergekommen« war. Sie redete mit mir wie mit einem Kind. Vielleicht sah ich deshalb, als ich in der Röhre lag und mir vorstellte, was sie sehen würden, zuerst den Wald. Mein Geist ist eine Landkarte voller Bäume. Ein kreisrundes Loch darin, dort liegt der See, und dort hinten ist der Gottesacker. Da das Glashaus, darunter der Bunker (da bist du so sicher, da muss nicht einmal Gott mehr auf dich aufpassen), oben im Norden ist das Meer, auf der Insel habe ich Renée begraben, und auf der anderen, daneben, stirbt ein Wal. Und dahinter? HIC SVNT LEONES. Und über allem hängt der Mond, mein Verstand, in einem tiefen Krater. (Und dann muss du ers ma jemand findn, der ihn für dich zerückholt.)
Diesmal war es Gideon, der mich zurückholte ins Glashaus, er berührte sachte mein Knie und sagte leise meinen Namen.
»Benni? Benni? Aufwachn!«
Ich rieb meine Augen und saß wieder zwischen frisch rasierten, fischäugigen Männern am großen Tisch, roch Zigarettenrauch, schmeckte, dass ich Bier getrunken hatte, und war froh, dass Gideon seine Hand noch etwas länger auf meinem Knie liegen ließ.
»Wir habn grad überlegt«, sagte Gideon, »das, was dir da passiert is, das is ne wichtige Geschichte.«
»Da kann man richtig gut sehn, was grad so alles falsch läuft in der Welt«, sagte der junge Reitwein.
»Deshalb dachten wir«, sagte Gideon, »vielleicht kanns du beim nächstn Stammtisch noch ma erzähln, wenn dann auch alle dabei sind.«
»Ja, klar.«
»Das wäre aber erst in zwei Wochen«, sagte Klaus. »Kannst du so lang bleibn?«
Er sah mich nicht an, als er das fragte.
»Ja, klar, mit meinem Arm kann ich sowieso nicht arbeiten, und wenn das für dich in Ordnung …«
»Gut«, sagte Klaus, klappte den Laptop zu und erhob sich, um die Männer zur Tür zu bringen. Gideon blieb bei mir und gab mir einen Flyer: »Da kanns du nachlesn, was du verpennt has.«
Es war kein zusammengefaltetes, selbst getipptes und viel zu oft kopiertes Flugblättchen wie die vom Alten früher, sondern ein professionell gedruckter Flyer aus dickem Hochglanzpapier, Porträtfotos von Gideon und Klaus, in Anzug und Krawatte. Gottvertrauen und gesunder Menschenverstand.
»Sieht offiziell aus«, sagte ich.
»Was dachtes du denn? Bloß weil wir hier am Küchntisch sitzn? Echte Politik wird immer am Küchntisch gemacht.«
Klaus kam, sehr langsam auf plötzlich wackligen Beinen, zurück in den Raum und sah uns an, als wüsste er nicht, wo er war. Wie Renée, kurz bevor sie ins Hospiz kam.
»Ist er krank?«, fragte ich Gideon flüsternd. Gideon lachte laut: »Der is sternhaglvoll, kanns du das etwa immer noch nich erkenn?«
Klaus drehte sich um, als wollte er zurück zur Haustür gehen. Gideon lief zu ihm und legte einen Arm um ihn: »Nich runter, keine friednsmäßige Nutzung, das weiß du doch. Wir gehn schön nach obn und schlafn in dem richtign Bett, aus dem wir auch wieder aufstehn könn.«
Er führte Klaus die Treppe hinauf und ins Bad. Ich holte meinen Rucksack aus dem Windfang und ging ebenfalls nach oben, in mein Zimmer.
Das Erste, was ich bemerkte, war der Gestank. Ein bisschen modriges Blumenwasser, wie in den Eimern in der Gärtnerei, etwas vom Waldsee im Sommer, und Lolli, als er aus der U-Haft kam. Dann sah ich die Knochen auf dem Bett. Große weiße Rippenbögen, die im Halbdunkel schimmerten wie frisch aus dem Fleisch herausgebrochen.
Ich war sicher, dass ich sie mir einbildete, aus etwas völlig anderem zusammensetzte, ich war fast vierzig Stunden wach und im Zimmer war es dunkel – aber die Knochen blieben auch, als ich Licht machte. Sie wurden nur etwas matter, und gelber. Es war ein ganzes Skelett: ein großer Fisch mit einem kleinen Schädel und einem langen Kiefer.
»Ach nee«, hörte ich Gideon hinter mir stöhnen, »hat er Fridolin wieder hier liegn?«
Er schob sich an mir vorbei und nahm den kleinen Schädel, streichelte ihn und hielt ihn mir hin. »Keine Angst, der beißt immer noch nich.«
Gideon hatte auch den lebendigen Wal ständig gestreichelt. Ich hatte das nie gern gemacht.
»Stinkt noch genauso wie früher«, sagte ich. Gideon lachte. Er legte den Schädel wieder zu dem Skelett, beugte sich über das Bett und öffnete das Fenster dahinter. Bis auf Fridolin war das Zimmer unverändert: derselbe Tisch, derselbe Stuhl, derselbe Kleiderschrank. Das Walposter über dem Bett, die kleine Bibel auf dem Nachtkästchen.
Gideon zog eine große Plastikwanne unter dem Bett hervor und fing an, die Knochen wegzuräumen.
»Sachte! Ganz sachte«, sagte Klaus, der aus dem Bad zu uns herüberkam. Seine Haare waren feucht, seine Lippen bläulich. Als er neben mir stand, spürte ich die Kälte, die von seiner Haut aufstieg. Er stand wieder sicherer, seine Augen waren klar und seine Sprache nur noch leicht verschwommen. Er kniete sich neben Gideon und nahm sehr behutsam einen Knochen vom Bett und legte ihn in die Wanne.
»Warum has du den denn schon wieder rausgeholt?«, fragte Gideon.
»Weil Lea ein Freund hat, der mir eine Leiter und das nötige Werkzeug borgt.«
»Wer? Reiko? Wann?«
»Das müssn wir noch klärn.«
Ich kniete mich zu ihnen und half, auch wenn ich mich vor den spröden, rauen Knochen ekelte.
»Gehören die nicht eigentlich ins Museum?«, fragte ich.
»Nein«, sagte Klaus, »der gehört mir. Hat immer mir gehört, hat der Kessels selbst gesagt.«
»Kessels war der Zoodirektor«, sagte Gideon leise zu mir.
»Ich weiß«, sagte ich.
»Höchstpersönlich hat er mir das Skelett ins Museum gebracht«, sagte Klaus. »Herr Kühn, hat er gesagt, ich mag ihn gefangen haben, aber Ihnen gehört er.«
»Ist das wirklich Fridolin?«, fragte ich, »das sieht alles so klein aus.«
Der lebendige Fridolin hatte mir – auch nachdem ich ihn bestimmt hundertmal gesehen hatte – jedes Mal wieder den Atem verschlagen, wenn ich ihn das erste Mal aus dem Wasser auftauchen sah. Ein massiger weißer Kopf mit absolut gleichgültigen Augen und diesem ewigen Grinsen. Er war so echt und so fremd, dass man selbst sich winzig und unwirklich fühlte vor seinem Becken. Jetzt passten seine modrig riechenden Überreste unter ein schmales Bett. Und das Einzige, was sie in mir auslösten, waren der dringende Wunsch nach frischer Luft und nach einem großen schwarzen Müllsack.
»Da fehln ja auch n paar Hundert Kilo Blubber«, sagte Gideon. »Wenn du tot bis, wirs du auch winzig sein. Viel gewachsn bis du ja nich mehr.«
Ich sagte nichts dazu und räumte weiter Knochen vom Bett. Die Knochen waren überraschend leicht. Auf jedem klebte ein kleiner weißer Aufkleber mit einer Nummer darauf, dessen sauberes Weiß die Knochen noch gelber wirken ließ. Ich dachte daran, wie sie den lebendigen, strahlend weißen Fridolin aus dem Zoo abtransportiert hatten, als das Walarium geschlossen wurde. Wir hatten zugesehen, wie der Kran Fridolin aus dem Wasser gehoben hatte, in einer riesigen blauen Plastikplane, aus der die Schwanzflosse, die es nun nicht mehr gab, herausschaute. Wenn sie schlug, schwankte der ganze Kran.
»Warum ist er überhaupt wieder hier? Ist er nicht damals in irgendein Sea World in Amerika gebracht worden?«
»Irgndwann stirbt jeder«, sagte Gideon. »Das Skelett haben sie dann in Amerika präpariert und der Kessels hat es Klaus fürs Museum geschenkt, und als Klaus in Rente gegang is, hat er ihn mitgenomm.«
Gideon schaute bewundernd auf Klaus und ich begriff, dass sie die Knochen gestohlen hatten.
»Jetz guck nich so, Benni«, sagte Gideon. »Die lagn da eh nur rum. Hier könn wir den richtig aufhäng, obn am Dachgiebl, sodass er überm Esstisch schwimmt. Müssn nur die richtige Leiter finden.«