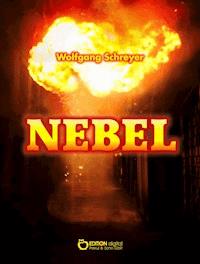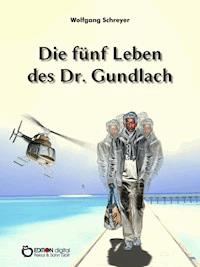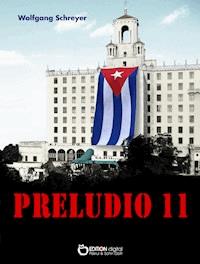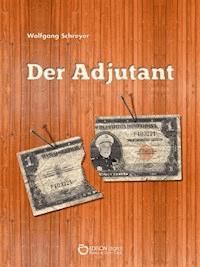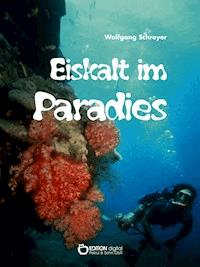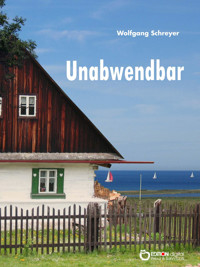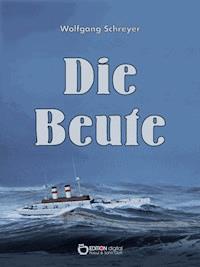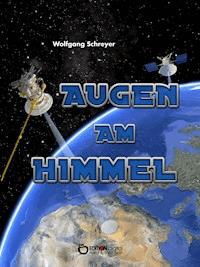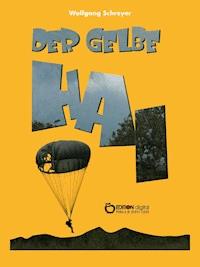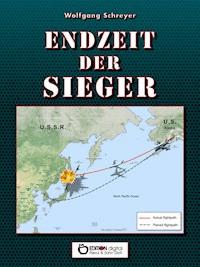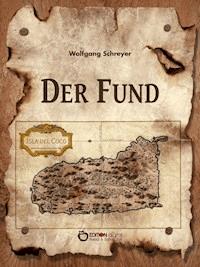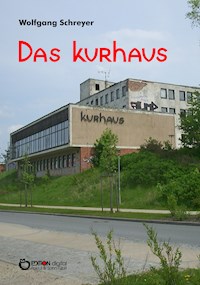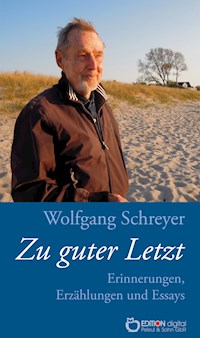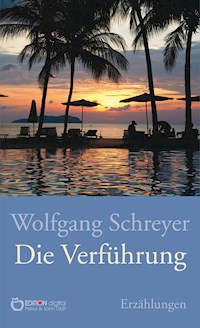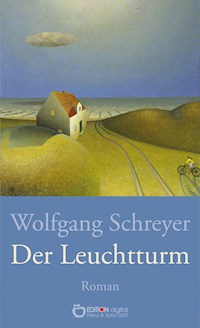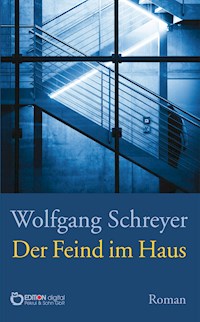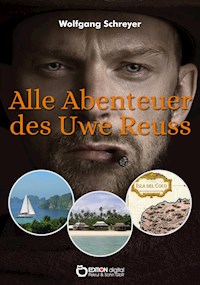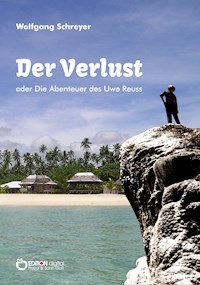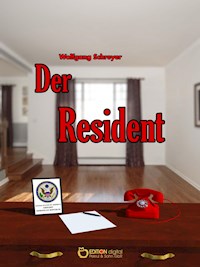
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dominikanische Tragödie
- Sprache: Deutsch
Zwischen 1971 und 1980 veröffentlichte Schreyer, der stets ebenso gut und gründlich recherchierte wie spannend geschriebene abenteuerlich-politische Bücher vorlegte, die drei Bände seiner „Dominikanischen Tragödie“, welche in den 1960er Jahren in der Dominikanischen Republik spielen. Im ersten Band, „Der Adjutant“, dessen Handlung im Frühjahr 1961 in Santo Domingo einsetzt, schildert Schreyer den Versuch einer Handvoll junger, aus reichen Elternhäusern stammender Offiziere, Diktator Trujillio zu stürzen. Im Mittelpunkt: dessen 1. Adjutant, Juan Tomás. Im abschließenden dritten Band, „Der Reporter“, erlebt ein US-amerikanischer Auslandskorrespondent Aufstand und Bürgerkrieg. Daneben diskutiert Schreyer erneut ein ihn stets sehr interessierendes Thema – die Verantwortung des Schriftstellers. Der Titel des erstmals 1973 veröffentlichten Mittelstücks, „Der Resident“, bezieht sich auf den neuen US-Botschafter Henry W. Mitchell, 44, Amateurdiplomat, liberaler Publizist und ein Kennedy-Mann, der Anfang März 1962 auf die Karibikinsel kommt. Im Geiste einer „Allianz für den Fortschritt“ will er die Dominikaner Demokratie lehren und das Land zu einem südlichen Schaufenster gestalten, das die kubanische Herausforderung überstrahlt. Drei Jahre zuvor hatte dort die Revolution unter Comandante Fidel gesiegt und bei vielen Menschen für Hoffnung gesorgt. Wie wird er sich machen, der neue Mann, der gleich zu Beginn seines Antrittsbesuch ein kleines Problem hat: Mitchell betrat den Botschaftersaal. Ein mächtiger, prunkvoller Raum. Eine Meile Rokoko – Kristall, Plüsch und Marmor, in Rosenholz, Purpur und Gold. Am anderen Ende saßen in schneeweißem Dress die sieben Mitglieder des Consejo de Estado, jenes Staatsrats, der seit Balaguers Flucht im Januar das Land regierte. Jetzt standen sie auf, Mitchell hielt an und verbeugte sich mit seinen Begleitern, wie das Protokoll es befahl. Auch Presse war da, Rundfunk und Fernsehen, nur wenige Leute, war ihm versichert worden, aber sie störten, dort an den Wänden insektenhaft huschend, sie reckten sich, ließen Blitze zucken ... Jäh überkam den Botschafter ein Gefühl der Leere. Er schritt, gefolgt von seinem Stab, bis zur Mitte des Saals, hielt noch mal getreu der Instruktion, verneigte sich wiederum. Die sieben Herren erwiderten den Gruß – plötzlich wusste er nicht mehr, wer sie waren. Keinen der sieben hatte er je gesehen. Sie standen in einer Front, rührten sich nicht, sieben Staatsräte – wem das Beglaubigungsschreiben geben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der Resident
Die Dominikanische Tragödie, 2. Band
ISBN 978-3-86394-103-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1973 beim Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Erstes Kapitel
1
Als Henry W. Mitchell an jenem sonnigen Märzmorgen in den Wagen stieg, einen schwarzsilbernen Cadillac mit pompösen Heckflossen, war es schon recht warm. Wohl hatten die Zeitungen gewarnt: Achtung, Kälte, Nachttemperatur um 14 Grad! Aber solche Zahlen bedeuteten in Santo Domingo stets Celsiusgrade über Null. Er musste sich eben daran gewöhnen, die Presse gewissenhaft zu lesen, ganz anders als zu Hause in den Staaten; und zwar in jeder Hinsicht. An so vieles musste er sich jetzt gewöhnen! Hier begann ja ein neues Leben. Der diplomatische Dienst verlangte Selbstzucht, kühlen Realismus. Aber was für ein Genuss, Einfluss zu haben, als Staatsmann zu handeln und den Wirkungen nachzuspüren. Für einen Mann wie ihn, den Schreibtischarbeiter – scheinbar dazu bestimmt, im Hintergrund zu bleiben –, war dies vielleicht das Höchste.
Mitchell war 44, sah aber jünger aus durch das volle wellige Haar oder seine impulsive, verbindliche Art zu reden. Er hatte noch nie im Staatsdienst gestanden. Zeit seines Lebens war er Publizist gewesen, ein liberaler Intellektueller. Ungezählte Berichte und Magazingeschichten hatte er verfasst, dazu Bücher über den Strafvollzug, die Rassenfrage und den Bürgerrechtskampf; viermal war ihm der Benjamin-Franklin-Preis für den besten Artikel des Jahres verliehen worden. Er war Adlai Stevenson und John F. Kennedy in den Wahlkampf gefolgt. Und nun, dreizehn Monate nach Kennedys Amtsantritt, ging er als Botschafter in ein Land, das er von zwei Reisen her ein wenig kannte... Es war Freitag, der 9. März 1962. Die Vereidigung in Washington lag eine Woche zurück, seine Ankunft hier fünf Tage. Und doch war schon so viel geschehen, was seine Erwartungen enttäuscht oder auf bizarre Art übertroffen hatte.
Zu seiner Linken saß ein schlanker, brünetter Mann, der Chef des dominikanischen Protokolls. Der war mit sechs Regierungswagen in der Calle Leopoldo Navarro vorgefahren, um ihn und zehn seiner Gehilfen von der Residenz abzuholen. Wagen ohne Regierungsnummer, geschützt durch Sicherheitsbeamte. Sie mieden den kürzesten Weg zwischen der Botschaft und dem Nationalpalast, huschten ohne Eskorte durch das Lugo-Viertel. Denn am Vortag hatten Aufrührer mehrere Autos der Botschaft und auch des Konsulats zerstört, sogar Mitchells eigenen Wagen. Die Kolonne glitt hastig vorbei an weißen Gartenmauern, an den Barockfassaden der Villen. Polizisten verschafften ihr überall freie Fahrt – mit winzigen Gebärden, die daheim eher das Gegenteil bedeutet hätten: die Handfläche zum Fahrer ausgestreckt, die Finger gekrümmt, als ob sie einen Apfel hielten, das hieß weiterfahren. Passanten blieben stehen, starrten den Limousinen nach. Das war die neue Freiheit, libertad nueva; zu Trujillos Zeiten hätte niemand es gewagt, Staatspersonen anzustarren, da hielt man den Kopf gesenkt. Und überall, auf Mauern, Bordsteinen und Bäumen, die Parolen der Parteien. Auch das war libertad: Trujillo hatte nur eine Partei gekannt – seine eigene.
In Mitchells Brusttasche steckte das Beglaubigungsschreiben. Ein bedeutsames, doch schwerlich ganz ernstzunehmendes Dokument. Er hatte, gedrängt von Caroline, schon im Flugzeug die Durchschrift gelesen, beeindruckt und belustigt. Ein Hauch des 18. Jahrhunderts entstieg dem formelhaften Brief. Er trug Präsident Kennedys Unterschrift und sprach dessen Überzeugung aus, dass Henry Walter Mitchell fähig sein würde, sowohl die Interessen der Vereinigten Staaten als auch die der Dominikanischen Republik zu wahren. "Hoffentlich hat er recht", hatte Mitchell zu Caroline gesagt... Und während man schon den Palasthügel hinauffuhr, fiel ihm ein, wie der siebenjährige Steve seine Ernennung aufgefasst hatte: "Du wirst Botschafter? O Daddy! Da reitest du auf einem Pferd und überbringst wichtige Briefe..." Nun, im Prinzip hatte Steve schon recht gehabt.
Frank A. King stieg als erster aus, wie stets. Obwohl innerhalb der vier Meter hohen Palastumfriedung nichts mehr zu befürchten war, sah er sich rasch um; eine tief sitzende Gewohnheit. Der Schutz des Botschaftspersonals oblag ihm auch dann, wenn ganz andere dafür verantwortlich waren. Die Auffahrt glühte, flirrende Luft, grelle Reflexe – drei Jahre in diesem Land hatten ihn gegen die Hitze nicht unempfindlicher gemacht. Außerhalb klimatisierter Räume litt er wie am ersten Tag. Sein weißer Leinenanzug, frisch gestärkt, lag ihm wie eine Rüstung aus Sperrholz an. Er wünschte das Ende der Zeremonie herbei; dreißig Minuten sollte sie dauern. In Washington lag die Norm für Antrittsbesuche bei weniger als zehn Minuten. Dort trugen die Botschafter und auch der Präsident ihre Reden nicht vor, sondern tauschten nur die vorbereiteten Texte aus, was die Sache abkürzte. Hier aber hörte man sich gern reden.
Vor ihm schritt Mitchell zur Rechten des Protokollchefs an einem der Bronzelöwen vorbei über die gleißenden Marmorstufen, deren es 28 gab. Neben und hinter King gingen fünf weitere Zivilbeamte der Botschaft, der Leiter der US-Militärmission und die Attachés der drei Waffengattungen. Man hielt nicht gerade hervorragende Ordnung, es hatte nur eine Probe stattgefunden, aber im Ganzen klappte es doch. Je höher man stieg, desto näher rückten die Schatten der pfirsichfarbenen Nordwestfront (italienische Renaissance in Portlandzement, ein Gräuel). Vor den Säulen angelangt, drehten sich alle um, standen steif und still im rettenden Seewind, der hier oben kräftig blies, hörten die Fahnen flattern und sahen unten am Gitter den Dirigenten der Militärkapelle salutieren: ein aufgeputzter Major, sein Degen blitzte in der Sonne und die ersten Takte der Nationalhymne wehten dumpf herauf.
Eines war kaum zu übersehen: Für einen Mann, der ohne Übung im öffentlichen Auftreten war, machte der Botschafter es gar nicht schlecht. Er bewegte sich natürlich und stand auch gut, ganz unverkrampft. Es fehlten all die nervösen Gesten, die John Hill, der scheidende Geschäftsträger, so reichlich produzierte, wenn er sich zur Schau stellen musste.
Es fehlten Hills forcierter Schneid und dessen dauerndes Lächeln – Anzeichen eines schwachen oder gestörten Charakters. Kein Zweifel, der neue Mann war von anderem Zuschnitt. Vor einem Irrtum hatte King ihn übrigens bewahrt: Mitchell hatte in Fulldress kommen wollen. Ihm war im State Department gesagt worden (wohl von Crimmins, dem Leiter des karibisch-mexikanischen Bereichs), der Antrittsbesuch erfordere Gehrock und gestreifte Hosen. Doch den formellen Tagesanzug hatte das alte Regime geschätzt, und was unter Trujillo Brauch gewesen war, galt nun als äußerst unpassend. "Ich empfehle Weiß, Sir", hatte King erklärt und auch gleich, da in Mitchells Gepäck ein Leinensakko fehlte, den Chauffeur zum Schneider geschickt. Einen Mann wie Hill hätte das irritiert, der Botschafter aber war einfach bloß dankbar dafür. "Für alles eine Lösung", hatte er gesagt. "Was können Sie eigentlich nicht, Frank?" – "Oh, eine Menge", war Kings Antwort gewesen. "Zum Beispiel die Krawalle stoppen. Dazu fällt mir nichts mehr ein." Und tatsächlich, um ein Haar wäre zur selben Stunde der Chauffeur gelyncht worden! Als er in einer der engen Altstadtstraßen den Sakko holen wollte, warf der Mob das Botschaftsauto um und setzte es in Brand.
Endlich riss das Spiel der Militärkapelle ab, der dominikanische Major salutierte wiederum, und alle wandten sich um. Man tauchte zwischen Säulen und Torbögen in die Kühle der Empfangshalle, schritt über rote Teppiche und polierten Marmor, geführt vom Chef des Protokolls. Auf der breiten Innentreppe sah King den Botschafter stolpern, ein peinlicher Moment. Mitchell griff zum Geländer, gewann sofort wieder Haltung, niemand nahm sein kleines Missgeschick zur Kenntnis. King fiel das Wort vom diplomatischen Parkett ein, auf dem der Unerfahrene ausglitt, und er dachte an das, was ihn seit Sonntag beschäftigte, als der Ankömmling sein erstes Telegramm diktiert hatte ("Eingetroffen. Amt übernommen. Mitchell") – wer von ihnen würde die Botschaft wirklich führen?
Bisher war King der unbestrittene erste Mann gewesen kraft seiner Berufserfahrung, Lokalkenntnis und Querverbindungen, der vielen Helfer, getarnten Geldquellen und des erdrückenden Informationsstroms, der dem CIA-Apparat pausenlos entfloss. So lagen die Dinge vielerorts, nicht nur in Lateinamerika, auch auf der übrigen Welt – der oberste Geheimdienstler war als Sonderberater des Botschafters der wahre Herr; und John Hill, ohnehin bloß Geschäftsträger, hatte das stillschweigend anerkannt. Aber Hills Zeit war abgelaufen, nach anderthalb Jahren hatte Washington die Beziehungen voll wieder aufgenommen und einen Botschafter entsandt, daher stellte sich die Frage neu.
Wer wurde Nummer eins? Botschaftsrat Smith natürlich nicht, der zwar am längsten im Land, aber so farblos war wie sein Name. Ebenso die Sekretäre, Wirtschaftsbeamten, politischen Abteilungsleiter und die drei Militärattachés – durchschnittliche Leute, die sich eher auf Akten verstanden. Außer ihm, King, kamen nur zwei in Betracht, Henry W. Mitchell und Oberst Cass, der baumlange Chef der US-Militärmission. Mitchell schien Kennedys Ohr zu haben, das stärkte seine Position. Minuspunkte waren seine außenpolitische Unerfahrenheit, eine gewisse Naivität und die Tatsache, dass er ein Familienmensch war. Während der jüngsten Unruhen hatte King ständig ein Dutzend Detektive aufbieten müssen, um den Schulweg von Steve und Jessika zu sichern, der achtzehnjährigen Tochter des Botschaftsehepaars. Eine starke, von Ängsten bedrohte Familienbindung dämpfte oft den Ehrgeiz eines Mannes.
Cass schien das größere Problem. Luftwaffenoberst Cass war Junggeselle wie er selbst, kein sturer Gamaschenknopf, sondern ein West-Point-Kommandeur, wie er im Buche stand – logischen Denkens und klarer Entschlüsse fähig. Cass war der Botschaft nur bedingt unterstellt, er saß mit seiner Beratergruppe auf dem Flugplatz San Isidro, im Zentrum der dominikanischen Militärmacht. Und er gebot dort über 45 junge Offiziere, die hauptsächlich Piloten und Panzerfahrer schulten, also die Elite, und mit ihr befreundet waren; seine Hausmacht war nicht viel kleiner als Kings eigene. Hinter Cass stand McNamara, stand der Granitblock des Pentagons.
Die Suite erreichte das Foyer des ersten Stocks, sie bog nun ab zum Salón de Embajadores, dem großartigen Botschaftersaal. Die Flügeltüren standen offen, in einem der venezianischen Spiegel sah King sich selbst neben Mitchell und Cass... Wahrscheinlich lief es auf ein Triumvirat hinaus, ein fein ausbalanciertes Dreieck der Macht. Man würde sich in den Einfluss teilen, bis irgendein äußerer Anstoß den Fall entschied. Bis dahin galt es, den Schwerpunkt zu finden, jenen mittleren Platz zu beziehen, der die meiste Handlungsfreiheit bot. Sicher strebten danach auch die beiden anderen, aber Mitchell stand zu weit links und Cass zu deutlich rechts, sie würden kaum harmonieren, so dass Kings Mittlerrolle sich ganz von selbst ergab.
Mitchell betrat den Botschaftersaal. Ein mächtiger, prunkvoller Raum. Eine Meile Rokoko – Kristall, Plüsch und Marmor, in Rosenholz, Purpur und Gold. Am anderen Ende saßen in schneeweißem Dress die sieben Mitglieder des Consejo de Estado, jenes Staatsrats, der seit Balaguers Flucht im Januar das Land regierte. Jetzt standen sie auf, Mitchell hielt an und verbeugte sich mit seinen Begleitern, wie das Protokoll es befahl. Auch Presse war da, Rundfunk und Fernsehen, nur wenige Leute, war ihm versichert worden, aber sie störten, dort an den Wänden insektenhaft huschend, sie reckten sich, ließen Blitze zucken... Jäh überkam den Botschafter ein Gefühl der Leere. Er schritt, gefolgt von seinem Stab, bis zur Mitte des Saals, hielt noch mal getreu der Instruktion, verneigte sich wiederum. Die sieben Herren erwiderten den Gruß – plötzlich wusste er nicht mehr, wer sie waren. Keinen der sieben hatte er je gesehen. Sie standen in einer Front, rührten sich nicht, sieben Staatsräte – wem das Beglaubigungsschreiben geben?
Gehemmt bewegte er sich vorwärts. Wohl hatte King ihm Fotos der Männer gezeigt, Lebensläufe und Beschreibungen, aber jetzt hielt er sie nicht mehr auseinander. Es waren ein drahtiger General dabei gewesen, ein pfiffiger Fabrikant, ein grauhaariger Jurist namens Bonnelly, ein feister Priester, ein Autoimporteur und zwei Ärzte, zufällig beide Herzspezialisten – das hatte sich ihm eingeprägt, wegen der wunderlichen Zusammensetzung; solch eine Regierungsspitze war einmalig. Man konnte ihr, was den jähen Aufstieg und ihre Unerfahrenheit im Staatsdienst betraf, in ganz Amerika, ja auf der ganzen Welt kaum eine Führungsgruppe an die Seite stellen. Der General und der Fabrikant hatten geholfen, Trujillo zu töten, das wusste er genau. Aber wer war der Vorsitzende? Sie trugen alle Zivil! Doch halt, die sechs übrigen würden den Vorsitzenden ja wohl flankieren. Sein Denken setzte wieder ein. Dieser graue Rundkopf musste Bonnelly sein, er stand fraglos in der Mitte.
Mitchell trat dicht an ihn heran, ergriff seine Hand und sagte laut und klar: "Señor Presidente, ich habe die Ehre, Ihnen mein Beglaubigungsschreiben als Botschafter der Vereinigten Staaten in der Dominikanischen Republik zu überreichen." Dabei gab er das Dokument Bonnelly mit der Linken – war das korrekt? – und stellte seine zehn Begleiter dem Präsidenten vor. Dann stellte der Protokollchef ihn jedem der übrigen Staatsräte vor, und er stellte seinen Stab jedem von ihnen vor; zusammen einige achtzig Vorstellungen. Ein marionettenhaftes Vor und Zurück der Herren, ein oder zwei leichte Zusammenstöße, es nahm sich aus wie ein schlecht gedrilltes Ballett. Aufatmend sah Mitchell einige der Dominikaner verhalten lächeln. Sie waren für ihr hohes Amt recht jung, und er glaubte in diesem Augenblick, mit ihnen auszukommen.
Die Gastgeber baten zu den steilen, vergoldeten Stühlen; man nahm befangen Platz. Mitchell fand sich zur Rechten Präsident Bonnellys wieder. Ein neuer Akt der Operette, das vereinbarte Gespräch unter vier Augen. Eine Viertelstunde sollte es dauern, jedoch nichts Ernstes behandeln. Fünfzehn Minuten statt der üblichen fünf, höchstens zehn, waren nötig, um den beiderseitigen Status klarzustellen: der Staatsrat eines kleinen Landes empfing die Vertreter der stärksten Nation. Er hörte Bonnelly, dann auch sich selber etwas darüber sagen, wie froh man sei, zusammenzuwirken beim Aufbau der dominikanischen Demokratie. So aufrichtig das fraglos gemeint war, es klang schal wie jedes große Wort, das bei solchem Anlass fällt. Die Prozedur war rührend und quälend zugleich, eine Pflichtübung des Prestiges.
Und doch, war es nicht der Anfang, sein erster Schritt in diesem Land? Das wirkliche Handeln würde schon folgen. "Sicher beginnt es pompös und trivial", hatte Caroline ihn gewarnt und wie üblich Recht behalten. Festgeschraubt auf dem unbequemen Stuhl, tauschte er mit Bonnelly Komplimente, Banalitäten über den Liebreiz der Landschaft und die Talente ihrer Völker, protokollgerechtes Kleingespräch. Da strapazierte man sein Spanisch, das für Sachverhandlungen gar nicht ausreichte, hatte auf den Dolmetscher verzichtet, damit man besser Zugang fand, doch ganz umsonst. Das glatte Lächeln wich nicht aus Bonnellys fleischigem Gesicht, von seinen dunklen Brillengläsern spritzten Lichtreflexe, sooft er bestätigend nickte. Wie um die Gespreiztheit der Szene noch zu steigern, lugte ab und zu der Leibwächter des Präsidenten um den schweren Purpurvorhang; ein lästiger Lauscher.
Mitchell fühlte sich gebremst, seine Gedanken wanderten. Oft war er an fremde Orte gereist, früher, als er durch die Vereinigten Staaten zu fahren und ständig Artikel zu schreiben pflegte; als er so vieles unvollkommen fand und es zu bessern wünschte – keinen Moment daran zweifelnd, dass dies möglich wäre, voller Hoffnung und Eifer... Damals hatte er sein Lebensziel gefunden, war er an der Seite demokratischer Persönlichkeiten quer durch den Kontinent geeilt, für Reformen kämpfend, für vernünftige Politik, für die Verwirklichung der Bürgerrechte und mehr soziale Gerechtigkeit. Kennedys Wahlsieg war ein glückhafter Beginn, der langersehnte Aufbruch zu neuen Grenzen, neuen Horizonten, dem amerikanischen Traum. Und nun stand er, Mitchell, auf dieser Insel wie ein Pionier, um die Kraft jener Ideen zu erproben, ihre Impulse hierher zu tragen. Schließlich war all das sein eigener Traum; was er für dieses eine Land erwirken wollte, das suchte John F. Kennedy für die Welt zu tun. Das vor allem war es, was ihn an diesen großen Mann band.
Was aber verband ihn mit den hiesigen Führern? Zunächst noch nichts, er musste die Brücke erst schlagen.
Er richtete sich etwas auf. Ihm war, als habe der Präsident eben sein Bedauern über die Verbrennung der Botschaftsautos ausgedrückt, wenn es auch kaum nach Entschuldigung klang. Vielleicht empfand Bonnelly die Ausschreitungen schon als selbstverständlich. Kein Wunder, der hatte den ganzen Herbst und Winter hindurch mit solchen Unruhen gelebt. Die Flucht der Trujillo-Erben hatte Spannungen entfesselt, in manchen Stadtteilen herrschten chaotische Zustände, zumal die Polizei diese Viertel mied, seit man ihr Schießverbot auferlegt hatte.
Im Übrigen war die Botschaft durchaus nicht ohne Schuld. John Hill, der alternde Geschäftsträger, lehnte Kontakte zu den Kreisen, die hinter derartigen Aktionen standen, rundheraus ab. Stattdessen hatte er die Zwischenfälle ständig bagatellisiert, gemäß der Devise "Immer ruhig bleiben", einer im State Department sehr geschätzten Haltung, die häufig von Albernheit kaum zu unterscheiden war. So hatte er auch diesmal bloß gesagt, es handele sich um begrenzte Krawalle. Doch schon ihr Anlass war gefährlich: Trujillos langjähriger Gehilfe Balaguer, einer der bestgehassten Männer, hatte am Mittwoch das Land verlassen dürfen. Expräsident Balaguer war zuerst in die päpstliche Nuntiatur geflohen, er sollte Asyl in Spanien finden, wo die meisten Trujillos lebten. Aber gestern Morgen hatten die Zeitungen berichtet, Balaguer sei in die USA gegangen. Das hatte die Linkskräfte aufgebracht – in ihren Augen hieß Washington die Spitzen des alten Regimes willkommen oder half ihnen doch, sich der dominikanischen Gerichtsbarkeit zu entziehen.
Und das schlimmste war, es stimmte: In seiner Eigenschaft als Generalkonsul hatte Hill das Visum selbst erteilt! Dieser Fehler rechtfertigte allein schon seine Abberufung. Auf so mittelmäßige Leute traf eben das zu, was Kennedy in Los Angeles gesagt hatte: "Lange Jahre der Dürre haben das Feld der Ideen ausgezehrt; dichte Finsternis hat sich über unsere führenden Organe gesenkt... Es ist an der Zeit, dass eine neue Generation von Führern, dass neue Männer an die Lösung der neuen Probleme gehen und die neuen Möglichkeiten nutzen!"
Mitchell stand auf, er gab Bonnelly die Hand, der sich fast gleichzeitig erhob. Sie sahen einander vorsichtig und forschend, doch auch erleichtert an. Der Präsident benahm sich sehr geschmeidig und liebenswürdig, man merkte ihm Erfahrung an; er war der einzige Berufspolitiker in diesem Kreis. Noch etwas anderes, eher Nachdenkliches ging von ihm aus – ein Hauch von Kummer, von Pessimismus, der vielleicht von schweren Erlebnissen herrührte, oder aus angeborenem Gespür für das Unsichere des menschlichen Daseins kam. Gewiss ein empfindsamer Mann.
Was nun zu tun war, hatte dem Botschafter niemand erklärt. So schüttelte er den sechs anderen Staatsräten einfach die Hand, was sein Stab diesmal unterließ. Nochmals traten alle nach der Rangordnung an, verbeugten sich – die Dominikaner erwiderten –, drehten sich um, hielten inmitten des Raums inne, verbeugten sich abermals, und ein letztes Mal beim Verlassen des Saals. Oben auf der Freitreppe umfing Mitchell wieder der Seewind, während die Militärkapelle "The Star-Spangled Banner" blies. Er sah die Wagen vorfahren und lächelte entspannt. Beim Essen würde er seiner Frau berichten, erwärmt von ihrer Anteilnahme, gestört durch Steves lebhaftes Gefrage, unter dem in sich gekehrten Blick der hübschen Jessika.
2
Ende Januar, gleich nach Balaguers Flucht in die Nuntiatur, hatte Juan Tomás seinen Zufluchtsort im fernen Nordwesten verlassen. Er war nach Santo Domingo aufgebrochen, kehrte heim in die Hauptstadt, die nun nicht mehr Ciudad Trujillo hieß. Alles hatte sich geändert. Sein altes Leben war endgültig vorbei: die behütete Jugend, der vom Vater gedeckte Aufstieg, der Dienst im Zentrum der Diktatur, die Teilnahme an der Verschwörung, die schreckliche Angst, das Sich-verstecken-Müssen. Er wollte neu beginnen – nicht im Palast, das Adjutantenamt war ihm verleidet. Fest aber stand sein Wiedereintritt in die Armee. Die Mitverschworenen würden ihm dazu verhelfen, die Überlebenden. Man fing jetzt an, das Attentat zu feiern. Sicher traten seine Freunde bald hohe Ämter an.
Er selber wollte nichts von einem Staatsamt wissen. Doch während der langen Fahrt durch die Berge, im Gespräch mit Jill Douglas, wurde ihm klar, dass er auch kein Truppenkommando wollte, selbst wenn man ihn zum Major machte. Ein Bataillon zu befehligen, das lockte ihn nicht, soweit es Kasernendienst bedeutete, das ziellose Einerlei des Soldatenalltags. Standen denn nicht neue Aufgaben vor der Armee? Unter Trujillo war sie ein Richtschwert gewesen, stählernes Rückgrat der Gendarmen, Zuchtrute für Streikende, Vernichter der Guerilleros. Als einziges Machtinstrument hatte sie den Umsturz unversehrt überlebt. Wohin nun mit der ganzen Kraft?
"Was können wir Besseres tun", sagte er zu Jill, "als das Brachland erschließen und verteilen, Kanäle und Talsperren bauen, den Kampf gegen Dürre und Armut führen?" – Und wirklich, was war eine Armee wert, die dem Volk, das sie unterhielt, nicht aus dem Elend half? Weshalb exerzieren, auf Pappfiguren schießen oder in teure Manöver ziehen, wo weit und breit kein Feind mehr war, vor dem es die Nation zu schützen galt? Schon früher bei den US-Ausbildern in Panama und nun wieder auf Ralph Douglas' Plantage hatte Tomás viel gelernt über Straßenbau, Bewässerung und Gesundheitsschutz – Dinge, die das Militär leisten konnte, wenn fähige Offiziere es übernahmen.
Auf dem Marktplatz von Bonao türmten sich ockerfarbene Trümmer. Tatsächlich, Bewohner der Stadt – einst die verschüchtertsten, am meisten geduckten der ganzen Republik – hatten das Standbild Rafael Trujillos vom Sockel gestürzt! Jugendliche hockten da in der Abendsonne, ließen Sandsteinbrocken rollen und freuten sich der neuen Freiheit. Sie winkten dem Auto zu, riefen ihm etwas nach, hier, wo man drei Jahrzehnte lang gezittert hatte vor den Launen des Trujillo-Bruders Petán und dessen "Leuchtkäfern der Berge", jener terroristischen Privatgarde, beritten und MPi-bewaffnet, "Schwarzer Hurrikan" im Volk genannt.
Ach, das Volk, was war denn das? Ein kaum durchdachter Begriff, verschwommen und romantisch, Füllwort für Festredner und Stütze jeder Politik. Das Volk hatte dem Herrscher zugejubelt, auch ohne Zwang, hatte ihm die barbarische Gewaltsamkeit verziehen, mit der er die Macht erobert und behauptet hatte. Offenbar übte wilde, in Prunk gehüllte Rohheit eine starke Anziehung auf Menschen aller Schichten aus. Arme und Reiche, Unwissende wie Gebildete unterwarfen sich oft willig, berauscht wohl vom Zugriff eines Mannes, der eben das tat, wovon sie selbst nur träumten.
Das aber sollte Tomás nicht kümmern. Bei allen Zweifeln an der Vernunft des Volkes hatte ihn das halbe Jahr im Bananenland der amerikanischen Gesellschaft, wo er vor Verfolgung sicher war, die Lage der Pflücker sehen gelehrt. Natürlich waren das führerlose, analphabetische Bauern, die wenig taten, um ihr Geschick zu ändern; dennoch begriff er die schlummernden Möglichkeiten, ihre missachteten Rechte. Man hatte sie stets unterdrückt, in Unwissenheit gehalten – aus Berechnung. Welch grausam reduziertes Dasein! Konnte man es Leben nennen? Sooft er an die Palmstrohhütten dachte, die endlose Feldarbeit, die jämmerliche Entlohnung, ihre stumpfsinnigen Vergnügungen, nahm er sich vor, dem abzuhelfen.
Wie? Die Armee konnte vieles bessern mit Fleiß, Planung, Organisation und Beharrlichkeit. Sie konnte, wenn sie nur wollte, manches für die Bauern tun. Nur durfte er nicht erwarten, dass derart niedergedrückte Menschen gleich ihm auf Soldatentugenden bauten. In diesem Punkt begriff man ihn nicht; selbst wenn er ins Gespräch gekommen war, hatte es ihn am Ende deprimiert. Niemand schien überhaupt an den Fortschritt zu glauben. Die Pflücker scheuten das Militär, sie hatten ihre Erfahrungen. Zwischen Stadt und Land, zwischen Volk und Armee klaffte ein Graben. Doch wer dem Volk dienen wollte, der musste es verstehen. Und wie von Mensch zu Mensch hieß verstehen auch hier, die große Verschiedenheit zu erkennen, das zwangsläufig Gewachsene mit all seinen Folgen.
Jill riss ihn aus seinen Gedanken: "So schweigsam, Juan! Sie sind wohl schon bei Ihrer Angelique?"
Tomás schüttelte den Kopf; er fühlte Jills schiefergraue Augen auf sich gerichtet. Was für ein guter Kamerad sie doch war! Seit ihr Vater ihn aus der Stadt hatte herausfliegen lassen – seit der Trennung von Angelique –, sah er Jill beinahe täglich. Kaum hatte der Hubschrauber ihn gebracht, da waren sie Freunde geworden, verbunden durch die gemeinsame Trauer um Livio Pimentel, ihren Verlobten und Tomás' Gefährten. Anfangs hatte sie ihn heimlich im Gästehaus besucht, um den genauen Ablauf des Attentats zu erfahren, alle Umstände der schrecklichen Nacht, in der Livio starb. Später, als Tomás innerhalb des Zauns umherreiten durfte, hatte sie ihm die Plantage gezeigt, die Feldchefs vorgestellt und deren Arbeit erklärt. Von November an nahm er daran teil, meist an ihrer Seite.
Immer sah er, dass sie an ihrem Verlust schwer litt, es aber zu verbergen suchte. Und obschon er die ganze Zeit über voller Sehnsucht und Schmerz an Angelique dachte, die in Pezuelas Händen zurückgeblieben war, hatte ihm Jills beherrschte, selbstsichere Art Achtung und Zuneigung eingeflößt. Dies war vielleicht das, was er bei Frauen am meisten gesucht und bewundert, doch niemals gefunden hatte: Charakter und Haltung, ein auf Einsicht und Reife beruhendes Wesen. Jill hatte beides, Anziehungskraft und Persönlichkeit. Daher wurde er es nicht müde, die Tage mit ihr zu verbringen, so wenig wie er es müde wurde, jeden Tag auszukosten vom Sonnenaufgang bis in die Nacht, alles von vorn zu durchdenken und das Leben tief in sich einzusaugen, nachdem es ihm so überraschend noch einmal geschenkt worden war. Er genoss es ja sogar, jetzt den Wagen zu steuern.
Wem aber verdankte er all das? Angelique! Nie würde er ihren Abschied vergessen, die letzten Minuten, während unten Pezuela auf sie wartete. Für immer stand er in ihrer Schuld. Ohne sie hätte es nur noch das schwarze Nichts für ihn gegeben. Ach, wie gut er sich an den Geruch regenfeuchter Erde erinnerte, an den betäubenden Duft von Zitronenkraut, Fruchtblumen und Jasminbäumen, als ihn das Schicksal aus der Falle seines Dachverstecks jäh in den grünen Nordwesten getragen hatte. Leben, nur leben – mehr hatte er damals nicht gewollt. Nun war ihm neue Kraft zugeflossen, er war fast dreißig und folglich alt; es musste ein sinnvolles Leben, ein wirklicher Neubeginn sein.
"Ich denke, sie hat Ihnen geschrieben?", hörte er Jill fragen und wurde sich ihrer Nähe wieder bewusst.
"Ein einziges Mal. Im November, als wir schon glaubten, der ganze Spuk wär' vorbei."
"Und Sie?"
"Ich durfte und darf ihr nicht schreiben, weil sie bei diesem Oberst lebt. Sie will sich von ihm trennen, sobald er nicht mehr gefährlich werden kann. Leider scheint das noch der Fall. Er ist immer noch in der Seguridad – nicht mehr der Chef, aber einer der Stellvertreter. Die Politiker gehen, die Fachleute bleiben; sie werden gebraucht."
Jill sagte: "Seien Sie vorsichtig, Juan. Tun Sie nichts auf eigene Faust, es könnte viel verderben. Die neue Regierung wird sämtliche Trujillistas aus dem Amt jagen und die Schuldigen vor Gericht bringen."
"Sämtliche?" Tomás lachte bitter. "Da müsste sie mehr Leute einsperren, als Trujillo es in den schlimmsten Zeiten tat."
"Aber dieser Pezuela wird verschwinden."
"Das hoffe ich auch." Er nahm eine Kurve und bremste, es ging unaufhörlich abwärts. Am Wegrand wich das Gebüsch, gab den Blick nach Osten frei, und plötzlich erblickte er zwischen den Hügeln die Silhouette der Hauptstadt.
Tomás hielt an, stieg wortlos aus. Santo Domingo, tintenfarben im sinkenden Abend! Der Moment seiner Heimkehr... Von Empfindungen durchströmt, nahm er das Bild in sich auf. Es brannten schon viele Lampen, wie ein funkelndes Sternbild dehnte es sich vor ihm zwischen dem Fluss und dem Meer; selbst in der Luft lag etwas Gewaltiges. Die Stadt war in leichten Dunst gehüllt, als berge sie ein Geheimnis. Rechts der smaragdgrüne Neonschein des Embajador und die schimmernde Dachterrasse auf dem Hotel Paz. Tiefgrau die Kirchtürme vor den ewigen Rauchstreifen des Elektrizitätswerks, die Hafenkräne, der düstere Barackengürtel,. stummer Vorposten der Pracht. Und dort die Lichtgirlande am Strandboulevard, der weiße Obelisk, der Nationalpalast auf dem Hügel, die Kuppel matt angestrahlt, das Warnlicht über dem Fernsehsender und weit hinten das kreisende Leuchtfeuer des Kolumbusturms.
Er konnte sich nicht satt sehen, seine Erinnerung ergänzte, was er nicht sah – das uralte Mauerwerk der Kathedrale, die Cafeterias, die Musikautomaten, den Kaffee- und Autogeruch unter den Kolonnaden, die flanierende Menge, orangefarbene Taxis und Frauen, Frauen jeder Rasse... Was für ein Ort, er hatte Melodie, bei aller Rohheit lockenden Reiz. Wie verschieden vom Grenzland am Ende der Welt. Hier war es, sein Leben! Er glaubte den Seewind zu spüren, hörte Schiffstuten, mächtige Laute, die seine Phantasie erregten. Was hielt die Zukunft dort unten für ihn bereit? Ein halbes Jahr hatte er am Rande der Ereignisse gelebt, nun ging er dorthin zurück, wo sie sich entschieden – mit oder ohne ihn, er war dabei.
Als er sich umwandte, saß Jill am Steuer. "Wohin jetzt?", fragte sie. "Ich fürchte, in Ihrer alten Wohnung wären Sie nicht sicher. Denken Sie nur an die vielen Funktionäre der ehemaligen Staatspartei. Die meisten sind bewaffnet, und in Ihnen sehen sie den, der sie brotlos gemacht hat."
"Sie haben Recht." Tomás stieg ein. "Fahren wir am besten gleich zu Imbert. Avenida Sarasota, kurz vor dem Embajador. Tony Imbert hat uns ja für heute eingeladen."
"Uns? Heißt das, mich auch?"
"Aber ja! Da wird auf Balaguers Flucht angestoßen. Eine Art Siegesfeier; das Wiedersehen derer, die davongekommen sind, mit denen, die dabei geholfen haben." Er sah Jill zögern und begriff, es widerstrebte ihr, ihn diesmal zu begleiten. Er musste ihr zureden. Vielleicht ging sie für Livio hin; damit man ihn nicht vergaß.
An jenem Nachmittag fuhr Oberst Pezuela eher heim als sonst, wütend, verwirrt, ohne Mütze, das korrekt gescheitelte Haar verklebt, die Uniform abscheulich beschmutzt. Seine Einsatzgruppe hatte den Schutz der berühmten Kreuzung Las Mercedes–Isabel la Católica übernehmen müssen, um die Dominikanische Staatsbank und die drei ausländischen Geldinstitute zu sichern, die sich dort im Zentrum der Altstadt zusammendrängten. Es galt, Demonstranten und Plünderer zu vertreiben, ohne auch nur einen Warnschuss abzugeben, also faktisch mit der bloßen Hand. Bei Gott eine böse Sache für einen Stabsoffizier, der ungern schrie und keinerlei Übung im Straßenkampf hatte (die hatte freilich niemand hier). Zwar musste er sich nicht selbst herumprügeln, aber seine gut sichtbaren Rangabzeichen boten dem Hass des Pöbels ein allzu klares Ziel. Nach einer wüsten Viertelstunde zum Hafen abgedrängt, hatte der Mob dreckgefüllte Tüten, Behälter und Flaschen, zuletzt auch Steine und zertrümmerte Gullydeckel geschleudert. Ein wahrer Hagel war gegen die Fassade der Bank of Nova Scotia geprasselt, von wo aus Pezuela den Gegenschlag leitete. Wie durch ein Wunder hatten ihn nur Dreckwolken umhüllt und Splitter gestreift. Viel mehr als Schmutz und Schrammen erbitterten ihn das Zerbröckeln der Autorität, die Schande des Verfalls jeder Ordnung, die persönliche Erniedrigung. Zum Gendarmen war er degradiert!
Unter so trüben Betrachtungen lenkte er seinen Wagen in die Avenida Penson und parkte vor dem Bungalow am Botanischen Garten, den hochgestellte Staatsdiener und auch Trujillos Mätressen bewohnt hatten. Nach seiner Ernennung zum Direktor der Staatssicherheit – Seguridad Nacional – war er hier mit Angelique eingezogen. Und wie immer munterte ihn der Anblick des Hauses etwas auf: die übermannshohe Hecke, die das Stahlgitter verbarg, die blühenden Zierpflanzen und das schmiedeeiserne Gartentor, hinter dem der Posten stand. Nie hatte er, der Sohn eines Schneiders, gewagt, das zu erträumen. Dennoch, das Haus war sein Besitz und würde es auch bleiben, wenn er keinen Fehler beging... Die letzte Platte des Gartenpfads war locker.
Pezuela verspürte wieder den rätselhaften Drang, mit beiden Füßen zu probieren, um welche Achse der Stein sich bewegte. Er wippte darauf (verstohlen unter dem störenden Blick der Leibwache), es erleichterte ihn, dem Zwang nachzugeben, doch zugleich mahnte ihn sein Gewissen – ein Mann wie er ließ sich nicht gehen!
"Ich bin schon da", rief er Angelique zu, die im Wohnzimmer hantierte, und schlüpfte ins Bad, um die kränkenden Spuren abzuwaschen. "Die Bande wirft neuerdings mit Kanaldeckeln", sagte er durch den Türspalt; da sie nicht antwortete, ließ er Wasser ein und zog sich aus. Sonst legte er die Uniformstücke planvoll zusammen, heute warf er sie auf die Fliesen, angewidert und entschlossen, nur noch Zivil zu tragen, bis wieder Ruhe und Frieden herrschten. Dabei merkte er, dass ihm die Hände flatterten. Sein Herz kam aus dem Takt, die Knie gaben nach, er kauerte auf dem Wannenrand, kalten Schweiß auf der Stirn. Nein, nicht wieder das! Vor zwei Monaten, auf dem Höhepunkt des elftägigen Generalstreiks, hatte ihn hier ein nervöser Zusammenbruch ereilt. Die Belastung war zu hoch gewesen, er hatte sinnlose Vorwürfe hinnehmen und von der Spitze seiner Behörde zurücktreten müssen. Hier im lauen Wasser liegend, hatte er schließlich vor Erschöpfung geweint. Soweit durfte es nicht wieder kommen! Dass Balaguer damals den Staatsrat gebildet hatte, bedeutete den Anfang vom Ende. Er handelte in Panik, unter dem Druck des Streiks. Es war die Zeit, da alle kleinen Kläffer aus Angst vor einer riesigen Katze mit feurigen Augen zu Hause geblieben waren und nur die erfahrensten Jagdhunde sich hervorgewagt hatten. Und nun gab der schlaueste Hund auf – Joaquin Balaguer entwich in die Nuntiatur, er überließ dem Staatsrat das Ruder, der es nur zum Schein hatte führen sollen. Mit dem erschütternden Resultat, dass die Macht denen entglitt, die gierig danach drängten! Die Macht sank in den Staub der Straße, unter die Stiefel der Anarchisten.
In der Wanne fand Pezuela das Gleichgewicht wieder. Noch war ja nichts verloren. Einem Wink aus der US-Botschaft folgend, hatte er sich längst behutsam von Balaguer gelöst und dem neuen Generalstaatsanwalt zur Verfügung gestellt als intimer Kenner des Gefüges der Staatssicherheit. Seit Weihnachten ließ dieser namhafte und energische Jurist (er war aus dem mexicanischen Exil zurückgekehrt) seine Leute gefährliche Dinge ermitteln: Sie gruben in alten Akten, hörten ehemalige Häftlinge an und stellten Verstöße der Seguridad fest. Im Staatsrat lief seit gestern ein geheimer Untersuchungsbericht um, dem Abbildungen jüngst entdeckter Folterwerkzeuge beilagen; darunter so üble Instrumente wie ein Gummikragen zum langsamen Erwürgen und Spezialscheren zum Zerquetschen der Finger und Zehen. Das Protokoll enthielt auch Fotos grässlicher Szenen – Häftlinge auf dem Drachenstuhl, nackt, unter Strom, mit herausquellenden Augen –, von idiotischen Folterern aufgenommen. Dergleichen befleckte jeden Offizier der Staatssicherheit, auch solche, die niemals gequält, sondern harmlos in Stäben gesessen, Karteien geführt, zur Leibwache gehört oder, wie er selbst, ganz normalen Palastdienst versehen hatten. Es gab überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Dienstbetrieb in der Adjutantur und den Vorfällen in La Cuarenta, Kilometer 9 oder anderen Kerkern. Nur, wer würde das begreifen? Die blinde Masse jedenfalls nicht! Die unterschied nicht einmal zwischen dem alten Regime und dem neuen, das zeigten die unflätigen Zurufe vorhin.
Er presste den Schwamm aus und hörte sich leise stöhnen. Der Untersuchungsbericht war vernichtend. Zum Glück würde man sich hüten, ihn zu veröffentlichen. Der Staatsrat wusste sehr wohl, dass er da mit Dynamit umging. Es drohte ohnehin die große Eruption, bitter nötig brauchte der Staatsrat die Ordnungskräfte, gegen die er ermitteln ließ! Und darin lag die Chance, der schmale Spielraum zwischen dem tobenden Mob und dem Säuberungsziel der neuen Herren. Waren die übrigens denn so rein? Bei Bonnelly etwa gab es dunkle Punkte. Trotzdem, es stand schlimm, weit schlimmer als im letzten Juni oder im November.
Schnappte da nicht nebenan ein Schloss? Pezuela hob den Kopf, er hatte ein Ohr für solche Laute. Schon wieder ein Schnappen. Er glitt aus der Wanne, griff nach dem Badetuch. Jetzt drehte Angelique die Wählscheibe, wartete auf eine Verbindung. Was trieb sie da? Dass sie launisch war und seine Ankunft übersah, war nicht neu, aber wieso wagte sie es, offen sein Telefonverbot zu übertreten? Er stieß die Tür auf und sah sie vor der Faltwand aus hellem Leder, die ins Schlafzimmer führte, mit zwei geschlossenen Koffern. Den Hörer in der Hand, sagte sie: "Bitte ein Taxi zur Avenida Penson Nummer vier."
"Wo willst du hin?", würgte er hervor, heiser, mit verbrauchter Stimme – obgleich er schon begriff.
"Weg", sagte Angelique. "Lass mich gehen. Ich kann nicht mehr. Ich gehe." Und sie griff nach ihren Koffern.
Er rührte sich nicht, stand fröstelnd da, etwas tropfend, spürte wieder sein Herz. Sie verließ ihn, er hatte gewusst, das würde kommen. Gut, sehr gut – den Ballast über Bord, Schluss mit privaten Eskapaden, der fatalen Jagd nach Glück. Sie bedeutete ihm nichts mehr, er hatte es satt, das Schweigen, die Blicke, den verdeckten Hass und ihre kalte Fügsamkeit, diese verächtliche Unterwerfung, die sein Selbstgefühl zerfraß. Es war von vornherein falsch gewesen, ein Irrtum. Man konnte auf die Dauer, von Liebe ganz zu schweigen, nirgends mehr Lust empfangen als man entfachte, und da ließ sich nichts entfachen, weiß Gott, er hatte es versucht. Wäre sie nur still gegangen, er hätte es verwunden. Erst ihre Auflehnung ließ ihm die Hände zittern. Dass sie das wagte, war ein schlimmes Zeichen. Sie hatte Witterung genommen und ging, aufsässig wie der Mob, wie die Gosse, aus der sie ja auch kam.
"Wohin, Angelique?", wiederholte er bohrend, nur noch bestrebt, zu verletzen. "Zurück ins Showgeschäft? Halbnackt auf die Bühne, zum Direktor ins Bett? Das Ganze jetzt von vorn oder gleich zu Tomas?" Er riss ein Schubfach auf, warf ihr einen Schlüssel hin. "Damit kommst du in sein Appartement. Er ist schon unterwegs nach hier."
"Immer noch allwissend?" Sie trug schon die Koffer, lächelte ihn feindlich an. "Aber nicht mehr allmächtig, Arturo... Du kleiner Polizist ohne Uniform. Ich hoffe für dich, du ziehst sie niemals wieder an."
"Warte es ab", keuchte er.
Als die Tür hinter ihr einschnappte, wurde ihm bewusst, mit welcher Anspannung er sich zurückhielt. Er trat zum Fenster und sah sie gehen, zwischen Hibiskusbüschen und Hyazinthen verschwand sie, seine Hoffnung auf Leben und Romantik. Er hatte das Gefühl, sich gegen einen Felsblock zu stemmen, der dabei war, ihn zu zermalmen. Er ließ den Kopf auf die Hände sinken und brach in krampfhaftes Schluchzen aus.
Vor Imberts Villa in der Avenida Saratosa standen mehrere Wagen; in einem saß ein uniformierter Fahrer. Armee oder Luftwaffe, das erkannte Tomás nicht, es war schon zu dunkel geworden. Jill parkte am Ende der Schlange, sie stieg mit ihm aus. Im Garten glommen kniehohe Laternen, sie betupften den Weg mit apfelsinenfarbenen Kreisen. Ein sonderbares Haus: es schwebte auf rosenumrankten Pfeilern, war ohne Erdgeschoß, eine wunderlich geschwungene Treppe führte hinauf zum Balkon. Hier am südwestlichen Stadtrand hatte man modern gebaut, luxuriös, märchenhaft. Durch die Jalousieschlitze drangen Licht, Musik und Stimmen.
Zwei weißbehelmte Gendarmen vertraten ihnen den Weg. Tomás sah ihre Waffen, die groben Gesichter, das Feldtelefon neben der Zypresse. "Melden Sie Miss Douglas und Hauptmann Tomás", sagte er fröstelnd, voller Unbehagen. Schon recht, dass Imbert Polizeischutz nahm – vielleicht brauchte er selber den jetzt auch –, aber mussten es denn Cascos blancos sein, Männer der Bereitschaftstruppe, die gemeinsam mit der Staatssicherheit die Attentäter gejagt und einen nach dem anderen aufgespürt hatten? Ein unguter Beginn des Abends! Da sagten sie die Namen durch, ganz wie in alten Zeiten. Auch Livio hatten sie auf dem Gewissen. Ihm grauste es vor solchen Dienern der Staatsgewalt. Er kannte ihre Rauflust, ihre Zerstörungswut. Die schlugen jeden auf Befehl zusammen, manchmal schon aus Übermut.
Oben flog die Tür auf, ein Herr im weißen Smoking eilte ihnen entgegen, gefolgt von einem blonden Mädchen. Tomás blieb überrumpelt stehen – Cindy Fonseca, wie kam sie hierher, in diesen Kreis? Während der Herr sehr herzlich Jill begrüßte (Tomás erkannte Antonio Guzmán), fiel ihm Cindy mit einem kleinen Aufschrei um den Hals. "Juancito", rief sie und küsste ihn. "Ein Dreivierteljahr! Eine schreckliche Zeit, ohne dich..."
Sogleich umfing ihn ein schwelgerischer, vergessener Duft. Ihr Mund schimmerte feucht, verlangend, ihr Haar war so zurückgekämmt, wie er es früher gewollt hatte, Nacken und Arme kamen zart aus dem hellblauen Kleid, das die rührende Schulterlinie betonte. "Trag mich", bat sie vor der Treppe wie ein Kind, und wieder berührten ihn die geschwungenen Lippen. "Mir ist, als ob ich träume..."
Er fragte: "Seit wann seid ihr zurück?"
"Noch mal hielt ich das nicht aus!" Sie presste sich heftig an. Er fand sie ein wenig schwerer geworden, üppiger, nur eben nicht reifer. Sie sah nur ihn, übersah völlig Jill Douglas. Unglaublich, dass sie älter sein sollte als Jill. Cindy – sinnlich, süß und saftig, niemals ganz erwachsen! Er hörte sie seufzen. Noch immer war sie für ihn die Vollendung einer bestimmten Weiblichkeit; hinreißend naiv und voll warmer Anziehung, die kein Mangel mindern konnte. Doch während er sie hinauftrug, wurde ihm klar, dass er sie nicht begehrte. Nicht jetzt, in diesem Augenblick. Er hatte ja weder mit ihr gerechnet noch überhaupt an sie gedacht. Das Wiedersehen war einfach zu plötzlich gekommen.
"Ist es wahr", hauchte sie, "du hast ihn erschossen?"
"Nicht allein! Wir sind fast ein Dutzend gewesen."
"Ich bin so stolz auf dich", sagte sie innig, den Kopf schräg an seiner Schulter. "Wen hast du denn da bei dir?"
"Die Tochter von Ralph Douglas."
"Sieht gut aus. Hat sie dich getröstet?"
"In gewissem Sinne schon."
"Ach, ja?" Cindy schlüpfte aus seinen Armen. Sie hatten schon die Terrasse erreicht, den einzigen Zugang zum Haus, aus dem ihnen nun Tony Imbert entgegentrat. "Willkommen in Santo Domingo", rief er und breitete die Arme aus. Er trug zu Tomás' Verblüffung die Uniform eines Generals der Bereitschaftspolizei. "Das hat keine Bedeutung", versicherte er verschmitzt. "Ich bin das nur 'ehrenhalber', ein General ohne Armee. Man hat mir den Rang verliehen, damit mir eine Leibwache zusteht." Er nahm Tomás beiseite. "Die werden Sie auch brauchen, Juan. Noch geht es drunter und drüber bei uns. Sie aber wird man wirklich befördern, dafür ist gesorgt." Er gab ihm einen großen Cocktail, auf dem zu Schnee zerquirltes Eis schwamm, und schob ihn in den Salon.
Laute Musik hinter Blattpflanzen, Parfüm und Zigarettenrauch. Ein Händedruck nach dem anderen, Gesichter und Namen, die Tomás nicht kannte. Bis auf ein paar Verwandte der toten Kameraden sicherlich alles Leute, die Imbert und Luna geholfen hatten, zu überleben. Sogar ein Yankee war dabei, Frank King, Botschaftsangehöriger, wie es hieß; ein noch junger Mann, doch schon fast kahl, mit fadem Lächeln und klugen Augen. Noch ein Glas Rum mit Coca-Cola! Drei Damen auf der Ledercouch, man saß in Gruppen zusammen, sprach lebhaft aufeinander ein, um die Musik zu übertönen, trank Daiquirís und Whisky auf Eis, die Luft schien erhitzt von all den Worten und Gesten. Da, ein vertrautes Gesicht, Francisco Caamaño, sein bester Freund damals und hoffentlich bald wieder. Francisco vertrat hier wohl seinen Vater, den Befehlshaber Nordwest, der es Douglas ermöglicht hatte, den Beschützer zu spielen. Erstaunlich, wie viele Menschen damit beschäftigt gewesen waren, die Verschwörer zu decken, ihre Spuren zu verwischen, damit die letzten drei übrig blieben.
"Du verzeihst mir, Juan? Ich wusste ja nicht...", stammelte Caamaño. "Hättest du mir damals nur gesagt, dass Imbert mitmacht! Román und Luna, von denen hab ich nichts gehalten." Er sprach leise, bedrückt, sein viereckiges Gesicht war gesenkt.
"Román ist tot", sagte Tomás.
"Aber Luna – sehr lebendig." Caamaño wies mit dem Kopf nach rechts, eine stierhafte Bewegung, an die Tomás sich sofort erinnerte. Zugleich hörte er den Unterton dieser Worte, doch bevor er ihm nachspüren konnte, sah er Mario Luna kommen – blendend, drahtig, mit großen blitzenden Augen, in weißem Hemd und engen Hosen, die Zigarettenspitze aus Elfenbein zwischen den Fingern. Sein Haar wurde grau, nicht nur an den Ohren, auch die kommaförmige Strähne auf der Stirn; sonst schien er unverändert. Und doch, wie fremd man sich in sieben Monaten geworden war! Imbert in Uniform, Luna in Zivil, das hatte es nie gegeben, sie wirkten beide wie verkleidet. "Was ist los, Mario?", fragte Tomás nach der tosenden Begrüßung. "Lässt du die Luftwaffe im Stich?"
"Im Gegenteil, ich führe sie, ab morgen!"
"Meinen Glückwunsch, General."
Sie tranken sich zu. "Juan, wir haben dich nicht vergessen", sagte Luna. "Du überspringst den Major, wirst Oberstleutnant, claro. Höchste Zeit, dass du kommst! Wir brauchen dich in der Regierung."
"In der Regierung?"
"Hör zu: Imbert und ich sind in den Staatsrat gegangen; er als maßgebender Mann für Rechtspflege, Inneres und Polizei. Ich vertrete die Streitkräfte." Luna zog ihn ins Nebenzimmer, er sprach mit gesenkter Stimme, drängend und vertraulich. Ein wahrhaft rastloser Mensch! Kaum der Verfolgung entgangen und schon wieder voller Pläne und Elan. "Noch ein dritter dort ist gut", fuhr er fort, "Romero Fonseca, Cindys Vater. Er ist im Staatsrat verantwortlich für Wirtschaftsfragen und stimmt in der Regel mit uns. Auf die vier anderen aber können wir nicht zählen, die hat noch Balaguer ernannt – einen Priester, zwei Ärzte und diesen Bonnelly, den vorletzten Justizminister des Regimes. Er ist der einzige Profi, bestimmt die Richtlinien der Politik und macht das meiste ganz allein, obwohl er an sich nur für die Außenpolitik da ist."
"Wie könnte ich euch schon nützen?"
"Pass auf: Der Consejo ist natürlich komplett, mehr als sieben dürfen nicht hinein, doch es fehlt noch ein Sekretär, ein Koordinator. Das richtige Amt für dich mit deiner Erfahrung aus der Adjutantenzeit! Als Sekretär des Staatsrats wärst du zwar nicht stimmberechtigt, würdest aber alles vorbereiten, hättest die Fäden in der Hand. Du wärst der Stabschef dieser Führungsspitze."
"Falls die anderen vier mich akzeptierten."
"Falls du akzeptierst! Bonnellys Gruppe kann es sich gar nicht leisten, gegen dich zu stimmen. Wir sind die Männer der Stunde! Tony Imbert war nie Soldat, trotzdem hat man ihn zum General ernannt, aus purer Hochachtung. Man respektiert uns, das müssen wir nutzen."
"Wozu?"
Luna lachte kurz auf. "Was für eine Frage", rief er halb belustigt, halb gereizt. "Um das zu verwirklichen, wofür wir gekämpft haben, Juan. Sauberkeit, Erneuerung, Reformen jeder Art. Das hast du doch nicht vergessen!"
Ehe Tomás antworten konnte, sagte jemand hinter ihnen: "General Luna, haben Sie die Militärpolizei draußen hingestellt? Sogar auf das Dach?" Cindy! Sie war ihnen gefolgt, stand an der Tür, die Brille in der Hand; ihre dunkelblauen Augen ruhten hungrig auf Tomás. Es war klar, sie wollte das Gespräch unterbrechen, das ihr viel zu lange dauerte. "Fürchten Sie etwa auch, dass Ramfis mit den übrigen Erben plötzlich wiederkommt?"
"Fürchten? Ich wünschte es, Señorita Fonseca", erwiderte Luna ziemlich laut. "Wenn Ramfis morgen bei mir landete, auf dem Flugplatz San Isidro, würde ich ihn mit allen Ehrungen empfangen, die einem Staatschef zukommen."
Nebenan wurde es still, der schockierende Satz war offenbar verstanden worden. Eine Stimme fragte: "Wer will Ramfis ehren?"
"Ich", rief Luna hinüber. "Mit einundzwanzig Salven. Er kriegt einundzwanzig Salven, wie alle Trujillos: genau in den Schädel!"
Man lachte dröhnend, dann ging die Unterhaltung weiter.
Ohne sich noch um Cindy zu kümmern, fuhr Luna fort, die Situation im Staatsrat zu schildern. Tomás hörte kaum hin. Das Wichtigste war klar: Luna führte dort, gestützt auf die Streitkräfte, die er hinter sich glaubte, eine Minderheit an; sie schien drauf und dran, ihren Einfluss auszuweiten. Kein Zweifel, Luna und Imbert griffen nach der Herrschaft, wie er es immer vermutet hatte, und sie brauchten dazu ihn, seinen Namen, seine Kenntnis des Regierungsapparats. Sicher mussten sie so handeln, sie folgten da nicht nur einem inneren Zwang. Denn Attentäter fielen entweder oder sie traten an die Spitze, es war das alte Gesetz. "Ohne jedes Blutvergießen", hörte er Luna sagen. "Eine neue, gerechtere Ordnung unter dem Schirm der Armee."
Tomás nickte, das klang vernünftig, er fühlte sich in seinen Vorstellungen bestätigt. Zugleich spürte er Cindys Nähe, sie kauerte auf einem Lederkissen und starrte ihn tiefernst an, bewundernd, gefesselt wohl von dem Gespräch, in einer Art düsterem Entzücken. Luna, der so gut aussah und sie großmütig an seinen Gedanken teilhaben ließ, existierte gar nicht für sie. Ihr Blick begann Tomás zu stören, er fühlte sich umschmeichelt, abgelenkt. Macht und Liebe, die großen Verführer, der ewige Kreislauf, das alte Spiel von vorn? Mit zündenden Worten und süßer Verlockung fing es immer an. Die Männer der Stunde, wie Luna es nannte, eroberten den Staat und brachten ihn womöglich vorwärts, jedenfalls ein Stück – soweit nämlich ihre Ideen, ihr Wille und ihre Fähigkeiten trugen; solange sie redlich und sauber blieben.
Tomás spürte jetzt den Alkohol, der löste das Denken aus seinen Bahnen, stachelte die Phantasie. Gewiss, man musste es riskieren. Amboss oder Hammer sein! Versuchten sie es nicht, dann taten es andere, ehemalige Trujillistas wie Bonnelly. Routiniers, die bloß fortfahren würden, das Land im alten Stil, im Sinne des Geldes zu regieren: statt für den Trujillo-Clan, die Großfamilie der Neureichen, nun für die großen alten Familien, die Bermúdes, Cabral, Cáceres, Vicini... und Guzmán und Fonseca (doch da riss sein Gedankenfaden ab). Kam es so, dann war die Chance vertan und alles umsonst gewesen.
"Ein wahrhafter Neubeginn für das Volk und mit dem Volk", erklärte Luna voller Nachdruck. "Wir sind auf dem Wege zur Demokratie, Juan, dort geht die Staatsgewalt vom Volke aus."
"Und wo geht sie hin?", fragte Cindy mit ihrem altklugen Lächeln, abgefeimt wie eh und je – naiv aus Berechnung oder schlau bei aller Naivität, das war die Frage. "Beim Volk kann die Staatsgewalt ja nicht bleiben, General. Schließlich kann es sich nicht selbst regieren. Das wär' doch Anarchie, nicht wahr?"
"Sehr richtig", antwortete Luna galant. "Sie haben den Kern durchaus erfasst. Sie werden Ihrem Herrn Vater bald eine starke Stütze sein." Er nahm ein Glas vom Tablett, leerte es in einem Zug und stand auf. "Die Einzelheiten morgen, Juan. Aber bitte, geh nicht weg, vielleicht gibt's noch eine Überraschung." Mit einer leichten Verbeugung zog er sich zurück.
"Endlich sind wir ihn los!" Cindy kam zu Tomás. "Tanz mit mir", bat sie. Ihre Brüste streiften ihn, doch kaum hatten sie angefangen zu tanzen, da füllte sich der Raum. "Muss es all die Leute hier geben?", flüsterte ihm Cindy zu. "Lass uns gehen, zu mir, ins Embajador."
Er fand keine Antwort, blickte herab auf das helle Oval ihres Haars, ratlos. Warum erregte ihn der Gedanke nicht, mit ihr allein zu sein? Seine Verliebtheit, wo war sie geblieben? Ganz konnte sie sich nicht verflüchtigt haben, etwas war auch noch in ihm, das spürte er – die Erfahrung empfangener Lust, die Gewissheit sicheren Genießens. Aber es genügte nicht wie einst ein Blick auf ihr Haar oder ihren Mund, damit er die Umarmung ersehnte. Seitdem war zuviel geschehen.
"Stimmt etwas nicht?", fragte sie. "Fühlst du dich nicht wohl?"
"Doch", sagte er mit trockener Kehle. "Ich war nur den ganzen Tag unterwegs..."
"Mit dieser Amerikanerin."
"Unsinn. Jill und ich sind weiter nichts als gute Freunde."
"Du bist verändert, das merke ich doch." Sie hatte plötzlich Tränen in den Augen. "Juancito, liebe mich wie früher!"
"Nicht weinen, Cindy. Sieh mal, es ist soviel Zeit seitdem vergangen. Ich konnte gründlich über uns nachdenken..." Sie blieb stehen, ließ ihn los. "Ich hab niemals über uns nachgedacht! Für mich war's immer klar, dass wir zusammengehören. Nur der Clan hat zwischen uns gestanden, und den gibt's jetzt nicht mehr." Sie betupfte ihre Augen – wenn sie weinte, schien ihr Gesicht nur noch aus diesen Augen zu bestehen – und wandte sich ab, außerstande, weiterzusprechen.
Irgendwann im Laufe des Abends fiel der Name Juan Bosch. Es war Guzmán, der ihn nannte. Bosch, nach 24 Exiljahren zurückgekehrt, hatte eine Reformpartei gegründet, die allmählich Mitglieder gewann. Er sollte ein guter Redner sein, doch konnte sich seine Partei keineswegs mit der Nationalen Bürgerunion messen; der Bürgerunion gehörten die wichtigsten Leute an, auch vier der Mitglieder des Staatsrats, darunter Romero Fonseca. "Señor Guzmán ist der einzige Millionär", sagte Jill, "der den Mut hat, mit Bosch zu verkehren."
"Ich unterstütze ihn sogar!" Guzmán stand am kalten Büfett, in der Hand ein kaviargefülltes Ei. "Der einzige politische Kopf weit und breit."
Caamaño fragte: "Sie wissen, dass Bosch der Erfinder der Parole ist: 'Für die zweihundert Millionen und gegen die zweihundert Millionäre'?"
Guzmán winkte ab. "Was erklärt ein Mann nicht alles im Laufe eines langen Lebens..."
"Zumal den Frauen", bemerkte Imbert.
Die Stimmung hatte den Punkt erreicht, an dem kein ernsthaftes Gespräch mehr möglich war. Man trank und lachte zuviel, die Trinksprüche wurden immer länger und phantastischer. Tomás wollte mithalten, doch es war, als habe er den Anschluss verpasst. Da beging man den Sieg, das Wiedersehen der Überlebenden, er aber musste dauernd an die Toten denken, an Livio, Benítez, Tejera und de la Maza, an Julia García und an Elena Velarde, die Schwester dieses Juan Bosch. Auf dem Weg zum Flugplatz hatte man ihr Taxi gerammt, nachdem Tomás sie überredet hatte, ihren Bruder aus Puerto Rico heimzuholen, damit der die Scheinopposition führe. Bosch war sein erster Kandidat gewesen, wenn auch nur auf dem Papier.
Tomás sah, dass King ihm zutrank, der Yankee aus der Botschaft. King lächelte etwas maskenhaft, er verdiente sicher mehr Beachtung, denn er war Lunas Retter, in gewisser Weise auch sein eigener, das hatte Tomás vorhin erst erfahren: King sollte die Seguridad ständig gebremst und erreicht haben, dass viele geschont wurden; so waren auch Estrella und Tavárez davongekommen. Tomás hob das Glas, er suchte nach Dankesworten, da sagte jemand hinter ihm: "Ein Literat, kein Mann der Praxis und ziemlich rot. Dann könnten Sie auch gleich Estrella unterstützen, diese Volksbewegung!"
"Kein Wort gegen Estrellas Partei", rief Cindy dazwischen.
"Es war immerhin Hauptmann Tomás, der sie geschaffen hat!"
"Auf Befehl", warf Luna ein. "Trujillos letzte Idee!" Er kam langsam näher, Tomás sah ihn wie durch Nebel, und wieder erschien Luna ihm fremd, verkleidet, gefährlich – dieser Mann in saloppem Zivil, er hätte nicht sagen können, was ihn daran so störte.
"Hoch Estrella und Tavárez", hörte er Cindy rufen. "Das sind auch Helden, weshalb habt ihr sie nicht eingeladen? Stoßt mit mir an auf die Volksbewegung!"
Die Gläser klirrten, wirklich, man gehorchte ihr!
"Sieh dir das an", sagte Luna. "Tony trinkt auf die Leute, die ihm Tag für Tag zu schaffen machen. Es scheint, er ist voll."
"Wer macht ihm zu schaffen, Estrella etwa?"
Luna nickte; sie traten zur Terrassentür. "Estrella und Konsorten stecken hinter jedem Spektakel. Heute erst ging's vor den Banken hoch her, unser alter Freund Pezuela hatte es auszubaden. Der muss sich neuerdings im Straßenkampf bewähren."
"Woher weißt du das?" Es hämmerte Tomás in den Schläfen, er hatte längst nach Pezuela fragen wollen.
Luna schob ihn ins Freie. "Aus erster Hand – von ihr, deiner Dame. Sie ist unten, Juan. Ich decke dir den Rückzug bei der kleinen Fonseca."
Tomás lief atemlos hinab. Angelique! Sie kam zu ihm, schon am ersten Abend – wie war ihr das gelungen? Vom Fuß der Treppe aus sah er sie, und sein Herz zog sich zusammen. Sie wartete unter dem Haus, schattenhaft, wohl eingeschüchtert von den Posten, bei Imberts Wagen zwischen den Pfeilern. Wie lange stand sie schon da, weshalb bat Imbert sie nicht herauf? Sie hatte doch ein Recht, dort oben mitzufeiern, mehr Recht als andere! Geschah es aus Rücksicht auf Cindy, deren Vater man verpflichtet war, oder wurde Angelique hier verachtet?
Er nahm sie in die Arme, beschämt und empört, überströmt von seiner Freude.
"Halte mich", flüsterte sie. "Halt mich ganz fest."
Über ihnen waren Schritte, Stimmen und Musik, dumpf schlug der Tanzrhythmus durch den Beton. Nein, er würde nicht wieder hinaufgehen; wer Angelique ausschloss, der konnte auch mit ihm nicht rechnen. Wie gut, wie schön sie war, voller Leidenschaft und Würde! Er sog den Geruch ihres Körpers ein und wusste mit einem Mal, dass er die ganze Zeit auf sie gewartet hatte. Wie viel Kraft lag in allem, was sie tat.
"Du hast ihn also verlassen", sagte er endlich. "Und nun bleibst du bei mir."
3
Als Oberst David C. Cass am letzten Mittwoch im März sein Büro betrat, fand er einen Bücherstapel vor, der am Vortag noch nicht da gewesen war. Nichts Militärisches, sondern Schriften über soziale Fragen. Er rief Hauptmann Fuller an, um den Irrtum aufzuklären. Doch da er ihn nicht erreichte, nahm er die Bücher zur Hand. Sie trugen dramatische Titel wie Reißt die Mauern ein!, Der tiefe Süden sagt: Niemals! und beschrieben im Stil des modernen Erfolgsjournalismus allerlei traurige Zustände in Zuchthäusern, Heilanstalten und selbstredend in den Südstaaten, die vermutlich als ein einziges Zuchthaus für die Farbigen geschildert wurden. Der Verfasser war immer derselbe: Henry W. Mitchell.
Mit solchen Werken also hatte sich Mitchell dem linken Flügel der Demokraten und dem Kennedy-Clan empfohlen, so nachdrücklich, dass er zum Wahlhelfer des Präsidentschaftskandidaten avanciert und schließlich Botschafter geworden war! Cass schob die Bücher beiseite. Es fiel ihm ein, dass er Fuller vor Wochen beauftragt hatte, sie zu beschaffen. Da hatte er es noch für nützlich gehalten, die früheren Denkergebnisse des Botschafters gedruckt zu besitzen. Inzwischen wusste er auch so Bescheid. Er würde vielleicht einmal darin blättern, hatte aber nicht vor, sie wirklich zu lesen. Was diese Liberalen schrieben, war ja nicht neu. Und meistens missfiel es ihm, mochte es nun oberflächlich dargeboten oder ernsthaft, mit wissenschaftlichem Anspruch begründet sein. Dies hier war offenkundig die glatte Arbeit eines Routiniers, der sein Publikum einfing, indem er gefühlsbetonte Thesen doch sehr nüchtern vortrug und sich bei aller Unterhaltsamkeit zugleich den Anschein von Tiefe gab.
Reißt die Mauern ein! Schon der Titel sagte genug. Todsicher warf Mitchell der Nation vor, sie sei nicht bereit, die Kriminalität als Folge von Konflikten anzusehen, die sie selbst verursachte: durch Konsumzwang, Leistungsdruck, Auspressen der Minderheiten und Verrohung; der ganze linke Wortschatz wurde da bemüht. Die übliche Anklage war, man fördere die Gewalt, überschwemme die sozial Schwachen mit aggressiven Reizbildern, lasse sie verkommen und mache sie durch inhumanen Strafvollzug endgültig zu Außenseitern. Alles wurde dem Milieu, nichts dem Erbgut zugeschrieben; vom Sport über die Armee bis zu den "heimlichen Verführern" der Werbung bekam jeder sein Fett. Die amerikanische Lebensweise stand zuletzt im Hemd.
Cass schlug nur das dünnste Exemplar auf, ein altes Heft von Harper's Magazine mit einem Beitrag Mitchells, den Fuller grün angekreuzt hatte (grün: dem MAAG-Chef vorzulegen). Der Artikel war überschrieben mit Glanz und Elend der Diplomaten, in mokanter Abwandlung des Romantitels von Balzac. Cass runzelte die Stirn. Amerikas Diplomaten, denn um sie ging es, auch nur assoziativ mit französischen Huren in Verbindung zu bringen, das zeugte von eigenartigem Geschmack.
Der Verfasser erläuterte anfangs ganz korrekt Ausdrücke der Fachsprache, wenn auch nicht ohne Ironie. "Die Bezeichnung Karrierediplomat wird seit langem kommentarlos gebraucht", schrieb er. "Sie erscheint unverfroren, ist aber nur ehrlich; jedenfalls wird der Aufstiegsdrang anderer Staatspersonen nicht schon am Berufsnamen klar. Wer immer den Ausdruck Karrierediplomat prägte, niederes Strebertum hat er nicht gemeint. Dafür wäre im diplomatischen Dienst auch kein Platz. Der verlangt Aufopferung, wie man sehen wird."
Das klang arglistig. Im persönlichen Umgang war Mitchell dieser Zug fremd. Vielleicht hatte es doch Sinn, mehr von ihm zu lesen; es konnte demaskierend sein. "Karrierediplomaten sind die Berufsmäßigen der Branche", hieß es nun wiederum recht anzüglich, "die Profis des Verständigungsgeschäftes im Unterschied zu den Amateurdiplomaten und einer dritten Sorte, den zeitweilig in der Außenpolitik stationierten Militärs..."
Cass fing an, sich zu ärgern. Natürlich hatte Mitchell, als er dies vor Jahren schrieb, nicht geahnt, dass er selbst einmal sein Land draußen vertreten und zu denen zählen würde, über die er sich da ausließ. Aber es war doch ungehörig, so respektlos Menschen zu charakterisieren, die in einer oft feindlichen Umwelt und unter Erschwernissen jeder Art Amerikas Ansehen und Interessen wahrten. So etwas verstimmte auch Leute mit gesundem Humor.
"Die Herren Sullivan und Vick", las er unwillig weiter, "die Präsident Wilson im März 1913 als Gesandten und als Hauptzolleinnehmer nach Santo Domingo schickte, waren Amateure. Vick hatte die Wahlschlacht der Demokraten geleitet, Sullivan deren Verbindung zur Wallstreet gepflegt. Doch wenn auch sachfremde Impulse wie Freundschaft oder Dankbarkeit Laien in verantwortungsvolle Auslandspositionen trugen, so muss man doch einräumen, dass mancher dort viel Talent bewies."
Cass massierte sein Kinn. Warum hatte Mitchell gerade dieses Beispiel gewählt? Zu merkwürdig für einen Zufall. War er denn früher schon einmal hier gewesen, vor seiner Sondierungsreise im letzten Herbst? Davon wusste Cass gar nichts... Der nächste Absatz schon bezog sich wieder auf diese Insel: "Nicht minder nützlich war das Wirken der Militärs. Oft gaben sie bereits im Stadium der außenpolitischen Planung wertvolle Winke. So versicherte Vizeadmiral Chester dem Senat vor unserer Haiti-Landung im Mai 1915, Haitis Strand sei praktisch ein Teil der Küstenlinie der USA und das Land sei in den Händen einer Regierung, die tief in religiösen Aberglauben und verwaltungsmäßiger Verkommenheit versunken ist. Solche Fingerzeige, die heutzutage der Geheimdienst gibt, kamen damals meist von der auslandserfahrenen Marine."
Hinter ihm trat Fuller ein, er brachte Neuigkeiten mit. Die Generale Luna und Imbert hatten ihre Stellung im Palast gefestigt. Nach wochenlangem Streit war es ihnen geglückt, den dritten überlebenden Attentäter, Oberstleutnant Tomás, in eine Schlüsselposition zu bringen – in das gegen Bonnellys Widerstand geschaffene Amt des Staatsratssekretärs. "Ich denke, ein guter Mann", sagte Fuller. "Er scheint uns wohl gesonnen. Es gibt bei ihm keinen Yankee-Komplex, Sir. Douglas hatte ihn versteckt, und er ist mit dessen Tochter befreundet. Allerdings lebt er zurzeit mit einer Haitianerin zusammen."
"Ja, ich hab davon gehört." Cass seufzte. Das Liebesleben der dominikanischen Kameraden war manchmal verwickelt, aber er musste es im Auge behalten, sofern sie wichtig waren. Und Tomás war wichtig, ein Nationalheld mit dem Vater im Hintergrund, General Tomás, der unangefochten die Ostprovinzen kontrollierte. Der Sohn würde zweifellos bald Oberst sein, eine glänzende Laufbahn lag vor ihm. Nach Luna, Viñas, Wessín und Vasallo war er jetzt der fünftwichtigste Offizier des Landes.
"Übrigens", Cass wies auf das Magazin, "wo haben Sie das aufgetrieben?"
"Das ist von King, Sir", antwortete Fuller. "Er hat mir geholfen, die älteren Sachen zu beschaffen. Ziemlich stark, nicht wahr? Heute würde sich der Botschafter wohl kaum noch so äußern."
Cass nickte langsam; Kings Motiv war ihm restlos klar. "Und wenn, es wär sein gutes Recht. Wir denken nicht so, Hauptmann. Aber mein Standpunkt ist immer: Ehrliche Meinungsverschiedenheiten schaden nichts. Soll jeder doch sagen, was er denkt."
"Das ist genau meine Ansicht", erwiderte Fuller. Tatsächlich war er durchaus nicht dieser Ansicht, er hielt Mitchells Äußerungen für reichlich skandalös, fand es aber überhaupt schwer, in politischer Hinsicht zu einem klaren Urteil zu kommen. Und nun glaubte er, dass Meinungsverschiedenheiten nichts schadeten, da David C. Cass es ihm gesagt hatte. Er war ein Jasager und insofern ein recht angenehmer Mensch.
Kaum war der Hauptmann gegangen, da griff Cass wieder zu dem Heft. Jetzt, nachdem er wusste, was King damit bezweckte, würden ihn Mitchells Spitzen nicht mehr treffen. "Die Flotte stellte bei einer Machtübernahme oft die leitenden Persönlichkeiten", las er. "Als es 1916 nötig wurde, in Santo Domingo Ordnung zu schaffen, ergriff Captain Knapp, der Kommandant des Kreuzers 'Force', dort die Regierungsgewalt. Nach ihm fungierte Konteradmiral Snowden als Präsident, während seine Fregattenkapitäne die Ministerien leiteten. Erst 1922 löste Sumner Welles die Seeoffiziere ab. Er verkörperte eine Mischform von Militär- und Berufsdiplomat: den Typ des Hochkommissars, einen Zivilbeamten Washingtons, der sich gleichwohl auf die stabilisierende Gegenwart von Marinetruppen stützt." All das stimmte zwar, war aber aufreizend formuliert und gegen die US-Streitkräfte gerichtet. Der Oberst blätterte um. "Politik von Kriegführung zu trennen kam uns nie in den Sinn. Von George Washington bis Dwight D. Eisenhower glaubten wir, dass der, der das Heer befehligt, auch das Land zu führen weiß..." Entschlossen, ruhig zu bleiben, übersprang Cass die Aufzählung der Einmärsche und Landungen, die in dem Zusammenhang stets folgte: México, Honduras, Panama und so fort, siebzig Interventionen zwischen 1870 und 1933. Es war ein Kreuz mit den Liberalen, die einfach nicht aufhören konnten, im Schutt der Vergangenheit zu wühlen. Sie merkten wohl gar nicht, wie das den Feinden half, die immer versuchten, die USA als Kolonialmacht hinzustellen.
Der Schluss war unerträglich: "Den ethischen Ursprung solcher Schritte legte Präsident Coolidge dar, als er in seiner UP-Erklärung vom 25. Januar 1927 darauf verwies, dass die Personen und der Besitz eines Staatsbürgers Bestandteile des allgemeinen Gutes der Nation sind, auch im Ausland. Der formulierungsstarke Coolidge fügte hinzu: Jede Regierung, die sich selbst achtet, hat die instinktive und bindende Pflicht, den Personen und den Besitztümern ihrer Bürger, wo sie sich auch befinden mögen, Schutz angedeihen zu lassen... Diese Rechte gehen mit dem Bürger. Wo er auch hingeht, müssen ihm die Pflichten der Regierung folgen. – Und sei es bis nach Korea, bis zum Libanon oder bis nach Vietnam."
Cass stieß das Heft weg. Der letzte Satz bohrte in ihm. Doch eben das, so mahnte er sich gleich, wollte King – ihn aufbringen gegen Mitchell, einen Keil treiben zwischen Militärmission und Botschaft... CIA-Resident King, der den alten Hill spielend an den Rand gedrängt hatte, sanft und listig, nach dem Wahlspruch der Jesuiten: Stark in der Sache, mild in der Form. Aber nicht mit ihm! Er war auf der Hut.
Und trotzdem, den Ton dieses Artikels vergaß man nicht, den kalten Spott, die Frivolität. Mitchell mochte ein ehrenwerter Mann sein; Gewiss schrieb er nur das, wovon er überzeugt war. Über bittere Dinge hatte der Botschafter nachgedacht, und er wich vor keinem Ärgernis zurück. Aber was, so musste man doch fragen, kam zuletzt dabei heraus? Skepsis gegenüber seinem Land, dessen Führern und Einrichtungen! Eine defekte Welt, ein Hauch des Schäbigen, der alles überzog, was Amerikaner berührten und was US-Politik hieß. Schade um den Mann, um seinen glänzenden Verstand. Er konnte Ironie nicht zurückhalten, ätzend sickerte sie ein, durchdrang Morsches wie Gesundes und höhlte aus, wo verantwortliches Handeln den Schaden zementiert hätte. Womöglich wollte Mitchell heilen; er überschätzte nur, wie viele Linken, auf groteske Art seine Kraft.
Im Bürohaus der US-Botschaft besprach man die Lage, die sich aus den fortwährenden Unruhen in Santo Domingo ergab. Henry W. Mitchell hatte wichtige Mitarbeiter vor seinem Schreibtisch versammelt: den DCM (stellvertretenden Missionschef) Al Hemba, den Leiter der politischen Abteilung Holland, Botschaftsrat Smith, Pressesprecher Artus, Frank A. King und Fregattenkapitän Wolfe, den Senior der Militärattachés. Diese sechs Männer füllten die kleine Kanzlei mit ihren Berichten und Kommentaren. Woher rührte die Misere und was konnte man tun? Das war seit Mitchells Ankunft ein Hauptthema aller Beratungen; und es sah nicht so aus, als würde es heute gelingen, die Wurzeln des Übels zu finden und zu einer klaren Behandlung zu kommen.
Da hockten sie vor ihm auf der grünen Ledercouch und drehten sich im Kreis – der sanfte, einfühlsame Holland, der subalterne, doch landeskundige Smith und der listige King; der steckte immer voller kurzatmiger Ideen, die keine Lösung brachten, für ein paar Tage aber weiterhalfen und einen glauben machten, dass man etwas unternahm... Die Übrigen liefen umher, ans Fenster oder nach der Karaffe, um Eiswasser in sich hineinzuschütten oder im Stehen zu sprechen wie Wolfe, dieser drahtige Seeoffizier, und Artus, den es meistens hochriss, wenn ihm etwas einfiel.
Auch dem hageren Hemba fiel das Stillsitzen schwer. "Wir haben in diesem Jahr drei politische Ziele hier", sagte er viel zu laut. "Erstens, den Staatsrat im Amt zu halten. Zweitens, für freie Wahlen zu sorgen. Und drittens, deren Gewinner pünktlich und lebend in den Palast zu bringen. Das Programm wird auf jeder Stufe durch die Krawalle schwer bedroht."
"Nicht nur dadurch, Al", warf Holland ein. "Auch durch Intrigen hinter den Kulissen. Was tut eine provisorische Regierung in Lateinamerika, wenn sie nicht gestürzt wird? Sie versucht, ihre Amtszeit zu verlängern."
"Na schön", rief Al Hemba, "aber das hat man besser im Griff als ständige Zusammenrottungen und nicht lokalisierbare Unruhe. Daraus kann ein allgemeiner Aufruhr werden! Wenn solche Erschütterungen wochenlang andauern, dann machen sie nicht mehr an Stadtgrenzen halt."
Mitchell fand, dass Hemba sich wiederholte. Übrigens neigte er dazu, alles zu vereinfachen, während der sensible Holland die Dinge sorgsam auseinander hielt und an Schattierungen seine Freude hatte. Es waren sehr verschiedenartige Helfer, die einen stark in der Analyse, die anderen Männer der Tat, die dritten voller Erfahrung. Manchmal hatte das, was sie sagten, überhaupt keinen Sinn. Aber neue Gedanken kamen von ihnen nur, wenn man sie unbehindert reden ließ.