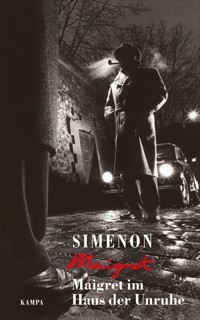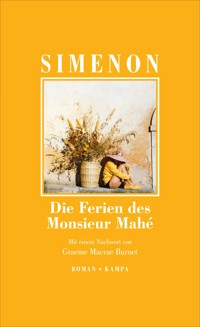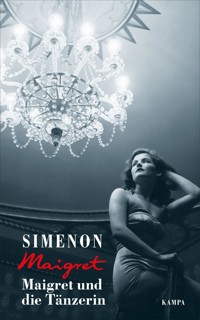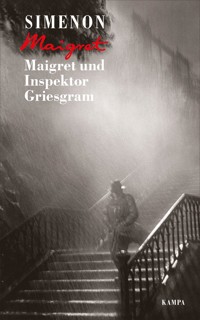Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georges Simenon. Weitere Titel
- Sprache: Deutsch
Blasse Haut, weiße Haare, gestärktes Hemd, schwarzer Anzug. Monsieur Froget ist eine altmodische Erscheinung. Als Untersuchungsrichter überführt er Verdächtige und braucht dafür nur wenige Worte. Er befragt einen Abenteurer, der in einem Luxushotel aufgegriffen wurde, einen New Yorker Kellner, der als blinder Passagier nach Frankreich geflohen ist, und immer wieder »Damen des Gewerbes«. Ob im Palais de Justice oder in den Nachtlokalen von Paris – Froget ist den Befragten immer einen Schritt voraus. Nach jedem Verhör zückt er sein Notizbuch, in das er Verdachtsmomente und Motive notiert, »eine Gewohnheit, die allmählich an Besessenheit grenzt«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges Simenon
Der Richter und die 13 Schuldigen
Vierzehn Fälle
Aus dem Französischen von Sophia Marzolff
Kampa
Ziliouk
Es war ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtigerGegner. In der Staatsanwaltschaft herrschte deshalb die Meinung, der Untersuchungsrichter Froget werde an diesem Fall schließlich scheitern, und manchen war das gar nicht unrecht.
Er saß an seinem Schreibtisch, mit gesenktem Kopf, die eine Schulter höher als die andere, eine unbequem aussehende Haltung.
Wie immer bot er ein Bild in Schwarz-Weiß: weiß seine Haut, sein Bürstenschnitt à la Prosper Bressant, sein gestärktes Hemd, schwarz sein strenger Anzug.
Sicher, er war eine etwas altmodische Erscheinung. Man hatte sich öfter einmal gefragt, ob er nicht längst die Altersgrenze erreicht hatte, denn schon vor Jahren hatte er ausgesehen wie sechzig.
Ich war wiederholt in seinem Haus am Champ-de-Mars zu Gast und möchte mir eine persönliche Bemerkung erlauben. Nie hat mich ein Mensch jemals so in die Knie gezwungen, mich so an mir selbst zweifeln lassen wie Monsieur Froget.
Ich erzählte ihm eine Geschichte. Er sah mich mit einem Blick an, den man für Ansporn halten konnte. Dann kam ich zum Ende, wartete auf seine Reaktion, einen Kommentar, ein Lächeln.
Er sah mich immer noch an, wie er eine Landschaft oder ein Beweisstück angesehen hätte, und stieß schließlich einen winzigen Seufzer aus. Ich schwöre Ihnen, es war genug, um mich für den Rest des Lebens Demut zu lehren. Ein einziger Seufzer, ein Lufthauch! Ich hörte heraus: »Und um mir das zu erzählen, machen Sie so ein Brimborium!«
Das ist natürlich nur eine oberflächliche Beschreibung, und ich werde sicher noch Gelegenheit haben, seinen tieferen Charakter zu schildern, so wie er sich mir offenbart hat.
Aber an jenem Tag in seinem Büro handelte es sich um einen Schlagabtausch von der Art, wie ich sie gerade geschildert habe und die man nicht einmal frostig nennen kann.
Er hatte vor sich Ziliouk, jenen verwegenen Abenteurer, von dem seit einigen Wochen in allen Zeitungen die Rede war, ein ungarischer Jude (oder polnisch, litauisch, lettisch, das wusste keiner so genau), der schon als Zwanzigjähriger aus fünf oder sechs europäischen Ländern ausgewiesen worden war.
Man hatte ihn (mit nun fünfunddreißig bis vierzig Jahren – oder doch eher dreißig, jünger oder älter?) in einem Pariser Luxushotel aufgegriffen, nachdem er Kontakt mit dem Ministerpräsidenten aufgenommen und ihm vertrauliche diplomatische Dokumente zum Kauf angeboten hatte.
Ob diese echt oder gefälscht waren? Darüber waren die Meinungen geteilt. Ziliouk hatte schon einmal sowjetische Dokumente an England verkauft, die zu einer Regierungskrise und dem Abbruch der Verhandlungen zwischen beiden Ländern geführt hatten. An Amerika hatte er japanische Unterlagen und an Japan amerikanische Unterlagen verkauft. Er hatte seine Spuren in Bulgarien, in Serbien, in Rom und Madrid hinterlassen.
Ziliouk war eine gut aussehende Erscheinung. Er trug elegante, fast luxuriöse Kleidung, wenngleich ihm immer etwas Halbseidenes anhaftete.
Er hatte mit Monarchen und Staatschefs korrespondiert. Hatte sich Eingang in diplomatische Kreise auf der ganzen Welt verschafft. Bei seiner Festnahme hatte er sich sogleich kämpferisch gegeben.
»Am Ende müssen Sie mich doch freilassen, und dann wird es Ihnen leidtun!«
Er ging so weit, gegen jeden Augenschein zu behaupten, dass er in Wahrheit für das Deuxième Bureau, den französischen Militärgeheimdienst, arbeite und in engem Kontakt mit dem britischen Secret Intelligence Service stehe.
Kein Richter wollte mit der Sache zu tun haben, dem Paradebeispiel eines Falles, der einem ehrbaren Untersuchungsrichter das Genick brechen und das traurige Ende seiner Karriere einläuten konnte.
Ziliouk saß da, in einem Anzug aus dem besten Herrenatelier Londons, wohlgepflegt, mit unbestimmtem Lächeln.
Eine Stunde lang richtete Froget nicht das Wort an ihn. Mit den zierlichen, präzisen Gesten einer knabbernden Maus las er die Berichte der mobilen Brigade, in deren Kopfzeile Fall Ziliouk stand, wie der Beschuldigte verkehrt herum entziffern konnte.
Froget las die Texte mit einer Ausführlichkeit, als sähe er sie zum ersten Mal. Anschließend betrachtete er den Verdächtigen mit dem ihm eigenen intensiven, bleischweren Blick. Er hatte nichts Durchdringendes oder gar Hellseherisches, auch nichts Grimmiges. Es war ein ruhiger Blick, der sich langsam auf einen Gegenstand richtete und dann stundenlang auf ihm verweilen konnte.
Seine ersten Worte, als Ziliouk sich mit ostentativer Lässigkeit eine Luxuszigarette anzündete, lauteten:
»Der Rauch ist mir ein wenig lästig …«
Und vielleicht zum ersten Mal in seiner beruflichen Laufbahn verspürte der Hochstapler ein Unbehagen. Und so beeilte er sich, großspurig zu antworten:
»Ich sage Ihnen lieber gleich, dass Sie nichts erreichen werden! Wenn die Dokumente, die ich Frankreich verkaufen wollte, gefälscht waren, wie behauptet wird, dann versuchen Sie doch einmal, mich deswegen zu verurteilen. Und angeblich soll ich vertrauliche Dokumente der französischen Außenpolitik an Deutschland verkauft haben, die ebenfalls gefälscht seien … Aber keiner hat diese Dokumente je gesehen! Der einzige Ankläger ist ein kleiner Beamter des Deuxième Bureau, und ich beweise Ihnen gern, dass der Mann sein eigenes Süppchen kocht, so wie ich auch beweisen werde, dass ich dem Deuxième Bureau erhebliche Dienste geleistet habe …«
Froget antwortete nicht. Er widmete seine Aufmerksamkeit einem weiteren Bericht, den er von Anfang bis Ende durchlas.
Schon eine Stunde war vergangen! Und Ziliouk wartete vergeblich auf ein Anzeichen von Neugier, Eifer oder Leidenschaft, kurz, auf irgendeine menschliche Regung. Wieder ergriff er das Wort.
»Und selbst wenn man mich verurteilen würde, dann höchstens zu drei Jahren, wie im Falle von X oder Z.« An dieser Stelle nannte er die Namen von Spionen, die unlängst von französischen Gerichten verurteilt worden waren. »Und danach würde Frankreich sich noch wundern!«
Die Papiere vor Froget raschelten. Der Richter war immer noch am Lesen. Er hatte Ziliouks sämtliche Ausweisdokumente vor sich liegen, eines zweifelhafter als das andere. Tatsächlich hätte man kaum mit Sicherheit sagen können, in welchem Land er eigentlich geboren war. Er hatte sich nacheinander Carlyle, Sunbeam, Smit, Keller, Lipton, Richet genannt. Und vermutlich gab es noch mehr Namen.
Bei seiner Festnahme hatte Ziliouk fünfzigtausend Dollar bei sich gehabt!
Jetzt saßen sie schon anderthalb Stunden einander gegenüber, und Froget hatte ihm noch immer keine Frage gestellt. Bei dem Dokument, das er zuletzt studiert hatte, handelte es sich um einen Militärbericht. Vor zehn Jahren war Ziliouk unter rätselhaften Umständen in Deutschland verhaftet und einen Monat später unter noch ominöseren Umständen freigelassen worden – dazwischen hatte er in seiner Zelle hohen Besuch aus der Wilhelmstraße erhalten.
Dass der Mann gefährlich war, stand außer Frage. Dass er ein Gauner war, gab er ja voller Stolz zu! Doch wie er selbst sagte, bot er den Gerichten keine wirklichen Angriffspunkte.
Froget saß nach wie vor mit seinen schiefen Schultern völlig unbewegt da, und sein teilnahmsloser Blick schweifte gelegentlich zu dem Beschuldigten, bevor er sich wieder auf die Unterlagen vor ihm richtete.
Plötzlich fragte er mit tonloser Stimme: »Würden Sie Ihre letzte Geliebte auf einem Foto wiedererkennen?«
Ziliouk fing an zu lachen.
»Schwerlich, Herr Richter! Schwerlich! Es war eine niedliche Kleine aus dem Picratt’s, der Bar in der Rue Daunou … Ich habe sie kaum gesehen …«
Und sein Lachen wurde zweideutig, ja anstößig. Er besaß noch die Dreistigkeit zu fragen:
»Gehört sie etwa zu Ihren Freundinnen?«
»In welcher Sprache haben Sie mit ihr geredet?«
Und wieder gab Ziliouk eine betont anzügliche Antwort. Sein Satz, der sich hier kaum wiedergeben lässt, entlockte dem Richter keinerlei Gemütsbewegung.
»Einmal hat das Mädchen im Dialekt von Lille zu Ihnen gesprochen, worauf Sie ihr im gleichen Dialekt geantwortet haben. Das hat sie aus der Fassung gebracht, denn sie hatte gewisse unfreundliche Dinge geäußert und nicht damit gerechnet, von einem Ausländer verstanden zu werden.«
Ziliouk schwieg. Auch der Richter schwieg, fast eine Viertelstunde lang. Er prüfte ausführlich die Akte, dann eine andere Akte, auf deren gelbem Deckel in sorgfältiger Rundschrift Fall Stephen stand.
Ziliouk konnte die dicke Überschrift so gut lesen wie Froget. Und dieser ließ ihm genug Zeit, um sich schon einmal Antworten und kleinste Reaktionen zu überlegen.
Die Akte war vor acht Jahren erstellt worden, und genauso lange ruhte das Verfahren. Es ging darin um eine Madame Stephen, Ehefrau von Pierre Stephen, die unter mysteriösen Umständen von ihrem Liebhaber, einem polnischen Arbeiter, ermordet worden war, der daraufhin spurlos verschwand.
Der Ehemann Pierre Stephen arbeitete als Werkmeister in einer Chemiefabrik, der man einen Artillerieoffizier zugeteilt hatte, was nahelegt, dass dort Forschungen betrieben wurden, die die nationale Verteidigung betrafen.
Zur selben Zeit waren wichtige Dokumente von dort verschwunden, darunter die Bauanleitung eines neuen Typs von Gasmaske.
Ebenfalls zu dieser Zeit lebten die Stephens auf ungewöhnlich großem Fuß und machten diverse Anschaffungen, die nicht recht mit ihrer finanziellen Situation zusammenpassten.
Dann das Drama: Madame Stephen wurde am Fuße einer Bergwerkshalde tot aufgefunden.
Von ihrem Liebhaber war kaum etwas bekannt. Man hatte ihn durch die Gegend streifen sehen. Er lebte im Barackenlager einer ganzen Sippe von polnischen Arbeitern, aber seine Mitbewohner wussten nicht zu sagen, in welcher Fabrik er tätig war. Nicht einmal seinen Namen kannten sie.
Er war direkt am Tag des Verbrechens verschwunden.
Das Spiel folgte nun spürbar neuen Regeln, und Ziliouk reagierte mit umso größerer Kühle und Überheblichkeit.
»Ich weiß nicht, was Sie damit anfangen wollen!«, sagte er mit beißendem Spott. »Wenn Sie möchten, könnte ich Ihnen auch in der Sprache der javanischen Kulis antworten oder im Jargon der Ford-Arbeiter …«
Damit hatte er recht. Er beherrschte außergewöhnlich viele Sprachen. So war in einem drei Jahre alten Bericht von seinem Aufenthalt in China die Rede, wo er als enger Berater eines südchinesischen Generals gewirkt hatte.
Bei seiner Verhaftung durch einen Inspektor der Kolonialpolizei hatte er an dessen Krawatte eine Nadel bemerkt, die von den indonesischen Moi gefertigt worden war, und sofort in der Sprache dieses Volksstammes zu reden begonnen.
Mit keinem Wort ließe sich jedoch das Desinteresse von Monsieur Froget beschreiben, dessen Haltung sich seit Beginn der Sitzung um kein Jota verändert hatte.
Die meisten Untersuchungsrichter bombardieren einen Beschuldigten mit Fragen, versuchen ihn regelrecht benommen zu machen und ihm auf diese Weise einen Satz zu entlocken, der einem Geständnis gleichkommt.
Nicht so Froget: Er ließ seinem Gegenüber Zeit zu überlegen, ja sogar zu viel zu überlegen. Die Schweigepausen dauerten mehrere Minuten, seine Fragen nur wenige Sekunden.
Bislang hatte er überhaupt nur zwei formuliert. Später sollte ein neugieriger Fachkollege einmal die Sätze zählen, die Froget im Laufe dieses entscheidenden Verhörs von sich gab.
Jetzt las der Richter still für sich ein Telegramm, das er an die Staatsanwaltschaft von Lille geschickt hatte, und anschließend deren Antwort.
Frage: Woher kamen die Stephens ursprünglich? Wie lange lebten sie schon in Lille, als sich der Mord ereignete?
Antwort: Sie kamen von der Loire. Sie sind einen Monat vor dem Mord von Saint-Étienne nach Lille gezogen. Die Fabrik in Lille hatte bei der Fabrik von Saint-Étienne einige Spezialisten für ein neues Produkt angefragt, beide Betriebe gehören zur gleichen Finanzgruppe. Stephen war unter den Fachleuten, die im Juni in den Norden zogen.
Zum dritten Mal formulierte Froget eine Frage.
»Können Sie mir sagen, wo Sie im Juni vor acht Jahren waren?«
Das Verbrechen hatte Mitte Juli stattgefunden.
»In Berlin!«, antwortete Ziliouk prompt. »Und wenn Sie es genau wissen wollen, ich stand damals in engem Kontakt mit der Wilhelmstraße. Ich weiß zwar nicht, worauf Sie hinauswollen, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie auf dem Holzweg sind. Ich kenne die Stephens nicht.«
Froget blätterte eine Seite um und studierte ein letztes Dokument, das ihm vom Deuxième Bureau übermittelt worden war. Darin stand:
Pierre Stephen, Werkmeister in der Waffenmanufaktur von Saint-Étienne, wurde von seinen Kollegen verdächtigt, mit feindlichen Agenten in Verbindung zu stehen. Da keine Beweise gegen ihn vorgebracht werden konnten, wurde er auf Anraten der Spionageabwehr Ende Juni nach Lille versetzt, wo man Arbeiter mit seiner Spezialisierung benötigte.
Man wollte überprüfen, ob dort ebenfalls Dokumente verschwinden würden.
Bevor Stephen jedoch eine Schuld nachgewiesen und vor allem seine Komplizen enttarnt werden konnten, veränderte die Ermordung seiner Frau durch einen Unbekannten die Situation, und danach bot Stephens Verhalten keinen Anlass zu weiteren Verdächtigungen.
Stark mitgenommen und gealtert, hat er die Fabrik kurz nach der Tragödie verlassen und arbeitet seither als Nachtwächter in einem Betrieb in Pantin.
Froget hatte bisher kaum mehr als vier Sätze geäußert. Ohne sich das Geringste anmerken zu lassen, erhob er sich von seinem Stuhl, wobei er größer und breiter erschien, als es im Sitzen den Eindruck gemacht hatte.
Er betrachtete Ziliouk, wie man einen einigermaßen vertrauten Gegenstand betrachtet. Widerwillig wie jemand, der einer lästigen Pflicht nachkommt, sagte er, während er seinen schwarzen Hut mit dem Aufschlag seines Ärmels säuberte:
»Ich beschuldige Sie des vorsätzlichen Mordes an Madame Stephen.«
»Wie das?«, fragte Ziliouk, der sich eine weitere Zigarette anzündete.
Froget schien ihn nicht zu hören. Ein kleiner Fleck auf seinem Hut beanspruchte offenbar seine ganze Aufmerksamkeit.
»Sie haben keinen einzigen Beweis!«, sagte Ziliouk mit Nachdruck.
Das Wort »Beweis« brachte Froget wieder in die Realität zurück. Langsam sagte er:
»Sie meinen einen Beweis für Ihre Schuld? Nun, hier ist er: Auf meiner Akte konnten Sie lediglich den Vermerk Fall Stephen lesen. Sie sagten aber zu mir: ›Ich kenne die Stephens nicht.‹ Dieser Plural ist Ihr Geständnis.«
Ziliouk steckte den Schlag ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Darin war er ganz sein Gegner. Aber er sagte kein Wort mehr.
Froget schien seinem Sieg allerdings wenig Bedeutung beizumessen. Wie sollte ein so leichter Triumph ihn auch zufriedenstellen? Nach einem letzten prüfenden Blick auf seinen Hut fügte er lakonisch hinzu:
»Ein Kind hätte die Sache durchschaut. Abgesehen von diesem formalen Beweis, der Ihr Geständnis enthält, haben drei Verdachtsmomente und Hinweise Sie überführt …«
Und Froget zählte an den Fingern ab:
»Erstens, dass Sie den Dialekt von Lille beherrschen … Zweitens, dass Sie mir so übertrieben schnell und präzise auf die Frage antworten konnten, wo Sie sich im Juni vor acht Jahren aufhielten … Drittens die Tatsache, dass Sie für die deutsche Spionage gearbeitet haben.«
Er schloss:
»Im Grunde eine banale Geschichte. Die Stephens besorgen Ziliouk, einem Agenten in deutschen Diensten, geheime Dokumente, die die Landesverteidigung betreffen. Als Ziliouk erfährt, dass man die Stephens verdächtigt und nach Lille versetzt, fürchtet er, seine Geliebte könnte ihn verraten und als Komplizen enttarnen. Er beschließt, sie aus dem Weg zu räumen … Das Verhalten des Werkmeisters Pierre Stephen aber hat seit der Ermordung seiner Frau, die für sie beide gebüßt hat, keinen Anlass mehr zu Misstrauen gegeben … Das ist alles!«
Und Froget läutete nach den Wächtern.
Monsieur Rodrigues
Frogets Anwesenheit in jener Wohnung im sechsten Stock eines Hauses der Rue Bonaparte hatte schon für sich genommen etwas Irritierendes. Es war schwer zu sagen, was am meisten daran befremdete, was fast unschicklich erschien, diese Wohnung oder der schwarz gekleidete Untersuchungsrichter, der seine Augen umherschweifen ließ, glasklar und rund wie zwei Objektive.
Die zwei Polizisten in Zivil, die Monsieur Rodrigues hergebracht hatten, waren draußen vor der Wohnungstür geblieben. Der Gerichtsschreiber, der den Richter seit zehn Jahren kannte, hielt sich so diskret um ihn auf, dass man seine Anwesenheit kaum noch wahrnahm.
Monsieur Rodrigues vervollständigte die bizarre Atmosphäre und machte sie verständlich, auch wenn mehrere Tage in Haft seine exzentrischen Seiten gemildert hatten.
Es gab fünf Räume mit schräger Decke, denn man befand sich direkt unter dem Dach. Nichts sah nach einem Esszimmer, einer Küche oder einem Schlafzimmer aus, stattdessen überall das gleiche Ambiente: eine verschwenderische Fülle von Teppichen, überwiegend in Rottönen, die ins Violette spielten, Nippsachen von ausgesuchter Originalität, fantastische Gebilde der verschiedensten Völker und Epochen; in jedem Winkel Diwane; niedrige Tische; auf dem Boden verteilte Kissen …
Das Einzige von annähernd praktischer Bedeutung waren eine angeschlagene Teekanne, einige leere Gläser, geöffnete Flaschen, ein Primus-Kocher, der einsam auf einem der Teppiche stand, und eine Zahnbürste, die jemand in eine Champagnerschale gesteckt hatte.
Das alles hatte etwas so Erlesenes wie Abstoßendes. Es roch nach Räucherharz, kostbaren Parfüms und Dreck.
Dazu passte der große, magere Hausherr, der an einen abgehalfterten Aristokraten oder einen verwelkten Clown erinnerte.
Er war fünfundfünfzig Jahre alt und kleidete sich wie ein Jüngling. Außerdem trug er Puder, und sein Haar war gefärbt. Aus der Nähe betrachtet erkannte man eine dünne Narbe auf seinem Nasenrücken.
Wie er gerne selbst erläuterte, stammte sie von einer Operation, der er sich unterzogen hatte, um die Form seiner Nase zu verändern und so mehr Harmonie in seine Gesichtszüge zu bringen.
»Die erste Pflicht eines Mannes ist es, schön zu sein, so wie Tiere und Blumen schön sind!«, hatte er dem Richter erklärt.
Er war abscheuerregend. Eine aufgetakelte männliche Schabracke! Eine Mischung aus Verfall und falscher Jugend.
Die Polizeiberichte waren jedoch eindeutig: Wenn er auch vor allem junge Männer empfing, fast alle wie er spanischer Herkunft, konnte man ihm doch keine widernatürlichen Praktiken nachweisen.
Überall lagen Bücher herum: allesamt Gedichtbände, und noch von besonders hermetischen Dichtern.
Trotz der Anschuldigung, die auf ihm lastete, blieb Rodrigues einigermaßen gelassen. Es gelang ihm sogar weitgehend, das Zucken in seinem Gesicht zu kontrollieren. Allerdings trug er wie üblich eine dicke Schicht Schminke auf der Haut.
Er begann als Erster zu reden, während der Richter mit derselben Geruhsamkeit hin und her wanderte, die er bei einem kleinen Verdauungsspaziergang an den Tag gelegt hätte.
»Sehen Sie doch ein, dass Sie nichts gegen mich vorbringen können! Selbst wenn Sie tausend Indizien hätten, könnten Sie keine wirkliche Erklärung für diese Tat finden.«
Drei Psychiater hatten bestätigt, dass er, wenn auch degeneriert, doch zurechnungsfähig sei.
Und dennoch hatte er einen Mord begangen! Das war eine moralische und rationale Gewissheit, sozusagen eine dieser offenkundigen Wahrheiten, die keines Beweises bedürfen.
Monsieur Rodrigues empfing regelmäßig Gäste. Er galt als reich. Er war rauschgiftsüchtig, und oft kamen junge Leute, um hier ganze Nächte lang Opium zu rauchen, zwischen den Kissen, Teppichen, Wandbehängen, all diesem albernen und feierlichen Zinnober, der einen stechenden Geruch nach Drogen, Schmutz und menschlichem Schweiß verströmte.
Am Dienstag der vergangenen Woche sieht die Concierge gegen acht Uhr abends einen jungen Mann die Treppe hochsteigen, den sie noch nie gesehen hat. Mitten in der Nacht hört sie im Treppenhaus ungewohnte Geräusche. Sie vermutet, dass Monsieur Rodrigues und sein Gast betrunken sind, denn oben im Dachgeschoss frönt man ebenso gerne dem Champagner, wie man sich dem Opium oder dem Heroin hingibt.
Sie zieht die Türschnur zum Öffnen, schläft wieder ein, öffnet etwas später einem Mieter, der seinen Namen nicht nennt.
»Monsieur Rodrigues hat seinen immer sehr laut gerufen!«, wird sie der Polizei später sagen.
Am Morgen entdeckt man in der Seine, gegenüber der Rue Bonaparte, die Leiche eines jungen Mannes, die vom Kai ins Wasser geworfen wurde und durch einen unwahrscheinlichen Zufall mit ihrer Kleidung am Haltetau eines Frachtkahns hängen geblieben ist.
Am Körper des Toten sind drei Stichwunden zu verzeichnen, in seinen Taschen befinden sich keine Ausweispapiere. Die Polizei beginnt zu ermitteln. Noch am selben Tag wird die Leiche identifiziert: Es handelt sich um den Sohn des Herzogs und der Herzogin von S., die am spanischen Königshof eine prominente Rolle spielen.
Ein Inspektor taucht bei Monsieur Rodrigues auf. Zuvor hat er in Erfahrung gebracht, dass sich das Opfer, das sich nur für kurze Zeit in Paris aufhielt, einer fragwürdigen Gruppe von Landsleuten angeschlossen hatte, die zwischen Montmartre, Montparnasse und gewissen Bars der Champs-Élysées ihre Runden zog.
Da S. den Wunsch hegte, einmal einen Opiumrausch zu erleben, stellten sie ihm Monsieur Rodrigues vor, der ihn zu sich einlud.
Auf einem der roten Teppiche entdeckt der Inspektor dunkle Flecken, in denen die Spurenexperten menschliches Blut zu erkennen glauben.
»Aber natürlich! Schauen Sie sich einmal meinen Finger an, wo ich mich am Montag geschnitten habe …«, hat Rodrigues darauf entgegnet.
»Als Sie Ihren Gast angegriffen haben?«
»Warum sollte ich ihn angreifen? Ich versichere Ihnen, er hat ungehindert die Wohnung verlassen. Ich habe ihn noch bis zur Ecke Rue Bonaparte und Boulevard Saint-Germain begleitet, weil er ziemlich betrunken war. Er wollte partout kein Taxi nehmen, wie ich ihm geraten hatte. Offenbar ist er dann wieder umgekehrt und am Seineufer gelandet, wo ihn irgendwelche Ganoven ermordet haben …«
»War er zum ersten Mal bei Ihnen?«