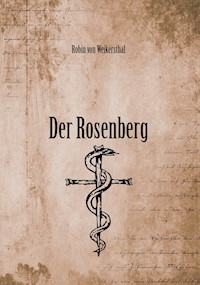
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Telescope Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosenheim, 1942.Der knapp achtzehnjährige Paul ist jüdischer Abstammung und wird zusammen mit seinen Schwestern auf der Straße von einer deutschen Patrouille kontrolliert. Während die Polizei beide Schwestern gewaltsam in ihren Wagen zerrt, wird Paul von der wohlhabenden Alexandra von Wertheim, der Witwe eines hohen SS-Offiziers, gerettet, die ihn als ihren Sohn ausgibt.Sie nimmt ihn bei sich auf, verschafft ihm eine neue Identität und deutsche Papiere. Nicht ohne Gegenleistung. Paul zahlt einen hohen Preis. Er verkauft sich selbst an die ältere Frau, die ihn immer mehr vereinnahmt. Und das, obwohl er in der Nachbarin Romy seine große Liebe findet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robin von Weikersthal
Der Rosenberg
Impressum
© Telescope Verlag
www.telescope-verlag.de
Redaktionelle Bearbeitung und Lektorat: Sandra Schindler
Meiner Mutter.
Alles Gute und bleib so positiv, wie du bist.
Du schaffst das!
Prolog
Manchmal sagte seine Großmutter, die Juden seien ein eigenartiges Volk. Damals verstand er nicht, was sie damit meinte. Paul war Jude und fand seine Familie nicht eigenartiger als andere Familien auch.
Doch wenn er genauer darüber nachdachte, musste er sich eingestehen, dass schon manches merkwürdig gewesen war. Einmal hatte er mit seinem Vater Karl, seiner Mutter Waltraud und seiner großen Schwester Eva eine Oper von Mozart gesehen. Kaum hatten sie gemeinsam das Münchner Residenztheater verlassen, begann seine Mutter ganz hemmungslos und lauthals auf der Straße zu singen. Paul konnte sich noch genau daran erinnern, dass seine Mutter in der Pause ein Glas Sekt getrunken hatte. Normalerweise trank Waltraud nie Alkohol. Dem kleinen Paul war der Auftritt seiner Mutter mehr in Erinnerung geblieben als die Hochzeit des Figaro selbst.
Auch zu Hause sang seine Mutter gern oder summte vor sich hin, wenn sie in der Küche einen Kuchen backte oder die Wäsche auf dem Dachboden aufhängte. Sie hatte eine schöne Stimme, soweit er das beurteilen konnte, aber es war ihm unangenehm, wenn sie in der Öffentlichkeit trällerte.
Paul lag diese Art der Kunst nicht. Wenn sie an Weihnachten vor der Bescherung „O du Fröhliche“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“ anstimmten, bewegte er nur stumm die Lippen und beschränkte sich aufs Zuhören.
Eigentlich seltsam, dass sie Weihnachten feierten. Denn für Juden gab es keinen Jesus und somit auch keinen Geburtstag des Heilands. Nur messianische Juden glaubten an den biblischen Jesus der Christen, den sie Yeshua nannten und der als Retter Israels gehuldigt wurde. Pauls Familie gehörte nicht dieser Glaubensrichtung an und für Pauls Eltern waren messianische Juden auch keine Juden, sondern Christen. Trotzdem feierte die Familie Weihnachten, weil die Kinder die Geschichte von der Geburt Jesu in einer Krippe in Bethlehems Stall liebten. Vor allem aber das Fest als solches: den geschmückten Baum, die roten Kerzen und nicht zuletzt die Geschenke. Bei christlich erzogenen Kindern war das wohl nicht anders.
Als Paul in Rosenheim auf das Gymnasium kam, feierten sie zum letzten Mal Weihnachten. Danach waren die Kinder alt genug, um zu verstehen, warum es für Juden kein Weihnachten gab. Als wenn Weihnachten eine Frage des Alters wäre.
Von da an feierten sie Hanukkah, ein jüdisches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem 164 vor Christus. Sie feierten am 25. Dezember, aber das Lichterfest war eben nicht Weihnachten. Dabei schien Christus in Bayern allgegenwärtig zu sein. In jeder Gastwirtschaft hing das Kreuz und selbst die allgemein gültige Zeitrechnung ging in der westlichen Welt von seiner Geburt aus.
Sie lebten in einem christlich geprägten Land und das war nicht zu leugnen. Während seiner Schulzeit merkte Paul das immer wieder. Es hatte ihn nie gestört. Er wurde nie gehänselt und die meisten seiner Freunde waren nicht jüdisch. Paul trug keine Kippa. Er besaß nicht einmal eine. Nur sein Vater setzte die gebräuchliche Kopfbedeckung auf, wenn er in die Synagoge oder auf den Friedhof zum Grab seines Vaters ging. Aber auch nur dann. Rein äußerlich unterschieden sie sich in nichts von den Katholiken oder Protestanten. Glaubten sie.
Familie Rosenberg war bayerischer und traditionsbewusster als die meisten ihrer Nachbarn. Paul und seine Schwestern wurden streng erzogen. Sie wussten sich bei Tisch zu benehmen, waren artige und gute Schüler. Die Mutter war Hausfrau. Nur abends saß sie manchmal über den Büchern und kümmerte sich um die Buchhaltung und die Korrespondenz.
Pauls Mutter schien immer zu Hause zu sein. Zumindest war sie immer da, wenn er und seine beiden Schwestern aus der Schule kamen. Dann stand meist das dampfende Essen in bunt-verzierten Rosenthal-Porzellanschüsseln auf dem Tisch und die ganze Familie nahm gemeinsam das Mittagessen ein. Manchmal mit dem Vater. Manchmal ohne.
Karl Rosenberg war Apotheker. Das Ladenlokal hatte er von seinen Schwiegereltern übernommen. Einst war er dort in die Lehre gegangen und hatte sich in die Tochter des Hauses verliebt. Schon damals, als Neuling in der Rosenheimer Löwen-Apotheke, arbeitete er mit vollkommener Hingabe und Herzblut. Karl liebte seine Arbeit, seine Kunden und die historische Einrichtung, die aus dem 18. Jahrhundert stammte. Ein Vorfahre seiner Frau hatte die Apotheke 1740 gegründet und noch im gleichen Jahr wurde sie zur königlichen Hofapotheke ernannt.
Karls Eltern hatten kein Geld für das Pharmaziestudium ihres Sohnes, aber Waltrauds Vater investierte, als die Beziehung zu seiner Tochter ernster wurde, in die Ausbildung seines Schwiegersohns in spe. So kam es, dass Karl an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Pharmazie studieren konnte. Bereits in Karls erstem Semester wurde Waltraud schwanger und die beiden mussten auf Drängen ihrer Eltern heiraten, sonst hätte Waltrauds Vater die Studienfinanzierung sofort wieder eingestellt. Waltraud wäre das nur recht gewesen, denn ihr gefiel es nicht, dass ihr Angetrauter in München studierte, wo er eine kleine Kemenate bewohnte. Sie vertraute ihm, aber sie vermisste ihn unter der Woche sehr. Und wenn Karl am Wochenende zu ihr kam, musste er lernen.
Nach der Geburt ihres ersten Kindes, der kleinen Eva, änderte sich Waltrauds Alltag schlagartig: Waltraud, das verwöhnte Mädchen, wurde über Nacht erwachsen. Sie war eine rührende Mutter. Doch plötzlich missfiel ihr die räumliche Nähe zu ihren eigenen Eltern. Am liebsten wäre sie ausgezogen. Am besten zu Karl nach München. Doch das waren Hirngespinste. Sie hatten kein Geld und ohne die Hilfe ihrer Eltern wären sie völlig hilflos gewesen. Also musste Waltraud sich wohl oder übel mit der Situation abfinden. Immerhin hielt die kleine Eva sie so auf Trab, dass sie kaum noch Zeit hatte, ihren geliebten Karl zu vermissen.
Waltraud und ihre Mutter stritten häufig. Nach Evas Geburt verging einige Zeit, bis Waltraud sich einen gewissen Freiraum erkämpft hatte, den ihre Eltern akzeptierten. Dennoch versuchte die Oma größtmöglichen Einfluss auf die Erziehung ihrer Enkelin zu nehmen. Wenn es sein musste heimlich oder gegen Waltrauds Willen.
Die kleine Eva liebte ihre Oma. Im Gegensatz zu ihrer Mutter blieb Oma Margarethe stets die Ruhe in Person. Sie war immer lieb, hatte Zeit zum Spielen und hörte zu.
In Karls drittem Studienjahr kam Paul zur Welt. Er wurde der ganze Stolz seines Großvaters, der ihm am liebsten sofort die Apotheke und das Haus überschrieben hätte. So sehr er seinen Schwiegersohn schätzte, war er doch nicht sein Fleisch und Blut.
Weitere zwei Jahre später bekamen Eva und Paul noch ein Schwesterchen. Hilde war schon bei ihrer Geburt von außergewöhnlich kräftiger Natur und mit vier Jahren schon stärker als ihr großer Bruder. Die Nachbarn nannten sie „Hilde, die Wilde“ und jedes Kind in der Gegend kannte sie. Hilde spielte Fußball mit Jungen, die doppelt so alt waren, und bald wurde sie meist zuerst in die Mannschaft gewählt. Die Jungen akzeptierten sie. Eine gute Entscheidung, denn Hilde war alles andere als zimperlich. Das bekamen auch ihre Geschwister zu spüren, wenn gestritten wurde.
Waltraud konnte sich nicht erklären, wie sie zu einem derartigen Kind gekommen war. Niemand sagte es, aber Hilde passte so gar nicht in die Familie. Nur einmal hörte Paul, wie seine Großmutter sagte: „Die Hebamme muss das Kind vertauscht haben!“
Eine Zeitlang glaubte Paul, Hilde sei nicht seine richtige Schwester. Die Familienähnlichkeit war jedoch unverkennbar. Je älter er wurde, desto mehr war Paul es, der rein optisch nicht in die Familie passte: Ein hübsches Kind, das zu einem auffallend schönen Mann heranwuchs. Sein dunkles, kurzes Haar trug er brav gescheitelt, die hohen, markanten Wangenknochen und seine großen braunen Augen fielen jedem Mädchen in der Stadt auf. Sein Gesicht war von einer ungewohnten Ebenmäßigkeit, seine Haut makellos und seine Lippen wohlgeformt.
Waltraud war keine hässliche Frau. Auch Eva nicht. Doch mütterlicherseits prägten etwas zu groß geratene Nasen die Gesichter. Pauls zierliche Nase passte hingegen ebenso perfekt zu seinem Antlitz wie der Rest in seinem Gesicht. Auch seine große und schlanke Figur fiel auf und manchmal blieben Menschen stehen, nur um ihn anzusehen.
Im Alter von fünfzehn Jahren begann Paul, an schulfreien Samstagen in der Apotheke auszuhelfen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich an diesen Tagen kichernde Mädchen aus der Schule einfanden. Aus Verlegenheit kauften sie etwas oder drückten sich nur am Schaufenster die Nase platt.
Nicht nur kleine Mädchen wurden von Paul in den Bann gezogen.
„Eine Mark und zwanzig Pfennige“, wiederholte Paul, aber die Dame gegenüber reagierte nicht.
„Oh Gott!“, stammelte sie schließlich erschrocken – ehe es aus ihr heraussprudelte: „Entschuldigen Sie bitte. Ich war abgelenkt. Wissen Sie: Ich habe noch nie einen so schönen Mann gesehen. Wobei: Sagt man das zu einem Mann überhaupt? Heißt es nicht besser ein gut aussehender Mann?“
Sie redete sich um Kopf und Kragen. „Äußerst gut aussehend“, ergänzte sie und lief rot an.
Paul fand solche Komplimente unangenehm, aber er hatte sich daran gewöhnt. Hastig packte die Frau die Arznei in ihre Tasche, drehte sich um – und lief direkt in einen Ständer mit Taschentüchern, der krachend zu Boden fiel.
Sie bückte sich.
„Lassen Sie das“, sagte Paul höflich, um sie vom Aufräumen und weiteren Missgeschicken abzuhalten, „ich mache das schon.“
Er schmunzelte, als die Frau die Apotheke verließ.
Je älter er wurde, desto mehr wurde ihm bewusst, dass er anders war als andere Jungen in seinem Alter. Allmählich lernte er die Vorteile seines Aussehens zu nutzen. Selbst seine eigene Mutter konnte er um den Finger wickeln. Von seiner Großmutter ganz zu schweigen. Nur bei Hilde, der Wilden, versagte sein Charme, und als ihm die kleine Schwester einmal ein blaues Auge verpasste, war das für Waltraud, als hätte jemand einen ihrer Porzellanengel zerstört.
Die Sammlung ihrer Porzellanengel war Waltrauds Allerheiligstes. Fein säuberlich aufgereiht standen sie in allen Größen auf der Anrichte im Esszimmer. Mit einem winzigen Wedel wischte die Mutter hier jeden zweiten Tag Staub und verbrachte damit genauso viel Zeit wie mit dem Wischen von Küche, Diele und Badezimmer zusammen.
Kapitel 1
Paul war acht Jahre alt, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den NSDAP-Führer Adolf Hitler zum Reichskanzler. Das hatte Paul schnell wieder vergessen, denn später nannte man den wichtigsten Mann im deutschen Reich schlicht „Führer“.
Paul interessierte sich, wie die meisten Kinder seines Alters, nicht für Politik. Trotzdem ahnte er, dass diese Wahl keine gewöhnliche Reichstagswahl war. Auch wenn er nicht verstand, was seine Eltern so beunruhigte, spürte er ihre Besorgnis. Paul wusste, dass Faschismus nichts Gutes war. Warum, das wusste er nicht. Er hatte das Wort schon öfter gehört, aber auf Nachfrage immer eine unverständliche, unbefriedigende Antwort erhalten. Deshalb hatte er es aufgegeben zu fragen. Genauso ging es ihm mit einem anderen Wort: Nationalsozialismus. Wie so oft gab es die schwierigsten Antworten auf die einfachsten Fragen.
Neun Jahre später, Frühjahr 1942.
Seit dem 1. September 1939 war Krieg. Von den Schlachten in Polen spürten die Rosenheimer wenig. Manchmal gelang es ihnen sogar, den Kriegszustand erfolgreich zu verdrängen. Nur der Judenstern erinnerte die Rosenbergs daran, dass sich auch im eigenen Land einiges geändert hatte. Alle vier trugen sie seit über einem Jahr das vom Nazi-Regime für ihr Volk vorgeschriebene Zeichen: Zwei überlagerte, schwarzumrandete, gelbe Dreiecke, die einen sechszackigen Stern bildeten.
Seit die Kennzeichnung der Juden von oberster Stelle angeordnet worden war, gingen sie nur noch auf den Wochenmarkt am Ludwigsplatz, wenn es nötig war. Statt wie früher jeden Samstag nur noch einmal im Monat.
Paul half seinem Vater Karl beim Tragen, seine Schwester Eva hatte meist eine eigene Einkaufsliste.
Frau Klinker machte den besten Obatzter der Stadt. In ihrem Spezialitätenladen am Rande des Marktplatzes gab es auch Käse, der teilweise von weit her geliefert wurde. Obatzter war eine neue Käsecreme aus verschiedenen Sorten und Gewürzen – Pauls liebster Brotaufstrich. Seine Mutter streute gern noch etwas Schnittlauch darauf, was er als überflüssig empfand, sich aber nie beschwerte, weil der Schnittlauch ohnehin nach nichts schmeckte.
Frau Klinker schien immer genug zu essen zu haben. Zumindest deutete ihr korpulentes Äußeres darauf hin. Ihr Alter ließ sich schlecht schätzen. Sie hätte sechzig sein können, dann hatte sie sich gut gehalten. Vielleicht war sie aber auch erst dreißig. Obwohl Frau Klinker ihn immer etwas griesgrämig anschaute, mochte sie Paul, der als kleiner Junge bei jedem Einkauf etwas geschenkt bekommen hatte. Ein Stück Käse, ein kleines Laugenteilchen oder eine Scheibe Wurst. Nur wenn Hilde oder Eva dabei gewesen waren, hatte es nichts gegeben. Auch für Paul nicht. Womöglich war Frau Klinker zu geizig, gleich zwei oder drei Geschenke zu verteilen. Deshalb ging Paul mit seinem Vater am liebsten allein zu ihr. Daran hatte sich auch nichts geändert, als er älter geworden war.
Den Spezialitätenladen am Marktplatz hatten sie schon länger nicht mehr besucht.
„Dort ist einfach völlig überteuert und die Sachen sind woanders genauso gut!“, erklärte Karl Rosenberg.
Eine glatte Lüge, dachte Paul. Die Tatsache, dass Waltraud für ihren zwanzigsten Hochzeitstag darauf bestand, Käse aus dem Spezialitätenladen zu kaufen, sprach dafür, dass das Angebot etwas Besonderes war. Paul fragte sich, ob er von Frau Klinker immer noch eine Scheibe Käse auf die Hand bekommen würde. Schließlich war er jetzt siebzehn und ein junger Mann.
Die Voraussetzungen waren gut, denn die Familie hatte sich aufgeteilt. Während Eva mit ihrer Mutter die weißen Tischdecken aus der Reinigung abholte, betrat Paul mit seinem Vater den Spezialitätenladen, der etwas abseits von den Marktständen lag.
Die Einrichtung hatte sich in den letzten Jahren nicht verändert. Auch Frau Klinker sah aus wie immer – oder vielleicht noch ein bisschen runder.
Paul war sich sicher, dass sie ihn erkannte. Er lächelte ihr zu. Sie lächelte nicht zurück, sondern guckte etwas seltsam und nervös, während sie sich offenbar mühsam darauf konzentrierte, den Kunden vor ihnen zu bedienen. Sie schnitt für den älteren Herrn Appenzeller in Scheiben und wog den Käse anschließend ab. Dabei warf sie immer wieder einen Blick über die Schulter des Mannes auf Paul und seinen Vater. Sie wirkte irritiert und wurde zunehmend unruhig.
Frau Klinker kassierte den Herrn freundlich ab und Pauls Vater machte einen Schritt auf den Verkaufstresen zu. Noch bevor er bestellen konnte, sagte sie: „Es tut mir leid. Ich darf Ihnen nichts verkaufen.“
„Frau Klinker!“, erwiderte Pauls Vater empört, „Sie waren doch noch letzte Woche in meiner Apotheke.“
„Seien Sie still“, flüsterte sie, „das war ein Notfall. Bitte verlassen Sie den Laden, bevor mein Mann Sie sieht.“
Paul fragte sich gerade, ob er Herrn Klinker jemals zuvor gesehen hatte, da zuckte er zusammen, weil sein Vater mit der Faust auf die Ablage schlug. Der ganze Tresen wackelte. Das sah dem ruhigen, zurückhaltenden Karl gar nicht ähnlich. Für seine Verhältnisse kam es einem Wutausbruch gleich.
„Es steht Ihnen frei, in meiner Apotheke einzukaufen oder nicht. Aber wenn ich in Ihrem Laden bin, dann erwarte ich auch, bedient zu werden.“
Anscheinend wusste Frau Klinker nicht, wie sie reagieren sollte. Beide schwiegen. Paul wollte seinem Vater gerade vorschlagen, den Käse doch lieber auf dem Markt zu kaufen.
Schließlich seufzte Frau Klinker ergeben. Paul atmete auf und wunderte sich, dass sein Vater nicht endlich bestellte. Karl stand reglos mitten im Laden, als die Türglocke weitere Kundschaft ankündigte. Unterbewusst nahm Paul war, dass zwei Damen fast im Chor „Grüß Gott“ riefen. Karls Hände zitterten.
Pauls Vater und Frau Klinker standen sich immer noch schweigend gegenüber und starrten sich an.
„Was darf es dein sein?“, fragte Frau Klinker nach einer gefühlten Ewigkeit.
Sein Vater bestellte drei verschiedene Käsespezialitäten, bezahlte und verließ den Laden. Erst vor der Tür fiel Paul auf, dass Karl sich den mit ein paar Stichen aufgenähten Judenstern von der Brust gerissen hatte. Wann hatte er das getan? Und warum?
Karl erwachte erst wieder aus seiner Lethargie, als Waltraud und Eva auf sie zukamen.
„Hast du alles bekommen?“
„Ja“, antwortete er knapp.
Gemeinsam gingen sie mehr oder weniger wortlos nach Hause.
Waltraud hatte die Wohnung mit Osterdekoration geschmückt und einen Korb mit gekochten Eiern gefüllt. Auf dem Esszimmertisch stand ein gewaltiger Strauß mit strahlend gelben Forsythien aus dem Garten. Draußen blühten sie noch nicht, aber die Zweige in der Vase sahen prächtig aus.
Es war Samstag, der 4. April 1942, und die Familie versammelte sich zum Mittagessen. Nur Karl fehlte, sehr zum Ärger seiner Frau.
„Wo treibt er sich nur wieder rum?“, rätselte Waltraud und schickte Paul los, um ihn zu suchen.
Paul sah im Keller nach und lief dann in den Vorgarten. Links daneben stand das Haus der Großeltern, in dem sich unten die Apotheke befand. Nur ein schmaler Gang, nicht mehr als einen Meter breit, trennte die beiden Häuser. Dahinter lag ein kleiner, aber schöner Garten. Durch den Gang hörte Paul ein seltsames Geräusch, das von der Straße kam. Ein merkwürdiges Stimmenwirrwarr.
„Vater?“, rief Paul durch den Gang. Seine Stimme hallte.
Er ging nach vorne zur Straße.
Vor dem Schaufenster der Apotheke standen vier Männer und auf der anderen Straßenseite eine ganze Gruppe Schaulustiger. An dem Hakenkreuz auf der Armbinde der Männer erkannte Paul, dass sie Nazis waren. Sie klebten ein großes, weißes Plakat auf die Glasscheibe und hämmerten ein Schild an den hölzernen Türrahmen, ohne Paul zu bemerken.
Seinen Vater konnte er nicht erspähen und so machte Paul kehrt. Er ahnte, wo er Karl finden würde.
Während von draußen immer noch Gehämmer dröhnte, saß sein Vater in der Apotheke auf einem wackeligen Schemel hinter dem Verkaufstresen. Das Ladenlokal war dunkel und es fiel nur wenig Licht von draußen ein. Die Männer hatten die Fenster mit weiteren Plakaten zugehängt und verbarrikadierten die Tür mit einem Holzbalken.
„Vater, du wirst zum Essen erwartet. Ich habe dich überall gesucht.“
Wortlos stand sein Vater auf und folgte Paul.
Nachdem das Hämmern an der Frontseite verstummt war, schien alles wieder friedlich ruhig zu sein.
Seit jenem Tag war Karl Rosenberg ein anderer Mensch. Am Sonntag in der Dämmerung entfernte er alleine alle Plakate und Holzbarrikaden. Am Montag öffnete er die Löwen-Apotheke wie gewohnt um acht Uhr in der Früh. Aber niemand kam. Kein einziger Kunde ließ sich blicken.
Zeitgleich wurde die Apotheke nicht mehr beliefert. Warum auch? Die Kunden blieben fern. An der Schaufensterscheibe prangte ein übergroßer Judenstern in grellroter Farbe.
Trotzdem ging Karl Rosenberg jeden Morgen um kurz vor acht in den Laden, schloss die Vordertür auf und machte sich an die Arbeit. Endlich konnte er all das erledigen, was im geschäftigen Alltag immer liegen geblieben war. Er überprüfte die Ware, zählte und legte Listen an. Er sortierte neu und räumte das Lager auf. Alte Rechnungen stapelte er ordentlich in verschiedenen Kisten und heftete neue Rechnungen in einem Ordner ab. Um die Buchführung würde sich Waltraud schon kümmern, dachte er, als er die Ordner im Keller in ein Holzregal schob.
Plötzlich ertönte die Ladenklingel. Ein fast unbekannt gewordenes Geräusch. Karl erschrak. Nur wenige Kunden verirrten sich in die Apotheke – meist Juden, die kein Geld hatten. Dennoch freute er sich über die potenzielle Kundschaft und eilte die steile Treppe nach oben.
Im Laden wartete eine altbekannte Nachbarin, deren Name ihm nicht einfallen wollte.
Bis vor kurzem waren jeden Tag mehrere Kunden durch diese Tür gekommen. Aber jetzt war es eine Besonderheit und beide wussten es.
Trotzdem bemühte der Apotheker sich um Normalität und sprach seine Kundin an, wie er es immer getan hatte.
„Guten Tag. Sie wünschen?“
Er ging noch einen Schritt vor, um sich mit beiden Händen auf dem Tresen abstützen zu können.
„Meine Tochter ist hochschwanger. Sie hat so fürchterliche Krämpfe.“
„Im wievielten Monat ist Ihre Tochter?“
Die Dame zögerte einen Moment, als ob sie rechnen würde.
„Im achten Monat.“
Das letzte Wort wurde von einem Klirren übertönt. Ein Stein flog durch das Fenster in die Apotheke und landete mit einem lauten Knall in einem Holzregal.
„Was ist da los?“, rief Karl empört und wollte nach draußen laufen. Die Frau versuchte ihn zurückhalten, indem sie ihn am Arm festhielt.
Sie blickten sich in die Augen. Dann flog ein zweiter Stein durch das zerbrochene Fenster in der Tür zwischen den beiden großen Schaufenstern.
Sie mussten in Deckung gehen, um nicht getroffen zu werden. Grölende Männerstimmen vor der Tür wurden lauter. Jetzt flog ein Stein nach dem anderen in die Apotheke.
Erst versteckten sich Karl und die Kundin hinter der Theke, doch die Treppe in den Keller war ein guter Fluchtweg und sie nutzen ihre Chance, zu entkommen.
Sie liefen an den neu geordneten Regalen vorbei in den Hinterhof und von da ins Nachbarhaus, wo die Familie wohnte. Die Kundin verschwand über den Hinterhof in den Nachbargarten.
War ihr Laden einige Jahre zuvor in der Reichskristallnacht am 9. November 1938 auch verschont geblieben, so legten ihn die Soldaten und die Ordnungspolizisten an diesem Tag in Schutt und Asche. Jeder Schlag traf Karl bis ins Mark, ganz so, als würde man einen Teil seiner Familie im Nachbarhaus abschlachten. Es klirrte und schepperte eine unendliche Weile. Sobald die Geräusche verstummt waren, stürmte er in die Apotheke, um sich den Schaden anzusehen. Tausend kleine Gläschen mit Tabletten und Tropfen darin, Glasscheiben und auch Porzellangefäße, alles war auf dem Fußboden zerschellt. Das hölzerne Inventar, die Regale und den uralten Tresen hatten die Männer mit einer Axt zerlegt.
Er stolperte über die Waage, die vor ihm entzweigebrochen auf dem steinernen Boden lag.
Unter einer Staubwolke fand er die dazugehörigen gusseisernen Gewichte. Sie waren unbeschädigt. Er hob sie auf und sortierte sie der Größe nach.
Das Hundert-Pfund-Gewicht fehlte! Karl suchte den Fußboden ab. Dabei schnitt er sich an einem Glassplitter. Der Schnitt war nicht groß, trotzdem blutete der Finger sofort stark. Karl ließ sich fallen und begann bitterlich zu weinen.
Die ersten Tage nach der Zerstörung der Löwen-Apotheke saß Karl fast den ganzen Tag apathisch am Küchentisch. Wenn er überhaupt reagierte, dann nur mit Aggression. Waltraud wusste nicht, wie sie mit ihrem Mann umgehen sollte, und verbrachte den Großteil der Zeit mit den Kindern bei den Eltern im Nachbarhaus.
Eine Woche später fasste sich Karl ein Herz und begann gegen den Willen seiner Familie mit den Aufräumarbeiten im Laden. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Dennoch: Er war für ein paar Tage beschäftigt und fühlte sich nicht mehr so nutzlos. Ein Stück Normalität kehrte zurück.
Während er versuchte, den Schaden zu beseitigen, den die Nazis angerichtet hatten, dachte er immer wieder über jenen schicksalhaften Tag nach. Er war so hilflos gewesen und hatte nichts gegen die Zerstörung der Löwen-Apotheke tun können. Nichts? Was, wenn er auf die Straße gelaufen wäre? Wenn er den Männern Paroli geboten hätte? Wenn er irgendetwas getan hätte, statt sich hinter dem Tresen zu verstecken?
Waltraud unterstützte ihren Mann, da sie erkannte, dass es keine bessere Therapie für ihn gab. Sie fegte, putze die Fenster und entsorgte den Müll. Ihre größte Sorge war ein erneuter Angriff auf die Apotheke – oder noch schlimmer: ihre Wohnung. Das würde Karl nicht überstehen. Und sie auch nicht. Einen weiteren Nackenschlag konnten sie nicht ertragen. Dabei wusste sie insgeheim, dass sich nichts zum Guten wenden würde. Im Gegenteil. Beide ahnten, was passieren würde, aber verdrängten es so gut wie möglich, um nicht verrückt zu werden. Zur Flucht war es jetzt zu spät. In den letzten Jahren hatten sie so oft im Familienkreis darüber geredet. Ihre Eltern wollten das Haus und den Laden nicht zurücklassen, auch Karl hätte die Löwen-Apotheke nie aufgegeben. Sie hatten zu wenig Angst vor dem, was unweigerlich auf sie zukam, und zu viel Angst vor etwas Neuem, einem Schritt ins Unbekannte.
Seit Hitlers Machtergreifung waren mehr als neun Jahre ins Land gezogen. Was anfangs niemand von ihnen hatte wahrhaben wollen, nannte man nun offiziell die „Endlösung der Judenfrage“.
Hysterisch hatte Karl seine Frau genannt, als sie vorgeschlagen hatte, zu seinen Verwandten an die holländische See zu fliehen. Doch niemals, in all ihren Gesprächen danach, hatte Waltraud ihn daran erinnert. Nie kam ein „Ich habs doch gesagt!“ oder „Hättet ihr doch nur auf mich gehört!“ über ihre Lippen.
Die einzige Hoffnung der Juden war die Befreiung von Außen und der Untergang des Nazi-Regimes. Sie klammerten sich an den Gedanken, dass der Rest der Welt auf ihrer Seite war, auch wenn sie davon wenig spürten.
Wenn die Kampfflugzeuge über der Stadt kreisten, hatte Waltraud keine Angst vor den Bomben. Manchmal war ihr das eigene Schicksal so gleichgültig, dass sie sich fast wünschte, eine Bombe würde allem ein Ende bereiten. Kurz und schmerzlos. Ihre Kräfte gingen zur Neige. Sie hatte immer versucht, die Kinder zu beschützen. Seit fast einem Jahrzehnt. Nun waren die drei fast erwachsen. Das machte die Situation nicht ungefährlicher.
Als die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übernommen hatten, war Waltraud besorgt gewesen, dass Eva, Paul oder Hilde in der Schule ausgegrenzt oder gehänselt würden. Niemand sollte ihre Kinder verletzen! Nun war Krieg und sie hatte ganz andere Sorgen als dumme Sprüche auf dem Pausenhof. Aber der Kriegsfeind war nicht ihr Feind. Der Feind waren die Nachbarn, die Polizei, der Staat, das Land, in dem sie seit Generationen lebten.
Über die Osterfeiertage hatten sie kaum etwas zu essen gehabt. Im Garten bauten sie Obst und Gemüse an, aber um diese Jahreszeit konnten sie davon noch nicht zehren. Ein einziges Huhn lief hinter dem Haus herum, pickte zwischen den Steinen und auf dem Gras nach etwas Essbarem. Waltraud hatte ihre Mutter gerade noch davon abhalten können, eine Hühnerbouillon zu kochen. Das Tier war zu alt, um gegessen zu werden, aber immerhin legte es ab und zu noch ein Ei.
Das Osterfest war für sie als Juden ohne Bedeutung. Selbst am Ostersamstag lag ihr Fokus darauf, die Apotheke wieder herzurichten. Es gab immer noch so viel zu tun. Trotzdem wurde Waltraud gerade an diesen Tagen bewusst, wie trostlos ihr Leben geworden war. Während die Nachbarn ihre Fenster schmückten und groß tafelten, bangten sie um ihre Existenz. Zumindest glaubte Waltraud, dass ihre nicht jüdischen Nachbarn so weiterlebten wie gehabt. Dass sie an Karfreitag einen delikaten Fisch und am Ostersonntag einen feinen Braten genossen.
Doch wenn sie ehrlich zu sich selbst war, musste sie sich eingestehen, dass die Kriegsjahre an allen zehrten. Auch wenn man im Voralpenland leichter vergessen konnte, was um einen herum geschah. Bei einem Spaziergang im Wald, am Simssee oder einer Wanderung in den nahen Bergen. Schon lange stand den Rosenbergs nicht mehr der Sinn nach Spazieren oder Wandern, zumal es immer ein gefährliches Unterfangen war, das Haus zu verlassen. Immer wieder hörten sie von jüdischen Freunden, die spurlos verschwanden. Doch nicht immer verschwanden die Juden still und heimlich. Es war noch nicht lange her, dass Heide, Waltrauds beste Freundin, schluchzend bei ihnen vor der Tür gestanden hatte.
„Sie haben Peter einfach ins Auto gezerrt und ihn mitgenommen. Nur weil er seinen Stern nicht richtig trug. Ich habe geschrien, getobt und versucht, sie aufzuhalten, aber ich konnte nichts tun! Das können sie doch nicht machen!“
Paul war entsetzt. Heide und ihr Mann Peter waren fast jeden Tag in ihrem Haus ein- und ausgegangen. Und jetzt sollte Peter plötzlich fort sein? Sicher war an der Geschichte etwas faul – die Polizei nahm doch nicht einfach wahllos Menschen fest und brachte sie fort! Ohne Grund. Ohne Urteil. Ohne einen Sinn.
Ende April war die Arbeit in der Apotheke fast beendet. Der Anschlag hatte irreparable Schäden verursacht und die Spuren waren nicht zu leugnen. Waltraud und Karl hatten dennoch ihr Bestes gegeben. Sie hatten Glassplitter aus den Vitrinen entfernt. Die Regale blieben nun eben offen. Die intakten Dosen, Schalen und Gläser standen wieder fein säuberlich an ihrem Platz. Seit Tagen war Karl damit beschäftigt gewesen, die große Waage zu reparieren. Dieser kleine Erfolg hatte ihm etwas Hoffnung zurückgegeben. Ganz unbemerkt war ein Lächeln über sein Gesicht gehuscht, als er die Waage testweise wieder in Betrieb genommen hatte. Alles wirkte wie früher, wäre ihm nicht ein Windstoß ins Gesicht geblasen. Türen und Fenster gab es nicht mehr. Die Apotheke wäre Plünderern schutzlos ausgesetzt gewesen. Deshalb hatten Karl und sein Schwiegervater sich entschlossen, die Fensterfront mit Holzresten zu vernageln. Anfangs hatte sich Karl gesträubt, weil er immer noch glaubte, den Laden wiedereröffnen zu können. Und wie sollte das funktionieren, wenn Fenster und Türen der Schaufensterfront verbarrikadiert waren?
Während Karl mit seinem Schwiegervater hämmerte, half Paul seiner Großmutter in der Küche, als sie ein ohrenbetäubender Lärm von unten aufschrecken ließ. Es hörte sich beinahe so an, als wäre ein Panzer frontal in das Haus gefahren. Männer brüllten und gaben einander unverständliche Befehle. Schüsse fielen. Dann hörten sie Eva schreien. Paul lief hinaus.
Kapitel 2
Seit fast drei Stunden stand der Zug aus Österreich auf dem Abstellgleis am Rosenheimer Bahnhof. Obwohl die Waggons keine Personenabteile enthielten, wurden darin Menschen transportiert. Wie Vieh hatte man sie in die letzten vier Wagen gepfercht. Schlechter als Vieh wurden sie behandelt. Sie bekamen nicht einmal Wasser. Durch die Bretter wurden dünne Ärmchen gestreckt und von innen waren immer wieder verzweifelte Rufe nach Wasser zu hören. Die Menschen hatten keine Kraft mehr.
Viele der unfreiwillig Reisenden starben an den Strapazen, an Hunger oder Durst. Seit mehreren Tagen waren diese Menschen nun schon unterwegs. Mittlerweile stank es nach Urin und Kot. Kleinkinder, alte, schwache und kranke Menschen starben als Erstes. Babys verhungerten in den Armen der Mütter, wenn deren Brüste keine Milch mehr hergaben. Die Leichen verwesten zwischen den Überlebenden. Der Geruch von Tod umkreiste sie alle.
Wohin die Reise ging, wussten die Insassen nicht.
Die alte Dame erschien an diesem Tag nicht durch Zufall am Rosenheimer Bahnhof. Eine Frau aus der Gemeinde hatte sie geschickt. Die sechzigjährige Olga Peters war eine stattliche Frau, die sich nie scheute, die Ärmel hochzukrempeln. Ihre Familie besaß viele Ländereien und Forst im Voralpenland. Schon im Alter von zehn Jahren hatte Olga gelernt, Bäume zu fällen, die Rinde zu entfernen und andere schwere körperliche Arbeiten zu erledigen, die sonst nur kräftige Männer vollbrachten.
Olgas Familie war in den Zwanzigerjahren zu einem ansehnlichen Vermögen und einigem Einfluss gekommen. Das lag einerseits am kaufmännischen Geschick ihrer beiden Brüder, andererseits am gestiegenen Bedarf an Brennholz der Bevölkerung.
Nun waren ihre Brüder im Krieg und zumindest Hermann, der jüngste, würde ziemlich sicher nicht zurückkehren. Olgas Nachforschungen hatten ergeben, dass Hermann in der Nähe von Kiew mit sechs weiteren Soldaten von einer nächtlichen Erkundung nicht zurückgekehrt war. Von Hermann hatte es seitdem kein Lebenszeichen mehr gegeben und fünf seiner sechs Kameraden waren als Tote identifiziert worden.
Olga hatte keine Kinder, war nie verheiratet gewesen und ihre große Liebe war 1916 in der Schlacht um Verdun gefallen. Seitdem ließ sie keinen Mann mehr in ihre Nähe. Sie brauchte auch keinen Mann an ihrer Seite, der ihr Halt gab. Nach dem ersten Weltkrieg hatte es ohnehin einen deutlichen Frauenüberschuss in Deutschland gegeben – und schon wieder war Krieg. Da konnte nicht jede Frau mit einer Familie gesegnet sein, sofern dies überhaupt ein Segen war. Nun, einen dritten Weltkrieg wollte sie jedenfalls nicht mehr erleben.
Dennoch hätte sie keiner als verbitterte alte Jungfer bezeichnet und in Rosenheim gab es wohl niemanden, der schlecht über sie sprach. Eine Seele von Mensch nannten die Leute sie.
Die Forstwirtschaft und das Sägewerk lagen in der Verantwortung von Hermanns einzigem Sohn. Olga griff nur wenn unbedingt nötig ein. Hermann junior war ein tüchtiger Bursche, aber etwas ungeschickt mit Zahlen, und damit er von seinen eigenen Angestellten nicht über den Tisch gezogen wurde, kontrollierte Olga regelmäßig die Bücher. Allein die Tatsache, dass sie dies tat und jeder es wusste, hielt die Mitarbeiter an, korrekt zu arbeiten.
Obwohl sie nur eine kleine Wohnung im Haus ihres Bruders besaß und wöchentlich nicht mehr als einen vollen Tag im Büro verbrachte, war Olga Peters eine vielbeschäftigte Frau, die nie zur Ruhe kam. Erst recht nicht in den letzten Jahren.
Als Olga Peters das Gleis, auf dem der Zug mit der menschlichen Fracht stand, fast erreicht hatte, kam ihr die Frau, die sie zur Hilfe geholt hatte, völlig aufgelöst entgegen.
„Es ist ein Anblick des Jammers, Frau Peters!“, schluchzte sie.
„Besorgen Sie Wasser. Am besten einen Schlauch und mehrere Eimer“, erwiderte Olga Peters beinahe im Befehlston.
„Aber die Soldaten haben uns verboten …“
„Um die Soldaten kümmere ich mich“, unterbrach Olga Peters sie schroff.
Und das tat sie.





























