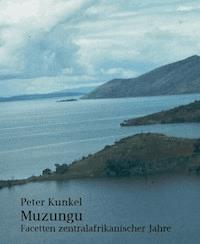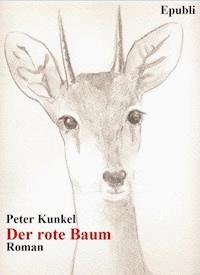
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Ehepaar - wahrscheinlich deutsch, könnte aber auch Schweizer oder Österreicher sein - und eine Engländerin halten es zusammen zwöllf Jahre in ostafrikascher Steppe aus und untersuchen einige der großen Tiere. Land, und Tiere und Leute haben natürlich tiegen Einfluß auf ihre pysische und intellektuelle Entfaltung (und verderben sie für Europa). Das Ehepaar untersucht Antilopen, die Engländerin zwei große Tier, die von diesen leben, öwen und Wildhunde. Der Gegensatz der Forschungsobjekte, Beute und Raubtier überträgt sich in verschiedener, abgewandelter Form auf das Verhältnis der drei Menschen, aber nicht nur er allein. Die Persönlichkeiten sind wohl von Anfang an verschieden. Außerdem brechen mannigfaltige Vertreter der Art Homo sapiens in die Abgeschiedenheit der Station und sorgen zusätzlich für einprall gefülltes Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:.
Thomas ist nach Jahren in Afrika in einem der großen europäischen Zoos gelandet. Bruchgelandet, wie er findet: als ‚beratender Experte‘. Jetzt bietet man ihm an, in neuer Funktion an den alten Arbeitsplatz zurückzukehren. Er weiß nicht recht. Er läßt seine die afrikanischen Jahre Revue passieren, die Antilopen, die er zusammen mit Susanne, seiner Frau untersucht hat, Maud, mit der sie zusammenlebt haben, die von ihr untersuchten Löwen und Hyänenhunde, die ganze tierische und menschliche Fauna, die ihnen begegnet ist… Vieles, sehr vieles hat sich inzwischen verändert. Soll und will er, will vor allem Susanne wirklich wieder dorthin gehen?
Peter Kunkel, Zoologe, hat über Verhalten von Vögeln und Ökologie von tropischen Wäldern gearbeitet, darunter zehn Jahre im Ostkongo, und war für die EU-Kommission als Experte für Vogel- und Habitat-schutz in Brüssel tätig.
ISBN 978-3-7375-5436-7
Copyright ©Peter Kunkel 2010
Umschlagbild : Oribibock. Zeichnung 2010 ©Regula Kunkel
Herstellung und Verlag : epubli GmbH. Berlin, www.epubli.de
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar
Inhalt
Thomas – Zoo oder Steppe
Mauds Zeit
Susannes Zeit
Diplomatisches Intermezzo
Dreimannertage
Thomas – das große Nein
Nachwort
Toutes ces petites observations quidégénèrent en étude ne conviennentpoint à l'homme raisonnable qui veutdonner à son corps un exercice modéré,ou délaisser son esprit à la promenadeen s'entretenant avec ses amis.
Jean-Jacques Rousseau,Julie ou la Nouvelle HéloïseQuatrième partie, lettre XI
Thomas : Zoo oder Steppe
1
Die großen Tiere vor dem Untergang bewahren und zugleich den Menschen lassen, was sie als ihr Recht, vielleicht sogar als ein Stück ihrer Würde ansehen, das ist schwierig, Herr Ministerialrat. Dafür hat bis jetzt noch niemand ein wirkliches Rezept gefunden. Das ist unmöglich. Das geht nicht, Herr Ministerialrat. Soviel wenigstens glaube ich in Afrika gelernt zu haben.
Ich weiß, Herr Ministerialrat mit der unleserlichen Unterschrift, Sie hören das nicht gern. Keiner hört das hier gern; es ist so negativ. Wer uns wohl will, nimmt dergleichen für böse Bonmots, für prickelnde Sprüche, die uns den Zugang zu geistelnden Salons öffnen könnten, wenn es solche noch gäbe; hierzulande kultiviert man ja gern das unverbindlich-subversive Wort als Gesellschaftsspiel. Niemand hat uns bisher abnehmen wollen, daß dies ein ernsthaftes Fazit aus dem ist, was wir gesehen und erlebt haben.
Was soll mir also Ihr Brief?
Ihr Rezept ist nicht besonders originell, Herr Ministerialrat. Erhaltung der Natur, Vermehrung des Wildbestandes - immer diese Vermehrung! Ich habe nie begriffen, was diese Viehzuchtidee im Naturschutz zu suchen hat. Wollt ihr die Nationalparks so trostlos mit Tieren überfüllen, wie es inzwi-schen gleich daneben Land und Städte mit Menschen sind? Oder wenigstens waren und bald wieder sein werden? - totaler Naturschutz also, aber: unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Bedürfnisse, der Inter-essen, der Entwicklung und des Fortschritts der anrainenden Bevölkerung. Und natürlich Vorbereitung der Übernahme des Geleisteten durch natio-nale Kader. Herr Ministerialrat, mit diesem Rezept träumen Sie sich ins Abseits und den ins Elend, den Sie losschicken, etwas auf die Beine zu stellen, was diesen Seifenblasen auch nur von ferne ähnlich sieht.
Mich also, wenn's nach Ihrem Brief geht. Vom Staatspräsidenten per-sönlich angefordert, schreiben Sie. Hat nun der Staatspräsident persönlich irgendjemand angefordert, egal wen, oder hat er mich, Thomas, Thomas Eschenbach, Dr. Thomas Eschenbach, persönlich angefordert? Sie sollten sich klarer ausdrücken, Herr Ministerialrat!
Wo schicken Sie mich überhaupt hin? Gibt es nach dem Bürgerkrieg in Bungwana überhaupt noch große Tiere? Oder eine Bevölkerung, deren Interessen man berücksichtigen könnte? Ich fürchte, Herr Ministerialrat, Sie haben diese Formeln aus alten Akten abgeschrieben, aus vergilbten Stilübungen der Kindertage der Entwicklungshilfe. Oder schlimmer noch, sie sind Ihnen in ständigem Gebrauch aus jenen Tagen überkommen, heilige Formeln, die nie mehr geändert werden dürfen, bei denen sich Ihresgleichen nichts mehr denkt; nur unruhig werden Sie, wenn sie in den Akten fehlen.
Vorbereitung der Übernahme durch nationale Kader. Sehen Sie, die Bungwanesen haben schon, als wir noch dort gearbeitet haben, die Nationalparks selbst verwalten wollen. Sie haben sie schließlich auch selbst verwaltet. Und das Ergebnis? Glauben Sie bitte nicht, Herr Ministerialrat, es sei an uns abgeglitten, daß die Bungwanesen nicht aufhörten zu behaupten, ihre Würde als Volk verlange, daß sie die Parks endlich selbst in Regie nähmen, und zwar voll und ganz. Den Glanz Bungwanas und seinen einzigen Reichtum, wenigstens in den Augen der Welt. Von allen Ecken und Enden sind die Leute gekommen, fast noch in den Bürgerkrieg hinein, um die Weite dieser Wildnis zu sehen und die großen Tiere, denen sie überlassen war.
Was denn national sei an diesen Parks, habe ich bungwanesische Politiker oft genug fragen hören, solange in ihrer Verwaltung ausschließlich Ausländer säßen. Ein Spiel mit Worten, Herr Ministerialrat, ganz nach Landesart, und die Bungwanesen sind in solchen Spielen besser als wir. Die Magie des Worts ist nicht nur in ihrer Seele zu Hause, sondern ihnen auch von ihren Vorfahren überkommen, in einem ganzen philosophischen System, das die besagten Vorfahren, fürchte ich, aus dem gleichen Grund entwickelt haben, dessentwegen die Enkel nicht von ihm lassen wollen, weil nämlich Worte bequemer sind als Taten: man spricht sie aus - mit ganzer Kraft tut man das - und harrt...
Sie sehen, Herr Ministerialrat, ich bin Rassist; wenigstens spiele ich ihn gern, wie alle alten Afrikaner. Und doch bin ich vor diesem Wortspiel immer still geworden. Bungwana haben die Landeskinder ihren Staat genannt, noch ehe er unabhängig war, Land der freien Männer. Was für ein Programm! Welche Hoffnung! Und ist nicht die schiere Existenz dieses Staatsgebildes schon Unfreiheit? Ein letzter Befehl des scheidenden, scheinbar scheidenden Kolonisators an zweiundsiebzig Stämme und Stämmchen, die sich auch heute noch gegenseitig verabscheuen, verach-ten, hassen, jedenfalls nicht lieben, weniger noch als ein Lombarde die Sizilianer? Ein Befehl, 'den Tribalismus zu überwinden', eine Nation zu bilden, der nichts gemeinsam ist als die Erinnerung, zwei Generationen lang Tag für Tag auf der eigenen Erde gedemütigt worden zu sein? Was sind sie, wenn sie die Nationalparks nicht selbst in die Hand nehmen? Wieder nur Bevölkerung, menschliches Füllsel zwischen den weiten Parkflächen, rasch mit dem Safaribus hinter sich zu bringen, preiswerte Handlanger und Kulisse einer nun nicht mehr für fremde Siedler und Pflanzer, sondern für nicht minder fremde Touristen bestehenden Welt.
Und wer waren wir schließlich, daß wir uns angemaßt haben, ihnen die Parks zu verwalten? Wer hat denn vor der Kolonialzeit die großen Tiere in seinen Ländern ausgerottet? Die Afrikaner? Vielleicht haben Sie sich vor dem Bürgerkrieg einmal in Bungwana umsehen können, Herr Ministerial-rat. Wer hat vor gar nicht langer Zeit noch als Kulturtat bezeichnet, Luchs, Bär, Wolf, Auerochs und Wisent ausgerottet zu haben? Wer hat den Afrikanern all die sogenannten Bedürfnisse beigebracht, derentwegen sie jetzt mit dem ihnen Anvertrauten so umgehen, wie sie es leider tun?
Nun, sie haben die Parks bekommen. Was haben sie aus ihnen gemacht? Von den zweitausend Nashörnern des Kuravunaparks haben sie Jacques vor zwei Jahren nur noch zwölf zeigen können. Nashörner können zu Hunderten umkommen, wenn die großen Regen ausbleiben, gewiß; aber es bleiben immer noch genug übrig, um ein gutes Jahr wieder mit kleinen Nashörnern zu füllen. Im Kuravunapark sind groß und klein blindlings verarbeitet worden, lange genug, zu lange. Die Füße zu Papierkörben, die Schwanzhaare zu Amuletten für streunende Hippies und die Hörner bis zum heutigen Tag zu Pulver, das älteren Herren im östlichen, ohnehin übervölkerten Asien eine erotische Wiedergeburt vorgaukelt. Die Regen mögen fallen, wie sie wollen; ohne erwachsene Nashörner kann es auch keine jungen mehr geben. Macht es einen Unterschied, ob die neuen Verwalter der Parks an dieser Nutzung nationaler Ressourcen aktiv beteiligt waren, wie es leider den Anschein hat, oder ob sie, wie sie sicher selbst behaupten würden, unfähig gewesen sind, ihren wildernden Mitbürgern und der hinter ihnen stehenden internationalen Mafia Einhalt zu gebieten?
Was wird inzwischen aus den zwölf Nashörnern geworden sein, nach Revolution und Bürgerkrieg, wo Tausende von Dörfern um Schädel-pyramiden herum in Schutt und Asche liegen und ganze Stämme von Erdboden verschwunden sind? Vorher werden sie, halbverhungert wie sie waren, doch wohl die Tiere der Nationalparks aufgegessen haben.
Jetzt bestellt man also wieder Ausländer in den Hauptstädten Europas. Sogar bei uns, und wir zeigen uns wieder einmal willig, Herr Ministerial-rat, nicht wahr? Nicht wegen sogenannter wirtschaftlicher Interessen, versteht sich. Rettet die großen Tiere! Sie gehören der Welt!
Und das soll ich tun? Ausgerechnet ich?
Mir gefällt es hier, wo ich bin, Herr Ministerialrat. Wenn ich nicht die falsche Konfession hätte, wie oft hätte ich nicht schon dem Heiligen Franziskus, Schutzpatron der Tiere, eine Kerze dafür gestiftet, daß ich die Nashorn- und Elefantenschlächterei nicht aus nächster Nähe ansehen muß. Und noch eine dafür, daß ich in diesem Trauerspiel nicht auf der Verliererseite Verantwortung trage. Manchmal allerdings überkommt mich eine gewisse Unruhe um die großen Tiere. Recht oft sogar. Recht viel Unruhe sogar. Auch über Susanne kommt sie; ich sehe es wohl. Wir sprechen nie darüber; wir wissen voneinander, daß uns diese Unruhe nie verläßt. Das ist nichts Neues. Es war schon in Bungwana so. Auch dort hat uns die Unruhe nur stundenweise verlassen, nämlich wenn wir die Tiere mit unseren eigenen Augen unbehelligt durch Steppe und Savanne ziehen sahen.
2
Der Blick zum Fenster hinaus ist ungemein friedlich. Er geht über die Bäume des Zoos, deren Laub ihm auch jetzt, Mitte September, noch die Gehege darunter entzieht, hinüber zu den hundertjährigen Villen am Steilhang, der die Flußaue begrenzt. Viel zu große Häuser für unsere dienstbotenlose Zeit; längst sind sie aufgeteilt unter Wohngemeinschaften und Familien, die sich nicht mehr als zwei, drei ungemütlich hohe Zimmer ohne rechte Küche und Bad leisten können. So haben auch wir ange-fangen, als wir von Bungwana zurückkamen. Den Blick beeinträchtigt die ganze Unbequemlichkeit nicht. Fast überall verschwindet sie unter wildem Wein, und was man vom Fenster meines Büros aus sehen kann, ist eine einzige feuchtgrüne Angelegenheit mit den ersten gelben und roten Zeichen des Herbsts.
Mein Kämmerchen liegt über dem Eingang des alten Antilopenhauses. Es ist in eine der Kuppeln eingebaut, mit denen der Architekt, vielleicht derselbe, der die Protzkästen drüben am Hang auf dem Gewissen hat, den exotischen Tieren einen exotischen Rahmen hat geben wollen. Drei Wände meines Stübchens sind gewölbt; nur dem Fenster gegenüber habe ich rechts und links von der Tür zwei Bücherbretter aufstellen können. Von draußen kommt Heuduft und Geruch von Wiederkäuern herein, von den Ausdünstungen der Tiere, vom Sekret der markierenden Drüsen, von Harn und Kot. Sie sind vielleicht das Beste an dieser Unterkunft; jedenfalls bin ich dankbar dafür, daß sie mein Stübchen füllen.
Rechts vom Eingang unter mir knabbert ein Rudel Sasins an den letzten sattgrünen Augrasflecken, die ihm in dem sonst kahlen Gehege noch haben widerstehen können. Links steht ein Nilgauantilopenpaar mit Kind. Die Mutter kann ihr Mißtrauen gegen Besucher, die stehenbleiben und sie still betrachten, nicht loswerden, nicht einmal gegen mich, obwohl ich nun schon jahrelang sechsmal am Tag an ihr vorübergehe und sie mich längst als harmlos eingestuft haben müßte.
Es sind nicht die kostbarsten Tiere, die wir hier haben. Jochen, klüger als ich und also im Lande geblieben, nach Hungerjahren als Volontär und Jahren des Kampfs gegen Band- und Spulwürmer als Assistent in unserem Zoo also dessen Direktor geworden, Jochen also hat sich in den Kopf gesetzt, ein Zentrum für die Erhaltungszucht von Wüstenhuftieren in unserem Tiergarten aufzubauen, auch jener Arten, die den periodischen Dürreperioden im Sahel nicht mehr ausweichen können, weil jedes grüne Fleckchen dort von Kühen, Ziegen und Menschen überquillt. Ihm haben es besonders die Antilopen angetan, die zusammengeschossen werden, wo man mit dem Erwachen des Islam jedes europäische Denken von sich getan hat, auch den Naturschutzgedanken, versteht sich. Lange Zeit wenigstens, lange genug um die Antilopen ihrer Länder fast zum Erlöschen zu bringen.. Jochen hat nicht geruht und gerastet, bis er sein Paar Sabelantilopen hatte, eine Gruppe der eigentlich schon aus-gestorbenen Mhorrs aus der Westsahara, die ihm die Spanier allerdings gern überließen, weil ihnen ihre Zucht bereits über den Kopf wächst, hellere Damagazellen aus dem Sudan, einige Mendesantilopen, persische Kropfgazellen, dazu Korrigums und Rotstirngazellen. Sie alle sind nicht in meinem alten Antilopenhaus untergebracht, sondern erfreuen sich weiter Gehege mit schimmernden Einzelpalästen für die Nacht, durchaus notwendig, um die Tiere einzeln in Kur nehmen zu können. Sehr wüsten-artig ist unser Voralpenklima nämlich nicht. Zwei Tage Sonnenschein lassen gleich ein Gewitter aufkommen, das alles durchfeuchtet und abkühlt. Jochen ist oft in Sorge um seine Preziosen.
Ich habe gelegentlich die Ehre, ihn auf dem morgendlichen Inspektions-gang zu begleiten. Ziemlich rituell geht es da zu.
„Lassen Sie sich nicht stören, Herr Meier!"
„Haben Sie schon die Proben ins Tierhygienische geschickt, Gisela?"
Ich bestätige jedesmal, daß die Anlage großartig sei, was nicht schwerfällt - sie ist es -, und Jochen hält stets bei den rotweißen Sabelantilopen an. Die bei Antilopen recht ungewöhnliche Farbkombination fasziniert ihn. Er kann nicht umhin, vor sich hinzumurmeln:
„Delikat! Delikat! Tolle Selektion, diese Wüste!"
Nach diesem Morgengesang ist er imstande weiterzuschreiten. Die Wüste hat es ihm angetan. In die Wüste fährt er, wann immer er kann, jeden Urlaub selbstverständlich, und ich glaube, der Teufel hat ihm dort von einer Sanddüne herunter die Wüstentieranlage seines Zoos gezeigt, und Jochen hat nicht gesagt: "Hebe dich hinweg, Satanas!"
Nicht daß die Sabelantilopen eigentliche Wüstentiere wären; sie haben sich mit ihren Farben wohl eher den roten Lateritböden des Sahel angepaßt. Aber Jochen will eben, daß es die Wüste sei. Vor den wirklichen ‚Säbel‘antilopen der Wüste, den Mendesantilopen, viel kostbarer, weil es wirklich kaum noch welche gibt, hält er nie an: sie sind in schlichten Braun- und Schwarzweißtönen gezeichnet. Es mag ihn allerdings auch bedrücken, daß er noch kein Mendesweibchen hat erwerben können.
Mir gefallen die rotweißen Sabelantilopen natürlich auch, wenn die schwache Gesichtsfarbe den dunklen Augen auch etwas Kuhhaftes gibt, einen für meine Begriffe nicht antilopengemäßen Dulderblick - da lobe ich mir die bedrohlichen schwarzweißen Masken der Oryxantilopen! Reine Subjektivität natürlich und gewiß nicht intelligenter als Jochens tägliche Hymne auf die Sabelantilopen. Deren sanftäugige Böcke bearbeiten ihren Zaun nicht weniger energisch als die Oryxmänner das Buschwerk des Kuravunaparks.
Jochens Wüstentierprogramm ist reine Perfektion. Ein Ernährungsveterinär überwacht, was die Kostbarkeiten zu essen bekommen, gutes Gras und Heu und allerhand Laubwerk, die unvermeidlichen Karotten, versteht sich, geschnitzelte Runkelrüben, und was ihnen damit nicht gereicht werden kann, bekommen sie in pellets, plätzchenartigen großen Tabletten, die sie mit langer Zunge und sichtlichem Genuß aus ihren Krippen fischen.
Jochen hat den Verwaltungsrat überredet, mich als Berater des Antilopen-zentrums einzustellen. Zuvor hatte ich mich eine Zeitlang als Gutachter für unser Entwicklungshilfsministerium, die FAO und andere Organisationen dieser Art versucht; aber diese Blitzstudien hatte ich schnell über: man sieht einiges von der Erde, hat aber nie genug Zeit, den Dingen auf den Grund zu gehen, und am Ende bleibt stets das Gefühl, entweder Selbstverständliches vorgeschlagen zu haben, für das eine Bezahlung zu verlangen eine gewisse Schamlosigkeit voraussetzt, oder mit seinen Regieanweisungen regelrecht hochzustapeln. So bin ich Jochen dankbar, daß ich hier häuslich sein darf. Hier kann ich wenigstens bei Arten, die ich kenne, anständig untersuchen, wie sich das Verhalten in Gefangenschaft ändert, welche Verhaltensweisen verschwinden, welche häufiger werden, welche sich manchmal zu ausgesprochenen Fehlleistungen auswachsen, und außerdem kann ich asiatische Antilopen beobachten, die Sasins und Nilgaus unter meinem Stübchen, die kleinen Vierhornantilopen im hinteren Teil des alten Antilopenhauses und unsere Saigagruppe in ihrem Freigehege. Beschäftigung freilich mehr als Arbeit.
Von der Kunst der pelletkomposition dagegen verstehe ich leider gar nichts. Ich bewundere sie aufrichtig. Die Pfleglinge sind offenbar nicht nur gesund, sondern auch bei gutem Temperament und bereit, sich fort-zupflanzen - was will man mehr? Mir allerdings gibt nichts so sehr das Gefühl, hier überflüssig zu sein, als diese pellets. Ich wünsche mir oft, wenigstens etwas gegen die Viren und Spulwürmer zu wissen, die ein Tier dem andern weiterreicht; aber sie sind für mich noch böhmischere Dörfer als Menüfragen.
Und das, obwohl wir damals im Kuravunapark immer wieder Kot für einen Veterinär gesammelt haben, der laufend neue Darmbewohner darin ent-deckte und mit ihren Beschreibungen ein wändefüllendes Lebenswerk schuf. Wir haben uns sogar eingehend mit den Speisekarten der einzelnen Antilopenarten im Kuravunapark beschäftigt; aber unserem Zooveterinär können diese endlosen Pflanzenlisten kein rechtes Interesse ablocken, auch wenn ich sie ihm mit chemischen Analysen der pièces de résistance schmackhaft zu machen versuche. Das alles ließe sich nicht so recht nachmachen, meint er, und schließlich seien Wüste und Kuravunapark nicht dasselbe. Das kann ich nicht abstreiten. Sein Gesicht heitert sich auf, weil er ein so treffliches Argument gefunden hat, und er greift wieder zu seinem Rezeptbuch für Rind, Schaf und Ziege.
3
Und wieviel Geld haben wir damals nicht in diese Analysen gesteckt! Eben weil auch wir von den langen Pflanzenlisten nicht befriedigt waren, obwohl wir für manche unserer Antilopen hübsche Präferenzlisten aus-gearbeitet haben: eine Liste der ganz guten Sachen, junge Blätter, Früchte, manchmal auch Pilze, immer und überall beliebt und gesucht, eine zweite Liste immer noch guter Ware, Pflanzen und Pflanzenteile, die die Tiere in Mengen verzehren, wenn in der zweiten Hälfte der Regenzeit alles wächst, blüht und fruchtet, und schließlich eine Tabelle der Nahrung, mit denen sich die Antilopen in der Trockenzeit behelfen, die sie aber in besseren Zeiten gar nicht erst anschauen. Wir hätten gern gewußt, was diesen Vorlieben zu Grunde lag; aber mit den verhältnismäßig groben Analysen des Food and Diet Institutes in Moyomoyo war das nicht heraus-zubekommen. Die Verteilung von Fetten, Ölen, Proteinen und Kohlehydraten allein macht's eben nicht, zumal sie je nach dem Alter der Blätter, Blüten und Früchte in weiten Grenzen schwankt, und für die flüchtigen Geschmacksstoffe und die Textur von Halm und Blatt erklärte sich das Institut für unzuständig. Wir sollten doch mit gefangenen Tieren Experimente machen, meinten sie dort; vielleicht dachten sie an ihre menschlichen Versuchskaninchen irgendwo im Stammesland. Wir waren darauf nicht eingerichtet. Außerdem waren wir immer darauf gefaßt, von den Wildtieren fortzumüssen, und wollten zunächst einmal soviel an ihnen beobachten, wie wir nur konnten.
Wir fanden auch schon die Pflanzenlisten in der Reihenfolge ihrer Beliebtheit einen Gewinn. Was sie uns an Zeit und Nerven gekostet haben, besonders am Anfang, haben wir weitgehend vergessen. Was für ein Zirkus, bis sich ein Kudu endlich hat entschließen können, den sanft anrollenden Wagen nicht minutenlang zu beäugen und dann doch plärrend abzuspringen, sondern weiterzuäsen. Oder wenigstens nach ausführlichem Geäuge zum Äsen zurückzukehren. Wie mühsam, zu erkennen, was das Tier denn nun wirklich gefressen hat. Da wird geschnuppert, mit der Zunge herumgespielt und -getastet, und man braucht lange, um sicher zu sein, ob ein Blatt zwischen den Lippen auch wirklich verschluckt worden ist. Das Fernglas zeigt das weiche Maul in allen Einzelheiten, auch die violette Zunge und die einzelnen Blättchen der Büsche; aber es nimmt die Perspektive, und wenn man sich nach Abzug der Herrschaften endlich auf den Äsungsplatz traut, ja, welche von den hinterlassenen Buschkulissen ist es nun gewesen, an der der Kudu stand? Hat man endlich die Pflanze in der Hand und ist beinah sicher, diese war es, so hebt die große Suche nach einer Blüte oder wenigstens einer Frucht an; denn ohne diese lassen sich Busch oder Staude nur selten bestimmen. Beschwingt eilt man zur Station zurück, wenn man sie gefunden hat, und dort warten lange Abende im Schein der leise vor sich hinzischenden Coleman-Lampen, über Büchern, die gleich in der ersten Regenzeit Stockflecken bekommen haben.
Oder die andere Methode: Kotbällchen sammeln, in Wasser auflösen und unterm Mikroskop betrachten, ob und welche Blatt- oder Grasoberflächen-reste man finden kann, die langestreckten Außenzellen der Grasblätter oder die runden, gelappten, kantigen anderer Blattsorten, die man sich natürlich vorher genau angesehen haben muß, um ihre Trümmer nach der Passage durch Antilopenmagen und -darm noch zuordnen zu können, in gröbsten Kategorien natürlich nur. Auch hier war Susanne unermüdlich; ich habe dieses deprimierende Geschäft bald aufgegeben. Sie hatte auch gelesen, daß man einigermaßen abschätzen kann, wieviel das Tier von was zu sich genommen hat, wenn man alle Reste in einer Kotbällchenaufschwemmung auszählt. Sie zählte und zählte – und mußte schließlich zugeben, daß die Rechnung nicht stimmen konnte, wenn sie sie mit ihren Beobachtungen am äsenden Tier verglich. Manche Blätter sind eben zart und weich und wer-den restlos verdaut; andere sind ledrig und hart, und auch wenn die Anti-lope nur wenig davon genommen hat, erscheint ihre Außenhaut fast quantitativ im Kot.
Wie mühsam war das alles am Anfang, wie rasch wurde es Routine, und wie wenig Geduld haben wir später aufgebracht, andere in dieses Geschäft einzuweisen. Besonders an Henry haben wir bös gesündigt.
Susanne ist über den Bestimmungsschlüsseln zur halben Botanikerin geworden. Auch für mich hat sich der graugrüne Filz um die Station in ungezählte Pflanzenindividualitäten aufgelöst. Es war unmöglich, ihn je-mals wieder als anonyme Vegetationsmasse anzusehen; hundertachtzig Gras-, Kraut- und Buscharten haben wir gleich in den ersten beiden Jahren ausgemacht. Gerade die Kudus zwangen uns, immer neue Pflanzen zu identifizieren; sie lieben Abwechslung.
Es war auch unmöglich, all diese Pflanzen anders als eßbar oder nicht eßbar, als lecker oder mäßig gut anzusehen, je nachdem welche Antilopen wir gerade untersuchten. Wir gingen durch die Steppe wie ein Pilzsucher durchs Alpenvorland, bloß daß wir selber nichts von all dem Eßbaren um uns hatten. Wir konnten unsere Tiere nur um das abwechslungsreiche Angebot beneiden, wenn unsere Vorräte wieder einmal auf zerbröckelte Spaghetti und die landweit verbreiteten rostigen Tomatenmarkbüchschen zusammengeschmolzen waren. Oder in der späten Trockenzeit schuld-bewußt zu unseren vollgefüllten Töpfen schleichen, wenn die Antilopen mit gesenktem Kopf durch die kahle Steppe zogen.
4
Zwölf Jahre lang waren wir in Bungwana, und immer am selben Ort. Unsere Untersuchungsobjekte sind fast ausschließlich Antilopen gewesen - natürlich haben wir uns nicht ausschließlich mit ihren Menüs beschäftigt, Herr Ministerialrat. Wir haben an ihnen beobachtet, was das Herz erfreut und vielleicht auch gut zu wissen ist, wenn man diese Tiere erhalten will in unserer täglich schwieriger werdenden Welt. Wir waren in Mti Mwekundu mit ihnen so beschäftigt, daß wir nie daran gedacht haben, unsere Zelte einmal woanders aufzuschlagen, und manchmal bedaure ich das.
Sitatungas zum Beispiel hätte ich für mein Leben gern eine Weile untersucht, jene Sumpfversion unserer Kudus, die sich bei Gefahr ins Wasser stürzt und nur die Nase über die Oberfläche hält. Seit einer Woche gehen sie mir wieder im Kopf herum wie eine lästige Melodie. Leuchtend weiße Streifen auf rotbraunem Fell, oder zimtfarbenem, wenn's ein Bock ist, die bleigraue Fläche des Prinzessin-Christina-Sees sehe ich vor mir, heute See der Nationalarmee genannt, das heißt, wie er jetzt heißt, wissen die Götter, See des Hasen, Hasensee vielleicht; vielleicht hat er im Augenblick überhaupt keinen Namen. Aber ich sehe ihn vor mir, und jeder beliebige Geruch verwandelt sich in die Ausdünstung der ans Ufer gespülten Laichkräuter.
Das hat man davon, wenn man sich von Susanne überreden läßt, ins Konzert zu gehen, zum Trio Schmitt, Schmidt und Schmid. Auf ihren Bassethörnern spielten sie ein liebliches Trio, von Mozart natürlich. Nicht daß es mich etwa an die Schilfflöten der Fischer am Prinzessin-Christina-See erinnert hätte, schon deshalb nicht, weil nicht genug Fliegen um die Schmidt'-schen Häupter standen; man hätte sie auch von unserer Reihe aus noch sehen müssen. Nein, ich vernahm plötzlich mitten in der graziösen Mozart'schen Melodik einen wohlbekannten Laut, einmal, zweimal, dreimal. Das gerade begleitende Bassetthorn mußte ihn von sich geben. Er riß mich aus dem Konzertsaal, weit fort. Dieser Grunz in tiefer Lage, mehr Schnaub als Ton, kurz, abrupt, obstinat, komisch, grob, ein bißchen ordinär, zu dem gehörten Flußpferdaugen und -nasen, die aus kotbrauner Brühe ragen. Ein Zug weißkehliger Kormorane streicht dicht darüber hin, und irgendwo klatschen, halb im Papyrus verborgen, weißgepunktete und -gestreifte Körper ins Wasser, die eben, die mich nicht mehr verlassen wollen...
An den Gesprächen der Flußpferde habe ich immer meine Freude gehabt; wir waren nie lange genug an einem Ort, wo sie uns hätten alltäglich werden können. Ich muß auch im Konzert wieder gelacht haben. Gesichter wandten sich uns zu. Susanne legte behutsam ihre Hand auf meine, und eine kernige Mitdreißigerin lächelte mich apfelfrisch an. Wahrscheinlich wollte sie mich auf urbane Weise zurechtweisen; ich in meiner Naivität dachte, sie teile meine Freude. Ich hätte sie in der Pause gern um Nachsicht gebeten, ihr erklärt, wie fern mir Flußpferde letztlich liegen, daß wir nur in einer Art Urlaub an den Prinzessin-Christina-See gefahren sind, und das mehr wegen der Sitatungas; aber das hätte wohl zu Mißverständnissen geführt, und ich hatte auch nicht die Courage dazu.
5
Gearbeitet haben wir, wo wir in den zwölf Jahren zu Hause gewesen sind, in Mti Mwekundu.
Mti Mwekundu heißt roter Baum, und der namengebende Baum stand auch nicht weit von der Station hoch über dem Steilufer des Ndogoflusses. Es war eine Erythrina. Alle fünf Monate traf der Name wirklich zu, wenn sie nämlich ihre runden, unansehnlich graugrünen Blätter mit der fahlgelben Unterseite abwarf und von oben bis unten mit roten Blütenpinseln bedeckt war, an denen sich Dutzende von Nektarvögeln, an die hundert manchmal, zu schaffen machten, wenn sie nicht gerade einander nachjagten. Brecht hat uns bekanntlich verboten, fürderhin Bäume zu besingen, und so werde ich meinem Drang, unserm Roten Baum eine Hymne darzubringen, bezähmen, Herr Ministerialrat, zumal er außerhalb der Blütezeit eigentlich nichts Besonderes darstellte.
Mti Mwekundu liegt im trockensten Teil des Kuravunaparks. Wasser gab es dort, zumal in der Trockenzeit, so wenig, daß wir oft ein schlechtes Gewissen hatten, es den Tieren wegzunehmen. Aus dem Untergrund des Ndogoflusses floß es von weit oberhalb in einem Plastikrohr zu den Blechhütten hin, die die Station bildeten, rein funktionellen Gebilden, die keinen Versuch machten, ästhetisch zu sein, jede mit einer breiten rundum laufenden Spalte zwischen Dach und Wand, durch die die Außenluft das ganze Jahr hindurch ungehindert Zutritt hatte; ein Moskitodraht hielt gerade noch andere stürmische Eindringlinge zurück. Unsere Behausungen schauten in eine Ebene hinaus, und ein Hügel trennte uns von den nahen Hütten der Parkwachen. In der großen Landschaft verloren sich ihre Behausungen so gut wie die unseren.
Wir alle kommen aus großen Städten, die in Landstriche eingebettet sind, wo jedes Stück sogenannter Natur, ein Waldstreifen, eine Wiese, selbst ein Moor oder eine Felswand, die zähmende und verkrüppelnde Hand des Menschen erkennen läßt. Freie Natur ist uns fremd, soviel wir auch davon reden. In der Landschaft um Mti Mwekundu aber gab es an menschlichen Spuren nur ein paar Pisten, je zwei Streifen roter Erde, zwischen denen das Gras so hoch stand, wie es konnte, ohne von unseren Wagen geköpft zu werden. Alles übrige war anderen Bewohnern dieses Planeten überlassen, Pflanzen, die es verstanden, die beiden jedes Jahr wiederkehrenden strengen Trockenzeiten zu überstehen, und Tieren, zahllosen kleinen und immer noch zahlreichen großen, wenn sie von dem wenigen leben konn-ten, was ihnen die Steppe bot. Ihre Pfade kreuzten unsere Pisten; aber auch unsere Piste konnte ihnen recht sein, dem Leoparden vor allem in den frühen Morgenstunden. Er mochte das taunasse Gras offenbar nicht so sehr.
Manche beunruhigt diese Landschaft tief, namentlich wenn sie aus Europa unmittelbar in sie versetzt werden; wir haben es immer wieder an Besu-chern erlebt. Sie scheint ihnen leer. Sie suchen, oft ohne es zu wissen, nach einem Zeichen menschlicher Präsenz und atmen auf, wenn nach hundert Kilometern Fahrt am Rand des Parks eine Bananenpflanzung oder gar ein paar Strohhütten auftauchen, so fremdartig sich in ihnen auch die Gegen-wart des Homo sapiens für sie äußern mag. Es gibt andere, die diese 'Leere' berauscht. Wir haben in unseren Anfangszeiten beides gekannt, die Beklemmung freilich nur selten.
Auch in zwölf Jahren bleibt dem, der aus den großen Städten kommt, die Menschenferne dieser Landschaft bewußt. Vollkommen verliert sich der Rausch, an solchem Ort zu sein, allein an ihm zu sein, niemals. Man weiß wohl, daß dies eine junge Landschaft ist. Diese weiten Flächen, aus denen sich hie und da abrupt steile, mehrzackige Hügel erheben, gibt es noch gar nicht lange. Sie sind das Ergebnis rezenter vulkanischer Aktivität, die eine riesige Lavadecke über das Land gebreitet und nur die Gipfel der alten Gebirge nicht überflutet hat. Aber über dieser Landschaft hängt etwas vom Atem der ersten Schöpfungstage. Diese Gras- und Buschflächen ziehen uns das Herz aus der Brust, aber nicht so, wie es ein Storm'scher Heideweg oder ein lauer Sommertag auf den Vorbergen der Alpen tun. Diese Landschaft schafft keine Sehnsucht, in tiefe Vergangenheit zu tauchen, keinen Trieb aufzubrechen, leuchtende Inseln im südlichen Meer zu suchen oder die graue Stadt am Watt. Diese Landschaft lädt nicht dazu ein, sie zu verlassen. Sie läßt nur das Bewußtsein sich in den grenzenlosen Raum hinein ausdehnen, wo man bereits ist. Jeden Morgen zieht sie es auseinander, und ohne Grenzen. Das ist wörtlich zu nehmen. Wohl weiß man, daß nach hundert, zweihundert Kilometern wieder Hütten auf-tauchen, Weiler, Dörfer, irgendwo in der Savanne auch Hochhäuser und eine gar nicht mehr unbegrenzte Stadt. Man weiß auch, daß nicht weit entfernt ein weißer Brandungsstrich den blauen Ozean von den gelben und braunen Tönen der Steppe trennt. Aber vor der Weite, in die man sich hineingestellt sieht, bedarf es keines Kraftakts, auch dieses alles in das sich täglich neu ausbreitende Bewußtsein aufzunehmen. Man kann gar nicht anders.
Außer der Weite ist nichts ohne Maß in dieser Landschaft. Das Gras ist kniehoch. Die dornigen Sträucher bleiben niedrig, auch die Akazien mit ihren Laubetagen. Wo ein Baobab steht, entwickelt er einen gewaltigen Stamm; aber die Belaubung über diesem Wasserspeicher ist bescheiden, und der Umfang der Krone führt den wuchtigen Träger wieder auf das Maß der Landschaft zurück, das kleine Dinge setzen. Ein Termitenhügel. Ein Grasbusch. Ein Granitblock, kaum fünfzehn Meter hoch, in dessen Spalten Klippschiefer hausen. Man ist nicht enttäuscht, nicht einmal verwundert, nach hundert Kilometern Fahrt - und sie ist lang auf den engen, kurvenreichen Pisten - an einer Kreuzung von Huftierpfaden ange-kommen zu sein oder am Kotplatz eines Dikdikpaars, der den Mittelpunkt des Reviers dieser hasengroßen Antilöpchen bildet. Vielleicht auch wieder an einem Flüßchen ähnlich unserm Ndogo, dessen Galeriewald gerade einen Baum breit ist, und in den Himmel wachsen diese Bäume auch nicht. Groß sind in dieser Landschaft am ehesten noch die Tiere. Aber auch ihnen ist ein Maß gesetzt, und vor der Weite dieser Landschaft ist auch ein Elefant nicht viel. Jedenfalls nicht zuviel.
Das bescheidene Maß der grenzenlosen Weite geht bald ins Blut über. Selbst die Blechhütten von Mti Mwekundu, anfangs schockierend dürftig und kaum bewohnbar, wachsen sich zu unerlaubt komfortablem Lebensrahmen aus, dicht an der Grenze dessen, was diesem Land zuge-mutet werden kann, vielleicht schon ein wenig darüber hinaus - und haben sich doch in all den Jahren nicht im Geringsten geändert.
6
Wir haben dort die großen Tiere beobachtet, untersucht, wenn Sie es lieber so ausgedrückt haben wollen, Herr Ministerialrat. Geschützt und verwaltet, wie Sie es mir jetzt zumuten, haben wir sie nicht, wenn uns die Park-verwaltung auch in der Absicht nach Mti Mwekundu gesetzt hat, den Wilderern durch diese europäische Präsenz eine gewisse Zurückhaltung einzuflößen.
Ich bin eine kontemplative Natur und zufrieden, wenn ich Fernglas, Diktaphon und Protokollheft, vielleicht noch einen Zähler für häufig wiederkehrendes Verhalten zu managen habe und mehr nicht. Ich könnte Wurzeln schlagen, versunken in den Anblick von Antilopen, wenn ich ihnen nicht zu den verschiedenen Stätten ihres Daseins folgen müßte. Susanne ist vielleicht etwas aktiver veranlagt; aber sie hat das in die Mühen um ein bißchen mehr Wissen, in die Bestimmung der Nahrungs-pflanzen zum Beispiel, umsetzen können, ohne ihre Umwelt in Rotation zu versetzen, wie es so viele Frauen, und besonders hierzulande, offenbar tun müssen, sollen sie sich des Lebens freuen - sie haben mich nicht wenig mit ihren Tätigkeitsdrängen erschreckt, als wir zurückgekommen waren.
Wir haben längst nicht alles herausbekommen, was wir gern gewußt hätten. Wir pflegen zu sagen, daß es Zeit war zurückzukehren, eh wir selbst zu vierbeinigen Wiederkäuern geworden wären. Aber wir sagen es mehr um unserer Freunde willen; sie möchten nun einmal glauben, daß wir 'draußen' die 'Heimat' und auch sie selbst vermißt haben, sie und das Werk ihrer Hände und Köpfe. Wir wissen, daß wir zu früh zurückgekommen sind und zu spät: wir sind hier nicht mehr heimisch geworden, auch Susan-ne in ihrem Verlag nicht, und dort hätten wir vielleicht noch etwas Kraft und einige Ideen für ein paar Jahre mehr gehabt, für sinnvollere Tätigkeit jedenfalls, als mittelmäßige Manuskripte trotz eigenen Einspruchs zum Druck gehen zu sehen und in einer Futterküche den Leuten zwischen die Füße zu laufen.
Mußten wir wirklich fort? Um jetzt zurückgerufen zu werden, damit wir die Reste dessen, was uns damals in ungestörter, oder doch kaum gestörter, Fülle umgab, vor endgültigem Untergang zu bewahren versuchen?
Sicher, wir wußten, schon bevor wir Mti Mwekundu zu sehen bekamen, daß wir dort nur auf Zeit arbeiten durften. Es hat unsere Arbeit nicht wenig beeinträchtigt, daß wir uns, mit gutem Gewissen wenigstens, nie eine Arbeit vornehmen konnten, die mehr als zwei Jahre in Anspruch genom-men hätte. Wir konnten jederzeit Kugelschreiber und Fernglas von einheimischen Kräften aus der Hand genommen bekommen - wenn sie sie bloß genommen hätten! Offiziell haben junge Leute von der richtigen Hautfarbe und, nicht zu vergessen, vom richtigen Stamm, uns ersetzt, manchmal mit der richtigen Ausbildung, gelegentlich sogar mit dem richtigen Diplom. Man kann sich fragen, worin eigentlich; denn Posten in der Parkverwaltung, eben die Posten, die sie nach uns eingenommen haben, hatten wir keine. Aber es ist müßig, so zu fragen. Wir haben gewußt, daß es so kommen würde. Wir sind unter der Bedingung nach Mti Mwekundu gekommen, junge Leute anzulernen, die eines Tages unsere Tätigkeit übernehmen sollten. Wir waren auch nicht unersetzlich. Jeder kann ersetzt werden, und ob das, wovon man ihn bei dieser Gelegenheit trennt, für ihn ersetzbar ist, kann nicht in Betracht gezogen werden. Es geht niemand an als ihn allein.
Bloß, anders als etwa in Kamerun oder in Zambia, war es eben nichts mit der Weitergabe des Fernglases, nicht einmal des Kugelschreibers. Man hat nichts mehr gehört von den großen Tieren des Kuravunaparks, ich meine, in wissenschaftlichen Zeitschriften und ähnlichen Orts, und geschützt haben die jungen Leute auch nicht viel. Es ist zum Teil unsere Schuld; ich weiß es. Ich denke ungern an Henry zurück. Ich bekenne mich aber nicht dafür schuldig, daß von den zweitausend Nashörnern des Parks nur zwölf übriggeblieben und die inzwischen vielleicht auch nicht mehr von dieser Welt sind. Wir sind nur scheinbar ersetzt worden, und alle Welt hat es gewußt. Man hat es sich mit bereitwillig nachgeworfenen Abschluß-zeugnissen leicht gemacht - mächtige Arroganz haben sie erzeugt! Mein Blick zurück ist immer noch zornig, auch wenn die Nashörner im Kuravunapark nicht Susannes und meine Tiere gewesen sind und es um das trockene Mti Mwekundu herum gar keine gab.
Mauds Zeit
7
Insgesamt waren wir acht oder neun, die damals im Rahmen der einen oder anderen Entwicklungshilfe, Stiftung oder wissenschaftlichen Institution den Kuravunapark und seine Tiere untersuchten. Zwar trafen wir uns gelegentlich zu einer Art Seminar; aber die meiste Zeit waren wir weit über die riesige Fläche verstreut, eben der Wilderer wegen. Von Mti Mwekundu aus lag die nächste Station, Jiwe ya Mechekele, ungefähr neunzig Kilometer nach Südwesten entfernt; dort ging Jacques seinen Nashörnern und Zebras nach. In Mti Mwekundu selbst waren wir zu dritt, Maud, Susanne und ich.
Meine Tiere waren, wie gesagt, die Antilopen. Ob sie deshalb auch Susannes Tiere waren, ob sie sozusagen aus doppelter Neigung zu den schönsten Tieren der Welt gekommen war, zu den Tieren selbst und einem im Vergleich mit ihnen recht uneleganten Individuum, oder ob es sie auch spontan zu dieser Tiergruppe gezogen hätte, habe ich nie heraus-bekommen. Maud aber hatte es mit Löwen und Hyänenhunden. Das sind verdammt andere Tiere, und wer sich auf sie einläßt, wird von Anfang an dem, der auf gras- und blätterfressende Wesen eingeht, nicht allzu ähnlich sein. Jedenfalls wird er im Lauf der Zeit ihm unähnlicher; denn der eine wie der andere wird von seinen Beobachtungsobjekten umgestaltet, unmerklich zwar, aber bis zum innersten Kern seines Wesens.
Maud warf schon Schatten auf unsere Ehe, bevor wir in Mti Mwekundu ankamen. Wir wußten, daß wir mindestens ein Jahr lang die Station mit ihr teilen würden, und das gefiel Susanne nicht. Es war Wasser auf ihre Mühle, daß ich auf unsere Universitätsbibliothek ging, um zu schauen, was dieses Mädchen bisher veröffentlicht hatte. Es war noch nicht viel; sie war eben noch jung. Nichts Afrikanisches, so wenig wie wir. Da war eine vergleichende Arbeit über den Beutefang - na, wenn Katzen, dann eben Beutefang; wie konnte es anders sein - , über den Beutefang verschiedener Kleinkatzen also, Hauskatze natürlich, Falbkatze, Manul, Fischkatze, Serval, Ozelot, teils auf dem Dorf, teils in verschiedenen englischen Zoos beobachtet, und zwei Jahre später etwas ganz anderes: ein ökologische Untersuchung an schottischen Wildkatzen, die vor allem auf Rupfhinter-lassenschaften basierte. Das Mädchen schien genau hinzuschauen. Sie brachte ihre Beobachtungen einfach und klar zu Papier und schien bar jeden Triebs zu übertriebener Verallgemeinerung. Ihr durchsichtiger, reifer Stil mochte auch aus der Feder des Doktorvaters stammen. Ich zog vor, ihn Maud anzurechnen.
Susanne hörte sich meine Lobeshymnen nicht lange an. Mißmutig warf sie Stil, Wissenschaft und Erotik durcheinander und prophezeite, ich werde Wachs in den Händen dieses Britenmädchens sein. Natürlich werde ich in Windeseile mit ihr schlafen, aber sicher. Wenn sie eine richtige Englände-rin sei, habe sie schließlich keine Komplexe, jedenfalls nicht solche. Ich entnahm dem, daß ich mich in Mti Mwekundu nicht auf eine gelassene Gefährtin stützen können würde. Außerdem verbitterte mich, daß mein Wille und meine Entscheidungen in dieser Sache erst gar nicht in Betracht gezogen wurden.
Nun hatte Maud in der Tat, ohne Absicht und Anstrengung, eine gewaltige Überlegenheit über uns gewonnen: ihre britischen Geldgeber waren schneller, das heißt, nicht so penibel gewesen wie die unseren, und sie hatte sechs Monate vor uns in Mti Mwekundu anfangen können. Sechs Monate! Sie hatte, für uns unvorstellbar, bereits ein halbes Jahr auf der Station verbracht, auf hundert Kilometer im Umkreis allein mit ein paar schwarzen Parkwachen, deren camp zudem ein ganzes Stück von unseren Unterkünften entfernt weiter oben an der Piste liegen sollte. Wieviel Erfahrung mußte dieses Mädchen nicht bereits haben. Sie war ja fast schon eine Einheimische.
Aber doch immerhin noch eine Europäerin, eine aus unserem weiteren Zuhause, und ich gestehe, daß mich erleichterte, daß am Ende unserer Anfahrt nach all den Schwierigkeiten mit bungwanesischen Zöllnern, schwarzen Portiers mit allzu offener Hand, schamlos teuren, unreellen indischen und arabischen Kaufleuten und groben Anremplern in Hafen und Altstadt von Medinat Kafir eine verwandte oder doch wenigstens verständliche Seele wartete.
Susanne aber kam selbst auf der Piste nach Mti Mwekundu nicht von ihren Zwangsvorstellungen los. Draußen tänzelten Straußenhähne über endloses braunes Gras. Immer wieder stand ein Elefant am Wegrand und gab mit wedelnden Ohren kund, daß er nicht gestört sein wollte. Von Zeit zu Zeit flüchtete eine Warzenschweinfamilie mit hocherhobenem Schwanz, die großen vorn, die kleinen dahinter. Über hohem Gras waren die beiden Nasenaufsätze und die Rückenlinie eines Nashorns sichtbar. Aber sogar eine riesige Ansammlung von Zebras vermochte Susanne nicht abzu-lenken, sie blickte schweigsam vor sich hin, und über ihrer Nase stand eine strenge senkrechte Falte. Ich hätte so gern all diese Tiere betrachtet, konnte den Blick aber nicht von der Piste heben, der ersten meines Lebens. Sie schien mir so primitiv und uneben, daß ich mich fragte, ob sie überhaupt für Autos gedacht sei und ob wir nicht vielleicht vom richtigen Weg abgekommen wären. Susanne aber hätte die Tiere ungestört ansehen können und tat es nicht.
Schließlich erreichten wir die Blechhütten der Parkwachen, zwischen denen Frauen verrußte Aluminiumschalen über winzigen Feuern bewachten. Wir fuhren grüßend an ihnen vorbei, wie wir es bereits gelernt hatten, und um eine Kurve herum öffnete sich der Blick auf Mauds Hütten und unser zukünftiges Heim, den Sandplatz dazwischen und die weite, nur gleich am Ndogofluß dicht, sonst spärlich bebuschte Ebene. Auf dem Sandplatz stand Maud. Sie mußte unsern Jeep herankeuchen gehört haben. Alles gleißte in der Sonne, daß es den Augen wehtat, die Ebene, auf der sich einige ebenfalls hell aufleuchtende Antilopen zu bewegen schienen, das Blech der Hütten, Mauds weiße Bluse und Hose, ihr blondes Haar. Maud trug jene leere Miene zur Schau, die wir Kontinentalen vor allem aus Agatha Christies Werken als Ausdruck britischer Detektiv-, vor allem aber Polizeielite kennen.
Wir stiegen aus, und von da ab entwickelte sich alles sehr unglücklich. Maud erblicken und ihre Panik im Zaum halten war unmöglich für Susanne.
„Siehst du", sagte sie in gespielt gleichgültigem Ton und in deutscher Sprache zu mir. „Du wirst schon sehen!"
Sie brachte weder ihre Logik noch ein leichtes Zittern ihrer Stimme unter Kontrolle, und ich sah sofort, daß sie in das richtige Fettnäpfchen getreten hatte. Maud mußte vor den fatalen Worten noch einen gewissen Ausdruck gezeigt haben, wie ich nachträglich feststellen konnte; denn jetzt war auch der verschwunden.
Maud versuchte noch wochenlang, uns über den Stand ihrer Deutsch-kenntnisse zu täuschen; aber wir merkten bald, daß sie es zwar nicht sprechen konnte, aber recht gut verstand. Sie hatte sich unsere vertrackte Geheimsprache angeeignet, nicht mit mitteleuropäischer Gründlichkeit, aber mit Intuition, um deutschsprachige Arbeiten über Katzen lesen zu können, von denen sie übrigens nicht viel hielt (dies ihre Ansicht, nicht meine).
Jetzt aber leerte sich ihr Gesicht stufenweise. Es wurde von Sekunde zu Sekunde fader. Es war eine faszinierende Leistung. Ich konnte den Blick nicht davon abwenden und starrte Maud schweigend an, während die Frauen sich höchst sachlich über die Verteilung der Hütten, die Wasser-frage und den - selten benutzten, weil gräßlich lauten - Stromgenerator weiter oben am Hang unterhielten. Maud drückte Susanne den Schlüssel zu unseren Hütten in die Hand; aber erst als Susanne mich, diesmal auf Englisch, aufforderte, mit ihr unser neues Heim zu besichtigen, ging mir auf, wie rüpelhaft ich mich benahm und wie berechtigt Mauds leeres Mienenspiel war. Sie hatte nun sechs Monate in Mti Mwekundu verbracht und sich nach Herzenslust einrichten und benehmen können; daß es ihr nicht viel ausmachte, so lange allein zu sein, sah man ihr an. Und nun brach da ein Pärchen herein, mit dem sie auf unbestimmte Zeit auskommen mußte, nicht einmal Engländer, sondern aus einer unbestimmten Gegend, von der man nicht wußte, ob sie von eingebildeten Spießern à la Schweiz, polternden 'Hunnen' oder balkanesischen Knoblauchspaniern bewohnt wurde, und mein Gestarre hatte ihr nur bestätigen können, was sie ohnehin befürchtet hatte: geplante erotische Schwierigkeiten, und die in unde-zenter, kontinentaler Manier. Sie käme zum Tee herüber, erklärte sie knapp und zog sich in ihre Hütte zurück.
Zwei geräumige ovale Blechhütten links und rechts einer überdachten Veranda, deren Rückwand aus Feldsteinen aufgemauert war, das war das erste, was wir von unserm neuen Zuhause sahen. In die Mitte der Verandarückwand war ein Kamin eingelassen; ein guter Geist hatte daneben bereits einige Eukalyptusknüppel aufgestapelt. An jedes der Ovale schloß sich hinten eine kleinere halbovale Hütte an, die vom Vorraum durch einen ziemlich häßlichen Plastikvorhang getrennt war. Die vier Hütten bildeten eine Art Hufeisen, in dessen Öffnung eine Miniblechhütte stand, die allem Anschein nach als Küche gedacht war. Die fünf Hütten bildeten einen Hof, in den man durch eine Tür in der Feldsteinmauer trat. Ziegelsteine bildeten die Böden von Veranda und Hütten. Ich hörte Susanne seufzen, begriff aber auch selbst, wie mühsam es sein würde all die kleinen Fugen zwischen ihnen sauberzuhalten. Offensichtlich war vorgesehen, links zu wohnen und rechts zu arbeiten. Das linke Halboval war mit zwei Betten, einem Kleiderschrank, dem man hierzulande seine Herkunft aus dem Sperrmüll nur zu deutlich angesehen hätte, einem Waschbecken, einer Duschecke und einer Klokabine gut ausgefüllt. Umso dürftiger war das zugehörige ovale Wohnzimmer möbliert: mit einem Tisch, vier Stühlen sowie vier Korbstühlen, die noch dazu eindeutig auf die Veranda gehörten. Der linke Komplex war noch knapper bestückt: eine Klokabine und ein Waschbecken im hinteren Raum, im vorderen ein Tisch, zwei Stühle und zwei bücherbrettartige Gestelle.
„Gemütliches Arbeitszimmer.“
Susanne antwortete nicht. Auch sie hatte vielleicht meinen langen Blick auf Mauds Schaustellung mißverstanden. Wahrsheinlich ging es ihr aber wie mir. Wir hatten uns zwar zu Hause des Langen und Breiten darüber unterhalten, daß man im Busch würde auf Komfort verzichten müssen, daß es geradezu kriminell und spießig sei, im Busch nach Komfort zu schreien; aber so brüsk mit dieser Kärglichkeit konfrontiert zu werden, war doch etwas anderes.
Schweigend packten wir unsere paar Bücher, Wäschestücke und Vorräte aus, das bißchen Geschirr und Besteck, das wir mitgebracht hatten, die kleinen sentimentalen Dinge, Fotos, Susannes Plüsch- und Gummi-känguruhsammlung. Susanne wollte die Eßwaren in die Küche bringen. Dort erwartete sie ein neuer Schock: die Küche enthielt eine offene, von einigen Ziegelsteinen umrahmte und markierte Feuerstelle, eine Zink-wanne und eine Emailleschüssel, sonst nichts. Die Wände waren schwarz verrußt. Susanne brachte die Vorräte auf einem der beiden Gestelle im Arbeitszimmer unter und machte sich daran, die Betten zu beziehen. Ich stand am Fenster und sah in die Ebene hinaus. Welche Leere. Welche Verlassenheit. Doch nein, eine kleine Herde Oryxantilopen zog zwischen den kümmerlichen Büschen dahin. Oryx hatten wir noch nicht gesehen auf dem Weg von der Küste herauf nach Mti Mwekundu. Ihr Anblick hätte mich erfreuen oder doch wenigstens aufmuntern sollen. Stattdessen ließ ich mich von der Haltung des Trüppchens anstecken. Mit gesenkten Köpfen trotteten sie durch den Glast, müde...
Und doch hätte ich eine von ihnen sein mögen. Oryxgeißen waren sicher anders. Das kommende Jahr lag wie ein Berg vor mir. Wie sollte ich das durchhalten, mit zwei verrückten Frauen ein ganzes Jahr in diesen elenden Blechhütten in der Einöde eingesperrt zu sein?
Um fünf Uhr kam Maud mit drei Tassen starken britischen Tees herüber und ließ sich zwischen uns auf einem der drei Korbsessel nieder. Während rasch die Nacht hereinbrach, erzählte sie von den Löwenrudeln, die sie um Mti Mwekundu herum ausgemacht hatte, wie sie zusammengesetzt waren, wie weit sie den Wagen herankommen ließen, woran man die führenden Weibchen erkennen könne, wie wenig sie erst von ihnen wisse. Je dunkler es wurde, desto weniger wußte sie von ihnen, desto tiefer stapelte sie. Es war eine Angeberei ohnegleichen.
„Habt Ihr keine Lampen mitgebracht?" fragte sie plötzlich aus dem Dunklen.
„Lampen?"
Sie belehrte uns, daß das unumgänglichste Gerät auf einer Station wie Mti Mwekundu eine Petroleumlampe sei, das heißt, für jeden eine, und keine von den kleinen, die Bungwanesen in ihren Hütten verwendeten, sondern anständige große Colemanlampen; „denn ihr wollt abends ja doch schließlich arbeiten und lesen."
Wir mußten ihr auf ihre Veranda folgen, wo sie ihre Colemanlampe in Gang setzte und jeden Schritt in allen Details erklärte. Anschließend mußte ich mich an ihrer Zweitlampe versuchen. Zunächst mußte ich den Petroleumtank unter der eigentlichen Lampe 'aufpumpen', mit andern Worten, unter Überdruck setzen, der das Petroleum später in den Leuchtstrumpf treiben würde. Wie jeder Anfänger dachte ich natürlich viel zu früh, es sei nun genug, und Maud rügte mich dafür in grobem Ton. Sie sprach von Faulheit, und es war keine Koketterie in ihren Worten, weiß Gott nicht. Wenigstens gelang mir einigermaßen, den Leuchtstrumpf anzuzünden; aber ich ließ das Petroleum zu früh und zu stark einströmen, so daß der Glutfleck in ihm ersoff, und ich mußte alles noch einmal von vorn anfangen, und unter grimmigen Maud'schen Kommentaren.
Schließlich zischte und leuchtete die Lampe, wie sie sollte. Sie warf scharfes helles Licht auf den Sandplatz, unsere Hütten und sogar noch auf die Sträucher tiefer in der Ebene. In der totalen Finsternis um uns herum mußte man sie meilenweit sehen. Wir sollten sie einstweilen behalten, befand Maud, und nicht vergessen, sie täglich früh genug, das heißt, bevor es dunkel würde, aufzufüllen. Wenn wir das erste Mal zu Shamil führen, sollten wir mindestens für jeden von uns eine kaufen. Auch ein Petroleumkocher für Tee sei zu empfehlen.
„Shamil?"
Shamil sei der Inhaber des nächsten Ladens, hundert Kilometer nach Süden an der Bahnstrecke zwischen Medinat Kafir und Moyomoyo. Er hätte fast alles, was man so brauche, und vieles besorge er auch, wenn man ihn darum bitte, natürlich mit hohem Aufgeld, bis zu zweitausend Prozent bei kleiner Ware, Nägeln zum Beispiel oder Nähnadeln, was aber immer noch billiger sei, als jedes Mal nach Moyomoyo oder Medinat Kafir zu fahren.
Ich war erleichtert, als wir wieder unserer Hütte zustrebten, Susanne mit dem Henkel der Lampe in der linken Hand.
8
Zum Abendessen waren wir allein; aber noch vor Sonnenaufgang trommelte uns Maud aus den Betten. Die Parkwachen hätten in einer anderen Ecke des Parks die Reste eines Zebra- und Büffelmassakers entdeckt, das die Wilderer kürzlich veranstaltet hätten. Wir sollten mit ihr hinfahren. Es sei wichtig, gleich am Anfang zu sehen, wie es hier zuginge. Unsern Wagen könnten wir stehen lassen; es sei genug Platz in dem ihren. Die Parkwachen führen mit ihrem Laster.
Wir waren müde und zerschlagen von der Anfahrt und den ungewohnten Betten, außerdem schlechter Laune wegen der ehelichen Mißverständnisse am Vortag, über die wir uns bis jetzt ausgeschwiegen hatten. Nun wagten wir uns Maud und der guten Sache nicht zu widersetzen. Eilfertig sprangen wir von unserm Lager und standen in Windeseile bereit.
Wir fuhren fünf Stunden. Susanne und ich mußten feststellen, daß der Weg von der Außenwelt nach Mti Mwekundu, der uns, wenigstens mir, tags zuvor so verloren vorgekommen war, eine Staatspiste erster Ordnung war. Es hatte geregnet, und in den Senken zwischen den flachen Grasrücken schlitterte der Lastwagen vor uns bald rechts, bald links tief in den wirren Pflanzenwuchs zwischen Piste und Steppe hinein. Unendlich langsam kroch er dahin. Bei der kleinsten Steigung ging ihm beinah die Puste aus. Auf Abhängen bewarf er Mauds Wagen von oben bis unten mit Schlamm. Ich saß zwischen den beiden Frauen, genau da, wo die beiden Scheiben-wischer den Schlamm auf der Windschutzscheibe nicht mehr erreichten; schon nach zehn Minuten sah ich nicht mehr, wo es lang ging. Maud schaltete zwischen meinen Knien herum, sachlich, energisch, auf Löcher und Schlammbahnen konzentriert, zum Fürchten. Die Idee, daß sie mich 'ins Bett abkommandieren' könnte, wie Susanne es in ihrer Verstiegenheit einmal formuliert hatte, war grotesk, wenn man ihr zusah. Mich ärgerte dieses gleichgültige und, wie ich meinte, ostentativ sexlose Geschubse. Hätte ich gewußt, wie gleichgültig Maud in solchen Lagen gegen erotische Möglichkeiten und den Eindruck, den sie hervorrief, tatsächlich war, so hätte ich nicht einmal den Trost gehabt, mich ärgern zu können, nur das Elend, zwischen zwei jungen Frauen zu hängen, hilflos gegen die Decke geschleudert zu werden, wenn Maud wieder einmal einen Stein übersehen hatte, keinen anständigen Griff in Reichweite, verschwitzt, säuerlich vor mich hinstinkend, rechts zu einem Weibchen meiner eigenen Art hin, links zu einem fremden oder doch wenigstens fremderen, und es brachte auch nicht viel, die Oberarme so fest wie möglich an den Körper zu pressen.
Immer wieder hielt der Laster an, die Parkwachen kamen an unsern Wagen, schlugen die Hacken zusammen, legten die rechte Hand ans Käppi und baten Maud, vor ihnen herzufahren. Maud zog jedesmal eine Schnute, die ihren Abscheu gegen das halbmilitärische Gehabe deutlich zum Ausdruck brachte und wohl auch bringen sollte, und lehnte ab. Es war nicht zu übersehen, daß in dieser Frau, die aussah wie die britisch-nordische Herrenrasse schlechthin, jene, die Jahrhunderte gelassen über Hindus, Moslems, Kelten, Gurkas, Afrikaner, Buren, Malaien und im fernen Guyana sogar über ein paar Indianer geboten und zwischen buddhistischen Tempeln, Moscheen, Kokospalmen, Korallenriffen und Teeplantagen unbeirrt Golfplätze angelegt hatte, daß im Kopf dieser arrogant ausdrucklosen Dame dieselben leicht abgestandenen radikal-demokratischen Ideen spukten, die mir den Abschied vom schönen Alpenvorland so leicht gemacht hatten. Sie wollte es auf keinen Fall besser, eher schlechter haben als andere, besonders Nichtweiße, und ihre Kumpel hatten nachzuziehen. In diesem Fall gelang ihr das prächtig: was wir hinter uns an Schlamm verspritzten, flog niemals so hoch, daß es das Führerhaus des Lasters erreicht hätte. Unsere Vordermänner dagegen...
Es sollte noch besser kommen. Der Laster fuhr plötzlich in eine stocktrockene Ebene ein, bis zu der das Wasser der Wolken offenbar nicht mehr gereicht hatte, und sogleich erhob sich hinter dem Laster eine kirchturmhohe Staubwolke, die uns jede Sicht nahm. Der Staub drang in den Jeep ein, in Hemd, Hose, Haar, Ohr, Nase und Mund. Mauds blaue und Susanne graue Augen hoben sich seltsam auf den weißen Augäpfeln der beiden Lateritgesichter ab.
Nach einer staubigen Ewigkeit bog der Wagen vor uns in die Savanne hinein, in der es offensichtlich vor kurzem geregnet hatte; das Blattwerk machte wieder einen grüneren, frischeren Eindruck. War der Laster vorher schon geschlichen, so kroch er jetzt mehr rückwärts als vorwärts, was aber nicht verhinderte, daß bald links, bald rechts ein Rad in irgendein Loch sauste und die Männer auf der Ladefläche von einer Seite zur andern purzelten. Eine halbe Minute später tat es ihm unser Jeep nach, und nachdem ich einmal auf Maud und sodann auf Susanne gefallen war, die im Gegensatz zu der weiterhin ungerührten Maud eheweibliche Klagelaute ausstieß, erfaßte mich jedesmal wilde Panik, wenn ich den Laster absacken sah: ich konnte nicht im geringsten vermeiden, wieder auf eine meiner beiden Nachbarinnen geschleudert zu werden. Nichts sah ich von dem, dessentwegen wir diese Torturen auf uns genommen hatten, bis wir direkt davorstanden, und es mußte doch, wie uns die Parkwachen herablassend versicherten, bereits seit einer Stunde an Hunderten von Geiern im graubleichen Himmel zu orten gewesen sein.
Geier bildeten jedenfalls die Hauptmasse des überquellenden Lebens, das sich plötzlich in der stillen Savanne vor uns auftat. Sie saßen in Scharen in den krüppeligen Akazien, an denen viele Äste abgebrochen und zu einem großen Haufen zusammengelegt waren, den die Parkwachen jetzt ausein-anderzogen. Andere Geier saßen am Boden. Die großen Vögel starrten auf den Fleck, den die Männer freilegten. Ein paar kühne hüpften zwischen die Leute hinein, flohen aber gleich wieder vor dem nächsten belaubten Ast, der sich auf sie zubewegte. Immer neue stießen vom Himmel herab, der nach wie vor voll von den gewaltigen Seglern hing. All das nahm ich allerdings nur durch einen Schleier wahr; denn kaum hatte ich den Jeep verlassen, als mir ein Leichengeruch auf die Brust schlug, daß ich halb ohnmächtig wurde.
Denn das kam unter dem raschelnden Laubwerk zum Vorschein: Gedärm, das sich bereits weitgehend verflüssigt hatte, Knochen, von denen ins Grünliche spielende Fleischfetzen herabhingen, dazwischen Blut, auf dem sich Teppiche schillernder Schmeißfliegen in ständiger Bewegung aus-breiteten, Füße, große Büffelfüße, Impalafüße, erkennbar am schwarzen Fleck auf der Vorderseite, ein Kudufuß mit koketten weißen Tupfen über dem schwarzen Huf, ein Büffelkopf mit ausgebrochenen Hörnern, dem die Zunge aus dem verdrehten Unterkiefer herausgeschnitten war, ausgefranste Ohren, zerfließende Augen aller Größen.
Da war auch der Kopf eines Büffelkalbs, der uns lebhaft zu betrachten schien, dessen Augen aber nur aus quibbelnden Maden bestanden. Ich war dankbar, daß es einem Geier gelang, ihn ein Stück weit wegzuschleifen. Er ließ ihn zwar nach wenigen Schritten fallen; aber der Kopf lag nun nicht mehr in einer so sprechenden Position, und außerdem bedeckte er sich in wenigen Minuten mit schwarzbraunen Wanderameisen, die alles davon-getragen haben dürften, Haut, Muskeln, was noch an Gehirn im Schädel steckte, Maden, Aaskäfer, selbst Fliegen, die sich beim Eierlegen über-raschen ließen.
Die Wilderer, so berichteten die Parkwachen gleichmütig, hatten nächtens an diesem abgelegenen Ort ihre Beute zusammengetragen, ordnungsgemäß zerlegt und verladen. Die tiefen Spuren ihrer Transporter standen noch in der roten Erde. Sie hatten mit Zweigen bedeckt, was nicht verwertbar war oder auch nur den Transport nicht lohnte, damit die Geier die Parkwachen nicht gleich zu diesem Platz führen würden. Er war diesen in der Tat zwei, drei Tage verborgen geblieben, solange eben, wie die Blätter der decken-den Zweige frisch geblieben waren. Schakale und Hyänen hatten sich offenbar nur am Rand bedient, und das wohl nachts, und sie hatten das Gezweig noch nicht beiseite gezerrt. Jedenfalls hatten die Geier die gigantische Mahlzeit erst vor kurzem entdeckt. Die Wilderer mußten ihre Beute längst unter die Leute gebracht haben, bis hinauf nach Moyomoyo und vielleicht noch weiter.
Den Parkwachen schien die dicke Luft nichts auszumachen. Sie strichen sich nur ab und zu lässig die Schmeißfliegen vom Gesicht. Gemächlich begannen sie, die Einzelteile zu ordnen und zu zählen. Ein Vormann markierte in einer Strichliste die einzelnen Tiere nach Art, Alter und, wenn möglich, Geschlecht. Es war nicht einfach. Wie gehörten zum Beispiel die vielen Füße zusammen? Die Männer zerbrachen sich nicht weiter die Köpfe. Sie kicherten nur verlegen vor sich hin, wenn wir sie auf ein Häufchen von fünf Füßen aufmerksam machten oder auf zwei Kudufüße, die mit einem Büffelhorn als ein Tier zusammengelegt worden waren. Sie gingen auch von solchen Anordnungen nicht ab, und wenn ihnen die Geier unterm Zählen ein Knochenhäufchen davontrugen, trugen sie eben ein Tier weniger in ihre Formulare ein.
Wir aber, verblödet vom Gestank, standen tatenlos daneben und mußten uns damit begnügen, empört zu sein. Wir waren es alle drei, besonders aber Maud. Sie hielt ihr Kinn fest auf den Hals gepreßt; es verdoppelte sich drei- und -vierfach. Die zusammengezogenen Lippen bekamen Falten, und, soweit man es unter dem Lateritstaub beurteilen konnte, war ihr Gesicht rot vor Zorn. So gemindert mein Denkvermögen auch war, ich konnte nicht umhin, mich darüber zu wundern. Diese Frau arbeitete an Löwen. Stank und quibbelte ein von Löwen getöteter Büffel nach meh-reren Tagen nicht genauso wie die Reste vor uns? Wenn Maud nach eigener Aussage auch noch nicht alles über Löwen wußte, das mußte ihr in sechs Monaten Mti Mwekundu doch aufgefallen sein. Es mußte ihr vertraut genug geworden sein, um diesen Anblick gelassener hinzu-nehmen. War es die unglaubliche Masse solcher Reste, oder richtiger, die unglaubliche Anzahl von Tieren, von denen diese Reste stammten, was Maud so in Rage brachte?
Susanne sah unter der Staubschicht eher blaß aus. Ich anscheinend auch; denn die Parkwachen begleiteten uns zum Jeep zurück, als ob sie Krankenpfleger wären.
Der Heimweg führte in der Dämmerung an großen Tierherden vorbei, die den Wilderern einstweilen entgangen waren. Wir warfen ihnen müde, gequälte Blicke zu. Als wir unsere Blechhütte betraten, schnupperten wir verzweifelt: wir wurden den Gestank nicht los. Er hielt nicht nur in den Kleidern; jeder Geruch, ob er nun aus unseren Laken aufstieg, von der parfümierten englischen Seife oder vom Körper des Partners, selbst dem frisch geduschten, wurde zu Leichengeruch. Es war tiefe Nacht. Wir zündeten die Colemanlampe gar nicht erst an, nur eine der Kerzen, die wir mitgebracht hatten. Wir löschten unsern Durst wider besseres Wissen mit ungefiltertem Ndogowasser aus der Leitung und gingen ins Bett. Essen mochten wir nichts. Als Susanne die Kerze ausgeblasen hatte, hatten wir nichts mehr, was uns von unseren geruchlichen Fehleindrücken hätte ablenken können, und immer noch die Aashaufen vor Augen.
9
Maud hatte erreicht, was sie wollte. Sie hatte uns gezeigt, daß es im Park Schwerwiegenderes zu bedenken gab als unser Dreieck und daß sie nicht wünschte, dieses auf die von Susanne gefürchtete Basis zu stellen. Ich ärgerte mich, daß ich mich hatte überrumpeln und zu einer solchen Irrsinnsunternehmung, letztlich ohne Sinn und Zweck, verführen lassen, und nahm mir vor, weiteren Vorstößen dieser Art entschiedenen Wider-stand zu leisten. Wir zogen uns in unsere vier Blechhütten zurück und konnten gar nicht erwarten, mit der Arbeit anzufangen.
Die Regen, die die Piste zu den Aashaufen teilweise in eine Schlammbahn verwandelt hatten, waren Vorboten der großen Regenzeit gewesen. Aber sie hatten noch keine größeren Gazellen- und Topiherden in die Gegend um Mti Mwekundu locken können. Zwei Tage zuvor waren wenigstens einige Oryx unterhalb der Station durchgezogen; jetzt war die Ebene wie leergefegt, und unser Eifer fand nichts, das heißt, fast nichts, an dem er sich hätte auslassen können. Fast nichts; denn eine Antilope war immerhin zu sehen. Eine einzige.
Eine Grantgazelle nämlich, ein Bock, stand kaum hundert Meter von unserer Hütte entfernt auf einem Fleck. Er stand dort stundenlang, reglos, um aus - uns Neulingen wenigstens - unerfindlichen Motiven heraus plötzlich zwei-, dreimal einen Huf vor den andern zu setzen. Er tat dies mit aufreizender Langsamkeit, als wolle er die paar Meter Laufstrecke nur nicht zu schnell vergeuden. Gelegentlich nahm er auch ein paar Grashalme zu sich oder tat sich nieder, um wiederzukäuen, auch alles dies langsam... langsam...
Ein ärgerliches Tier. Es tat so, als habe man ihm die Preisaufgabe gestellt, in möglichst langer Zeit möglichst wenig Verhalten zu zeigen. Ich sah ihm trotzdem durch das Fenster unseres Wohnzimmers, oder besser, unseres künftigen Wohnzimmers, zu, stundenlang. Ich ließ mich sogar von Susan-ne ablösen, wenn ich einen Kaffee nötig zu haben glaubte. Schließlich waren wir ja gekommen, um das Verhalten von Antilopen zu untersuchen. Das einzige Ergebnis unserer Bemühungen war, den Fleck, auf dem der Bock offensichtlich zu bleiben wünschte, bis auf wenige Meter eingrenzen zu können, wenigstens bis zum späten Nachmittag, als das Tier plötzlich auf und davon ging und hinter einigen Büschen in der Ebene verschwand.