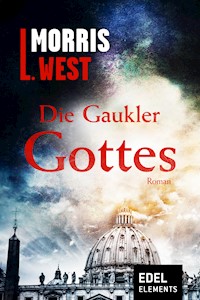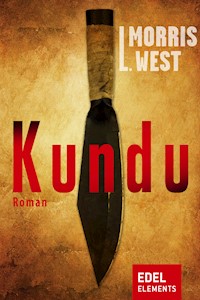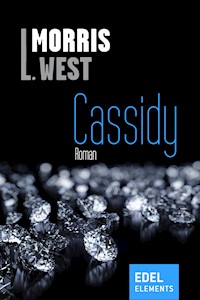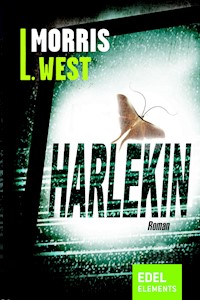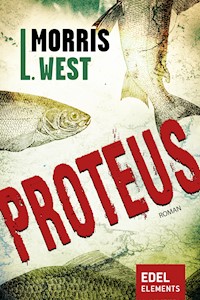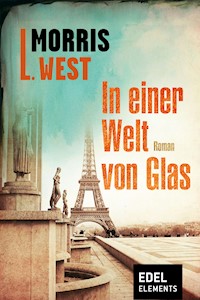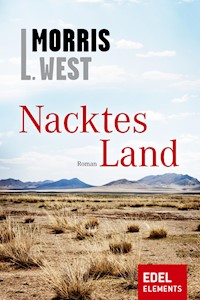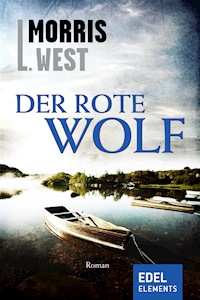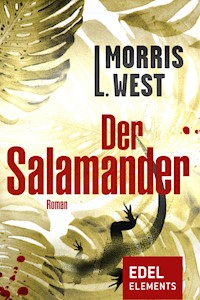
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Morris L. West hat mit seinem atemberaubend spannenden Roman "Der Salamander" weltweit Begeisterung ausgelöst. Es geht um ein hochbrisantes Thema: einen Staatsstreich in Italien mit geradezu beklemmend realem Hintergrund... Oberst Dante Alighieri Matucci vom italienischen Geheimdienst gerät bei Nachforschungen zum mysteriösen Tod eines hochdekorierten Generals, Kopf einer neofaschistischen Verschwörerclique, in einen Strudel dramatischer Ereignisse. Die Entdeckung eines geheimnisvollen Emblems auf einem Kärtchen – ein gekrönter, flammenzüngelnder Salamander – führt Matucci zu einem einflußreichen Industriellen, der unter dem Decknamen "Salamander" im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle im Widerstand gespielt hat. Mit ihm läßt er sich auf ein gefährliches Bündnis ein. Doch auch Intrigen und Morddrohungen können Matucci nicht von seinem Vorhaben abbringen, die Verschwörer zu entlarven - auch wenn er dabei sein Leben und seine Liebe riskiert... Große Hollywood-Verfilmung mit Franco Nero und Anthony Quinn in den Hauptrollen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Der Salamander
Roman
Ins Deutsche übertragen von Karl-Otto von Czernicki
Edel eBooks
Anmerkung des Autors
Dieses Buch ist ein Roman. Die darin wiedergegebenen Ereignisse sind Analogien und Allegorien der Wirklichkeit. Die handelnden Personen sind der Phantasie des Autors entsprungen.
Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert Und handelt, statt zu reden noch und noch. So was hätt einmal fast die Welt regiert! Die Völker wurden seiner Herr, jedoch Daß keiner uns zu früh da triumphiert – Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!
BERTOLT BRECHT,
Inhalt
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Impressum
Erstes Buch
Für große Taten eignen sich nur skrupellose Menschen.
TURGOT
Zwischen Mitternacht und Morgendämmerung, während seine römischen Mitbürger das Ende des Karnevals feierten, starb in seinem Bett Massimo Graf Pantaleone, General des Militärstabes. Ein Junggeselle Anfang sechzig und Soldat von spartanischem Zuschnitt, starb er allein.
Sein Diener, ein ehemaliger Wachtmeister der Kavallerie, brachte den Kaffee des Generals zur gewohnten Stunde um sieben Uhr morgens herein und fand seinen Herrn auf dem Rücken liegend vor, komplett angezogen, den Mund offen, die Augen starr auf die getäfelte Decke gerichtet. Der Diener stellte den Kaffee behutsam beiseite, bekreuzigte sich, schloß dem Toten mit zwei Fünfzig-Lire-Stücken die Augen und rief dann den Adjutanten des Generals, Hauptmann Girolamo Carpi, an.
Carpi rief den Direktor an. Der Direktor rief mich an. Sie finden meinen Namen im Salamander-Dossier: Dante Alighieri Matucci, Oberst der Carabinieri, mit Sonderauftrag zum Militärischen Nachrichtendienst abkommandiert.
Der Dienst wird gewöhnlich mit seinen italienischen Initialen, SID (Servizio Informazione Difesa), bezeichnet. Wie jeder andere Nachrichtendienst, gibt er große Mengen Steuergelder aus, um sich selbst zu verewigen, und etwas weniger dafür, um Informationen zu sammeln, die hoffentlich dazu beitragen, die Republik gegen Einfälle von außen, Verräter, Spione, Saboteure und politische Terroristen zu schützen. Sie merken schon, daß ich von seinem praktischen Nutzen nicht viel halte. Ich habe ein Recht dazu. Ich arbeite in ihm; nun wird freilich jeder, der in ihm arbeitet, irgendwie desillusioniert. Der Dienst verleitet zum Verlust der Unschuld; man wird zum gefügigen Instrument der Politik. Doch das ist eine Abschweifung ...
Massimo Graf Pantaleone, General des Militärstabes, war tot. Ich wurde beauftragt, der Leiche einen ordnungsgemäßen Abgang zu verschaffen. Ich brauchte Hilfe. Die Armee stellte diese zur Verfügung in Gestalt eines älteren Sanitätsoffiziers im Range eines Obersten und eines Heeresrichters im Range eines Majors. Wir fuhren gemeinsam zur Wohnung des Generals. Hauptmann Carpi empfing uns. Der Diener des Generals weinte in der Küche über einem Glas Grappa. So weit, so gut. Keine Aufregung. Keine Nachbarn im Treppenflur. Die Verwandtschaft noch nicht benachrichtigt. Ich schätzte Carpi nicht sehr, mußte aber seine Diskretion loben.
Der Sanitätsoffizier führte eine oberflächliche Untersuchung durch und kam zu dem Schluß, der General sei an einer Überdosis von Barbituraten, die er selbst eingenommen habe, gestorben. Er stellte den Totenschein aus, der von dem Heeresrichter gegengezeichnet wurde und attestierte, daß der Tod auf Herzversagen zurückzuführen sei. Dieses Dokument war nicht falsch, sondern einfach bequem. Das Herz des Generals hatte aufgehört zu schlagen. Schade, daß es nicht schon vor Jahren zu schlagen aufgehört hatte. Ein Skandal würde niemandem nützen. Er könnte höchstens einer großen Anzahl unschuldiger Menschen erheblichen Schaden zufügen.
Um acht Uhr dreißig traf ein Sanitätskraftwagen des Militärs ein und transportierte die Leiche ab. Ich blieb in der Wohnung mit Carpi und dem Diener zurück. Der Diener kochte uns Kaffee, und während wir ihn tranken, befragte ich ihn. Seine Antworten stellten eine Reihe simpler Tatsachen fest.
Der General hatte außerhalb zu Abend gegessen. Er war zwanzig Minuten vor Mitternacht zurückgekehrt und hatte sich gleich in sein Schlafzimmer zurückgezogen. Der Diener hatte Türen und Fenster verriegelt, die Alarmanlage eingeschaltet und sich zu Bett begeben. Er war um sechs Uhr dreißig aufgestanden und hatte den Morgenkaffee zubereitet ... Besucher? Keine ... Eindringlinge? Keine. Die Alarmanlage war nicht ausgelöst worden ... Telefonanrufe? Keine Ahnung. Der General pflegte den Privatanschluß im Schlafzimmer zu benutzen. Der Hausanschluß hatte jedenfalls nicht geklingelt ... Das Verhalten des Generals? Normal. Er war ein schweigsamer Mann. Überhaupt schwer festzustellen, was er dachte. Das war alles ... Ich klopfte ihm auf die Schulter, murmelte ein paar beruhigende Worte und entließ ihn in die Küche.
Carpi schloß hinter ihm die Tür, goß von dem Whisky des Generals zwei Gläser ein, reichte mir eines und fragte: »Was sagen wir seinen Freunden – und der Presse?«
Das war genau die Art von Frage, die man bei ihm erwarten konnte: trivial und irrelevant.
»Sie haben den Totenschein gesehen, unterzeichnet und beglaubigt: natürliche Ursache, Herzversagen.«
»Und der Obduktionsbefund?«
»Mein lieber Capitano, für einen ehrgeizigen jungen Mann sind Sie reichlich naiv. Es wird keine Obduktion geben. Die Leiche des Generals ist in ein Leichenschauhaus überführt worden, wo sie für eine kurze öffentliche Aufbahrung hergerichtet wird. Wir wollen, daß man ihn sieht. Wir wollen, daß ihm Ehrungen zuteil werden. Wir wollen, daß er als untadeliger Diener der Republik betrauert wird – was er in gewisser Hinsicht auch gewesen ist.«
»Und dann?«
»Dann wollen wir, daß man ihn vergißt. Und dabei können Sie uns helfen.«
»Wie denn?«
»Ihr Herr und Gebieter ist tot. Sie haben uns gute Dienste geleistet. Sie verdienen eine bessere Stellung. Ich würde einen Posten weit weg von Rom vorschlagen – etwa in Südtirol, oder in Taranto, vielleicht sogar Sardinien. Dort wird man wesentlich schneller befördert.«
»Darüber möchte ich mir gern noch Gedanken machen.«
»Keine Zeit, Capitano! Sie nehmen noch heute vormittag Ihre Versetzungspapiere in Empfang. Sie liefern sie, ausgefüllt und unterzeichnet, bis spätestens fünf Uhr nachmittags ab. Ich garantiere Ihnen, daß Sie unmittelbar nach der Beisetzung einen neuen Posten haben werden ... Und noch was, Capitano ...«
»Ja?«
»Vergessen Sie nicht, daß Sie sich in einer sehr heiklen Lage befinden. Sie erklärten sich damit einverstanden, einen Vorgesetzten zu bespitzeln. Wir vom SID sind Ihnen dankbar, aber Ihre Offizierskameraden würden Sie deswegen verachten. Die geringste Indiskretion würde also Ihrer Karriere schaden und Sie außerdem großen persönlichen Gefahren aussetzen. Ich nehme an, Sie verstehen mich?«
»Ich verstehe.«
»Gut. Sie können jetzt gehen ... Ach, noch eine Kleinigkeit ...«
»Ja?«
»Sie haben einen Schlüssel für die Wohnung. Lassen Sie ihn, bitte, hier.«
»Was geschieht anschließend?«
»Die übliche Routine. Ich prüfe Papiere und Dokumente. Ich verfasse einen Bericht. Bitte, versuchen Sie, bei der Beisetzung einen kummervollen Eindruck zu machen ... Ciao!«
Carpi ging hinaus und bemühte sich, den letzten Rest verlorener Würde zur Schau zu stellen. Er gehörte zu jenen schwachen, gut aussehenden Burschen, die stets einen Gönner brauchen – und meistens auch finden –, die diesen dann aber unweigerlich zugunsten eines Mächtigeren verraten. Ich hatte ihn eingesetzt, über Pantaleones Bewegungen, Kontakte und seine politischen Aktivitäten zu berichten. Jetzt war er überflüssig geworden und ein Risiko dazu. Ich goß mir noch ein Glas Whisky ein und versuchte, meine Gedanken zu ordnen.
Die Pantaleone-Affäre besaß alle Merkmale einer politischen Zeitbombe. Die Ironie des Schicksals lag darin, daß man den Namen auf dem Corso in alle Welt hinausschreien konnte, ohne daß auch nur einer unter tausend Bürgern der Republik ihn erkannt hätte. Und von denen, die ihn tatsächlich kannten, würde kaum einer unter zehn die Brisanz oder das Ausmaß der Verschwörung begreifen, die sich um diesen Namen gerankt hatte. Der Direktor war im Bilde; ich auch. Ich besaß Dossiers über alle Hauptbeteiligten. Lange Zeit war ich wütend darüber gewesen, daß man nichts gegen sie unternehmen konnte. Sie waren keine Verbrecher – jedenfalls noch nicht. Alle waren hochgestellte Persönlichkeiten – Minister, Abgeordnete, Industrielle, aktive Offiziere, Beamte –, die auf den Tag warteten, da die verworrene Lage in Italien – unsichere Regierung, Unruhe unter der Arbeiterschaft, wirtschaftliche Schwierigkeiten, eine unfähige Bürokratie und eine zutiefst enttäuschte Bevölkerung – das Land an den Rand der Revolution bringen würde.
An jenem Tag, der näher war, als viele Menschen ahnten, hofften die Verschwörer, die Macht zu ergreifen und sich einer fassungslosen Bevölkerung als Retter der Republik und als Garanten rechtsstaatlicher Ordnung zu präsentieren. Ihre Hoffnungen waren nicht unbegründet. Wenn es eine Junta griechischer Obristen geschafft hatte, warum sollte es dann nicht einer viel größeren und viel mächtigeren Gruppe von Italienern gelingen ... und besonders dann, wenn sie auf die Unterstützung der Armee und die aktive Mitarbeit der Sicherheitsstreitkräfte zählen konnte.
Ihr Aushängeschild stand schon seit langem fest: jener untadelige Soldat, ehemals Adjutant des Marschalls Badoglio, leidenschaftlicher Patriot, Freund des einfachen Mannes – der General Massimo Pantaleone. Jetzt war der General aus eigenem Entschluß von der Bühne abgetreten. Warum hatte er es getan? Wer oder was hatte den letzten Anstoß gegeben? Und warum? Stand ein neuer Mann hinter den Kulissen bereit? Wer war das? Wann und aufweiche Weise würde er sich zu erkennen geben? Und war der Tag vielleicht gar schon gekommen? Ich war beauftragt, alle diese Fragen zu beantworten, und ich durfte dabei zu keinerlei Fehlschlüssen kommen.
Auch das geringste Anzeichen, daß eine Untersuchung im Gange sei, würde das ganze Land in zwei Lager spalten. Falls die Presse auch nur andeutungsweise erführe, daß ein dubioses Dokument notariell beglaubigt und von der Armee herausgegeben worden sei, würde die Affäre in der ganzen Weltpresse Schlagzeilen machen.
Verschwörungen hat es in Italien immer gegeben, schon seit der Zeit, als Romulus und Remus von der Tiberinsel aus ihre zweifelhaften Geschäfte durchführten; aber wenn das Ausmaß dieses Komplotts und seine durchaus realen Erfolgschancen bekannt würden ... Dio! Innerhalb eines Tages würden Barrikaden auf den Straßen errichtet, und die Straßenbahnschienen wären voller Blut; sogar eine Meuterei bei den Streitkräften, deren politische Loyalität zwischen rechts und links tiefgreifend gespalten war, wäre nicht auszuschließen. Meine Bemerkungen gegenüber Hauptmann Carpi waren keine leere Drohung gewesen. Sollte er versuchen, sich selbst oder seine Informationen an neue Herren zu verkaufen, würde man für ihn schnellstens einen netten kleinen Unfall arrangieren. Aber in der Zwischenzeit mußte ich mich um meine eigene Arbeit kümmern.
Ich trank den restlichen Whisky aus und begann, die Wohnung nach Papieren zu durchsuchen. Ich öffnete Schubladen und Schränke und untersuchte alle Möbel nach Geheimfächern, durchstöberte die Taschen jedes Kleidungsstücks in den Schränken, schüttelte jedes Buch in der Bibliothek aus und entfernte das Löschpapier von der Schreibtischunterlage. Ich sparte mir die Mühe, alles, was ich fand, zu untersuchen, sondern legte alle Stücke auf einen Haufen. Es würde Stunden dauern, das Material zu sichten und zu analysieren – und viel würde schließlich nicht dabei herauskommen. Der General war ein zu alter Fuchs, um gefährliche Dokumente in seinem Haus herumliegen zu lassen.
Aber ich durfte kein Risiko eingehen; deshalb verrückte ich Bilder und Teppiche auf der Suche nach einem geheimen Safe. Dann ging ich zum Schluß noch einmal alles durch, hob Schüsseln und Vasen hoch und löste die Filzunterlagen der Schmuckkassetten, in denen der General seine Orden und Ehrenzeichen aufzubewahren pflegte. Und trotzdem hätte ich die Karte beinahe übersehen.
Sie lag hochkant hinter dem Nachttisch; ein kleines, rechteckiges Stück steifer Pappe, mit einer Zeichnung auf der einen und einer Inschrift auf der anderen Seite. Zeichnung und Inschrift waren in schwarzer Tusche von Hand ausgeführt worden. Die Zeichnung war durchgehend, mit einem einzigen Strich, in einer Reihe ineinander verschnörkelter Züge hergestellt worden. Sie zeigte einen Salamander, mit einem Krönchen auf dem Kopf, in einem Flammenbett liegend. Die Inschrift – ein perfekter Kupferstich – bestand aus vier Worten: »Un bel domani, fratello.«
»Ein schönes Morgen, Bruder ...« Es war ein typisch italienischer Ausdruck, der eine Vielzahl von Gefühlsregungen beinhalten konnte: eine eitle Hoffnung, die Zusage einer Belohnung, eine Rachedrohung, einen Schrei im Getümmel der Schlacht. Das Wort Bruder war ebenfalls zweideutig, und der Salamander schien zunächst völlig unverständlich, wenn es sich bei ihm nicht um das Symbol eines Klubs oder einer Bruderschaft handelte. Aber es bestand keine Verbindung zu irgendeinem Zeichen oder Decknamen in meinen Dossiers. Ich beschloß, die Karte den Spezialisten zu übergeben. Dann ging ich ins Arbeitszimmer zurück, schob die Karte in einen neuen Umschlag und steckte diesen in meine Jacke.
Jetzt hielt ich es für an der Zeit, mich mit dem Kavalleriewachtmeister einmal rein persönlich zu unterhalten. Ich fand ihn in der Küche – ein niedergeschlagener, alter Mann, der über eine unsichere Zukunft nachgrübelte. Ich tröstete ihn mit dem Gedanken, daß der General ihn wahrscheinlich in seinem Testament bedacht habe und daß er wenigstens Anspruch auf eine Abfindungsentschädigung aus der Hinterlassenschaft des Toten habe. Das schien ihn zu erleichtern, denn er bot mir Wein und Käse an. Als wir zusammen tranken, wurde er auf einmal redselig, und ich ließ ihn nur zu gern sein Herz ausschütten.
» ... Er brauchte gar nicht Soldat zu werden, wissen Sie. Die Pantaleones haben immer Geld wie Heu gehabt. Aber nicht, daß sie damit etwa verschwenderisch umgegangen wären. Du lieber Gott, nein! Sie drehten jede Lira dreimal um, bevor sie sie ausgaben. Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, daß sie reich geblieben sind. Ländereien in der Romagna, Wohnblocks in Lazio, das alte Gut in Frascati, die Villa auf Ponza – das hat sie jetzt natürlich alles bekommen.«
»Wer?«
»Sie wissen doch – die Polin. Die Frau, mit der er gestern abend noch diniert hat. Wie heißt sie doch gleich? ... Anders – ja, richtig – Anders. Sie ist seit Jahren seine Freundin gewesen. Wenn ich auch sagen muß, daß er in dieser Hinsicht sehr zugeknöpft war. Er hat sie nie hierher gebracht. Eigentlich merkwürdig ... Er wollte nicht, daß die Leute dachten, er amüsiere sich. So, wie wir in der Armee zu sagen pflegten: Es war, als hätte er einen Ladestock verschluckt. Ich wußte selbstverständlich über sie Bescheid. Ich nahm immer ihre Anrufe entgegen ... Manchmal ging ich in ihre Wohnung, um Sachen für den General abzugeben. Eine gutaussehende Frau, noch nicht über dem Höhepunkt. Dabei fällt mir ein ... Jemand müßte ihr sagen, was geschehen ist.«
»Das werde ich tun. Wo wohnt sie?«
Die Frage war eigentlich überflüssig. Ich kannte die Antwort und wußte noch eine ganze Menge mehr über Lili Anders.
»Parioli. Die Adresse steht im Notizbuch des Generals.«
»Ich werde sie finden.«
»He! Was machen Sie denn da! Sie nehmen doch nicht etwa Sachen des Generals mit? Ich bin für alles verantwortlich. Ich will nicht in Schwierigkeiten geraten.«
»Ich nehme alle seine Papiere mit, und ich werde mir dazu einen Koffer ausleihen.«
»Aber warum?«
»Aus Sicherheitsgründen. Wir können vertrauliche Dokumente hier nicht herumliegen lassen. So, jetzt gehen wir den Stapel durch, nehmen alles heraus, was der Armee gehört, und übergeben die persönlichen Unterlagen seinem Anwalt. Sie werden keine Schwierigkeiten haben, denn ich werde Ihnen eine offizielle Quittung aushändigen, bevor ich gehe. Klar?«
»Wenn Sie meinen ... Einen Augenblick! Wer sind Sie eigentlich? Ich kenne nicht einmal Ihren Namen.«
»Matucci. Carabinieri.«
»Carabinieri! ... Stimmt etwas nicht?«
»Keine Sorge ... Die übliche Prozedur – wie es sich bei einer wichtigen Persönlichkeit wie dem General nun einmal gehört.«
»Wer wird denn nun alle nötigen Vorkehrungen treffen, seine Freunde benachrichtigen, alles das?«
»Die Armee.«
»Aha, und was tue ich? Soll ich nur hier herumsitzen?«
»Etwas könnten Sie schon für uns tun. Es werden Leute anrufen. Notieren Sie sich alle Namen und Telefonnummern, und wir werden dafür sorgen, daß jemand zurückruft.«
»Ich werde weiter meinen Lohn erhalten?«
»Keine Sorge. Sie müssen entlohnt werden. So lautet das Gesetz ... Ich wollte Sie noch etwas anderes fragen. Wo hat der General gestern zu Abend gegessen?«
»Im Schachclub.«
»Sind Sie sicher?«
»Natürlich bin ich sicher. Ich mußte immer wissen, wo er war. Manchmal wurde vom Stab oder vom Ministerium angerufen ... Noch einen Schluck?«
»Nein, vielen Dank, ich muß jetzt gehen.«
»Und Sie sind wegen des Geldes absolut sicher?«
»Ja. Und Sie denken daran, die Anrufe festzuhalten?«
»Verlassen Sie sich auf mich, Freund. Das tat auch der General. Ich habe ihn nie hängenlassen. Er war kalt wie ein Fisch, wissen Sie, aber ich werde den alten Gauner vermissen. Wirklich.«
Der Mann fing an, rührselig zu werden, und es war Zeit, ihn loszuwerden. Ich kritzelte eine Quittung hin, ergriff den Dokumentenkoffer und trat hinaus in den sonnigen Frühlingstag. Es war zehn Minuten nach eins. Die Ladenbesitzer schlossen die Fensterläden, und auf den Straßen wimmelte es von Römern, die zum Mittagessen und zur Siesta nach Hause strebten.
Ich muß Ihnen ganz offen sagen, ich kann die Römer nicht leiden. Ich stamme aus der Toskana, und dieses Volk hier in Rom ist irgendwie mit den Hottentotten verwandt. Ihre Stadt ist ein Misthaufen, das umliegende Land ein einziger, riesiger Abfallplatz. Sie sind die schlechtesten Köche und gierigsten Esser in ganz Italien. Sie sind ungehobelt, dumm, zynisch und bar der elementarsten Umgangsformen. Sie kennen kein Mitgefühl und sind intrigant und hinterlistig bis ins letzte. Sie haben alles gesehen und nichts gelernt, außer den primitivsten Erfordernissen des Lebens. Sie haben kaiserlichen Pomp, päpstlichen Prunk, Krieg, Hungersnot, Pest und Plünderung erlebt; und dennoch werden sie das Knie vor jedem Tyrannen beugen, der ihnen ein extra Stück Brot und eine Freikarte für den Zirkus verspricht.
Gestern war es Benito Mussolini, trunken vor Rhetorik, der ihnen vom Balkon auf der Piazza Venezia lange Reden hielt. Morgen kann es ein anderer sein. Und wo war er jetzt, zu dieser Stunde am Aschermittwoch, in diesem Jahre eines zweifelhaften Heils? ... Eines war sicher – er würde nicht wie Dante Alighieri Matucci plattfüßig mitten auf dem Campo Marzio stehen.
Ich riß mich aus diesen Träumereien, ging einen halben Häuserblock weiter bis zu meinem Wagen, warf die Papiere auf den Sitz und fuhr ins Büro zurück. Ich hätte mir die Mühe sparen können. Meine zwei Angestellten waren zum Mittagessen gegangen; der dritte schäkerte mit der Stenotypistin, und die Datenbank war lahmgelegt, weil der Strom durch einen zwei Stunden dauernden Streik unterbrochen worden war. Es lag eine Nachricht vom Innenministerium vor, in der »sofortige Verbindungsaufnahme in einer höchst dringlichen Angelegenheit« erbeten wurde. Als ich dort anrief, wurde mir gesagt, daß meine Kontaktperson mit irgendwelchen ausländischen Besuchern unterwegs sei und eventuell um vier Uhr zurück sein würde. Mein Gott! Was für Idioten! Der Tag des Jüngsten Gerichts könnte hereinbrechen oder die Maoisten das Engelstor zum Vatikan stürmen, aber die Römer müssen erst ihre Siesta in Ruhe genießen, bevor sie zu neuen Taten schreiten.
Ich ließ das Bündel mit den Dokumenten auf den Schreibtisch fallen und rief nach dem Angestellten Nummer drei, damit er sie sortierte und zusammenstellte. Da der Streik auch den Fahrstuhl außer Betrieb gesetzt hatte, stieg ich die Treppe drei Stockwerke hinauf in das technische Untersuchungslaboratorium, wo auch zur Mittagszeit immer jemand anwesend sein mußte. Wie üblich war es der alte Stefanelli, der angeblich jede Nacht in einer Flasche mit Formalin schlief und jeden Morgen bei Sonnenaufgang frisch wie ein Fisch daraus wieder auftauchte. Er war ein kleiner, schrulliger Mann, mit wirren Haaren, gelblichen Zähnen und einer Haut wie altes Leder. Er mußte bereits zehn Jahre über das Pensionierungsalter hinaus sein, aber es war ihm gelungen, sich durch Protektion und besondere Begabung an seinen Job zu klammern.
Worüber sich andere Techniker den Kopf zerbrachen, wußte Stefanelli einfach. Man brauchte ihm nur ein paar Staubkörnchen in die Handfläche zu geben, und schon nannte er einem die Provinz und das betreffende Gebiet und konnte sogar mit einer gewissen Sicherheit das Dorf angeben, aus dem die Partikel stammten. Gab man ihm ein Stück Stoff, so befühlte er es eine Weile zwischen den Fingern, sagte einem dann genau, wieviel Baumwolle und wieviel Polyester es enthielt und in welchen Fabriken es erzeugt worden sein konnte. Aus einem Tropfen Blut, zwei Nagelspänen und einer Haarlocke entwarf er ein Bild des Mädchens, zu dem sie gehört hatten. Er war auf seine Art ein Genie, wenn er im Umgang auch oft reizbar und schwierig war; er zeigte einem die kalte Schulter, wenn man ihn hinters Licht führte, aber er schuftete auch vierundzwanzig Stunden ohne Pause für einen Menschen, der ihm Vertrauen entgegenbrachte. Er las viel und war jederzeit bereit, Wetten aufgrund seines technischen Wissens abzuschließen. Nur ein ganz junger oder sehr eitler Mitarbeiter hätte es gewagt, gegen ihn zu wetten. Als ich hereinkam, schwer atmend und mit säuerlichem Gesicht, begrüßte er mich überschwenglich.
»Eh, Colonnello! Was haben Sie heute für Steffi? Ich habe etwas für Sie ... Tod durch Ersticken ... grüne Alkaloide im Blut ... keine Punkturen, keine Schürfungen, kein erkennbarer Eintritt in den Blutstrom. Fünftausend Lire, wenn Sie mir sagen können, was das ist.«
»Wenn Sie mir so kommen, Steffi, weiß ich gleich, daß ich verliere. Was ist es denn?«
»Ein Schalentier. Kommt aus dem Südpazifik. Man nennt es den Goldmantel. Bei Berührung injiziert der Fisch mikroskopisch kleine Nadeln voller Alkaloide, die das zentrale Nervensystem lähmen. Der vorliegende Fall – ein Meeresbiologe, der mit den Amerikanern im Südpazifik gearbeitet hat ... Wenn Sie Interesse haben, schicke ich Ihnen eine kurze Darstellung darüber zu.«
»Vielen Dank, Steffi, aber heute bitte nicht. Ich habe genug eigene Sorgen.« Ich zog die Salamanderkarte heraus und gab sie ihm. »Ich möchte eine vollständige Analyse haben: Papier, Handschrift, Bedeutung des Symbols und alle Fingerabdrücke, die Sie abnehmen können. Und zwar möglichst schnell.«
Stefanelli betrachtete die Karte aufmerksam einige Augenblicke lang und erging sich dann in längeren Ausführungen.
»Der Karton' selbst ist japanischen Ursprungs – qualitativ hochwertiges Reispapier. Ich kann Ihnen innerhalb eines Tages sagen, wer so etwas importiert. Die Schriftzüge – phantastisch! So schön, daß man weinen möchte! So etwas hab ich nicht mehr gesehen, seit Aldo der Kalligraph im Jahre 1935 starb. Sie erinnern sich doch an ihn, nicht wahr? Aber nein, natürlich nicht. Dazu sind Sie zu jung. Hatte ein Atelier drüben bei der Cancelleria. Machte ein Vermögen mit gefälschten Wertpapieren und nachgemachten Adelsbriefen für Leute, die reiche Amerikanerinnen heiraten wollten ... Schön, Aldo ist tot, er kann Ihnen nicht mehr helfen. Wir müssen in den Karteien nachsehen, wer jetzt im Geschäft ist ... Die Zeichnung? Tja ... Offensichtlich ein Salamander, das Tier, das im Feuer lebt. Was es hier bedeutet, weiß ich nicht. Es könnte ein Warenzeichen sein. Es könnte eine tessera sein – die Mitgliedskarte für einen Klub. Vielleicht hat man den Salamander von einem Wappen übernommen. Ich werde es Solimbene zeigen ... Sie kennen ihn nicht. Alter Freund von mir. Arbeitet bei der Consulta Araldica. Kennt jedes Wappen in Europa. Er liest sie, wie andere ihre Tageszeitung lesen.«
»Gute Idee. Übrigens, fertigen Sie doch ein paar Fotokopien an, bevor die anderen vom Mittagessen zurückkommen. Ich werde sowieso eine für meine eigenen Nachforschungen benötigen.«
»Woher haben Sie das, Colonnello?«
»General Pantaleone ist gestern abend gestorben. Ich fand die Karte in seinem Schlafzimmer.«
»Pantaleone? Der alte fascista! Was ist denn passiert?«
»Natürliche Todesursache, Steffi ... und wir haben einen beglaubigten Totenschein, aus dem das klar hervorgeht.«
»Sehr zweckmäßig!«
»Sehr notwendig.«
»Mord oder Selbstmord?«
»Selbstmord.«
››Eh! Die Sache stinkt.«
»So, Steffi, das Ganze bleibt vorläufig zwischen Ihnen und mir – und dem Direktor. Geben Sie die Karte nicht aus der Hand. Kein Karteiblatt, keine Diskussionen im Laboratorium. Absolutes Stillschweigen, bis Sie wieder von mir hören.«
Stefanelli grinste und legte den Zeigefinger an die Nase – er wußte Bescheid und war mit der kleinen Verschwörung einverstanden.
»Ich liebe die Faschisten ebensowenig wie Sie, Colonnello – und wir haben in unserer Abteilung mehr als genug von ihnen. Manchmal frage ich mich, ob überhaupt noch Demokraten übriggeblieben sind – oder ob wir überhaupt jemals welche in Italien gehabt haben – außer Ihnen und mir. Wenn wir nicht bald zu einer stabilen Regierung kommen, gibt es einen colpo di stato, mit einem Faschisten an der Spitze. Eine Woche danach gibt es einen Bürgerkrieg – oder etwas Ähnliches – die Linke gegen die Rechte, der Norden gegen den Süden. Ich bin ein alter Mann. Ich kann es förmlich riechen ... Und ich habe Angst, Colonnello. Ich habe Söhne und Töchter und Enkelkinder. Ich will nicht, daß sie ebenso zu leiden haben, wie wir damals ...«
»Ich auch nicht, Steffi. Deshalb müssen wir in Erfahrung bringen, wer in die Fußstapfen des Generals tritt. Nehmen Sie sich die Karte vor. Rufen Sie mich an, Tag oder Nacht, sobald Sie irgend etwas festgestellt haben.«
»Viel Glück, Colonnello.«
»Das kann ich brauchen ... Ciao, Steffi.«
Ich tappte im dunkeln. Ich konnte mir aus den Pantaleone–Dokumenten kein Bild machen, solange sie nicht zusammengestellt und mit dem Dossier des Generals in Einklang gebracht waren. Der Direktor war der einzige Mensch, mit dem ich offen reden konnte, und er war nicht im Büro. Ich konnte natürlich Francesca aufsuchen, das kleine Modell, das am frühen Nachmittag immer zu Hause war. Aber dann wäre ich für den Rest des Tages für weitere Unternehmungen untauglich. Ich entschloß mich zu einer Tasse Kaffee in einer Bar und fuhr dann nach Parioli, um mit Lili Anders zu sprechen.
Ihre Wohnung lag im dritten Stock einer neuen Wohnanlage, ganz aus Glas und Aluminium, mit einem Portier in Livree und einem Fahrstuhl, der mit Walnußholz getäfelt war. Die Wohnung hatte, laut dem Dossier der Dame, sechzig Millionen Lire gekostet; die Unterhaltungskosten beliefen sich laut Mietvertrag auf einhundertundzwanzigtausend pro Monat. Die Steuerunterlagen der Comune di Roma wiesen aus, daß Lili Anders offiziell angegebene Einkünfte von einer Million Lire im Monat zu versteuern hatte. Da sie die Steuern ohne Murren abführte, war anzunehmen, daß ihre wahren Einkünfte etwa doppelt so hoch sein mußten. Ich unterhielt eine Wohnung, ein Dienstmädchen, einen drei Jahre alten Fiat und eine gelegentliche Spielgefährtin – und das alles mit sechshunderttausend pro Monat, abzüglich Steuern, und ich fand, daß Lili Anders eigentlich ein Glückspilz war. Als ich den Klingelknopf drückte, war ich deshalb schlecht gelaunt und ausgesprochen voreingenommen. Eine ältliche Haushälterin, in einem Gewand aus schwarzem Seidenkrepp und gestärktem weißen Leinen, trat mir wie eine echte Römerin lakonisch und feindselig entgegen:
»Ja?«
»Matucci. Carabinieri. Ich möchte mit Signora Anders sprechen.«
»Sind Sie angemeldet?«
»Nein.«
»Dann müssen Sie später wiederkommen. Die Signora schläft.«
»Ich muß Sie leider bitten, sie zu wecken. Die Angelegenheit ist dringend.«
»Können Sie sich ausweisen?«
Ich zeigte ihr meine Karte; sie nahm sie und las sie langsam durch, Zeile für Zeile; dann schob sie mich wie einen Kehrichthaufen in den Korridor und ließ mich stehen.
Ich wartete, grimmig und ungehalten, empfand aber widerwillig eine gewisse Bewunderung für diese Matrone, deren Vorfahren Dachziegel auf Päpste und Kardinäle und Marionettenfürsten geworfen hatten. Dann trat Lili Anders ein. Für eine Frau Mitte dreißig hatte sie sich außerordentlich gut gehalten; für meinen Geschmack war sie vielleicht ein wenig zu voll, aber sie befand sich ganz entschieden noch in den besten Jahren. Wenn man bedenkt, daß sie soeben noch geschlafen hatte, war sie hervorragend zurechtgemacht: Jedes einzelne Haar lag an der richtigen Stelle, das Make-up war in Ordnung, Rock, Bluse und Strümpfe zeigten nicht die geringste Falte. Ihr Gruß war höflich, aber kühl.
»Sie wünschen mich zu sprechen?«
»Unter vier Augen, wenn das möglich ist.«
Sie führte mich in den Salon und schloß die Tür. Dann bot sie mir einen Stuhl an, blieb aber selbst neben dem Kaminsims unter einem Reiterbild des Generals Pantaleone stehen.
»Sie kommen, nehme ich an, von den Carabinieri.«
»Ich bin Oberst Matucci.«
»Und der Grund für diesen Besuch?«
»Eine schmerzliche Angelegenheit, fürchte ich.«
»Oh?«
»Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, daß General Pantaleone heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist.«
Sie weinte nicht. Sie schrie auch nicht auf. Sie starrte mich nur zitternd und mit weit aufgerissenen Augen an und stützte sich haltsuchend auf den Sims. Ich ging auf sie zu, um ihr zu Hilfe zu kommen, aber sie winkte ab. Ich ging zum Buffet hinüber, goß ein Glas Brandy ein und reichte es ihr. Sie trank es in einem Zug aus, verschluckte sich dann an dem starken Alkohol. Ich gab ihr das saubere Taschentuch aus meiner Brusttasche, und sie betupfte sich damit die Lippen und den Ausschnitt ihrer Bluse. Ruhig sagte ich zu ihr: »Es ist immer ein Schock, auch in unserem Beruf. Wenn Sie weinen wollen, halten Sie sich bitte nicht zurück.«
»Ich werde nicht weinen. Er war freundlich und rücksichtsvoll zu mir, aber ich weine ihm keine Träne nach.«
»Da ist noch etwas anderes, was Sie wissen sollten.«
»Ja?«
»Er starb von eigener Hand.«
Sie verriet keinerlei Überraschung. Sie zuckte nur mit den Achseln und öffnete die Hände, als gebe sie sich geschlagen. »Bei ihm war das immer möglich.«
»Warum sagen Sie das?«
»Es gab zu viele dunkle Punkte in seinem Leben, Colonnello, zu viele Geheimnisse, zu viele Menschen, die ihm auflauerten.«
»Hat er Ihnen das gesagt?«
»Nein. Ich wußte es.«
»Dann wissen Sie vielleicht auch das: Warum wählte er die vergangene Nacht, um sich das Leben zu nehmen? Warum tat er es nicht vor einer Woche oder erst im nächsten Monat?«
»Ich weiß es nicht. Er war seit langer Zeit in sich gekehrt, seit einem Monat oder länger. Ich habe ihn mehr als einmal gefragt, was denn los sei, aber er hat mir nichts erzählt.«
»Und gestern abend?«
»Nur eines. Während des Essens überbrachte ihm der Kellner eine Nachricht. Fragen Sie mich nicht, worum es sich handelte. Sie kennen doch den Schachclub – dort ist es wie in der Kirche, nur Flüstern und Weihrauch. Er ließ mich am Tisch sitzen und ging hinaus. Er war etwa fünf Minuten fort. Als er zurückkam, erzählte er mir, ein Kollege habe ihn angerufen. Weiter wurde darüber nicht gesprochen. Später, als er mich nach Hause brachte, bat ich ihn herein. Manchmal blieb er die Nacht, manchmal auch nicht. Diesmal sagte er, er habe zu Hause noch zu arbeiten. Das war nichts Ungewöhnliches. Ich versuchte nicht, ihn umzustimmen. Ich war auch selbst müde.«
Ich nahm die Fotokopie der Salamander–Karte heraus und gab sie ihr.
»Haben Sie das schon einmal gesehen? Oder irgend etwas Ähnliches? Denken Sie einmal genau nach!«
Sie betrachtete die Karte ein paar Minuten lang mit großer Aufmerksamkeit und schüttelte dann den Kopf. »Nein, nie.«
»Erkennen Sie das Tier?«
»Eine Art Eidechse ... vielleicht ein Drachen.«
»Die Krone?«
»Nichts.«
»Der Text?«
»Nichts Besonderes ... ›Ein schönes Morgen, Bruder‹ ... das ist alles.«
»Haben Sie die Worte schon irgendwo einmal gehört?«
»Nicht, daß ich wüßte. Tut mir leid.«
»Bitte, meine Gnädigste! Sie brauchen sich wirklich keine Vorwürfe zu machen. Sie haben einen schweren Schlag erlitten. Sie haben einen teuren Freund verloren. Und jetzt – wie soll ich es sagen? – muß ich Ihnen noch weiteren Kummer bereiten. Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, daß Sie sich von diesem Augenblick an in großer, persönlicher Gefahr befinden.«
»Ich Verstehe nicht.«
»Dann gestatten Sie mir, es Ihnen zu erklären. Sie sind lange Zeit die Geliebte eines bedeutenden Mannes gewesen, der in den Augen gewisser Elemente ein explosiver Mann war. Eine Geliebte gilt als Vertrauensperson, als Geheimnisträgerin. Auch wenn Ihnen der General nichts erzählt hat, werden andere dennoch glauben, daß er Ihnen alles gesagt hat. Sie werden deshalb unweigerlich unter Beschattung geraten, unter Druck, eventuell sogar Drohungen ausgesetzt sein.«
»Von wem?«
»Von Extremisten von rechts und links, von Leuten, die gelernt haben, Gewalt als politische Waffe zu benutzen; von ausländischen Agenten, die auf dem Territorium der Republik operieren; sogar von – wenn es mir auch die Schamröte ins Gesicht treibt – Mitarbeitern unseres eigenen Sicherheitsdienstes. Als Ausländerin, die hier mit einer Aufenthaltsgenehmigung lebt, sind Sie natürlich besonders gefährdet.«
»Aber ich habe nichts zu berichten! Ich habe als Frau mit einem Mann zusammengelebt, der sich nach etwas Häuslichkeit und Zuneigung sehnte. Sein anderes Leben, was es auch gewesen sein mag, habe ich nicht geteilt. Wenn sich diese Tür hinter uns schloß, blieb die übrige Welt draußen. Er wollte es so. Das müssen Sie mir glauben.«
Sie hatte die Fassung verloren. Ihr Antlitz zerbrach in die Konturen einer alten Frau. Ihre Hände ballten sich nervös um ein zerknülltes Taschentuch.
Ich lehnte mich in dem Sessel zurück und redete ihr gut zu. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen Glauben schenken. Aber ich kenne Sie, Lili Anders. Sie sind für mich ein offenes Buch, von dem Tage, da Sie in Warschau auf die Welt kamen, bis zu Ihrer letzten Kuriersendung an einen gewissen Colomba, einen Drucker und Buchbinder in Mailand. Sie gebrauchten für sich, wie üblich, den Decknamen Falcone. Alle Mitarbeiter Ihres Netzes führen Vogelnamen, nicht wahr? Sie werden von Canarino aus dem Konto Nr. 68-Pilau bei der Kantonalbank in Zürich bezahlt ... Sie sehen, Lili, wir Italiener sind nicht ganz so dumm und faul, wie wir aussehen. Als Konspiratoren sind wir gar nicht so schlecht, denn wir lieben das Spiel und sorgen dafür, daß die Regeln unseren Bedürfnissen entsprechen ... Noch einen Brandy? Ich hätte selbst gern noch einen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Beruhigen Sie sich, ich will Sie nicht fressen. Ich bewundere eine gute, professionelle Arbeit. Aber Sie sind ein Problem, ein wirkliches Problem ... Salute! Auch weiterhin auf Ihre gute Gesundheit!«
Während sie trank, umklammerte sie das Glas mit beiden Händen, als ob sie sich daran festhalten wolle.
»Was geschieht jetzt mit mir?«
»Eh! Das ist eine durchaus offene Frage, Lili. So, wie ich die Lage im Augenblick sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme Sie unter dem Verdacht verschwörerischer Tätigkeit und Spionage vorläufig fest. Das bedeutet lange Vernehmungen, ein hartes Gerichtsurteil und keine Hoffnung auf vorzeitige Entlassung. Oder ich könnte Sie, unter bestimmten Bedingungen, in Freiheit lassen, so daß Sie Ihr angenehmes Leben in Rom fortsetzen könnten. Was würden Sie vorziehen?«
»Ich habe das Spiel satt, Colonnello. Ich möchte aussteigen. Ich werde alt.«
»Gerade das ist das Problem, Lili. Sie können nicht aussteigen. Sie können nur die Seiten wechseln.«
»Und das heißt?«
»Volle Aufklärung über das Netz und Ihre gesamte Tätigkeit, sowie ein Vertrag mit uns als Doppelagentin.«
»Können Sie mich schützen?«
»Solange Sie nützlich sind, ja.«
»Ich war eine gute Geliebte, Colonnello. Ich habe meinen Mann glücklich gemacht und war stets mein Geld wert.«
»Versuchen wir also noch ein paar Fragen. Wer hat Ihr erstes Zusammentreffen mit dem General arrangiert?«
»Die Marchesa Friuli.«
»Wie lautet ihr Deckname?«
»Pappagallo.«
»Paßt auf das alte Frauenzimmer. Sie sieht sogar wie ein Papagei aus. Was war Ihr Auftrag?«
»Frühwarnung über jeden Versuch eines Staatsstreichs neofaschistischer Gruppen und über alle Aktionen, die diesen auslösen sollen.«
»Zum Beispiel?«
»Planung von Gewaltakten gegen Polizei oder Carabinieri während gewerkschaftlicher Demonstrationen, Bombenattentate, die maoistischen oder marxistischen Gruppen zugeschrieben werden könnten, Ausbreitung von Unzufriedenheit unter den Wehrpflichtigen, sowie neue Gestellungsbefehle für die Streitkräfte, jegliche Kontakte, geheime wie offene, zwischen dem griechischen Regime und offiziellen Persönlichkeiten der italienischen Republik, Veränderungen im Einfluß und in der Zusammensetzung politischer Gruppen im italienischen Oberkommando.«
»Hat es kürzlich solche Veränderungen gegeben?«
»Nein ... nicht, daß ich wüßte.«
»Warum war dann der General so niedergeschlagen?«
»Ich weiß nicht. Ich versuchte ja, den Grund dafür ausfindig zu machen.«
»Finanzielle Probleme?«
»Das nehme ich nicht an ... Er war nie besonders freigebig – nicht einmal mir gegenüber.«
»Politischer Druck – Erpressung?«
»Ich hatte das Gefühl, daß es sich um eine persönliche, und nicht um eine politische Sache handelte.«
»Was veranlaßte Sie zu dieser Meinung?«
»Dinge, die er zu mir sagte, wenn er es sich hier bei mir gemütlich machte.«
»Zum Beispiel?«
»Ach, seltsame Bemerkungen. Er hatte die Gewohnheit, etwas – wie soll man es nennen? – irgend etwas Rätselhaftes zu sagen, um dann gleich auf ein anderes Thema überzuwechseln. Wenn ich ihn drängte, sich näher zu erklären, zog er sich in sein Schneckenhaus zurück. Ich lernte rasch, den Mund zu halten ... Eines Abends, zum Beispiel, sagte er: ›Meine Zukunft wird nicht einfach sein, Lili, denn meine Vergangenheit ist zu komplizierte Ein anderes Mal zitierte er aus der Bibel: ›Des Menschen Feinde sind sein eigenes Hausgesinde ...‹ So redete er.«
»Noch etwas?«
»Lassen Sie mich nachdenken ... Ach ja, etwa vor drei Wochen trafen wir uns in Venedig. Er nahm mich zu einer Opernaufführung ins Teatro della Fenice mit. Er sprach über die Geschichte des Theaters und erklärte mir den Namen. Er sagte, der Phönix sei ein vogelartiges Fabelwesen gewesen, das aus seiner eigenen Asche lebendig wiederauferstanden sei; und dann sagte er, es gebe noch ein anderes Tier, noch geheimnisvoller und gefährlicher – den Salamander, der im Feuer lebe und die heißesten Flammen überstehen könne ... Warten Sie mal! Das ist doch Ihre Karte ... der Salamander!«
»So ist es, Lili. Sehen Sie, wie weit wir kommen, wenn wir uns wie gute Freunde unterhalten? Was sagte er sonst noch über den Salamander?«
»Nichts. Kein Wort. Wir trafen noch ein paar Freunde. Das Thema wurde fallengelassen und vergessen.«
»Lassen wir es also dabei bewenden. Es wird später sicher noch weitere Fragen geben. Von jetzt ab werden Sie unter Dauerbeobachtung gestellt. Hier ist meine Karte mit den Nummern für Tag– und Nachtanrufe. Sie werden über den Termin der Beisetzung unterrichtet werden. Ich bitte Sie, anwesend zu sein.«
»Nein, bitte nicht!«
»Bitte doch! Ich brauche Tränen, Lili. Ich brauche tiefen Kummer und schwarze Trauer. Sie werden Ihr gesellschaftliches Leben erst dann wieder aufnehmen, wenn ich es Ihnen sage. Natürlich werden Sie telefonisch von Ihren Chefs und von den Freunden des Generals angerufen werden. Ihre Haushälterin wird den Grund meines Besuches wissen wollen. Sie werden allen dieselbe Geschichte erzählen. Der General sei an einem Herzversagen gestorben. Es schadet nichts, wenn Sie andeuten, daß er ein Leiden gehabt habe, das gelegentlich seinem Liebesleben im Wege gestanden hat ... Und noch etwas. Keine neuen Männerbekanntschaften, bevor die Trauerzeit vorüber ist. Das würde nicht gut aussehen. Wenn Sie danach einen geeigneten Partner finden, würde ich ihn gerne überprüfen, bevor Sie ihm um den Hals fallen.«
Sie rang sich ein müdes Lächeln ab. »Ihn oder mich, Colonnello?«
»Ich bewundere Sie, Lili, aber ich kann Sie mir nicht leisten. Wenn Sie imstande waren, ein altes Fossil wie den General Pantaleone um Ihre Gunst betteln zu lassen, mein Gott, was würden Sie dann mit einem liebeshungrigen Burschen wie mir anstellen. Aber immerhin, wir wollen den Gedanken nicht ganz außer acht lassen. Irgendwann einmal, an einem schönen Morgen, könnten wir vielleicht etwas Kammermusik zusammen spielen. Bleiben Sie jetzt erst einmal ein braves Mädchen. Und für jede bei dem Requiem vergossene Träne gibt es eine Belohnung ... Wo ist Ihr Telefon?«
Eine halbe Stunde später saß ich in einem Glaskasten auf der Via Veneto, bei einem Toast und einer Tasse Cappuccino, und sah die Nachmittagsausgaben der Zeitungen aus Rom und Mailand durch. Der Tod des Generals wurde nur in der Rubrik »Letzte Nachrichten« kurz erwähnt. Der Text war überall der gleiche, eine wörtliche Wiedergabe der Verlautbarung der Armee. Es gab keine Nachrufe, keine Kommentare in den Leitartikeln. Vielleicht würde es einige in den Abendausgaben geben, aber die Spürhunde der Presse würden erst ab morgen früh ihr lautstarkes Geschrei erheben. Aber dann würde der Leichnam des Generals bereits vollkommen einbalsamiert in der Familienkapelle zu Frascati aufgebahrt sein und Kadetten seines alten Regiments würden die Totenwache halten.
Die Beisetzungsfeierlichkeiten des Massimo Graf Pantaleone, General des Militärstabes, entfalteten den ganzen Pomp eines glanzvollen Schauspiels. Das Requiem wurde von dem suburbikarischen Bischof von Frascati gesungen, Kardinal Amleto Paolo Dadone, dem der Chor des Klosters Sant' Antonio della Valle assistierte. Der Panegyrikus wurde in klassischem Rhythmus und widerhallendem Singsang vom Generalsekretär der Societas Jesu, einem früheren Mitschüler des Verstorbenen, vorgetragen. Der Messe wohnten der Vizepräsident der Republik bei, Kabinettsminister, Mitglieder beider Häuser des Parlaments, Prälaten der Römischen Kurie, hohe Offiziere der Streitkräfte, Vertreter der NATO und des Diplomatischen Korps sowie Freunde des Verstorbenen, Verwandte und der Familie Nahestehende, Presseleute, Fotografen und ein buntes Durcheinander von Römern und zufällig anwesenden Touristen. Sechs Stabsoffiziere trugen den Sarg zur Gruft, wo ihn der Regimentsgeistliche bis zum Auferstehungstage zur letzten Ruhe bettete, während eine Gruppe jüngerer Offiziere die Ehrensalve abgab und die Büßermönche von Sant' Ambrogio die Passionsgeheimnisse des Rosenkranzes rezitierten. Die Tür zur Gruft wurde vom Vizepräsidenten persönlich geschlossen und verriegelt – eine Geste des Respekts, der Dankbarkeit und der nationalen Solidarität, die den Herren der Presse nicht entging. Lili Anders war da, tief verschleiert und auf den Arm des Hauptmanns Girolamo Carpi gestützt, der von dem Hinscheiden seines geliebten Gönners deutlich bewegt schien.
Auch ich befand mich unter den Trauergästen; aber ich kümmerte mich weniger um die Zeremonie als um die Bemühungen meines Kamerateams, das von jeder bei dem Begräbnis anwesenden Person, vom Kardinal, der die Messe zelebrierte, bis zu den Blumenmädchen, die die Kränze ordneten, eine deutlich erkennbare Aufnahme anfertigen sollte. Ich hasse Begräbnisse. Auf ihnen fühle ich mich stets alt, unerwünscht und zu sexueller Betätigung aufgelegt – eine Art Trotzreaktion auf meine eigene Sterblichkeit. Ich war froh, als das Ritual vorüber war, so daß ich Francesca besuchen konnte, während sich meine Kollegen in der Villa Pantaleone an Sekt und süßem Gebäck delektierten.
Nachmittags um drei Uhr dreißig fuhr ich in das forensische Laboratorium zurück, um mit Stefanelli zu sprechen. Der alte Bursche sprang wie eine Heuschrecke umher.
» ... Ich habe es Ihnen doch gesagt, Colonnello! Hören Sie auf den alten Steffi, und Sie gewinnen jede Wette! Ich habe die Karte Solimbene gezeigt, und er erkannte sie auf den ersten Blick. Der gekrönte Salamander ist das Emblem Franz' des Ersten. Es kehrt, mit gewissen Modifikationen, in Wappen wieder, die aus dem Hause Orléans, dem Herzogtum von Angoulême und der Familie Farmer in England abgeleitet werden. Ich habe Solimbene beauftragt, uns eine Liste noch existierender italienischer Familien zu beschaffen, die das Symbol verwenden. Sie müssen die entsprechenden Ausgaben genehmigen. Die Schriftzüge? Wir sagen, sie gehen auf Aldo den Kalligraphen zurück, wurden aber wahrscheinlich von Carlo Metaponte ausgeführt, der als Fälscher tätig war, Personalpapiere für die Partisanen während des Krieges herstellte, aber seither ein anständiges Leben geführt hat. Die Karte selbst ... hier habe ich mich geirrt. Sie ist nicht japanisch. Sie stellt eine durchaus passable italienische Imitation dar, die von den Brüdern Casaroli in Modena hergestellt worden ist. Sie liefern uns eine Liste ihrer hauptsächlichen Kunden in Europa. Die Inschrift ist vorläufig noch unverständlich, aber wir werden schon noch draufkommen. Na, was sagen Sie jetzt? Keine schlechte Leistung für achtundvierzig Stunden. Sagen Sie, daß Sie glücklich sind, Colonnello, sonst spüle ich mich auf der Toilette hinunter.«
»Ich bin glücklich, Steffi. Aber wir brauchen noch viel mehr. Zum Beispiel Fingerabdrücke.«
»Tut mir leid, Colonnello. Die einzigen, die wir abnehmen konnten, gehören dem verblichenen, allgemein betrauerten General. Hatten Sie etwas anderes erwartet?«
»Ich verlange Wunder, Steffi. Ich verlange sie am besten schon gestern.«
»Nehmen Sie ein klein wenig Rücksicht auf uns, Colonnello. Alles braucht seine Zeit ... Wie war das Begräbnis?«
»Wunderschön, Steffi. Ich hab geheult wie ein Schloßhund! Und die hochtönenden Reden! ... ›Dieser edle Geist, der vorzeitig aus unserer Mitte gerissen wurde, dieser pflichtbewußte Diener der Republik, dieser christliche Patriot, dieser Held aus vielen Schlachten ...‹ Merda!«
»Requiescat in aeternum.« Stefanelli kreuzte die Hände über seiner knochigen Brust und verdrehte die Augen gen Himmel. »Wenn er im Himmel ist, komm ich hoffentlich nie dort hin. Amen! ... Haben Sie die Zeitungen gelesen?«
»Wann soll ich denn dazu Zeit haben, Steffi?«
»Ich hab sie in meinem Büro. Kommen Sie mit! Ein Blick lohnt sich.«
Die Nachrufe waren, ebenso wie die Beisetzungsfeierlichkeiten, ein Musterbeispiel an Schwülstigkeit. Der rechte Flügel übertrieb schamlos; das Zentrum zeigte Respekt und äußerte nur über die faschistische Vergangenheit des Generals milde Kritik; die Linke steigerte sich zu einer Art Schmähgedicht, das in einer Satire gipfelte, die aus formalen Gründen einem anonymen Römer zugeschrieben wurde.
Estirpato oggi,
Heute ausgemerzt,
L' ultimo della stirpe,
Der Letzte seines Stammes,
Pantaleone,
Pantaleone,
Mascalzone.
Der Gauner.
Ich war mit der Lektüre gar nicht unzufrieden. Es waren gute Artikel über eine schlechte Sache und sie steckten voller Widersprüche. Nirgends wurde die offizielle Version vom Tod des Generals in Frage gestellt, was natürlich nicht heißen sollte, daß man ihr Glauben schenkte; es kam allen Parteien lediglich gelegen, sie zu akzeptieren. Die Satire machte mir einige Sorgen. Oberflächlich betrachtet war sie ein harmloses Pasquill. Der General war der letzte Pantaleone und außerdem ein alter Gauner. Anders betrachtet konnte sie aber auch bedeuten, daß die Linke bei seiner Ausmerzung die Hand im Spiele gehabt hatte und glücklicherweise kein Nachfolger in Sicht war. Wenn man sehr spitzfindig war – und ich wurde schließlich dafür bezahlt, auch aus leeren Seiten irgendeinen Sinn herauszulesen –, konnte man das Schmähgedicht als Eröffnung einer Kampagne verstehen, den General zu verleumden und alle Skelette aus seiner Familiengruft ans Tageslicht zu zerren. Es wäre ein Jammer, wenn das geschähe, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich war noch schläfrig und hatte keine Lust, mich irgendwie anzustrengen, deshalb begann ich, in den Journalen zu blättern, während Stefanelli einen gepfefferten Kommentar dazu abgab.
» ... Hier, eine reizende Geschichte: ›Die Principessa Faubiani führt ihre Sommerkollektion vor!‹ Sie wissen über sie Bescheid, nicht wahr? Kam ursprünglich aus Argentinien, heiratete den jungen Fürsten Faubiani, verkuppelte ihn mit einem anderen Knaben und reichte dann die Trennungsklage unter Berufung auf seine Impotenz ein. Auf diese Weise erhielt sie sich ihre Freiheit, den Titel und ein Recht auf Unterhaltszahlungen. Seit damals hat sie alle zwei Jahre einen neuen Beschützer – alles ältere Herren und alle reich. Sie finanzieren die Kollektionen und heben außerdem ihren Lebensstandard. Der letzte war der Bankier Castellani ... Ich frage mich, wer es dieses Jahr ist. Komisch, sie ist immer noch mit allen befreundet. Sehen Sie her, das ist Castellani, neben dem Mannequin im Bikini. Aha, hier ist der Neue, in der ersten Reihe, zwischen Faubiani und dem Herausgeber von Vogue. Das ist der Ehrenplatz. Ein Ritual, müssen Sie wissen. Wenn die Hohepriesterin ihrer überdrüssig wird, reicht sie sie an die Mannequins weiter. Aber wenn sie sechzig oder darüber sind, was macht das schon aus? Die Mädchen kommen billiger als eine ganze Sommerkollektion, stimmt's? Ich muß herausfinden, wer der Neue ist.«
»Und warum interessieren Sie sich für Mode, Steffi?«
»Meine Frau hat eine Boutique auf der Via Sistina ... Haute Couture für reiche Touristen.«
»Sie schlauer alter Fuchs!«
»Ich habe Glück gehabt, Colonnello. Ich habe aus Liebe geheiratet und jetzt für das Alter auch noch Geld dazubekommen. Außerdem wirken die Angestellten dekorativ, und das Geschwätz ist immer interessant ... Dabei fällt mir ein – Pantaleone. hatte angeblich einen Bruder, der irgendwo herumgeistert.«
»In meinem Dossier nicht, Steffi. Der alte Graf Massimo hatte in den ersten drei Jahren seiner Ehe zwei Töchter und etwa zehn Jahre später einen Sohn. Eine Tochter heiratete einen Contini und starb im Wochenbett. Die andere heiratete einen spanischen Diplomaten und lebt in Bolivien. Sie hat drei erwachsene Kinder, die alle die spanische Staatsbürgerschaft besitzen. Der Sohn, unser General, war der einzige männliche Nachkomme. Er erbte den Titel und den größten Teil des Grundbesitzes. Soweit die Karteiunterlagen – sie sind nach dem Zentralen Personenstandsregister und den Taufurkunden in Frascati angelegt.«
»Gewiß, ich weiß, sie ist zwar nicht so offiziell wie das Zentrale Personenstandsregister, aber die alte Baronin Schwarzburg ist seit Jahren eine Kundin meiner Frau. Sie steht schon mit einem Bein im Grabe, gibt aber immer noch Unsummen für Kleider aus. Sie behauptet, den Vater des Generals gekannt zu haben – was durchaus möglich ist, denn der alte Knabe war ein Schürzenjäger, bis er eines Tages auf dem Pincio vom Pferd hei und sich den Hals brach. Nach ihrer Version zeugte der Graf mit der Gouvernante der Mädchen einen Bastard. Er zahlte sie aus, und sie heiratete daraufhin jemand anderen, der dem Jungen seinen Namen gab, wenn sich die Baronin auch an diesen Namen nicht mehr erinnern kann. Sie redet natürlich oft dummes Zeug, deshalb kann es sich bei der ganzen Geschichte auch bloß um ein Skandalgerücht handeln. Sie wissen ja, wie diese alten Mädchen sind. Sie sind noch immer nicht über ihren ersten Walzer und die Zeit hinweggekommen, da ihnen König Umberto seine Münzensammlung gezeigt hat ... Immerhin ist das ein Nebenaspekt, falls Sie Interesse haben.«
»Eigentlich nicht, Steffi. Wenn Sie mir einen Abschiedsbrief oder einen Erpresserbrief vorweisen könnten, der mir Aufschluß darüber gibt, warum sich Pantaleone umgebracht hat, wäre ich viel glücklicher ... Dio! Es ist fast fünf. Die Bilder vom Begräbnis müßten jetzt eigentlich fertig sein – wenn nicht, werde ich Ihnen drei Köpfe zum Einbalsamieren schicken. Bis später, Steffi.«
Natürlich waren die Bilder nicht fertig, und der Chef der Fotografischen Abteilung war selber sehr unglücklich darüber. Jeder verstehe die Dringlichkeit, aber ich müsse vernünftig sein. Könne ich denn nicht sehen, daß die Wassertanks voller Filme seien, die Vergrößerungsapparate pausenlos arbeiteten und es sogar mit drei Fotografen und zwei Foto-Karteiexperten noch Stunden dauern würde, alle Personen zu identifizieren? Auch dann würde es noch Lücken geben. Das Ganze sei wie ein Monumentalfilm in Cinecittá – es wimmle von Hunderten von Statisten, und wie solle man jedem einzelnen der Landarbeiter und drei Autobussen voller Touristen jeweils einen Namen zuteilen?
Nach zehn Minuten gereizter Unterhaltung gab ich verärgert auf und ging in mein Büro zurück. Hier bestand wenigstens ein gewisser Eindruck von Ordnung und Arbeitsleistung. Die Papiere, die ich aus der Wohnung des Generals mitgebracht hatte, waren alle aufbereitet und abgeheftet, und der Angestellte Nummer eins hatte einige interessante Entdeckungen gemacht.
»Maklerkorrespondenz, Colonnello. Alles Verkäufe. Der General hat in den letztere vier Wochen Aktien im Werte von etwa achtzig Millionen Lire abgestoßen. Begleitschreiben der Makler, jedes mit demselben Text: ›Wir haben die Erlöse gemäß Ihren Instruktionen überwiesene. Frage: Wohin sind die Erlöse gegangen? Auf sein Konto jedenfalls nicht, denn hier ist der letzte Bankauszug, Stichtag vor einer Woche. Dann ist da ein Brief von der Agenzia Immobiliare della Romagna. Sie teilt mit, obwohl der Pantaleonesche Besitz seit über zwei Monaten zum Verkauf ausgeschrieben sei, bestehe angesichts des verlangten Kaufpreises kein ernsthaftes Interesse. Sie empfiehlt, das Angebot zurückzuziehen, bis sich die Kreditsituation in Europa etwas beruhigt habe und die neuen Landwirtschaftsvereinbarungen für den Gemeinsamen Markt bekanntgegeben worden seien ... Jetzt dieser kleine Zettel. Es ist eine handgeschriebene Notiz von Emilio del Giudice in Florenz. Sie kennen ihn – ein großer Name, bedeutender Händler in Kunstwerken von Rang. Hier steht, was er sagt: ›Ich rate dringend von allen Transaktionen ab, die Sie persönlich verpflichten könnten, Werke aus der Pantaleone-Sammlung zu exportieren. Als Verkäufer bieten Sie die Werke unter den herrschenden gesetzlichen Bedingungen zum Verkauf an. Anschließend trägt der Käufer die volle Verantwortung für die Einhaltung der Exportformalitäten ...‹«
»Er wollte also alles verkaufen. Irgendein Hinweis, warum?«
»In diesen Papieren nicht.«
»Was haben wir sonst noch?«
»Alte Scheckbücher, Haushaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Korrespondenz mit Immobilienbüros und Wohnungsvermittlungen, Telefonverzeichnis, Adressenbuch. Ich bin noch dabei, die Namen mit unseren Dossiers zu vergleichen, bis jetzt gab es aber keine Überraschungen. Das hier ist der Schlüsselring des Generals mit einem Schlüssel zum Safe in der Banco di Roma. Ich würde dort gerne einmal hineinschauen.«
»Das werden wir auch – sobald die Banken morgen öffnen.«
»Sein Anwalt drängt auf die Herausgabe der Dokumente.«
»Mit ihm befasse ich mich später. Ich werde mich auch mit den Maklern des Generals unterhalten. Ich möchte gerne wissen, wohin sie die Verkaufserlöse überwiesen haben ... Falls Sie mich in der nächsten Stunde brauchen – ich bin im Schachclub. Danach zu Hause.«
Der Schachclub von Rom ist eine beinahe ebenso geheiligte Institution wie der Jagdclub. Man betritt ihn, wie man eines Tages hofft, in den Himmel einzuziehen, durch einen vornehmen Portikus und findet sich dann in einem Innenhof von wahrhaft klassischen Ausmaßen wieder. Man steigt eine Treppenflucht zu einer Reihe von Vorzimmern hinauf, wo Diener in Livree den Gast mit vornehmer Zurückhaltung empfangen. Man tritt leise auf und spricht mit gedämpfter Stimme, um nicht die Geister zu stören, die hier immer noch hausen – Könige und Fürsten, Herzöge, Barone, Grafen und alle ihre Gemahlinnen. In dem Salon kommt man sich wie ein Zwerg neben den hohen Pfeilern, den Fresken an der Decke und den mit Blattgold überzogenen Möbeln vor, die für die Rücken der Granden entworfen worden sind. Im Speisesaal wird man durch die im Flüsterton geführten Gespräche von Männern beeindruckt, die sich mit großen Dingen wie Finanzen, Staatskunst und wirtschaftlichen Einflußsphären beschäftigen. Voller Verachtung ruhen auf einem die kalten Blicke älterer Damen, denen ihre Jahre einen Anflug säuerlicher Tugendhaftigkeit verliehen haben. Man fühlt sich von Kellnern verfolgt, für die schon eine Brotkrume auf der Hemdbrust ein Sakrileg zu sein scheint ... und man wird vergeblich nach Schachspielern Ausschau halten, obwohl gerüchtweise verlautet, es gebe sie tatsächlich, nur seien sie wie Karmeliter klösterlich zurückgezogen in einer geheimgehaltenen Zelle zu finden.
Ich war nicht gekommen, um Schach zu spielen. Ich war gekommen, um mich bei dem Sekretär einzuführen, der sich vielleicht herablassen würde, mich dem Oberkellner vorzustellen, der mich, falls die Sterne günstig stehen sollten, wiederum mit dem Kellner in Verbindung bringen würde, der General Pantaleone in den Stunden, bevor dieser starb, das Abendessen serviert hatte.
Diese Aussicht bereitete mir einiges Unbehagen. Der Schachclub gehört zu jenen Orten, an denen ich über meine Landsleute in Verzweiflung geraten könnte. Im Oberland von Sardinien, wo ich einst als junger Offizier stationiert war, gibt es Schafhirten, die den ganzen Winter von Maisbrot, schwarzen Oliven und Ziegenkäse leben, die sich dann dem Räuberhandwerk zuwenden, um ihre Familien zu ernähren, während ihre Grundbesitzer den Senatoren und Ministern über mehreren Gläsern Brandy im Schachclub um den Bart gehen. In der Leichenhalle von Palermo habe ich den Leichnam eines Kollegen identifiziert, der von der Mafia ermordet worden war, während der Auftraggeber dieser Bluttat mit einem Bankier aus Mailand zu Mittag aß – im Schachclub natürlich. Die Wirtschaftsbosse vergießen Krokodilstränen angesichts der Kapitalflucht von Italien in die Schweiz, aber die Leute, die dem Gelde Flügel verleihen, sitzen ungerührt und respektabel beim Lunch am Tisch in der Ecke. Hier schließen die Überlebenden der alten Ordnung und die Ausbeuter der neuen miteinander Waffenstillstand und gehen Vernunftehen ein, während das Volk, arm, ungebildet, ohnmächtig, den Schikanen der Politiker und der Tyrannei untergeordneter Bürokraten ausgeliefert ist.
Es gab einmal eine Zeit, da ich mit dem Gedanken spielte, mich den Kommunisten anzuschließen, die wenigstens einen Ausgleich und eine Säuberung und gleiches Recht für alle versprachen. Mein Enthusiasmus erstarb an dem Tage, als ich sah, wie ein hoher Parteifunktionär mit dem Präsidenten eines Chemiekonzerns Räucherlachs und Filetsteak aß. Je mehr sich die Dinge in Italien ändern, desto mehr bleibt alles beim alten. Der Abkömmling eines alten Hauses tritt den Christlichen Demokraten bei; der Kadett kann mit der Linken oder der Rechten liebäugeln, wie er will; und egal, wer das letzte Rennen gewinnt – die Wetten werden immer noch im Schachclub abgeschlossen ... Eh! Philosophen sind für das Land ein ebenso großer Fluch wie Politiker, und die Gewissensnot ist schlechte Medizin für einen Ermittlungsbeamten. Bringen wir die Sache hinter uns und dann nichts wie nach Hause!
Es war erst halb neun, und nur wenige Gäste waren anwesend. Der Sekretär erwies sich als ungewöhnlich umgänglich, der Oberkellner schien geneigt, hilfreich zu sein. Er führte mich in den Besucherraum, brachte mir einen Aperitif und erschien fünf Minuten später mit dem Chefportier und dem Kellner wieder, der dem General die letzte Mahlzeit serviert hatte. Ich erklärte meine Mission so vage, wie es die Lage erforderte. Während des Abendessens sei der General einmal zum Telefon gerufen worden. Aus Gründen der militärischen Sicherheit wolle ich den Anrufer feststellen und mich mit ihm in Verbindung setzen. Dann erlebte ich meine erste Überraschung.
»Nein, Colonnello«, äußerte sich der Chefportier entschieden. »Sie sind falsch informiert. Der General wurde zwar aus dem Speisesaal herausgerufen, aber nicht zum Telefon. Ein älteres Clubmitglied hatte darum gebeten, mit ihm unter vier Augen sprechen zu können. Er wartete im Spielzimmer. Der Kellner führte den General zu ihm. Sie sprachen ein paar Augenblicke miteinander, der General kehrte an seinen Tisch zurück, das Clubmitglied holte sich seinen Mantel und verließ das Haus. Ich sah ihn gehen.«
»Und wer war dieses Clubmitglied?«
»Ein Herr aus Bologna. Der Cavaliere Bruno Manzini. Er befindet sich gerade hier im Club. Kam vor etwa zwanzig Minuten mit der Principessa Faubiani.«
»La Faubiani, wie?« Ich gestattete mir ein kleines, befriedigtes Lächeln. Wenigstens führte ich vor dem alten Steffi eins zu null.
Der Chefportier hüstelte bedeutsam. »Colonnello ...?«
»Könnten Sie mir etwas über den Cavaliere erzählen?«
»Das könnte ich, mein Herr, aber – bei allem Respekt – diese Art von Ersuchen sollte an den Sekretär gerichtet werden.«
»Selbstverständlich. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Diskretion. Würden Sie dem Cavaliere meine Karte geben und ihn bitten, mir ein paar Augenblicke zu erübrigen?«
In jeder Gesellschaft hätte der Cavaliere Manzini eine eindrucksvolle Figur gemacht. Er mußte fast siebzig sein. Seine wie eine Löwenmähne über den Kragen nach hinten gebürsteten Haare waren schlohweiß; aber sein Rücken war kerzengerade wie eine Tanne, seine Haut glatt, die Augen hell und voll launigen Humors. Sein Anzug war modisch geschnitten, seine Hemdbrust makellos, und er trat mit dem Gehabe eines Mannes auf, der Ehrerbietung gewohnt war. Er reichte mir nicht die Hand, sondern stellte sich mit kühler Höflichkeit vor.
»Ich bin Manzini. Ich höre, daß Sie mit mir zu sprechen wünschen. Darf ich Ihren Ausweis sehen?«
Ich übergab ihm das Dokument. Er las es sorgfältig durch, gab es mir zurück und setzte sich. »Ich danke Ihnen, Colonnello. Und jetzt – Ihre Frage.«
»Sie waren, glaube ich, ein Freund des Generals Pantaleone?«
»Nicht ein Freund, Colonnello, ein Bekannter. Er flößte mir wenig Achtung ein, am allerwenigsten seine Politik.«
»Wie würden Sie seine Politik definieren?«
»Faschistisch und opportunistisch.«
»Und Ihre eigene?«
»Meine Privatangelegenheit, Colonnello.«
»In der Nacht vor seinem Tod dinierte der General hier mit einer Dame. Wie ich höre, hatten Sie eine Unterhaltung mit ihm.«
»Ja.«
»Darf ich den Inhalt wissen?«
»Gewiß. Ich bin Klient eines Kunsthändlers in Florenz. Er heißt del Giudice. Er hatte mir erzählt, Pantaleone sei im Begriff, seine Familiensammlung zu verkaufen. Ich war an bestimmten Bildern interessiert, an einem Andrea del Sarto und an einem Bosch. Ich sagte Pantaleone, ich würde gern mit ihm direkt verhandeln. Das würde uns beiden Geld sparen.«
»Und ...?«
»Er sagte, er wolle es sich überlegen und mir in Kürze schreiben.«
»Sie haben ihn nicht wegen eines Termins gedrängt?«
»Nein. Ich konnte ja immer noch über del Giudice kaufen. Darf ich den Grund für diese Nachforschungen wissen?«
»Im gegenwärtigen Augenblick, Cavaliere, bin ich leider nicht in der Lage, ihn bekanntzugeben. Eine weitere Frage. Die Sammlung Pantaleone ist alt und bedeutend. Warum wollte der General sie auflösen?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Darf ich Sie bitten, dieses Gespräch für sich zu behalten?«
»Nein, das dürfen Sie nicht! Ich habe nicht darum gebeten. Ich habe mich vorher nicht zur Geheimhaltung verpflichtet. Ich bestehe auf meinem Recht, darüber zu sprechen, mit wem es mir beliebt – oder auch nicht.«
»Cavaliere, Sie kennen die Organisation, die ich vertrete?«
»Den militärischen Geheimdienst? Ich weiß von seiner Existenz. Mit seiner Arbeit bin ich nicht vertraut.«
»Aber es ist Ihnen doch zumindest bekannt, daß wir es mit höchst delikaten Angelegenheiten zu tun haben, sowohl auf politischem wie auf militärischem Gebiet.«
»Mein lieber Colonnello, ich bitte Sie! Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Milchzähne schon vor Jahren verloren. Ich habe keine Vorliebe für Spione, Provokateure oder diejenigen, die mit ihnen umgehen. Ich weiß, daß Nachrichtendienste zu Handlangern der Tyrannei werden können. Ich weiß, daß sie die Menschen, die in ihnen arbeiten, gelegentlich korrumpieren. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, werden Sie mich jetzt sicher entschuldigen ... Guten Abend!«
Er schritt, steif wie ein Grenadier, aus dem Zimmer, und ich stieß einen langen Seufzer der Erleichterung aus. Das war zur Abwechslung einmal ein harter Brocken gewesen, ein Mann, dem man nicht um den Bart gehen konnte und der nicht einzuschüchtern war. Er blickte einem direkt ins Auge und gab einem klare, knappe Antworten, da er genau wußte, daß ihm niemand zu widersprechen wagte. Aber es waren immer noch wichtige Fragen offen. Warum sollte Pantaleone, wenn er Selbstmordgedanken hegte, diese langen und mühseligen Vorkehrungen zum Verkauf seiner Besitzungen treffen? Und wenn er sich schon zum Verkauf entschloß, warum führte er ihn dann nicht auch durch? Und warum sagte er zu, einen Brief zu schreiben, wenn er genau wußte, daß er ihn nie schreiben würde?
Puh! Es war für einen Tag mehr als genug. Mir schwirrte der Kopf, und in meinem Herzen spürte ich blanken Neid auf einen siebzig Jahre alten Cavaliere, der sich kostspielige Freundinnen wie die Fürstin Faubiani leisten konnte. Ich trat aus dem Clubgebäude in einen warmen Frühlingsregen hinaus, manövrierte meinen Wagen aus dem Hof heraus und fuhr langsam heimwärts zu einem warmen Abendessen, einer langweiligen Stunde Fernsehen und einem kalten Bett.
Tatsächlich hatte ich aber eine sehr unruhige Nacht. Kurz nach zehn rief ein Kollege aus Mailand an und teilte mir mit, ein junger Maoist, der sich im Zusammenhang mit einem Bombenanschlag im Untersuchungsgefängnis befand, habe sich aus dem Fenster des Vernehmungszimmers zu Tode gestürzt. Das würde in der gesamten Morgenpresse Schlagzeilen machen. Die Linke würde schwören, er sei hinausgestoßen worden. Die Rechte würde feierlich erklären, er sei aus eigenem Entschluß gesprungen. Wie dem auch sei – sie hatten wieder einen Märtyrer. Mein Kollege wollte sich nicht festlegen, aber als er den Namen des Vernehmungsbeamten erwähnte, kannte ich die Wahrheit. Der Mann war ein Sadist, ein wildgewordener Idiot, dem es völlig egal war, wie er zu seinen Beweisen und Geständnissen kam. Er besaß außerdem Freunde weiter oben, die bei jeder Untersuchung für ihn bürgen würden. Das war die Art von Irrsinn, die das ganze Land einschließlich der Polizei und des Rechtswesens in Mißkredit brachte. Eine Woche lang würden an jeder Straßenecke Truppen aufziehen, und auch das würde dazu beitragen, die Spannungen zu erhöhen und die Parteigegensätze zu polarisieren: Während die eine Seite »Tyrannei!« und »Unterdrückung!« schrie, würde die andere lauthals für Ruhe und Ordnung und ein Ende der Anarchie eintreten. Dio! Was für ein Alptraum! Wenn ich noch etwas Vernunft im Leibe hätte, würde ich meine Koffer packen und das nächste Schiff nach Australien nehmen.