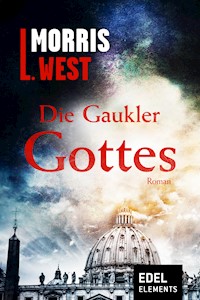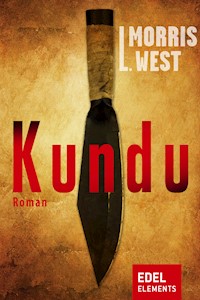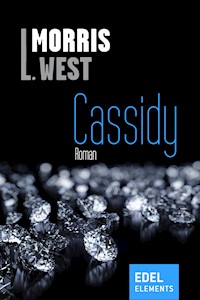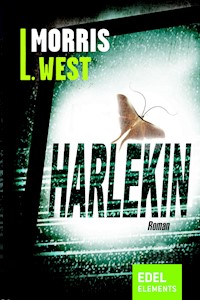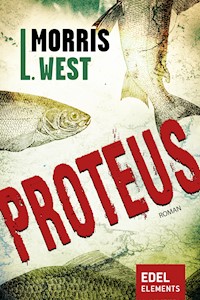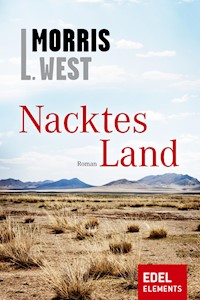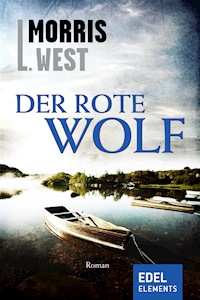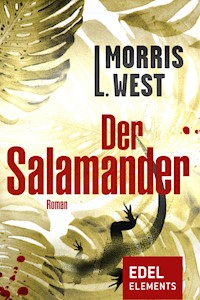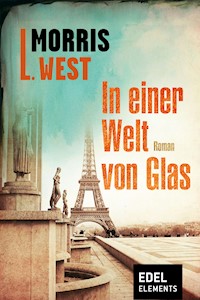
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Europa 1913: Magda, eine junge Ärztin, muß wegen eines Skandals von Berlin nach Paris fliehen. Hier führt sie ein ausschweifendes Leben – bis sie den großen Psychologen C. G. Jung trifft. Die ungewöhnliche Charakterstudie einer Frau vom großen Romancier Morris L. West.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
In einer Welt von Glas
Roman
Ins Deutsche übertragen von Karl-Otto und Friderike von Czernicki
Edel eBooks
Dies ist ein Roman. Ihm liegt ein Fall zugrunde, der in dem autobiographischen Werk »Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung« ganz kurz festgehalten wurde. Die Krankengeschichte ist nicht datiert und merkwürdig unvollständig belassen. Aus Jungs anderen Schriften habe ich den Eindruck gewonnen, daß ihn diese Episode noch lange Zeit beschäftigte und er bewußt darauf verzichtet hat, sie in allen Einzelheiten darzustellen.
Ich habe diese Geschichte in das Jahr 1913 verlegt – also in die Zeit von Jungs historischem Zwist mit Freud, dem Beginn seines lange währenden Liebesverhältnisses mit Antonia Wolff und den ersten Anzeichen seines sich über viele Jahre hinziehenden Verfalls.
Die Gestalt der Frau ohne Namen ist eine dichterische Erfindung, aber sie entspricht den Anhaltspunkten, die Jung in seiner Darstellung der Begegnung skizziert hat.
Was ich über Jung selbst, seine persönlichen Beziehungen und seine berufliche Einstellung schreibe, gründet sich durchweg auf die umfangreichen zur Verfügung stehenden Unterlagen. Die Deutung dieses Materials und dessen sprachlicher Ausdruck stammen natürlich von mir.
Im übrigen ist jeder Schriftsteller ein Mythenschöpfer, wie ihn Jung im Prolog zu »Erinnerungen, Träume, Gedanken« dargestellt und gerechtfertigt hat: »Ich kann jedoch nur unmittelbare Feststellungen machen, nur ›Geschichten erzählen.‹ Ob sie wahr sind, ist belanglos. Die Frage ist nur, sind sie mein Märchen, meine Wahrheit?«
M. L. W.
Begehe ein Verbrechen – und die Weltist von Glas ... irgendein vernichtenderHinweis sickert immer durch.
Ralph Waldo Emerson
C. G. Jung war sich stets der Gefahr geistiger Ansteckung und der nachteiligen Auswirkungen bewußt, die eine Persönlichkeit auf eine andere haben kann ... Jeder, der als Psychotherapeut psychotische Fälle behandelt hat, wird bestätigen, daß Wahnvorstellungen und andere Merkmale der Welt des psychisch Kranken in der Tat ansteckend sind und sich sehr störend auf das Urteil des Therapeuten auswirken können.
Anthony Storr: »Jung«, Kap. 2
Inhalt
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Carl Gustav Jung
Magda
Magda
Epilog in Fragmenten
Magda
Berlin/Paris
Gestern um Mitternacht wurde mein ganzes Leben zu etwas Unwirklichem: zu einem dunklen nordischen Märchen mit Trollen, Kobolden und vom Schicksal verfolgten Liebenden in alten Burgruinen voller Spinnweben und Rissen.
Ich muß jetzt, verschleiert wie eine trauernde Witwe, auf Reisen gehen, denn mein Gesicht ist zu vielen Menschen an zu vielen Orten bekannt. Ich muß mich in den Hotels unter einem falschen Namen eintragen. An den Landesgrenzen muß ich gefälschte Papiere benutzen, für die ich Gräfin Bette einen fürstlichen Preis bezahlt habe – Gräfin Bette, die natürlich überhaupt keine Gräfin ist, aber seit fünfundzwanzig Jahren am Hof der Hohenzollern ein Leben in Saus und Braus führt.
Für Notfälle – und für gewisse sexuelle Begegnungen, an denen ich noch immer Interesse habe – führe ich eine kleine Auswahl Herrengarderobe mit, die mir Poiret in Paris in glücklicheren Tagen angefertigt hat. Auch diese Notizen, die ich nur für mich persönlich niederschreibe, können nicht ohne Pseudonyme und Verschlüsselungen auskommen, damit ich meine Geheimnisse vor den neugierigen Augen von Zimmermädchen und männlichen Begleitern bewahren kann.
Aber so sieht die Wahrheit aus – soweit ich sie überhaupt zu Papier bringen kann –, und mein Bericht beginnt mit einem trüben Scherz. Gestern war mein Geburtstag, und ich feierte ihn im Edelbordell der Gräfin mit einem Mann, der in meinem Bett beinahe gestorben wäre.
Der Vorfall hat mir schwer zugesetzt, aber für Gräfin Bette war er nichts Ungewöhnliches. Ältere Herren, die ausschweifende Bettabenteuer lieben, bekommen nicht selten einen Herzanfall. Jedes Freudenhaus von Rang ist darauf vorbereitet, in solchen Fällen sofort zu reagieren. Ein Hausarzt leistet Erste Hilfe. Tot oder lebendig wird das Opfer wieder ordnungsgemäß bekleidet und mit der gebotenen Eile nach Hause, zu seinem Club oder in ein Krankenhaus transportiert. Wenn er keinen eigenen Kutscher oder Chauffeur hat, stellt Gräfin Bette einen solchen zur Verfügung: einen wortkargen Burschen mit einer langen Liste überzeugender Lügen, die den Zustand seines Fahrgastes erklären. Nachforschungen durch die Polizei sind selten – und die Diskretion der Polizei läßt sich stets erkaufen.
Diesmal war es jedoch nicht so einfach. Mein Begleiter und ich hielten uns als zahlende Gäste im Etablissement der Gräfin auf. Er ist ein Mann von Rang, ein Oberst in der Umgebung des Kaisers. Ich bin eine bekannte Gesellschaftsgröße, und außerdem bin ich Ärztin. Es war mir klar, daß der Oberst eine Koronarthrombose erlitten hatte und daß ihn eine zweite Attacke dieser Art während der Nacht, was in solchen Fällen immer möglich ist, mit Sicherheit das Leben kosten würde.
Er war – nicht allzu glücklich – mit einer Nichte der Kaiserin verheiratet und hatte seiner Frau gesagt, daß er an einer Generalstabskonferenz teilnehmen müsse. Dieses Alibi war bestimmt hieb- und stichfest. Aber schließlich würde mein Oberst, tot oder lebendig, seiner Ehegattin übergeben werden, und es gab keine Möglichkeit, den gefährlichen Zustand seines Herzens oder seine anderen Verletzungen zu verschweigen: Striemen in der Lendenregion, zwei angebrochene Rückenwirbel und wahrscheinlich auch Quetschungen der Nieren.
Gräfin Bette faßte die Situation kurz und bündig mit den Worten einer Berliner Straßendirne zusammen:
»Ich werde hier gründlich reinemachen. Dafür wirst du mir blechen. Aber versteh mich richtig! Du bist hier nicht mehr gern gesehen. Bisher warst du amüsant. Jetzt bist du gefährlich. Eine Ehefrau und ein Sohn, sogar der Kaiser persönlich und ein ganzes Kavallerieregiment werden wegen dieser Affäre blutige Rache schwören. Wenn ich dir etwas flüstern darf, dann sei ein schlaues Kind und verdufte eine Weile. Vorerst aber brauche ich Geld – und zwar eine ganze Menge.«
Als ich fragte, wieviel, nannte sie genau jene Summe, die ich am Vormittag zuvor für sechs Jagdpferde erhalten hatte. Ich hatte sie dem Prinzen Eulenburg verkauft. Weder fragte ich, wieso sie den Betrag kannte, noch, wie sie überhaupt auf eine solche Summe kam. Ich hatte das Bargeld in meinem Täschchen und gab es ihr ohne Murren. Sie ließ mich dann allein, damit ich meine Sachen packen und mich um den Patienten kümmern konnte, der offenbar einem neuen Herzanfall entgegensah.
Eine dreiviertel Stunde später war sie wieder da; sie hatte Ausweise und Papiere auf den Namen Magda Hirschfeld bei sich und eine Fahrkarte erster Klasse für den Nachtschnellzug nach Paris. Außerdem brachte sie mir einen abgetragenen Mantel aus schwarzer Serge und einen schwarzen Hut mit Schleier. Ich wollte einen Scherz machen und sagte, ich sähe damit wie eine englische Gouvernante aus. Gräfin Bette war jedoch nicht zum Spaßen aufgelegt.
»Ich tue dir einen Gefallen, den du gar nicht verdienst. Jedesmal, wenn ich in letzter Zeit etwas über dich gehört habe, war es noch verrückter und noch gemeiner ... Jetzt verstehe ich, warum.«
Ich fragte sie, was sie mit dem Oberst zu tun gedenke. Sie fuhr mich an: »Das ist meine Sache. Was du nicht weißt, kann weder dir noch mir schaden. Ich mag dich zwar nicht, aber ich stehe zu meinem Wort. Und jetzt verschwinde von hier, aber schnell!«
Mein Oberst war zwar bewußtlos, aber er lebte noch, als Bette mich aus dem Haus und durch den Küchengarten zu einem rückwärtigen Ausgang bugsierte, wo eine Droschke wartete, um mich zum Bahnhof zu bringen. Ich kam gerade noch drei Minuten vor Abfahrt des Zuges an und gab dem Schaffner ein Riesentrinkgeld, damit er mir ein leeres Abteil besorgte. Dann schloß ich mich ein und ging zu Bett.
Nachts hatte ich dann diesen Alptraum: den Traum von der Jagd durch ein schwarzes Tal, den Sturz vom Pferd und dann das Eingeschlossensein in einer Glaskugel, die über eine blutrote Sandwüste rollt.
Als ich aufwachte, war das Bettzeug zerwühlt. Angstschweiß brach aus allen meinen Poren, und ich schrie nach Papa. Aber Papa ist schon lange tot, und mein Schreien ging in dem klagenden Pfeifen des Zuges unter, das über die Äcker um Hannover hallte.
Carl Gustav Jung
Zürich
Ich weiß, daß ich dem Wahnsinn sehr nahe bin, und ich habe große Angst. Nachts schleiche ich, von Panik übermannt, durch furchterregende Landschaften: Meere von Blut und Schluchten zwischen gezackten Bergen und toten Städten, die weiß unter dem Mond daliegen. Ich höre den Donner von Pferdehufen und das Gebell von Hunden, und ich weiß nicht, ob ich Jäger oder Gejagter bin.
Wenn ich aufwache, sehe ich im Spiegel einen Fremden mit glühenden, feindseligen Augen. Ich kann kein vernünftiges Buch lesen; die Worte verschwimmen zu einem unsinnigen Knäuel. Ich versinke in dumpfe Depressionen, explodiere in unsinnigen Wutanfällen, die meine Kinder in Angst und Schrecken versetzen und bei meiner Frau Tränenausbrüche oder bittere Vorwürfe auslösen. Sie nörgelt an mir herum und will, daß ich einen Arzt oder einen Psychiater aufsuche; aber ich weiß, daß sich diese Krankheit weder durch ein Arzneifläschchen noch die bohrenden Fragen eines Analytikers heilen läßt.
Um meine geistige Gesundheit zu bestätigen, habe ich mir deshalb ein Ritual zurechtgelegt. Vor dem Fremden im Spiegel sage ich die Litanei meines Lebens auf, etwa so: »Ich heiße Carl Gustav Jung. Ich bin Arzt, Dozent der Psychiatrie, Analytiker. Ich bin achtunddreißig Jahre alt. Ich wurde am 26. Juli 1875 in der kleinen Schweizer Ortschaft Keßwil im Kanton Thurgau geboren. Mein Vater Johann Paul Achilles war protestantischer Pfarrer. Meine Mutter war ein Mädchen aus Basel und hieß Emilie Preiswerk. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, und ein fünftes ist unterwegs. Der Mädchenname meiner Frau ist Emma Rauschenbach. Sie wurde in der Bodenseegegend geboren – und manchmal hält sie offenbar auch heute noch den Bodensee für den Nabel der Welt ...«
Die Rezitation geht weiter, während ich mich rasiere. Sie soll mir einen festen Platz in Raum, Zeit und Umwelt sichern, damit ich mich nicht in eine Unperson auflöse. Ich frühstücke allein, ohne zu sprechen, denn ich forsche dabei noch immer dem Gespinst meiner Träume nach.
Nach dem Frühstück gehe ich am See spazieren und sammle alle möglichen Steine für das Miniaturdorf, das im unteren Teil meines Gartens allmählich Gestalt annimmt. Es ist ein kindlicher Zeitvertreib, aber er hilft mir, meine schweifenden Gedanken an die einfachen Realitäten der gegenständlichen Welt zu heften, an das kühle Wasser, die Form und Beschaffenheit der Steine, das Rauschen des Windes in den Ästen und die hellen Sonnenflecken auf dem Rasen. Im weiteren Verlauf dieses Rituals höre ich oft Stimmen und sehe manchmal Personen aus der Vergangenheit. Gelegentlich höre ich die Stimme meines Vaters, der von der Kanzel in Keßwil die christliche Glaubenslehre verkündet: »Ein Sakrament, meine lieben Brüder, ist das äußerlich sichtbare Zeichen einer inneren Gnade. Die Gnade ist ein Geschenk Gottes ...«
Ich lehne schon seit langer Zeit die Religion ab, die mein Vater predigte. Für seinen Gott ist in meinem Leben kein Platz; aber für die Gnade, das Geschenk – o ja! Diese Gaben werden mir jeden Morgen zuteil, wenn mein Ritual beendet ist und meine Antonia Punkt zehn Uhr in mein Leben tritt.
Meine Antonia! Ja, das kann ich sagen, auch wenn ich sie weder vollständig noch ununterbrochen besitze, wie ich es mir wünschen würde. Wir haben ein Liebesverhältnis, aber es ist mehr als das. Manchmal glaube ich, daß wir einen vollendeteren Bund eingegangen sind als die gesetzliche Ehe, die Emma und mich verbindet. Toni hat sich mir so leidenschaftlich und so vorbehaltlos geschenkt, daß ich, wenn ich nur ihre Schritte oder den Klang ihrer Stimme höre, zu neuem Leben erwache und sie begehre. Mein Geschenk für sie stammt von ihr selbst: eine Einfalt des Herzens, eine ausgeglichene Gefühlswelt, ein Ganzsein, eine Harmonie zwischen dem Bewußten und dem Unbewußten. Als sie – damals noch Patientin – zu mir kam, glich sie der Prinzessin, die in dem verzauberten Wald im Dornröschenschlaf liegt, gefangen in Brombeergestrüpp und Dornenranken. Ich erweckte sie. Ich verscheuchte die Alpträume und die Wirrsal ihres langen Schlummers. Als sie geheilt war, machte ich sie zu meiner Schülerin. Dann wurde sie meine Gefährtin und Mitarbeiterin.
Jetzt, da ich selbst die Zeit des Schreckens erlebe, sind unsere Rollen vertauscht. Ich bin der Patient. Sie ist die geliebte Ärztin, deren Stimme mich beruhigt und deren Berührung ihre Heilkräfte auf mich überträgt.
Ich werde lyrisch, ich weiß es; aber nur, wenn ich allein bin, kann ich so sein. Ich vertraue mich diesem geheimen Tagebuch an, das während der Stunden, die Antonia und ich gemeinsam verbringen, in meinem Turmzimmer, wo sonst niemand ungebeten eintreten darf, verschlossen liegt. Aber selbst hier ist unsere Gemeinsamkeit nicht vollständig. Wir flirten und tändeln miteinander, wenn wir nicht arbeiten – was wir wirklich auch tun! –, aber wir lieben uns nie richtig, denn Toni will sich nicht im Haus einer anderen Frau einem Mann ganz hingeben. Ich bedaure das, aber ich muß zugeben, daß ihr Standpunkt viel für sich hat. Emma ist schon jetzt unverhohlen eifersüchtig, und wir dürfen nicht riskieren, im Bett auf frischer Tat ertappt zu werden.
Natürlich vergrößert diese erzwungene Abstinenz meine emotionalen Spannungen, aber es herrscht insofern ein gewisser Ausgleich, als auch Toni gezwungen ist, jenes Maß an Zurückhaltung an den Tag zu legen, das für unsere berufliche Beziehung notwendig ist. Ich persönlich kann nicht – sosehr ich es auch wünschte – alle meine ungelösten Probleme in ihrer üppigen Weiblichkeit ersticken. Ebensowenig kann ich mich sinnlos betrinken oder mich mit Drogen um den Verstand bringen und dann beim Einschlafen vor mich hinmurmeln, daß zwischen mir und der Welt alles in Ordnung sei.
So begrüßen wir uns jeden Morgen liebevoll ... Sie kocht Kaffee für uns beide. Wir erledigen die Korrespondenz. Dann setzen wir uns zusammen, um die Konflikte zu analysieren, die mir psychisch schwer zusetzen.
Trotz unserer therapeutisch ausgerichteten Beziehung während dieser Sitzungen bin ich mir jeden Augenblick Tonis körperlicher Gegenwart bewußt. Ich betrachte die Rundung ihrer Brüste, den Fall ihres Rockes über die Oberschenkel, eine Haarsträhne, die an ihrer Schläfe herabhängt. Ich bin sinnlich erregt, aber sie sitzt ruhig und gelassen da wie eine Eiskönigin – so wie sie es von mir gelernt hat – und stellt ihre Fragen: »Was hast du letzte Nacht geträumt? Hatte der Traum etwas mit den Symbolen zu tun, über die wir gesprochen haben?«
Heute besprachen wir eine neue Traumsequenz, die anscheinend mit allen früheren, an die ich mich erinnern konnte, keinerlei Verbindung hat. Ich war in einer Stadt in Italien. Ich wußte, daß sie irgendwo im Norden liegen mußte, weil sie mich an Basel erinnerte. Aber ich befand mich eindeutig in Italien und in der Gegenwart. Die Menschen waren modern gekleidet. Es gab Fahrräder und Autobusse und sogar eine Straßenbahn. Ich schlenderte die Straße entlang, als ich plötzlich vor mir einen Ritter in voller Rüstung sah, einer Rüstung aus dem zwölften Jahrhundert mit dem roten Kreuz der Kreuzritter auf der Brust. Er war mit einem gewaltigen Schwert bewaffnet und schritt dahin wie ein Eroberer, ohne nach rechts oder links zu schauen. Das Bemerkenswerte daran war, daß niemand von ihm Notiz nahm. Es war, als sei ich der einzige, der ihn sah. Ich spürte die ungeheure Kraft, die von ihm ausging – als stünde eine Offenbarung unmittelbar bevor. Wenn ich ihm nur hätte folgen können, aber ich konnte es nicht ...
Bei der Deutung dieses Traums gerieten Toni und ich fast in Streit. Ich war überzeugt – und bin es auch heute noch –, daß er magische und alchemistische Bilder enthielt, die auf alte Mythen hinweisen, etwa auf die Ritter der Tafelrunde von König Artus und die Suche nach dem Heiligen Gral – ein Symbol für meine eigene Suche nach dem Sinn des Lebens inmitten allgemeiner Verwirrung.
Toni widersprach mir nachdrücklich. Der Ritter sei Freud, sagte sie. Freud sei der einsame Kreuzritter, der von den Gleichgültigen nicht erkannt wird. Sie behauptete, ich hätte seine Bedeutung und seine Macht erkannt, könne ihm aber nicht folgen, weil ich unfähig sei, die Wucht seiner Ideen zu akzeptieren, und weil sich meine Zuneigung zu ihm in Feindseligkeit verwandelt habe.
Ich spürte wie so oft sinnlose Wut in mir aufsteigen. Dann brach sie gottlob die Auseinandersetzung mit mir ab, kam zu mir, drückte meinen Kopf an ihre Brust und sagte versöhnlich: »Schon gut! Schon gut! An diesem wunderschönen Morgen wollen wir uns doch nicht streiten. Wir sind beide abgespannt und gereizt. Ich habe die halbe Nacht wach im Bett gelegen und an dich gedacht. Ich sehne mich nach dir. Bitte, bring mich heute abend nach Hause und mach mich glücklich.«
Wäre sie zänkisch oder kleinlaut gewesen, hätte ich vielleicht stundenlang meine Wut an ihr ausgelassen, wie ich es manchmal bei Emma tue. Aber ihre Zärtlichkeit entwaffnet mich stets und bringt mich zuweilen den Tränen nahe.
Trotzdem macht sie im therapeutischen Gespräch keinerlei Zugeständnisse. Sie ist überzeugt, daß meine Probleme mit Freud zu meiner Psychose beitragen. Ich gestehe es mir selber ein, kann es ihr gegenüber aber noch nicht zugeben. Ich habe ihr weder von der homosexuellen Vergewaltigung erzählt, die mir in jungen Jahren widerfuhr, noch von der homosexuellen Komponente meiner Zuneigung zu Freud, noch wie schwer es mir fällt, mich von seiner Dominanz frei zu machen.
Früher oder später muß jedoch die Wahrheit herauskommen, wenn wir meine Analyse gemeinsam fortsetzen. Aber um Gottes willen nicht schon jetzt! Ich bin ein alter, verheirateter Narr, der ein fünfundzwanzigjähriges Mädchen liebt. Dieses Glück möchte ich, so lange es geht, genießen. Ich sehe schon heftige Auseinandersetzungen mit Emma am Horizont auftauchen, und wenn mein finsterer Doppelgänger jemals über mich die Oberhand gewinnt, kann ich alle Hoffnung und Freude fahren lassen. Aber dann werde ich lieber dem Beispiel meines alten Freundes Honegger folgen und freiwillig aus diesem Leben scheiden.
Magda
Paris
Zum erstenmal seit zwanzig Jahren wohne ich nicht im Crillon, sondern in einer bescheidenen Pension in der Nähe des Étoile. Ich nehme die Mahlzeiten im Haus ein und gehe nur in solchen Stadtvierteln spazieren, wo ich bestimmt keine Freunde oder Bekannten treffe. In der Nachbarschaft befindet sich ein Kiosk, an dem ausländische Zeitungen verkauft werden. Ich habe mir das »Berliner Tageblatt« abonniert. Bis jetzt habe ich noch keine Meldung über das Schicksal meines Obersten entdeckt. Daß ich in Berlin war, wurde nur einmal in einer kurzen Notiz indirekt erwähnt: »Prinz Eulenburg hat von einem bekannten Gestüt sechs Jagdpferde gekauft, die auf seinem baltischen Gut für die kommende Saison ausgebildet werden.« Ich umreiße meine Situation. Mein Oberst lebt entweder noch, oder er ist tot. Wenn er tot ist, wird dies den Todesanzeigen zu entnehmen sein. Man wird ihn mit militärischen Ehren begraben: gedämpfte Trommelwirbel, ein reiterloses Pferd mit leeren Stiefeln in den Steigbügeln, eine Lafette – kurz, alles, was zur militärischen Tradition gehört. Wenn er lebt, muß er zumindest vorübergehend körperlich behindert sein und sich schwertun, dafür eine plausible Erklärung gegenüber seiner Frau zu finden. Ich weiß, daß er bei Liebeshändeln nie um eine Ausrede verlegen ist, aber diese Episode dürfte sein diesbezügliches Talent aufs höchste strapazieren.
Doch gibt es noch eine dritte, unangenehmere Möglichkeit: daß nämlich mein Oberst sich bald erholt und mich erledigen will. Er hat keinen Grund, mich zu lieben. Zudem ist es durchaus möglich, daß er sich vor Erpressung fürchtet – eines der wenigen Spiele, die ich noch nie ausprobiert habe. Man redet aber seit kurzem immer häufiger von neuen Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten. Bulgarien hat Serbien und Griechenland angegriffen. Im Westen werden Geschichten über Spione, Anarchisten und Attentäter kolportiert. Erst vor drei Monaten wurde auf König Alfonso von Spanien ein Attentat versucht. Wenn der Kaiser und sein Oberst mich loswerden wollen, könnten sie das ganz leicht arrangieren. Es ist allgemein bekannt, daß der Kaiser in diesen Tagen sehr empfindlich reagiert, wenn das Ansehen seines Hofes auf dem Spiel steht. Sogar sein königlicher Vetter in England hat einmal bemerkt: »Willy ist wirklich sehr ungeschickt!« Und mich hätten bereits beinahe Gerüchte ruiniert, die mich – diesmal allerdings fälschlicherweise – zu der »schönen Reiterin« machten, »mit der die Kaiserin angeblich ein Liebesverhältnis unterhält«.
Im Augenblick sitze ich also zurückgezogen in meiner Pension am Étoile. Ich lese die Morgenblätter, mache ein paar Einkäufe, gehe spazieren und hoffe, daß Gräfin Bette in Berlin ihr Wort hält. Ich versuche, das Komische an der Sache zu sehen, aber es ist wirklich nicht zum Lachen. Ich habe Angst. Ich bin zutiefst verwirrt – nicht etwa deshalb, weil mir jemand etwas antun könnte, sondern darüber, was ich mir selbst angetan habe. Plötzlich hat sich vor meinen Füßen ein schwarzes Loch aufgetan, und ich taumle am Rand der Vernichtung entlang.
Eine Erklärung finde ich nur, wenn ich mir ins Gedächtnis zurückrufe, was vor zwanzig Jahren geschah, als ich gerade mein Studium beendet hatte. Papa nahm Lily und mich auf eine Reise in den Fernen Osten mit. Wir fuhren auf dem Flaggschiff der alten Royal Dutch Line und liefen Hongkong, Schanghai, Indien, Siam und Java an. Eines Tages machten wir in Surabaja einen Landausflug und bummelten über den Markt, als plötzlich eine Panik ausbrach. Die Menschen stoben schreiend in alle Himmelsrichtungen auseinander. Wir blickten auf und sahen einen Malaien, der blindwütig mit einem großen, geschwungenen Kris um sich schlug und auf uns zugerannt kam. Er war schon ganz nahe herangekommen, vielleicht bis auf zehn Meter, als ihn ein holländischer Polizist niederschoß. Dies sei, erklärte Papa, die einzige Möglichkeit, ihm Einhalt zu gebieten. Der Mann lief Amok. Er war von einer mörderischen, manischen Wut ergriffen, gegenüber der jede Vernunft versagte.
»Deshalb muß man ihn töten«, sagte Papa lächelnd in seiner gelassenen Art. »Für ihn ist es eine Erlösung und für die Öffentlichkeit notwendig. Diese Art des Wahnsinns kann sich unter diesen Menschen wie die Pest verbreiten.« Ich frage mich, was er wohl gesagt hätte, wenn er seiner Tochter im selben Zustand im Schlafzimmer des Bordells der Gräfin Bette begegnet wäre. Es hatte wie ein ganz gewöhnliches Liebesspiel begonnen, wenn auch wie ein ziemlich heftiges. Mein Oberst, ein großer, kräftiger Kerl, brannte darauf, sich vor Frauen zu demütigen. Er verlangte, erniedrigt und für eingebildete Verfehlungen bestraft zu werden. Für seine Phantasien war ich die perfekte Kumpanin. Ich bin groß, sportlich, eine gute Reiterin, und ich verkehre in Jägerkreisen. Auch mir gefiel dieses Spiel – so wie mir fast alle sexuellen Abenteuer gefallen. Aber plötzlich war es kein Spiel mehr. Ich wurde zu einer reißenden Furie, voller Rachegelüste, die mich plötzlich übermannten. Ich wollte den Mann umbringen und schlug mit dem Griff meiner Reitpeitsche auf ihn ein. Erst als ich sah, daß er einen Herzanfall bekam – sein Brustkorb fiel ein, sein Mund verzerrte sich, und er rang nach Atem –, brachte mich dieser Schock in die Wirklichkeit zurück. Es ist schwer zu glauben, wie nahe ich daran war, einen Mord zu begehen, und wieviel Spaß ich dabei hatte.
Wenn ich aus meiner Pariser Zuflucht zurückblicke, kommt mir der Gedanke, daß sich dergleichen vielleicht wiederholen könnte und daß ich das nächste Mal nicht wieder mit einem blauen Auge davonkomme. Etwas geht in mir vor, und zwar schon seit längerer Zeit, was ich nicht erklären kann.
Jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe, trete ich nackt vor den Spiegel. Ich habe allen Grund, mit dem, was ich sehe, zufrieden zu sein. Ich bin fünfundvierzig Jahre alt und habe ein Kind zur Welt gebracht. Aber meine Brüste sind fest, meine Haut ist rein, und meine Muskeln sind kräftig wie die eines jungen Mädchens. Meine Haare haben noch immer ihre natürliche, kastanienbraune Farbe. Zwar entdecke ich ein paar verräterische Linien um die Augen, aber bei günstiger Beleuchtung und sorgfältigem Schminken und Pudern sind auch diese kaum zu sehen. Ich bekomme noch regelmäßig meine Tage und leide noch nicht unter den Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Wenn ich heute abend – wozu ich Lust hätte – in den Club Dorian’s gehe oder Nathalie Barney besuche, kann ich beliebig wählen: Mann oder Frau.
Diese Veränderung, worin sie auch bestehen mag, vollzieht sich in meinem Innern. Es ist, als ob sich – wie soll ich es nur erklären? – in meinem Gehirn eine Tür geöffnet hätte und alle möglichen seltsamen Wesen losgelassen worden wären. Sie entziehen sich meiner Kontrolle. Ich kann ihrer nicht wieder habhaft werden. Nicht alle sind grausam und böse wie der Teufel, der mich bei Gräfin Bette geritten hat. Manche dieser Wesen sind phantasievoll, geistreich, ausgelassen, voll wilder und brillanter Gedanken. Aber sie folgen ihren eigenen Einfällen und nicht meinen Anweisungen. Ich könnte genausogut einen Handkarren durch die Tuilerien-Gärten ziehen wie mit Nathalie Barney bei einem Tango-Tee gewagte Dinge treiben.
Aber genau das ist es, was mich bestürzt. Ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren. Bei Männern, Pferden und Hunden bin ich stets die Herrin gewesen; bei Frauen entweder eine zärtliche Freundin oder eine gefährliche Feindin. Ich bin nie von Alkohol oder Drogen abhängig gewesen, obwohl ich beide ausprobiert habe. Papa war es gewesen, der mich in seiner unverblümten Art darauf hingewiesen hatte: »Verlieb dich nie in die Flasche oder die Opiumpfeife! Du verbaust dir jeden Spaß und die Zukunft damit. Geh nie mit einem Fremden ins Bett! Die Syphilis ruiniert den ganzen Organismus. Denk immer daran, daß der einzige Liebhaber, der dein Herz gewinnen kann, derjenige ist, auf den du dich verlassen kannst!«
Ich wünschte, Papa wäre jetzt hier, damit ich ihm die Fragen stellen könnte, mit denen ich nicht fertig werde: »Was tut man, wenn man sich auf sich selbst nicht verlassen kann? Wohin wendest du dich, wenn du die Straßenschilder nicht mehr lesen kannst? Was soll ich mit all diesen Fremden anfangen, die in meinem Kopf herumschwirren?«
Aber das ist ja reine Narretei. Papa ist schon lange nicht mehr da, und ich kann nicht den Rest meines Lebens damit zubringen, Banalitäten mit der Witwe eines Abgeordneten auszutauschen oder meine längst verlorene Unschuld vor einem Weinhändler aus Bordeaux zu verteidigen, der unter dem Tisch mein Knie tätschelt. Koste es, was es wolle – ich muß aus dieser Unterkunft heraus. Heute abend gehe ich ins Dorian’s. Dort werde ich schon sehen, was mir bevorsteht.
Jahrmarkt der Abnormitäten? Wem sage ich das? Ich bin Clubmitglied bei Dorian’s, solange ich mich zurückerinnern kann. Laut Papa – der gewöhnlich über die Halbwelt sehr gut Bescheid wußte – wurde der Club von Liane de Pougy gegründet, die damals die große Lebedame von Paris war. Der König von Portugal schenkte ihr ein Vermögen. Baron Bleichröder, Lord Carnarvon, Fürst Strozzi und Maurice de Rothschild – sie alle zollten ihr Tribut mit Geld und Leidenschaft. Die Leidenschaft nutzte sie rücksichtslos aus, das Geld gab sie zügellos für lesbische Freundinnen, Ringer und allerlei seltsame Gestalten aus den Spelunken um den Montmartre aus.
Der Club war ihre private Abnormitätenschau, wo sie ihren willfährigen Kunden noch mehr Geld aus der Tasche ziehen konnte. Ihr Geschäftsführer war Dorian, ein kleiner, buckliger Gnom aus Korsika, der wie Zwerg Nase aussah, ein aufbrausendes Temperament besaß und trotz seiner Menschenverachtung ein Herz hatte, das so groß war wie der Buckel auf seinem Rücken.
Papa pflegte die Pougy und Dorian zu besuchen, sooft er nach Paris kam. Sie suchte aufgrund der Krankheiten ihres Gewerbes seinen ärztlichen Rat. Dorian behandelte er wegen der Gelenkschmerzen, die von seinem gekrümmten Rücken herrührten. Als die Pougy ihren Anteil an dem Club verkaufen wollte, überließ Papa Dorian das Geld zum Ankauf. So erbte ich eines schönen Tages die Mitgliedschaft auf Lebenszeit.
Als mein Mann starb und meine kleine Tochter zu ihrer Tante zog, sah ich mich mit einem großen Vermögen konfrontiert und einer Vielzahl lange aufgestauter Gelüste, die sich, falls ich mich nicht auch als Lebedame etablieren wollte, nur insgeheim befriedigen ließen. Dorian’s wurde meine Pariser Absteige. Als ich mich vorstellte und Papas alte Visitenkarte präsentierte, umarmte mich Dorian und ernannte mich auf der Stelle zu seiner Leibärztin.
Ich kann mich noch genau erinnern, wie er mit verschmitztem Lächeln den Zeigefinger an seine Nase legte und sagte: »Ein faires Tauschgeschäft, eh? Sie werden für meine Gesundheit sorgen, ich werde Ihnen alle Schwierigkeiten vom Leibe halten. Ich mochte Ihren Papa. Er war ein Draufgänger, aber er hatte heilende Hände – und, ach, so viel Stil! Die englischen Milords konnten ihm nicht das Wasser reichen. Von den Deutschen wagte keiner, sich mit ihm anzulegen. Und die Franzosen haben ihn nie ganz verstanden. Ich übrigens auch nicht. So war ich mir auch nie ganz sicher, was er mit Ihnen vorhatte ... Er hatte höchst seltsame Vorstellungen von der Erziehung einer Tochter ... Aber das geht mich nichts an. Manche mögen Fisch und manche mögen Geflügel, doch wie soll man das feststellen, bevor man nicht beides probiert hat, eh?«
Dorian ist inzwischen älter geworden, um mehr als ein Jahrzehnt. Seine Haare sind weiß. Seine Gelenke knacken, wenn er sich bewegt. Er hat die fahle Blässe eines Höhlenbewohners. Sein Dienstpersonal befindet sich stets in Rufweite: ein finsterer, wortkarger Bursche aus Ajaccio und eine Barfrau aus Calvi, die aussieht, als könne sie einen Ochsen mit den bloßen Händen erwürgen. Die Barfrau führt ihm den Haushalt. Der Mann aus Ajaccio folgt Dorian wie ein Schatten: er ist immer in der Nähe, kaum zu sehen, aber gefährlich wie eine Viper.
Wenn ich Dorian aufsuche, gehe ich zuerst in sein Haus am Quai des Orfèvres. Es ist ein Akt ritueller Höflichkeit. Ich bin seine Ärztin, und er erwartet, von mir untersucht zu werden. Anschließend begeben wir uns, von dem großen, schweigsamen Kerl gefolgt, über den gepflasterten Innenhof zum Club, wo Dorians Exoten sich produzieren.
Heute abend habe ich beschlossen, mein Poiret-Kostüm anzuziehen: lange schwarze Hose, schwarze Smokingjacke, weiße gerüschte Bluse und darüber einen mit mitternachtsblauer Seide gefütterten Umhang. Beim Ankleiden fragte ich mich, wieviel ich Dorian von meinem Dilemma erzählen dürfe. Wir sind gute Freunde, aber in unserem Zirkus der Absurditäten darf man die Bosheit nie unterschätzen.
Ich hätte mir darüber aber keine Gedanken zu machen brauchen, Dorian wußte schon alles – sogar mehr als ich. Mein Oberst lebte und erholte sich auf seinem Gut in Ostpreußen. Er hatte seinen Herzanfall überwunden, aber sein Rücken war noch in Gips. Aus der näheren Umgebung des Kaisers hatte er sich zurückgezogen und einen Posten im Generalstab übernommen ... Was mich angehe, seien zwar keine Vergeltungsmaßnahmen geplant, aber ich täte gut daran, mich nie wieder in Berlin sehen zu lassen.
»Du bist noch mit einem blauen Auge davongekommen!« Dorian gab sich in dieser Sache kurz angebunden. »Wenn du dich nicht in der Gewalt behalten kannst, fang solche Spielchen gar nicht erst an! Eines kann ich dir sagen: Die Preußen können sehr rüde werden ... Und jetzt sieh mich einmal an und sage mir, wie lange ich noch zu leben habe.«
Während ich seinen entstellten kleinen Körper untersuchte, dem rasselnden Geräusch der Lungen lauschte, sein verkrümmtes Rückgrat und die Knötchen an allen seinen Gelenken befühlte, hielt er mir wie ein Schulmeister einen Vortrag.
»Weiber! Ihr seid so dumm – jede von euch! Ihr begreift nie, daß ihr gegen die Bank spielt – und die Bank gewinnt letzten Endes immer. Zum Beispiel, Chérie. Du bist robust, du bist reich, und du bist intelligent. Aber auch du wirst dich allmählich aufreiben. Es wird nicht mehr lange dauern, und du bist nur noch ein Nervenbündel. Dann beginnt das große Geschrei. Du wirst zwar nicht ›Hilfe‹ schreien, aber ›Mord‹. Und schon wird dich die Polizei ins Gefängnis abtransportieren.«
Er streckte sich und streichelte meine Wange mit seiner kleinen, arthritischen Hand, die sich wie die Klaue eines Vogels zusammengekrampft hatte. Die Geste war zärtlich gemeint, wirkte aber bedrohlich.
»Du machst mir Kummer, Chérie. Die meisten Frauen, die hierher kommen, sind für mich wie ein offenes Buch. Irgendein Mann hat ihnen etwas angetan. Sie fühlen sich elend, weil sie nicht mehr jung sind. Es sind Lesbierinnen oder Einzelgängerinnen, die sich vom Leben noch etwas erwarten. Meist trinken sie, nehmen Drogen oder tun beides. Aber bei dir ist es anders. Einmal bist du eine Madonna mit honigsüßem Lächeln und Brüsten, welche die ganze Welt mit Muttermilch erfreuen könnten, und im nächsten Augenblick bist du eine Medusa mit giftigem Atem und Schlangenhaar.«
»Jage ich dir auch Angst ein, Dorian?«
»Angst?« Er lachte, und der heisere Ton endete in einem Hustenanfall. »Keineswegs! Ich kenne dich zu gut. Außerdem wagt niemand, sich mit einem Buckligen anzulegen. Man reibt ihm vielmehr den Buckel, weil das Glück bringen soll. Du könntest ihn mir auch reiben, wenn du magst. Du kannst etwas Glück gut gebrauchen.«
Auf das Wort »reiben« hatten wir uns seit langem stillschweigend geeinigt. Es war Ausdruck seines Schreis nach sexueller Entspannung mit einem Partner, der ihn nicht auslachen oder über die Geheimnisse seines verunstalteten Körpers herumtratschen würde. Ich tat ihm den Gefallen gern. Es dauerte nicht lange, und ich empfand dabei weder Widerwillen noch Abscheu. Statt dessen überkam mich eine seltsame Zärtlichkeit. Ich wollte ihm Freude bereiten, ihm Gelegenheit geben, sich als Mann zu fühlen, und ihn beobachten, während er schläfrig und zufrieden hinterher ein Glas Cognac mit mir trank.
Bei dieser Gelegenheit überfiel er mich mit der unverblümten Frage: »Warum ziehst du diese ... diese Löwenbändigernummer ab?«
»Löwenbändiger?« Die Vorstellung war so unwahrscheinlich, daß ich in lautes Lachen ausbrach. Dorian wurde böse.
»Mach keine Witze. So nennt man dich jetzt im ganzen europäischen Fachzirkus: la dompteuse des lions.«
»Das ist gar nicht so komisch.«
»Soll es auch nicht sein. Ein solcher Ruf bringt Risiken mit sich. Was erwartest du dir von diesen Verrücktheiten?«
»Nichts.«
»Warum tust du es dann?«
»Ich weiß es nicht, Dorian; ich weiß es wirklich nicht. Wenn es passiert, überkommt es mich wie ein Wutanfall, wie ein Feuersturm. Ich kenne mich dann selbst nicht mehr.«
»Wo wohnst du denn jetzt?«
»In einem Mauseloch mit anderen grauen Mäusen. Es ist eine Pension am Étoile.«
»Kannst du dort Besuche empfangen?«
»Nein.«
»Dann übernachte hier! Nimm mein Gästezimmer! Ich werde dich mit jemandem bekannt machen. Hinterher wirst du so friedlich sein wie eine Nonne bei der Abendandacht.«
»Nein, vielen Dank! Ich konnte jetzt keinen Mann verkraften.«
»Wer hat etwas von einem Mann gesagt?« Er fuhr mir mit seinen kleinen Krallenfingern durch die Haare. »Es ist ein Mädchen wie jenes, das Sappho auf Lesbos besungen hat. Ich glaube, du brauchst gerade jetzt so jemanden. Außerdem – was hast du zu verlieren? Wenn ihr beglückt einschlaft und als Freundinnen wieder aufwacht, geht es euch beiden besser.«
Er hatte recht. Ich verlor nichts, sondern gewann etwas – glaube ich wenigstens. Sie schmiegte sich an meine Brust wie ein Kind und rief: »Hab mich lieb, Mamilein, hab mich lieb! Nimm mich wieder in deinen Schoß!«
Ich dachte an meine verlorene Tochter und liebkoste das Mädchen. Dann versuchte ich meinerseits, den Eingang zu ihrem Schoß zu finden, aber er war zu klein und zu eng, um mir Einlaß zu gewähren. Ich ärgerte mich jedoch nicht, denn sie wollte mir so bereitwillig diesen Gefallen erweisen. Es war nicht ihre Schuld, daß das Haus zu klein und noch nie bewohnt worden war. Wir schliefen ein und hielten uns in den Armen – vielleicht nicht beglückt, aber zärtlich und ruhig. Gegen drei Uhr morgens wachte ich auf. Sie schlief in meiner Armbeuge und hatte die Lippen an meine Brust gedrückt. Der Mondschein fiel auf ihr Gesicht, und ich sah zu meiner Überraschung, daß sie fast so alt war wie ich. Wie ich hatte sie Krähenfüße an den Augenwinkeln und Runzeln um die Mundwinkel.
Ich empfand kein Bedauern, keine Enttäuschung, mir fiel nur plötzlich mein Vater wieder ein, der nach meiner ersten Liebesnacht morgens am Frühstückstisch lächelnd gesagt hatte: »Schon verteufelt schwierig, nicht wahr?«
»Entschuldige, Papa«, erwiderte ich, so keck es ging, »aber ich wüßte nicht, was schwierig sein soll.«
»Du Glückliche!« Er sah mich noch immer eulenspiegelhaft schmunzelnd an. »Als ich jung war, wußte ich nie, was ich ihnen hinterher sagen sollte.«
»Aber inzwischen hast du es gelernt?« Zum Necken gehörten immer zwei.
»O ja! Ich sage immer dasselbe: Danke, und – so leid es mir tut – leb wohl!«
»Das muß sie ja zu Tränen rühren!«
»Nein.« Er lachte und schwenkte ein Croissant vor meinem Gesicht hin und her. »Aber es hält alles im Fluß. Man macht sich keine Feinde. Wenn man Glück hat, behält man eine Freundin für kalte Winternächte.«
Diese Kindfrau wollte ich nicht behalten. Ich stand auf, ohne sie zu wecken, und ließ etwas Geld neben dem Kopfkissen liegen. Ich schlich hinaus in die graue Morgendämmerung, nahm mir eine Droschke und fuhr in die Pension zurück. Der Kutscher war mürrisch, das Pferd ging lahm und war nicht zum Traben zu bewegen; aber durch das langsame Klipp-Klapp seiner Hufe auf den Pflastersteinen konnte ich Lily hören, die ein Wiegenlied aus meiner Kindheit sang.
Reite auf dem Schaukelpferd nach Banbury Cross.Dort siehst du die Dame hoch zu RoßMit Ringen an den Fingern und Glöckchen am Bein.So hört sie Musik und ist nie allein.
Carl Gustav Jung
Zürich
Ich habe eine Reise angetreten, die gefahrvoller ist als all die Expeditionen der alten Seefahrer – eine Reise zum Mittelpunkt meiner selbst. Ich muß herausbekommen, wer ich bin und warum ich bin. Ich muß mit dem Dämon fertig werden, der in mir lebt. Ich muß mit meinem längst verstorbenen Vater über jenen Gott rechten, den er predigte und den ich ablehnte. Ich muß mit meiner längst dahingegangenen Mutter reden, die ich nie lieben gelernt habe. Ich muß dem Mann begegnen, der mich als Knaben vergewaltigte, und den dunklen Göttern, die mich jetzt noch im Traum verfolgen. Ich muß das Band zu Freud durchtrennen, und das ist gewiß keine einfache Aufgabe. Ich muß vom letzten Uferstreifen in das wilde Meer meines persönlichen Unbewußten vorstoßen.
Dieses Unterfangen ist voller Schrecknisse, mit denen ich in den Stunden nach Mitternacht ringe. Ich komme mir vor wie der Seefahrer früherer Zeiten, der auf eine uralte Karte blickt, auf welcher der Kartograph gleich hinter den Säulen des Herkules fürchterliche, feuerspeiende Tiere eingezeichnet hat. Solche Monster sind mir vertraut. In meinen Träumen erscheint eine ganze Menagerie von ihnen: der riesenhafte, einäugige Phallus in der Höhle, die Taube mit der Stimme eines Menschen, die lebenden Leichname von Alyscamps, der schwarze Skarabäus und die Felsen, aus denen Blut herausspritzt. Irgendeines dieser herrlichen Wesen hält stets neben meinem Kopfkissen Wache.
Ich strecke im Dunkeln die Hand nach Emma aus, um sie näher an mich heranzuziehen. Mit einem Seufzer des Mißvergnügens wendet sie sich ab und legt die Hand auf ihre Scham. Diese Abwehrreaktion ärgert mich, habe ich mich ihr doch nie aufgedrängt. Ich verstehe, daß sie, im zweiten Monat schwanger, für körperliche Liebe nicht viel übrighat; aber sie ahnt nicht, wie einsam ich mich in diesem Ehebett fühle, wie schutzlos ausgeliefert. Wenn es nicht Toni gäbe, ich wäre längst impotent.
Natürlich ist mehr im Spiel als nur diese zeitlich bedingte Aversion gegen das Sexuelle. Emma ist schon immer eher autoerotisch eingestellt gewesen. In ihrem letzten Briefwechsel mit Freud hat sie dies sogar zugegeben. Sie sehnt sich also weniger nach mir als ich nach ihr. Meine Krankheit hat mich verändert, aber auch meine Rolle in der Familie. Ich bin für alle zu einer Last geworden. Ich arbeite nicht mehr in der Klinik. Ich habe meine Vorlesungen aufgegeben, weil ich mich nicht einmal auf den einfachsten Text konzentrieren kann. Die Liste meiner Privatpatienten ist bedauernswert klein geworden. Ich kann die Familie nicht mehr ernähren, und wir müssen von Emmas Erbschaft leben. Sie ist infolgedessen zur matrona victrix geworden, zur siegreichen Matrone, sicher eingebettet in ihrer Rolle als Mutter und unangreifbar in ihrer Selbstachtung, während mein Selbstgefühl durch Krankheit und finanzielle Abhängigkeit schwer angeschlagen ist. Sie ist also zu guter Letzt in der Lage, sich indirekt für meine tatsächlichen oder eingebildeten Seitensprünge zu rächen.
Ich erhebe nicht den Anspruch, ein Musterbeispiel für eheliche Treue zu sein. Ich gehe nicht mit jeder Beliebigen ins Bett, aber monogam veranlagt bin ich nicht. Meines Erachtens hielten es die alten Griechen richtig: eine Ehefrau für Haus und Kinder, die Hetäre oder den Lustknaben zur Gesellschaft und das Freudenhaus für ausgelassene Späße, wenn einem danach zumute war. Unsere verknöcherte kalvinistische Gesellschaft in der Schweiz legt Männern und Frauen unerträgliche Beschränkungen auf. Jede Ehe bedarf einer gewissen Freizügigkeit.
Natürlich ist Emma anderer Ansicht, und ich versuche nicht, diesen Punkt mit ihr zu diskutieren. Mir reichen die Szenen wegen Toni, und Emma zögert auch nicht, mir lautstark immer wieder Beispiele aus der Vergangenheit vorzuhalten – etwa diese Frau Spielrein, die unbedingt ein Kind von mir haben wollte.
Die analytische Psychologie steckt voller Versuchungen. Auch wenn man tugendhaft wie ein Einsiedler im härenen Gewand ist, kann man ihnen nicht immer widerstehen. Wenn eine Frau ihre Seele offenbart, ist sie viel gefährlicher, als wenn sie bloß Rock und Bluse ablegt. Diejenigen, die man abweist, verbreiten Skandalgeschichten. Gibt man ihnen nach, und sei es auch nur mit einem winzigen Eingeständnis der Zuneigung, werden sie zu unersättlichen Empusen.
Was du auch tust, du wirst verdammt. Und deine Frau gibt dir die Quittung, indem sie wie eine Botticelli-Jungfrau die Scham mit der Hand bedeckt. Zum Teufel damit! Es ist besser, aufzustehen und zu arbeiten, statt hier im Finstern zu liegen und mit juckenden Eiern alten Ängsten nachzugehen.
Im Arbeitszimmer ist es kalt und still wie in einem Grab. Wäre doch Toni hier, um etwas Wärme und Glut zu verbreiten. Ich bin versucht, sie anzurufen; aber so egoistisch bin ich nun auch wieder nicht, sie um zwei Uhr nachts aufzuwecken. Ich gieße mir ein großes Glas Cognac ein und stopfe meine Pfeife. Ich schlage auf dem Lesepult das schwarze Buch auf, in dem ich jeden Schritt meiner Wanderung verzeichne, die hoffentlich einmal zur Erleuchtung führt. Auf den Schreibtisch lege ich die Akte mit den Traumdeutungen, an denen ich mit Toni gearbeitet habe. Daneben lege ich einen Notizblock, eine Kladde, meine Bleistifte und meine Farbstifte. Ich zünde mir die Pfeife an und mache dankbar den ersten Zug. Langsam trinke ich einen großen Schluck Cognac. »So«, sage ich zu mir selbst, »so«, sage ich zu meinem dunklen Doppelgänger, »jetzt fangen wir an. Wir wollen einmal sehen, ob wir uns einander verständlich machen können.«
Ich nehme den schwarzen Bleistift, den weichen, in die Hand und versuche zu schreiben. Sofort gerate ich ins Stocken. Ich kann meine Phantasien einfach nicht schriftlich fixieren. Nur mit größter Anstrengung kann ich die einfachen, üblichen Fragen niederschreiben: »Wer bin ich? Wo wohne ich? Welchen Beruf habe ich?«
Nach wenigen Minuten gebe ich den sinnlosen Versuch auf. Ich trinke. Ich inhaliere den beruhigenden Rauch. Ich verfalle in Tagträume. Ich greife wieder zum Bleistift und beginne, meine Träume zu zeichnen. Dabei überkommt mich eine wunderbare Ruhe. Die Wände meines Arbeitszimmers fallen auseinander. Meine Kleider verschwinden. Ich stehe nackt vor einer gewaltigen Felswand aus ockerfarbigem Gestein und zeichne auf ihr mit einem Kohlestift.
Zuerst mache ich einen großen Kreis, selbstsicher und vollkommen wie Giottos »O«. In den Kreis zeichne ich ein Mädchen und einen Mann hinein. Sie ist jung und gerade zur Frau gereift, er ist alt und ehrwürdig, mit langem, weißem Haar und wallendem Bart. Er hat einen Stab in der Hand. Eine Aura heiterer Autorität umgibt ihn. Ich verstärke das Lächeln um seine Mundwinkel. Hinter mir sagt eine tiefe Stimme anerkennend: »Besser! Viel besser!«
Ich fahre herum, um zu sehen, wer da spricht. Vor mir stehen der alte Mann und das Mädchen. Ich bin wie gebannt. Mein Blick wandert zwischen der Zeichnung und der Wirklichkeit hin und her.
Das Mädchen lacht über meine Verlegenheit. Der alte Mann lächelt und sagt: »Es ist wirklich ganz einfach. Ich bin Elias. Dies hier ist Salome. Du erträumst uns und malst uns auf eine Wand. Aber wer bist du?«
Ich kann ihm nicht antworten. Ich blicke an mir herunter, nackt wie ich bin, und schäme mich. Ich schüttele den Kopf. »Ich weiß nicht, wer ich bin.«
Da sagt der alte Mann: »Das macht nichts. Wir wissen, wer du bist.«
Das Mädchen streckt mir die Hand entgegen. Ich ergreife sie zögernd. Sie zieht mich enger zu sich und dem alten Mann. Ich werde wieder ganz ruhig. Ich erinnere mich, daß ich Carl Gustav Jung heiße, und ich bin stolz, es ihnen sagen zu können. Wir setzen uns gemeinsam auf einen flachen Felsen, und ich frage höflich:
»Herr Elias, ist diese junge Dame Ihre Tochter?«
»Sag es ihm, Kind.« Den alten Mann amüsiert meine Frage, aber er beantwortet sie nicht direkt. »Sag ihm, wer du für mich bist.«
»Ich bin alles: Tochter, Gemahlin, Geliebte und Beschützerin.«
»Bist du zufrieden, Carl Gustav Jung?«
»Ich bin verblüfft, nicht zufrieden.«
»Dann hast du keinen Anspruch darauf, zufrieden zu sein. Dreh dich wieder zur Wand um, und mach die Zeichnung fertig!«
Ich wende mich um – und bin wieder in meinem Arbeitszimmer. Meine Pfeife qualmt im Aschenbecher. Der Cognac ist verschüttet, und ich wische ihn mit meinem Taschentuch auf. Aber in meiner Kladde ist tatsächlich eine Zeichnung. Der Kreis ist vollkommen wie Giottos »O«. Der alte Mann und das Mädchen sehen genauso aus, wie sie mir im Traum erschienen sind und wie ich sie auf die Felswand gezeichnet habe. Was bedeutet das? Wie soll ich mir dieses Phänomen erklären?
Dann fällt mir etwas ein. Ich krame eine Stunde lang in meinen Bücherregalen. Hastig mache ich mir Notizen. Das Schreiben fällt mir jetzt nicht mehr schwer. Um vier Uhr morgens habe ich drei kleine Geschichtsauszüge beisammen: Simon Magus, der Begründer der Gnosis, reiste mit einem Mädchen aus einem Freudenhaus umher. Laotse, der chinesische Weise, verliebte sich in eine Tänzerin. Der Apostel Paulus war, so heißt es, der Jungfrau Thekla zärtlich zugetan. Lauter alte Legenden! Aber was für eine kosmische Magie hat sie in mein Unbewußtes eingepflanzt? Elias und Salome sind mir jetzt so gegenwärtig, daß ich sie mit ausgestreckter Hand berühren könnte. Wenn sie nicht Wirklichkeit wären – eine ganz bestimmte Art von Wirklichkeit –, wie hätte ich sie erträumen können? Ist unsere ganze Geschichte also in unserem Unterbewußtsein begraben, vergessen, aber abrufbereit, und wartet sie nur darauf, wie Irrlichter aus der Tiefe des Sumpfes heraufbeschworen zu werden?
Ich kann mich der Frage jetzt nicht stellen. Ich klappe die Kladde zu und gehe hinaus in das nebelige Grau des dämmernden Morgens. Am Ufer werfe ich flache Kiesel in den See und rufe immer wieder: »Elias! ... Elias! ... Salome, meine Liebe!«
Einzige Antwort ist das Rauschen von Vogelschwingen, während ein Moorhuhn über das seichte Wasser streicht.
Magda
Paris
Heute vormittag erlebte ich ein trauriges und irgendwie albernes Spektakel. Ich ging auf den Champs-Élysées spazieren, dachte an meine Nacht bei Dorian und hielt Ausschau nach einem passenden Café, um mein Frühstück einzunehmen. Ein Obstverkäufer – einer von denen, welche die Restaurants in der Nachbarschaft beliefern – kreuzte meinen Weg. Er trug einen Korb mit Orangen auf dem Kopf.
Mit der Fußspitze stieß er gegen einen Pflasterstein, und er strauchelte. Der Korb rutschte ihm vom Kopf, die Orangen rollten auf den Boden und einige platzten. Andere wurden von Schulkindern aufgesammelt oder von Passanten mit dem Fuß in die Gosse gestoßen.
Einen Augenblick blieb der Obstverkäufer hilflos und wie angewurzelt stehen und starrte der Kaskade goldener Kugeln nach. Da ich der nächststehende Augenzeuge war, fuhr er mich dann wütend an und schrie auf italienisch: »Sie sind schuld! Ja, Sie!«
Er hob die Hand, machte das Zeichen des Gehörnten, warf mir dann den Korb vor die Füße und lief davon. Seine Wut war so kindisch und seine Anschuldigung so grundlos, daß ich in Lachen ausbrach. Als ich mich aber anschließend zum Kaffee hinsetzte, merkte ich, daß ich bebte. Der Zwischenfall erschien mir nicht mehr komisch, sondern magisch und unheimlich. Plötzlich war ich wieder inmitten meines Traums. Die Orangen waren Glaskugeln, und in jeder einzelnen war mein nacktes Ich eingesiegelt, aber alle diese Ichs konnten nicht miteinander sprechen.
Es war ein Augenblick tiefsten Erschreckens – wie damals, als mein bestes Jagdpferd mit mir durchging und ich es unter Hieben so lange galoppieren lassen mußte, bis es vor Erschöpfung stehenblieb. Da war derselbe furchterregende Stachel des Bösen, den ich gespürt hatte, als ich meinen Wolfshund Alexander tot vor meiner Tür fand, mit blutigem Schaum vor dem Maul – und drei Tage danach meine Rosenlaube, die von einem Vandalen mit der Axt zusammengeschlagen worden war.
Das Zeichen des Gehörnten, das primitive Symbol der Teufelsaustreibung, war nicht bloß vulgär gemeint. Sah ich aus wie eine Hexe? Hatte ich den bösen Blick? Trug ich das Kainsmal auf der Stirn? Ich kramte in meiner Handtasche nach einem Spiegel und schaute hinein. Der Spiegel sagte mir lediglich, daß ich blaß war und daß der Mann am Tisch hinter mir versuchte, sich darüber schlüssig zu werden, ob ich eine Vormittagshure sei oder eine leichtsinnige Dame, die einen Augenblick frische Luft schöpfen wollte.
Das half mir nicht weiter. Mir wurde nur klar, daß eine Witwe, die auf den Champs-Élysées Tränen über ihrem Kaffee vergießt und nachts Bettabenteuer mit Fremden in zweifelhaften Häusern absolviert, von der Zukunft nicht viel zu erwarten hat. Mir war, als habe sich unter meinen Füßen eine Falltür geöffnet und ich fiele kopfüber in die Finsternis.
Der Mann hinter mir stand auf und trat zu mir. Er fragte höflich: »Geht es Madame nicht gut? Kann ich vielleicht helfen?«
»Vielen Dank, aber ich fühle mich ausgezeichnet.«
»Sind Madame ganz sicher?«
Ich war ganz sicher. Ebenso gewiß war, daß ich Hilfe brauchte. Nur, wohin sollte ich gehen, an wen sollte ich mich wenden? Ich spreche sechs Sprachen einschließlich Ungarisch, aber keine ist angemessen, das Leben zu beschreiben, das ich geführt habe, seit ich ein kleines Mädchen war.
Über Sexuelles läßt sich leicht reden. Ganz gleich, wie bizarr der Geschmack des einzelnen auch sein mag, aufmerksame Zuhörer findet er immer. Aber alles übrige – meine Kindheit in dem verwunschenen Schloß, die primitiven, aber eigenartig schönen Riten bei meiner Einführung in das Erwachsensein, meine Jahre an der Universität und als Ärztin im Krankenhaus – dies alles sind Geschichten aus einem fernen Land, fast von einem anderen Planeten. Ich bin nicht sicher, ob ich sie irgend jemandem begreiflich machen kann.
Außerdem fällt auf sie alle ein Schatten, der Schatten des Galgens, und es ist unmöglich, so etwas bei Kaffee und Kuchen zu erklären. Sogar Papa, der fast sämtliche menschlichen Verirrungen mit einem Achselzucken abtun konnte, hat dieses Thema nie angeschnitten. Er wußte, was ich getan hatte und warum ich es getan hatte; aber alles, womit er andeutete, daß er Bescheid wußte, war die trockene Bemerkung: »Hoffentlich sprichst du nicht im Schlaf, liebe Tochter.«
Seit Papa tot ist und mein Mann, den ich sehr geliebt habe, mir allzu früh genommen wurde, habe ich in vielen fremden Betten mit einer ansehnlichen Reihe von Männern und Frauen geschlafen. Einige wären durchaus fähig gewesen, mich zu erpressen, aber kein Mensch hat auch nur angedeutet, daß ich im Schlaf Geheimnisse preisgebe.
So weit, so gut; aber meine Ausdauer läßt nach, wie Dorian warnend meinte. Ich kann nicht auf immer und ewig diesen krassen Wechsel zwischen wüsten Ausschweifungen und tiefster Niedergeschlagenheit ertragen. Ich brauche einen festen Liebhaber, einen Freund, eine Vertraute – vielleicht gar einen Beichtvater ...
Der Gedanke ist nicht schlecht. Doch ist er für eine Frau, die nie religiös war, die allerseltsamste Lösung. Papa war ein altmodischer Vernunftmensch, der mich gelehrt hat, daß das Leben hier beginnt und hier endet und wir das Beste daraus machen müssen. »Ich habe den Lebenden den Bauch aufgeschnitten«, pflegte er zu sagen, »und die Toten seziert; aber von Gott oder einer Seele habe ich keine Spur entdeckt.«
Ich liebte Papa so sehr, daß es mir nie eingefallen wäre, auch nur ein einziges Mal seine Meinung in Frage zu stellen. Das tue ich auch jetzt nicht, aber ich spiele mit dem Gedanken, daß es ganz angenehm sein könnte, Katholikin zu werden, um dann jeden Samstag in den Beichtstuhl zu schlüpfen, alle Sünden herunterzubeten und anschließend wieder rein wie ein frisches Taschentuch aufzutauchen.
Welch ein müßiger Gedanke und wie unlogisch! Wenn man nicht an Gott glaubt und auch nicht an die Sünde – warum sich Sorgen machen? Aber die Tatsache besteht, daß du dir eben doch Sorgen machst. Du erbleichst beim Zeichen des Gehörnten, und du siehst in purzelnden Orangen eine magische Bedeutung.
Ich habe ein Schuldgefühl – nein, ich fühle mich lächerlich, und ich schäme mich, weil ich mich wegwerfe, Stückchen für Stückchen, wie Konfetti bei einer Hochzeit. Sogar eine Hure hat mehr gesunden Menschenverstand: sie verkauft, was sie hat. Das Komische ist nur, daß ein Teil meines Selbst sehr wachsam ist. Bauernschläue nannte es Papa.
Ich verwalte mein Vermögen streng geschäftsmäßig. Meine Bücher werden mit peinlicher Sorgfalt geführt, und sie weisen immer einen Gewinn aus. Ich kaufe die besten Kleider – aber ich bekomme sie mit einem Nachlaß, weil ich sie in gehobenen Kreisen zur Geltung zu bringen verstehe. Wenn ich mit Vollblutpferden handle, feilsche ich um jeden roten Heller, und bei Auktionen rieche ich eine Absprache unter den Bietern schon auf hundert Meter.
In Gesellschaft gebe ich mich zurückhaltend und diskret. Die meisten meiner Freunde wären schockiert, wenn sie wüßten, wie ausschweifend ich bei meinen Vergnügungen bin und welche Worte ich dann im Munde führe. Es gab einmal eine Zeit, da schien dieses Doppelleben ein erregendes Spiel zu sein. Jetzt ist daraus ein gefahrvolles Unterfangen geworden: ein nächtlicher Gang durch übelriechende Gassen voll drohender Schatten ...
Ich zahlte mein Frühstück und machte mich auf den Weg zum Bankhaus Ysambard Frères, um mit einem Kreditbrief Geld abzuheben. Ich hoffte, daß mich Joachim Ysambard, der ältere der beiden Brüder, zum Mittagessen einladen würde. Joachim ist jetzt über sechzig, er ist weißhaarig, geistreich und ein Frauenkenner. Vor zehn Jahren verlebten wir einen Liebessommer in Amalfi. Dann kam er zurück, um seine jetzige, seine zweite Frau zu heiraten. Es war eine ausgesprochene Vernunftehe – die dynastische Allianz mit einer alten elsässischen Bankiersfamilie. Seltsamerweise blieben wir Freunde; wahrscheinlich deshalb, weil er mich – sogar im Bett – stark an Papa erinnerte.
Er war gerade in einer Besprechung, als ich ankam, aber seine Sekretärin brachte mir eine Notiz, in der er mich bat, mich etwas zu gedulden und dann mit ihm zu essen. Inzwischen würde sein Bruder Manfred kurz mit mir sprechen. Manfred ist Anfang Fünfzig, elegant wie eine Modepuppe, von tadellosen Manieren, aber seltsam blutleer. Er war nie verheiratet. Soweit ich weiß, unterhält er auch kein Verhältnis, weder mit einer Frau noch mit einem Mann. Er hat etwas Mönchisches an sich, was ich beunruhigend und manchmal abstoßend finde. Andererseits spricht Joachim von ihm mit Hochachtung und Bewunderung.
»Manfred ist ein Genie. Er versteht das Geschäft wie kaum ein anderer. Drück ihm in Tibet als Startkapital einen Haufen Teeziegel in die Hand, und schon bald handelt er mit Wolle in Bradford, Gold in Florenz, Roheisen an der Ruhr, und auf unseren Konten in Paris erscheint jedesmal ein hübscher Profit.«
In dieser Hinsicht muß ich Joachim recht geben. Dank Manfreds Umsicht habe ich in Frankreich ein zweites Vermögen erworben. Er aber tut meine Dankesbezeigungen mit einer lässigen Handbewegung ab: »Es ist keine Zauberei, Madame. Das sind einfach Handelsgeschäfte in etwas größerem Stil als auf dem Wochenmarkt. Es kommt nur darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu erfassen – womit wir bei Ihren Angelegenheiten wären. Joachim und ich geben Ihnen den Rat, mindestens die Hälfte Ihres Vermögens außerhalb Europas zu investieren.«
»Aus irgendeinem besonderen Grund?«
»Um das Risiko zu verteilen. Auf dem Balkan wird gekämpft. Innerhalb eines Jahres wird sich das übrige Europa im Kriegszustand befinden.«
»Wieso sind Sie denn so sicher?«
Er ließ sich zu einem schwachen, herablassenden Lächeln herbei. »Die alten Auguren betrachteten die Eingeweide von Vögeln. Wir sind viel fortschrittlicher. Wir beobachten die Bewegungen von Kohle und Erzen, von Chemikalien und Geld. Momentan hält zum Beispiel jedes Kavallerieregiment in Europa Ausschau nach jungen Militärpferden und geeigneten Stallungen. Das ist natürlich Irrsinn, die Starrköpfigkeit seniler Generäle. Nach einem Jahr moderner Kriegsführung wird das Pferd ebenso überholt sein wie das Breitschwert. Aber für den Verkauf Ihres Gestüts wäre jetzt ein ausgezeichneter Zeitpunkt.« Er hielt inne und fügte dann die spitze Bemerkung hinzu: »Ihr Ruf als Pferdezüchterin ist immer noch sehr gut. Ihr Besitz befindet sich in erstklassigem Zustand. Wir raten Ihnen, jetzt, auf dem Höhepunkt der Nachfrage, zu verkaufen und den Erlös bei Morgan in New York zu investieren. Dadurch würden Sie sich in der Neuen Welt eine sichere Basis schaffen, sollten Sie durch die Umstände gezwungen werden, Europa zu verlassen.«
Ich sagte ihm, ich könne mir keine Umstände vorstellen, die mich zwingen würden, Europa zu verlassen.
Er meinte vorwurfsvoll: »Meine liebe Frau, der Krieg ist eine höchst unangenehme Sache. Er weckt die niedrigsten Instinkte des Menschen und gibt ständig Gelegenheit, ihnen freien Lauf zu lassen. Sie sind – wie soll ich mich ausdrücken? – in der Gesellschaft wohlbekannt, aber nicht überall wohlgelitten. Sie könnten das Opfer von Klatsch, Intrigen und anderen Manipulationen werden.«
»Manipulationen? Ein merkwürdiger Ausdruck.«
»Er trifft trotzdem zu. Lassen Sie mich Ihnen etwas zeigen.«
Meine Akte lag auf seinem Schreibtisch. Er öffnete sie, zog einen Brief heraus und reichte ihn mir. Der Briefkopf lautete: SOCIÉTÉ VICKERS ET MAXIM. Das an Manfred Ysambard gerichtete Schreiben war mit einer kräftigen, weit ausladenden Handschrift abgefaßt.
Sehr geehrter Herr Kollege,ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß unser Vorstand einstimmig beschlossen hat, Ysambard Frères zum Bankhaus der Société Vickers et Maxim und der Société Française des Torpilles Whitehead zu ernennen. Wir sehen einer dauerhaften und einträglichen Geschäftsbeziehung mit Ihnen und Ihrem geschätzten Herrn Bruder entgegen.Vielleicht können wir diese mit einem Souper in meinem Hause einleiten, zu dem Sie liebenswürdigerweise auch jene ungewöhnliche und gutaussehende Klientin einladen wollen, über die wir uns in der vergangenen Woche unterhalten haben und der ich Sie bitte mich vorzustellen.
Bis bald,Z. Z.
Die Unterschrift war ein schwungvolles doppeltes »Z«. Ich fragte Manfred, wer denn der Schreiber sei. Er schien verlegen zu sein, da ich ihn zum erstenmal leicht erröten sah.
»Er heißt Basil Zaharoff und hat überall seine Hände im Spiel: Stahl, Waffen, Reederei, Presse, Banken ...«
»Und wie hat er von mir gehört?«
»Von uns nicht, das kann ich Ihnen versichern, Madame. Joachim wird es bestätigen. Zaharoff erwähnte Ihren Namen uns gegenüber. Wir waren überrascht, wieviel er über Sie wußte; aber das ist typisch für ihn. Er verkehrt in den einflußreichsten Kreisen, bei Kaisern, Königen und Präsidenten. Er unterhält das beste private Nachrichtennetz auf der Welt.«
»Und warum sollte er sich für mich interessieren?«
Ich hatte eine ausweichende Antwort erwartet, aber Manfred nahm kein Blatt vor den Mund. »Zaharoff bedient sich bei seinen Geschäften oft weiblicher Vermittlung. Für solche Hilfen und für Informationen zahlt er großzügig. Er kennt nicht nur Ihre Lebensgeschichte, sondern auch die Ihres Herrn Vaters. Nicht alle seine Andeutungen konnten wir einordnen ... Kurz gesagt, er hat Ysambard Frères einen großen Dienst erwiesen. Dafür bittet er jetzt um den bescheidenen Gefallen, Ihnen vorgestellt zu werden.«
»Und wenn ich es ablehne, ihn kennenzulernen?«
»Dann wird er andere Mittel und Wege finden, eine Begegnung mit Ihnen zu arrangieren. Er ist sehr zielstrebig.«
»Auch ich kann sehr zielstrebig sein.«
»Bitte!« In Manfreds Stimme klang ein Anflug von Verzweiflung mit. »Ich will Ihnen diesen Zaharoff genauer schildern. Er handelt in großem Stil mit Rüstungsgütern. Zum Beispiel vertritt er die britische Firma Vickers. Er möchte sehr gern auch bestimmenden Einfluß auf unseren französischen Konzern Schneider Creusot gewinnen. Was tut er also? Ganz im stillen beginnt er, Anteile an der Banque de l’Union Parisienne aufzukaufen, einem im Besitz von Schneider Creusot befindlichen Geldinstitut, das für diesen Konzern und andere französische Industriefirmen Kredite beschafft. Zaharoff sitzt bereits im Aufsichtsrat. Nichtsdestoweniger bringt er auch uns hohe Einlagen, so daß auch wir zu seinen Bundesgenossen geworden sind. Eines Tages wird er bei Schneider Creusot das Sagen haben – darauf können Sie sich verlassen. Wenn er Sie kennenlernen will, wird er dies tun; so oder so. Warum dann nicht gleich und auf elegante Art? Wir wollen nur zwei unserer geschätzten Kunden zusammenführen. Ist da so schrecklich viel dabei?«
»Was hält Joachim davon?«
»Fragen Sie ihn beim Mittagessen doch selbst.«
Die Antwort, die Joachim mir gab, war so klar wie Glockengeläut an einem Wintertag.
»Wenn auch nur die Hälfte von dem wahr ist, was man über dich redet«, sagte er, »brauchst du einen Beschützer. Wer eignet sich besser dafür als Zaharoff, der mächtigste Mann in Europa?«
»Warum brauche ich einen Beschützer, Joachim?«
»Du wirst älter.« Joachim schenkte mir ein dünnes Lächeln.
»Und wegen deiner zunehmenden Unbeherrschtheit in sexuellen Dingen.«
»Und wieso weißt du so gut Bescheid, mein lieber Joachim?«
»Etwas höre ich immer aus eigenen Quellen ...«
»Und einiges zweifellos von diesem Basil Zaharoff.«
»Stimmt.«
»Wie ist er im Bett, Joachim?«
»Woher soll ich das wissen?« Joachim schien die Frage wenig zu begeistern. »Ich vermute, daß er dich überhaupt nicht in seinem Bett haben will.«
»Wenn man dich so reden hört, könnte man meinen, er ist ein Zuhälter.«